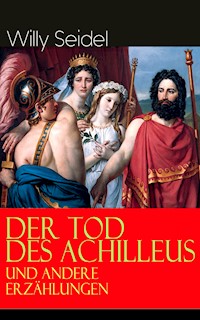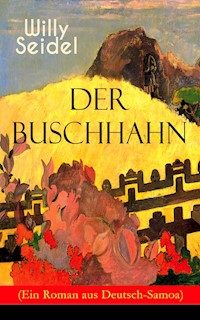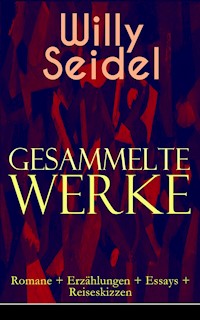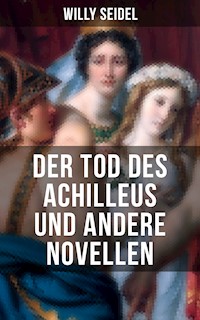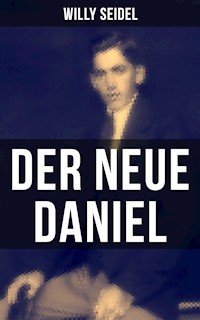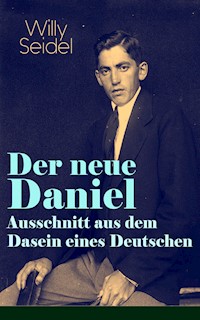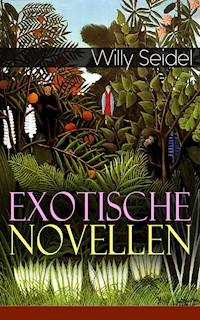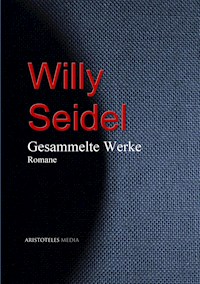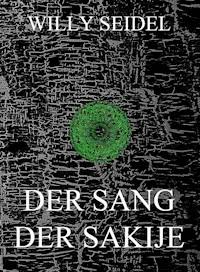Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Ein Klassiker der Horror-Literatur ist diese Geschichtensammlung, die erstmals in den 1920er Jahren erschien. Inhalt: Zeitgemäßes Zwiegespräch Der kleine Tabakladen Das dunkle Abenteuer des Herrn Perlafinger Die "Lebende Blume" Der Apfelsinentrick Die Rückkehr der Violante Die Krawatte Psyche und der Tod Vom orangefarbenen Herzogtum Das älteste Ding der Welt Masken des Frühlings Larven oder die Beichte eines Sonderlings Juan in der Sonne Herrn Zinkeisens eigene verwunderliche Geschichte
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 570
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die magische Laterne des Herrn Zinkeisen
Willy Seidel
Inhalt:
Willy Seidel – Biografie und Bibliografie
Die magische Laterne des Herrn Zinkeisen
Zeitgemäßes Zwiegespräch
Der kleine Tabakladen
Das dunkle Abenteuer des Herrn Perlafinger
Die »Lebende Blume«
Der Apfelsinentrick
Die Rückkehr der Violante
Die Krawatte
Psyche und der Tod
Vom orangefarbenen Herzogtum
Das älteste Ding der Welt
Masken des Frühlings
Larven oder die Beichte eines Sonderlings
Juan in der Sonne
Herrn Zinkeisens eigene verwunderliche Geschichte
Die magische Laterne des Herrn Zinkeisen, W. Seidel
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849636098
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Willy Seidel – Biografie und Bibliografie
Schriftsteller, geboren am 15. Januar 1887 in Braunschweig, gestorben am 29. Dezember 1934 in München. Bruder der Schriftstellerin Ina Seidel und Neffe des Ingenieurs und Schriftstellers Heinrich Seidel. Mit 10 Jahren zieht Willy Seidel, nach dem Tod des Vaters, mit seiner Familie nach München. Nach dem Abitur studiert er u.a. in München und Jena und promoviert 1911 als Doktor der Philosophie. Er beginnt viel zu reisen, bald auch im offiziellen Auftrag des Auswärtigen Amtes. Als der erste Weltkrieg ausbricht weilt er auf Samoa und setzt sich von dort in die USA ab. Die Jahre dort waren nicht einfach für Seidel und er konnte erst 1919 nach Deutschland zurückkehren. Seidel starb 1934 an einem Herzanfall.
Wichtige Werke:
*Der schöne Tag, 1908
*Absalom, 1911
*Die Natur als Darstellungsmittel in den Erzählungen Theodor Storms, 1911
*Der Garten des Schuchân, 1912
*Der Sang der Sakîje, 1914
*Yali und sein weißes Weib, 1914
*Der Buschhahn, 1921
*Der neue Daniel, 1921
*Das älteste Ding der Welt, 1923
*Die ewige Wiederkunft, 1925
*Der Gott im Treibhaus, 1925
*Der Käfig, 1925
*Alarm im Jenseits, 1927
*Schattenpuppen, 1927
*Der Uhrenspuk und andere Geschichten, 1928
*Larven, 1929
*Die magische Laterne des Herrn Zinkeisen, 1929
*Der Himmel der Farbigen, 1930
*Jossa und die Junggesellen, 1930
*Otto Nückel, 1930
Die magische Laterne des Herrn Zinkeisen
Zeitgemäßes Zwiegespräch
mit einem gewissen Dichter-Kompositeur; einstigem Königlich-Preußischen Kammergerichts-Rath zu Berlin
Der du die Bürgersitten überrennst: bist wieder da, Du schwärmendes Gespenst?
Thronst immer noch, wie Väterchen zu Rom, in Deinem Ohrenstuhl, Du toller Gnom?
Genügte nicht – (hier steh' ich schier verwundert) – zu Deinem Tod ein »skeptisches« Jahrhundert?
Und konnten Kritiker nicht längst erdolchen Dich flüchtigsten von allen Feuermolchen?
Antwort:
Verehrter! – Fragen Sie nicht gar so töricht. Ich bin unsterblich wie der Wind im Röhricht.
Ich bin das Pneuma; – bin die Phantasie. Und diese, Bester, mordete man nie.
Auch jene Altersweisheit schwerkalibrig – in Weimar – ließ das Beste von mir übrig.
In neuer Flamme – und die Zeit ist reif! – zuckt unversengt mein Salamander-Schweif.
». . . Denn herunter muß es, Herr Doktor, von der Seele, was der Mensch erlebt hat; und wenn er steinalt wird, es gibt Dinge . . . Dinge gibt es, und Zufälligkeiten, kaum zu beschreiben.«
(Ausspruch Herrn Zinkeisens.)
Der kleine Tabakladen
Vor einigen Wochen wurde ich mitten in der Stadt von einem Platzregen überrascht. Eine Trambahnhaltestelle war nicht in der Nähe, und so entschloß ich mich, in einen Tabakladen einzutreten, einen kleinen Einkauf zu machen und zu warten, bis das Ärgste vorüber sei.
Der Laden war von einer strahlenden Sauberkeit; die Ware bot sich symmetrisch und gefällig dar; und wiewohl das Geschäft nicht zu überlaufen schien, herrschte blankgeputzte Ruhe darin und denkbar beschaulicher Mangel jeglicher Überstürzung. Zu diesem Eindruck trug der Inhaber bei, der mir bei der Auswahl der Zigarren half. Sein Organ klang hanseatisch hell; seine Bemerkungen waren von freundlicher Sachlichkeit.
Unter Mittelgröße, fast plump gebaut, hatte er durch seine ruhige Bestimmtheit etwas irgendwie Autoritatives, ja, in bescheidenem Sinn Respekteinflößendes. Seine blauen Augen blickten besinnlich; sie erhielten dadurch, daß das obere Lid ganz unter der Brauenfalte verschwand, bescheidene Schärfe . . . Gekleidet war er in einen schlohweißen, gestärkten Leinenmantel, unter dem zuweilen der hellgraue Stoff des Anzugs hervorsah. – Und ausgerechnet bei diesem patenten kleinen Ladeninhaber, diesem Besitzer einer vernickelten Registriermaschine, mußte es mir passieren, daß meine Barschaft restlos ausgegangen war, als es ans Zahlen ging. Sehr peinlich war mir das, das muß man mir glauben. Ich hatte ihn in Bewegung gesetzt, hatte ihn bemüht in seinem weißen Leinenmantel, hanseatisch propre Geschäftigkeit veranlaßt, und nun sollte das alles mit einem Fiasko enden! – Ich sagte »Donnerwetter«, oder Ähnliches, und durchsuchte meine Taschen. Er merkte das, wickelte das Paket aber ruhig ein, machte ein Daumenschleifchen an die Schnur und sprach: »Denn können der Herr ja das nächste Mal bezahlen.«
»Scheußlich unangenehm . . . Ich lasse es hier . . .«
»Nichts dergleichen«, entschied er mit seiner hellen Stimme. »Sie nehmen es ruhig mit, mein Herr. Nur, zur Formalität, Ihren geschätzten Namen; den können Sie mir ja wohl mitteilen; denn schick' ich Ihnen gelegentlich mal eine Offerte . . .« Er sagte es sehr nett; als er meinen Namen aufschrieb, wurde er jedoch nachdenklich.
»Sind Sie vielleicht, mein Herr, identisch mit dem Schriftsteller dieses Namens?«
Leicht geschmeichelt, daß solches in diesen kleinen Tabakladen gedrungen sei, bestätigte ich's. – Und nun wurde er ganz anders; er verfiel in jene Mischung von Hoch- und Niederdeutsch, die man »messingsch« nennt; er zählte mir einige meiner Aufsätze auf, die er gelesen habe; bei Gott, er kannte sie wirklich; fremde Namen glitten ihm glatt von der Zunge; seine Beschlagenheit verwirrte mich. Mit leichtgeröteten Zügen rezitierte er ein oder das andere Satzgebilde, das ihm hängengeblieben sei; Schilderungsdetails, die er, mich mit seinen Dachaugen durchbohrend musternd, als »gut gesehen« pries . . .
»Mein Name«, fügte er scheu gewichtig schließlich ein, »ist Zinkeisen; Edmund Zinkeisen. Damit eine gegenseitige Vorstellung daraus wird. Sie werden sich, Herr Doktor, vielleicht wundern, daß ich mit einem Schimmer von Sachkenntnis über Ihre Artikel zu urteilen mir die Freiheit nehme. Ich kenne nämlich die Gegenden, die Sie so treffend schildern, gewissermaßen aus eigener Anschauung, wenn Sie erlauben. Und Sie werden begreifen, mit welcher Andacht ich mich hineinvertieft habe . . . ›Wenn du doch‹, so sagte ich oft zu mir, und auch zu meiner Frau sagte ich das, ›diesen Herrn Verfasser einmal persönlich sprechen könntest . . . dann könntest du Erinnerungen tauschen an die bedeutsamste Zeit deines Lebens; dann wäre dir leichter . . .‹ Denn herunter muß es, Herr Doktor, von der Seele, was der Mensch erlebt hat, und wenn er steinalt wird, es gibt Dinge . . . Dinge sag' ich, gibt es, und Zufälligkeiten, kaum zu beschreiben. Darf ich mir gestatten, Ihnen diese Havannazigarre anzubieten? Brennt sie? So . . . so . . .« Mit finsterem Interesse sah er zu, wie ich mich bediente.
»Sie waren also auch in Indien?«
»Nicht nur in Indien«, sprach er fast flüsternd. »Viel, viel weiter . . .« Es war, als raune er über einem Schatz, der eifersüchtig behütet aufblinkte. Auf einmal, schneidig wegwerfend: »Ich habe den Rahm abgeschöpft! Ich war sechs Jahre bis zum Krieg ununterbrochen unterwegs! Ich habe mein Erlebnisschäfchen im Trockenen! – Nun, Herr Doktor, habe ich eine Bitte an Sie: würden Sie mir heute die Ehre und das Vergnügen machen, zum Abendbrot mein Gast zu sein? Eine Flasche importierter Jamaikarum? Wie? Ein kleiner Grog in diesem kalten Mai? – Dann kann ich Ihnen etwas zeigen, was Sie in Erstaunen setzen wird. Das macht die Wertschätzung, verstehen Sie!«
###
Es war am Abend. – Auch in seinen Wohnräumen herrschte jene auffallende Sauberkeit. – Es war bieder-bürgerlich und nett. – Eine mollige, blonde Frau begrüßte mich. – Nach dem Essen blieb man noch eine Weile bei einer Tasse guten Mokkas plaudernd beisammen; – dann gab der Hausherr seiner Frau ein offenbar vorher verabredetes Zeichen.
Sie brachte einen Spiritusapparat mit bereits heißem Grogwasser; Herr Zinkeisen bereitete das Getränk mit zeremonieller Sachlichkeit und so nördlich, daß das ganze Zimmer duftete und zur Koje wurde, mit dem »Pochen großer Wasser drei Handbreit hinter der Wand . . .« –
Dann ging er noch nach vorn in den Laden und brachte folgendes mit: – zwei »Cheeroots« mit giftgrünen Leibbinden und eine runde Büchse »Capstan«Zigaretten. »Dies stammt noch von . . . damals«, sagte er sinnend. »Diese Zigarren – sehen Sie – diese perfekten Walzen! – rollen die indischen Mädchen auf ihrem sonnenwarmen Schenkel. Schwer und schwarz und stark . . . Man verträgt sie nur nach der Mahlzeit . . .«
»Bemühen Sie sich nicht!« sagte ich behaglich und brannte mir das Kraut an, wovon sich augenblicks ein schwerer, schier benebelnder Duft erhob.
»Was heißt bemühen!« winkte er ab und ließ sich auf dem lederüberzogenen Sofa nieder. Die Frau blieb noch ein paar Minuten da; dann zog sie sich wie mitwisserhaft lächelnd zurück. Die Geräusche der Stadt drangen ganz schwach durch den geschlossenen Laden zu uns herein. Er sah freundlich und ein wenig versonnen aus. – Dann sagte er, indem er im Grog rührte:
»Sehen Sie den Blechkasten dort, Herr Doktor?«
Ich erblickte auf einem Holzgestell eine ungefüge, schwarzlackierte Kiste, mit einer vorn hervorstehenden Blechröhre, und verhangen von einem buntseidenen Tuch. Von einem Wandkontakt aus lief ein Leitungsdraht in den hinteren Teil. Recht vorsintflutlich mutete das Ding an.
»EineLaterna magica?«
»– So ist es. – Eine biedere magische Laterne, wie sie bei unseren Vorvätern in Gebrauch war. Ein Requisit aus einer menschenwürdigeren Zeit. Ein Spielzeug, das ich auf dem Trödelmarkt fand und unverzüglich erwarb . . . Man läuft jetzt ins Kino, – gut; – es hat eben jeder die Unterhaltung, die er verdient. Ich meinerseits bin, mit Ihrer Erlaubnis, ein philosophischer Charakter und lasse mich nicht abspeisen anläßlich einer Massenfütterung. Nackte Tatsachen werden da geboten; nichts zum Träumen. – Und was ist die Würze des Lebens, mein Herr? – Die Träume.«
Ich staunte. Denn Herr Zinkeisen ließ in seinem Äußeren gar nicht vermuten, daß er ein so verpöntes Steckenpferd im Geheimen ritt. Aber dies Innenleben in einem Allerweltsschädel nebst proprem Scheitel, leicht glotzenden hellen Augen und einer behutsamen Kleinbürgerlichkeit war echt deutsch, sehr rührend und ein wenig lächerlich. –
Und er fügte noch etwas hinzu, das mich aufhorchen ließ; er sprach: »Mit diesem Kasten flüchte ich ins Land der Phantasie. – Dies Land, verstehn Sie, ist die einzige deutsche Kolonie, die wir behalten haben.« –
Hatte er nicht dreimal recht? Gibt es da eine Mandatswirtschaft? Bleiben wir da nicht die Herren? Haben wir den anderen diese Domäne (so ausgeplündert wir auch dastehen vor aller Welt) nicht erfolgreich unterschlagen, und können sie uns dorthin etwa eine »Kontrollkommission« nachschicken? Gibt es nicht dort Herzleid und Erhabenheit und tolleres Geschütz als jedes erfundene? –
Und er fuhr fort: »Wenn ich so sinniere bei meinen Bildchen, dann leist' ich Verzicht auf die ›Große Welt‹. – Tja . . . wenn ich so'n büschen geistig ausschweife, denn hab' ich sie alle in der Tasche, die Rechenkünstler und Fisematentenmacher und Wucherer vom grünen Tisch. Gut! sage ich, – folgen Sie mir, meine Herrschaften! Und sie sitzen trübe da und schneiden mit ihren Papierscheren blutende Wunden in unseren Volksbestand und schnippeln an unseren Grenzen herum . . . Folgen Sie mir! sage ich. – Aber sie können nicht, denn wir haben Raum. Wir haben die Phantasie. – Hmm. –«
Als ich das hörte, setzte ich keinen stählernen Helm aufs Haupt oder nannte es Pazifistenmoral und vertrackte Drückebergerei. Ich fand es im Gegenteil ganz vernünftig. Dieser Mann hatte sein Teil weg; er erholte sich auf seine Weise. – Ich war weder ein unbedingter Anhänger jenes alternden Geheimen Rats, der eine Literaturmauer um sich baute, als es in dem, was er Vaterland hätte nennen müssen, erbärmlich drunter und drüber ging; – noch auch schwenkte ich einen Hut bei jeder Gelegenheit, die einen Mann-zu-Roß antraben ließ, gleichviel aus welcher Richtung. So schenkte ich mir alle Bedenken hinsichtlich Herrn Zinkeisens und sagte mir: Sieh da; ein deutsches Individuum! Wie es uns im Einzelfall so stärkt und im Volksfall so schwächt! – Und woher kommt das? Weil von jeher der Mensch uns wichtiger ist als die Menschheit und weil, nach unserem voreiligen Dafürhalten, ein deutscher Kellner oder Zigarrenhändler intimere Beziehungen zur »Weltseele« unterhalten kann als der Herrscher von Zeitungen, der sein dumpfes Millionenpublikum mit Gebrauchsbildung versorgt.
Der (wirklich unvergleichliche) Grog ließ des Mannes Rede in meinen Ohren vielleicht lieblicher erklingen, als sie von Natur aus war; jedenfalls war jenes Bonmot vom »Land der Phantasie« fast zu gut für ihn, denn im Grunde zeigte er sich, wie auch seine eigene Geschichte dartun wird, als schlichte Seele. –
Ich ermunterte ihn nun, da ich neugierig war, mir seine magische Laterne vorzuführen. Hierauf entfernte er die Möbel von der weißgestrichenen Wand uns gegenüber, drehte das Deckenlicht ab und entwickelte im Dunkeln eine rege Geschäftigkeit. Glasplatten klapperten, und nun erschienen auf der Wand lebensgroße Figuren – von bunten Abziehbildchen erzeugt, die innerhalb des Kastens von einer offenbar sehr starken Birne bestrahlt wurden.
Langsam wechselten die Bilder. Es war als träten diese bunten Schemen in unsere Gemeinschaft ein; gesellten sich flüsternd uns zu . . . Herr Zinkeisen entfachte den Grog, den er nachfüllte, mit einem Streichholz, und im violetten Flackerlicht verstärkte sich der Eindruck des gespenstisch Lebendigen, schwellend Hervortretenden, plastisch Atmenden dort in der Wand . . .
Ein Herr mit rundem Backenbart floh vor einer hübschen Mulattin.
Ein David in silbernem Schuppenkleid fällte einen Goliath, der niederprasselte, irres Erstaunen im Blick. Die Pupille eines waschblauen Auges rollte innerhalb eines goldenen Dreiecks verschmitzt hin und her. –
Dann sah man einen Jongleur, der mit Apfelsinen spielte – plötzlich platzten sie in einer lohenden Katastrophe. –
Zwei Rokokodamen prügelten sich um eine Marionette; hinter ihnen dämmerte eine Eule auf, die an Schlaflosigkeit litt und den Tod in Gestalt eines Arztes heranwinkte. –
Eine nackte Jungfrau, wie ein Porzellanfigürchen, flatterte buntbeschwingt als Schmetterling durch arkadisches Blau, verfolgt von einem borstigen Ungeheuer, das einer monströsen Schmeißfliege glich. –
Daraufhin gab es ein seltsames Durcheinander von kaum entwirrbaren Dingen: ein Affe trat auf, ein Chinese, ein fratzenhafter Fels, zusammen mit einer flink kletternden kleinen Gestalt im Matrosenanzug, die Angst fühlte und gläsern zu schreien schien . . . Nun wurden die Bilder beklemmender. Ein aschblonder Backfisch in langem Hemd schritt schlafwandelnd durch eine Gallerie drolliger Puppen und versetzte ihnen träumerische Nasenstüber. Sie versank in einer Sintflut und reckte die dünnen Arme nach einem kleinen Spanier, der einen untergehenden Mast umklammerte, und Tausende von Köpfen, wie von Robben, tauchten ertrinkend auf und wurden dann weggeschwemmt . . .
*
– – – Ich weiß nicht mehr, wie lange dies interessante Panorama, dank eifriger Geschäftigkeit Herrn Zinkeisens, noch weiterrollte; jedenfalls erschrak ich heftig, als mit letztem Plattenwechsel plötzlich seine flache Stimme ertönte: »Tja, Herr Doktor, nun ist wohl das Material vorläufig aufgebraucht, nicht?« – und als er das flammende Deckenlicht wieder anknipste. –
Ich war wie benommen; ich mußte noch eine Weile die Augen schließen, bis all das Bunte, Quellende hinter meinen Lidern zur Ruhe kam. Doch diese törichten Abziehbildchen, die der treffliche Jamaika-Rum so lebendig gemacht, blieben mir gleichsam mahnend im Blut sitzen; ich wußte, ich müsse ihre Schicksale entwirren und schildern, um sie loszuwerden, die vertrackten Quälgeister.
Vielleicht war dies auch Herrn Zinkeisens Absicht, und er freute sich darauf, meinen Eindruck schwarz auf weiß als Lektüre zu bekommen.
Ob er freilich dies Buch jemals erhalten wird, ist die Frage, denn ich habe mich in der Folgezeit leider vergeblich bemüht, seinen Zigarrenladen wieder aufzufinden, und das Adreßbuch enthielt seinen Namen nicht. –
Es fällt mir furchtbar schwer, zu glauben, er sei sozusagen selbst nur eine Fiktion gewesen an einem regnerischen Mai-Nachmittag; er ist mir noch zu deutlich in Erinnerung, und ebenso ist es seine Geschichte am Schlusse dieses Buches.
Da er persönlich nicht sehr gut erzählte, so habe ich (da auch der ununterbrochene herzhafte Konsum des Grogs seinem Vortrag nicht förderlich war) ein kleines Epos oder, wenn man will, einen bescheidenen Roman aus ihm gemacht.
Und damit, hoffe ich, habe ich ihm meine seltsame Verpflichtung zufriedenstellend abgetragen.
Erstes Bild
Das dunkle Abenteuer des Herrn Perlafinger
In der Hofburg ist eine überkuppelte Einfahrt, die dem Verkehr offensteht. Dieser »Verkehr« schlängelt sich auf der anderen Seite des Residenzkomplexes unter dem Propyläum mit der ehernen Inhaber-InschriftFrancisci Josephi I. R.hindurch und hinaus.
Es ist eine Katastrophe, daß das respektlose Stinktier »Verkehr« soviel Spektakel in der Hofburg macht, ohne daß eins von den Erzherrschaften zwischen aufklirrenden Fensterflügeln hinab nach Ruhe wettern dürft'. – – Durchaus lebensmüd wird man, wenn man es so bedenkt; nie früher wär das erlaubt gewesen.
Dies waren die Gedanken, die Herrn Franz Josef Perlafinger bewegten. Er hauste neben der überkuppelten Einfahrt und versah Pförtner- und Kastellandienst. Beiläufig fünfundfünfzig, mußte er schau'n, wo er ein Kissen fand für seinen Lebensherbst im Dreigroschen-Elend der »Kaiserstadt«. Er saß am geschmälerten Futtertrog der zwei Adlerköpf' ohne Rumpf, die hungriger denn je pickten trotz mangelnden Verdauungsschlauchs. Aber das Münchhausensche halbe Roß hat ja auch wacker gesoffen, und so paßte denn Herr Perlafinger lediglich auf, daß dem ehrwürdigen Geflügel die Schattenkronen nicht herunterfielen. Er war ein treuer Hüter des monarchischen Begriffs . . .
Er hatte es sehr schön und ruhig gehabt als Kammerdiener und Vertrauensmann des letzten Grafen von Wiltczek. Ein sehr angenehmer Posten! Der Graf war ein hoher Funktionär: Reichsmundschenk, der bei den seltenen großoffiziellen Anlässen mit zittriger Hand etwas Sekt in den goldenen Empirehumpen spritzen ließ. Zwei ebenso wackelige Lakaien balancierten diesen auf einem Tablett und pflanzten ihn dann vor die K. und K. Majestät, die kaum daran nippte, geschweige denn daraus zechte. – Des Grafen Aufgabe war es nun, bei diesen Habsburger Schwanengesängen (die immer gedämpfter klangen, bis der Krieg der Monarchie den letzten Wind nahm) – zu spähen, ob der Kaiser nicht auf dem Trockenen sitze; daß er stets frisch nachgefüllt bekomme und seine Kehle gut geölt sei für etwaige Toaste. Für dieses Amt ergab sich aber nie ein Anlaß; wenigstens in den letzten zehn Jahren nie. Deshalb sank die Würde des Mundschenks inmitten des Gewimmels der Schranzen zur stilvollen Geste herab; ja kaum zur Andeutung einer solchen.
Mit der Monarchie – sogar noch vor deren letztem Aufflackern in der Person Karls – neigte sich auch das letzte Reis derer von Wiltczek verdorrt über den Rand des uralten Wappens.
Im Wermut- und Baldriandunst, unter muffigem Damasthimmel, devote Floskeln als welkes Adieu in die Hand eines Erzherzogs hauchend, verschied es. Mit allen Segnungen der Kirche schwer versehen, zog der feudale Greis mit den silbernen Favoris sich hinter die Barockfassade seines Familienmausoleums zurück.
Da die ausgesetzte Rente in der Inflation sofort schmolz und nicht einmal mehr eine »Trabuco« täglich garantierte, wäre für Herrn Perlafinger nichts übriggeblieben als das Altersheim. Der Himmel aber fügte es, daß ihm in Anbetracht dreißigjähriger Treue der erwähnte Fremdenführerposten zufiel; daß er genug zu essen hatte, sich drei Trabucos und eine Virginier täglich leisten konnte und sogar spazierengehen, wenn »Schluß der Vorstellung« war. – Diese Möglichkeit nützte er jedoch nur äußerst selten aus.
Wir müssen nämlich wissen, daß der Mann ein unzufriedenes Gemüt besaß und der Verbitterung den Eingang in sein Herz gestattete. Wenn er nach Beendigung der Rundführung das Eingangsportal zu den vierundzwanzig »öffentlichen Gemächern« der Hofburg schlüsselrasselnd geschlossen, wartete er zuweilen (anstatt sich in seinen Verschlag zurückzuziehen, seinen Kaffee zu brauen und zu nachtmahlen) noch unter der Kuppel.
Diese Kuppel mit den verblaßten Fresken dröhnte vom Lärm bellender Hupen und von der eiligen Drangsal hastender Füße. In dies Gewusel hinein lächelte von oben ein kalkiger Himmel, derselbe, der einst frisch und farbig geleuchtet hatte, da er noch über sanften Sänften und Galawagen prunkte. Nun aber war er verwittert nicht bloß durch die Zeit, sondern aus Trauer und Abscheu. Lange Risse wanderten quer über Puttenleiber, Nymphenbrüste und tabakfarbene Gliedmaßen feiernder Heroen. – »Es dauert nimmer lang,« dachte Herr Perlafinger, »dann kommt der ganze Verputz herunter samt der schönen Schilderei . . .« Gram umflorte sein Auge, wie er so dastand und mit dem Blick eines Bernhardiners die todgeweihten Nacktheiten bespähte. Er hatte nämlich Sinn für Kunst, besonders wenn sie ihm gewisse angenehm-plastische Vorstellungen erweckte.
###
War es noch zu früh für das Abendmahl, so harrte er aus, bis die Verkehrskuppel zufällig einmal leer war; dann sperrte er das Portal geschwind wieder auf und war nun ganz allein in der Hofburg. Er brauchte sich keinen Zwang anzutun, durfte sich soweit gehen lassen, als die tolerant gelaunte Tradition in diesen Gemächern es ihm gestattete. Hier war man sozusagen »unter sich«. Gemästet von dynastischem Prunk, hervorgesogen aus der Seide der Saalwände, geschöpft aus der Tiefe unendlich aufgeworfener weißgoldener Flügeltüren, schwoll Herrn Perlafingers innerer Protest gegen das scheußliche Draußen; gegen das heutige Wien.
Hier innen war er gefeit und geborgen unter den stilvollen Gespenstern des Gestern. Denn nicht sehr alt war dies Gestern trotz der hundertfünfzigjährigen Möbel, der dreihundertjährigen Gobelins; es huschte hervor und begleitete seine einsam knarrenden Schritte auf dem Parkett. Denn er ging jetzt nicht auf dem Läufer, über den er die Fremdenhorden hinübergetrieben. Er ging auf der dämmrigen Parkettiefe als Mitbestandteil der Dinge, die sie spiegelte und in zerfließenden Farbtupfern in ihre Märchentiefe lockte. Ebenso wie der Traum jedweden Gegenstandes darin geisterte (das Weiß zierlichster Öfen, das Türkisblau mannshoher Vasen, das vergoldete Kupfer-Rokoko, das Goldfunken heruntertropfte, das Facettengewirr der Lüster, wie blühend im braunen Sumpf) – ebenso spiegelte sich auch der Bauch Herrn Perlafingers, verkehrt zwar, doch trotzdem ebenbürtig hindurchgetragen.
Ja, dieser Vorkriegsbauch – es gab ihn noch, wenn zwar nicht so straff und proper mehr. Er hatte Falten, wie alles andere an seinem Besitzer. Er war ein halbwelker Ballon, gerade noch in Schwebe gehalten durch moralische Fingerstüber, aber ohne pfeilgeraden Trieb mehr, in die heroische Welt der wienerischen Halbgötter hinaufzuschießen. Er war in seiner Bekleckerung durch verirrten Schnupftabak und Gulaschspritzer, beschwert von stählerner Uhrkette, keine Staatsangelegenheit mehr.
Aber sah man ihn so im Parkett, spähte man steil über seine Wölbung nach unten, so sah man lediglich die Rundung und all das Unzulängliche war barmherzig verwischt.
###
Es ist nach sechs Uhr im März: durch die französischen Fenster blinkt ein grellweißer Himmel. Alles ist stumm, entrückt; voll von der Weihe eines nach letzten, höchsten Machtexzessen zusammengesunkenen Regimes.
Strenge Fürstinnen, kokette Thronfolger, Schlachtenlenker der Boudoirs, süße Puppengesichter unter beschleiften Chignons, grünsamtene Knaben mit der schmollenden Erblippe, zierliche Hifthörnchen schwingend wie Honigkringel . . . Dann wieder stilvoll aufgebaute Feldherrenhügel, Gepurzel verfilzter Reitergruppen in brauende Kessel von Kriegspanoramen: dies ist für Herrn Perlafinger der Hintergrund.
Über einem Porphyrkamin steigt ein Spiegel an; etwas getrübt ruht der in einer Umrandung gelbsilberner Voluten. Herr Perlafinger nähert sich ihm und starrt sich an. Die Ähnlichkeit mit dem erhabenen Spender seines Taufnamens ist verblüffend. Verwittert ist dieser Kopf: gelbliche Hautfarbe, kranzartiges Fältchenspiel an langlidrigen, leicht schiefgestellten Augen, ein gelbes, gesundes Zahngeheck und dann der Backenbart, ein peinlich ausrasiertes Kinn zwischen den Flügeln hegend wie ein rosa Ei!
Der Backenbart! Diese wunderbaren runden, graumelierten Polster rechts und links!
Perlafinger wendet sich ab, erschüttert von der mühsam zur Vollendung gezüchteten Ähnlichkeit! Hört er nicht Anspielungen darauf Tag für Tag? Es ist schon was dran! Tolles Gefühl, dem alten Franzel Höchstselig so grad ins Gesicht hineinzublinzeln, und auch Er muß dann blinzeln, und man kann mit Ihm machen, was man möcht'! – – Breit läßt er sich in einen Prunksessel nieder, und der Kaiser verschwindet aus dem Spiegel.
Perlafinger grinst traumverloren und raucht. Lichtblau zieht sich wie welliger Schleier der Qualm durch die Hofburg-Atmosphäre. Zuweilen knackt ein Sofa, ein Prunkbett, ein Stuhl. Erinnerungslächeln umspielt seinen Mund; durch strählende Finger gleitet der Backenbart. Er geht zuweilen zur chinesischen Vase an der Tür und stäubt seine Asche hinein. Es ist dämmrig geworden; noch einmal marschiert er sinnend durch die vierundzwanzig Türen, und überall in den Spiegeln begleitet ihn ein ehrwürdiger Greis: der rechtmäßige Inhaber einst dieser und vieler anderer Räume; leicht gebückt.
Nur etwas zu feist. Und unwahrscheinlich bürgerlich.
Und Herr Perlafinger denkt an ein Geschehnis, das reichlich lang her ist. Er denkt an Ilonka . . .
Er hatte diese Ilonka, die gräfliche Mätresse, im Auftrag seines Herrn ins Bockshorn gejagt. Er hatte ihr dargestellt, daß im Kabinett bereits erwogen werde, ob man sie entfernen solle, »deportieren«, wenn ihr der Ausdruck sympathischer sei . . . Und zwar aus Wien, irgendwohin an die Grenze. Sie solle gescheit sein und in Gottes Namen die Abfindung nehmen, die man ihr anbiete, und die Hofburg nicht weiter beunruhigen. Die Majestät habe ohnedies soviel Schererei in der eigenen hohen Familie von wegen Dispensen, die man Ihm von Gemüts wegen erpresse, von nervenfolternden Kompromissen im Interesse weitaus wichtigerer Damen, als Fräulein Perchtenleitner jemals darzustellen hoffen dürfe. So sei Er äußerst heikel auf den Punkt der Seitensprünge zu sprechen, und wo Er merke, daß man Ihn, das heißt Seine Herren Söhne, kopieren wolle, da werde Er nicht mehr lange fackeln. Er habe in der letzten Zeit ohnehin die Moral stark unterstrichen und daß Er's sauber haben wollt' um Seine heilig römische Person herum. Sie solle nur so weiter machen mit Eingaben gegen den Herrn Reichsmundschenken; dann werde das Erzhaus ihr schon die Macht zeigen. Gott sei Dank sei ihr Tratsch noch im Keim zu ersticken, wenn sie vernünftig sei; und für das Buberl werd' der Herr Reichsmundschenk schon einen Vater besorgen.
Der Vater fand sich denn auch im k. und k. Infanterieregiment (Deutsch und Hochmeister Nr. 4), ein charmanter Feldwebel. Der Krieg raffte ihn aber leider am Isonzo hinweg. Zunächst natürlich war dann davon die Rede gewesen, daß etwa Herr Perlafinger selber . . . (bitt' Sie, unmöglich! . . .) einen Laden aufmachen sollt', eine Trafik, wo er's doch so gut hatte; wo er so verantwortungslos und sorgenfrei in der Wolle saß . . . Seinen prächtigen Frack sollt' er ausziehen? Seine Eskarpins? In den Küchendunst eines kleinbürgerlichen Betriebs hinuntersteigen? – Übrigens war die Ilonka, blauäugig und drall, durchaus eine Lockspeise für ein Mannsbild. Und auch Intelligenz durchblicken ließ das Weib, sobald sie sichergestellt war.
Kurz, die Episode hatte er ins reine gebracht ohne Zeitaufwand und insofern Dankbarkeit geerntet, als der Graf ihn, solang der Krieg brenzlich war, als »unabkömmlichen Sekretär« in der Etappe benötigte oder als Küchenchef im Stabstrain, wo man den Krieg nur ganz von fern pumpern hörte . . . So gab es von beiden Seiten Vertrauensbeweise. Oder geschah dies alles nur, weil man einen Doppelgänger des Allerhöchsten Kriegsherrn nicht der Schlachtbank opfern wollte?
###
Als Herr Perlafinger an einem dieser Tage in seinem Verschlag ins Bett ging, konnte er durchaus nicht schlafen, denn die Ilonka meldete sich immer dringlicher in seinem Gedächtnis. Weiße glatte Haut hatte sie gehabt, weißbestrumpfte Waden und allerhand doppelte Rundungen, wo sie hingehörten. In reicher Fülle und doch sozusagen knapp. Recht jung und bockig, wie sie halt sind mit neunzehn; aufgehetzt auch noch von einer gewissenlosen sozialdemokratischen Verwandtschaft, die natürlich eine dauernde Anzapferei vorhatte an Seiner Erlaucht.
Herrgott! Wenn er, Perlafinger, doch zugegriffen hätte? Der Graf hätt' ihn zwar »außerg'worfen«; aber das mit dem kleinbürgerlichen Milieu hätt' er schon passend modeln können nach eigenem Geschmack. Und der Graf hätt' ihn sicher ausreichend finanziert, so daß er von einem Roßhaarpfühl übergesiedelt wär' auf ein lebendig-elastisches. Verlust an Bequemlichkeit wär' das kaum gewesen. Eigentlich fast ein Profit! Es hätt' ihn ja schließlich nichts gehindert, trotzdem ein feiner Herr zu bleiben und die Ilonka heimisch zu machen auf seinem Niveau . . .
Er seufzte. Sollte er am Ende damals nicht doch eine Riesendummheit gemacht haben in seinem byzantinischen Dusel und engen Horizont? Es blendet den Blick, wenn man immer nur Hofschranzen sieht und Uniformen. Es verstopft das Ohr gegen Naturlaute, wenn man immer auf Getuschel lauschen muß wegen der Konkurrenz der anderen Leisetreter. Den schönsten Teil seines Lebens hatte er dafür weggeschmissen, und nun war er fünfundfünfzig.
Er träumte von den Nymphen an den Freskodecken. Mitten unter ihnen saß die Ilonka in verschobener Fernrohrperspektive; sie hatte ein fernes mythologisches Getu', und auf ihrem drallen Schenkel ritt ein Putto. Der vom gefallenen Feldwebel adoptierte Putto. Der bohrte dem einsamen Träumer einen rundlichen Finger voll Schadenfreude mitten ins Herz . . .
Er schrak auf. Beklommen und unzufrieden. Zunächst war der schwellende Protest wieder da gegen Wien. Es war nicht mehr sein Wien; das war radikal weggefegt. Nichts war übrig davon als eine absurde Anhäufung von Großstadtelend ohne Hinterland, als ein Kopf ohne Rumpf. – Ilonka und ihresgleichen hatten jetzt darin das große Wort. Und trotzdem erschien sie ihm (als Teilhaberin seiner Tradition und ins gräfliche Wohlwollen so eng einst hineinbezogen) auf einmal besonders begehrenswert, wie alles Versäumte.
Wie alt sie wohl war? – Beiläufig vierzig. Und ob sie wohl einigermaßen konserviert war? – Was eine waschechte Wienerin ist, hält auf sich.
Du wirst einmal schauen müssen, dachte er auf seinem einsamen Lager, wo sie steckt, was sie so treibt; unverbindlich herantrudeln wirst du müssen . . . Dann kannst du sie herausholen und sie umgestalten, bis sie reif ist fürs bessere Leben! – Wie bitte? Wieso besseres Leben? Was bietet man ihr denn? Einen Fremdenhirt mit Bauch und Backenbart, der Sprüchlein schnurrt! Der in die Ohren der Besucher hinein folgendes predigt: »Der Kaiser Koarl ergriff das Steuerruder des Staatsschiffes noch einmal mit hoffnungsvoller Hand; doch ein tragisches Schicksal wollte, daß es kenterte . . .!« –
Nach solchen resultatlosen Erwägungen beschloß Herr Perlafinger, in den nächsten Tagen einmal auf die Suche zu gehen. Er war immerhin erst fünfundfünfzig Jahre.
###
Er machte sich bereits am folgenden Tag auf, an dem keine Besichtigung der Hofburg stattfand. Er gürtete seine Lenden, indem er sich in seine korrekteste, nach Mottenkugeln duftende Vorkriegsgala steckte, und begab sich auf die Suche nach der plötzlich wieder so lebendigen Ilonka.
Naturgemäß lenkte er seine Schritte, begleitet vom Dröhnen des aus der gräflichen Erbmasse stammenden Stockes, zunächst nach der Polizei, um festzustellen, wo eine gewisse Witwe mit fünf unaussprechlichen Konsonanten im Namen hauste. Der Name wurde nachgewälzt, doch nicht entdeckt. – »Der Herr möcht' ein wenig Geduld haben und gelegentlich wiederkommen. Bei der wechselnden Rechtschreibung der tschechischen Namen (noch dazu ohne Vokal, an den man sich klammern könnt') sei es eine niederträchtige Arbeit, den verewigten Feldwebel auszugraben. Nichts für ungut.«
Worauf ihm nichts übrigblieb, als zunächst einmal einen Spaziergang zu machen. Er hatte allerhand Trinkgelder gespart, die seine Brieftasche schwellten. – – – Apart war das junge Grün, wie es so zum Vorschein kam. Ein paar Büsche blühten bereits gelb. Der Frühlingssermon der alten Weiber, die ihre Veilchensträußlein schwenkten, lautete wie seit je: »Weil Sie's sind, Herr Baron, ein Schilling . . .«
Und überall saßen auf Parkbänken verlorene Existenzen.
Sehr ärgerten ihn die ordinären Taxidroschken; sie kläfften ihn an wie erboste Köter, und oft mußte er sich, schier mit Verlust an Haltung, auf den Gehsteig zurückretten. Scheußlich zugenommen hatte der Verkehr während seiner »Klausur«.
Andächtig beäugte er die Prachtbauten. Da hatte man wenigstens etwas Handfestes von früher, den ganzen monumentalen, unzerstörbaren Ausdruck des monarchistischen Prinzips. All die Herrschaften auf ihren muskelschwellenden Marmorrössern, all das Barock, das in tobendem Herrschdrang ins Blau brandete, war Balsam für seine Seele. Und doch webte in der mildstreichelnden Frühlingssonne ein Hauch von Melancholie darüber. Kein Wunder: dies alles war nicht mehr berechtigt. Glanzvolle Kulissen waren das; auf ihnen ließ ein verschuldeter Magistrat den alten Scheinwerfer spielen. Ein Museum voll toter Pracht, in dessen weitläufigen Räumen und Gängen eine darbende Menge wuselte; ein Ameisenhaufen, in den ein eiserner Besen gefahren war und ihn in tausend triste Asphaltrinnen hineingekehrt hatte. Der Vergleich fiel ihm ein mit einer Perlmuttermuschel, einem großen Meerschneckenhaus, das zwar noch ganz wunderbar schimmert, doch der eigentliche Bewohner ist fort, so daß im Gehäuse nichts mehr weilt als ein bißchen Duft und viel sausende Erinnerung. Hielt man das Ohr dran, so starb wie ein kleines Fragezeichen ein anmutiger Walzertakt.
Aber was an Herrn Perlafinger lag, so mußte einmal wieder die Zeit kommen, da ein gekrönter Nachkomme prächtig Einzug halten würde in die leere Muschel! Alsdann gibt's einen Tusch darin; der schmettert lauter als jener tränenreiche Dreivierteltakt! Ja, wenn einmal der Otto, der nette Bub' (dessen schwarzgelb umschleifte Bildchen in kleidsamem Matrosenanzug sein Ofensims zierten) herabsteigen würde aus der Ferne seines Exils, im Morgenrot besserer Zeiten, und eine Armee von Fensterputzerinnen in Bewegung setzen . . . Der würde auch die alte Dame Wien in ihrer vereinsamten Loge, die sie im Welttheater innehatte, galant wieder aufwerten, so daß sie's dann nicht mehr nötig hatte, ins internationale Parkett hinunter zu lorgnettieren, um so nervös das Mienenspiel der Kavaliere »Anschluß« und »Anleihe« zu studieren. Dann würde sie wieder jung auf ihre alten Tag', wenn der Otto käm' und sie herauszög' aus dem Schlamassel. – – –
Perlafinger stampfte mit dem Stock auf, und da ihm im Augenblick nichts Besseres einfiel, ging er die Kärntnergasse hinunter und landete im »Griechenbeisl«.
Hier stellte er fest, daß wenigstens das Pilsener den Sturz der Monarchie unbeschadet überdauert hatte. Auch die alten Kellner dort heimelten ihn an.
Dies stellte er solange fest, bis er einen kleinen Schwips hatte. Ein solcher Zustand veredelt, und mit jedem Glas wird die Welt verständlicher. Zunächst mußte eine unabweislich aufsteigende Rührung überwältigt werden, in der sich die Trauer über den Umsturz mit seinen persönlichen Versäumnissen verquickte. So gab Herr Perlafinger, respektvoll von konservativen Gästen und verträumten Kellnern betrachtet, zunächst ein Bild ab mit der Unterschrift: »Mir bleibt nichts erspart.«
Nachdem er der Vergangenheit einen Monolog gewidmet, wurde er menschlicher und zeitgemäßer. »Seine Stimmung«, ließ er wissen, »sei gehoben. Er wolle nicht immer bloß Fremdenführer spielen. Er wolle selbst einmal den ›Fremden‹ spielen. Er ersehne einen Ort, wo sich allabendliche Gemütlichkeit an Schrammelmusik stärke; er fühle heute etwas Unternehmungsgeist.«
Die konservativen Gäste und verträumten Kellner hierauf berieten sich untereinander. Dann sagten sie, was die »Schrammelmusik« anlange, so gäben sie ihm einen großartigen Tip. Das rechtsstehende Element in Wien habe ein Geheimlokal, wo es sich treffe. Er würde da die Elite finden von früher, die Creme der alten Gesellschaft; warm ums Herz würd's ihm werden; so ganz im eigenen Fahrwasser würd' er schwimmen . . . Eingeklammerte Grafen streiften dort ihre Klammern ab und gäben sie in der Garderobe ab. »Tabarin« heiße das Geheimlokal. Er solle mit Scheuklappen hineingehen und sich vorher niemandem anvertrauen; kenne man sich doch jetzt nicht mehr aus, wer ein Sozialdemokrat oder gar Kommunist sei und wer noch ein anständiger Mensch.
Das begreife er gut. Ganz ihrer Ansicht sei er. Hätt' man übrigens schon jemals so was Dummes gehört als »eingeklammerte« Grafen? Sein seliger Graf würde sagen: »Karl der Große hat mich geadelt; und Karl Renner will mich entadeln? . . . Soll er's probieren . . .«
Die Gäste wurden immer munterer, geradezu ausgelassen. »Also, Herr Hofrat – (sie tauften ihn Hofrat!) – dort werden Sie was erleben, dort im Tabarin. Sie werden sich zurückversetzt fühlen in die schöne alte Zeit, direkt ins Dreimäderlhaus! Eine reizende Schrammelmusik werden Sie finden! Einen Geiger, der seinen Kasten menschlich behandelt, und einen Pianisten, der streichelt die Tasten . . . Aber die Hauptsach', Herr Hofrat, warum Sie dort hingehen müssen, ist die Baker Peperl. – Unsere Baker Peperl.«
»So, so«, sagte er und zwinkerte verständnisinnig. Dabei kämmte er leicht erregt seine Bartpolster. »Fesches Madel, was? – Eine Hiesige?«
Die Gäste besprachen sich wieder untereinander. Sie machten schnaubenden Gebrauch von ihren Taschentüchern. Dann wandten sie sich wieder Herrn Perlafinger zu und sprachen: »Sie ist nicht gerade von Wien gebürtig. Mehr südlich. Stark brünett. Aber ein fesches Madel, ganz wie Sie sagen, Herr Hofrat. Eine Tänzerin. Wie der liebe Gott die g'schaffen hat, war der Heurige gut. Wir sagen Ihnen, die tanzt einen Drahrer, daß Ihnen ganz anders wird. Die engagiert Sie, passen S' auf; da kriegen S' eine Hitzen, und mit den Augen schmeißt s' wie mit Knallerbsen. Wissen S' . . . (in Ermangelung weiterer Vergleiche seufzte man) . . . also zum Anbeißen. Und unterhaltsam. Keine Ziererei; keine Ziererei . . . Ja, ja, die Baker Peperl.«
Herrn Perlafinger lief das Wasser im Mund zusammen. »Gut. – Ich gehe!« rief er schallend und schwenkte sein Glas. Alle tranken ihm zu.
»Servus, Herr von Perlafinger! Und grüßen S' die Baker Peperl von uns, vom Stammtisch im Griechenbeisl!«
– – Als er die Treppe ins Freie gewann, aus der verließartig angelegten Lokalität heraus, hörte er noch, wie sie drinnen sangen und durcheinander riefen: »Nußbraune Maid« – »goldig's Mensch« – »hat Wien im Sturm erobert« . . .
###
Der Portier in der lichterflammenden Einfahrt zum »Tabarin« tritt beiseite, um einen Herrn hineinzulassen, der mit der Geste eines alten Kenners der Garderobe zustrebt. Er sieht dem Kaiser Franz Joseph zum Verwechseln ähnlich; nur der Bauch stört im Bild. Und die leicht untersetzte Figur. Der Portier schmunzelt und seufzt ein wenig.
»Ich bin der Hofrat von Perlafinger«, sagt der Herr mit einer gewissen Strenge im Ton zur Garderobenfrau. »Falls ich gewünscht werd', so haben Sie in das Lokal hineinzurufen: ›Herr Hofrat!‹ Haben Sie verstanden?«
»Jawohl, Herr Hofrat«, sagt das schlichte Weib und glotzt aus übermüdeten Augen. »Wie Sie befehlen.« Sie starrt mit der gleichen Verblüffung auf einen Fünfschillingschein, der ihre Handfläche ziert. »Küss' d' Hand, Herr Hofrat.«
»Sagen Sie . . .« fährt der Hofrat fort und zupft an sich – »hat man mich richtig orientiert, daß hier ein Fräulein – Baker? Wie? – mit dem volkstümlichen Namen ›Peperl‹ (soll wohl augenscheinlich das Mundartliche sein für ›Josephine‹) . . . daß also ein derartiges Fräulein hier auftritt?«
Das übermüdete Garderobeweib nimmt sich zusammen. »Jawohl!« sagt sie schier militärisch. »Herr Hofrat sind richtig. Bemühen sich bitte durch jene Tür . . .« Und da des Herrn Hofrats Blicke in falsche Richtungen irren, setzt sie hinzu: »Aber nein, gnä' Herr, net in d' Toiletten; – außer Sie möcht'n d' Händ' waschen . . .? – No alsdann gradeaus bittä . . . Obacht, Stüfchen!!«
– – – Als der Herr »Hofrat« in den großen Saal trat, dessen Logen im Kreis eine sehr geräumige Tanzdiele umrahmten, war sofort ein kleiner Mensch zugegen mit einem schwarzen Bürstchen auf der Oberlippe, bläulichen Schatten auf den kalkigen Wangen und schwarzen, unruhigen Augen. Er war im Cutaway und ging mit zurückgeschobenen Schultern und einladendem Schwenken seiner vornehmen Hand – (eines ruchlosen Patschhändchens mit einem Gemmenring daran) – Herrn Perlafinger voran, ihn sozusagen vergewaltigend. Er wollte ihn an ein Einzeltischchen setzen und gedachte dies durch Überrumpelung zu erreichen. Aber der Hofrat ärgerte sich über die Selbstverständlichkeit des inferioren, »geradezu jüdisch aussehenden« Subjekts und ließ es allein voraneilen, während er in eine geräumige noch leere Loge abschwenkte. Und da ließ er sich nieder wie Kaiser Franz Josef im Theater, trommelte auf den Tisch und blickte sich huldvoll um.
Der Saalaufseher versuchte darum vergebens, das erlauchte Phantom, das er noch hinter sich wähnte, zu plazieren. – Eine Rotte feister Kellner erschien mit Servietten tändelnd an der Loge. Herr Perlafinger hatte gerade mit herabgezogenen Mundwinkeln geäußert: »Woll'n S' mir die Champagnerkarten bringen bitte . . .« – da, in diesem selbstbewußten Moment, ging ein so viehisches, grobes, gemeines Geplärr und Gedudel los, daß er beinahe vom Stuhl fiel. Ratlos glotzte er nach der Kapelle, ebenso ratlos auf die Kellner, die höchst unbefangen blieben und weiterhantierten, als sei der Spektakel die gewöhnlichste Sache von der Welt. – »Ja . . . . um Jesu Barmherzigkeit,« stotterte der Gast – »erlauben Sie . . . erlauben Sie . . . was is denn das für ein grauslicher Radau, für ein abscheulicher??«
Der Servierkellner stieß seinem Vorgesetzten, dem Zahlkellner, mit dem Ellbogen in die gepolsterte Hüfte. Dann beugte er sich nieder und brüllte Perlafinger ins Ohr: »Die Jaßkapell'n, Euer Gnaden. – Ausgezeichnete Musikanten. Machen eine Turneh, die Leute. – Soeben kommen sie von Budapest.«
»Ja, aber erlauben Sie . . . Sie reden von Musikanten . . . Ist das denn auch noch, bei meiner ewigen Seligkeit, Musik?!«
»Euer Gnaden wer'n bemerken, daß wenn Euer Gnaden das Ohr spitzen, die Weise sozusagen deutlich hervortritt und zum Vorschein kommt. – Kontrapunktlich, was man sagt.« Der Kellner war gebildet und stellte sich auf die Seite der Darbietung.
»Muß ich gelten lass'n«, sagte der Hofrat resigniert. »Geschmacksache. Wann s' den Leuten gefallt . . . Sehr ein eigenartiger Geschmack allerdings. – Schenken S' ein«, schloß er abrupt mit geröteten Zügen, aus denen die Ratlosigkeit noch nicht wich.
Der Ober tat mit eifriger Bewegung das Gewünschte. Der Hofrat trank; seine Augen tränten leicht. »Man muß umlernen,« flüsterte er, »scheußlich umstellen muß man sich . . . Hinausg'jagt hätt' man die Bande früher, solche ›Musikanten‹ . . .« Eine Erinnerung durchflog ihn wie ein Blitz. »Wann kommt die Schrammelmusik, bitte?!«
»Da hat man Euer Gnaden falsch informiert«, rief der Ober und schwenkte übermütig seine Serviette. »Mir ham keine Schrammelmusik. Mir sind ein besseres Lokal. Aber passen S' auf, Herr Hofrat, der Herr Direktor ist ein guter Tenorist; der singt wie ein Zeiserl; lauter bekannte Weis'n.«
Der Krach, den man Musik nannte, stoppte plötzlich, und im Hintergrund ward ein hoher Jodelton laut, wie ein Nachtigallenschluchzer. Es tremolierte, es warb und lockte. Ein feister Herr mit einem Knabengesicht und einer Hornbrille erschien auf der Bildfläche, öffnete einen Mund, den man mit einem Schillingstück hätte bedecken können, und sang. Die Hände in den Hosentaschen, leicht auf Lackschuhen wippend, wußte er sich kein Ende melodischer Schelmerei. Er sang das Fiakerlied; betonte, daß es nur ein Wien gebe, ließ die bekannten Bäume im Prater blühen und sehnte sich mit verhauchendem Schmelz nach Grienzing (was übrigens mit der Trambahn jederzeit für zwanzig Groschen erreichbar war). Und die Jazzkapelle war bezwungen. Sie zirpte mit; sie zupfte Akkorde. Versöhnlichkeit und schlichtes Behagen nahmen Besitz von Perlafinger. Seine Miene glättete sich; die zornrote Wolke löste sich auf; alle Amoretten der Vorkriegszeit meldeten sich.
»Sehen S', das ist Musik«, sagte er glücklich und summte mit. Und nach jeder Strophe machte er ein kleines Beifallsgetöse und nippte einen Schluck. So thronte er, mit den Schaumweinperlen im Backenbart, wie ein unsterbliches Symbol des alten echten Wien gleichsam über dem ganzen Saal. Und der Saal schien das zu empfinden, denn die anderen (übrigens meistens unwienerisch aussehenden) Herrschaften in den anderen Logen hoben die Gläser und tranken ihm zu. Auch der glückgeschwellte Caruso mit der Hornbrille verzögerte den tänzelnden Schritt und legte ihm gleichsam ein Klangopfer zu Füßen.
»Man muß den Leuten abbitten«, dachte Perlafinger. »Sie ham doch Lebensart . . . Ja, unser konservatives Element ist nicht umzubringen. Der liebe Gott schützt es in seiner Echtheit. Mit der Mode muß man halt gehen, die Fremden verlangen das. Aber es bleibt g'sund, das goldene, herrliche Wiener Herz.« – Er wedelte herablassend mit dem Handrücken, wie es die erlauchte Spiegelfigur gemacht. Der Sänger, gleichsam neugestärkt dadurch, kletterte zum Schluß des Liedes in glockenreine Kastratenhöhe.
###
Schwebendes Glücksgefühl beseelte Perlafinger. Und dies war irgendwie verknüpft mit der mythischen Persönlichkeit, von der man ihm im Griechenbeisl erzählt hatte. Mein Gott, was die Schrammelmusik anlangte, so hatten jene Herren sich eben in bester Absicht getäuscht. Man weiß ja auch nicht, was die Fremden wollen; das wechselt jeden Tag. Aber von diesem Fräulein Josephine oder »Peperl« – von diesem verheißungsvollen Geschöpf hatte er eine ganz festumrissene Vorstellung. »Brünett«, hatten jene Herren gesagt. »Südlich; temperamentvoll.« Also höchstwahrscheinlich eine Ungarin, eine Madjarin mit etwas rauher Kehle. Nicht unbedingt aufs Wurzen versessen, sondern eine, die mit sich plaudern ließ und einen soliden älteren Herrn zu schätzen wußte. No – auf ein Flascherl Sekt kam's nicht an.
Ob sie wohl auch so eine weiße Haut hatte wie die Ilonka? Das war ihm nämlich bei der Ilonka aufgefallen, obwohl er gar nicht so besonders g'nau hing'schaut (weil er doch auf einer offiziellen Sendung war). Aber das war sicher: maßlos gespannt war er auf dieses Fräulein Josephine. Mit allem Vorkriegscharme würde er seinen Wunsch äußern diesen Lakaien gegenüber in ihren fleckigen Fräcken: »Führen S' mir einmal jene Dame her. Sagen S' ihr, sie hat meinen Beifall erregt.« Und dann würde das herzige Kind anschwirren, mit zitternden Knien seinen Knix machen und aus ihrem Plaudermund würden naive Bemerkungen quellen, während er sie ein wenig krabbeln würd' unterm Kinn oder sonstwo. Und dann würde er sich herablassen, ihr unter Umständen intimer näherzutreten . . .
In diese Träumerei, die wieder von viehischem Saxophongeplärr gestört wurde, stieß die Ankunft einer reiferen Dame, deren Alter die rücksichtsvolle Abschätzung zwischen dreißig und vierzig vertrug. Zielbewußt war sie durch den Saal geschritten in einem kurzen Abendkleid mit vielen Silberpailletten, mit fleischfarbenen Seidenstrümpfen an fülligen Waden und Tanzschuhen, deren Hacken energisch knallten. Oben war sie nackt, unter Puder gesetzt, und trug an den grübchenvollen Armen viel klirrendes Schmuckzeug. Ein Doppelkinn hatte sie, einen fuchsroten Bubikopf und wässrige, leicht untermalte Augen. Aber ihre Stubsnase, ihr Lächeln und ihre runde Kinderstirn gaben ihr was ausgesprochen Sympathisches, wie auch ihr tiefes Organ.
»Grüß Gott, Herr Hofrat,« sagte sie ohne Federlesen und hielt ihm kameradschaftlich die Hand hin, »amüsieren Sie sich bei uns? Warten S', ich leist' Ihnen ein bißchen Gesellschaft . . . Es is ja auch schad' für einen hübschen Herrn, so ganz allein . . .«
»Hm. Ich erinnere mich nicht,« sagte er mit der silbenhackenden Korrektheit, mit der ein besserer Herr Zurückhaltung durchblicken läßt – »die werte Bekanntschaft . . .«
». . . gemacht zu haben. Macht nichts. – Ober, noch a Flasch'n.«
Der Ober hüpfte davon. Sie herrschte hier, das war klar. Der Hofrat wurde konfus.
»Aber Sie wern doch gestatten, daß ich mich vorstelle . . .«
»Damit hat's keine Eile. Hier tut ein jeder, was er mag. Und die Konvention: die lassen wir schwimmen, wie?«
»Wie Sie wünschen«, entschloß sich Perlafinger und hob das Glas. Die Dame bohrte die Zunge in die Backe und beobachtete ihn freundlich unter einem Schleier von Nachdenklichkeit. Dann zupfte sie an sich und prüfte den Hochglanz ihrer Fingernägel.
»Sie brauchen durchaus nicht glauben, mein werter Herr,« sprach sie auf das Tischtuch hin, »daß Sie mir mein Getränk zahlen müssen. Ich hab' das Gottlob nicht nötig. – Das sind unsere Geschäftsspesen.«
»Aber –«, fiel ihr Perlafinger ins Wort, »es wird mir ein Vergnügen sein . . .« Wiederum war er verwirrt.
»So? Wirklich? Dann ist es was anders«, kam die Antwort wie ein Pistolenschuß. – – Langsamer: »Eigentlich setz' ich mich ja net zu einem jeden; aber Sie haben gar so ein zutrauliches G'schau . . .«
Diese Antwort war nicht geeignet, seine Verwirrung zu lindern. Er äußerte mühsam: »Ihr Vertrauen, meine Dame, ehrt mich ungemein.«
»Oh! Man kümmert sich um die Gäste«, fuhr sie heiter fort. »In unserem Lokal hat sich noch keiner beklagt. – – Sagen S' einmal . . . – und sie bettete das Kinn auf den ausgestreckten Zeigefinger, an dem ein Türkis saß so groß wie ein junges Osterei – »Sie ham so was Beruhigendes, Herr – Hofrat . . . das ist doch der Titel? . . . so was lieb Unzeitgemäßes, so was Anheimelndes . . . Man möcht' schier meinen, man sitzt der guten alten Zeit Aug' in Aug' gegenüber . . . Wie ausgerechnet Sie hier hereinschnein, ist mir ein Rätsel. Es schmeichelt mir! Denn Sie sind doch wegen mir gekommen? Ich hab's zwar nicht b'sonders mit der Selbsteinschätzung . . . . obwohl (und sie lächelte verschleiert) ich mir noch jung vorkomm' . . .«
Hier meldete sich der Kavalier in Perlafinger.
»Zufälligerweis' hatte ich von einer gewissen Josephine Baker gehört . . . aber Gnädigste dürfen überzeugt sein, daß eine Attraktion wie Gnädigste vollständig genügen würde, mich herzulocken . . .«
»Da haben Sie ja eine Ausrede, Herr Hofrat. Glatt geht mir das hinunter. Vor der Baker müßt' ich allerdings die Waffen strecken. Wie man eine neunzehnjährige Heuschrecken ist, und außerdem den alten Herren so lieb an der Platt'n krabbelt, hat man natürlich einen Mordsvorsprung . . .«
»Ich kann mir denken,« sagte hier Perlafinger angeregt und vergnügt, »daß es so sehr lang unmöglich her sein kann, daß Sie selbst in jeder Beziehung das Ebenbild waren von der ›Peperl‹ . . .«
»Wie bitte?«
Perlafinger, im Verfolg seines Komplimentes, tat ein erschütterndes Übriges. »No, no,« fuhr er mit erhöhter Stimme fort, »wollen S' mich denn net versteh'n? Ich mein', so elastisch wenn man daherkommt, wie Sie, und eine so schöne weiße Haut wenn man besitzt, dann müßt' man doch noch jetzt eine gefährliche Rivalin sein für dieses Fräulein Baker?«
Die Dame machte einen Mund wie ein Karpfen. – »Was??« schnappte sie endlich, mit zischendem Unterton.
»Nu so . . .« – und Herr Perlafinger, stets noch im Schwung seiner Galanterie, modellierte mit den Fingern – »ich bin doch nicht blind . . . So eine blendend weiße Haut wie die Ihrige ist doch jeder Konkurrenz gewachsen . . .«
Die Dame raffte sich zusammen und beugte sich böse vor. »Jetzt sag' ich Ihnen was,« sprach sie scharf und sehr pointiert, »ich muß mir solche geschmacklosen Scherze aber sehr verbitten, mein Herr. Alles was recht ist, Scherz ist Scherz. Aber ich hab' auch meinen privaten Anstand, merken S' Ihnen das. Ich wer' mich in dem Lokal, wo ich Empfangsdame bin, von einem alten Hanswursten nicht beleidigen lass'n . . .«
Herr Perlafinger bekam ganz runde Augen. Etwas stimmte hier nicht, das merkte er endlich. »Beleidigen?« stammelte er . . . Doch seine Augen wurden noch runder und sein Kinn fiel herab. Er spähte über die Schulter der Dame; er saß wie erstarrt. Ein leiser Tusch des Orchesters geschah. Der Direktor sprach soeben mit wohllautender Stimme:
». . . Und mache ich die Herrschaften nunmehr aufmerksam auf das unvergeßliche Auftreten der weltberühmten Diva Miß Josephine Baker!«
. . . als auch schon folgendes geschah: Ein Geschöpf tauchte hinter dem Orchester auf und stellte sich nach bemerkenswert biegsamen, wiegenden Schritten, die ihrem Gang etwas von der Grazie einer Katze gaben, mitten in den Saal. – Und in gewürgten Lauten löste sich aus Herrn Perlafinger, allen vernehmbar, heiser vor fassungslosem Erstaunen, die klassische Bemerkung:
»Heiliger Herrgott . . . Gibt's denn das auch?! . . . Die is ja schwarz!!!«
###
Der ganze Saal, der still gesessen, verfiel in ein entzücktes Gaudium.
Eine Welle prustender Heiterkeit überschwemmte die Menschen.
Die Dame an Herrn Perlafingers Tisch, die Situation nun endlich begreifend, beugte sich nach hinten und gab weiche Schreie, glucksende Lachkaskaden von sich. Ein Puderwölkchen löste sich aus ihrem hüpfenden Busen. »Einrahmen müßt' man Sie,« schluchzte sie dabei, »unter Glas stellen, Herr Hofrat . . . Nein, das ist gar zu köstlich . . . Einzigartig ist das . . . Nein, ich erstick' ja . . . ›schwarz‹ sagt er . . . Schön dunkelbraun, wie? Mokkafarbig! . . . Schön schokoladenbraun, wie? Das ist einmal eine Sensation! Ganz was Apartes!«
Perlafinger blickte sich vollkommen hilflos um.
»No ja«, murmelte er gedämpfter . . . »Also eine Negerin is das Fräulein Baker; jetzt das is aber eine Überraschung . . . Eine Negerin . . .«
Er murmelte es zwar, aber das Ohr der Menge war auf ihn eingestellt. Man wieherte von neuem.
Die Empfangsdame verschluckte sich, prustete und verschwand.
Perlafinger, immer noch leise den Kopf wiegend, spähte umher; dann, als es stille wurde, beschloß er, sich als scherzenden Kenner zu zeigen. Er brannte sich eine »Virginier« an und benahm sich unbeteiligt. Mochte ein beliebiges Schicksal nun über ihn hinwegrasseln mit Blech und Kalbfell und Saxophongewinsel.
– – – Miß Josephine Baker hatte augenscheinlich den Tumult als eine spontane Huldigung für ihre Person aufgefaßt. Man äußerte ja seinen Beifall in jedem Land, dem sie ihr Auftreten schenkte, auf verschiedene Art. Darum entblößte sie unangefochten ihr prächtiges, schlohweißes Gebiß, lächelte ihr berühmtes langsames Lächeln, das wie eine Eröffnungsfanfare zur Szenerie ihres Körpers wirkte, und begann auf einem Fleck zu tanzen, wobei sie die Arme nach unten stemmte und die Kehle hervordrückte.
Mit einem weichen Urwaldschrei schmiß sie darauf ihre schlanken Schenkel auseinander, umwandelte die Peripherie des Lokals in Kniebeuge und ließ mit eingebuchtetem Kreuz das kleine Gesäß sinnverwirrend rollen. Zwischendurch wackelte sie auch damit. Sie verlieh diesem Körperteil eine eigne, anheimelnde Physiognomie. Wieder in der Mitte des Saales angelangt, drängten die Synkopen des Orchesters mit Trommelverstärkung ihre Gliedmaßen zu gesteigertem Tempo. Sie verschränkte die Kinderarme hinter dem Kopf und ließ die Knie wie Kautschukbälle aneinanderprallen. Schließlich wirbelte sie umher . . . Der schlanke, braune Leib wuchs hoch und höher, von den Zehen gelüftet, wie eine Amphora am Kreisel eines Töpfers.
»Jessus«, dachte Herr Perlafinger und hatte Stielaugen. »Ganz nackt sein . . . und so hupfen . . . Ja, gibt's denn das . . .«
Er war geblendet; war hypnotisiert. In der Tat hatte Miß Baker nichts auf dem Leib als ein Schlupfleibchen aus braunem Seidentrikot; dieses saß wie angegossen und trieb so vollkommene Mimikry, dank der Farbe, daß es tatsächlich gewissermaßen gar nicht vorhanden war. Die kleinen Brüste steckten ihre Näschen keck in die Luft; zweifellos bestanden sie ebenfalls aus Hartgummi; sie zitterten kaum trotz all der Arbeit. Allmählich glitten Perlafingers Gedanken aus der reinen Ablehnung in neutralere Bahnen.
»So ein ausgeschamt's Weib«, dachte er. »Aber Mut hat sie, Mut . . . ›Was wollt s' denn?‹ dachte sie ganz bestimmt so bei sich – ›habt ihr vielleicht eine Ahnung von der großen Kunst, die ich euch hinwerf'? Hab' ich das vielleicht nötig, in euerm kalten Klima, daß ich mich öffentlich auszieh' bis aufs letzte Unterleiberl und euch was vorhupf' in meinem Naturzustand? Aber ich bin eine Jüngerin der Kunst‹ . . .«
Solche Gedanken vermeinte Herr Perlafinger von ihrer kleinen Stirn abzulesen und vom sieghaften Blick ihrer rollenden Antilopenaugen. Sie formulierte ihre Gedanken vielleicht nicht exakt so hochgebildet – sie hatte wohl auch kaum eine akademische Bildung genossen! – Aber immerhin hatte sie den Trieb zum Höheren, das war einmal klar. Perlafinger wußte genau, was es auf sich hatte mit dem Trieb zum Höheren.
Als ob sie fühle, daß sich der nette Herr dort mit ihr beschäftigte, drehte Miß Josephine ihr Vogelköpfchen zu ihm herüber und ließ ihr Porzellangebiß wieder erblitzen.
»Bravo!« schrie der Hofrat und klatschte was er konnte. Zu spaßig sah dies Köpfchen aus im Rahmen der verschränkten Arme. Die hart an den Kopf gekämmte, lackschwarze Scheitelfrisur glänzte wie ein Spiegel. Unheimliche Mengen von Vaseline mußte sie draufgeschmiert haben, die Miß Josephine; so steif war der Kitt! Und so gut hielt er die Fasson! Und dabei tanzte sie jetzt, was man den Hahnenschritt nennt: die Brust war in Ruhe, doch die langen, glatten, zärtlichen Beine mit durchgedrückten Grübchenknien übten Paradeschritt.
Mit einemmal schwang sie einen großen Überwurf aus Straußenfedern von allen Farben und wickelte sich hinein. Wechselnd kamen ihre Gliedmaßen darunter hervor. Aus dem wallenden Geriesel tauchten die Arme mit rund nach oben gedrehten Fingern. Damit schnalzend, sank sie in den Hocksitz zusammen, ein bunter Haufe leichtesten Materials, und nur das impertinente Vogelköpfchen guckte oben noch heraus. Rollende, flüssige Augen, blau untermalt . . . Und die Lippen waren durch lackrote Schminke zum Amorbogen umgeschaffen! Dabei blieben es braune Sauglippen, schelmisch gespitzte . . .
Jetzt war der Tanz zu Ende. Miß Baker also hatte sich endgültig aufs Parkett gesetzt, war gleichsam im Fallschirm ihres Federgewandes niedergesunken. Beifall brauste.
Sie wand sich wieder heraus wie ein brauner Nachtfalter aus buntem Kokon, und ein paar beflissene Herren räumten die Pracht hinweg.
Auf einmal hatte sie einen Stoß von Papierfächern in der Hand, auf die ihr Name in goldenen Buchstaben gepinselt war, und verteilte dieselben an die Leute, die ihr gefielen. Ganz recht hatte die Empfangsdame gehabt: die »Peperl« bevorzugte die alten Herren. Was nun auch immer ihr halbafrikanischer Gedankengang dabei sein mochte (vom Utilitätsprinzip derU.S.A.überfärbt) – jedenfalls hielten die paar alten Herren sehr still, als sie ihnen Killekille machte.
Sie nahm es dabei durchaus nicht genau, welcher Greis den Hauch ihres braunen Leibes zu schlürfen bekam, und sie schnupperten an ihr wie an einer Havannazigarre, die ihnen zu teuer war. Teufel ja, was wurden sie lebendig! Elektrisiert, wie durch Berührung mit dem Äquator selbst! –
Hätte O'Neill die Tänzerin so erblickt: er hätte sie als Dramatische Erlösung, als trostreiche Göttin seinem armen »Emperor Jones« zugesellt, als die Dämonen des WooDoo und die Phantome des Sklavenmarktes, [die] dessen Herz unter dem zerfetzten Hermelin so maßlos ängstigten. Denn nahm Miß Baker nicht jedesmal, wenn einer unserer weißen Sklavenhalter verlangend nach ihrem goldbraunen Fleisch griff und einen Klaps von ihr erntete, subtile historische Rache für Jahrhunderte martervollen Rasseleids? Hatte der kindliche »Schwarze Mann« die blutbespritzte Ebenholzmaske, die sein Wappen gewesen, mit ihrer Hilfe nicht endgültig zertrümmert? Hatte er nicht mit diesem klappernden »Step« das Sausen der Peitschen erstickt? War es nicht seine alte Wäldertrommel, mit der seine späten verpflanzten Nachfahren den Sensationshunger einer entarteten weißen Welt bis zum Taumel sättigten? Wies nicht der Finger dieser braunen Diva einen endlosen Kalvarienweg zurück, und war sie nicht die Apotheose, die die letzten Scheiterhaufen des Judge Lynch siegreich überflammte? – – Emperor Jones war in sein wahres Erbe eingetreten!
###
Lachend, gurrend wand sich das farbige Fräulein zwischen den Tischen hindurch, – ein mildes exotisches Tier; jeder fühlte das Bedürfnis, es zu streicheln, und Herr Perlafinger machte jetzt durchaus keine Ausnahme mehr.
Vielleicht, weil er so auffällig vorhin geklatscht, nahm sie ihn besonders aufs Korn. Der Saal bemerkte es schmunzelnd. Der Hofrat sah sich hilfesuchend um, als die braune Hand in seinem prächtigen Kaiserbart kraulte. Zudem war soviel Nacktheit, in allernächster Nähe und in breitester Öffentlichkeit, beklemmend. Es gab keinen Präzedenzfall, nach dem er sich hätte richten können. Doch weil die Peperl gar so liebenswürdig lächelte mit ihrer porzellanenen Zahnpracht, und alle Welt so gut gelaunt schien, starb seine Bedenklichkeit.
Nun nahm Miß Baker (keineswegs von Hemmungen geplagt!) einfach Platz an seinem Tisch. Jessus! – Sie war ein bißchen müd' und spannte sich aus. Sie setzte sich im Reitsitz auf den Stuhl. Nicht ein bisserl transpirierte sie, und ganz eigenartig duftete sie. Man hatte ihr in Paris ein paar Fläschchen verraten, einen aufpulvernden Extrakt, den sie sorgfältig und pünktlich jeden Abend über sich verspritzte. – Sie schwang also ihre hochversicherten Bronzebeine über den Stuhl; Herr Perlafinger war ihr sympathisch. Und sie tippte ihm auf den Bauch und gurrte:
–»You like my dance?«
Ihre Augen rollten purpurbraun in bläulichem Weiß; ihr Stubsnäschen mit lichtroten Nüstern schnupperte. Herrn Perlafinger war die Sprache fremd, deren sie sich bediente. Aber ein wahrhaft gebildeter Mensch wird nicht abgeschreckt.
»Hofrat von Perlafinger . . .« stellte er sich vor. (Form ist Form.) – »Also, Fräulein Josephine . . . Respekt! – Wie Sie tanzen können! – Mein Gott! – Ganz schwindlig is mir geworden . . . Jetzt werden Sie durstig sein; wie?«
»O you jolly old boy . . .«sagte sie voll verträumter Güte und ließ ihre Augen unbefangen spazierengehen.
»Ob Sie Durst haben, Fräul'n Baker?«
»Gosh!«meinte sie darauf.»So hot!«
»Da kennt sich der Teufel aus mit so einem Wildendialekt«, dachte der Hofrat. – »Red'n wir nur weiter; es wird schon gehn.« – »Hott!« sang er und schnalzte mit den Fingern. »Hü und Hott!«
Miß Josephine lächelte gütig.»Funny«, sprach sie beifällig, in ihren Taubenlauten. –
Dann zog sie die Schultern hoch. Durch dies Manöver spazierten die Brüstchen um einen Zentimeter höher; voll Andacht betrachtete Perlafinger das Phänomen. – Er war atemlos bemüht, ein bekanntes Wort zu erhaschen. Er rang nach einer Ideenverbindung . . .
Miß Josephine rieb ihre Schulterblätter am Logenpolster wie eine Katze am Ofen. – Plötzlich warf sie hin:
»Don't you speak English?«
Hurrah!Englisch! Das hatte er begriffen. – »Nein. – Leider nicht Englisch. Leider nicht, Fräulein Peperl. – Wienerisch halt. – Deutsch, sozusagen –«
»Oh. – Dutch. That's a pity.«
Nun schien es, als habe sie gefragt: »Bitte?«, und er wiederholte seine Information mit dem gleichen negativen Resultat. – So trat denn eine Pause ein; ungemütlich für beide Teile.
»Das beste wird sein,« dachte er, »ich geb' ihr halt ein Busserl; das is auch eine Unterhaltung und eine internationale Verständigung . . .« – worauf er die Peperl ganz plötzlich um die geschmeidige Hüfte packte, und das ging so schnell, daß sein Bart die ganze kunstvolle Freskomalerei ihres Antlitzes wie ein Besen durcheinanderwischte.
Sein Gesicht ward mohnblumrot, während er versuchte, einen Kuß anzubringen; – es war lediglich Vaseline, was er zu schmecken bekam, und nicht Miß Baker selbst. Sie begann zu strampeln und schrie:»Stop!!«– Aber so leicht ließ er nicht locker. Es war ziemlich schwer festzuhalten, das Fräulein; wie eine Eidechse wand sie sich. Aber er war einmal im Schuß. Jetzt hatte er das Knie erwischt, doch sie hatte Muskeln und rutschte aus jedem Griff. »Obst net stillhaltst!« schnaufte er. – »Stillhalt'n sag' ich . . . Sei doch nicht blöd . . . Ja, Herrgott, sei doch nicht so blöd . . . Lieb's G'schmacherl bist, ein lieb's . . . mach doch keine G'schicht'n . . .«
»Stop!!«schrie Miß Baker und strampelte.
– – – Hier griffen höhere Gewalten ein und trennten Herrn Perlafinger von der Diva. –
Sie ließ einen Strom von exotischen Worten los. Mehrere Herren fanden sich ein, der Direktor, der Zahlkellner, der Servierkellner, der Aufsichtsinhaber mit dem schwarzen Bärtchen und dann noch ein italienisch aussehendes Individuum, das Englisch verstand und der Impresario der Diva war . . . Und sie alle lauschten ihr, wie sie einen Kübel voll von heimischem Dialekt überschwappen ließ und sie alle mit dem Osten von New York bekannt machte.
Sie standen voll grimmer Trauer und blickten auf Herrn Perlafinger wie eine Korona von Oberlehrern. Ein Sektgast war er ja; aber so ein Schauspiel! – Der Ruf von Wien! – Wenn die Diva nun ihre Koffer packen tät'? – Gar nicht auszudenken wär' das . . . Hatte sie's etwa nötig, sich einfach hernehmen zu lass'n? –
Miß Baker zupfte an sich herum; wie ein gerupfter Spatz sah sie aus. Dem Impresario, der sie begleitete, gelang es, sie zu beruhigen . . . wenigstens halbwegs. – Man starrte ihr ratlos nach, während sie ihr niedliches Gesäß resolut von hinnen trug. Und es sah so aus, als ob sie es diesmal nicht ausschließlich aus Liebe zur Kunst so deutlich schwenke . . .
###
Nun wenden wir uns dem wahren Opfer zu, dessen Schäferstündchen von so kurzer Dauer gewesen.
Er wurde während der ganzen Verhandlung nicht einmal angesprochen, sondern der Aufseher, der sich gleich anfangs von ihm ignoriert gefühlt, warf befehlsgewohnt das Wort hin: »Der Herr möcht' zahlen.«