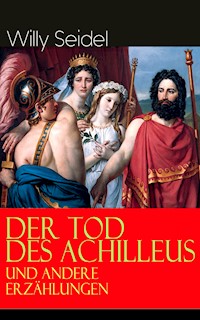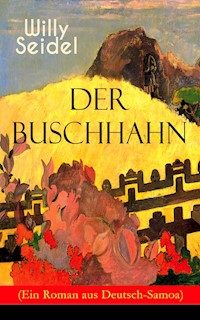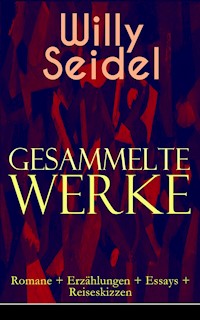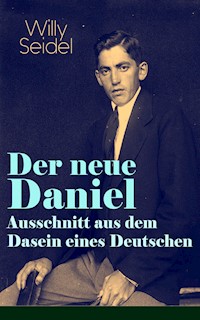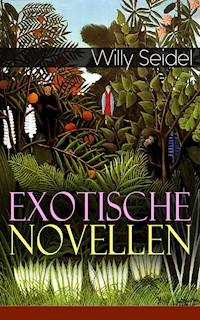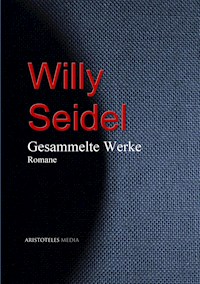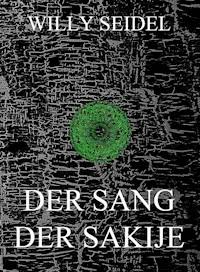Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Roman aus Java und ein Klassiker des Exotismus. Tiefgründig erzählt Seidel von den Problemen eines Europäers, der im fremden Indonesien nicht mit der dortigen Kultur klarkommt ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Schattenpuppen
Willy Seidel
Inhalt:
Willy Seidel – Biografie und Bibliografie
Schattenpuppen
Vorwort
Die Scheidewand
Europäisches
Das Mischlingstribunal
Koos
Der Raden Kusuma
»O Katharina . . .«
Der Schatten an der Treppe
Nächtliches Zwiegespräch
Beichte
Flucht
Die kleine Wissenschaft
Steinernes Lächeln
Ein Brief
Die Schildpattdose
Intermezzo
Schweres Geschütz
Reistafel in Solo
Beim Bilderbuch-König
Beginn des Dramas
Von Prinzipien
Abrechnung
Der Tritt auf die Viper
Das Stigma Indiens
Weiße Ameisen
Fazit
Schattenpuppen, W. Seidel
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849636104
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Willy Seidel – Biografie und Bibliografie
Schriftsteller, geboren am 15. Januar 1887 in Braunschweig, gestorben am 29. Dezember 1934 in München. Bruder der Schriftstellerin Ina Seidel und Neffe des Ingenieurs und Schriftstellers Heinrich Seidel. Mit 10 Jahren zieht Willy Seidel, nach dem Tod des Vaters, mit seiner Familie nach München. Nach dem Abitur studiert er u.a. in München und Jena und promoviert 1911 als Doktor der Philosophie. Er beginnt viel zu reisen, bald auch im offiziellen Auftrag des Auswärtigen Amtes. Als der erste Weltkrieg ausbricht weilt er auf Samoa und setzt sich von dort in die USA ab. Die Jahre dort waren nicht einfach für Seidel und er konnte erst 1919 nach Deutschland zurückkehren. Seidel starb 1934 an einem Herzanfall.
Wichtige Werke:
*Der schöne Tag, 1908
*Absalom, 1911
*Die Natur als Darstellungsmittel in den Erzählungen Theodor Storms, 1911
*Der Garten des Schuchân, 1912
*Der Sang der Sakîje, 1914
*Yali und sein weißes Weib, 1914
*Der Buschhahn, 1921
*Der neue Daniel, 1921
*Das älteste Ding der Welt, 1923
*Die ewige Wiederkunft, 1925
*Der Gott im Treibhaus, 1925
*Der Käfig, 1925
*Alarm im Jenseits, 1927
*Schattenpuppen, 1927
*Der Uhrenspuk und andere Geschichten, 1928
*Larven, 1929
*Die magische Laterne des Herrn Zinkeisen, 1929
*Der Himmel der Farbigen, 1930
*Jossa und die Junggesellen, 1930
*Otto Nückel, 1930
Schattenpuppen
Vorwort
Javanisch – malaiische Schattenpuppen sind kunstvoll aus Leder geschnittene Silhouetten, deren Schema vorislamischen Zeiten angehört. Halb karikiert und halb dämonisch, streng stilisiert, verblüffen sie als Zeugen einer ehemals heroischen Triebhaftigkeit, die verloren ging.
Von verstecktem Regisseur an Hornstielen bewegt, regen sie spinnenfeine Glieder. Ein spitznasiger Götterhimmel der Hindu-Mythe mit Ogern, Fabelprinzen, drolligem Gezwerg wird schattenhaft hinter bestrahlter Leinwand lebendig. Und bei leiernd gesungenen Dialogen, im Dunkel der Tropennacht, vertieft sich eine kindliche Menge in das Drama ihres Geblütes.
So gleicht auch alles, was sich in jenen Zonen abspielt, den zuckenden Schatten solcher Puppen und gewinnt, trotz altbekannter menschlicher Verstrickung, etwas Unglaubhaftes, Unwirkliches, Verschollenes.
Und alles Exotische ist nur ein Gleichnis.
Die Scheidewand
Djodok schließt die weißbewimperten Augen und fährt noch einmal mit seinen Armen, die doppelt so lang sind als sein Kinderkörper, wie ein erschöpftes Klageweib durch die Luft, als wolle er Unnennbares abwehren. Dann sackt er zusammen, entschlummernd, und läßt noch ein zufriedenes Schmatzen hören, das wie »ok, ok« klingt. Zuweilen zucken seine schwarznägeligen Finger wie tastend, als suche er Zweige um sich zu gruppieren. Solche fehlen auf dem üppigwarmen Schoß der Mevrouw Kehmerdill, und bald tritt völlige Ruhe ein.
Der fette elfenbeinfarbene Arm mit den vielen Goldketten schließt sich mütterlich um den warmen Tierleib; man kann den Puls darin spüren wie ein hastendes Uhrwerk. Und der Kopf der Frau mit den kurzen Zottellocken neigt sich nach vorn. Hierdurch tritt ein Doppelkinn hervor. Sie atmet wie ein langsam bewegter Blasebalg und ihre großen dunklen Augen starren an Djodoks schwarzbesträhntem Rücken vorbei auf den gedeckten Abendtisch.
Der Gibbon hat seine zwei in Milch geschnittenen Bananen artig verzehrt. Es geht ihm also relativ gut. Für Otto zwar ist der Affe ein tragischer kleiner Phtisiker und nur ein hoffnungsloses Zerrbild der menschlichen »Fälle«, deren er übergenug in Behandlung hat. So delikat ist Djodok, daß ihm allein schon der Sprung aus der Treibhausluft der Tenggerberge in das Seeklima Batavias die Lunge bedroht. So äußerst delikat ist er! – Und wenn man ihm fremde Gesichter zeigt, so regt ihn die eigene Gastgeber-Rolle so auf, daß er es mit den Nerven bekommt und stundenlang schluchzt . . .
Wie lang die Frau so dahockt, den Affen umschlungen, in ihrem enganliegenden rohseidenen Kleid, weiß sie selbst nicht. Sie hat sich dies leere Starren angewöhnt; – schon seit Monaten. Prall in den Korbstuhl geschmiegt, sitzt sie schnaubend; ihr Herz kämpft ein wenig unter der Last von Kummer und unter dem massiven Polster, das Herkunft und Klima erzeugt. Die linke Hand, mit klirrenden Bracelets, kraut träge in den Fellsträhnen Djodoks; stumpf blitzen daran einige schlechtgeschliffene Rubine.
Draußen hinter den Hibiskus-Sträuchern des Gartens, im »Pavillon«, brutzelt das Abendessen. Es ist längst gar; die Babu sorgt dafür, daß es nicht erkaltet. Die Gonguhr schlägt halb zehn.
Plötzlich wendet sie den Kopf nach der Veranda. Sie hat das wohlbekannte Knirschen der Autoreifen auf der kieselbestreuten Einfahrt gehört und das leise Ächzen der Steuerung; Nas, der Chauffeur, lenkt den Wagen zur Garage. Diese Geräusche sind ihr vertraut von ungezählten Abenden her; selbst der soeben einsetzende pladdernde Regen kann sie nicht verwischen. Gleichzeitig ertönen langsame, wie vorwärtsfallende Schritte, und der Doktor Kehmerdill tritt in Erscheinung. Er kommt über die Strohmatte der Veranda und geht mit einem Grunzlaut, der die Begrüßung ersetzen soll, zunächst in den Ordinationsraum, wo er seine Instrumente deponiert. Man hört Wasser brausen; er wäscht sich die Hände. Mit noch feuchten Fingern bietet er den ihren einen matten Druck. Die Babu, eine duldsam lächelnde Matrone, in bedrucktes Kattun gewandet, und der weißgekleidete Boy Mahil mit genähter, blauer Turbankappe, bringen die Suppe. Während das weiche Geräusch ihrer nackten Sohlen im Raum lebendig ist, schweigt der Doktor. Als sie verschwinden, hebt er sein zerfurchtes Gesicht in den Schein der Hängelampe und seine regenfarbenen Augen öffnen sich angestrengt, während er sie auf die Frau heftet.
»Du bist müde, Otto,« stellt sie mit ihrer etwas kreischenden, metallischen Stimme fest. Mit dieser Bemerkung eröffnet sie die »Unterhaltung« dreihundertfünfundsechzigmal im Jahr.
Er nimmt hastig, als versäume er etwas, ein paar Löffel Suppe. Es ist ein maschinenmäßiges Auf und Ab der feingegliederten dickgeäderten Hand. Langsam wischt er sich den aschblonden Schnurrbart. Dann schenkt er ihr einen gläsernen Blick.
»›Müde‹ ist schon längst kein Ausdruck mehr,« sagt er endlich mit farbloser Stimme. »Täglich fünfzehn Stunden, und das nun seit Jahren . . .« Sein Unterkiefer fällt herab. Sein Mund bleibt halb offen stehn, als sei er erschrocken wie über eine Entdeckung.
»So nimm dir doch den Assistenten von Hamburg,« sagt sie gelangweilt. »Riskier' es doch, in Gottes Namen; die Referenzen sind doch glänzend . . .«
Die Babu und Mahil haben inzwischen das Fleischgericht gebracht, und der Doktor schiebt die Antwort auf. Es gilt ja auch, das halbe Frühstück und das Mittagessen nachzuholen; er ißt mit zäher Hingabe, und wenn er zuweilen an dem Bordeaux-Glas nippt, so nimmt er kauend Gelegenheit, ihr einen nachsichtigen Blick zuzuwerfen. Erst als der Teller geleert ist, läßt er sich zu einer Äußerung herab.
»Jawohl! – Der ›Assistent aus Hamburg‹! – Begreifst du immer noch nicht, daß ich keinen Schmarotzer brauchen kann? – Denn darauf läuft es doch hinaus . . . Ein junger Kerl, der zunächst einmal drei Monate klimaschlapp macht . . . prompt tut er das. Und bis er dann im Training ist . . . Und die Kosten? Wer bezahlt die? Etwa deine Alte mit ihrer Blumenzucht? Ich danke schön; ich danke . . . Einstweilen bleibe ich hier mein eigener Herr!« – Er holt sich eine Eingeborenen-Zigarette aus der Tasche, eine »McGillavry«, von denen er täglich sechzig Stück konsumiert. Der Boy stürzt lautlos herzu und bietet ihm mit demütig eingezogenem Bauch das Streichholz. – »Vorläufig bin ich mein eigener Herr!! Und wenn ich fünfzehn Stunden schufte, dann will ich es wenigstens zu Hause gemütlich haben! Und kein fremdes Gesicht bei Tisch sehn! – Auch keinen Affen!«
Es ist klar, daß eine dumpfe Irritation ihm diesen Ausbruch diktiert. Eigentlich interessiert ihn Djodok, und er hat das Geschöpf – (als es noch gesund war und noch nicht Sklave seiner Nerven) – gern als Auto-Maskot auf seine Krankenbesuche mitgenommen. Die Frau, wie unter dem Dampfstrahl eines jäh gelösten Ventils, läßt den Kopf sinken. Das feiste Madonnenantlitz wird vom Doppelkinn gebremst. Sie starrt mit ihren dunkelbraunen Augen wie ein beschämtes Kind unter den Tisch . . .
Eine Röte tritt in ihr Gesicht. Diese unschöne Blutwelle gemahnt den Doktor an verhaßte Fiebersymptome aus seiner Praxis. Sein Ausdruck ist nicht übermäßig liebenswürdig. Der schwarz umzottelte Kopf drüben erhebt sich nach einer Pause wieder; die Augen treffen ihn runder als sonst, und greller. Sie ist gründlich aufgerüttelt! – Gleichviel, er wagt heute eine Szene; ja, er wünscht sie als erlösendes Gewitter in dieser Atmosphäre von Arbeit, Nervosität, Schweiß und verregneter Zukunft. Wenn zwei sich in den Tropen streiten: wer hat schuld? Wer nicht? – in diesem Land der winzigen, penetranten Ameisen, des Schimmels, der allgemeinen Klebrigkeit von Dingen und Gedanken? –
Der Affe schiebt sein samtschwarzes, drollig von weißem Bart umrahmtes Greisengesicht spähend unter der Achsel der Frau hervor. Die engsitzenden Augen flackern erwartungsvoll. So der grellen Betrachtung von Weib und Tier ausgesetzt, denkt der Doktor: »Djodok hat weiß Gott ihre Augen. Vielleicht sind sie doch auf keinem allzulangen Umweg miteinander verwandt . . .« – Und schier unbewußt machen seine Finger eine kleine Kletterbewegung an der Blumenvase . . . Klar ist eins: Doktor Otto Kehmerdill hat nicht allzuviel übrig für Mevrouw Kehmerdill. Dabei denkt er an seinen Freund Heyermans.
Sie würgt nach Worten; ihre Kehle bläht sich. – Dann stößt sie hervor:
»Mißgönnst du mir auch Djodok?«
»Du sprichst,« erwidert er mit einer Stimme, die ihn selbst an knarrendes Blech erinnert, »als ob ich dir je etwas mißgönnt hätte. Du hast es sehr bequem; billiges Personal, mit dem du dich – außerordentlich gut verständigst . . .« Er vergewissert sich, daß der Sundanese nicht in der Nähe ist. Man kann nie wissen, wie weit dessen holländischer Sprachschatz inzwischen gediehen ist. »Du hast einen Haushalt, hast europäische und amerikanische Schmöker; neulich habe ich wieder einen Haufen zerlesener Magazine-Novellen – du kannst dir ausmalen, wo – gefunden . . . Lektüre und Reistafel; der gleiche gesunde Appetit. Wenn du willst, kannst du ja auch deiner Mutter in der Pension helfen; andrerseits steht es dir genau so frei, im Korbstuhle zu liegen und zuzunehmen, während ich beschäftigt bin. Mißgönnt ist dir nichts . . .«
Ihre Kehle wandert; sie schluckt. Der Doktor sitzt steif; seine Stimme hallt lauter.
»Und das Vieh gehört in seine Koje!!« ruft er mit sinnlosem Aufwand. Zur Unterstreichung klopft er mit der Gabel auf den Tisch. »Ich sehe genug von Krankheit; ich verzichte darauf, daß man mir einen siechen Affen zur Gesellschaft gibt . . .« Abschließend, beginnt er mit nervösen Griffen eine Banane zu häuten.
»Du sagst also,« bringt sie endlich heraus, »daß du mir allerlei gönnst, Otto. Jawohl! Fünfzehn Stunden Einsamkeit täglich, und wenn du heimkommst, deine zerrüttete Person und einen Scheffel Grobheit. Ich will doch . . .« – sie tastet mit allen zehn Fingern beschwörend in die Luft –: »ich will doch – Unterhaltung von dir! Ich bin sechsundzwanzig und du stellst mich kalt . . . Was soll ich denn tun? Du willst mich ja nicht . . . Auch meine Mutter sagt, du bist verstockt. Und noch mehr. – Du bist kein– Mann.«
»Aha!«
»Das steckst du ein?! – Wenn ich meinem Bruder sagte: ›Du bist kein Mann‹ – er risse mir die Haare aus . . .«
»Und zöge den Kris!« (Eingeborenen-Dolch.)
Mit einem Schlag sitzt sie still und ihre Röte weicht gelblicher Blässe.
»Wie billig!« stöhnt sie dumpf.
»Aber denkbar,« ergänzt er gelassen. Das ist das böse Etwas zwischen ihnen; die Scheidewand aus zähem Kautschuk, die man nie durchbohrt.
»Denke nicht,« sagt sie auf einmal hitzig, »daß ich deine geschmacklosen Anspielungen auf meine Familie überhöre. Es gibt eine Grenze! – Ich weiß, wer dich gegen uns aufhetzt! – Aber . . .« Und sie reckt ihre starken Brüste vor, daß sie den leichten Stoff spannen – »ich bin nicht schuld daran, daß du kein Mann bist!« Sie bricht lauernd ab und beobachtet ihn.
Hofft sie, ihn zu reizen? – Kehmerdill lächelt wegwerfend. Er steht auf, um auf die Veranda zu gehen, und bestellt sich bei Mahil einen »Split« (Whisky-Soda). Er läßt also auch heute, wie immer, das Gespräch auf seinem dramatischen Höhepunkt ohne Grazie und ohne Echo verpuffen!
Sie fällt in sich zusammen und sitzt eine Weile apathisch. Dann löst sie sich aus dem Korbstuhl und führt Djodok an der Hand in den Garten zurück, zu seinem Bambusverschlag. Der Doktor sitzt auf dem Verandasessel und saugt an dem eiskühlen Getränk. Dabei zittert seine Hand . . . Er flucht, als er etwas verschüttet, flüsternd vor sich hin.
Schleppenden Schrittes geht er in den Ordinationsraum und schließt die Tür hinter sich. Als er heraustritt, scheint er munterer: so, als sei ein Teil der tödlichen Erschöpfung von ihm abgefallen; ja, es ist irgendein Zug um seinen Mund, als habe er seiner Umgebung schnell ein verschmitztes Schnippchen geschlagen . . . Doch bald zeigt sich wieder die Falte des Ekels, als das Tischtelephon schnurrt. Widerwillig tastet er zum Hörer. Er vernimmt eine deutsche Stimme:
»Herr Doktor! – Man hat Sie mir empfohlen . . . Könnten Sie wohl herüberkommen, – zu ›Daendels Hotel‹? Meine Frau ist nicht wohl . . . Eine Vergiftung vermutlich . . .«
Elastisch, als sei er froh, noch einmal seinem »Heim« zu entkommen, steht der Doktor auf und ruft nach dem Chauffeur Nas.
Europäisches
Nas ist dreimal geschieden, das gehört sich so für einen Küstenmalaien, der auf sich hält. Wo unter der Sonne dieser Insel seine verflossenen Gattinnen schwere Palmbastkörbe voll Durianfrucht oder singend empfohlene Limonaden schleppen, ist ihm unbewußt. Ebensowenig ahnt er, in welchem Kampoeng seine von Reisschlamm geschwärzten Kinder sich balgen. Wenn er sich auch dreimal beim Kadi losgekauft, so übernimmt eine nebelhafte Person, gemeinhin Allah genannt, die sich aus seiner animistischen Seele hervorschält, weitere gütige Verantwortung für sein Schicksal. Zurzeit ist er mit der Babu des Doktors vermählt. Nun hockt er, wie immer mit aufgerecktem Oberkörper, angespannt, auf dem Führersitz. Drei seinesgleichen würden, trotz der Kleinheit des Chevrolets, vorn noch Platz finden. Seine nackten Füße sind am Beschleuniger tätig, und seine kleinen Hände, nervig, Stahlklammern voll Feingefühl, spielen mit gewagtem Griff am Lenkrad.
Der Wagen fegt um den Koningsplein herum; rings an den Seiten des ausgedehnten Wiesenquadrats blitzen die Lichterschnüre und erzeugen einen helleren Dunst unter dem schwarzblauen Himmel. Die Hupe grölt und kläfft. Fünf Minuten schnurrender Raserei vergehen, begleitet vom Glockenlärm der einrädrigen Ponydroschken, von aufkreischenden Unterhaltungsfetzen, vom Gelächter und Zungenschnalzen abendlich flanierenden Pöbels . . . Dann schwingt sich der Wagen in die Einfahrt von »Daendels Hotel«.
Der Doktor steigt aus. Im Hintergrund des bestrahlten Ganges, der zum Speisesaal führt, lauert schon ein Boy, der eilig herzurennt und ihm eine Zimmertür zeigt. Auf sein Klopfen wird sie von einem sehr großen Herrn geöffnet, der den Doktor unweit des Bettes zu einem Stuhl bittet. – »Erdbrink, aus Hamburg,« stellt er sich mit monotoner Stimme vor. »Es ist offenbar, wie ich schon sagte, eine Vergiftung . . .« Er schiebt die Falten des Mückennetzes, dessen kahler weißer Würfel dem halbbeleuchteten Raum etwas Totes gibt, auseinander und rafft sie über die Hornhaken: da liegt in braunseidenen Pyjamas das reizvollste Geschöpf, auf das der Doktor je Augen legen durfte. Er hebt den federleichten Arm und tastet daran entlang wie am Hals einer Violine. Der Puls ist schwach und intermittierend. Die Frau, mit geschlossenen Augen, atmet hoch und schnell; zitternd regen sich die mädchenhaften Brüste unter dem nachgiebigen Stoff, unter dem sich der Körper deutlich abzeichnet.
Ihr Alter muß zwischen 25 und 30 liegen. Dieser Leib ist jung; die Erfahrung hat ihn verschont und sich nur mit einer kleinen Falte zwischen den Brauen eingezeichnet, einer leichten Verfinsterung . . . Die Gesichtshaut, mit einem Hauch von Honigfarbe, ist zart geschminkt. Das Antlitz ruht mit trotzigem Ausdruck, den Mund an den Winkeln gesenkt, in einer Masse ungebärdigen, braungoldnen Haars . . . Die Nüstern der feingebogenen Nase hauchen leicht und schnell unregelmäßigen Atem über die Oberlippe. Man ist versucht, an einen hübschen Knaben zu denken, einen übermüdeten Kammerpagen etwa, der in bleiernem Schlaf ertrunken ist . . . Die schmalen Hüften verstärken den Eindruck.
Der Doktor zeigt bei der ersten Untersuchung nichts als Sachlichkeit. Und doch ist dies ein Ansturm von Lieblichem; das schöpferische Europa in bester Laune, das sich hier unter dem Mückennetz eines tropischen Hotels entpuppt. –
»Speisenvergiftung?« fragt er.
»Möglich,« klingt die Stimme des anderen aus der Ecke des Raumes, monoton, in völliger Hoffnungslosigkeit. »Aber auch möglich, daß es hiermit zusammenhängt . . .« Er zieht eine leere Glasröhre aus der Tasche und reicht sie dem Doktor. »Ich fand dies unter dem Bett.« – Hastig nimmt Kehmerdill die Röhre entgegen.
»Veronal!! – Wieviel Tabletten waren noch da?«
»Mir unbekannt,« flüstert Erdbrink und stößt einen ungeheuren, hohlen Seufzer aus, der einen leisen Dunst nach Alkohol herüberträgt . . . »Es ist nicht das erstemal, daß sie mir einen derartigen Streich spielt. Sie will mich damit necken.« Seine Stimme klingt zerborsten. »Logik ist nie ihre Stärke gewesen . . . Schauerlich extrem ist das alles . . .«
»Lieber Herr, wir dürfen jetzt nicht philosophieren. Wir müssen retten.«
»Gut,« sagt Erdbrink brüsk. »Retten Sie.« Der Doktor starrt ihn kurz an: er erkennt seinen Zustand.
»Setzen Sie sich ins Nebenzimmer; ich werde Maßnahmen treffen.« Und nachdem er den Djonges nach der Apotheke geschickt, setzt er sich wieder an das Bett und versucht, das heisere Flüstern des weißblonden Riesen, das aus dem Nebenzimmer dringt, zu verstehn. Diese Bemühung gibt er bald auf. Seine Jacke beengt ihn. In Hemdsärmeln sieht er aus wie ein Mann, der sich zum Ringkampf rüstet; diesmal gilt es einer ihm vor zehn Minuten noch völlig Unbekannten, die er seit seiner Jugend kennt; ja, ein geheimster, ältester, brünstigster Wunsch hat Fleisch und Bein gewonnen und ist im Bereich seiner Hände . . .
Hier liegt nun dieser Page in Pyjamas, im Veronalstupor, und beschert ihm Rätsel über Rätsel. Er faßt wieder nach dem fadendünnen Puls. – »Ein knappes Rennen wird das,« murmelt er und verflucht sich, daß er es versäumt hat sich gegen die äußerste Eventualität hinreichend zu rüsten. Erdbrinks Worte am Telephon haben ihn den Ernst nicht ahnen lassen. – »Meine Frau ist nicht wohl . . .!« – Wie oft hat er in seiner Praxis diesen gleichen Satz gehört! Und fast immer war es Konstipation oder ähnliches; zu wenig Bewegung; zu fettes Essen . . . Ja, die Unbehaglichkeiten dieser Holländerinnen sind ziemlich eindeutig. Er springt nach bestem Gutdünken mit ihnen um; er legt ihnen Pferdekuren auf oder jagt sie für vier Wochen ins Gebirge . . . Doch das Geschöpf hier neben ihm erfordert mehr Verständnis; das ist kein Fall für Aspirin; eine finstere, eine radikale Angelegenheit ist es.
Während er sie anstarrt, dämmert Vergrabenstes, Tiefstes auf und wird plastisch. Ein Kontakt schließt sich zu einer Leitung, deren Draht ins Unterbewußte mündet. Ein magischer Strom trifft die Wurzeln seines Daseins. Ist sie nur ein kindliches Weib, ein kostbares Spielzeug, mit ihrer Atmosphäre stets bereiter und stets zurückzuckender Körperverheißung? Oder ist sie mehr? Ja, sie muß mehr sein, woher käme denn sonst die kühle Süße einer halbbegriffenen Verwandtschaft und des Heimatlichen, das ihn anweht über Jahre hinüber voll greller Sonne und Tropenmüdigkeit?
Kalter Schweiß bricht ihm aus, und sein Herz schlägt dumpfe Warnung. Wieder schließt er die Finger um das seine Handgelenk; fern, wie unter Watte, rieselt das Leben.
Er reißt die Augen weit auf. Unter dem Baldachin des Moskitonetzes kreist eine eherne Stille. Großer Gott, warum hört er nichts? Wo bleibt das Bimmeln der Sados draußen, das Röhren der Hupen? Ihr Gesicht leuchtet wie eine weiße Tulpe. Zwei, drei Minuten sind nötig für dies Rezept; nun dauert es schon Äonen . . .
Er flößt ihr Whisky ein, den er in einer halbleeren Flasche auf der Konsole findet. Gottlob, ein paar Schluckbewegungen; der Körper zittert. Es kann sein, daß sie die Krise übersteht. – Endlich kommt der Boy zurück; Kehmerdill füllt die Spritze und drückt die Nadel in die Vene. Erdbrink kommt schlürfend aus dem Nebenzimmer und stiert herüber.
»Ich denke, wir können hoffen,« spricht Kehmerdill dürr. »Sie wird jetzt einen Dauerschlaf halten; die Injektion wirkt gut. Bei Komplikationen rufen Sie mich . . . Wenn sie aufwacht, Bouillon mit Kognak. Eiswickel, zweistündlich erneuert . . .«
Er geht, kühl grüßend. Im Auto entnimmt er seiner Tasche ein gelbseidenes Tuch, das er aus der Gürtelfalte des braunseidenen Pyjamas entnommen – schlechthin gestohlen! – hat; er drückt es an den Mund und schlürft den Duft.
Das Mischlingstribunal
»Kollege van Affelen? – Hier spricht Kehmerdill. Sie staunen wohl über Ihren Zulauf in den letzten Tagen? – Ja; ich schicke Ihnen meine Patienten. Ich bin erledigt. Ich denke, es wird noch einige Zeit dauern, bis ich die Fälle wieder übernehmen kann. Liefern Sie mir die Patienten dann wieder aus; womöglich im ›status quo‹ . . . Na; Späßchen. Der Raden Nongkalam ist ein kitzlicher Herr; läßt sich schon den dritten Monat um Operation bitten. Mit dem werden Sie energisch. Stellen Sie ihm vor, sein prospektiver Sitz im Volksraad sei vorgewärmt und in Gefahr, zu erkalten. Mit de Vries springen Sie grob um; edler Hiesiger, aber feig; Wassermann positiv. Daß ich Seow Lik Sen loswerde, ist mir erwünscht; behalten Sie den. Aber die alte Quick Bok Aij brauche ich noch. Na, viel Glück, Kollege.«
Kehmerdill hängt den Hörer ein; es ist günstig, daß er den anderen Arzt von seiner Praxis mitprofitieren lassen kann, schlägt dieser sich doch mit sechs Kindern ohne viel Glück durchs Leben. Der Doktor hat um sieben Uhr die Veranda von Patienten säubern lassen.
Am Frühstückstisch, beim Tee, empfindet er ein Übermaß von Sonne im Zimmer und kommt nach einem trägen Gedankenprozeß zum Bewußtsein des leeren Stuhls ihm gegenüber. Schon seit Tagen steht er leer.
Er empfindet weder Frohsinn noch Schmerz. Seine Wehmut stammt aus anderer Quelle: er denkt an ein Hotelzimmer und an ein trotziges kleines Gesicht mit dunklen Wimpern. Und diese gesenkten Mundwinkel fragen ihn, etwas verächtlich: »Was hast du mit deinem Leben gemacht?« Vor dieser Frage verblaßt alles, woran er sich klammert; sein Haus, mit all dem östlichen Porzellan, den Soembawadecken, dem Palembangsilber; sein ganzes Leben verblaßt und seine ganze mit Schweiß und Nervenverfall ausgebaute Karriere.
»Eigentlich,« denkt er, »sind achtunddreißig Grad Fieber ein idealer Zustand.« Er spürt eine schwebende Leichtigkeit; seine Stirn ist heiß wie ein sonnbestrahlter Ziegel. In diesem irrseligen Zustand zieht er ein gewisses Taschentuch aus der Pyjamajacke und schnuppert daran; ein Rüchlein wird lebendig, das in seiner schwachen Mahnung die schaurigsüße Kraft besessen, die letzten Nächte in Orgien von unklarer Sehnsucht und glimmenden Wandelbildern umzuschaffen!
Er setzt sich in den Korbstuhl der glasgedeckten Vorhalle, die den inneren Teil der Veranda bildet. Um ihn dreht sich das sanfte Karussell des Fiebers. Djodok klagt draußen »Wuh, wuh« und rüttelt an den Stäben. Er vermißt seine Morgenpromenade an der Hand der Hausfrau.
»Bleib nur, wo du bist,« denkt Kehmerdill gehässig. Er will diese ungewohnte Ruhe ausbeuten, diesen halben Schlummer seiner Hände, und die Ausschweifungen seines schwimmenden Hirns . . . Von draußen quillt Sonne herein, die wütende Dezembersonne der Regenzeit, die vormittags, vor dem Zwei-Uhr-Gewitter, erbarmungslos sticht. Agaven und Fächerpalmen der Einfahrt stehen reglos. Das näselnde »Quä, Quä« eines Kuchenhändlers verliert sich im staubigen Schwarzgrün der blanken Fikusblätter, zwischen denen der karminrote Schirm eines Flamboyant-Baumes grell und still leuchtet . . . Fernes Dröhnen, Karrenquietschen, Ponytrappeln: ein Vormittag wie tausend andere. Die Tschitschaks (Eidechsen) an der Verandawand rascheln um die Bilderrahmen und schnalzen ihr »Tjak, tjak«.
Plötzlich surrt das Telephon. Er fährt zusammen und nimmt den Hörer. Doch statt der Stimme Erdbrinks trifft ihn ein holländisch gesprochener Satz. »Otto,« spricht ein unreines, schwankendes Organ, »hier ist Mevrouw de Ruyter. Meine Tochter ist bei mir. Um vier Uhr, heute nachmittag, erwarten wir dich zum Tee.«
Die Schwiegermutter! . . . Zwischen seine zottigen bleichblonden Brauen tritt eine Grübelfalte . . . Ach – es muß ja sein.
»Jawohl, Mevrouw,« sagt er höflich. »Ich denke, ich kann es einrichten.«
Was man in Europa Privatleben nennt, spielt sich in Weltevreden fast auf der Straße ab. Von vorn bis hinten stehen die Häuser offen; blankgeputztes, tadelfreies Familienleben wird dem Volk oder dem Nachbarn demonstriert. Der Holländer sehnt sich selbst aus der Phantasiearmut der für wenige Jahre zusammengekauften Magazinmöbel heraus und starrt mit seinen müden Bureauaugen in das »vorüberbrausende Leben« . . .
Für Mevrouw de Ruyter gibt es keine Wechselbeziehung zwischen Straße und Veranda. Sie verbaut sich den Vorgarten mit dichten Schattensträuchern; jawohl, die ganze Schleife der Einfahrt entlang stellt sie chinesische Blumenkübel auf, und um ihrem exzentrischen Wesen die Krone aufzusetzen, verkriecht sie sich, wie eine Hexe, die verschmitzte Gewebe spinnt, hinter das Haus und empfängt ihre Besuche dort. Doch ist das Garn harmlos, das sie spinnt, denn sie gibt einen Pensionstisch an sechs bis acht Leute, ohne sie gerade zu überfordern.
Eigentliche Quelle ihres Einkommens ist Blumenzucht. Zu jeder Gelegenheit in erreichbarer Nähe schickt sie ihre Produkte. So hat sie nicht schlecht zu leben. Ihrem längst verstorbenen Mann hat sie eine Reihe verwegen blickender Söhne und bildschöner Töchter geboren. Bis auf Mevrouw Kehmerdill sind diese Töchter nach auswärts verheiratet; von den in Batavia ansässigen Söhnen ist Hendrijk Lehrer in der »Stovia«, dem medizinischen Lehrinstitut für Eingeborene, und Peter Notar im Vorsitz des »Indoeuropäischen Verbandes«.
Kehmerdill durchschreitet den Gang zum Speisezimmer. Es ist lange her, daß er sich hier nicht mehr gezeigt. Ist die dämmrige Wohnung ohnedies schon vollgepfropft mit Europa-Möbeln der schlimmsten Periode – schon Mijnheer de Ruyter, der sein »van« gegen ein »de« eingetauscht, hat zu seiner Zeit einer eleganten Lebensführung gehuldigt –, so wirkt der Reichtum an Blumenvasen vollends erdrückend. Auf jedem Mahagonibord, jeder Kredenz, jeder Kommode blitzt Messing, drängt sich chinesische Dutzendkeramik an deutsches Fabrikporzellan, und diese Deckchen überall! Diese Amoretten in Perlstickerei! Dieser zersetzte Orient, der ihm entgegenquillt! Ha! Diese Öldrucke: Orgien von Rosa unter Zephirschleiern und »südlichen Himmeln«! Und dazwischen wieder etwas Schönes, Echtjavanisches . . . Qualvoll zwecklos . . .
Er muß eine Beklemmung überwinden, denn es steht ihm ein Kampf bevor mit Leuten, in deren Köpfen der Begriff »Behaglichkeit« solche Form annehmen kann. Wind muß er hineinblasen in diese unsauber-altmodische Würde, das gespreizte Milieu der füufundsechzigjährigen indischen Matrone. Wie kam es nur, zum Teufel, daß er dies vor zehn Jahren so wenig empfand! Er hat Antja herausgeholt und auf eigene Füße gestellt, doch es hat nichts geholfen; mit allen Fasern ihres Wesens ist sie hier hängen geblieben.
Er schreitet aus der Glastür in den Hintergarten. Auf der Treppe drängen sich Blumentöpfe, stapeln sich Kränze. In der feuchten Glut hier gedeiht ein Farbenwirrwarr. Rabattenförmig geordnet strecken sich parallele Bambusgestelle in die Gartentiefe. An den Drähten hängen breitmaschige Bastkörbe oder schimmelnde Rindenbündel voll weißer, gelber oder violetter Orchideen. Aus all dem quillt ein Duft, der Schwindel erzeugt; ein Gemisch von Humusmoder und penetranter Süße.
Als er das Labyrinth ganz durchdrungen, steht er vor einer Gruppe von Menschen, die unter dem Wellblechdach, am Beginn des asphaltierten Ganges zur Küche, Tee zu sich nehmen. Das erregte Gespräch verstummt flugs, als sie ihn sehen. Kehmerdill erkennt die gesamte in Batavia ansässige Familie. Aha, er soll also heute vor ein Tribunal kommen. – Peter und Hendrijk sind breitschultrige Menschen mit massiv geschnittenen gutmütigen Gesichtern. Wären sie blond und weiß, sie würden als »Pioniergestalten« Aufsehen erregen. Die schwarzen Haare jedoch, die schlaffe Attitüde, das fahle Kaffeebraun der Hautfarbe, die weichen, entgleitenden Händedrücke sagen dem Kenner sofort, daß er es hier mit »Indos« zu tun hat, mit Mischlingen, die mindestens zur Hälfte malaiisch sind . . . Der Großvater de Ruyter hat sich seine Frau aus Soerakarta geholt, und da die dortigen Javanen Urabkömmlinge von Hindus sind, so ist es ja eigentlich (wie Kehmerdill damals meinte, als er Antja zu sich nahm) eine »arische Familienangelegenheit« gewesen . . .
Diese Auffassung hat sich bei ihm verloren.
Als er Antja heute bei ihresgleichen sitzen sieht mit flammenden Augen, die mattweißen Hände im breiten Schoß geballt, wird ihm ihre Ähnlichkeit mit Brüdern und Mutter deutlich wie nie. Sie ist einfach die weibliche Ausgabe der hübschen, großen, schlaffen, feisten Männer. Und während er sich kopfnickend niederläßt, denkt er blinzelnd: »Das hat nun jahrelang neben mir Fett angesetzt, und ich hab' es ertragen, wie ein schlechtes Bild im Zimmer. Das Bild gefiel mir anfangs; längst aber mußte es vom Haken herunter. Hier ist sie zu Hause.«
»Eh . . .!« – Die Alte gibt ein zerborstenes Lachen von sich und reicht ihm ihre Hand hinüber, an deren verrunzeltem Mittelfinger ein dicker Schlangenring sitzt. Kehmerdill beugt sich vor und überwindet sich zu einem Handkuß. »Ist das auch noch eine Hand?« denkt er. »Das ist ja ein Tschitschak!« Die kleine Hand entgleitet ihm glatt und kühl, und nun reichen die Brüder ihre großen warmen Pranken herüber. Antja begrüßt ihn kaum. Mit hochgezogener Kopfhaut und großen Augen, die leblos, wie gemalt im gepuderten Gesicht sitzen, starrt sie ihn an. Man lächelt von allen Seiten; überall trifft der Blick Kehmerdills auf sonnig gelüftete Gebisse. »Prächtige Zähne habt ihr,« denkt er verdrießlich. Er versucht zurückzulächeln, doch dieser schwache Abglanz wird von seinem hängenden Schnurrbart halb versteckt.
»Da ist er ja, der böse Mann!« spricht die Alte endlich, und ihre Augen verkriechen sich hinter geschwollenen Lidern. Es gibt Schnitzereien ans Seifenstein, die ihr ähnlich sehen. Ein Wölkchen zieht über die Szene, das Lächeln ringsum erlischt. Die Alte räuspert sich unrein und schlürft ein Schlückchen Tee, das nach Jasmin riecht. Sie bewegt den Kopf wie eine witternde Schildkröte.
Kehmerdill gibt sich einen Ruck, bietet Zigaretten an und bringt ein Gespräch in Gang. Man spricht über Politik. Peter, als »Vollholländer«, verteidigt die Regierung und hat wenig Verständnis für »Home Rule«. Hendrijk jedoch schwört auf Limburg-Stirum und auf eine fortschrittliche »christlich-ethische Innenverfassung«. Sie schnauben und geraten sich darüber, unter großem Wortschwall und vielen Gesten, fast in die Haare. Kehmerdill wirft ab und zu ein Wort hinein, das beiden Standpunkten gerecht zu werden scheint. Er sitzt ja selber am Pulverfaß und hat kein Interesse daran, den Gegensatz zu schüren. Der »Vollholländer« Peter beschlagnahmt ihn bedingungslos für sich; das fühlt er und spürt einen faden Geschmack im Mund. Immer heißt es »wir« dabei, oder »uns«. – Plötzlich geschieht ein Knall.
Eingeschüchtert blickt man auf die Matrone. Sie hat wie ein Zeremonienmeister zur Eröffnung des offiziellen Teiles der Sitzung ihren Malakkastock auf die Fliesen gestoßen. Ihr Kiefer schiebt sich vor, ihre Augen sind trüb glitzernde Ritzen.
»Wir sind nicht zusammengekommen,« spricht sie mit wankender Stimme, »um zu politisieren. Oder denkst du, Otto, es sei nur ein hübscher Zufall, daß meine Söhne zugegen sind? – Denkst du, ich hätte telefoniert, damit der Verkehr nicht einschläft?«
Kehmerdill pafft stark. »Ich habe Fieber, Mevrouw,« erwidert er fast schmeichelnd. »Ich freue mich, daß Sie sich meiner erinnern. Eine Tee-Einladung ist nicht problematisch. Daß Peter und Hendrijk hier sind, tut mir wohl, ohne mir den Kopf zu verdrehen.« Die Männer schnalzen leise mit den Zungen und wiegen die schwarzen Scheitel.
»Ha! – Du willst es glatt und schön, und bringst Handschuhe mit. – Wir wollen Tee trinken, gewiß. Wir lieben uns alle untereinander. Das ist doch so, nicht wahr, Otto?«
Kehmerdill schweigt. Er kratzt sich mit dem tabakgelben Nagel des Zeigefingers an der Rinne der Oberlippe.
Die Alte bewegt sich heftig im Korbstuhl; dieser kracht. Sie hebt den Krückstock und deutet damit auf Antja. »Da sitzt deine Frau,« spricht sie, und ihre Stimme geht modulierend in ein leises Kreischen über – »da sitzt eine gebrochene Frau, Otto . . . und diese ist – meine Tochter!!«
Kehmerdill schweigt weiter. »Wer sind diese Leute?« muß er plötzlich denken . . . »Was wollen sie eigentlich von mir?«
Endlich sagt er kurz: »Sie erzählen da nichts Neues, Mevrouw. Es scheint, man hat vor, theatralisch zu werden. Also nehmen Sie kein Blatt vor den Mund.«