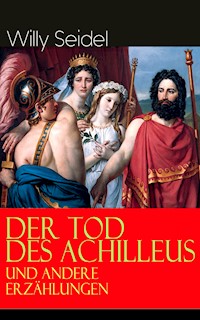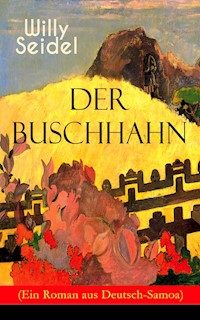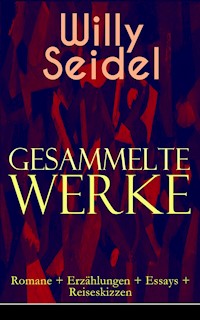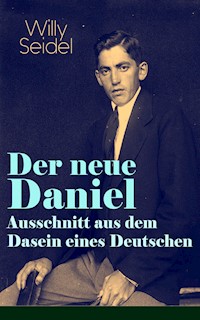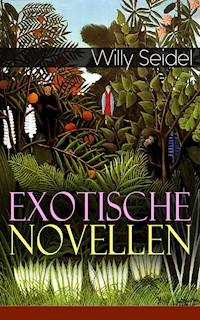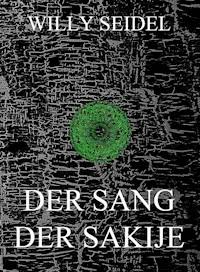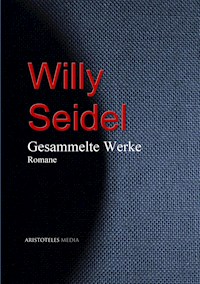
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: aristoteles
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Diese Sammlung der Werke von Willy Seidel, des berühmten deutschen Schriftstellers enthält: Schattenpuppen Ein Roman aus Java Der Buschhahn Vorklang Gerhart Ollendiek Die Eltern Die zweite Stimme Vom kleinen Niklas Der Mann mit dem Schlüssel Ein Tag aus dem Leben Grothusens Die Matronen 'Ebbe am Nachmittag' Das Huhn Maggie Der tote Hund Heimkehr Der Pa‘alagi Von der Sina und vom Tulivaipupûla Das Geheimnis des Buschhahns Begegnung Ein Stück vom Anfang Totentanz Vom ewigen Lächeln Das Geheimnis des Buschhahns Die Pflanzung des Misi Kuma Preisung der Matten von Tanumalçto Mond in Tufu 'Uma' Die Entlarvung des Buschhahns Zank mit Moso Schwerer Gang Bruchstück eines Briefes Botschaft durch den Regen Das Phantom mit der Häkelspitze Intermezzo Beschluß eines Briefes Die Entlarvung des Buschhahns Der Gott im Treibhaus Ein Roman von Übermorgen Der Sang der Sakije Daûd-ibn-Zabal Der Brunnen des unlauteren Ehrgeizes Der Mann mit den Tieren Intermezzo Der Diener der ganz Verworfenen Hassan-Muharram Die Mutter Das Dekret Haschisch Der Vater des Irrwegs Der Sang der Sakije
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Schattenpuppen
Ein Roman aus Java
1927
Seinem lieben Schwager
Anthony van Hoboken
Vorwort
Javanisch – malaiische Schattenpuppen sind kunstvoll aus Leder geschnittene Silhouetten, deren Schema vorislamischen Zeiten angehört. Halb karikiert und halb dämonisch, streng stilisiert, verblüffen sie als Zeugen einer ehemals heroischen Triebhaftigkeit, die verloren ging.
Von verstecktem Regisseur an Hornstielen bewegt, regen sie spinnenfeine Glieder. Ein spitznasiger Götterhimmel der Hindu-Mythe mit Ogern, Fabelprinzen, drolligem Gezwerg wird schattenhaft hinter bestrahlter Leinwand lebendig. Und bei leiernd gesungenen Dialogen, im Dunkel der Tropennacht, vertieft sich eine kindliche Menge in das Drama ihres Geblütes.
So gleicht auch alles, was sich in jenen Zonen abspielt, den zuckenden Schatten solcher Puppen und gewinnt, trotz altbekannter menschlicher Verstrickung, etwas Unglaubhaftes, Unwirkliches, Verschollenes.
Und alles Exotische ist nur ein Gleichnis.
Die Scheidewand
Djodok schließt die weißbewimperten Augen und fährt noch einmal mit seinen Armen, die doppelt so lang sind als sein Kinderkörper, wie ein erschöpftes Klageweib durch die Luft, als wolle er Unnennbares abwehren. Dann sackt er zusammen, entschlummernd, und läßt noch ein zufriedenes Schmatzen hören, das wie »ok, ok« klingt. Zuweilen zucken seine schwarznägeligen Finger wie tastend, als suche er Zweige um sich zu gruppieren. Solche fehlen auf dem üppigwarmen Schoß der Mevrouw Kehmerdill, und bald tritt völlige Ruhe ein.
Der fette elfenbeinfarbene Arm mit den vielen Goldketten schließt sich mütterlich um den warmen Tierleib; man kann den Puls darin spüren wie ein hastendes Uhrwerk. Und der Kopf der Frau mit den kurzen Zottellocken neigt sich nach vorn. Hierdurch tritt ein Doppelkinn hervor. Sie atmet wie ein langsam bewegter Blasebalg und ihre großen dunklen Augen starren an Djodoks schwarzbesträhntem Rücken vorbei auf den gedeckten Abendtisch.
Der Gibbon hat seine zwei in Milch geschnittenen Bananen artig verzehrt. Es geht ihm also relativ gut. Für Otto zwar ist der Affe ein tragischer kleinerPhtisiker und nur ein hoffnungsloses Zerrbild der menschlichen »Fälle«, deren er übergenug in Behandlung hat. So delikat ist Djodok, daß ihm allein schon der Sprung aus der Treibhausluft der Tenggerberge in das Seeklima Batavias die Lunge bedroht. So äußerst delikat ist er! – Und wenn man ihm fremde Gesichter zeigt, so regt ihn die eigene Gastgeber-Rolle so auf, daß er es mit den Nerven bekommt und stundenlang schluchzt . . .
Wie lang die Frau so dahockt, den Affen umschlungen, in ihrem enganliegenden rohseidenen Kleid, weiß sie selbst nicht. Sie hat sich dies leere Starren angewöhnt; – schon seit Monaten. Prall in den Korbstuhl geschmiegt, sitzt sie schnaubend; ihr Herz kämpft ein wenig unter der Last von Kummer und unter dem massiven Polster, das Herkunft und Klima erzeugt. Die linke Hand, mit klirrenden Bracelets, kraut träge in den Fellsträhnen Djodoks; stumpf blitzen daran einige schlechtgeschliffene Rubine.
Draußen hinter den Hibiskus-Sträuchern des Gartens, im »Pavillon«, brutzelt das Abendessen. Es ist längst gar; die Babu sorgt dafür, daß es nicht erkaltet. Die Gonguhr schlägt halb zehn.
Plötzlich wendet sie den Kopf nach der Veranda. Sie hat das wohlbekannte Knirschen der Autoreifen auf der kieselbestreuten Einfahrt gehört und das leise Ächzen der Steuerung; Nas, der Chauffeur, lenkt den Wagen zur Garage. Diese Geräusche sind ihr vertraut von ungezählten Abenden her; selbst der soeben einsetzende pladdernde Regen kann sie nicht verwischen. Gleichzeitig ertönen langsame, wievorwärtsfallende Schritte, und der Doktor Kehmerdill tritt in Erscheinung. Er kommt über die Strohmatte der Veranda und geht mit einem Grunzlaut, der die Begrüßung ersetzen soll, zunächst in den Ordinationsraum, wo er seine Instrumente deponiert. Man hört Wasser brausen; er wäscht sich die Hände. Mit noch feuchten Fingern bietet er den ihren einen matten Druck. Die Babu, eine duldsam lächelnde Matrone, in bedrucktes Kattun gewandet, und der weißgekleidete Boy Mahil mit genähter, blauer Turbankappe, bringen die Suppe. Während das weiche Geräusch ihrer nackten Sohlen im Raum lebendig ist, schweigt der Doktor. Als sie verschwinden, hebt er sein zerfurchtes Gesicht in den Schein der Hängelampe und seine regenfarbenen Augen öffnen sich angestrengt, während er sie auf die Frau heftet.
»Du bist müde, Otto,« stellt sie mit ihrer etwas kreischenden, metallischen Stimme fest. Mit dieser Bemerkung eröffnet sie die »Unterhaltung« dreihundertfünfundsechzigmal im Jahr.
Er nimmt hastig, als versäume er etwas, ein paar Löffel Suppe. Es ist ein maschinenmäßiges Auf und Ab der feingegliederten dickgeäderten Hand. Langsam wischt er sich den aschblonden Schnurrbart. Dann schenkt er ihr einen gläsernen Blick.
»›Müde‹ ist schon längst kein Ausdruck mehr,« sagt er endlich mit farbloser Stimme. »Täglich fünfzehn Stunden, und das nun seit Jahren . . .« Sein Unterkiefer fällt herab. Sein Mund bleibt halb offen stehn, als sei er erschrocken wie über eine Entdeckung.
»So nimm dir doch den Assistenten von Hamburg,«sagt sie gelangweilt. »Riskier' es doch, in Gottes Namen; die Referenzen sind doch glänzend . . .«
Die Babu und Mahil haben inzwischen das Fleischgericht gebracht, und der Doktor schiebt die Antwort auf. Es gilt ja auch, das halbe Frühstück und das Mittagessen nachzuholen; er ißt mit zäher Hingabe, und wenn er zuweilen an dem Bordeaux-Glas nippt, so nimmt er kauend Gelegenheit, ihr einen nachsichtigen Blick zuzuwerfen. Erst als der Teller geleert ist, läßt er sich zu einer Äußerung herab.
»Jawohl! – Der ›Assistent aus Hamburg‹! – Begreifst du immer noch nicht, daß ich keinen Schmarotzer brauchen kann? – Denn darauf läuft es doch hinaus . . . Ein junger Kerl, der zunächst einmal drei Monate klimaschlapp macht . . . prompt tut er das. Und bis er dann im Training ist . . . Und die Kosten? Wer bezahlt die? Etwa deine Alte mit ihrer Blumenzucht? Ich danke schön; ichdanke. . . Einstweilen bleibe ich hier mein eigener Herr!« – Er holt sich eine Eingeborenen-Zigarette aus der Tasche, eine »McGillavry«, von denen er täglich sechzig Stück konsumiert. Der Boy stürzt lautlos herzu und bietet ihm mit demütig eingezogenem Bauch das Streichholz. – »Vorläufig bin ich mein eigener Herr!! Und wenn ich fünfzehn Stunden schufte, dann will ich es wenigstens zu Hause gemütlich haben! Und kein fremdes Gesicht bei Tisch sehn! – Auch keinenAffen!«
Es ist klar, daß eine dumpfe Irritation ihm diesen Ausbruch diktiert. Eigentlich interessiert ihn Djodok, und er hat das Geschöpf – (als es noch gesund warund noch nicht Sklave seiner Nerven) – gern als Auto-Maskot auf seine Krankenbesuche mitgenommen. Die Frau, wie unter dem Dampfstrahl eines jäh gelösten Ventils, läßt den Kopf sinken. Das feiste Madonnenantlitz wird vom Doppelkinn gebremst. Sie starrt mit ihren dunkelbraunen Augen wie ein beschämtes Kind unter den Tisch . . .
Eine Röte tritt in ihr Gesicht. Diese unschöne Blutwelle gemahnt den Doktor an verhaßte Fiebersymptome aus seiner Praxis. Sein Ausdruck ist nicht übermäßig liebenswürdig. Der schwarz umzottelte Kopf drüben erhebt sich nach einer Pause wieder; die Augen treffen ihn runder als sonst, und greller. Sie ist gründlich aufgerüttelt! – Gleichviel, er wagt heute eine Szene; ja, er wünscht sie als erlösendes Gewitter in dieser Atmosphäre von Arbeit, Nervosität, Schweiß und verregneter Zukunft. Wenn zwei sich in den Tropen streiten: wer hat schuld? Wer nicht? – in diesem Land der winzigen, penetranten Ameisen, des Schimmels, der allgemeinen Klebrigkeit von Dingen und Gedanken? –
Der Affe schiebt sein samtschwarzes, drollig von weißem Bart umrahmtes Greisengesicht spähend unter der Achsel der Frau hervor. Die engsitzenden Augen flackern erwartungsvoll. So der grellen Betrachtung von Weib und Tier ausgesetzt, denkt der Doktor: »Djodok hat weiß GottihreAugen. Vielleicht sind sie doch auf keinem allzulangen Umweg miteinander verwandt . . .« – Und schier unbewußt machen seine Finger eine kleine Kletterbewegung an der Blumenvase . . . Klar ist eins: Doktor Otto Kehmerdill hatnicht allzuviel übrig für Mevrouw Kehmerdill. Dabei denkt er an seinen Freund Heyermans.
Sie würgt nach Worten; ihre Kehle bläht sich. – Dann stößt sie hervor:
»Mißgönnst du mir auchDjodok?«
»Du sprichst,« erwidert er mit einer Stimme, die ihn selbst an knarrendes Blech erinnert, »als ob ich dir je etwas mißgönnt hätte. Du hast es sehr bequem; billiges Personal, mit dem du dich – außerordentlich gut verständigst . . .« Er vergewissert sich, daß der Sundanese nicht in der Nähe ist. Man kann nie wissen, wie weit dessen holländischer Sprachschatz inzwischen gediehen ist. »Du hast einen Haushalt, hast europäische und amerikanische Schmöker; neulich habe ich wieder einen Haufen zerlesener Magazine-Novellen – du kannst dir ausmalen, wo – gefunden . . . Lektüre und Reistafel; der gleiche gesunde Appetit. Wenn du willst, kannst du ja auch deiner Mutter in der Pension helfen; andrerseits steht es dir genau so frei, im Korbstuhle zu liegen und zuzunehmen, während ich beschäftigt bin. Mißgönnt ist dir nichts . . .«
Ihre Kehle wandert; sie schluckt. Der Doktor sitzt steif; seine Stimme hallt lauter.
»Und das Vieh gehört in seineKoje!!« ruft er mit sinnlosem Aufwand. Zur Unterstreichung klopft er mit der Gabel auf den Tisch. »Ich sehe genug von Krankheit; ich verzichte darauf, daß man mir einen siechen Affen zur Gesellschaft gibt . . .« Abschließend, beginnt er mit nervösen Griffen eine Banane zu häuten.
»Du sagst also,« bringt sie endlich heraus, »daß du mir allerlei gönnst, Otto. Jawohl! Fünfzehn Stunden Einsamkeit täglich, und wenn du heimkommst, deine zerrüttete Person und einen Scheffel Grobheit. Ich will doch . . .« – sie tastet mit allen zehn Fingern beschwörend in die Luft –: »ich will doch – Unterhaltung von dir! Ich bin sechsundzwanzig und du stellst mich kalt . . . Was soll ich denn tun? Du willst mich ja nicht . . . Auch meine Mutter sagt, du bist verstockt. Und noch mehr. – Du bist kein–Mann.«
»Aha!«
»Das steckst du ein?! – Wenn ich meinem Bruder sagte: ›Du bist kein Mann‹ – er risse mir die Haare aus . . .«
»Und zöge den Kris!« (Eingeborenen-Dolch.)
Mit einem Schlag sitzt sie still und ihre Röte weicht gelblicher Blässe.
»Wie billig!« stöhnt sie dumpf.
»Aber denkbar,« ergänzt er gelassen. Das ist das böse Etwas zwischen ihnen; die Scheidewand aus zähem Kautschuk, die man nie durchbohrt.
»Denke nicht,« sagt sie auf einmal hitzig, »daß ich deine geschmacklosen Anspielungen auf meine Familie überhöre. Es gibt eine Grenze! – Ich weiß, wer dich gegen uns aufhetzt! – Aber . . .« Und sie reckt ihre starken Brüste vor, daß sie den leichten Stoff spannen – »ich bin nicht schuld daran, daß du kein Mann bist!« Sie bricht lauernd ab und beobachtet ihn.
Hofft sie, ihn zu reizen? – Kehmerdill lächelt wegwerfend. Er steht auf, um auf die Veranda zu gehen,und bestellt sich bei Mahil einen »Split« (Whisky-Soda). Er läßt also auch heute, wie immer, das Gespräch auf seinem dramatischen Höhepunkt ohne Grazie und ohne Echo verpuffen!
Sie fällt in sich zusammen und sitzt eine Weile apathisch. Dann löst sie sich aus dem Korbstuhl und führt Djodok an der Hand in den Garten zurück, zu seinem Bambusverschlag. Der Doktor sitzt auf dem Verandasessel und saugt an dem eiskühlen Getränk. Dabei zittert seine Hand . . . Er flucht, als er etwas verschüttet, flüsternd vor sich hin.
Schleppenden Schrittes geht er in den Ordinationsraum und schließt die Tür hinter sich. Als er heraustritt, scheint er munterer: so, als sei ein Teil der tödlichen Erschöpfung von ihm abgefallen; ja, es ist irgendein Zug um seinen Mund, als habe er seiner Umgebung schnell ein verschmitztes Schnippchen geschlagen . . . Doch bald zeigt sich wieder die Falte des Ekels, als das Tischtelephon schnurrt. Widerwillig tastet er zum Hörer. Er vernimmt eine deutsche Stimme:
»Herr Doktor! – Man hat Sie mir empfohlen . . . Könnten Sie wohl herüberkommen, – zu ›Daendels Hotel‹? Meine Frau ist nicht wohl . . . Eine Vergiftung vermutlich . . .«
Elastisch, als sei er froh, noch einmal seinem »Heim« zu entkommen, steht der Doktor auf und ruft nach dem Chauffeur Nas.
Europäisches
Nas ist dreimal geschieden, das gehört sich so für einen Küstenmalaien, der auf sich hält. Wo unter der Sonne dieser Insel seine verflossenen Gattinnen schwere Palmbastkörbe voll Durianfrucht oder singend empfohlene Limonaden schleppen, ist ihm unbewußt. Ebensowenig ahnt er, in welchem Kampoeng seine von Reisschlamm geschwärzten Kinder sich balgen. Wenn er sich auch dreimal beim Kadi losgekauft, so übernimmt eine nebelhafte Person, gemeinhin Allah genannt, die sich aus seiner animistischen Seele hervorschält, weitere gütige Verantwortung für sein Schicksal. Zurzeit ist er mit der Babu des Doktors vermählt. Nun hockt er, wie immer mit aufgerecktem Oberkörper, angespannt, auf dem Führersitz. Drei seinesgleichen würden, trotz der Kleinheit des Chevrolets, vorn noch Platz finden. Seine nackten Füße sind am Beschleuniger tätig, und seine kleinen Hände, nervig, Stahlklammern voll Feingefühl, spielen mit gewagtem Griff am Lenkrad.
Der Wagen fegt um den Koningsplein herum; rings an den Seiten des ausgedehnten Wiesenquadrats blitzen die Lichterschnüre und erzeugen einen helleren Dunst unter dem schwarzblauen Himmel. Die Hupegrölt und kläfft. Fünf Minuten schnurrender Raserei vergehen, begleitet vom Glockenlärm der einrädrigen Ponydroschken, von aufkreischenden Unterhaltungsfetzen, vom Gelächter und Zungenschnalzen abendlich flanierenden Pöbels . . . Dann schwingt sich der Wagen in die Einfahrt von »Daendels Hotel«.
Der Doktor steigt aus. Im Hintergrund des bestrahlten Ganges, der zum Speisesaal führt, lauert schon ein Boy, der eilig herzurennt und ihm eine Zimmertür zeigt. Auf sein Klopfen wird sie von einem sehr großen Herrn geöffnet, der den Doktor unweit des Bettes zu einem Stuhl bittet. – »Erdbrink, aus Hamburg,« stellt er sich mit monotoner Stimme vor. »Es ist offenbar, wie ich schon sagte, eine Vergiftung . . .« Er schiebt die Falten des Mückennetzes, dessen kahler weißer Würfel dem halbbeleuchteten Raum etwas Totes gibt, auseinander und rafft sie über die Hornhaken: da liegt in braunseidenen Pyjamas das reizvollste Geschöpf, auf das der Doktor je Augen legen durfte. Er hebt den federleichten Arm und tastet daran entlang wie am Hals einer Violine. Der Puls ist schwach und intermittierend. Die Frau, mit geschlossenen Augen, atmet hoch und schnell; zitternd regen sich die mädchenhaften Brüste unter dem nachgiebigen Stoff, unter dem sich der Körper deutlich abzeichnet.
Ihr Alter muß zwischen 25 und 30 liegen. Dieser Leib ist jung; die Erfahrung hat ihn verschont und sich nur mit einer kleinen Falte zwischen den Brauen eingezeichnet, einer leichten Verfinsterung . . . Die19Gesichtshaut, mit einem Hauch von Honigfarbe, ist zart geschminkt. Das Antlitz ruht mit trotzigem Ausdruck, den Mund an den Winkeln gesenkt, in einer Masse ungebärdigen, braungoldnen Haars . . . Die Nüstern der feingebogenen Nase hauchen leicht und schnell unregelmäßigen Atem über die Oberlippe. Man ist versucht, an einen hübschen Knaben zu denken, einen übermüdeten Kammerpagen etwa, der in bleiernem Schlaf ertrunken ist . . . Die schmalen Hüften verstärken den Eindruck.
Der Doktor zeigt bei der ersten Untersuchung nichts als Sachlichkeit. Und doch ist dies ein Ansturm von Lieblichem; das schöpferische Europa in bester Laune, das sich hier unter dem Mückennetz eines tropischen Hotels entpuppt. –
»Speisenvergiftung?« fragt er.
»Möglich,« klingt die Stimme des anderen aus der Ecke des Raumes, monoton, in völliger Hoffnungslosigkeit. »Aber auch möglich, daß es hiermit zusammenhängt . . .« Er zieht eine leere Glasröhre aus der Tasche und reicht sie dem Doktor. »Ich fand dies unter dem Bett.« – Hastig nimmt Kehmerdill die Röhre entgegen.
»Veronal!! – Wieviel Tabletten waren noch da?«
»Mir unbekannt,« flüstert Erdbrink und stößt einen ungeheuren, hohlen Seufzer aus, der einen leisen Dunst nach Alkohol herüberträgt . . . »Es ist nicht das erstemal, daß sie mir einen derartigen Streich spielt. Sie will mich damit necken.« Seine Stimme klingt zerborsten. »Logik ist nie ihre Stärke gewesen . . . Schauerlich extrem ist das alles . . .«
»Lieber Herr, wir dürfen jetzt nicht philosophieren. Wir müssen retten.«
»Gut,« sagt Erdbrink brüsk. »Retten Sie.« Der Doktor starrt ihn kurz an: er erkennt seinen Zustand.
»Setzen Sie sich ins Nebenzimmer; ich werde Maßnahmen treffen.« Und nachdem er den Djonges nach der Apotheke geschickt, setzt er sich wieder an das Bett und versucht, das heisere Flüstern des weißblonden Riesen, das aus dem Nebenzimmer dringt, zu verstehn. Diese Bemühung gibt er bald auf. Seine Jacke beengt ihn. In Hemdsärmeln sieht er aus wie ein Mann, der sich zum Ringkampf rüstet; diesmal gilt es einer ihm vor zehn Minuten noch völlig Unbekannten, die er seit seiner Jugend kennt; ja, ein geheimster, ältester, brünstigster Wunsch hat Fleisch und Bein gewonnen und ist im Bereich seiner Hände . . .
Hier liegt nun dieser Page in Pyjamas, im Veronalstupor, und beschert ihm Rätsel über Rätsel. Er faßt wieder nach dem fadendünnen Puls. – »Ein knappes Rennen wird das,« murmelt er und verflucht sich, daß er es versäumt hat sich gegen die äußerste Eventualität hinreichend zu rüsten. Erdbrinks Worte am Telephon haben ihn den Ernst nicht ahnen lassen. – »Meine Frau ist nicht wohl . . .!« – Wie oft hat er in seiner Praxis diesen gleichen Satz gehört! Und fast immer war es Konstipation oder ähnliches; zu wenig Bewegung; zu fettes Essen . . . Ja, die Unbehaglichkeiten dieser Holländerinnen sind ziemlich eindeutig. Er springt nach bestem Gutdünken mit ihnen um; er legt ihnen Pferdekuren auf oder jagt sie für vier Wochen ins Gebirge . . . Doch das Geschöpfhier neben ihm erfordert mehr Verständnis; das ist kein Fall für Aspirin; eine finstere, eine radikale Angelegenheit ist es.
Während er sie anstarrt, dämmert Vergrabenstes, Tiefstes auf und wird plastisch. Ein Kontakt schließt sich zu einer Leitung, deren Draht ins Unterbewußte mündet. Ein magischer Strom trifft die Wurzeln seines Daseins. Ist sie nur ein kindliches Weib, ein kostbares Spielzeug, mit ihrer Atmosphäre stets bereiter und stets zurückzuckender Körperverheißung? Oder ist sie mehr? Ja, siemußmehr sein, woher käme denn sonst die kühle Süße einer halbbegriffenen Verwandtschaft und des Heimatlichen, das ihn anweht über Jahre hinüber voll greller Sonne und Tropenmüdigkeit?
Kalter Schweiß bricht ihm aus, und sein Herz schlägt dumpfe Warnung. Wieder schließt er die Finger um das seine Handgelenk; fern, wie unter Watte, rieselt das Leben.
Er reißt die Augen weit auf. Unter dem Baldachin des Moskitonetzes kreist eine eherne Stille. Großer Gott, warum hört er nichts? Wo bleibt das Bimmeln der Sados draußen, das Röhren der Hupen? Ihr Gesicht leuchtet wie eine weiße Tulpe. Zwei, drei Minuten sind nötig für dies Rezept; nun dauert es schon Äonen . . .
Er flößt ihr Whisky ein, den er in einer halbleeren Flasche auf der Konsole findet. Gottlob, ein paar Schluckbewegungen; der Körper zittert. Eskannsein, daß sie die Krise übersteht. – Endlich kommt der Boy zurück; Kehmerdill füllt die Spritze und drückt die Nadelin die Vene. Erdbrink kommt schlürfend aus dem Nebenzimmer und stiert herüber.
»Ich denke, wir können hoffen,« spricht Kehmerdill dürr. »Sie wird jetzt einen Dauerschlaf halten; die Injektion wirkt gut. Bei Komplikationen rufen Sie mich . . . Wenn sie aufwacht, Bouillon mit Kognak. Eiswickel, zweistündlich erneuert . . .«
Er geht, kühl grüßend. Im Auto entnimmt er seiner Tasche ein gelbseidenes Tuch, das er aus der Gürtelfalte des braunseidenen Pyjamas entnommen – schlechthin gestohlen! – hat; er drückt es an den Mund und schlürft den Duft.
Das Mischlingstribunal
»Kollege van Affelen? – Hier spricht Kehmerdill. Sie staunen wohl über Ihren Zulauf in den letzten Tagen? – Ja; ich schicke Ihnen meine Patienten. Ich bin erledigt. Ich denke, es wird noch einige Zeit dauern, bis ich die Fälle wieder übernehmen kann. Liefern Sie mir die Patienten dann wieder aus; womöglich im ›status quo‹ . . . Na; Späßchen. Der Raden Nongkalam ist ein kitzlicher Herr; läßt sich schon den dritten Monat um Operation bitten. Mit dem werden Sie energisch. Stellen Sie ihm vor, sein prospektiver Sitz im Volksraad sei vorgewärmt und in Gefahr, zu erkalten. Mit de Vries springen Sie grob um; edler Hiesiger, aber feig; Wassermann positiv. Daß ich Seow Lik Sen loswerde, ist mir erwünscht; behalten Sie den. Aber die alte Quick Bok Aij brauche ich noch. Na, viel Glück, Kollege.«
Kehmerdill hängt den Hörer ein; es ist günstig, daß er den anderen Arzt von seiner Praxis mitprofitieren lassen kann, schlägt dieser sich doch mit sechs Kindern ohne viel Glück durchs Leben. Der Doktor hat um sieben Uhr die Veranda von Patienten säubern lassen.
Am Frühstückstisch, beim Tee, empfindet er ein Übermaß von Sonne im Zimmer und kommt nach einem trägen Gedankenprozeß zum Bewußtsein des leeren Stuhls ihm gegenüber. Schon seit Tagen steht er leer.
Er empfindet weder Frohsinn noch Schmerz. Seine Wehmut stammt aus anderer Quelle: er denkt an ein Hotelzimmer und an ein trotziges kleines Gesicht mit dunklen Wimpern. Und diese gesenkten Mundwinkel fragen ihn, etwas verächtlich: »Was hast du mit deinem Leben gemacht?« Vor dieser Frage verblaßt alles, woran er sich klammert; sein Haus, mit all dem östlichen Porzellan, den Soembawadecken, dem Palembangsilber; sein ganzes Leben verblaßt und seine ganze mit Schweiß und Nervenverfall ausgebaute Karriere.
»Eigentlich,« denkt er, »sind achtunddreißig Grad Fieber ein idealer Zustand.« Er spürt eine schwebende Leichtigkeit; seine Stirn ist heiß wie ein sonnbestrahlter Ziegel. In diesem irrseligen Zustand zieht er ein gewisses Taschentuch aus der Pyjamajacke und schnuppert daran; ein Rüchlein wird lebendig, das in seiner schwachen Mahnung die schaurigsüße Kraft besessen, die letzten Nächte in Orgien von unklarer Sehnsucht und glimmenden Wandelbildern umzuschaffen!
Er setzt sich in den Korbstuhl der glasgedeckten Vorhalle, die den inneren Teil der Veranda bildet. Um ihn dreht sich das sanfte Karussell des Fiebers. Djodok klagt draußen »Wuh, wuh« und rüttelt an den Stäben. Er vermißt seine Morgenpromenade an der Hand der Hausfrau.
»Bleib nur, wo du bist,« denkt Kehmerdill gehässig. Er will diese ungewohnte Ruhe ausbeuten, diesen halben Schlummer seiner Hände, und die Ausschweifungen seines schwimmenden Hirns . . . Von draußen quillt Sonne herein, die wütende Dezembersonne der Regenzeit, die vormittags, vor dem Zwei-Uhr-Gewitter, erbarmungslos sticht. Agaven und Fächerpalmen der Einfahrt stehen reglos. Das näselnde »Quä, Quä« eines Kuchenhändlers verliert sich im staubigen Schwarzgrün der blanken Fikusblätter, zwischen denen der karminrote Schirm eines Flamboyant-Baumes grell und still leuchtet . . . Fernes Dröhnen, Karrenquietschen, Ponytrappeln: ein Vormittag wie tausend andere. Die Tschitschaks (Eidechsen) an der Verandawand rascheln um die Bilderrahmen und schnalzen ihr »Tjak, tjak«.
Plötzlich surrt das Telephon. Er fährt zusammen und nimmt den Hörer. Doch statt der Stimme Erdbrinks trifft ihn ein holländisch gesprochener Satz. »Otto,« spricht ein unreines, schwankendes Organ, »hier ist Mevrouw de Ruyter. Meine Tochter ist bei mir. Um vier Uhr, heute nachmittag, erwarten wir dich zum Tee.«
Die Schwiegermutter! . . . Zwischen seine zottigen bleichblonden Brauen tritt eine Grübelfalte . . . Ach – es muß ja sein.
»Jawohl, Mevrouw,« sagt er höflich. »Ich denke, ich kann es einrichten.«
Was man in Europa Privatleben nennt, spielt sich in Weltevreden fast auf der Straße ab. Von vorn bis hinten stehen die Häuser offen; blankgeputztes, tadelfreies Familienleben wird dem Volk oder dem Nachbarn demonstriert. Der Holländer sehnt sich selbst aus der Phantasiearmut der für wenige Jahre zusammengekauften Magazinmöbel heraus und starrt mit seinen müden Bureauaugen in das »vorüberbrausende Leben« . . .
Für Mevrouw de Ruyter gibt es keine Wechselbeziehung zwischen Straße und Veranda. Sie verbaut sich den Vorgarten mit dichten Schattensträuchern; jawohl, die ganze Schleife der Einfahrt entlang stellt sie chinesische Blumenkübel auf, und um ihrem exzentrischen Wesen die Krone aufzusetzen, verkriecht sie sich, wie eine Hexe, die verschmitzte Gewebe spinnt, hinter das Haus und empfängt ihre Besuche dort. Doch ist das Garn harmlos, das sie spinnt, denn sie gibt einen Pensionstisch an sechs bis acht Leute, ohne sie gerade zu überfordern.
Eigentliche Quelle ihres Einkommens ist Blumenzucht. Zu jeder Gelegenheit in erreichbarer Nähe schickt sie ihre Produkte. So hat sie nicht schlecht zu leben. Ihrem längst verstorbenen Mann hat sie eine Reihe verwegen blickender Söhne und bildschöner Töchter geboren. Bis auf Mevrouw Kehmerdill sind diese Töchter nach auswärts verheiratet; von den in Batavia ansässigen Söhnen ist Hendrijk Lehrer in der »Stovia«, dem medizinischen Lehrinstitut für Eingeborene, und Peter Notar im Vorsitz des »Indoeuropäischen Verbandes«.
Kehmerdill durchschreitet den Gang zum Speisezimmer. Es ist lange her, daß er sich hier nicht mehr gezeigt. Ist die dämmrige Wohnung ohnedies schon vollgepfropft mit Europa-Möbeln der schlimmsten Periode – schon Mijnheer de Ruyter, der sein »van« gegen ein »de« eingetauscht, hat zu seiner Zeit einer eleganten Lebensführung gehuldigt –, so wirkt der Reichtum an Blumenvasen vollends erdrückend. Auf jedem Mahagonibord, jeder Kredenz, jeder Kommode blitzt Messing, drängt sich chinesische Dutzendkeramik an deutsches Fabrikporzellan, und diese Deckchen überall! Diese Amoretten in Perlstickerei! Dieser zersetzte Orient, der ihm entgegenquillt! Ha! Diese Öldrucke: Orgien von Rosa unter Zephirschleiern und »südlichen Himmeln«! Und dazwischen wieder etwas Schönes, Echtjavanisches . . . Qualvoll zwecklos . . .
Er muß eine Beklemmung überwinden, denn es steht ihm ein Kampf bevor mit Leuten, in deren Köpfen der Begriff »Behaglichkeit« solche Form annehmen kann. Wind muß er hineinblasen in diese unsauber-altmodische Würde, das gespreizte Milieu der füufundsechzigjährigen indischen Matrone. Wie kam es nur, zum Teufel, daß er dies vor zehn Jahren so wenig empfand! Er hat Antja herausgeholt und auf eigene Füße gestellt, doch es hat nichts geholfen; mit allen Fasern ihres Wesens ist sie hier hängen geblieben.
Er schreitet aus der Glastür in den Hintergarten. Auf der Treppe drängen sich Blumentöpfe, stapeln sich Kränze. In der feuchten Glut hier gedeiht ein Farbenwirrwarr. Rabattenförmig geordnet streckensich parallele Bambusgestelle in die Gartentiefe. An den Drähten hängen breitmaschige Bastkörbe oder schimmelnde Rindenbündel voll weißer, gelber oder violetter Orchideen. Aus all dem quillt ein Duft, der Schwindel erzeugt; ein Gemisch von Humusmoder und penetranter Süße.
Als er das Labyrinth ganz durchdrungen, steht er vor einer Gruppe von Menschen, die unter dem Wellblechdach, am Beginn des asphaltierten Ganges zur Küche, Tee zu sich nehmen. Das erregte Gespräch verstummt flugs, als sie ihn sehen. Kehmerdill erkennt die gesamte in Batavia ansässige Familie. Aha, er soll also heute vor ein Tribunal kommen. – Peter und Hendrijk sind breitschultrige Menschen mit massiv geschnittenen gutmütigen Gesichtern. Wären sie blond und weiß, sie würden als »Pioniergestalten« Aufsehen erregen. Die schwarzen Haare jedoch, die schlaffe Attitüde, das fahle Kaffeebraun der Hautfarbe, die weichen, entgleitenden Händedrücke sagen dem Kenner sofort, daß er es hier mit »Indos« zu tun hat, mit Mischlingen, die mindestens zur Hälfte malaiisch sind . . . Der Großvater de Ruyter hat sich seine Frau aus Soerakarta geholt, und da die dortigen Javanen Urabkömmlinge von Hindus sind, so ist es ja eigentlich (wie Kehmerdill damals meinte, als er Antja zu sich nahm) eine »arische Familienangelegenheit« gewesen . . .
Diese Auffassung hat sich bei ihm verloren.
Als er Antja heute bei ihresgleichen sitzen sieht mit flammenden Augen, die mattweißen Hände im breiten Schoß geballt, wird ihm ihre Ähnlichkeit mit Brüdernund Mutter deutlich wie nie. Sie ist einfach die weibliche Ausgabe der hübschen, großen, schlaffen, feisten Männer. Und während er sich kopfnickend niederläßt, denkt er blinzelnd: »Das hat nun jahrelang neben mir Fett angesetzt, und ich hab' es ertragen, wie ein schlechtes Bild im Zimmer. Das Bild gefiel mir anfangs; längst aber mußte es vom Haken herunter. Hier ist sie zu Hause.«
»Eh . . .!« – Die Alte gibt ein zerborstenes Lachen von sich und reicht ihm ihre Hand hinüber, an deren verrunzeltem Mittelfinger ein dicker Schlangenring sitzt. Kehmerdill beugt sich vor und überwindet sich zu einem Handkuß. »Ist das auch noch eine Hand?« denkt er. »Das ist ja ein Tschitschak!« Die kleine Hand entgleitet ihm glatt und kühl, und nun reichen die Brüder ihre großen warmen Pranken herüber. Antja begrüßt ihn kaum. Mit hochgezogener Kopfhaut und großen Augen, die leblos, wie gemalt im gepuderten Gesicht sitzen, starrt sie ihn an. Man lächelt von allen Seiten; überall trifft der Blick Kehmerdills auf sonnig gelüftete Gebisse. »Prächtige Zähne habt ihr,« denkt er verdrießlich. Er versucht zurückzulächeln, doch dieser schwache Abglanz wird von seinem hängenden Schnurrbart halb versteckt.
»Da ist er ja, der böse Mann!« spricht die Alte endlich, und ihre Augen verkriechen sich hinter geschwollenen Lidern. Es gibt Schnitzereien ans Seifenstein, die ihr ähnlich sehen. Ein Wölkchen zieht über die Szene, das Lächeln ringsum erlischt. Die Alte räuspert sich unrein und schlürft ein Schlückchen Tee,das nach Jasmin riecht. Sie bewegt den Kopf wie eine witternde Schildkröte.
Kehmerdill gibt sich einen Ruck, bietet Zigaretten an und bringt ein Gespräch in Gang. Man spricht über Politik. Peter, als »Vollholländer«, verteidigt die Regierung und hat wenig Verständnis für »Home Rule«. Hendrijk jedoch schwört auf Limburg-Stirum und auf eine fortschrittliche »christlich-ethische Innenverfassung«. Sie schnauben und geraten sich darüber, unter großem Wortschwall und vielen Gesten, fast in die Haare. Kehmerdill wirft ab und zu ein Wort hinein, das beiden Standpunkten gerecht zu werden scheint. Er sitzt ja selber am Pulverfaß und hat kein Interesse daran, den Gegensatz zu schüren. Der »Vollholländer« Peter beschlagnahmt ihn bedingungslos für sich; das fühlt er und spürt einen faden Geschmack im Mund. Immer heißt es »wir« dabei, oder »uns«. – Plötzlich geschieht ein Knall.
Eingeschüchtert blickt man auf die Matrone. Sie hat wie ein Zeremonienmeister zur Eröffnung des offiziellen Teiles der Sitzung ihren Malakkastock auf die Fliesen gestoßen. Ihr Kiefer schiebt sich vor, ihre Augen sind trüb glitzernde Ritzen.
»Wir sind nicht zusammengekommen,« spricht sie mit wankender Stimme, »um zu politisieren. Oder denkst du, Otto, es sei nur ein hübscher Zufall, daß meine Söhne zugegen sind? – Denkst du, ich hätte telefoniert, damit der Verkehr nicht einschläft?«
Kehmerdill pafft stark. »Ich habe Fieber, Mevrouw,« erwidert er fast schmeichelnd. »Ich freue mich, daßSie sich meiner erinnern. Eine Tee-Einladung ist nicht problematisch. Daß Peter und Hendrijk hier sind, tut mir wohl, ohne mir den Kopf zu verdrehen.« Die Männer schnalzen leise mit den Zungen und wiegen die schwarzen Scheitel.
»Ha! – Du willst es glatt und schön, und bringst Handschuhe mit. – Wir wollen Tee trinken, gewiß. Wir lieben uns alle untereinander. Das ist doch so, nicht wahr, Otto?«
Kehmerdill schweigt. Er kratzt sich mit dem tabakgelben Nagel des Zeigefingers an der Rinne der Oberlippe.
Die Alte bewegt sich heftig im Korbstuhl; dieser kracht. Sie hebt den Krückstock und deutet damit auf Antja. »Da sitzt deine Frau,« spricht sie, und ihre Stimme geht modulierend in ein leises Kreischen über – »da sitzt einegebrocheneFrau, Otto . . . und diese ist – meine Tochter!!«
Kehmerdill schweigt weiter. »Wer sind diese Leute?« muß er plötzlich denken . . . »Was wollen sie eigentlich von mir?«
Endlich sagt er kurz: »Sie erzählen da nichts Neues, Mevrouw. Es scheint, man hat vor, theatralisch zu werden. Also nehmen Sie kein Blatt vor den Mund.«
Die Alte atmet stark. Ihre Zehen krümmen sich in den offenen, mit schillernden Metallplättchen bestickten Sandalen. Tastend streicht sie sich den Sarong glatt, den sie innerhalb des Hauses zu tragen pflegt – eine Ranken- und Blätteraffäre in Ziegelrot und Ocker – und bringt die Hand mit ratlos bebenden Fingernan den mächtigen Schildpattkamm am Hinterkopf. Sie blickt um sich; aber die Söhne springen ihr nicht bei. Sie schnalzen nur wiederum leise mit den Zungen. Plötzlich sagt Antja: »Er hat keinen Respekt vor Ihnen, Mama. Dabei ist er aber fast noch höflich. Sie sollten ihn nur hören, wenn er . . .« Sie gerät ins Schlucken, und ihre gemalten großen Augen verschleiern sich.
Der Doktor begreift immer deutlicher die Harmonie in dieser Verschwörung.
»Wenn er was?« schnauft die Alte.
»Wenn er mich anfährt, Mama, ohne Grund und Sinn . . . Oh, er macht mit mir, was er will. Weil ich zugenommen habe, weil ich mit Djodok spiele, weil ich eine schlechte Hausfrau bin und seine Gäste nicht unterhalten kann. Weil ich ungebildet bin. Weil ich keine Kinder kriege.« Dies alles stößt sie ruckweise hervor.
»Du hast vorhin gesagt, daß ich theatralisch bin, Otto,« beginnt die Alte nach unreinem Räuspern. »Du bist salopp . . . aber ich will dir ruhig erklären, was uns an dir nicht mehr gefallen will. Du besuchst uns nie. Vom Koningsplein zum Waterlooplein ist es nicht bis zum Ende der Welt. Auch deine Schwäger vernachlässigst du, besonders Hendrijk, an den dich doch gleiche Interessen fesseln . . . Und daß Antja keine Kinder kriegt, ist nicht ihre Schuld . . . Du näherst dich ihr nie in zärtlicher Absicht, das ist es!« –
»Ich habe keine Zeit, Mevrouw. Ich bin übermüdet.«
»Seit zwei Jahren schlägt man dir vor, einen Assistenten zu nehmen. In Europa gibt es genug.«
»Der Assistent kostet zweitausend Gulden Überfahrtsspesen und tausend Gulden Gehalt monatlich.«
»Wenn ich an meinen seligen Korneelis denke, der hätte sich nicht besonnen. Der war großzügig . . .«
»Sie werfen mir Geiz vor, Mevrouw. Aber das ist es nicht. Ich kann es ja schaffen ohne Hilfe.«
»Aber deine Frau, Otto, geht darüberzugrunde!!« stößt die Alte höchst erregt hervor und deutet wiederum mit dem Krückstock nach der Tochter. – Kehmerdill sieht sich diese Frau an, die zehn Jahre neben ihm gelebt, mit ruhiger Abschätzung, als betrachte er ein Möbelstück. Das Fieber stimmt ihn gleichgültig und verhindert, daß er über sich selbst erstaunt. Das sanfte Karussell beginnt wieder; die ganze Gruppe auf ihren Korbstühlen bewegt sich sprunghaft nach links, und die alte Frau, über Meilen hinweg, aus fremder Sphäre, deklamiert eine eingelernte Rolle. Es ist ja alles restlos logisch, was sie vorbringt. Aber kann dies animalische Geschöpf dort drüben, Antja, mit ihrer elfenbeinfarbenen Haut, mit ihren runden Armen, mit dem Doppelkinn und den rollenden indischen Augen wirklich »zugrunde« gehen? Die Vorstellung kommt ihm plötzlich spaßhaft vor. Er lacht.
»Damit hat es noch gute Weile, Mevrouw. Antja ist gesund und noch jung. Sie kann sich amüsieren, soviel sie will. Peter und Hendrijk werden sich ein Vergnügen machen, sie ins ›Des Indes‹ zu nehmen, oder ins ›Koningsplein‹ . . .«
»Aber sie will mitdirgehen,« spricht die Alteknarend und mustert ihn aus ihren trüben Chinesenaugen. »Und sie will in die ›Harmonie‹.«
»Sie wissen selber ganz gut, Mevrouw,« spricht Kehmerdill kühl, »daß das seine Schwierigkeiten hat. Selbst wenn ich Zeit und Lust hätte, – es gibt da gewisse Vorurteile . . .«
Peter und Hendrijk fahren zusammen, wie von Nadeln gestochen; ihre Gesichter werden zu ausdruckslosen Masken. Die Alte scharrt mit dem Stock; Antja bläst kurze Luft durch vibrierende Nüstern. Kehmerdill merkt den Aufruhr. In der Hemmungslosigkeit des Fiebers, das leise in seinen Ohren singt, steht er auf, steckt die Hände in die Hosentaschen, und sieht immer noch kühl auf die Gruppe hinunter. »Ja, – ist denn das etwas Neues für euch? Ihr zerrt mich hier vor euer Tribunal, ihr sitzt zu Gericht über mich, ihr schreibt mir allerhand vor, und ich soll zu allem Ja und Amen sagen . . . Geiz werft ihr mir vor, schlechte Behandlung Antjas . . . Mevrouw, ich glaube, Sie verkennen Ihre Lage.«
Die Alte sinkt wie geschlagen in ihren Stuhl zurück.
»Das geht zu weit, mein Lieber,« sagt Peter. Antjas Oberlippe hat sich gelüftet, ihre Zähne sind aufeinandergesetzt, als wollten sie etwas zerknacken. Sie zischt: »Ihr habt es mir ja nicht glauben wollen. So ist er. So sind seine Freunde. Das ist seine Meinung von euch und mir.«
Die Alte öffnet die Augen, die sie geschlossen hat. »Ausreden sind das,« murmelt sie, »für seinen eklatanten Egoismus, für seine Bequemlichkeit, für seine Verantwortungslosigkeit . . .« Sie sieht sich hilflos umund schenkt dann dem Doktor wieder einen Blick, in den ein Ausdruck des Bettelns, des Überwundenseins tritt. »Ich weiß ja, er ist kein schlechter Mensch . . . Er ist nicht geizig; übertrieben sparsam, kommt mir vor . . . Man hat ihm Dinge in den Kopf gesetzt . . .«
»Heyermans!« zischt Antja.
»Dinge hat man ihm suggeriert, sage ich . . . Ich bin fünfundsechzig, ich durchschaue die Naturen . . . Ich will, daß meine Tochter Freude vom Leben hat, ich will Enkelkinder . . .« Und ohne sich aufhalten zu lassen, überraschend elastisch, steht sie auf und humpelt ins Haus. Mit einem Entschluß schlägt sie sich gleichsam eine Bresche durch all dies widrig Unverständliche hindurch. Die vier Menschen rühren sich nicht. Als sie wiederkommt, hält sie etwas mit ihrer altersfleckigen Faust umschlossen.
»Hier, nimm! – Damit du nicht sagen kannst, daß alles von dir kommt! – Hier hast du den Assistenten! – Das macht dir deine Frau wieder schmackhaft! – Hier hast du Kinder! – Hier hast du Zeit!« Drei Tausendguldenscheine entblättern sich zwischen ihren halbgeöffneten Fingern.
Kehmerdill weicht zurück und faßt sich an die Stirn. Dies ist mehr als unerwartet, es ist pathetisch.Wollendiese Leute nicht begreifen? Endlich bringt er hervor: »Setzen Sie sich doch, Mevrouw. Es ist nicht das Geld. Sie zwingen mich ganz offen zu sein. Nun also: ich glaube nicht, daß ich auf die Dauer mit Antja glücklich sein kann. Es ist das beste, wir trennen uns. – In Güte.«
Das gefürchtete Stichwort ist gefallen. Antja stehtauf und geht ins Haus. Drinnen entlädt sich ihr Jammer in langgezogenen Tönen.
»Und was – –« fragt die Alte mit zerborstener Stimme, »hast du ihr vorzuwerfen?« – Die Geldnoten flattern langsam unter den Tisch, niemand hebt sie auf.
»Nichts,« spricht Kehmerdill. »Und ich übernehme die Folgen für meinen Entschluß.«
Die Alte blickt stumm, wie lauernd, ihre Söhne an. Doch deren Gesichter sind völlig eingefroren. Hendrijk sagt leise: »Nun ist es ja klar, aus welcher Ecke der Wind bläst.«
Kehmerdill geht ohne sich umzusehen. Er hat die Brücke zertrümmert; und in seinem Rücken, in der süßdumpfen Atmosphäre dieses Gartens, grübelt das Verhängnis. –
Koos
Lackpumps an weißbesockten Füßen, in makellos gestärktes Leinen gekleidet, entsteigt der zwei Meter hohe Beamte der »Secretarie«, Heyermans, seinem »Fiat«. – Hände in den Hosentaschen, wandelt er ins Haus des Doktors. Daß er nicht als Patient kommt, sieht man ihm an: er setzt dem Klima eine strotzende Gesundheit entgegen.
So blond ist Heyermans! – Eine weißblonde Haarkappe schimmert über dem roten rasierten Gesicht; blondes Fell trägt er auf den Handrücken und sogar noch auf den Fingern. Seine saphirblauen verschmitzten Augen im langen Gesicht und seine pferdeartig lange Oberlippe machen ihn zum typischen Vertreter eines rauflnstig-bequemen, vollblütigen Patriziertums. Indem er sich in den krachenden Korbstuhl wirft, bestellt er sich eine Erfrischung beim aufwartenden Mahil, als sei er hier zu Hause.
Kehmerdill ist mit den Vorbereitungen für seinen späteren Gesellschaftsabend fertig geworden und kommt aus dem Hintergrund. Seine Augen blitzen hektisch im kalkfarbenen Gesicht. Nicht über Mittelgröße, wirkt er auf den ersten Blick neben seinem hünenhaften Freund fast belanglos. Sieht man aber genauer zu,so erkennt man, daß das Leben seine Züge bedeutend schärfer gezeichnet hat, als die des harmlosen »Pionierpatriziers«. Gleicht nämlich das Gesicht Heyermans' einer Delfter Landschaft, schlecht und recht, mit friedsamen Windmühlen, so bietet das Kehmerdills den Anblick eines verstürmten Gebirgstales.
Der Doktor hat es mit seiner Karriere ziemlich schwer gehabt. Deutsch geboren, hat er eine stets wachsende Konkurrenz niederkämpfen müssen, bis er beschloß, sich naturalisieren zu lassen. Hätte er es nicht getan: der Krieg, anstatt ihm nur vorübergehend einige anglophile Patienten zu rauben, hätte ihn weggefegt. Heyermans, dem sein Heimatländchen zu eng gewesen, hat die Sprossen in dieser Militärbürokratie unbehindert, voll breiten Humors trotz Hitze und verworrener Innenpolitik, erklettert – Hände in den Hosentaschen, genau so wie er heute daherkommt.
Kehmerdill setzt sich nicht, sondern nach einer zerstreuten Begrüßung fährt er fort, auf und ab zu wandern. Der Himmel draußen sticht grell orangefarben durch das Laub: es schlägt sechs. Die Gäste sind auf neun gebeten, – die offizielle batavische Besuchszeit. So hat er drei Stunden frei, um sich die Seele mit Hilfe des hereingewehten Freundes zu entlasten; bei Heyermans, dem guten Zuhörer, kommt es sicher dazu; das ahnt er. Das periodische Fieber ist überwunden; zur Vorsicht nimmt er noch Chinin und hat sich heute sogar ein gewisses Stärkungsmittel gestattet, dem er in letzter Zeit verdächtig häufig unterliegt. Es gehört kein großer Scharfblick dazu, um ihm einen ungewöhnlichen Zustand anzusehen; so schlägt dennauch Heyermans auf die Stuhllehne und spricht: »Gottverdammich . . .«
Kehmerdill macht halt. »Aha,« sagt er mit farbloser Stimme, – »du merkst was.«
»Ich merke bloß, daß du gegen den Strich gekämmt bist. – Wo steckt Antja?«
»Antja? – Ho, Antja . . . Gratuliere mir. – Ich bin sie los.«
Heyermans macht eine Bewegung, als wolle er aufstehen, und pfeift durch die Zähne. – »Gutwillig?«
»Nun, es gab natürlich ein Theater. – Ich hab' sie einfach in den Schoß ihrer farbigen Familie abgeladen. – Du siehst ja, ich bin kaputt.«
Er blickt etwas schief und lauernd zum Freund hinüber.
»Das ist bös,« murmelt Heyermans. »Warum hast du es ihr nicht langsam, stufenweise, abgewöhnt, mit dir zu leben? So aber, von heute auf morgen . . . Du wirst es auszubaden haben.«
Kehmerdill stellt sich vor ihn hin und sieht ihn aus seinen fiebrigen Augen an, beide Fäuste gegen die Schläfen gepreßt.
»Koos,« sagt er mit heller Stimme – »was habe ich nicht alles versucht, damit siemeinersatt wird! – Aber es ist phantastisch, welch dicke Haut diese Indos haben! – Ich habe sie, Gott verzeih mir's,en canaillebehandelt. Immer hoffte ich und hoffte, sie würde mir den Fehdehandschuh hinwerfen – aber ich muß dir sagen: das ganze Weibsstück besitzt nicht mehr Selbstachtung als ein Rikschakuli. Eine andere wäre schon Jahre vorher weggelaufen. Aber40diese Antja ist blind . . . Oder will blind sein . . . Also sie bleibt, sie lutscht Pralinés, sie sieht ein wenig nach dem Rechten, nach meiner Küche, ja . . . sie sitzt hilflos vor guten Büchern, und schläft ein, wenn man Ansprüche an ihr Hirn stellt. Aus ihrem täglichen Kino, wo sie des Denkens enthoben wird, bringt sie keine Anregung mit. Auch nicht aus dem Badetümpel. An amerikanischen Magazineschmökern findet sie vielleicht noch träges Gefallen und schwatzt dann unsicher darüber . . . Über dem Modespiegel brütet sie stundenlang . . . Jedes Gespräch endet in einer Blamage für meine Hoffnungen. Da kannst du säen, jahrelang, und erntest Lava. Das Weib ist steckengeblieben, sag' ich dir . . . Schauerlich ist sie im Rückstand. Seit ihrem neunzehnten Geburtstag hat sie keinen Schritt vorwärtsgemacht, und was mir damals entwicklungsfähig schien und hurtige Intelligenz, war nur Zweck und Schauspielerei. Da hast du den ›Labetrunk meiner Seele‹, da hast du meine Erholung und Zerstreuung; das ist sie. Und deswegen mußte ich Schluß machen.«
»Vielleicht hast du dich doch zu wenig mit ihr abgegeben . . .«
»Zwei Jahre lang hab' ich's probiert, weiß Gott, ihr Interessen beizubringen . . . aber sie reagierte nur – mit dem Körper.« Er lacht tonlos.
»Du warst eben ein Esel,« sagt Heyermans beruhigend. »Es ist schade, daß wir uns damals nicht kannten. Ich hätte mich sonst wohl rechtzeitig mit dem Holzhammer eingefunden und dich aufgeklärt. Du gibst also zu, daß sie verdammt hübsch war, und41daß du in das Projekt ihrer Familie hauptsächlich deswegen hineingestolpert bist. Jetzt kennst du diese Rasse; spät genug bist du dahintergekommen. Ziemlich schwimmen lassen hast du dich, mein Lieber. Deine Beweggründe in Ehren – aber diese gewaltsame Regulierung, die du arrangiert hast, ist verkehrt. Schließlich hast du sie doch geheiratet.«
»Was blieb mir übrig? Du kennst doch selbst die Konventionen in eurer Krämerkolonie. Aber sie war zu hitzig; sie wollte unbedingt Kinder. Das bekam mir nicht. Ich habe immer gebremst.«
»Toll aggressiv, das sind sie ja; da hast du recht. Das verstehe ich.« Heyermans lacht ein großes gesundes Gelächter. »Die wissen, was sie wollen . . . Deshalb haben sie uns auch die vielen Kuckuckseier hineingesetzt. Die Kolonie geht noch darüber kaputt, wenn ich und meinesgleichen nicht dauernd dagegenbohren . . . Wir sind hier schon mit allen Nuancen von Braun schattiert. Wenn das nicht anders wird, sind wir in fünfzig Jahren dauernd blamiert und können unseren östlichen Verwandten endgültig das Feld räumen. Schließlich soll dieser schönbestellte Garten kein Mischlingsparadies werden, mit all der Verfahrenheit und moralischen Zersetzung wie in Saigon und Macao . . . Reinlich, zum Teufel, muß das nebeneinander hausen, Weiß und Braun. Es ist eine Gemeinheit, wie wir uns verzetteln und unsere guten, soliden Pioniernamen bis in die Kampoengs tragen . . .« Sein Kiefer schiebt sich vor; seine prächtigen Zähne setzen sich hart aufeinander. »Ich hab' ja nichts gegen das Volk. Gott will es so, wie es ist; und42sympathisch ist es mir auch in seiner Art. Aber wir dürfen uns das Heft nicht so schlapp aus der Hand winden lassen, wenn das auch bei achtunddreißig Grad Celsius und hübschen Weibern schwer ist. Die Engländer bringen es fertig, einen Punkt zu machen; warum nicht wir? Das ist keine saubere Sache mehr; das bringt uns in die beliebte schiefe Lage. Wenn unsere Eingeborenen als unverfälschte Patrioten, wenn auch mit drolligen Mitteln, ihre Interessen wahren, so begreife ich sie vollständig; ich hätte auch eine Wut, wenn man mich enteignete, kontrollierte, mit lächerlichen Taschengeldern abspeiste . . . Ich bin aber europäischer Kapitalist, ho, ho, Kulturträger, Eckpfeiler; was soll ich machen gegen mein besseres historisches Selbst . . . Wenn man einen fragwürdigen Indo gegen mich ausspielt, der womöglich auch Heyermans heißt und von der ›Heimat an der Schelde‹ faselt, dann wehre ich mich.«
»Erfrischend bist du, Koos . . . Schenk' dir ein. Also ich freue mich, daß ich schließlich in deinem Sinn gehandelt habe. Einen Indo namens Kehmerdill gibt es nicht. Jetzt ist alles in schönster Ordnung.«
Heyermans starrt ihn an. »Mann,« bellt er plötzlich, »schmeichle doch den Tatsachen nicht so greulich! Den Fuß hast du herausgezogen – aber es hängen noch Widerhaken genug an deiner Hose. Meinst du etwa, man kehrt dort drüben friedlich zur Blumenzucht zurück?« – Er deutet mit dem Daumen in die Richtung des Waterlooplein. – »Laß dir das Essen vorschmecken, wenigstens für die nächste Zeit, und sei mir nicht bös, wenn ich meinen Whisky selbermitbringe . . . Nun, werde nicht nervös, sie heißen ja schließlich de Ruyter‹ und sind ›Europäer‹ –.« Seine Stimme lenkt ein. »Daß du keine Kinder hast, ist eine Mischung von Egoismus und Dusel. Denn im Bett wirst du dir kaum politische Skrupel gemacht haben. Jetzt wollen wir aber zur Hauptsache kommen. Wenn ich nicht Heyermans wäre, so würde ich mir sagen, du hast mir alles zufriedenstellend motiviert. Ich bin aber schlauer. Du hast mir schon einmal mit deinem Serum über den Berg geholfen. Du darfst ruhig mit der Sprache herauskommen. – Was ist denn dereigentlicheAnlaß zu dieser ganzen Geschichte?«
Kehmerdill blickt hurtig auf. Die Zigarette entgleitet seinen Fingern und glimmt auf der Bastmatte weiter. Heyermans' mächtiger Fuß kommt herüber und tritt sie tot. Wie mit gelähmten Lippen wiederholt der Doktor: »Der –eigentlicheAnlaß?«
»Das meine ich,« bestätigt Heyermans gemütlich. »Man wirft doch eine Frau, mit der man zehn Jahre zusammenhaust, nicht so halsüberkopf hinaus. Dazu hat man schon einen ganz speziellen triftigen Grund. Von dem hast du noch nichts gesagt.« Kehmerdill erhebt sich, rennt dreimal um den Eßtisch, und setzt sich dann, zitternd wie im Frost, wieder hin. Seine Augen wandern langsam, prüfend über den Freund, um sich wie beruhigt wieder zu schließen. Er atmet aus, als stoße er mit diesem Atemzug eine Last von sich.
»Weiß Gott,« flüstert er, »du bist ein Satanskerl, Koos.«
Er nimmt einen großen Schluck unverdünnten44Whiskys. Erwärmt, schier munter, beugt er sich vor und spricht mit dozierendem Zeigefinger: »Wenn du zehn Jahre lang geschuftet hast, und man hat dir Scheuklappen vorgeschnallt, und du hast dein Menschentum eingebüßt in dieser Tretmühle von Klebrigkeit und Hitze und du bist ganz verödet, verblödet, und jämmerlich anspruchslos, und auf einmal kommt jemand mit einem Spiegel, und zeigt dir die Kreatur, die du bist . . .was tust du dann? Du haust um dich, wie? –«
»Wo kann man diesen Spiegel zu sehen bekommen?« gibt Heyermans zurück. »Gib mir doch bitte die Adresse . . .«
Kehmerdills Gesicht überzieht sich mit gleichmäßigem Scharlach, seine Augen blinzeln. »Das sieht dir ähnlich. Immer der große Draufgänger . . .« Er lacht, mit gleichsam wegwerfendem Humor, und patscht sich mit der flachen Hand aufs Knie. –
»Als alter Pionier gehst du aufs Ganze. Sie wohnt übrigens im ›Daendels‹; seit einer Woche ist sie hier. Wie es weiter sich entwickelt, weiß niemand. Soviel weiß ich aber –« und er zupft am Strohgeflecht des Stuhles – »daß die Frau mir bitter nötig ist; daß sie um meinetwillen herkam. Das ist die höhere Absicht, verstehst du; wir kennen sie nicht. Sie trieb hier an Land, weil ich sie brauche. Und wenn sie nicht mein wird, so ist das radikal falsch; so liegt das unmöglich in der höheren Absicht.« Er beginnt zu stottern und zupft heftiger am Stuhl. – »– Und heute abend hab' ich beide eingeladen; heute kommt sie hierher . . .«
Heyermans' mächtige weißblond bewachsene Pranke45landet auf seiner Schulter. Er hat etwas nie Geschautes in der Miene des Freundes gemerkt. Er erhebt sich.
»Cheer up, Alter,« sagt er voll Bonhomie. »Ich denke, du willst dich noch ein wenig vorbereiten auf deinen Besuch, und ich lasse dich lieber jetzt allein . . . Morgen überfalle ich dich wieder. Sag deinen Patienten ab; ich will dich nach Buitenzorg schleifen auf einige Tage . . . Ich habe sowieso Urlaub fällig. Ausspannung brauchst du, gottverdammich. Ausspannung für –« (er schlägt sich auf den Brustkasten, daß es knallt) – ». . . fürdashier.«46
Der Raden Kusuma
Eigentlich – (und hier ergreift der Berichterstatter von des Doktors Verwirrungen selbst das Wort) – müßte man dem Raden Kusuma den ganzen Schwanz von Titeln gönnen, den er als Erbe des ausgemerzten Fürstentums in Westjava hinter sich herschleppt. Er hat ein halbes Dutzend von Namen, die sich künstlerisch steigern, um in Mangoenkoesoema auszuhallen. – Nun, der Einfachheit halber: nennen wir ihn »Kusuma«.
Kein weißer Tropfen rinnt in ihm. Er ist ein schlanker Mann von etwa Dreißig, mit einem Schauspielerkopf. Sein hellbraunes Gesicht ist von Natur bartlos. Mit seines Schöpfers feinstem Pinsel hingesetzte Brauen steigen rund in die glatte Stirn; seine Augendeckel, bläuliche Blätter, sind leicht bepudert, und unter diesen feindurchbluteten seidigkrausen Kapseln rollen Augen von flüssiger Schwärze. Ihr Dunkel verschmilzt mit dem Wimpernkranz, wenn er lächelt; dann zieht er gleichsam den Vorhang zu einer Ritze, hinter der die schwebend grübelnde, selbstbeherrschte Anmut seiner Rasse wetterleuchtet.
Sein Wagen ist leise knirschend vorgefahren; jetzt tritt er ins Haus. Er ist europäisch, in einen47rohseidenen Anzug, gekleidet. Seine Hauptfrau, die ihm alle Nebenfrauen ersetzt, anscheinend sein Augapfel, wandelt ihm seitlich voran – leicht schwellen die Hüften unter dem kaffeebraunen Sarong, fallen die winzigen Füße in ausgeschnittenem Brokat auf die Stufen . . . Sie trägt eine gestickte Bluse und streckt die beweglichen Finger an steif gehaltenen Armen von sich, als raffe sie einen Rock. Sie wandelt im Dunst eines stillen, starken Parfüms, und ihre Augen leuchten wie Lampen.
Dies liebenswürdige Ehepaar kommt pünktlich um neun Uhr. Kehmerdill begrüßt sie; man nimmt Platz. ›Es ist heute,‹ denkt er, ›vielleicht zweckdienlich, den Großhändler mit diesen Leuten bekannt zu machen. Das wird ihn absorbieren.‹ – Mahil und Nas, der heute mitserviert, bringen allerhand angeschleppt auf Silberschalen: Nüsse, Krokant, Pralinés und Käsestangen, und Kusumas Frau, die Ratu, bedient sich wie ein Eichhörnchen. Ihres Gatten Zähne zermalmen eine kandierte Mandel, und als er sie artig geschluckt, – (eine Zeitspanne, die er zum Beobachten ausnützt und mit sonnigstem Lächeln füllt) setzt er zu der Frage an, wo Mevrouw Kehmerdill sich befinde. Der Doktor hat diese Frage vorausgeahnt und beantwortet sie frischweg damit, daß »Antja krank sei auf unbestimmte Zeit und von ihrer Mutter verpflegt werde; dort sei sie ja auch am besten aufgehoben.«
Bedauerndes Zungenschnalzen. Die Ratu läßt ihre Lampen leuchten; ein leiser tragischer Zug – ist es Mitgefühl? – umwittert ihr Näschen und kraust die niedere Stirn unter dem blauschwarzen Scheitel.
48Der Doktor ist außerordentlich nervös. Jeden Augenblick gibt er den Djonges neue Befehle. Feuchte bedeckt sein Gesicht; seine Rede ist sprunghaft. Sein eines Ohr, das der Straße zugewandte, streckt sich gleichsam, und wird zu einer empfindlichen Muschel, in der alle Geräusche von draußen Stelldichein halten. Die Eidechsen schnattern; im Garten grunzt ein Gecko. Wenn der Raden sein sanftes, gutturales Gespräch unterbricht, entstehen kleine Verlegenheitspausen. Er weiß viel zu erzählen; er ist ein gutunterrichteter Mann und in Innenpolitik versiert, wie kaum ein zweiter. Er hat mit dem Doktor schon manchen Spaß gehabt auf Kosten von Dingen, die Kolonial-Bureaukraten ehrwürdig sind. Der Doktor erkennt, daß Heyermans außer seinem Taktgefühl noch einen anderen Grund hatte, heute frühzeitig aufzubrechen; er wollte nicht in die Lage kommen, mit dem Raden diskutieren zu müssen.
Endlich ist es zehn Minuten nach neun Uhr, und der schicksalhafte Moment ist da. Der Doktor läßt mit Getöse das silberne Schutzdeckelchen seines Whiskyglases fallen.
Ein Moskito mästet sich an seinem Nacken; er merkt es nicht. Während er das Deckelchen aufhebt, blickt er schnell auf und sieht Kusumas Augen auf sich geheftet mit dem leeren Ausdruck, der beim Orientalen ein Zeichen plötzlicher Nachdenklichkeit ist. ›Der Raden merkt etwas,‹ denkt er und beschließt sich zusammenzunehmen.
Es ist auch die höchste Zeit, denn Nora Erdbrink betritt soeben, von ihrem Mann gefolgt, die Veranda.49Mit kleinen leichten Schritten in perlgrauen Schuhen geht sie auf den Doktor zu und berührt mit ihrer zarten schmuckbeschwerten Hand seine fiebrige feuchte, an der nichts sitzt als ein rohgearbeiteter »Schlangenring«, ein Amulett seiner Verwandten. Er hat vergessen ihn abzuziehen. ›Im Lauf dieses Abends noch,‹ denkt er und starrt halb abwesend auf die stumpf blitzenden Steine, ›ziehe ich ihn ab, sonst bringt er Unglück . . .‹ – Nora blickt lächelnd auf die anderen Besucher und flüstert mit ruckweisen Bewegungen des Köpfchens: »Also sind wir doch nicht die Ersten, wie?«
Kehmerdill stellt vor. Er entwickelt überstürzte Geschäftigkeit. »Gute Freunde,« bemerkt er, »von denen Sie, Herr Erdbrink, manches Passende erfahren können . . .« – Nora setzt sich. Das mattblaue Seidenkleid spannt sich an den Knieen. Die perlgrauen Strümpfe sind bis zu der Grenze sichtbar, die eine freigebige Mode gerade noch gestattet. ›Sie ist doch fünfundzwanzig,‹ denkt der Doktor.
»Sehr erfreut,« spricht Erdbrink und reicht seine große Hand umher. Er lächelt und der Ausdruck seines grobgeschnittenen Gesichtes wirkt melancholisch, weil die traurigen Augen unbeteiligt bleiben. Sie verlieren kaum etwas von dieser rätselhaften Unbeweglichkeit, als er sie in die funkelnden Pupillen der Javanerin senkt. Nur ein paar Fältchen in den Winkeln deuten kümmerliches Interesse an, das sich kaum unterscheidet von mattem Wohlwollen . . . Alle folgen dem Beispiel Noras und setzen sich. Mit ihrer melodischen, raschen Stimme erklärt sie: »Paul hatte sich verspätet. Die Chauffeure hier sind so schwer50von Begriff. Wenn man ihren Jargon nicht kennt, darf man ihnen keine richtigen Straßennamen nennen. Man muß sich, glaube ich, in Beziehung setzen zu ihren Ställen oder Bambushäuschen . . .«
»Man braucht natürlich,« sagt der Doktor, »für die erste Zeit einen Dolmetsch.«
»Nicht bloß für die Kutscher!« fügt der Raden hinzu. Er schmückt seine Einfälle, mögen sie auch sachlicher Natur sein, mit einem perlenden Gelächter. Kehmerdill kennt die tiefe Bedeutungslosigkeit solchen Scheinhumors. Die sprudelnde Lebensfreude, die scheinbar aus jeder Belanglosigkeit Honig saugt, ist Teil des »Adat«, der javanischen Sitte.
»Es ist angenehm, Herr Kusuma,« sagt Erdbrink und meint es sehr nett, »daß bei Ihnen kein Dolmetsch nötig ist. Ich beneide Sie um Ihr Sprachtalent. Ihr Deutsch ist fast akzentfrei . . . Erstaunlich.«
»O lala,« sagt der Raden und fächelt die Bemerkung mit gespreizter Hand hinweg, als enthalte sie eine gewaltige Schmeichelei; ja, er krümmt sich fast im Stuhl. Sein Gelächter perlt. »Akzentfrei . . . nun ja, man gibt sich Mühe. Mein Freund Kehmerdill sorgt dafür, daß ich das Stottern verlerne.« – Plötzlich umspringend: »Ich kenne Ihr großes Land, Herr Erdbrink. Ich bewundere es.«
Nora nimmt ihr Taschentuch vor den Mund. Mit einer Stimme, in der verschlucktes Lachen bebt, wendet sie sich, beherrschte Weltdame, an die Ratu. »Sie sind beneidenswert; Sie haben einen begabten Mann . . .«
Die kleine Ratu weiß, da sie deutsch angesprochen wird, einen Augenblick nicht Bescheid. Immerhin51strahlt sie auf, und sagt auf holländisch: »Sie sind sehr gut, Mevrouw.« Ihre Augen ruhen versonnen auf der Europäerin. Ein Gemisch von Gefühlen beherrscht sie. Kehmerdills Blick, der sich zuweilen an der deutschen Frau geradezu festsaugt, entgeht ihr nicht. Das Klappern des silbernen Deckelchens, jenes kleine schicksalhafte Geräusch, hatte die Ratu zusammenzucken lassen. Sie ist mit Antja befreundet. Ihr feines Näschen wittert Unrat; doch alle Schlüsse, die zu ziehen wären, sind noch wolkig. – »Der Raden,« fährt sie tapfer fort, »spricht sechs Sprachen.«
Nora mustert den munteren Herrn in seiner gebatikten Turbankappe mit etwas respektvollerem Interesse. Die kleine Ratu folgt ihrem Blick und sagt fast entschuldigend: »Das kam ganz von selbst; er war jahrelang in Europa.«
»Nun,« meint Nora, »dann hat er ja seine Zeit ausgenutzt. Paul spricht nur Englisch. Das hält er aber für gut.«
»Es ist passabel,« murrt Erdbrink. »Man versteht mich.« Alle lachen, doch weiß keiner so recht warum. Man ist von der Sonnigkeit des eingeborenen Pärchens angesteckt; das wird es sein. Und außerdem ist das Prinzip »Keep smiling« bei der Unterhaltung wie Öl für einen Motor. Der Doktor beglückwünscht sich insgeheim zu seiner Idee.
Er verkündet: »Kusuma hat eine große Karriere vor sich. Hier kann er sich aussprechen; er ist hier auf ganz neutralem Gebiet . . . Bei uns ist alles gut aufgehoben, was? – Deine Rede neulich im Volksraad war glänzend.«
52»Herr Kusuma ist so bescheiden,« zwitschert Frau Erdbrink. In der Tat: Kusuma hat sich vor lauter Bescheidenheit soeben erst die zweite kandierte Mandel genommen und zerknuspert sie. Er scheint nicht willens, über sich selbst zu reden. Er macht eine Geste, die dies dem Doktor überläßt. »Sehr witzig warst du,« sagt der Doktor. »Kein Mensch verübelt dir die Prätendenten-Seele, die neben der sozialdemokratischen in deinem Busen haust. Deine Welfenbestrebung mit Hilfe der Freisinnigen . . . das darf ich doch erzählen?«
»Du wirst es zwar ganz falsch erzählen,« sagt der Raden und senkt seine Lider auf halbmast; »aber wer fällt dem Gastgeber gern ins Wort? – Wenn es deine Gäste amüsiert . . .«
»Wie bescheiden!« seufzt Nora noch einmal; wendet sich aber, da sie ihren Blick von des Javanen schläfrigem Lid ertappt fühlt wie von einer Falle, ostentativ dem Doktor zu . . .
»Es ist im Volksraad,« verkündet Kehmerdill. »Der Oberstkommandierende verteidigt die Flottennovelle. Kusuma erhebt sich darauf und hält eine Rede, die gewissen europäischen Berufskollegen größte Ehre gemacht hätte; eine Rede, man denke sich, die mit dem Passus beginnt: ›DieseltsameSorge, die den Vorredner bedrückt, scheint dieser mit wenigen in diesem Haus zu teilen . . .‹ – Eine Rede, die von Sarkasmen trieft . . . ›Zahlt eure Flotte selber,‹ ruft er, ›wir geben kein Geld dafür her . . .‹ Und dies von Kusuma, dem sequestrierten Sultan von Bantam, man denke sich, den ganzen holländischen Militärs undBuitenzorg-Chefs ins Gesicht gesagt, im blendendsten Parlamentsjargon . . . und dann der Höhepunkt! Als jemand die Möglichkeit von Krieg erwähnt, ruft er: ›La guerre... c'est une affaire trop sérieuse pour la laisser au militaire!‹ – Ruft es aus und setzt sich. Prägt ein neues nie dagewesenes Schlagwort, wischt sich den Schweiß ab und schweigt. Verblüffung, Wut. Lachen links. Und das Flottengesetz fällt durch . . .«
Alle applaudieren. Erdbrink, schmunzelnd, wendet sich mit plötzlich erwachtem Interesse dem Raden zu. Nora sitzt, halb zu Kehmerdill gedreht; geschützt vom drüben beginnenden Gespräch zwischen den Männern, spricht sie leichthin, etwas gedämpft: »Ihr javanischer Freund hat es hinter den Ohren . . . Sie haben ihn ausgezeichnet kopiert . . .«
Sie wirft dem Doktor einen schnellen Blick zu; streichelt ihn gleichsam mit dunkler Wimper. Noch vermeidet er es, sie zu betrachten. Er erwidert nachdenklich: »Oh, wir haben manches Mal zusammen gelacht; – über die ›Unterlegenheit der bellenden Krämer‹ zum Beispiel – so drückt Kusuma sich aus – der ›schleichenden Beharrlichkeit des Ostens gegenüber, die sich sacht zum Sieg hindurchwurme‹ . . . Stück nach Stück würden die Volksraadmänner ihre Unabhängigkeit einheimsen, wie man ›Manggafrüchte mit dem Ketscher heimse‹ . . . So gibt es da eine Geschichte von Propaganda in seinem Stammdistrikt, wo er mit Impfkommissionen arbeiten ließ . . .«
»Das istnichtinteressant,« schneidet ihnen plötzlich überraschend der Raden ins Gespräch. Er wirft dies so nebenhin über den Tisch.
54Kehmerdill blickt erstaunt auf. Doch schon führt der erstaunliche Mann einen für Erdbrink begonnenen Satz ruhig zu Ende.
Das kleine Veto bleibt in der Luft hängen: winziges Blitzen und Verschwinden einer Klaue.
Der Doktor und Nora sehen sich an. Es dauert nur einige Sekunden, doch es genügt für beide, um zu ahnen, woran sie sind.
Sie werdenbelauscht. – Schon jetzt.
Kehmerdill lacht, schenkt ein und findet ein anderes Thema, was nicht mit dem Raden zusammenhängt – Djodok, den Gibbon. – Doch in Noras Augen sitzt tastende Neugier, mit ein wenig nervösem Schreck gemischt.
Jetzt, da jemand kleine kontrollierende Gebärden macht des Inhalts: ›Ihr sprecht miteinander . . . Darf man fragen, worüber?‹ –, kommt es scheinbar ganz zusammenhangslos zum Vorschein, daß sie einander ganz nah sind, verhängnisvoll nah . . . Wo steckt die Ursache? –