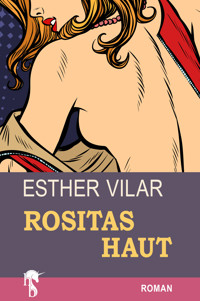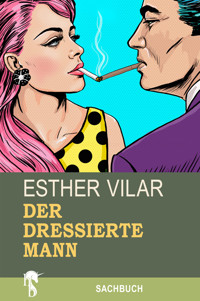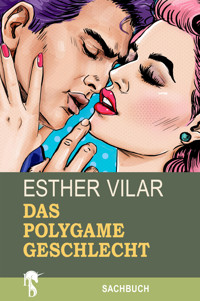3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Ist Nina Gluckstein tatsächlich die Frau, die weiß, wie die Liebe «funktioniert»? Die Formel scheint so einfach begreifbar zu sein, ist aber so unendlich schwer zu leben: Es gibt ein sicheres Mittel, einen anderen an sich zu binden – man darf ihm nicht zeigen, daß man ihn an sich binden will. Nina Gluckstein ist die Frau, die diese Formel erkannt, angewendet, erlebt, aber auch erlitten hat. Sie konnte sich und den Mann, den sie liebte, auf der Höhe des Glücks halten – doch um welchen Preis! Selten ist die Liebe so auf das Wesentliche reduziert worden wie in dieser brillanten Novelle: brillant in der Idee, der Form und der Sprache. Zugleich ist dies eine Liebesgeschichte voller Raffinesse und subtiler Spannung. Die Mathematik der Nina Gluckstein ist eine Mathematik des Herzens, des Liebens und Geliebtwerdens. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 112
Ähnliche
Esther Vilar
Die Mathematik der Nina Gluckstein
Novelle
FISCHER Digital
Inhalt
Für Eléonore Hirt
1
Ich heiße Roberta Gómez Dawson, und auch wenn Sie seit Ihrer Schulzeit keine Gedichte mehr lesen, haben Sie wahrscheinlich schon von mir gehört. Nach einer Umfrage vom November letzten Jahres kennen siebenundfünfzig Prozent der Einwohner von Buenos Aires noch immer meinen Namen, vierunddreißig Prozent wissen, daß es sich dabei um eine Schriftstellerin handelt, dreizehn Prozent können einen meiner Buchtitel nennen und zwei Prozent sind sogar imstande, den einen oder andern meiner Verse aufzusagen. Und seit den Feiern zu meinem siebzigsten Geburtstag – zwölf Jahre ist das jetzt schon wieder her – haben es auch die Kritiker aufgegeben, auf mir herumzuhacken: Keiner möchte eine literarische Hinrichtung geschrieben haben, die zugleich mit der Nachricht vom natürlichen Ableben des Opfers in der Zeitung erscheint. So nennen sie mich heute lieber «die alte Dame der argentinischen Literatur». Ich erwähne das, um Ihnen zu zeigen, daß auch der literarische Ruhm irgendwann einmal seinen Schrecken verliert.
Anfangs habe ich mich oft gefragt, warum es ausgerechnet in diesem Beruf, wo alle sich so menschlich geben, soviel barbarischer zugeht als anderswo. Ich kam aus der Welt der Naturwissenschaften, der Mathematik. Auch da gibt es Rivalität und Neid, aber niemals diese Gemetzel. Doch Literaten sind Fachleute für Worte und Gefühle. Sie besitzen die schärfsten Waffen und wissen genauestens, auf welche Stelle man zielt, um einen Konkurrenten zu erledigen.
Das ist auch als Warnung an künftige Leser dieses kleinen Buches gedacht. Vorausgesetzt, ich kann es überhaupt beenden, denn ich arbeite langsamer als früher, und meine Lebenserwartung ist tatsächlich begrenzt: Eine zweiundachtzigjährige Person weiblichen Geschlechts kann in diesem Teil des Landes noch mit einer mittleren Lebensdauer von zwei Jahren rechnen – jeder Heimcomputer stellt einem heute dieses Horoskop. Doch falls ich es veröffentliche und falls es dann zu positiven Reaktionen käme, wäre dies wohl hauptsächlich meinem hohen Alter anzukreiden. Prosaschreiben hat mich nie sonderlich interessiert – meine Ambition galt stets der Lyrik.
Eine Folge meiner Beschäftigung mit den exakten Wissenschaften? Mag sein. Die Kriterien, an denen ich die Gültigkeit einer literarischen Aussage messe – Unabhängigkeit, Widerspruchsfreiheit, Vollständigkeit –, fand ich zuweilen in Gedichten erfüllt, in Romanen und Erzählungen so gut wie nie. Es sind übrigens die gleichen, die der Mathematiker Hilbert zu Beginn dieses Jahrhunderts für die Tauglichkeit von Axiomen formulierte. Es gibt – nach diesem Maßstab – keine befriedigendere Kunstform als das Gedicht.
Wenn ich mich jetzt, nach einundzwanzig Jahren, noch einmal zu einer literarischen Arbeit aufraffe und trotzdem die Erzählform wähle, geschieht dies in der ganz pragmatischen Absicht, möglichst viele Leser zu erreichen. Denn die meisten von Ihnen scheinen sich aus Versen so wenig zu machen wie aus Formeln. Aus meiner Perspektive – und in beiden Fällen – welch ein Verlust!
2
In unserer Presse wird alle Jahre wieder über meine bewegte Vergangenheit und meine heutigen, ach so skurrilen Gewohnheiten berichtet. Wenig davon ist wahr. Teils wurden diese Geschichten von Journalisten erfunden, teils von mir selbst, um jene von meiner eigentlichen Vergangenheit und meinen eigentlichen Gewohnheiten abzulenken. Das habe ich immer so gehalten. Sobald mir jemand zu nahe trat – und da man sich für erfolgreiche Frauen mehr als für andere Leute interessiert, geschah dies leider häufig –, erfand ich etwas, das ihn sofort wieder auf eine falsche Fährte lockte. Mein Vergnügen und mein gutes Recht. Außerdem finde ich es blamabel, wenn einer, dessen Beruf darin besteht, möglichst widerspruchsfreie Lügen zu erfinden, ausgerechnet über sich selbst die Wahrheit erzählt. Was würde man von einem Schneidermeister halten, der nackt herumgeht?
Über mein Privatleben – ich erwähne das nicht ohne Stolz – hat trotz aller Versuche bis zum heutigen Tag keiner Nennenswertes herausgefunden. Wenn ich jetzt erstmals davon spreche, geschieht es freiwillig und aus zwei guten Motiven. Einmal, weil es mit der Geschichte, die ich zu erzählen habe, auf lockere Art zusammenhängt. Ich will hier nämlich versuchen, Nina Gluckstein zu rehabilitieren – eine Frau, die ich zwar nicht persönlich kannte, deren Schicksal mich aber trotzdem zunehmend berührt. Und vielleicht versteht man die Richtigkeit ihres Handelns besser, wenn ich zunächst einmal von mir und meinem großen Irrtum erzähle. Zum andern, weil es gilt, einer Legendenbildung um meine Person entgegenzuwirken, die niemand peinlicher sein kann als mir selbst.
Ich weiß, daß junge Menschen Idole brauchen, schließlich habe ich immer wieder auf diesen fatalen Mechanismus hingewiesen. Ich erinnere an das Bändchen Gebete für Gottlose – meine ersten Gedichte und zugleich mein erster Skandal: Unsere damals noch recht mächtige Kirche hatte «eine gefährliche Anleitung zur Selbstverherrlichung» darin erkannt. Trotzdem, oder gerade deshalb, muß ich mich dagegen wehren, daß mich werdende Dichter und Dichterinnen nun zunehmend als Denkmal mißbrauchen. Wenn sie unbedingt jemand auf ein Podest stellen wollen, kann ich sie natürlich nicht hindern. Ich kann sie nur immer wieder herzlich bitten, sich einen andern auszuwählen. Ich bin ihrer Anbetung weder würdig, noch ertrage ich sie. Macht hatte ich zeit meines Lebens mehr, als mir lieb war.
Außerdem bin ich sicher, daß nur sehr dumme Menschen ihre Macht über andere genießen: Wie könnte jemand mit Einbildungskraft sich darum reißen, das Schicksal fremder Leute zu verantworten? Macht über mich, die hätte mich gereizt: Doch meine berüchtigte «Selbstverherrlichung» ist ja nicht einmal mir gelungen. Hätte ich sonst den Wunsch gehabt, dieses Kunststück zu beschreiben?
3
Das Gerücht von dem großen Roman, an dem ich heimlich arbeite, meinem Alterswerk. Nur weil man merkt, daß ich noch immer denke und trotzdem seit Jahrzehnten nicht mehr publiziere. Ich muß hier meinen Lesern ein Geständnis machen: Die meisten meiner Gedichte habe ich leider nicht für Sie verfaßt, sondern für einen ganz bestimmten andern. Und mit der Literatur habe ich vor einundzwanzig Jahren tatsächlich Schluß gemacht. Die Person, für die ich schrieb, der Mann meines Lebens, das mir einzig wichtige Publikum, ist in jenem Jahr verstorben. Wozu hätte ich weiterschreiben sollen? Um ihm meine Neuerscheinungen aufs Grab zu legen?
Meine jetzt so häufig gerühmte Vielseitigkeit, mein Fleiß. Was habe ich nicht alles verfaßt! Gedichte, Balladen, Epigramme, Kinderreime, Lieder, den Text für jene Tango-Oper, meine «Argentinischen Landschaften». Doch was macht eine Frau, die immer wieder ein und demselben Mann gefallen möchte? Sie versucht, sich ihm immer wieder neu zu zeigen, nicht wahr? Neue Kleider, neue Frisuren, hin und wieder ein neues Parfum. Nun, der Mann, von dem hier die Rede ist, lebte weit weg, in einem anderen südamerikanischen Land, und aus Gründen, die in diesem Zusammenhang kaum eine Rolle spielen, konnten wir uns selten sehen. Zu den wenigen Möglichkeiten, ihn zu überraschen, gehörte meine literarische Produktion. Sobald wieder ein Bändchen fertig war, ließ ich es in Leder binden, verpackte es in Goldfolie und schickte es ihm zu.
Manchmal reagierte er, manchmal nicht, manchmal sofort, dann wieder erst nach Monaten. (Ich habe einmal zum Spaß seine durchschnittliche Reaktionszeit ausgerechnet: Von den unbeantworteten Sendungen abgesehen, waren es 41,8 Tage.) Diese Antworten waren meine Angst und meine Hoffnung, nicht das Urteil der Literaturkritik. Wenn er schrieb, daß ihm etwas gefallen habe, gab es keine Pressestimme, die mich verletzen konnte. Schwieg er, so fühlte ich mich als die langweiligste Schriftstellerin auf der ganzen Welt. Kein Lob konnte mich dann trösten, und jeder Verriß war die schmerzvolle Bestätigung meiner Mittelmäßigkeit.
Dabei weiß ich bis heute nicht, ob er überhaupt ein Gefühl für Poesie besaß. Er war ein arbeitswütiger Mann, der in seiner knapp bemessenen Freizeit Hochseefischerei betrieb und selten las. Sein Geschmack war der damals übliche: García Márquez, Vargas Llosa, Paz, Cortázar. Neruda fand er «weibisch» («Gedichteschreiben, das ist doch keine Arbeit für einen Mann!»), Borges «ein bißchen unheimlich, nicht wahr?» (Wie hätte das den Meister amüsiert, vor allem, wenn er gewußt hätte, von wem es kam. Ich habe mich gehütet, es ihm zu erzählen.) Nach den übrigen Kollegen habe ich ihn vorsichtshalber gar nicht erst gefragt.
Ich weiß nicht einmal, ob er wirklich gescheit war. Oder schön. Fest steht nur dies: Mit einem Blick, einem Lächeln vermochte er «meine Seele zu berühren», wie es bei Homer heißt. Warum das so war, habe ich nie ergründen können. Die seltsame Einsamkeit, in der er in all dem Getriebe lebte? Seine Integrität? (Die letztlich wohl verführerischste aller männlichen Eigenschaften.) Jedenfalls war mir zu keiner Zeit daran gelegen, den Lesern die Wandlungsfähigkeit einer Literatin vorzuführen. Ich war einfach eine Frau, die sich für ihren Geliebten immer wieder einmal umzog.
Bis ich nach langen Jahren herausfand, daß ihm meine Arbeit immer dann am besten gefiel, wenn ich ihn damit zum Lachen brachte. (Ja, er war ein Mann, der gern lachte!) Das war der Zeitpunkt, als ich mit meinen «humoristischen Balladen» begann, jenen im Hexameter verfaßten Tiergeschichten, die heute Unterrichtsstoff an unseren Schulen und auf jeden Fall mein größter Publikumserfolg sind. Ich persönlich halte sie von allen meinen Arbeiten für die unbedeutendsten. Doch was macht eine Frau, der ihr Geliebter zu verstehen gibt, er sähe sie am liebsten in dieser und jener Farbe, mit der und der Frisur? Eben.
4
Diese zunehmende Beweihräucherung in der feministischen Presse! Das Hin und Her um jenen Verherrlichungsfilm, zu dem ich schließlich meine Zustimmung verweigern mußte. Schwestern, denkt doch bitte nach: Ich, die Priesterin des weiblichen Zölibats? Die Frau, die es ablehnt, sich an Mann und Kind zu ketten, weil ihr ihre Freiheit über alles geht?
Wo habe ich geschrieben, daß ich frei bin? Ich und frei? Ich war dreißig Jahre lang dank einer absolut unerklärbaren Leidenschaft mehr versklavt als jede der von euch so bedauerten Ehefrauen. Wenn das niemals amtlich wurde, lag es weiß Gott nicht an mir. Ich habe den Heiratsanträgen meiner Verehrer nicht widerstanden, wie ihr so gern prahlt. Sie haben mich schlicht nicht gereizt!
Den einzigen Mann, den ich wollte, habe ich immer wieder nur beinah bekommen. Die einzigen Kinder, die ich hätte gebären mögen, wären seine gewesen. Wie gern hätte ich ihm meine heilige Freiheit vor die Füße gelegt. Er wollte sie nicht.
Es gebe eine Möglichkeit, immer zu gewinnen, heißt es bei Ramón José Sender: Es genüge, daß man zu verlieren versteht. Im wissenschaftlichen Sinn ist das unbrauchbar, ich weiß, in der Praxis jedoch eine hervorragende Formel; ich habe sie in allen Lebenslagen mit Erfolg angewendet. Doch wie sollte ich verstehen, mein Liebstes zu verlieren?
5
Dann der vielleicht wichtigste Grund, weshalb ich hier versuchen möchte, für die Rehabilitierung Nina Glucksteins einzutreten. Ich spreche von meiner Erfahrung mit der Kehrseite des Ruhms, die sicher größer ist als die der andern, die sich bisher mit ihrem Schicksal befaßten. Denn wer vom einen Teil der Leute vergöttert wird, darf ja fest damit rechnen, beim andern zum Teufel zu avancieren – wie die Geschichte lehrt, macht ein gemeinsamer Haß die Herden genauso stark wie ein gemeinsames Gebet. In meinem bescheidenen Fall beziehe ich mich auf die Legende von der kaltblütigen Karrieristin, mit der mich die Gegenseite zu desavouieren suchte, von der «Bienenkönigin, die Männer benützt und liegenläßt». (Wörtliches Zitat aus einer Biographie von Arnoldo Huemez.)
Ich weiß, daß da einiges gegen mich spricht. Ich habe ja tatsächlich «Karriere gemacht», und wenn ich mich mit einem meiner zuweilen recht auffälligen Begleiter in der Öffentlichkeit zeigte, kamen auch die Schlagzeilen; die Auflagen meiner Bücher begannen in der Folge tatsächlich zu steigen. Und dann gab es auch ein paar echte und falsche Tragödien, die Ihnen trotz meiner Bemühungen nicht ganz verborgen blieben. Wie diese wahnwitzige Chacarita-Affäre, die bis zum heutigen Tag nicht einmal ich selbst verstanden habe. Meine Passion für Pferde und der wegen der Identität meines Begleiters später «historisch» genannte Reitunfall. Jene vielbesprochene Ohrfeige. Die «Enthüllungsgeschichte» eines rachsüchtigen Journalisten.
Gut, ich habe es überlebt. Und zweifellos haben diese Skandale mehr dazu beigetragen, daß man in diesem Land ab und zu wieder ein Gedicht liest, als alle Interviews meiner feinsinnigen Kollegen. Denn wie immer man sich eine Poetin vorgestellt haben mochte, so wie mich hatte man sie sich nicht vorgestellt. Doch gesucht habe ich das kaum.
6
Vielleicht bin ich hier schuldiger, als ich glaube, ich weiß es nicht. Fest steht, daß ich keinen dieser Männer liebte. (Wie wäre das auch möglich gewesen, ich liebte ja ihn!) Und daß ich mich von keinem je aus Berechnung lieben ließ. Ich habe diese Karriere, um die man mich zeit meines Lebens so beneidete, niemals gewollt. Ich habe einfach gern geschrieben.
Mit jener einen Ausnahme waren meine jeweiligen Weggenossen selbstsichere, von Frauen umworbene Männer. Gerade ihre Arriviertheit schien mir ein gewisser Schutz vor Verwicklungen zu sein – insofern bestand bei der Auswahl vielleicht doch eine gewisse Berechnung (ich arbeitete sozusagen mit Kardinalzahlen, um äquivalente Mengen zu erhalten). Ich wollte mir und jenen Männern eine Freude machen und habe lange nicht begriffen, wie sich aus so heiteren Anfängen immer wieder diese kitschigen kleinen Dramen entwickeln konnten.