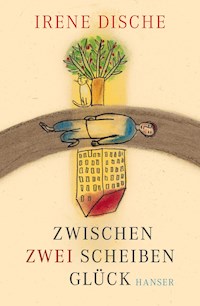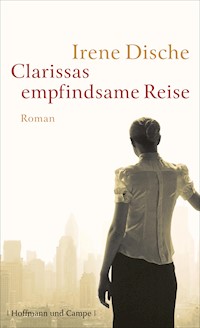10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein atemberaubender Roman über Männer und Frauen – und eine außergewöhnliche historische Figur, die beides war "Ich betrachte Sie in Ihrem seltsamen Jahrhundert voller Verwunderung. Zweihundertfünfzig Jahre nach meiner Zeit glauben Sie offenbar, Sie hätten die Wahlfreiheit erfunden, ein Mann oder eine Frau zu sein. " Diese unglaubliche Geschichte von Männern und Frauen, Täuschungen und Intrigen, unwahrscheinlichen Affären, heimlichen Fluchten und dramatischen Triumphen ist die Geschichte des Chevalier d'Eon de Beaumont , den es wirklich gab. Er war Diplomat, Soldat, Bibliothekar, Freimaurer, Degenfechter, Schriftsteller und Spion – und verbrachte den größten Teil seines turbulenten Lebens als Frau. Bis zu seinem Tod rätselte ganz London, wer die militante Madonna, die in öffentlichen Degenkämpfen alle Männer in die Knie zwang, wirklich war.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Irene Dische
Die militante Madonna
Roman
Aus dem Englischen von Ulrich Blumenbach
Hoffmann und Campe
Vorspruch
Ich betrachte Sie in Ihrem seltsamen Jahrhundert voller Verwunderung. Zweihundertfünfzig Jahre nach meiner Zeit glauben Sie offenbar, Sie hätten die Wahlfreiheit erfunden, ein Mann oder eine Frau zu sein. Schon mit dem Wort Wahl fuchteln Sie herum, als hätten Sie es erfunden, aber in Wahrheit haben Sie nur jede Menge Regeln erfunden, wie eine einmal getroffene Wahl umzusetzen und zumal in Worte zu fassen ist. Sie kontrollieren den Sprachgebrauch, und »Falschsprechen« – ein Wort, mit dem mein in den 1600ern geborener Großvater gegen das Aussprechen sündiger Dinge wetterte – wird mit schweren Strafen geahndet. Die Sünde wurde aus Ihrem Wortschatz gestrichen, aber die Verdammung des Wortverbrechens ist geblieben.
In meiner Zeit und in meinen Kreisen sprachen wir, wie es uns gefiel. In den obersten Gesellschaftsschichten, am kultiviertesten Hof der Welt kleideten sich die Männer wie Frauen und die Frauen wie Männer, und niemand regte sich über solche Kinkerlitzchen auf. Bevor sie Zarin wurde, kleidete sich Elisabeth von Russland wie ein Soldat und pflegte nachts mit den Truppen zu fluchen und Karten zu spielen. Nach ihrer Thronbesteigung nahm sie eine kleine Korrektur an der Etikette der wöchentlichen Maskenbälle vor – Männer hatten fortan in Abendkleidern und Frauen in Uniformen zu tanzen. Ich war als Frau dabei, als Lea de Beaumont. Eine schöne, geistreiche Frau mit kecken Brüsten, strahlend blauen Augen und blonden Locken, die ich nicht unter Puder erstickte. In die inneren Angelegenheiten des Reichs eingeweiht, sandte ich meine Berichte dem klatschsüchtigen König von Frankreich, der mich gut dafür bezahlte, und verfasste persönliche Briefe mit klugen »weiblichen« Beobachtungen zum menschlichen Charakter. Dann verwandelte ich mich wieder in den Chevalier d’Éon de Beaumont, einen grimmigen Krieger und gefürchteten Fechter. Ich wurde zweimal verwundet, und nachdem ein Zug von nur fünfzig Dragonern unter meinem Kommando den Sieg über siebenhundert Preußen errungen hatte, rühmte der König meine »glorreichen Heldentaten auf dem Schlachtfeld«. Nach Kriegsende erkannte er meine eigentlichen Talente als Diplomat und beauftragte mich mit der Teilnahme an Friedensverhandlungen zwischen England und Frankreich. Als Zeichen seiner Anerkennung heftete er mir die begehrteste Auszeichnung, das Sankt-Ludwigs-Kreuz, ans Revers der Uniform eines Dragonerhauptmanns und sandte mich nach London. Unter dem Nom de Plume William Wolf analysierte und prophezeite ich den Verlauf der Romanzen, die mir als Frau zu Ohren kamen, und der politischen Intrigen, deren Zeuge ich als Mann wurde, und als eigenbrötlerischer Chevalier d’Éon verfasste ich, versteckt in einem Herrenhaus in Hampshire, Abhandlungen zur Finanzkunst, die kein Geringerer als Friedrich der Große sammelte und studierte. Als die englische Polizei in meine Bibliothek gestürmt kam, um mich zu ergreifen, weil ich einen Feind im Kaffeehaus zum Duell gefordert hatte – ein Duell, das ich spielend gewann, weil mein Gegner das Hasenpanier ergriff –, empfing ich sie als verschämte, in Bücher vernarrte Demoiselle, die die fünfzehntausend Bände des Herrn bewundern wollte, der, wie ich sie bedauernd in Kenntnis setzte, zwei Tage zuvor nach Amerika abgereist war.
Bald darauf wurde mein Leben eine abgedroschene Geschichte. Spätestens als die überheizten öffentlichen Wetten an der Londoner Börse, ob ich nun ein Mann oder eine Frau sei, den heutigen Gegenwert von zwei Millionen Pfund überstiegen, zeichnete sich ihr Ende ab. Die Engländer hätten auch Wetten darüber platziert, ob die Madonna eine Jungfrau war, und ich beschloss, ihrem Beispiel zu folgen und dafür zu sorgen, dass mein Geheimnis niemals gelüftet würde.
Wie ich eine hohe Stelle bekleidete und auch behielt
Es war einmal ein König, Louis XV. von Frankreich, der machte mich, den er Yeux d’Ange, »Engelaugen«, nannte, zum französischen Interimsbotschafter am Hof von St. James. Das kränkte mich tief. Für jahrelange geheime wie öffentliche Dienste belohnte er mich mit einem vorläufigen Amt. Es war nicht seine Idee gewesen – sein Außenminister, gebenedeit mit der noblesse de race, vulgo ein Trampel, steckte hinter der Beleidigung. Im stillen Kämmerlein erhob ich Einspruch beim König. Er kalmierte mich und versprach, sich eines Tages über seinen Minister hinwegzusetzen. Ich ging nach London. Bei meiner ersten großen Soirée in der französischen Botschaft behelligte mich im Ballsaal, wo ich, der anmutigste Mann des Abends, die englischen Gäste voller Schwung lehrte, einen Cotillon zu tanzen, der größte Mann im Saal. Seine turmhohe Perücke fügte seiner Gestalt eine zweite Etage hinzu. In den wenigen Sekunden, in denen ich ihm, nachdem er aus dem Hintergrund in mein Blickfeld getreten war, mein Ohr lieh, plapperte er, meine gegenwärtige Stellung sei eine »Travestie«. Mehr konnte er nicht sagen – das Kompliment wurde ihm mit dem Hinauswurf vergolten. Etliche Stunden später erwartete er mich draußen im Dunkeln. Er folgte mir einige Schritte, bis ich den Degen zog. Er sprach über die stählerne Klinge hinweg und drängte mich in innig vertrautem französischem Dialekt, die Waffe zu senken. Auch er kam aus der Bourgogne. Er nannte sich schlicht »Morande«.
»Wir sind Brüder!«, flüsterte er und trat an mich heran, obwohl meine Degenspitze ihm schon in den rötlich weißen Rock drang. Er war aus dickem Stoff, sonst hätte ich ihn durchbohrt. Ich warf einen kurzen Blick auf seine karmesinrote Reithose und die Seidenstrümpfe über den Storchenbeinen. Dieser Mann konnte mir nicht gefährlich werden. Ich senkte den Degen. Wie sich zeigte, wusste er viel über mich. Es war sein Metier, Dinge über andere zu wissen.
Morande war, was Sie einen Gossenjournalisten nennen. In Ihrem bauchnabelbeschaulichen Jahrhundert könnte es Sie interessieren, dass er das Genre praktisch aus der Taufe gehoben hat. Gossen halten Städte und Häuser rein. Mit ihren Ergüssen über die Geheimnisse der Hautevolée schwemmen diese Tintenkleckser die Illusionen der Öffentlichkeit fort. Morande hatte bei seinem Tun allerdings keine Sozialhygiene im Sinn, sondern wollte Kasse machen. Er verwertete den Klatsch in Spottgeschichten, die er unter Pseudonymen in einem Boulevardblatt publizierte, das er eigens zu diesem Zweck gegründet hatte. Es hatte eine riesige Leserschaft. Er schrieb auf Französisch und für den Bedarf seiner französischen Landsleute, ließ das Blatt aber in England mit seinem liberalen Leumundsrecht drucken. Man konnte sogar den englischen König oder Angehörige seines Hofs beleidigen, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Am liebsten beleidigte Morande in aller Öffentlichkeit unseren eigenen Monarchen, Louis XV., aber nicht etwa, weil er einen Rochus auf ihn hatte. Ihm ging es nur um den Reibach. Er bezahlte Spione, die ihm Palasttratsch aus Versailles zutrugen, und beschäftigte einen Tross von Zwischenhändlern, die seine Postillen nach Frankreich schmuggelten, wo sie teuer gehandelt wurden. Bevor er die Skandalgeschichten in den Druck gab, bot er die verleumderischsten Passagen den Betroffenen an; wenn sie ihm noch mehr zahlten, unterließ er die Veröffentlichung. Die meisten zahlten.
»Ich verdiene mit meinen Sachen mehr als Voltaire und Marivaux zusammen!«, prahlte er, als wir gemeinsam weitergingen. Er war zu aufwendig gekleidet, um als elegant zu gelten, zu schrill für ein weltmännisches Auftreten und zu prahlsüchtig, um lange ernst genommen zu werden. Aber er bezauberte mich.
In den ersten Stunden unserer Bekanntschaft gab er meiner Zukunft eine neue Richtung. Mit einem Appell an meinen Stolz brachte er mich dazu, alles daran zu setzen, dass ich Botschafter auf Lebenszeit blieb. Er wusste, dass ich das Vertrauen Louis’ XV. genoss und Zugang zur prall gefüllten Börse des Ständigen Botschafters hatte: Diese Mittel sollte ich unverzüglich abzweigen, statt auf die Ankunft des noch unernannten Vorgesetzten zu warten, der mich ersetzen würde. Gegenwärtig repräsentierte ich den König Frankreichs. Die Botschaft war kein Ort für Geheimverhandlungen egal welcher Art. Ich brauchte eine prachtvolle Privatresidenz, um Würdenträger zu empfangen. Und die dazu passende Garderobe.
Morande wartete mit einer praktischen Lösung auf. Ich sollte jeden Livre und jeden Sou aufzehren. Dann musste ich die Stellung aus finanziellen Gründen behalten.
Ich ließ mich breitschlagen und kaufte mir ohne viel Federlesens eine Pracht und Herrlichkeit, die mir bis dato nichts bedeutet hatte. Wäre das angemessen für Louis XV., fragte ich mich bei der Auswahl der Inneneinrichtung für ein Stadtpalais in Botschaftsnähe mit einer Remise und einem Vierspänner.
Heute können Sie mein Haus in Petty France, dem vornehmsten Teil von Westminster, so besichtigen, wie es mir in Erinnerung geblieben ist. Zwanzig große Kutschen können um den Platz vor meiner Tür herumrauschen. Das Hufeklappern und Räderknarren lässt die Vogelschwärme, die am Brunnen trinken, in die Luft emporflattern. Stabile schwarze Tür, kupferne Einfassungen, weiß behandschuhter Butler, nach Rosenwasser duftendes Entrée. Ein ausladender Treppenaufgang führt zum Herrenzimmer im ersten Stock, die Wände mit blauem Atlas ausgekleidet und goldenen Vögeln verziert. Der Kaminaufsatz mit geschnitztem Obst und Laub gleicht dem Schnitzwerk, das den Altar in der nahe gelegenen St. James’s Church umgibt. Über diesem Kaminaufsatz können Sie in einem Eichenblattgewinde eine kreisförmige Einbuchtung und eine weiße Marmorbüste von Louis XV. erkennen, ein steingewordenes Gespenst. Die Pfeiler zwischen den hohen rechteckigen Fenstern werden von Spiegeln gesäumt, die bei Tag das Sonnenlicht und bei Nacht die brennenden Fackeln draußen widerspiegeln. Zierrat aus Kristall und Silber tupft alle Flächen.
An die eine Seite dieses Empfangssaals grenzt meine Bibliothek, meine berühmte Büchersammlung, die ebenfalls mit Staatsgeldern erworben wurde. Bitte nicht berühren. Bücher sind meine Heimat, und jedes von ihnen bietet mir unabhängig von Umständen und Stimmung sein eigenes Refugium. Wie gemütlich man sein Heim auch ausstatten mag, es bietet weniger Sicherheit als ein gutes Buch. Wenn Sie aus der Bibliothek in den Korridor zurückkehren, stoßen Sie auf ein ausgeklügeltes Wasserklosett mit drei breiten Sitzplätzen aus Mahagoni. Halten Sie sich nicht die Nase zu! Je nach Jahreszeit riecht es üppig nach Lavendel oder Kiefer, ein Duft, der allmorgendlich erneuert wird. Am oberen Ende einer steilen Treppenflucht liegt mein Ankleidezimmer, das an Pracht, mit seinen Ebenholzmöbeln, Spiegeln und schweren roten Damastvorhängen dem restlichen Haus gleicht. Mehrere Wandschränke beherbergen die Seiden- und Wollausstattung, die ein Londoner Gentleman braucht, um den Eindruck exquisiter Eleganz zu erwecken und keine ungebührliche Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Schauen Sie sich ruhig weiter um. Im hinteren Teil dieses Kleiderschranks lässt sich die Tür zu einem engen zweiten Schrank aufschieben, wo ich meine hübschen Kleider und Hausschuhe, Unterröcke, Seidenbänder und Schnürbrüste verwahre. Mein fabelhafter Kammerdiener James kümmert sich kommentarlos um beide Bereiche. Von Ihnen abgesehen, hat in dieser Zeit nur er Zugang zu meinem Schlafzimmer am Ende des Korridors, das am meisten über meine Person verrät. Es besteht aus einer harten Bretterpritsche, wie sie einem Soldaten ziemt, einer einfachen Wolldecke, einem Kamin und einer mit einem Bärenfell abgedeckten Holzlatrine. Der einzige Schmuck in diesem Zimmer ist ein schlichtes Kruzifix an der Wand, und als einziges weiteres Möbelstück steht mitten im Zimmer ein hölzernes Betpult, auf dem eine Taschenbibel, ein Spiegel und mein Gesichtspuder liegen.
So, jetzt haben Sie alles gesehen. Sie haben einen Blick in meine Seele erhascht. Sie können dann gehen. James wird Sie hinausgeleiten. Versuchen Sie nicht, sich sein Gesicht einzuprägen. Das wäre Intimitätserschleichung.
Ich bezahlte James aus eigener Tasche, gab ihm ein Zimmer hinter dem Treppenhaus und finanzierte ihm auch die rote Livrée mit dem grünen Innenfutter und der Weste. Manche Menschen mögen eine stumme und stupide Dienerschaft. Ich bevorzuge die geistvolle Sorte und war auf der Suche nach meinem James von Pontius zu Pilatus gelaufen. Seine normannische Mutter hatte dem Mischling Französisch beigebracht. Einmal war ich unerwartet nach Hause gekommen und fand ihn in meinem Lieblingssessel in der Bibliothek vor. Tief in seine Lektüre versunken, hatte er mein Kommen nicht gehört. Ich baute mich hinter ihm auf – er begann gerade mit dem Abschnitt, in dem der Pfarrer von Wakefield vom angeblichen Tod seiner Tochter erfährt. Seine Schultern bebten, möglich, dass er weinte. Ich ging auf Zehenspitzen wieder hinaus. Meinen Segen hatte er.
Mit Botschaftsmitteln stellte ich Köche, Lakaien, Portiers, Kutscher und Stallburschen ein und erwarb die erforderlichen Accessoires, darunter diamantene Manschettenknöpfe und Schnallenschuhe. Ich veranstaltete glanzvolle Soiréen, Bälle und Feste in der Botschaft und empfing Würdenträger in meinem Privatsalon. Die mächtigsten Männer und Frauen waren meine Gäste. Versailles mitten in London. Ich kredenzte meinen eigenen Wein. In einem Jahr kaufte ich 2800 Flaschen, um sie in London zu verteilen. Jedermann wusste, dass der Weißwein meiner Heimat Tonnerre zu den besten Weinen Frankreichs zählte. Morande wurde jedes Mal eingeladen.
Ich war damals noch keine vierzig Jahre alt, sehr jung für eine solche Stellung. Alle Welt wusste, dass die d’Éon-Beaumonts aus der Bourgogne, meine Familie, nicht dieselben waren wie die Beaumonts aus der Normandie. Die d’Éon-Beaumonts gehören zum niederen Adel, der für Versailles nicht gut genug war. Man sollte meinen, die beiden zusätzlichen Silben »d’Éon«, die da wie Hoden an ihrem Namen baumelten, hätten mehr aus ihnen gemacht, aber ohne sie wären wir herrliche Comtes gewesen. Weniger ist mehr. Manche Leute glauben, dasselbe gilt für das Geschlecht.
Als junger Aristokrat niederen Ranges, als bloßer Chevalier, musste ich wirklich brillieren. Und wie ich brillierte! George III. bewunderte meine Fähigkeit, mir bei jeder unserer Begegnungen ein neues Kompliment für ihn einfallen zu lassen, seine schüchterne Frau Charlotte und mich einte die Hochschätzung der Tugend, und schon bald ging das Gerücht, sie trüge mein Kind unter dem Herzen. Morande posaunte es natürlich herum, was meinen geheimnisvollen Nimbus noch verstärkte. Ich repräsentierte also nicht nur das Beste, was Frankreich zu bieten hatte, wozu auch die betörende Fama gehörte, der Geliebte der Königin zu sein, ich ließ Louis XV. auch Bulletins mit allem zukommen, was meine Gäste mir im Rausch erzählten. Die Schlafzimmer interessierten mich nicht, diese Weide konnte Morande abgrasen. Ich führte Buch über ministerielle Stellungen, politische Ambitionen, die Planungen der Militärs und die Finanzen des Staates. Diese Kommuniqués waren mein Geheimauftrag. Die langen geselligen Abende waren das Opfer, das ich meiner Vaterlandsliebe brachte, denn in Wahrheit handelte ich am liebsten auf Papier.
Ich bin ein anerkannter Meister der Ars dictaminis. Lange Zeit wusste jedoch niemand, dass ich der vertrauenswürdigste Korrespondent von Louis XV. war. Er hatte eine wunderschöne Handschrift mit langen schmalen Unterlängen und kringeligen Tüpfelchen. Und er brachte stets seine Dankbarkeit zum Ausdruck und drängte mich, neue Recherchemöglichkeiten auszuloten. Wir erlitten eine katastrophale Niederlage, als Großbritannien La Nouvelle France einfach von der neuen Weltkarte wischte. Den König dürstete höchstpersönlich nach Rache; er plante eine Invasion Englands. Es war sein Wunsch, dass ich die britische Kriegsflotte und den Zustand der Häfen genau im Auge behielt. Die unbotmäßigen Siedler in den amerikanischen Kolonien lenkten die Briten ab, und wir warteten nur auf den günstigsten Augenblick, um zuzuschlagen. Louis XV. hatte allerdings auch Inlandsprobleme, die er mir anvertraute. Meine Briefe waren ihm Ergießungen einer reichen Brunnader von Witz und Zuversicht. Und eilends schrieb er mir dann zurück. Wenn ich seine Briefe las, hörte ich ihn immer sprechen, und seine Stimme klang, als hätte sie ein Leck wie ein rissiges Chalumeau. Einmal schrieb er mir: »Ich habe weniger Einfluss auf das Gesetz als ein Rechtsverdreher auf einen Richter und weniger Gewalt über meine Armeen als ein einfacher Oberst. Meine Geheimkommunikation mit Euch gibt mir ein bisschen Macht zurück.« Und er unterschrieb einfach mit »Louis«.
Ich fühlte mich in meiner Stellung sicher.
Wie ich unerwarteten Gefahren begegnete und auf unerwartete Weise mit ihnen fertigwurde
Wer je eine hohe Stellung bekleidet hat, ohne in sie hineingeboren worden zu sein, weiß, wie heimtückisch sich der Boden des Olymp für bloße Besucher erweisen kann. Ein kleiner Fehltritt, ein starker Gegenwind, und man purzelt wieder hinab. Louis XV. schätzte meine Berichte, aber seine Hofschranzen, die nichts von unserer Beziehung wussten, kritisierten schon bald die Selbstverständlichkeit, mit der ich die Botschafterstelle als mein dauerhaftes Eigentum ansah, und mehr noch, dass ich frei über Staatsgelder verfügte.
Leider Gottes wurde der König von Liebesdingen abgelenkt und vernachlässigte seine militärischen Ambitionen. Seine neidischen Minister übernahmen das Ruder. Als ich mein inzwischen drittes Jahr der Macht in London genoss und im Ruf eines Mannes stand, der auf äußerst entspannte Weise das Sagen hatte – schließlich wusste ich, dass man mir in jedem Saal den Weg freimachte und dass ich auch große Männer von oben herab behandeln konnte –, setzte ein einfacher Sekretär mich eines Tages darüber in Kenntnis, der König habe an meiner Stelle einen neuen und diesmal Ständigen Botschafter ernannt.
Ich sandte ihm umgehend meine Protestnote. Der König antwortete nicht. Als ich seine königliche Aufmerksamkeit mit einem verärgerten Brief endlich auf mich ziehen konnte, reagierte er optimistisch. Insgeheim solle ich für ihn weiterarbeiten, aber in der Öffentlichkeit müsse ich mich von meiner Stelle zurückziehen. Mir nichts, dir nichts. Natürlich konnte sich ein König die Tragweite einer solchen Entwicklung überhaupt nicht vorstellen, ergo tat er sie mit einem Achselzucken ab. Ich musste acht Angehörige meines Personals entlassen, und man erwartete von mir sogar, dem wahren Botschafter das Geld für die Möbel zurückzugeben, damit er sich eigene anschaffen konnte.
Das war aber noch nicht das Schlimmste. Der neue und wahre Botschafter war ein alter Idiot aus einem uralten Geschlecht, ein Graf, ein feistes Zipfelhirn, der kein Wort Englisch sprach und selbst dann keinen anständigen Satz herausbekam, wenn sein Leben davon abhing. Der Außenminister fürchtete seine Depeschen wie die Pest, weil er wusste, dass sie seinen Ruf und sein Werk beschädigen konnten. Ein Mann in einer ranghohen Position wird nicht nach seinen Leistungen beurteilt, sondern nach seinen Leistungsberichten; der Graf indes konnte nicht einmal schreiben. »Daran gibt es nichts zu deuteln«, lamentierte der Außenminister beim König. Der frisch Bestallte hatte sich aber als kriecherischer Tugendbold bei der allmächtigen Maitresse des Königs eingeschmeichelt, Madame Pompadour, er buckelte und hielt ihr Hündchen, wenn sie sich erleichtern musste. Sie war es, die über die englische Botschafterstelle entschied, und zwar nach dem Tonfall, in dem er »Ja« sagte, und sie informierte auch den Minister, der ihr gehorchen musste. Wird die Regierung in Ihren Tagen etwa nicht mehr von Flatteuren gelenkt? Ich wurde zum Sekretär und Adlatus von Graf Zipfelhirn und, schlimmer noch, zu seinem Sprachrohr degradiert. Ich musste meinen Schreibtisch aus dem großen Botschaftsbüro entfernen und im Korridor in eine Nische stellen lassen. Und Sie müssen sich vor Augen halten, dass ich bei dem Mann, für den ich arbeitete, hoch verschuldet war – das überstieg mein Demutsvermögen.
Auf Morandes Rat hin nahm ich meine Mahlzeiten weiterhin in der Botschaft ein, kam früh in den Speisesaal, setzte mich an den Kopf der Tafel, überprüfte die Gelassenheit meiner Gesichtszüge in der blank polierten Oberfläche, arrangierte die Spitzenserviette, handhabte Besteck und Weinglas mit gewandter Selbstsicherheit, war bemüht, die mir anhaftende Aura der Macht nicht zu verlieren, und rührte mich nicht von der Stelle, wenn Zipfelhirn angedackelt kam. Ich ließ mir keine Verärgerung anmerken. Ich begrüßte ihn freundlich und erkundigte mich nach seiner Gesundheit. Er war gezwungen, an der Längsseite Platz zu nehmen. Als der frustrierte Graf mir einen Brief des Außenministers überreichte, der mich unverzüglich nach Versailles zurückbeorderte, versetzte ich: »Ich befolge nur die Befehle meines Königs, nicht die seiner Minister«, und tat weiterhin so, als hätte ich das Sagen. Morande applaudierte und war sich meines Erfolgs sicher.
Ebenfalls auf Morandes Vorschlag hin – ich stand in seinem Bann, war gefesselt davon, wie er Worte schleudern konnte – beschrieb ich in zierlichen, poetischen Wendungen, wie ich die Fähigkeiten des neuen Botschafters einschätzte, und stellte diesen Berichten sowohl seine Briefe an mich gegenüber als auch die all der kleinen Jupiters in seinem Dunstkreis, die ihn eingesetzt hatten. Ihre eigenen Schreiben gaben aus erster Hand Auskunft darüber, wes Geistes Wickelkind die Autoren waren und über wie viel Esprit und Staatskunst sie geboten. Ich vertraute sie Morande im Entrée der Botschaft an, vor den Augen Zipfelhirns, der sein Tagwerk gerade beenden wollte und bemerkte: »Das wird eine finstere und stürmische Nacht«, und der dann, als er Morande sah, stehen blieb und sagte: »Ich dachte, jemand wie Ihr hätte einen Regenschirm dabei!«
Eine gehässige und alles andere als unbedarfte Äußerung, gab sie doch zu verstehen, Morande könne sich keine Kutsche leisten. Zipfelhirn war verschwunden, bevor Morande majestätisch seine herrschaftliche Equipage mit Familienwappen an der Wagentür besteigen konnte, während sich der Botschafter mit einer Mietdroschke begnügen musste. Trotz meiner Degradierung hatte ich meine Kalesche noch nicht preisgegeben, machte aber lieber einen belebenden Regenspaziergang, zumal Morande nicht angeboten hatte, mich in seinem Fuhrwerk nach Hause zu bringen. Allzu ungeduldig brannte er darauf, ans Drucken zu gehen, und beteuerte, bis zum Morgen wäre mein Dossier fertig.
Zu Hause zog ich mich in die Bibliothek zurück. Ich trug den goldenen Hausrock, den die Zarin mir in Sankt Petersburg geschenkt hatte und der eine genaue Nachbildung ihres eigenen war. Dieser Hausrock beschützte mich vor allen Kümmernissen. Ich setzte mich an den Kamin und vertiefte mich wieder einmal in Abaelards Historia Calamitatum. Sie ist bis auf den heutigen Tag mein Lieblingsbuch – die Leidensgeschichte eines denkenden Menschen. Mein halbes Leben lang habe ich nicht begreifen können, welche Beweggründe Abaelard hatte, den Untergang zu riskieren, seinen engsten Freund zu hintergehen und seine Arbeit als Philosoph zu vernachlässigen, und all das nur, um mit einer närrischen jungen Frau im selben Zimmer sein zu können. Abaelard hielt sich nicht damit auf, seine Ekstase zu erklären, sondern ging einfach davon aus, seine Leserschaft würde ihn schon verstehen, wie sie ja auch Hunger und Kälte verstand. Von achtzehn bis vierundvierzig, sechsundzwanzig Jahre lang habe ich immer zum dritten Kapitel vorgeblättert, in dem der Held für seine Leidenschaft bestraft, von vier Männern festgehalten und entmannt wird. Ich fand immer, dass das Buch erst danach richtig interessant wird, wenn Abaelard sich mit dem Leben als Eunuch abfindet. Erst in meiner Lebensmitte sollte ich auf den Anfang des Buchs zurückkommen und daraus lernen.
Der Türklopfer zu später Stunde riss mich aus meiner ergötzlichen Lektüre. James war fort und sah nach einer mir unbekannten erkrankten Ehefrau, und ich musste selbst die Tür öffnen. Morandes riesige Erscheinung stand zerzaust und mit nackten Beinen im Platzregen. Er verlangte, ich solle ihm nach draußen folgen.
Dem gebieterischen Ton eines großgewachsenen Mannes konnte ich noch nie widerstehen. In Hausrock und -schuhen folgte ich ihm in den Wolkenbruch hinaus, wo er mir bedeutete, in seine Kutsche zu steigen. Das Luxusgefährt war ihm wichtiger als seine Kinder. Sie brauchten neue Schuhe, aber Papa sparte, um die erdrückende neue Radsteuer zahlen zu können. In meiner Überraschung vergaß ich nachzufragen, als er erklärte, er brauche mich bei sich zu Hause. Dorthin hatte er mich noch nie eingeladen. »Das ist keine Ehre, sondern ein Muss«, sagte er. »Gib mir deinen Rock, mir ist kalt.« Der Rock der Zarin war ihm in den Schultern viel zu eng, und ich hörte die Nähte krachen, aber sogar in der Dunkelheit musste ich zugeben, er stand ihm gut. Übergangslos fing er an, gegen die Arbeiter zu wettern, die allesamt faul und undankbar seien. Stumm und fügsam saß ich in meinem dünnen Hemd und der Kniehose da, lauschte dem Hufgetrappel der Pferde auf der Straße und dem Trommeln des Regens auf dem Dach. Als seine Tirade endlich versiegte, fragte ich: »Wo ist denn deine Hose geblieben?« Daraufhin zog er vom Leder, wie ich eine so »dämliche« Frage stellen könne, und zeigte schließlich auf das Häufchen in einer Ecke der Kutsche. »Da. Besudelt mit dem Blut meines Arbeiters. Er hat immerzu Fehler gemacht. Ich war so edelmütig, ihn bei seiner Bruchbude abzusetzen. Du wirst mir helfen müssen. Es ist übrigens dein Meisterwerk.« Wir waren angekommen. Morandes Haus gehörte zu den schmalen umgebauten Stallungen hinter dem Hanover Square. Kaum war die Haustür hinter uns ins Schloss gefallen, hielt er mir eine tintenbespritzte Druckerschürze hin und befahl: »Anziehen.«
Kein Wunder, dass er nie Gäste empfing; im Wohnzimmer stand seine große gusseiserne Druckerpresse. Seine zart gebaute Frau kehrte uns den Rücken zu und mühte sich an der Maschine ab, reinigte sie und bereitete alles vor. Druckertinte hat ihr eigenes Bouquet, verführerisch wie Galle, die mit verrottendem Wurzelwerk gemischt worden ist – ein öliger Sud aus Ruß, Terpentin und Walnussöl. Alle Flächen waren dem nötigen Zubehör vorbehalten. »Meine Frau erklärt dir alles«, erklärte Morande. »Eine Lage hat sie schon gesetzt. Ich bin müde und muss schlafen. Außerdem sorgt das für deine Unsterblichkeit, nicht meine.«
Ich behielt die Frage für mich, woher die Blutergüsse in ihrem Gesicht und das blaue Auge stammten. Sie war schlicht gekleidet, trug einen braunen Wollkittel, und ihr blondes Haar türmte sich auf dem kleinen Kopf; eine kleine, sehr hübsche Frau, ein Landeskind der Bretagne, das nicht wie eine Kuh aussah. Sie schien von unverfälschter Fröhlichkeit und wandte sich über die Schulter an mich, während sie mit zwei schweren Kugeln hantierte, aus denen sie die Tinte auf den Druckstöcken verteilte. »Man braucht Augenmaß, das ich mitbringe, um die Tinte gleichmäßig einzuwalzen, man braucht Fingerfertigkeit, die ich mitbringe, um den Pressdeckel aufzusetzen, und Körperkräfte, um den Pressschwengel zu bedienen. Die Kräfte habe ich nicht!« Sie zeigte mir, wo ich mich hinstellen musste, um den schweren Hebel zu betätigen.