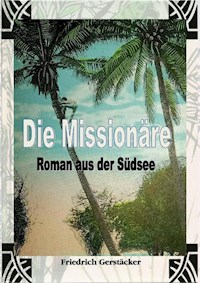
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Auch in diesem Roman entführt uns Friedrich Gerstäcker in die Südsee. Auf einer kleinen Insel landet Berchta, eine junge Adlige aus Deutschland. Ihre romantischen Vorstellungen, den Heiden der Südsee den christlichen Glauben zu bringen, lassen sie kopfüber in ein unglaubliches Abenteuer stürzen. Sie reist völlig unbedarft mit der Missionsgesellschaft in die Südsee, heiratet dort einen ihr bis dahin vollkommen unbekannten Missionar und lebt nun unter den Einheimischen. Zunächst erfolgreich, müssen die Missionare jedoch schon bald erkennen, dass sich der Häuptling der Insel nur taufen ließ, um mit Hilfe der Schusswaffen der Weißen die Insel zu unterwerfen und seinen Herrschaftsbereich auszubauen. Es kommt zum Krieg auf der idyllischen Insel, und Berchta ist mitten im Geschehen...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 898
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gesammelte Schriften
von
Friedrich Gerstäcker.
Zweite Serie, Fünfter Band.
Volks- und Familien-Ausgabe
Die Missionäre.
Roman aus der Südsee
Jena,
Hermann Costenoble Verlagsbuchhandlung.
Ausgabe letzter Hand, ungekürzt, mit den Seitenzahlen der Vorlage
Gefördert durch die Richard-Borek-Stiftung und Stiftung Braunschweigischer Kuilturbesitz
Friedrich-Gerstäcker-Gesellschaft e.V. und Edition Corsar, Braunschweig, 2021
Herausgegeben von Thomas Ostwald nach der von Friedrich Gerstäcker
eingerichteten Textausgabe für H. Costenoble
Geschäftsstelle: Am Uhlenbusch 17, 38108 Braunschweig
Alle Rechte vorbehalten! © 2016 / © 2021
Vorwort.
In den vorliegenden Blättern habe ich versucht, dem Leser die Missionäre und Missionen zu schildern, wie ich sie gefunden, wie sie von tausend Anderen gefunden wurden.
Ich will gern zugestehen, daß viele dieser Geistlichen aus innerer Ueberzeugung in ferne Welten gingen, daß sie dort nach ihrem Glauben und besten Kräften wirkten, und wenn das nicht immer in der rechten Weise geschah, wenigstens den guten Willen dabei hatten. Aber machten sie jene Völker wirklich glücklich, denen sie einen andern Glauben, andere Sitten brachten? - Der Erfolg zeigt, daß überall die Verbindung mit den Weißen allen wilden Völkern zum Verderben gereichte und sie ausrottete, und ich fürchte, ohne sie wirklich gebessert zu haben.
Ein wahrer Glaube kann nicht gewechselt werden, nur die Form wurde verändert, und wie noch heutigen Tages die mexikanischen Indianer alte kleine Götzenbilder hinter den christlichen Altären zu verbergen suchen und darin streng überwacht werden müssen, damit sie nicht in Gedanken zu ihren Bildern beten, so sehen auch fast alle wilden Völker nur in der Form den neuen Gottesdienst, und leider wird auch selten mehr von ihnen verlangt.
Ich habe in meinem Buche fast Nichts erfunden, sondern nur eine Kette von Thatsachen hingestellt, und diese zwar mit den verschiedenen Missionsschriften selber belegt. Ich wollte nicht Autoren citiren, die scharf und entschieden über das ganze Missionswesen abgeurtheilt haben.
Es ist naturgemäß, daß wenn wir wirklich glauben, nur unsere Religion könne zum ewigen Heil führen - Männer, die sich dazu ihren Lebensberuf gestellt, andere, ihrer Meinung nach im Irrthum befangene und dadurch in schlimme Gefahr gebrachte Völkerstämme zu retten suchen. - Aber die Sache wurde übertrieben und das, was nur aus reiner innerer Ueberzeugung hervorgehen kann: eine wirkliche Aenderung des Glaubens, zu einem Geschäft herabgewürdigt.
Was für Summen sind nicht allein aus Europa, besonders aus England herausgezogen worden, um Chinesen zu bekehren, und mit wie fabelhaft geringem Erfolg in jenes Land getragen, und haben wir selber in Europa so wenig Bedürftige, um solche ewige Collecten zu rechtfertigen?
Elend überall hier, wohin wir blicken, und doch werden Hunderttausende von Thalern jährlich auf solche romantische Zwecke vergeudet und unseren Armen hier entzogen.
Ich bin vollkommen gegen diese Sammlungen, über welche dem Publikum später nicht die geringste Controle zusteht.
Wie sie zum großen Theil verwandt werden, habe ich aus eigener Anschauung gesehen, und dabei in vielen fremden Ländern beobachten können, in welcher Weise das Christenthum verbreitet und von den verschiedenen Stämmen aufgefaßt wurde.
Ich will den Geistlichen selber mit diesem Buch nicht zu nahe treten und ihnen wissentlich nicht Unrecht thun, aber ich schildere auch treu ihre Wirksamkeit, wie sie in der That noch heutigen Tages, ja oft in weit verschärftem Maße besteht.*)
Nichts habe ich von den Verfolgungen der verschiedenen Seelen untereinander erzählt, die viel, viel Blut, besonders auf Tahiti gekostet haben und sogar, wie z. B. aus Neuseeland, nicht allein zwischen Protestanten und Katholiken, nein sogar unter protestantischen Secten selber stattfanden.
Ich habe treu und wahr zu schildern gesucht, was wirklich geschehen ist und noch bis auf den heutigen Tag geschieht, und übergebe dem Leser das Buch in der festen Ueberzeugung, recht gehandelt zu haben.
August 1868.
Der Verfasser.
*) Eine höchst interessante Zusammenstellung über die Wirksamkeit der Missionäre in Indien, China -etc. giebt Ernst Friedrich Langhans, Pfarrer in Waldau bei Berlin, in seinem bei Otto Wigand (Leipzig) erschienenen Buch: „Pietismus und Christenthum im Spiegel der äußern Mission."
1.
Schloß Schölfenstein.
An den Ausläufern des Erzgebirges, unmittelbar über einem breiten, prächtigen Bergwasser, das sprudelnd von den bewaldeten Höhen herunterkam und lustig über die bräunlich blitzenden Kiesel hinwegsprang, lag ein altes Waldschloß, der Schölfenstein genannt, das man von Weitem und das Thal heraufkommend recht gut hätte für eine Ruine vergangener Zeiten halten können. Ein halbverfallener Thurm überragte nämlich das Ganze, und links davon lag eine ebenfalls eingestürzte Kapelle, die, von Epheu überwuchert, einen höchst malerischen Anblick bot. Das Schloß selber aber, aus dicken, gewaltigen Mauern aufgeführt, war im Innern noch vollkommen gut erhalten, ja sogar wohnlich eingerichtet, und dabei der Lieblingsaufenthalt des alten Barons von Schölfe, der hier wenigstens acht Monate vom Jahre mit seiner einzigen Tochter verbrachte.
Der alte Baron war eigentlich noch ein ächtes Stück aus der alten Zeit und mit so wunderlich gemischtem Charakter, wie man sie jetzt wohl nur selten findet; allerdings ein Edelmann von „altem Schrot und Korn", grundehrlich, schlicht und recht, ein vortrefflicher Reiter und ausgezeichneter Schütze wie leidenschaftlicher Jäger, und dabei derb und geradeaus, aber auch zugleich einer entschieden frommen, ja fast bigotten /2/ Richtung angehörend, die sich, da ihm kein besonderer Einfluß nach außen zu Gebote stand, mit desto größerem Eifer auf seine eigenen Unterthanen und Bauern warf.
In seiner Jugend sollte er anders gewesen sein, und aus dieser rührte noch einer seiner Jäger, der alte Claus, her; aber er heirathete in eine sehr fromme Familie, und mit jener doch schon in ihm schlummernden Neigung zur Schwärmerei, mit der er sich z. B. besonders für die Kreuzfahrer begeistert hatte und stolz war, einen seiner Ahnen zu ihnen zu zählen, wuchs dies Gefühl von Jahr zu Jahr.
Seine sämmtliche Dienerschaft mußte jeden Sonntag regelmäßig den Gottesdienst besuchen, und zwar abwechselnd, an einem Sonntag ein Theil den Morgen-, ein anderer den Nachmittags-Gottesdienst, und wer sich da säumig zeigte, konnte nur gleich sein Bündel schnüren. Ja, als die gnädige Frau noch lebte, las diese nach ächt patriarchalischer Sitte den Leuten Abends selber fast eine Stunde lang aus der Bibel vor, und konnte ernstlich böse werden, wenn Einer oder der Andere dabei einmal aus Versehen einnickte.
Den Leuten war damit natürlich nicht gedient, und sie hätten sich lieber in einer andern Weise unterhalten; einige kündigten sogar, aber die meisten fügten sich doch, denn der Dienst war ein vorzüglicher und der Herr besonders so gut mit den Leuten, daß sie sich keinen besseren wünschen konnten.
Der Baron hatte eine einzige Tochter, die er, der alten deutschen Zeit anhängend, Berchta genannt. Das Kind bekam eine wunderlich gemischte Erziehung, der ähnlich, wie sie der Charakter des Vaters abstrahlte, halb ritterlich, halb religiös, und als die Mutter, da Berchta kaum vierzehn Jahre zählen mochte, starb und der Vater jetzt den größten Theil seiner Zeit auf dem Schölfenstein verbrachte, fast mehr das erstere als das letztere. Sie mußte vor allen Dingen reiten lernen, um ihn auf seinen Spazierritten zu begleiten, und wie sie kaum sechzehn Jahre alt war, übte er sie sogar im Pistolen- und Gewehrschießen, und nahm sie dann mit hinaus auf die Jagd.
Berchta wuchs heran, und ein lieblicheres Wesen ließ sich kaum auf der Welt denken. Von schlanker, fast zarter, an-/3/muthiqer Gestalt, ganz das Ebenbild ihrer seligen Mutter, konnten ihre Züge wirklich schön genannt werden. Die Nase war edel geformt, der kleine Mund fein geschnitten, und wenn sie lachte, zeigte sie zwei Reihen perlengleicher Zähne und ein tiefes Grübchen in jeder Wange. Volles, lockiges, kastanienbraunes Haar umwallte ihr Haupt, und sonderbar stachen dagegen die wunderbar schönen blauen Augen ab, die sich so selten zugleich mit dunkeln Haaren finden. Die unweibliche Beschäftigung der Jagd hatte aber keinen nachtheiligen Einfluß auf ihr Benehmen ausgeübt. Sie glich in keiner Weise jenen sogenannten „emancipirten" Frauenzimmern, die gerade darin etwas suchen, ihre schönste Zierde - schüchterne Weiblichkeit - abzustreifen. Sie war frei und offen in ihrem ganzen Wesen, ohne je auch nur um eines Haares Breite die Grenzen zu überschreiten, welche zarte Sitte um ihr Geschlecht gezogen.
Aber in den blauen Augen lag auch eine tiefe Schwärmerei, ein Erbtheil, und zwar ein gefährliches, der Mutter, und fand allerdings in den vielen einsamen Stunden, die sie hier verleben mußte, reichliche Nahrung.
Berchta war tief religiös, aber ihr gesunder, klarer Geist bewahrte sie doch vor einer Uebertreibung dieser Tugend, die so leicht in ein bigottes Formenwesen ausartet. Der Tod der Mutter ergriff furchtbar ihr weiches Gemüth und nährte mit den schon in ihr Herz gelegten Keim, der ihr die ganze Seele bald mit einem unerklärlichen Sehnen erfüllte.
Die Erziehung des Vaters, der sie fortwährend mit hinaus in Feld und Wald nahm, diente allerdings dazu, sie in etwas davon ab- und der Erde wieder mehr zuzuwenden, aber ganz unterdrücken konnte er diese geistige Anspannung nicht, ja er gab ihr auf der andern Seite - selbst bei dieser Erholung - frische Nahrung.
Die Kreuzzüge waren, wie schon erwähnt, sein Lieblingsthema, ja er hatte sogar einmal seinen Vorfahr, der eine Streitaxt in Form eines Kreuzes geführt haben sollte, poetisch besungen und das Gedicht dann, da keine größere Zeitung veranlaßt werden konnte es aufzunehmen, in das Kreisblatt einrücken lassen. Von diesen Kreuzzügen erzählte er auch am liebsten, und hatte sich in der That eine ganze Bibliothek /4/ darüber angeschafft, in der auch Berchta natürlich fleißig lesen mußte.
Dadurch bekam ihre Schwärmerei ein bestimmtes Ziel. Sie konnte sich dafür begeistern, daß es Menschen gegeben hatte, die ihr Leben einsetzten, um das Grab des Heilands den Bekennern des Islam nicht allein zu entreißen, sondern auch dadurch wieder das Christenthum auf jenen Boden zu pflanzen, von dem es ausgegangen war und sein Licht über die ganze Erde verbreitet hatte.
Warum war sie kein Mann geworden - warum nicht in einer Zeit geboren, in der sie selber Theil an solchen Gefahren nehmen konnte! Ach, wie gern hätte sie freudig ihr Leben hingegeben, um ein so hohes, so seliges Ziel erreichen zu helfen!
Ein wenn nicht täglicher, doch sehr häufiger Gast im Schlosse war der Diakonus des Ortes.
Unter dem Schölfenstein, und kaum ein halb Stündchen davon entfernt, lag das kleine Städtchen Rothenkirchen. Der Pastor aber, der schon seit längerer Zeit kränkelte, hatte einen Diakonus beibekommen, um ihn in seinen Predigten zu unterstützen, und dieser erwies sich denn auch bald für den Baron als ein wahrer Schatz in seiner Einsamkeit. Kästner, wie der Diakonus hieß, war ein durchaus gebildeter, tüchtiger junger Mann, der zugleich mit einem bedeutenden musikalischen Talent einen Lieblingswunsch des alten Herrn von Schöffe erfüllen und Berchta in der Musik unterrichten konnte. Aber dabei blieb es nicht; das junge, damals kaum der Schule entwachsene Mädchen, dessen reger Geist eine entsprechende Beschäftigung verlangte, sehnte sich selber nach einer solchen, und ihr Vater bewilligte gern, daß der Diakonus auch noch einen Cursus von Literatur und Kirchengeschichte - inclusive „Kreuzzüge" - hinzufügte. Gehörte der Diakonus doch einer streng orthodoxen Richtung an, und es war deshalb nicht zu fürchten, daß er schädliche Lehren in die Brust des noch halben Kindes pflanzen würde.
Aber Diakonus Kästner war auch noch in anderer Weise im Schlosse willkommen, denn er spielte nicht allein sehr gut Clavier, sondern auch eben so fertig Schach und Piquet, und zeigte sich dadurch also nach allen Seiten nützlich, ja fast un-/5/entbehrlich. Uebrigens war er in seinem ganzen Wesen gerade das Gegentheil von dem alten Baron, der eben derb und rauh seinen geraden Weg durch's Leben ging und ohne Scheu herauspolterte, was und wie er's meinte. Kästner dagegen, obgleich wahrscheinlich eben so rechtschaffen in seinen moralischen Ansichten und dabei, was der alte Baron nicht war, gründlich gebildet und belesen, hatte - in sehr gedrückten Verhältnissen erzogen - das Gefühl der Freiheit und Ungebundenheit, das jenem eine so große Sicherheit verlieh, nie kennen gelernt. Er war, so lange er denken konnte, immer von anderen, fremden Menschen abhängig, und der erste Lichtblick in seinem Leben eigentlich der gewesen, als er die Stellung als Diakonus in Rothenkirchen bekam.
Aber Kästner war ehrgeizig, und der Umgang mit dem Baron schmeichelte zuerst seiner, darin allerdings unschuldigen Eitelkeit, während es ihm Freude machte, das noch blutjunge, aber bildhübsche Mädchen, dessen reiche Fähigkeiten er bald erkannte, heranzubilden und zu unterrichten.
Doch die Jahre vergingen; Berchta wurde älter, und während sie in Allem, worin sie Kästner unterrichten konnte, erstaunlich rasche Fortschritte machte, erwachte in dem Diakonus selber allmälig und unbewußt ein Gefühl für die Jungfrau, vor dem er, als er es entdeckte, erschrak.
Allerdings kämpfte er ernstlich dagegen an; er suchte sich klar zu machen, wie wahnsinnig eine solche Leidenschaft für ihn, den armen Diakonus, sein müsse; aber was richtet überhaupt Vernunft gegen Liebe aus? Nach einiger Zeit begann er schon in seinem Herzen das Für und Wider solcher aufkeimenden Hoffnungen zu erwägen, bei denen das Wider freilich sehr das Für überwog. Wenn der alte Baron überhaupt auf etwas stolz genannt werden konnte, so war er das auf seine Ahnen und sein Kind, und trotzdem baute Kästner auf dessen streng frommes Gemüth seine Hoffnung. Er wußte auch, wie der alte Herr an seinem Kinde hing, und sah er wirklich, daß sich Berchta auch unter bescheidenen Verhältnissen
glücklich fühlen würde, hätte er da nicht doch vielleicht seinen alten Ahnenstolz vergessen?
Aber das Alles mußte ja doch der Zeit überlassen bleiben, /6/ und Diakonus Kästner war auch der Mann dazu, um diese geduldig abzuwarten. Selber ziemlich heftiger Gemüthsart, hatte er solche mit zäher Willenskraft zu bändigen gewußt und sich, schon von der Liebe zu Berchta dabei getrieben, den Launen des alten Herrn so angeschmiegt, daß sich dieser wirklich keinen besseren Gesellschafter wünschen konnte. Ein Streit fiel zwischen ihnen in ihrer Unterhaltung niemals vor. Ueber Religion waren sie fast vollständig einerlei Meinung, das Thema also zu monoton, um es weiter zu behandeln, und über Politik wurde, nach stillschweigendem Uebereinkommen, wenig oder gar nichts gesprochen, da der alte Herr, wenn er auch in seinen Kreisen einer sehr freisinnigen Richtung angehörte, doch in seinen Ansichten mit dem weit radicaleren Diakonus noch ziemlich auseinanderging. Dafür aber hatten sie ein anderes Thema, auf welchem sie sich desto ungestörter und harmonischer bewegen konnten: die Forstwissenschaft.
Kästner, der mit der ihm eigenen Gewandtheit Alles ergriff, was ihn interessirte, war bei seinen tüchtigen Vorkenntnissen in Naturwissenschaften und mit der Gelegenheit umher ein ganz tüchtiger Forstmann geworden, und dabei - allerdings nicht zufällig - auf die Lieblings-beschäftigung des Barons gerathen. Dieser bedauerte auch in der That nichts weiter, als daß der junge Geistliche nicht auch Jäger und Schütze wäre, um ihn manchmal mit auf die Jagd hinaus zu nehmen. Dafür hatte aber Kästner keinen Sinn, und wenn er auch anfangs, dem alten Herrn zu Liebe, ein paar Mal mitfuhr, so hätte das doch beinahe ein böses Ende genommen und der Diaconus einen der Treiber erschossen. Die Kugel ging dem armen Teufel wenigstens zwischen Hemd und Haut durch, und es kostete dem Baron damals viel Geld, um die Sache zu vertuschen, damit sie nicht dem Consistorium zu Ohren kam.
Von da an lud er ihn nie wieder mit zur Jagd ein, ging aber desto öfter mit ihm im Walde spazieren, um die neuen Culturen anzusehen oder frische Anlagen zu besprechen. So, mit seiner Partie am Abend und dem Unterricht der Tochter, war Kästner nicht allein ein gerngesehener, nein, unentbehrlicher Gast im Schlosse geworden, und selbst Berchta /7/ fühlte sich einsam, wenn sie ihn einmal einen Tag entbehren
Und Berchta wuchs heran; sie wurde achtzehn und zwanzig Jahre, und mit ihr wuchs in Kästner's Brust die Leidenschaft für das junge, wunderschöne und so liebliche Mädchen. Wohl sagte er sich oft, wie unmöglich es sein würde, den alten, adelsstolzen Baron zu einer Einwilligung zu vermögen, und dann auch wieder, wenn er mit diesem und Berchta manchen Abend über altvergangene Scenen sprach, und der Baron nicht aufhören konnte, die Alles opfernde Liebe der Kreuzfahrer zu schildern, und Berchta ihm zustimmte, wie es ein seliges Gefühl sein müsse, für eine gute und edle Sache Allem zu entsagen, an dem bisher unsere Seele gehangen, - kehrte frische Hoffnung in sein Herz ein.
Von jetzt an suchte er in seinen Geschichtsstunden die Beispiele edler Frauen vor, die allem Glanz, aller Hoheit entsagt hatten, um allein dem zu folgen, was sie für ihre Pflicht, für ihren Beruf hielten, und fand für solche Lehren ein nur zu empfängliches Herz, einen nur zu begierig horchenden Geist. Besonders waren es Erzählungen aus der Missiousgeschichte, die für Berchta insofern doppeltes Interesse hatten, als sie den Reiz der Neuheit und des Fremdartigen mit all' dem verbanden, für das bisher ihr Herz in Mitgefühl geschlagen.
Selbst der alte Baron fing zuletzt an, sich für die Sache zu begeistern. Er schaffte einige der Reisewerke an, die ihm Kästner empfahl, hielt die verschiedenen Missionsschristen, und bedauerte nur immer, daß er selber schon zu alt sei, um all' die Herrlichkeiten jener fremden Welt und die Wunder, die dort der liebe Gott durch fromme Diener seines Wortes geschehen lasse, mit eigenen Augen zu schauen.
Fast hörbar schlug dem jungen Manne aber das Herz in der Brust, als Berchta einst mit leuchtenden Blicken sagte, daß es doch gewiß ein großes, herrliches Wagniß, das größte eigentlich, was eine F r a u unternehmen könne, sein müsse, dort hinaus in die Fremde zu ziehen, um wilden, barbarischen Völkern, die in dem Fluch der Finsterniß lebten, den Segen und das Licht des wahren Glaubens zu bringen, und sie /8/ könne ein solches Loos nur als ein von Gott bevorzugtes betrachten.
„Aber, gnädiges Fräulein," warf da Kästner ein, nur um diese Gesinnung in Gegenwart des alten Barons auf die Probe zu stellen, „Sie, die Tochter eines altadeligen Geschlechts, würden sich nicht davor scheuen, als die Frau eines armen, niedrig geborenen Missionspriesters Ihr Leben zu beschließen ?"
„Und adelt ihn nicht sein Stand?" rief da Berchta begeistert aus. „Denn was haben die alten Kreuzfahrer mehr gethan, von denen Vaters Bücher so viel erzählen? Ja, wohl je so viel? Diese zogen nur in großen Heeren und mit Allem ausgerüstet in ein feindliches Land, das Schwert an der Seite, während jene frommen Männer, blos ihre Bibel in der Hand und auf Gottes Schutz vertrauend, sich mitten hinein zwischen Kannibalen und blutdürstige Heidenstämme wagten, und freudig unter tausend Entbehrungen der guten Sache ihr Leben zum Opfer brachten. Das sind Helden, und was wiegt selbst dagegen ein alter Stammbaum und Name, was ein edles Geschlecht?"
Kästner sah den Baron an. Es schien fast, als ob dieser etwas darauf erwidern, dagegen einwenden wolle; aber im Princip war er mit der Sache vollkommen einverstanden, und da es sich hier nur um ausgesprochene Gefühle handelte, durfte er seinen früher geäußerten Grundsätzen nicht untreu werden. Er war mit seinen eigenen Waffen geschlagen worden.
Von diesem Abend an schöpfte Kästner neue Hoffnung, er sah eine Möglichkeit vor sich, den Adelsstolz des alten Barons zu besiegen, wenn er sich nur erst einmal das Herz der Tochter gewinnen und sichern konnte. Er hatte Berchta wirklich recht von Herzen lieb und die feste Ueberzeugung, daß er sie einst als Gattin glücklich machen werde. Er strebte auch nicht nach dem Geld und Gut des Vaters, oh wie gern hätte er alledem entsagt, wenn er nur hoffen durfte, daß Berchta an seiner Seite sich mit einer bescheidenen Existenz begnügen würde; aber er bemerkte auch nicht, daß er in ihren Augen irgend einen Fortschritt mache, und kein einziges, selbst kleines /9/ Zeichen verrieth ihm, daß die geringste Liebe zu ihm in ihrem Herzen keime..
Sic nahm alle die Aufmerksamkeiten, die er ihr bewies, so unbefangen hin, daß er dadurch stets in seinen eigenen Schranken gehalten wurde. Sie war immer freundlich, ja herzlich mir ihm, ohne aber nur je mit einer Miene, mit dem Zucken einer Wimper zu verrathen, daß er ihr mehr sei, als ein geachteter Lehrer und Freund. Ja selbst bei den Liedern, die er sie lehrte und die sie mit ihrer glockenreinen Stimme in wunderbar zum Herzen gehend sang, sprach sich wohl ein tiefes Gefühl aus, das aber, wie sich Kästner nicht verhehlen konnte, noch keinem bestimmten Ziel entgegenstrebte. Es lebte wohl, von einem innern Feuer genährt, in ihrem Herzen, aber es konnte noch keinen Weg in's Freie gefunden haben.
Aber Kästner, von Jugend auf an Entsagung gewöhnt, hatte auch dabei gelernt, Geduld zu üben. Er war sich in seiner Liebe zu Berchta keiner unrechten Handlung bewußt, denn er sah darin mir ein rein menschliches Gefühl. So hoch stand das gnädige Fräulein vom Schälfenstein ja doch auch nicht über ihm, daß ein braver, rechtschaffener Mann - wenn er auch dem Bürgerstand angehörte - hätte zurückschrecken müssen, um ihre Hand zu werben. Er hoffte auf die Zeit und that indessen Vater wie Tochter, was er ihnen an den Augen absehen konnte.
Alle hatten ihn auch gern; nur Eine Person im Schlosse gab es, die ihn nicht leiden konnte, und das war der alte Claus, das Factotum des Barons, der dessen Pferde überwachte, seine Hunde fütterte, seine Gewehre in Ordnung hielt, seine Patronen machte und so ziemlich Alles im Schloß besorgtc, was eben in derlei Dingen zu besorgen vorkam.
Der alte Claus war ein Erbstück im Hanse, eigentlich mit dem alten Baron auch aufgewachsen, und galt bei diesem viel. So lieb er aber den Baron hatte, recht fromm war er, trotz der Kirchenzucht im Hause, doch nicht geworden. Er ging allerdings jeden Sonntag in die Predigt - weil er eben mußte, aber er profitirte wenig davon, denn er schlief die meiste Zeit, und wenn er nicht in Gegenwart seines Herrn manchmal fluchte, weil dieser das unter keiner Bedingung ge-/10/stattete, so machte er dafür draußen im Walde desto öfter seinem Herzen Luft und meinte dann immer, so ein „Heiliges Kreuz-Donnerwetter“ könne Einem der liebe Herrgott nicht übel nehmen, denn wenn man das immer hinunterschlucken müßte, so sei es gerade so, als ob Einer niesen wolle und dürfte nicht.
Der alte Baron, dem das natürlich kein Geheimniß blieb, machte ihn deshalb auch oft herunter und nannte ihn einen schweren Sünder und Heiden nach dem andern, drohte auch, ihn fortzuschicken, weil er keinen so unchristlichen Charakter in seinem Hause dulden wolle. Er aber hätte so wenig ohne Claus leben können, wie dieser ohne ihn und das „gnädige Fräulein", das er liebte, als ob es sein eigenes Kind gewesen wäre.
Claus hatte eine Abneigung gegen den Diakonus - weshalb, wußte er selber nicht. Wie oft finden wir ja das im Leben, daß wir uns zu diesem hingezogen, von anderem abgestoßen fühlen, ohne im Stande zu sein, einen wirklichen Grund dafür anzugeben. Aber dies Gefühl wurde ihm zuletzt unbehaglich; er mußte sich darüber gegen irgend Jemanden aussprechen und that das gegen den alten Baron, als er einst mit ihm draußen im Walde war. Bei dem aber kam er an den Unrechten, denn dieser wußte die guten Eigenschaften des jungen Geistlichen wohl zu schätzen und duldete überhaupt nicht, daß sich irgend wer von der Dienerschaft über Jemanden aufgehalten hätte, mit dem er verkehrte.
„Weißt Du etwas Bestimmtes gegen den Herrn?" schnauzte er Claus mit einer Miene an, die diesen schon bereuen ließ, auch nur Ein Wort gesagt zu haben.
„Bestimmtes - nein," stotterte er; „ich - ich meinte nur, daß er in seinem ganzen Wesen -"
„Dann halte künftig Dein Maul," fuhr der Freiherr fort, „und untersteh' Dich nicht, mir je wieder mit so etwas unter die Augen zu kommen, oder - wir sind die längste Zeit Freunde gewesen!"
Damit mußte Clans abziehen, und daß ihn der Verweis nicht günstiger gegen den Geistlichen stimmte, läßt sich denken. So sehr er aber auch von da ab aufpaßte, um irgend etwas /11/ gegen ihn aufzufinden und seinem Herrn einen Beweis bringen zu können, es war nicht möglich; denn Kästner, wenn auch wohl ohne Ahnung, daß er so scharf beobachtet wurde, that ruhig seine Pflicht, verkehrte mit dem Baron und dem gnädigen Fräulein nach wie vor, und zeigte sich dabei in seiner Gemeinde, besonders gegen die ärmeren Familien, stets so teilnehmend und freundlich, und suchte, wo er das irgend konnte, ihre Noth zu lindern oder ihnen wenigstens Trost zuzusprechen, daß er schon lange der Liebling des ganzen Städtchens geworden war. Die Leute sprachen es auch ganz offen und unumwunden aus, daß sie einen besseren Geistlichen in ihrem ganzen Leben nicht verlangten.
2,
Der Missionsprediger.
In diese Zeit fiel es, daß ein protestantischer Missionsprediger jenen Theil Deutschlands bereiste. Dieser hielt nicht allein in den größeren Städten seine Vorträge über das Missionswesen und dessen Erfolge, sondern suchte selbst kleinsten Ortschaften auf, ja sprach sogar von größeren Dorfkanzeln herab zu den aufmerksam lauschenden Zuhörern und forderte sie zur Unterstützung des großen Werkes auf, das den Heiden und Götzenanbetern in fernen Welten den Segen des Christenthums und der Civilisation bringen sollte.
Schon viele Wochen vorher hatten sich die Zeitungen mit dem merkwürdigen Manne beschäftigt und von seiner glühenden Beredsamkeit sowohl, wie von den Schicksalen gesprochen, die ihn selber in jenen wilden Ländern und unter den noch wilderen Stämmen betroffen. Wie oft war er in Lebensgefahr gewesen, wie unzählige Male hatte schon die Kriegskeule des Wilden oder das Opfermesser über seinem Haupt geschwebt! /12/
Aber allen den Gefahren bot er ruhig, von Gott beschützt, die Stirn, allen war er entgangen, und kühn und unerschrocken schmetterte er dem Racheschrei der Feinde gegenüber die Götzenbilder zur Erde nieder, und pflanzte an deren Statt das Kreuz des Erlösers auf. So wenigstens lauteten die Berichte.
Der alte Baron von Schölfe hatte die Artikel auch gelesen und sich dadurch in eine ganz eigene Aufregung versetzt gefühlt. Das war einer der alten Kreuzfahrer, wie er sich selber sagte; das war ein Mann, wie sie nur vorige Jahrhunderte gesehen, voll Muth und Ausdauer, allen Ent-behrungen, allen Gefahren trotzend und stets bereit, sein Leben dem zu weihen, dem er seine ganze Seele schon so lange zu eigen gegeben. Es gewährte ihm deshalb eine ganz entschiedene Befriedigung, als er noch an dem nämlichen Abend von dem Diakonus erfuhr, daß der ehrwürdige Mr. Johnson, ein Engländer von Geburt, der aber auch einen ganz vortrefflichen deutschen Brief schrieb, dem Geistlichen in Rothenkirchen die Meldung gemacht habe, daß er selber in den nächsten Tagen dorthin kommen und einen Vortrag über das Missionswesen halten würde. Gastfrei überhaupt im höchsten Grade, erklärte er dem Diakonus denn auch augenblicklich, daß der Mann hier bei ihm auf dem Schlosse wohnen müsse.
Ganz gegen sein Erwarten schien sich aber Kästner keineswegs über das Eintreffen des Geistlichen so zu freuen, wie er nach seinen früheren Reden erwartet haben mochte. Ja er machte sogar einige Einwendungen: man wisse doch nicht, mit was für einem Mann man es zu thun bekomme. In den Zeitungen würde viel geschrieben - es wäre vielleicht besser, ihn vorher kennen zu lernen, und anderes Derartiges mehr. Wenn sich aber der alte Baron einmal etwas in den Kopf gesetzt hatte, so war er auch nicht so leicht wieder davon abzubringen.
Und was konnte der Mann nicht Alles von seinen Reisen erzählen; was hatte er nicht erlebt, und welchen tiefen Einblick mußte er durch ihn in das Missionswesen selber bekommen! Es blieb unfehlbar dabei, was er gesagt, und er setzte sich sogar augenblicklich hin, um einen Brief an den ehr-/13/würdigen Mr. Johnson zu schreiben, in welchem er ihn auf das Freundlichste und Herzlichste einlud, für die Dauer seines Aufenthaltes in Rothenkirchen den Scholfenstein zu seinem Absteigequartier zu benutzen; ja der Diakonus mußte versprechen, den Brief gleich am nächsten Morgen mit der richtigen Adresse zu versehen und zu befördern.
Der Baron erhielt allerdings keine directe Antwort auf sein Einladungsschreiben; aber vier Tage später kam plötzlich ein Junge aus dem Dorf heraufgelaufen und brachte eine Karte von dem indessen eingetroffenen Missionär. Auf dieser zeigte ihm Mr. Johnson nur mit wenigen Worten an, daß er Rothenkirchen erreicht, noch Einiges mit dem Geistlichen unten im Ort zu besprechen habe und dann unverzüglich dem Boten nachfolgen werde.
Der alte Herr fand das auch ganz in der Ordnung. Es gefiel ihm sogar, daß der Fremde keine weiteren Umstände machte und das freundliche Anerbieten eben so unumwunden annahm, wie es geboten worden. Er war selber kein Freund von langen Weitläufigkeiten, und dieser Herr Johnson hatte draußen in anderen Welttheilen auch wohl eben so oft Gastfreundschaft geboten, wie sie von Anderen empfangen. Dann betrachtet mau etwas Derartiges eben als selbstverständlich, ohne weiter ein Aufheben davon zu machen. Was wußte der Missionär, der vielleicht die Stammbäume von zahllosen indianischen Königen im Kopfe hatte, auch von dem uralten Geschlecht derer von Schölfe - er hätte sonst seinen kurzen Brief jedenfalls etwas anders abgefaßt.
So vergingen noch mehrere Stunden, und der alte Baron hatte allerdings schon nach einem vorfahrenden Wagen ausgehorcht, als es plötzlich an seine Thür klopfte und diese sich auf sein etwas erstauntes „Herein" auch unmittelbar öffnete. Auf der Schwelle aber stand Mr. Johnson, eine lange, hagere Gestalt mit vorstehenden Backenknochen, kleinen, grauen, aber lebendig umherfahrenden Augen, etwas bleicher Farbe und fest zusammengekniffenen Lippen, aber mit einem unzweifelhaft ausdrucksvollen und intelligenten Gesicht, einfach, aber natürlich schwarz gekleidet, den runden Hut in der Hand, und sagte mit tiefer, klangvoller Stimme: /14/
„Ich weiß nicht, ob ich die Ehre habe, den Freiherrn von Schölfe in Ihnen zu begrüßen?"
„Mein Name ist von Schölfe," sagte der Baron, sich unwillkürlich von seinem Stuhl erhebend.
„Dann erlauben Sie mir," erwiderte der Fremde, „mich Ihnen als Josua Johnson, den Missionsprediger, vorzustellen, den Sie so freundlich waren in Ihr gastliches Haus zu laden. Ich hoffe, ich falle Ihnen hier nicht zur Last -"
„Mein lieber Herr," sagte der Baron herzlich, „Sie sind uns so willkommen, wie die Blumen im Mai. Wo haben Sie Ihre Sachen? Die Zimmer für Sie stehen schon seit einigen Tagen bereit."
„Es ist sehr wenig, was ich bei mir führe," lächelte der Fremde, „denn immer auf Reisen, gewöhnt man sich an Einschränkungen und betrachtet eigentlich jedes Haus nur als ein flüchtiges Bivouak. Ich werde Ihnen auch nicht lange beschwerlich fallen, denn mein Weg ist noch weit, und ich darf darauf nicht rasten."
„Von Beschwerlichfallen kann gar keine Rede sein," lächelte der alte Herr, „wir haben sehr viel Raum im Schlosse und genügend in Küche und Keller, also bitte, thun Sie, als ob Sie zu Hause wären."
Damit reichte er ihm in seiner offenen Weise die Hand, die der Missionsprediger auch nahm und herzlich schüttelte. Er hatte Menschenkenntniß genug, um im Augenblick zu sehen, daß der alte Baron jedes Wort, das er sprach, auch ebenso meinte. Das Weitere nahm auch keine lange Zeit in Anspruch; ein Diener wurde gerufen, um den Gast in sein Zimmer zu führen; sein Gepäck - ein einziger kleiner Lederkoffer - war schon hinübergeschafft worden, und er wurde dort sich selber überlassen, um erst wieder gerufen zu werden, wenn das Mittagessen bereit sein würde. Aber er brauchte, wie es schien, zu seiner Toilette nicht besonders lange Zeit, denn kaum eine Viertelstunde später zeigte er sich schon wieder unten im Garten, wo er sich auf das Eifrigste mit den dort blühenden Pflanzen beschäftigte und den Gärtner auch nach Manchem in einer Weise fragte, die deutlich verrieth, daß er selber etwas davon verstand. /15/
Noch war er damit beschäftigt, als er Schritte auf dem Kies hörte und, aufschauend, sich einer allerdings ungewöhnlichen, wenn auch sehr lieblichen Erscheinung gegenübersah. Es war Berchta, die eben mit Claus, ihrem steten Begleiter, aus dem Wald zurückkehrte und den näheren Weg durch den Garten eingeschlagen hatte, um zum Schlosse zu gelangen. Natürlich vermuthete sie keinen Fremden darin zu finden.
Sie trug ein leichtgeschürztes, hellgraues Kleid, darüber eine ebensolche joppenartige Jacke mit grünen Aufschlägen und Kragen, einen grauen kleinen Hut mit ein paar Birkhahnfedern darauf, und über der Schulter eine leichte und sehr zierlich gearbeitete Doppelflinte, während Claus, der hinter ihr herkam, einen alten Jagdranzen umhängen hatte, aus welchem als heutige Siegestrophäe die rothe buschige Lunte eines erlegten Fuchses herausschaute.
Berchta sah wirklich bildhübsch aus; von dem scharfen Gang war ihr Gesicht geröthet; der gute Schuß, den sie heute Morgen gethan, gab dabei ihrem Auge einen eigenthümlich lebendigen Glanz, und unter dem kleinen kecken Jagdhut quoll die Fülle der dunkeln Locken reich hervor. Johnson, der Missionsprediger, war auch in der That frappirt von der plötzlich vor ihm stehenden Gestalt der Jungfrau und grüßte befangener, als es sonst wohl seine Sitte war. Berchta aber, die ja wußte, welcher Gast erwartet wurde, und schon aus dem Schnitt des dunkeln Rocks den Geistlichen erkannte, hatte rasch errathen, wen sie vor sich sah.
„Ehrwürdiger Herr," sagte sie freundlich, „ich vermuthe in Ihnen den schon seit einigen Tagen erwarteten Herrn Johnson zu sehen. Habe ich Recht?"
„Allerdings, mein - gnädiges Fräulein," sagte der Geistliche fast verlegen.
„Dann erlauben Sie mir, daß ich mich Ihnen selber vorstelle. Ich hin die Tochter vom Haus, Berchta mit Namen, und fürchte fast, ich habe durch mein etwas längeres Ausbleiben heute das Diner verzögert, aber der Bursche da drin, er Fuchs, machte uns so viel zu schaffen, bis wir ihn aus seinem Bau bekamen, und ohne meinen kleinen wackern Waldmann da, den Teckel, wäre es uns auch gar nicht gelungen." /16/
„Ich habe gar nicht gewußt," sagte Johnson wirklich etwas verlegen, ,,daß in Deutschland auch Damen der Jagd obliegen."
Berchta erröthete leicht. ,,Es geschieht auch nicht so häufig," erwiderte sie lächelnd, „aber hier in unserer Abgeschiedenheit bin ich von meinem Vater, da ich die Mutter so früh verloren, fast wie ein Knabe erzogen worden. Doch" - setzte sie rasch hinzu - „ich vertrödle durch mein Plaudern nur noch immer mehr Zeit; aber Sie sollen sehen, daß ich rasch Toilette machen kann. Ich werde Ihre Geduld nicht zu sehr auf die Probe stellen."
„Mein gnädiges Fräulein -"
Berchta wendete sich schon ab. „Bring den Fuchs in den Hof, Claus," rief sie dem Jäger zu, „nach Tisch wollen wir dann die jungen Teckel daran lassen und sehen, wie sie sich benehmen," und mit freundlichem Gruß gegen den fremden Geistlichen eilte sie leichten Schrittes durch den Garten hin, dem Schlosse zu.
Berchta hatte in der That nicht zu viel versprochen, wenn sie gesagt, daß sie zu ihrer Toilette nicht übermäßig lange Zeit brauche, denn kaum war eine halbe Stunde vergangen, als schon ein Diener in den Garten kam, um den Gast in das Speisezimmer einzuladen.
Der Freiherr war übrigens, wie er stets ging, in der Joppe, Diakonus Kästner aber, nach dem er rasch hinunter in's Städtchen geschickt, um mit ihnen zu speisen, im schwarzen Frack und weißer Halsbinde. Berchta's Blick, als sie den Speisesaal betrat, flog unwillkürlich von einem zum andern der beiden Geistlichen, denn obgleich einem Berufe angehörend, schien es doch kaum möglich, sich zwei verschiedenere Menschen zu denken.
Kästner war wirklich ein schöner Mann, kaum in den Dreißigen, mit offenem und ehrlichem Gesicht und vollem, lockigem Haar. Er trug ein glattrasirtes Kinn, das allerdings einen Ansatz zur Fülle zeigte, und einen starken, sorgfältig gepflegten Backenbart; nur hatte er etwas Zartes, Weichliches in seinen Zügen und eine Angewohnheit, die Unterlippe leicht mit den oberen Zähnen zu fassen, was ihm, besonders /17/ wenn er manchmal die Augen niederschlug, ein fast verlegenes Aussehen gab. Auch die weiße Halsbinde machte ihn vielleicht förmlicher erscheinen, als er wirklich war. Er hatte dabei außerordentlich weiße und zarte, fast frauenhafte Hände und ebensolche Füße, und trug bei festlichen Gelegenheiten, z. B. heute, auch glanzlederne, sehr eng anschließende Stiefel.
Der Missionsprediger war das gerade Gegentheil von ihm. Er ging allerdings auch schwarz gekleidet, aber in einen zugeknöpften Rock mit Stehkragen, aus dem nur ein schmaler Streifen weißer Wäsche hervorsah. Er trug dabei derbe, rindslederne Stiefel, und seine Hände wie auch sein Antlitz waren sonngebräunt und knochig. Kästner's hellbraunes Auge war schwimmend und weich; seine kleinen grauen Augen blitzten lebhaft, oft fast stechend, umher, wenn er Jemanden scharf ansah. Seine hohe, gewölbte Stirn, von spärlichen, schon graugemischten Haaren eingefaßt, fing an, eine Glatze zu bilden, und zeigte deutlich an der linken Seite eine breite, etwas röther gefärbte und lange Narbe. Sein Gesicht war vollkommen glatt rasirt, selbst ohne den geringsten Backenbart, und die buschigen Augenbrauen gaben ihm manchmal, wenn er sinnend vor sich niedersah, etwas Finsteres. Aber im Ganzen schien das seine Natur gar nicht zu sein; er war, wie sich bald im Gespräch zeigte, lebhaft und mittheilend, und nur um seine Lippen zog es sich manchmal wie ein tiefer Schmerz, der aber in seinen übrigen Zügen nie zum Ausdruck kam.
Der Diakonus hatte Johnson schon unten im Städtchen, wenn auch nur flüchtig, begrüßt, und die beiden Männer kannten sich also. Mit innigem Wohlgefallen ruhte aber des Missionspredigers Blick auf der reizenden Gestalt Berchta's, als sie im Saale erschien. Die Amazone von vorhin war verschwunden und an ihrer Statt ein ächt weibliches, züchtig ehrbares Wesen erschienen, das mit wahrhaft bezaubernder Liebenswürdigkeit den Platz der Hausfrau an der Tafel versah und dabei nur Auge für das Wohlbefinden ihrer Gäste zu haben schien.
Anfangs wollte das Gespräch nicht so recht in Fluß kommen; es waren zu heterogene Elemente hier zusammen-/18/gewürfelt, und es mußte erst ein gemeinsamer Anknüpfungspunkt gefunden werden, ehe man sich darüber hinwegsetzen konnte. Aber Johnson selber lieferte ihn durch die Mission, die ihn hierher geführt, durch seine vielen Reisen, die er gemacht, das Wunderbare, Fremdartige, das er dort gesehen, und der Baron begann endlich das, was er hauptsächlich zu wissen wünschte, mit einigen allgemeinen Fragen einzuleiten.
Wo Johnson hauptsächlich seinen Aufenthalt gehabt?
Der Missionsprediger zuckte mit den Achseln. „Mein werther Herr" sagte er, „ich bin in meiner ganzen Lebenszeit wie ein vom Winde umhergewehtes und getragenes Blatt gewesen, - ohne Ruhe, ohne Rast. Von jenem Augenblick an, wo ich meine Studien in einem englischen Missionscollegium beendete, - und das sind jetzt volle dreißig Jahre - bis zu diesem, der einen Lichtblick in meinem Leben bildet," setzte er hinzu, und fast unwillkürlich, ja vielleicht unbewußt, streifte sein Auge Berchta's Gestalt, „war es mir selten, sehr selten vergönnt, von mühevollen Wanderungen und Beschwerden auszuruhen. Bald sah ich mich der heißen Sonne der Tropen, bald dem Eis und den Schneestürmen der kalten Zone ausgesetzt, aber immer nur mit dem einen Ziel vor Augen: die Lehre des Heilands zu verbreiten."
„Und waren Sie vielen Gefahren dabei ausgesetzt?" sagte Berchta theilnahmsvoll, indem ihr Auge unwillkürlich nach der Narbe auf seiner Stirn flog.
„Gott hat seine Hand wunderbar über mir gehalten," erwiderte der Missionär.
„Das muß ein tüchtiger Hieb über den Kopf gewesen sein," bemerkte der alte Freiherr, der dem nämlichen Gedankengang der Tochter folgte, „und ist damals gewiß hart am Leben vorbeigegangen."
„Es war ein blutiger Tag," sagte der Missionär, wie in sich selbst zusammenschaudernd. „Ich erhielt den Schlag von einem Wilden in Neuseeland mit einer Kriegskeule. Aber nicht solche trübe Bilder möchte ich an so freundlichem Tage vor Ihnen heraufbeschwören," brach er kurz ab; „es sind die Schattenseiten unseres Lebens, das aber doch auch wieder viel, viel des Freudigen und Erhebenden dafür bietet." /l9/
Sie haben gewiß so schöne Länder gesehen," sagte Berchta, die kein Thema länger berühren wollte, das dem Gaste selber peinlich schien, „jene wunderherrliche Inselwelt. Oh, welch ein Zauber muß darüber liegen!"
„Allerdings ein Zauber," nickte der Missionär, dessen Züge sich bei diesen Worten wieder aufhellten. „Oh, mein gnädiges Fräulein, wenn es Ihnen je vom Himmel beschieden wäre, jenes wunderbare, herrliche Land zu sehen! Worte sind da nicht im Stande, das auszudrücken, was man empfindet; aber noch weiß ich mich der Zeit zu erinnern, wenn auch viele, viele Jahre seitdem verrannen, wo ich zum ersten Mal jenes Paradies erblickte und keinen andern Ausdruck dafür hatte, als Thränen, Thränen des innigsten Dankes, daß mich Gott vor Tausenden so bevorzugt, seine schönsten und herrlichsten Wunder anzustaunen."
„Und sind jene Länder wirklich so herrlich in ihrer Scenerie, wie wir es so oft in Reisebeschreibungen lesen?" sagte der Freiherr. „Ich habe immer geglaubt, daß die guten Leute, unter dem Eindruck von etwas ganz Fremdem und Ungewohntem, da ein wenig übertreiben oder doch ihren eigenen Gefühlen zu viel Rechnung tragen."
„Ich weiß nicht, sagte der Missionsprediger, „auf welche Reisebeschreibungen Sie sich beziehen, aber ich bezweifle von ganzer Seele, daß irgend eine Feder der Welt im Stande wär das wiederzugeben, was dort Gottes Hand verschwenderisch ausgebreitet. Es ist nicht möglich! Ein Mensch kann die palmengekrönten Küsten, die donnernde Brandung der Riffe, die kühn geschnittenen Bergkuppen, den grünen Wald und den blauen Himmel, die lauschigen Wohnungen, die Fruchthaine und tausend andere Dinge aus das Genaueste und Gewissen- hafteste schildern; aber den Duft, der über dem Ganzen liegt, die blitzenden Farben, das Aroma, von dem die Lüfte durchdrungen sind, vermag er nicht wiederzugeben. Es ist gerade so, als ob ich auf einem Stück Leinwand einen Chimborazo oder Himalaj malen wollte; ich bin vielleicht im Stande, / dem Beschauer einen annähernden Begriff von der riesenhaften Größe jener Bergkolosse zu geben, aber ein richtiges Bild? – nie im Leben.“ /20/
„In der That," nickte der Herr von Schölfe - „und wenn Sie das sagen, der Sie doch ein ruhiger, nicht eben excentrischer Mann scheinen, muß das wirklich etwas Absonderliches sein. Aber wie ist es auf jenen Inseln mit der Jagd?"
Der Missionsprediger lächelte. „Ich muß wirklich gestehen, verehrter Herr," sagte er, „daß ich selber kein Jäger bin und mich also auch nie der Jagd in jenen Bergen zugewendet habe; doch weiß ich bestimmt, daß es auf sehr vielen wilde Rinder, Ziegen und Schweine giebt, die von früheren Seefahrern dort ausgesetzt wurden und dann, was ihre Wildheit betrifft, allerdings nichts zu wünschen übrig lassen. Die Jagd selber ist aber in solchen tropischen Wäldern außerordentlich beschwerlich, und uns Volkslehrern blieb wirklich keine Stunde Zeit, um sie darauf zu verwenden."
„Und was sind die dortigen Indianer für Menschen?" fragte der Freiherr.
„Mein werther Herr," sagte der Missionsprediger, „die Frage ist allerdings so gemein gehalten, daß sie Ihnen kein Mensch direct beantworten könnte. Die Eingeborenen jeder Inselgruppe, von denen es eine große Menge giebt, haben nicht allein andere Sitten und Gebräuche, eine andere Religion, einen andern Charakter, sondern selbst auch nicht selten verschiedene Farbe. Im Ganzen kann man aber doch nur ein günstiges Urtheil über die verschiedenen Stämme fällen, die sich sehr häufig bildungsfähig gezeigt haben und auf manchen Inseln mit Begierde die Religion ergriffen, ja selber mit weiter verbreiten halfen. Auf anderen ist es uns schwerer gemacht worden, und verschiedene Gruppen existiren noch, selbst bis auf die heutige Stunde, wo die Bevölkerung sich hartnäckig weigert, den Segen des Christenthums anzunehmen. Aber wir dürfen nicht nachlassen im guten Werke: Gehet in alle Welt und lehret alle Heiden' Das ist das Motto, das Gott uns auf das Schild geschrieben, und um das schwere und edle Werk zu fördern, mache ich jetzt die Rundreise durch Deutschland. Unsere Missionäre setzen wohl ihre Gesundheit, ja ihr Leben für die gute Sache ein, sie entbehren da draußen Alles, was hier der Mensch zum täglichen Leben fast unent-/21/behrlich hält; aber sie sind arm wie die Jünger Jesu, die damals in die Welt zogen. Wir brauchen Druckschriften und Druckerpressen, ja selbst den Bedarf für das tägliche Brod; wir müssen kleine Fahrzeuge unterhalten, die unsere Missionäre von einer Insel zur andern führen, um unsere Filiale zu revidiren oder neue zu gründen. Wir brauchen Tauschartikel, um dadurch das Nothwendige zum Leben von den Eingeborenen selber zu erhalten, da man auf sehr vielen Inseln nicht einmal den Begriff des Geldes kennt. Und selbst die Reise dorthin macht viele Kosten, nicht allein für die Missionäre selber, sondern auch für ihre Familien. Zu entschieden hat sich da nämlich die Nothwendigkeit herausgestellt, in den Frauen derselben den Frauen der Eingeborenen Lehrerinnen zu geben, die sie auf ein civilisirtes, christliches Leben nicht allein vorbereiten können, sondern ihnen auch durch ihren Wandel als gute und nachahmungswerthe Beispiele vorleuchten. Doch das sind Alles Sachen, verehrter Herr, die ich in meiner morgigen Predigt näher und ausführlicher entwickeln werde;
es würde Sie hier nur ermüden, wollte ich jetzt weitläufig darauf eingehen."
„Und fallen selbst jetzt noch Kämpfe unter den Eingeborenen vor?" fragte Berchta, die mit der gespanntesten Aufmerksamkeit den Worten des fremden Mannes gelauscht hatte.
„Allerdings, mein gnädiges Fräulein," erwiderte der Misssionär, „aber weit weniger in den Distrikten, welche wir unserem Glauben gewonnen haben, als in denen, in welchen noch blinder Aberglaube herrscht. Manche Inselgruppen, z. B. den Archipel von Hawaii, haben wir - ich kann wohl mit Recht sagen, vollkommen civilisirt, und seit Jahren ist dort keine Streitaxt erhoben, kein Schuß abgefeuert worden.
„Welche Wohlthat für die armen Menschen!“ flüsterte Berchta.
„Wohl eine solche - in der That!" nickte der Missionsprediger, „aber kein Mensch weiß auch, was jene wackeren Leute, die sich einer solchen Unternehmung widmeten, auszustehen hatten; ja sie werden noch von vielen Seiten angefeindet und verdächtigt. Wie traurig ist allein ihr häusliches Leben, wenn /22/ sie nicht glücklich genug waren, von daheim ihre eigene Frau, ihre Familie mitzubringen!"
„Aber warum heirathen sie da nicht eine von den Landestöchtern?" sagte der Freiherr. „Es soll ein schöner Menschenschlag sein."
„Das geht nicht," schüttelte der Missionär mit dem Kopf. „Es ist uns auch von dem Collegium selber, wenn auch nicht gerade untersagt, doch angedeutet worden, welche fatale Con- sequenzen das nach anderer Richtung haben könnte; und die Herren waren da in ihrem vollen Recht," setzte er nach kurzer Pause hinzu. „Die Frau des Missionärs soll Mitlehrerin, nicht Schülerin sein, und gerade in dem Nimbus, den wir uns dadurch bewahren, sichern wir uns einen großen Theil unserer Erfolge."
„Dann müssen also die Missionäre, die ohne Frau hinübergehen, unverehelicht bleiben?" sagte der Freiherr.
„Nicht immer," erwiderte der Missionär. „Mit einigem Erfolg haben wir doch bewirkt, daß dann und wann brave und gottesfürchtige Jungfrauen den allerdings kühnen Schritt wagten und hinaus zu einem solchen einsamen Bruder zogen, um seine treue Hausfrau zu werden und seine schweren Pflichten mit ihm zu theilen."
„Ohne ihn zu kennen?" rief Berchta erstaunt.
„Allerdings, ohne ihn zu kennen," erwiderte Johnson; „es erfordert freilich vielen Muth. Fast immer gehören jedoch diese, wenn auch tugendhaften Wesen den unteren Ständen an - Töchter von Handwerkern zum großen Theil, die auch solch ein Loos als eine Art von Versorgung betrachten, und der arme Missionär muß trotzdem noch froh sein, daß er wenigstens eine Landsmännin gefunden hat, die - wenn sie auch nicht auf dem nämlichen Bildungsgrad mit ihm steht - doch in Freud' und Leid bei ihm ausharren will."
„Welch ein eigenthümliches Verhältniß!" sagte Berchta sinnend. „Und ganz allein zogen sie in die Welt hinaus, fern von ihrer Heimath fort, ohne Eltern und Geschwister, nur um dort ihre Hand in die eines vollkommen fremden Mannes zu legen? Es ist kaum denkbar!"
„Und weshalb nicht?" sagte der Missionsprediger freundlich. /23/ „Weshalb sollen Frauen nicht den nämlichen Muth zeigen wie Männer, wenn es gilt, einer Sache zu dienen, die man erst einmal für gut und edel erkannt hat? Und welcher schöne, herrliche Wirkungskreis blüht ihnen nicht da drüben unter den Töchtern des Landes, auf welche der Missionär selber nur durch die Männer des Stammes seinen Einfluß ausüben könnte, und mit denen sie dann direct verkehren und glückliche Familien um sich emporwachsen sehen! Sie, mein gnädiges Fräulein, sind allerdings in anderen Verhältnissen erzogen; Sie ahnen noch gar nicht, welchen Segen ein weibliches Herz über seine Umgebung ausgießen kann, wenn es sich opferfreudig selbst dem Schwersten unterzieht."
„Und wie leben überhaupt die Frauen dort?" sagte der alte Freiherr, den diese wunderlichen Ehestandsverhältnisse nicht besonders interessirten und der gern mehr von den Eingeborenen des Landes hören wollte. Johnson ging auch gern darauf ein, und erzählte jetzt auf so einfache, aber wirklich höchst anziehende Weise von den Eigenthümlichkeiten der dort lebenden verschiedenen Stämme, daß sie ihm Alle gespannt lauschten und das Gespräch erst zum Schlusse allgemein wurde, wo verschiedene Fragen und Bemerkungen herüber und hinüber wechselten.
Diakonus Kästner hatte im Anfang fast gar keinen Antheil der Unterhaltung genommen, sondern nur mit großer Aufmerksamkeit die Erzählung des Missionärs verfolgt und dann und wann durch eine geschickt eingeworfene Frage dessen Erklärungen bald auf diesen, bald auf jenen Punkt gelenkt. Cigarren wurden jetzt herumgereicht, aber der Missionsprediger rauchte nicht, er trank auch fast keinen Wein oder doch nur mit Wasser verdünnt, und schien überhaupt an ein sehr mäßiges Leben gewöhnt - wohl die natürliche Folge eines langen Aufenthalts in wilden Ländern und unter daraus folgenden Entbehrungen aller Art.
Bald nach Tisch empfahl er sich aber, da er noch hinunter in das Städtchen wollte, um mit dem durch Unwohlsein an sein Zimmer gefesselten Geistlichen Manches zu bereden. Die kleine Gesellschaft blieb jedoch im Salon, denn zu viel neue und fremdartige Eindrücke waren ihr geboten worden, um diese /24/ nicht, wo sie noch so frisch in ihrem Gedächtniß lagen, weiter zu verfolgen.
So saßen sie noch beisammen, als drunten im Hof klappernde Hufschläge gehört wurden; der Freiherr drehte den Kopf danach um, und Claus, der mit im Zimmer servirt hatte und jetzt eben damit beschäftigt war, eine frische Flasche Bordeaux auf den Tisch zu stellen, trat zum Fenster, um zu sehen, wer da gekommen wäre. Sein ganzes Gesicht leuchtete aber auf in demselben Augenblick, und schmunzelnd sagte er:
„Der junge Herr Baron! Das ist gescheidt!"
„Der Franz?" rief der alte Freiherr, beide Arme auf den Tisch stemmend.
„Gewiß! auf einem prächtigen Rappen!" rief Claus. „Und wie er geritten sein muß! Schade, daß er nicht ein bischen früher gekommen ist," setzte er dann halblaut und mehr zu sich selber redend hinzu.
„Ei, wo kommt der Wetterjunge her?" rief der alte Baron, erfreut von seinem Stuhl aufspringend; aber es blieb ihm kaum Zeit, zum Fenster zu gehen, als die Thür schon aufgerissen wurde, denn Franz, wie er nur einem der Stallknechte den Zügel zugeworfen, war in wenigen Sätzen die Treppe hinausgeflogen und wurde jetzt mit Jubel von dem Onkel und Berchta empfangen.
Franz war der älteste von seines Bruders Söhnen, eine edle, männliche Gestalt, dabei immer heiter, oft ausgelassen, ja wild, aber seelengut von Herzen und eigentlich der Liebling des alten Barons, der ihn auch als Kind oft Jahre lang in seinem eigenen Hause gehabt und mit erzogen. Franz und Berchta waren deshalb auch - überdies ja schon Geschwisterkinder - wie Bruder und Schwester mitsammen aufgewachsen.
„Junge," rief ihm der Alte entgegen, indem er ihn in die Arme schloß, „Du triffst gerade zur rechten Zeit ein, um zu spät zu kommen. Wir sind eben mit dem Essen fertig."
„Thut nichts, Onkel," lachte Franz, „für mich wird schon noch ein kalter Imbiß da sein. Berchta, mein Schatz, wie geht es Dir? Aber ich brauche nicht zu fragen: frisch und blühend wie eine Rose!" Und seinen Arm um ihre Taille /25/ legend drückte er einen Kuß auf ihre Lippen, die sie ihm willig bot. In dem Augenblick sah er den Diakonus, gegen den er sich aber nur förmlich neigte.
„Also den Braten noch einmal herauf, Claus, aber ein wenig schnell und ein frisches Glas hierher!"
„Hallo, Claus, mein alter Bursche, wie geht's?" rief Franz, ihm die Hand entgegenstreckend.
„Danke unterthänigst, Herr Baron,“ schmunzelte der alte Jäger, „famos geht's, so lange die alten Knochen eben noch aushalten."
„Alte Knochen?" lachte Franz. „Wer weiß, ob Du uns nicht noch Alle zu Grabe trägst!"
„Das verhüte Gott!" sagte der Alte ernst, „ich möchte es Ihnen und mir eben so wenig wünschen!"
„Aber was führt Dich so plötzlich her, Franz?" rief der alte Baron, während Claus das Zimmer verließ, „komm, setz' Dich, Junge, und schenke Dir einmal vor allen Dingen ein. Dort neben Dir steht noch ein reines Glas. Unser Herr Johnson hat getrunken, als ob er Vorsteher irgend eines Mäßigkeitsvereins wäre."
„Was mich herführt?" sagte der junge Mann, der Einladung ohne Weiteres Folge leistend, indem sein Blick aber doch, halb unbewußt, nach dem Diakonus hinüberflog, „reine Familienangelegenheit, Onkel, die wir nachher besprechen. Vorderhand werde ich einmal einen Schluck Wein trinken, denn ich bin durch den Ritt wirklich durstig geworden."
Der Diakonus Kästner hatte den Blick aufgefangen, so flüchtig er gewesen, und die nachherige Andeutung, daß eine Familienangelegenheit zu besprechen wäre, genügte ihm vollkommen. Er wendete sich gegen den Freiherrn und sagte dabei freundlich:
„Sie entschuldigen mich wohl, Herr Baron, wenn ich unserem Herrn Johnson hinunterfolge. Es ist auf morgen noch Manches zu besprechen, wobei meine Gegenwart nothwendig sein könnte."
„Mein lieber Kästner," ries der Baron, „machen Sie keine Umstände. Sie wissen, daß Sie bei mir wie zu Hause sind."
Der Diakonus nahm seinen Hut, sprach noch leise einige /26/ Worte mit Berchta und verließ dann mit ehrfurchtsvollem Gruß das Zimmer, während ihm Baron Franz wohl vornehm höflich dankte, seiner Gestalt aber mit eben nicht freundlichen Blicken folgte.
„Sag' einmal, Onkel," begann er auch, wie jener die Thür hinter sich zugezogen hatte, „Du hast dir wohl ein ganzes Nest von solchen Schwarzröcken eingeladen? Dicht vor dem Schlosse begegnete ich ebenfalls einem ältlichen Herrn, der ganz in das Fach zu schlagen schien."
„Es war ein Missionsprediger, der morgen früh hier predigen will," erwiderte der Freiherr. „Aber was ist das für eine Familienangelegenheit, die Dich hierher geführt? Doch nichts Unangenehmes, wie ich hoffe?"
„Ich denke nicht," lachte Franz von Schöffe, bei der Frage alles Andere vergessend. „Ich bin glücklicher Bräutigam, Berchta!"
„In der That?" rief diese, „und mit wem?"
„Mit Selma von Hohenstein, Euren Nachbarn fast."
„Mit Selma von Hohenstein?" rief Berchta erstaunt aus.
„Nun sage mir um Gottes willen, Franz, wie kommst Du dazu?"
„Das möchte ich auch fragen," schüttelte der Baron mit dem Kopf. „Höre, mein Junge, ich fürchte fast, Ihr Beiden paßt nicht recht zu einander. Du bist ein halber Heide und sie ein tief religiöses, fast schwärmerisches Wesen. Ich begreife auch, aufrichtig gestanden, gar nicht, daß sie Dir nur ihr Jawort gegeben hat."
„Ist es nicht ein prächtiges Mädchen?" lachte Franz.
„Das ist sie," bestätigte der Onkel, „aus guter Familie, dabei reich, hübsch, klug und auch gut von Herzen; ich kenne sie ja von klein auf. Doch in Euren Ansichten geht Ihr weit auseinander."
„Sage mir nur, Franz," bat Berchta, „wie Ihr Euch habt kennen lernen, und daß selbst wir, die nächsten Nachbarn, nichts davon erfuhren."
„Die Sache ist sehr einfach, mein schönes Bäschen. Hohensteins waren doch kürzlich in Berlin, nicht wahr?"
„Allerdings." /27/
„Schön. Dort trafen wir einander, denn bekannt sind wir ja schon als Kinder mitsammen gewesen, und da zufällig einmal das Gespräch auf Religion kam und ich dabei vielleicht einige Ansichten entwickelte, die ihr Besorgniß für mein künftiges Seelenheil einflößten, so ging sie scharf an die Arbeit, um mich zu bekehren."
„Und ist ihr das gelungen?" fragte der Baron trocken.
„Leider nicht," seufzte Franz. „Mit dem regen Interesse für mich aber geweckt, und da sie doch wohl einsehen mochte, daß der kurze Aufenthalt in der Residenz kaum ausreichen würde, um ihr Liebeswerk zu beenden, scheint sie beschlossen zu haben, die Sache radical anzugreifen und mich zu heirathen."
„Du spottest, Franz," sagte Berchta ernst.
„Wahrhaftig nicht, Schatz!" rief ihr Vetter. „Dort erklärten wir uns allerdings noch nicht, aber das liebe Ding wollte mir nicht wieder aus dem Kopf. Gar so herzlich hatte sie zu mir gesprochen, und eine solche Sorge, solche Angst um mich gezeigt, daß ich von der Zeit an gar nichts weiter denken konnte, als nur eben sie, und da der Vater außerdem in mich drängte, mir nun endlich einen Hausstand zu gründen, packte ich gestern auf, reiste in einem Strich nach Hohenstein und habe gestern Abend um ihre Hand angehalten und sie bekommen."
„Alle Wetter! das ging rasch -"
„Heute Morgen litt es mich nun nicht länger, Euch wenigstens hier zu sehen und die frohe Kunde mitzutheilen, und da Selma überdies auf Besuch zu einer Tante mußte und zwei Tage ausbleiben wird, benutzte ich die Zeit und ritt herüber. Voilá tout!"
„Und glaubst Du wirklich, Franz," sagte Berchta bewegt, „daß Ihr Beide zusammen passen werdet?"
„Und warum nicht, Schatz?" lachte der leichtherzige junge Mann. „Entweder sie bekehrt mich, oder ich sie. Wenn wir nur einander lieb haben, das Andere findet sich nachher schon von selber, und ich bin fest überzeugt, glücklich mit ihr zu werden."
„Das gebe Gott!" nickte Berchta.
„Und meinen Segen hast Du auch, Franz," sagte der /28/ alte Freiherr, „wenn ich auch Berchta's Befürchtung halb und halb theile. Aber das ist Deine Sache; Du mußt sehen, wie Du mit ihr fertig wirst. Uebrigens, wenn Deine Verlobte auf Besuch ist, bleibst Du doch wohl kurze Zeit bei uns?"
„Wenn Ihr mich haben wollt, heute und morgen. Uebermorgen früh muß ich aber wieder nach Hohenstein zurück."
„Schön, mein Junge; dann soll Dir Berchta Deine Zimmer gleich in Ordnung bringen lassen," nickte der Onkel; „Du wirst wieder in Deiner alten Stube einquartiert."
3.
Die Missionspredigt.
Der nächste Morgen brach an, und mit ihm kam ein ganz eigenes, reges Leben in das sonst so stille Rothenkirchen, - denn Johnson, der Missionsprediger, war noch am vorigen Tag außerordentlich thätig gewesen und hatte Boten nach allen benachbarten Dörfern ausgeschickt, um seinem Vortrag über jene „Heimath über dem Meer", wie er es nannte, die weiteste Verbreitung zu geben. Er schien auch damit einen ganz außerordentlichen Erfolg zu erzielen, denn wenn sich viele Menschen vielleicht - sobald sie erst genau erfuhren, um was es sich hier handelte - wohl nicht besonders für die Missionen interessirt haben würden, so lockten die große Mehrzahl doch schon die Worte an: „Die Heimath über dem Meere."
Viele von ihnen hatten Söhne oder nahe Verwandte in Amerika, Andere trugen sich selber mit stillen Gedanken einer möglichen Auswanderung, wenn sie es auch noch gegen Niemanden eingestanden hatten. Sie wollten wenigstens einmal hören, wie es da drüben aussehe, und das konnte ihnen natürlich kein Mensch besser sagen, als ein solcher Mann, der /29/ lange selber in jenen Ländern gelebt und dann natürlich die Verhältnisse doch auch genau kannte.
Sie zogen deshalb schaarenweise nach Rothenkirchen hinüber, und die ziemlich geräumige Kirche dort faßte kaum die Zahl der Zuhörer, die sich Kopf an Kopf in dem weiten Raum drängten.
Und dahinein trat Johnson, in seinem schlichten schwarzen Rock, mit der hohen Stirn und den klugen Augen, die ganze Gestalt edel und von dem Gefühl getragen, ein Werk zu fördern, dem er sein ganzes Leben gewidmet, für das er Alles geopfert, was. er sein nannte. Konnte man es ihm gerade da verdenken, wenn er kleine, unbedeutende Opfer von Anderen forderte? Ja, konnte man solche Unterstützung selbst nur ein Opfer nennen?
Als er mit seiner ruhigen, klangvollen Stimme, die den ganzen Raum vollständig ausfüllte, begann, herrschte Todtenstille in dem Gebäude. Er schilderte jene herrliche Welt der Südsee, jene stillen, von Korallenriffen umgürteten, von brandenden Wogen umschäumten Palmenhaine und Fruchtgärten, jenes blaue Meer und die mächtigen, bewaldeten Kuppen der Berge - ein Paradies auf Erden, aber mit der Hölle in ihrem Herzen und der Fluch blinden Heidenthums schwer und verderblich auf dem Paradiese lastend.
Er beschrieb mit grellen, furchtbaren Farben die Menschenopfer, die man hölzernen Götzen schlachtete; er schilderte mit einer Wahrheit, die seine Zuhörer schaudern machte, die Kindes- morde, die von unnatürlichen Müttern verübt wurden, weil das heidnische Gesetz sie dazu zwang. Er sprach von den Tausenden und Tausenden unschuldiger Kinderseelen, die dort selbst jetzt noch in jenen unheilvollen Gebräuchen auferzogen würden,und selbst jetzt noch gerettet werden könnten, wenn eben christliche Prediger ihre Pflicht erfüllten und den Heiden das wahre Wort brächten. Und nun ging er auf die Missionen über, auf den kühnen Muth, mit dem sie in ein fernes, unbekanntes Meer, zwischen wilde, kriegerische, grausame Volksstämme ausgezogen wären, um nach des Heilands Vorschriften seine Lehre zu verkündigen. Mit welchen Gefahren und Entbehrungen sie dort zu kämpfen gehabt, wie sie oft allein, nur unter dem Schutz des Höchsten, dagestanden hätten zwischen /30/ erhobenen Opferbeilen und geschwungenen Keulen; wie Viele dabei auch den fremden Boden, dem sie ja nur den Frieden und das Heil bringen wollten, mit ihrem Blute gedüngt hätten. Ja selbst zu Opfern waren sie selber verwendet und ihre zerstückten Glieder von den Kannibalen gebraten und verzehrt worden. Aber dennoch folgten ihnen Andere; keine Schrecken konnten sie zurückhalten. Muthig gingen sie Allem entgegen, und wie die Wahrheit überall doch zuletzt siegen muß, so ruhten sie auch nicht eher, bis sie selbst auf jenem Boden Wurzel faßten.
Nun ging er zu der Wirksamkeit der Missionäre über, wie sie nach und nach doch einen kleinen Theil der Wilden ihrem Glauben gewonnen und mit deren Hülfe sich weiter auszubreiten suchten; wie sie Kirchen bauten und Schulen errichteten, wie sie den Insulanern nützliche Gewerbe lehrten und die Thaten des Friedens verbreiteten. Aber ihre Kämpfe waren deshalb noch lange nicht vorüber. Feindliche und heidnische Horden, in der wahnsinnigen Meinung, ihre gestürzten Götzen zu rächen, überfielen die jetzt wehrlosen christlichen Stämme, so daß diese in ihrer Verzweiflung, und nur um ihr Leben und das ihrer Familien zu retten, zu den Waffen greifen mußten - aber die Wahrheit siegte dennoch. Der Glaube hatte Wurzeln gefaßt auf den Inseln und konnte nicht wieder ausgerottet werden, und jetzt lag es an Europa, an der alten Welt, die neue in ihren Bemühungen zu unterstützen und da nur hülfreich die Hand zu reichen, wo kühne und fromme Männer schon Leib und Leben gewagt hatten, um ihr schönes Ziel zu erreichen.





























