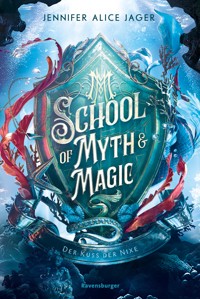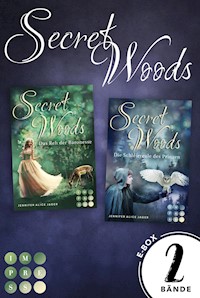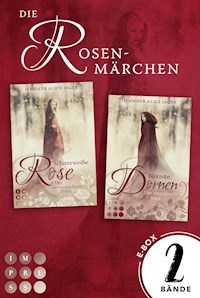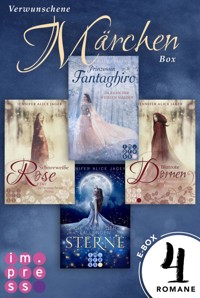4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
**Die verlorenen Splitter des Herzens der Mondkönigin** Niemals trüben Wolken den Blick auf das Firmament des Landes Havendor. Der Mond leuchtet stets rund vom Himmelszelt und die Sterne flüstern sich Geschichten von Magie und Wundern zu. Legenden über den silbernen Thron der alten Könige… Als direkte Nachfahrin eben dieser Könige und rechtmäßige Regentin hat Luna die Erzählungen darüber schon immer geliebt. Doch nie hätte sie für möglich gehalten, dass sie wahr sein könnten. Bis eines Nachts die Sterne vom Himmel fallen und zu Männern werden – den Kriegern der Mondkönigin. Sie suchen nur eines: Luna. Nun muss Luna sich ausgerechnet mit dem Mann verbünden, der ihre Familie gestürzt hat und jetzt selbst Anspruch auf die Regentschaft erhebt: Hayes Hallender, dessen warme Augen eine trügerische Sicherheit versprechen. »Die Nacht der fallenden Sterne« ist eine Adaption des Volksmärchens »Sterntaler« und ein in sich abgeschlossener Einzelband. //Weitere märchenhafte Romane der Bestseller-Autorin Jennifer Alice Jager: -- Sinabell. Zeit der Magie -- Being Beastly. Der Fluch der Schönheit -- Secret Woods 1: Das Reh der Baronesse -- Secret Woods 2: Die Schleiereule des Prinzen -- Prinzessin Fantaghiro. Im Bann der Weißen Wälder -- Schneeweiße Rose. Der verwunschene Prinz (Rosenmärchen 1) -- Blutrote Dornen. Der verzauberte Kuss (Rosenmärchen 2)//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Jennifer Alice Jager
Die Nacht der fallenden Sterne
**Die verlorenen Splitter des Herzens der Mondkönigin** Niemals trüben Wolken den Blick auf das Firmament des Landes Havendor. Der Mond leuchtet stets rund vom Himmelszelt und die Sterne flüstern sich Geschichten von Magie und Wundern zu. Legenden über den silbernen Thron der alten Könige … Als direkte Nachfahrin eben dieser Könige und rechtmäßige Regentin hat Luna die Erzählungen darüber schon immer geliebt. Doch nie hätte sie für möglich gehalten, dass sie wahr sein könnten. Bis eines Nachts die Sterne vom Himmel fallen und zu Männern werden – den Kriegern der Mondkönigin. Sie suchen nur eines: Luna. Nun muss Luna sich ausgerechnet mit dem Mann verbünden, der ihre Familie gestürzt hat und jetzt selbst Anspruch auf die Regentschaft erhebt: Hayes Hallender, dessen warme Augen eine trügerische Sicherheit versprechen.
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Danksagung
Das könnte dir auch gefallen
© privat
Jennifer Alice Jager begann ihre schriftstellerische Laufbahn 2014. Nach ihrem Schulabschluss unterrichtete sie Kunst an Volkshochschulen und gab später Privatunterricht in Japan. Heute ist sie wieder in ihrer Heimat, dem Saarland, und widmet sich dem Schreiben, Zeichnen und ihren Tieren. So findet man nicht selten ihren treuen Husky an ihrer Seite oder einen großen, schwarzen Kater auf ihren Schultern. Ihre Devise ist: mit Worten Bilder malen.
Ich widme dieses Buch den Sternen, die uns des Nachts daran erinnern, dass auch ein kleines Licht gegen die Dunkelheit bestehen kann, solange es nur nicht alleine ist. Und alleine sind wir nie wirklich. Oft fühlen wir uns einsam und verlassen, aber ein Blick in den nächtlichen Himmel genügt, um zu wissen, dass wir zwar klein und unscheinbar, aber von Abermillionen Hoffnungsschimmern umgeben sind.
Prolog
An manchen Tagen muss uns die Sonne daran erinnern, wie sehr wir sie vermisst haben.
An solch einem Morgen geschah es, dass ein junges Dienstmädchen die Terrassentüren zum Kinderzimmer weit offen stehen ließ. Das Wetter war mild, die Vögel zwitscherten und die gerade aufgegangene Sonne warf ihre Strahlen wie flüssiges Gold durch die Fenster des Anwesens.
Das Mädchen hielt es für eine gute Idee, zu lüften, und verließ das Zimmer, ohne zu ahnen, wem sie dadurch Eintritt gewährte.
Man konnte ihr keinen Vorwurf machen, denn niemand hätte damit gerechnet, dass an jenem Morgen die Sonnenkönigin selbst Gestalt annahm und die Welt der Menschen betrat. Begleitet vom Licht, gehüllt in goldene Strahlen, trat sie in das Zimmer. Hätte ein Erwachsener sie gesehen, wäre er vor Ehrfurcht auf die Knie gefallen. Die Königin war all das, was die Menschen als schön ansahen, gebannt in einen lieblichen Körper, der von innen heraus zu strahlen schien. Ihre Züge waren weich, ihre Augen groß und rund wie zwei funkelnde Münzen und ihr Haar ebenso golden wie ihr Gewand. Beides umhüllte sie wie Licht, das auf klarem Wasser glitzerte, sich in sanften Wogen bewegte und geschickt verbarg, was in den Untiefen darunter lauerte.
Die Königin der Sonne und des Lebens trat an die Wiege. Das Kind darin kannte so etwas wie Ehrfurcht nicht. Es kannte noch kaum etwas anderes als das Lächeln seiner Mutter und die starken Arme des Vaters. Es streckte seine kleinen Ärmchen nach der Frau aus, die es neugierig beobachtete. Sie war weder entzückt von diesem kleinen, zerbrechlichen Wesen, noch ließ sein Anblick sie kalt. Dabei hätte sie sich gewünscht, dass Letzteres der Fall gewesen wäre.
»So schutzlos …«, stellte sie fest. »So unschuldig.«
Der Säugling strampelte in seiner Wiege, lachte, als das Licht der Sonnenkönigin in sein Gesicht fiel, und erhaschte ihre Haare, als ihr ein paar Strähnen davon über die Schulter glitten. Er hielt es fest, als wolle er nicht, dass die Sonnenkönigin wieder ginge.
Sie griff nach der kleinen Hand des Kindes und befreite sich davon, ohne dem Kleinen wehtun zu wollen. Dabei war sie sich der Ironie durchaus bewusst. Denn sie würde ihm wehtun. Nur dafür war sie gekommen. Das Kind sah sie traurig an, schrie aber nicht. Sie beugte sich über es und küsste seine Stirn.
»Pass mir gut auf dieses Geschenk auf«, flüsterte sie und richtete sich wieder auf.
Der Kuss auf der Stirn des Kindes blieb an ihm haften, leuchtete, als würde es von einem Sonnenstrahl berührt werden, und versickerte schließlich in seiner Haut, bis nichts mehr daran erinnerte, was an jenem Morgen geschehen war.
Als das Dienstmädchen nach wenigen Minuten zurückkehrte und die Terrassentür schloss, war von der Sonnenkönigin nichts mehr geblieben – nichts bis auf ihr Geschenk, tief verborgen in der Seele eines unschuldigen Kindes. Ein Geschenk, das dazu gedacht war, das Schlimmste in den Menschen zum Vorschein zu bringen.
01.
Das Reich von Nebel umhüllt
Wie jeden Abend stand ich auf meinem Balkon und betrachtete die Sterne am tiefschwarzen Himmel. In ein einfaches Nachthemd gekleidet lehnte ich am Geländer und ließ den Wind an den Strähnen meiner hellbraunen Haare zupfen. Zu selten hatte ich die Gelegenheit, mein Haar offen zu tragen.
In meiner Heimat, auf der Insel Havendor, war jede Nacht wie die vorhergegangene. Nie trübten Wolken den Blick auf das Firmament, der Mond war rund und blass und wenn man die Sterne lange genug beobachtete, hatte man das Gefühl, ihr zaghaftes Flimmern sei eine Sprache – als flüsterten sie sich Geschichten zu, die von Magie und Wundern handelten.
Ich wusste, dass der nächtliche Himmel andernorts nicht so aussah wie hier. Zwar hatte ich meine Heimat noch nie verlassen und die Geschichten von Ländern, fern der kleinen, vom Nebel umschlossenen Insel, waren nichts weiter als Legenden, doch ich glaubte fest daran, dass da noch mehr sein musste. Außerhalb Havendors musste es andere Menschen geben. Andere Überlebende eines Krieges, der schon so lange zurücklag, dass sich kaum noch einer an ihn erinnern konnte. Nur wir Magnaten kannten die alten Geschichten.
Einst hatten unsere Vorfahren einen Pakt mit den Kindern des Lichts geschlossen. Den Dienern der Mondkönigin, ihrem Volk, das auf der anderen Seite der Sterne lebte. Von ihnen erhielten sie Magie und erhoben sich zu Königen.
Doch dann kam der Krieg, die Kinder des Lichts zogen sich in ihr Reich zurück und meine Vorfahren flohen mit den treuesten ihrer Anhänger auf diese Insel. Seit jenen Tagen lebten wir abgeschottet vom Rest der Welt. Die Magie hatte uns schon vor Generationen im Stich gelassen und die Kinder des Lichts waren zu Legenden geworden.
Hinter den Nebeln, so hieß es, zogen des Nachts Wolken über den Himmel. Dort nahm der Mond ab und zu, leuchtete und tauchte die Sterne und die Gesichter der Menschen, die sich ihm zuwandten, in sein silbriges Licht.
In Havendor waren es die Lichter des Palasts von Lymerik, die sich in den trüben Augen der Thrall widerspiegelten – der Nachfahren unserer einst so treuen Diener. Von hier oben, einem der höchsten Balkone des Palasts, sah man das natürlich nicht. Hier wirkten die Gossen sauber und die Häuser beschaulich.
Wie es den Thrall erging, wusste ich nur von meinen Bediensteten. Mir war es verboten, die Stadt zu betreten, und so war das Leben dort für mich ebenso fern und schwer zu greifen wie die vielen Geschichten von anderen Inseln und Ländern, von dem Reich hinter den Sternen, von Magie und Abenteuern.
Ich atmete tief ein und füllte meine Lungen mit der kühlen Abendluft. Wenn ich einmal die Nachfolge meines Vaters antreten, den silbernen Thron besteigen und Vorsitzende des Parlaments der Zwölf Familien werden würde, wollte ich vieles anders machen.
Es war nicht fair, dass nur wir ein Recht auf Wohlstand und Reichtum hatten. Nichts unterschied die Lightgrows, Hallenders und die anderen Familien von jenen, die keine Namen tragen durften. So sah zumindest ich es. Mein Vater und so ziemlich alle Magnaten, die ich kannte, teilten diese Meinung nicht.
Dabei gehörten die Zeiten, in denen die Thrall Ehrfurcht vor uns empfanden und glaubten, wir würden weiterhin Magie beherrschen und mit dem Volk hinter den Sternen im Bunde stehen, lange schon der Vergangenheit an. Das Blut der alten Könige war dünn, die Magie verblasst und die Namen der zwölf Familien würden das einst ebenfalls.
»Manchmal denke ich, du hast so oft schon in den Himmel geschaut, dass du ein Sternbild auf deiner Seele trägst«, meinte Emma, meine Ankleidedame.
Ich lächelte und wandte mich ihr zu. Sie stand im Türrahmen und sah mich freundlich an. Emma war eine große, dünne Frau, mit breitem Mund und immerzu ehrlichen, offenen Augen. Obwohl sie beinahe zehn Jahre älter war als ich und zudem eine Thrall, standen wir beide uns so nah, wie es nur Freundinnen konnten.
»Das sind Sommersprossen«, erklärte ich. »Und ich trage sie nicht auf meiner Seele, sondern im Gesicht.«
»Ist das so? Von all den Magnaten, die ich kenne, bist du die einzige, die überhaupt eine Seele hat, und ebendie spiegelt sich auf deinen Wangen wider.«
»Sprich nicht so«, bat ich mit gesenkter Stimme. »Wenn jemand hört, dass du schlecht von den Zwölf Familien sprichst, bekommst du Ärger.«
»Weil ich eine Thrall bin, ich weiß«, seufzte sie. »Weil ich nicht das Recht habe, über euch zu reden, zu denken oder mir eine Meinung zu bilden. Ich habe nicht einmal das Recht, mit dir so offen zu sprechen, aber du hast es mir erlaubt und deswegen ist es so, wie ich es sage. Du bist die einzige Magnatin mit einer Seele und auch die einzige, die bei so kalten Temperaturen im Hemd und mit nackten Füßen auf den kalten Balkonfliesen stehen würde. Komm jetzt rein, bevor du dich erkältest, Luna.«
Ich kam der Aufforderung nach und betrat mein Schlafzimmer. Es war, wie jeder Raum im Palast der Lightgrows, feudal eingerichtet und so groß, dass dort laut Emma problemlos drei Familien Platz gefunden hätten und dafür noch von den anderen Thrall beneidet werden würden.
Der Boden war mit weißem Seidenteppich ausgelegt, die Decke mit aufwendigem Stuck verziert. An den Wänden flackerten Gaslampen, die geweißelte Vertäfelung war aus edelsten Hölzern und an jedem Möbelstück gab es filigrane Ornamente, die mit Blattgold beschlagen waren.
Von solch hellen und großzügigen Schlafzimmern gab es Dutzende im Palast. Dazu mehrere Salons, Bibliotheken, Festsäle und natürlich den großen Konferenzraum, wo sich regelmäßig das Parlament versammelte und über das Volk entschied. Angeführt von Edwin Lightgrow, der auf dem silbernen Thron der alten Könige saß und sich selbst wie einer benahm. Als einer der letzten Magnaten, in dessen Adern noch das Blut der alten Könige floss, nahm er sich das Recht dazu heraus.
»Was ist mit meiner Mutter?«, fragte ich. »Hatte sie auch kein Herz?«
»Oh, sie war eine ganz liebe Frau«, meinte Emma. »Zumindest erzählt man sich das.«
»Siehst du, dann sind doch nicht alle Magnaten so herzlos, wie du behauptest.«
»Alle, die ich kenne, und da zählt deine Mutter nun mal nicht mit dazu.« Emma zog den Kleiderschrank auf und nahm eines der feinen Tischgewänder vom Bügel. »Das hier ist gut. Du hast es lange nicht mehr getragen und es schmeichelt deiner Figur.«
Sie breitete das blassblaue Gewand auf meinem Himmelbett aus. Das Kleid bestand aus mit Silberfäden durchwebtem Stoff, der leicht wie eine Wolke wirkte. Perlen verzierten den tiefen Ausschnitt und den bestickten Saum. Emma suchte dazu passend Silberschmuck und Schuhe aus.
»Ich hätte sie zu gerne gekannt«, meinte ich nachdenklich und zupfte an dem Stoff. Es machte mir nichts aus, mich jeden Tag dreimal umzuziehen, stundenlang mit meinem Hauslehrer über Allmögliches zu philosophieren, Tanz- und Klavierunterricht zu nehmen und für meinen Vater die brave Tochter zu sein. Wenn es mir nicht so leidtäte, dass anderen verwehrte wurde, was mir vergönnt war, hätte ich mein Leben genießen können. Doch manchmal, da sehnte ich mich nach mehr. Da wollte ich nicht länger die brave Tochter sein und mehr spüren als nur den Wind in meinen Haaren, wenn ich auf dem Balkon stand. Ich wollte frei sein, die Welt außerhalb des Palastes erkunden und Abenteuer erleben. Nur leider war mir das nicht vergönnt. Genauso wenig, wie es mir vergönnt gewesen war, meine Mutter kennenzulernen.
Mein Vater achtete sehr darauf, mich nicht in Gefahr zu bringen. Schließlich floss auch in meinen Adern das Blut der alten Könige und damit sicherte ich unserer Familie den Herrscherthron. Es kam nicht infrage, dass ich den Palast verließ, mich mit niederen Thrall abgab oder auch nur einen Happen aß, ohne dass mein Essen vorgekostet worden war.
Die Lightgrows hatten viele Feinde. Sie lauerten überall und waren einst meiner Mutter zum Verhängnis geworden.
»Sie war sehr zurückhaltend und schüchtern. So erzählt man sich. Eine zarte Blume, die viel zu schnell verblüht ist. Kein Wunder, wo sie doch in Edwin Lightgrows Schatten wachsen musste.«
»Jetzt sprichst du schon wieder schlecht von meinem Vater. Du solltest wirklich mehr auf dich achtgeben. Ich will nicht, dass dir etwas geschieht.«
Emma zuckte unbedarft mit den Schultern. In letzter Zeit war sie immer unvorsichtiger geworden. Ich konnte ja verstehen, dass sie frustriert und sorgengeplagt war. Ihr Bruder litt an einer hartnäckigen Lungenentzündung und ihr fehlte das Geld, ihn behandeln zu lassen. Doch so zu sprechen, hätte Emma ihre Anstellung, ihre Zunge oder gar ihr Leben kosten können. Was würde dann aus ihrem Bruder werden?
»Mach dir darüber keine Gedanken«, bat Emma. »Mir geschieht schon nichts.«
»Was ist mit unserem Plan?«, fragte ich. »Ich bleibe dabei, dass wir es versuchen sollten. Ich gehe in die Gärten, werfe ein paar Schmuckstücke über die Mauer und du sammelst sie auf der anderen Seite ein. Niemand wird uns dabei beobachten, wenn wir es während der Wachablösung machen, und du kannst den Schmuck verkaufen oder gleich gegen Medizin eintauschen.«
»Bin ich es jetzt, die dich ermahnen muss, vorsichtiger zu sein?«, fragte Emma. »Das ist viel zu riskant. Glaube mir.«
»Nimm den«, schlug ich vor und wollte mir meine Kette vom Hals lösen. »Es ist ein ungeschliffener Mondstein. Niemand wird Verdacht schöpfen, wenn du damit den Palast verlässt.«
Emma legte ihre Hände auf den Anhänger und schüttelte den Kopf.
»Das kann ich nicht annehmen«, lehnte sie ab. »Du hast ihn noch nie abgelegt. Ich weiß, wie wichtig er dir ist.«
»Nicht so wichtig, wie du mir bist«, widersprach ich.
Ich trug den Stein, weil mein Vater ihn mir geschenkt hatte und weil er mir sonst nie etwas schenkte. Bei dem Reichtum meiner Familie hatte ich alles, was ich brauchte, und bekam, wonach mir der Sinn stand, aber das alles war für mich ohne Bedeutung. Mir war egal, wie wertvoll meine Kleider waren oder wie kostbar mein Schmuck. Dieser einfache, glanzlose Stein um meinen Hals, der mich mein Leben lang begleitet hatte, war mehr wert als alle Schätze Havendors. Er war der Beweis dafür, dass mein Vater mich liebte. Immer wenn ich Zweifel daran bekam, erinnerte er mich daran.
Bestimmt hatte Emma recht. Meinem Vater würde schnell auffallen, dass der Stein verschwunden war, und das konnte für uns beide gefährlich werden.
»Ach Luna«, seufzte Emma. »Wenn du doch keine Lightgrow wärst, dann könnten wir richtige Freundinnen sein.«
»Für mich bist du die einzige Freundin, die ich je hatte«, meinte ich.
Emma lächelte mich trübe an. Sicher hatte sie viele Freundinnen und ich war für sie nichts weiter als ihre Brotgeberin. Das sprach Emma aber nicht offen aus, obwohl sie sich sonst selten zurückhielt. Wahrscheinlich war es auch besser so, denn ich wollte die Wahrheit gar nicht erfahren.
Wenn man nur eine Freundin hat, nur eine Person, der man alles anvertrauen kann, lebt man lieber mit einer Lüge, als ohne diesen Menschen.
»Zieh dich jetzt an, sonst kommst du zu spät zum Lichterfest und wir bekommen tatsächlich noch Ärger«, erinnerte Emma mich.
Ich nahm das Kleid und verschwand hinter dem Paravent.
»Die Hallenders sollen heute geladen sein«, rief Emma mir zu.
Ich warf mein Hemd über den Sichtschutz und schlüpfte in ein Unterkleid.
»Das kann ich mir nicht vorstellen«, lachte ich. »Vater hasst die Hallenders. Wie lange war Macaulay schon nicht mehr im Palast? Fünf Jahre?«
»Mindestens. Es ist aber auch kein Wunder. Es gibt Gerüchte, dass sie Magie beherrschen, aber so tun, als hätten sie ihre Kräfte genauso verloren wie die anderen Familien. Sie warten nur auf den richtigen Moment, heißt es. Sie sind immerhin beinahe so mächtig wie ihr Lightgrows. Keine der Zwölf Familien hat so viel Einfluss. Ein Grund mehr, dass dein Vater sich mit ihnen gut stellen will.«
»Das sollte er vielleicht, aber das wird er nicht. Lieber weiß er sie als offene Feinde, als sich mit Macaulay Hallender zu verbrüdern und nie zu wissen, wann er ihm in den Rücken fällt. Du weißt, dass die Hallenders für ihre Giftmischungen bekannt sind? Mit Magie hat das nichts zu tun.«
Ich zwängte mich in das enge Kleid und zupfte es an den Ärmeln zurecht. Luft würde ich keine mehr bekommen, wenn die Haken erst einmal geschlossen waren, aber dazu waren die wenigsten meiner Kleider gedacht.
»Dann solltest du heute Abend wohl besser fasten«, schlug Emma vor.
Ich trat hinter dem Paravent hervor und drehte Emma den Rücken zu, damit sie mir die Haken schließen konnte.
»In dem Kleid kann ich ohnehin nichts essen«, sagte ich und zog den Bauch ein.
»Noch etwas, das ich an euch Magnaten nicht verstehen kann«, sagte Emma durch zusammengebissene Zähne. Sie zerrte mit aller Kraft am Stoff, sodass mir endgültig die Luft wegblieb. »Ihr habt alles im Überfluss, spart aber am Stoff eurer Kleider und näht sie so eng, dass ihr weder atmen noch etwas von den Speisen zu euch nehmen könnt, die jeden Abend im Überfluss aufgetischt werden.«
»Das Gute ist …«, begann ich und schnappte nach Luft. »So bleibt mehr für die Angestellten übrig.«
Emma lachte hohl. »Ja, wir essen gerne eure Reste«, höhnte sie. »Fertig. Bekommst du noch Luft?«
Ich wandte mich ihr zu. »So habe ich das nicht gemeint«, beteuerte ich.
»Ich weiß«, beschwichtigte Emma und lächelte milde. »Und jetzt beeil dich, bevor dein Vater dich holen lässt.«
Ich nickte und verließ mein Zimmer.
Zu so später Stunde waren in den Korridoren alle Lichter entzündet. Wenn Edwin Lightgrow eines genoss, dann war es, den Namen seiner Familie zu rühmen, indem er den Palast jeden Abend in Tausende Lichter hüllte. Es war beinahe so, als wolle er damit den Sternen Konkurrenz machen. Aber an diesem Abend hatte das noch einen ganz anderen, bitteren Beigeschmack. Denn das Lichterfest gehörte den Wünschen und Träumen der ärmeren Menschen und sollte nicht mit dem Glanz des Palastes konkurrieren müssen.
Ich lief in den dritten Stock und überall wo ich vorbeikam, nickten die Angestellten meines Vaters mir freundlich zu. Schon von Weitem war die seichte Musik zu hören, die die abendliche Feier begleitete. Kurz darauf sah ich schon die hohe Flügeltür zum Festsaal vor mir. Die Wachmänner daneben verbeugten sich und öffneten mir den Durchgang.
Ich zog sofort alle Blicke auf mich, als ich den Raum betrat und durch die Reihen der Gäste lief. Es gab selten Tage, an denen ich abends nur mit meinem Vater an der großen Tafel im Speisesaal saß und zu Abend aß. Immer waren Vertreter der anderen Familien zu Gast, immer gab es etwas zu feiern. Da waren die Dashwoods, die sich nur zu gerne im Palast aufhielten, unter ihnen auch Sir Henry Dashwood und seine junge Frau, denen ich im Vorbeigehen zunickte. Dann waren da natürlich die Winters, die sich darin verstanden, ihren Reichtum zu hüten. Lady Amanda Winter, die mich freundlich grüßte, wohnte schon beinahe im Palast. Ihr Sohn hob sein Weinglas, als er mich sah, und ich erwiderte seine Begrüßung mit einem Lächeln. Wir waren ungefähr im selben Alter und ich ahnte, dass seine Mutter uns gerne als Paar gesehen hätte. Also hütete ich mich davor, die beiden anzusprechen.
»Marshall Babingston«, stellte sich mir ein junger Mann ohne Umschweife vor und verstellte mir den Weg. Ich kannte ihn nicht. Wahrscheinlich ein Provinzler, der irgendwo nahe der Küste wohnte und nur selten, wenn überhaupt schon einmal, in der Hauptstadt Havendors zu Gast war.
»Es freut mich«, sagte ich und ließ ihn stehen.
Es war der heutige Abend. Das Lichterfest. Es lockte sie alle aus ihren Verstecken, damit sie einen Blick auf die junge Lightgrow werfen konnten, die einmal die mächtigste Frau Havendors werden würde und seit wenigen Tagen alt genug war, einem Mann versprochen zu werden. Sie ahnten ja nicht, dass mein Vater mich mehr hütete als seine wertvollsten Schätze und um nichts in der Welt hergeben wollte.
Ich entdeckte ihn in einer Ecke. Er unterhielt sich mit niemand Geringerem als Macaulay Hallender. Ich war zu neugierig zu erfahren, wie es dazu gekommen war, ihm und seinen Begleitern den Zugang zum Palast zu gewähren. Nicht grundlos waren die Hallenders keine willkommenen Gäste. Auch an einem solchen Abend nicht.
»Und da ist sie auch schon«, sagte mein Vater und deutete auf mich.
Er lächelte, was aber nicht darüber hinwegtäuschte, dass seine Augen mich böse anfunkelten. Ich war spät dran und das ließ er mich jetzt spüren.
»Vater«, sagte ich und nickte ihm zu. Auch ich lächelte und auch bei mir war diese Geste lediglich eine Maske.
Ich wandte mich an Macaulay.
»Luna Lightgrow«, sprach er das Offensichtliche aus und betrachtete mich wohlwollend. Er nahm ungefragt meine Hand und deutete einen Kuss an.
Macaulay war nicht irgendein Hallender. Er war das Oberhaupt seiner Familie. Ein großer Mann von kräftiger Statur. Kleine dunkle Augen wanderten über meinen Körper, wie der hektische Blick eines Vogels. Seine Mundwinkel zuckten und ich kam nicht umhin zu bemerken, wie ihm seine Zungenspitze über die Lippen fuhr. Mir lief ein Schauer über den Rücken. Dieser Mann ekelte mich an.
Mit vierundvierzig Jahren war er jung für einen Mann in seiner Position. Erreicht hatte er sie nicht durch sein Blut, wie es bei meinem Vater der Fall war. Unter den Hallenders war es üblich, sich durch List und Intrige einen Namen zu machen. Ich wollte gar nicht wissen, wer alles den Tod gefunden hatte, um Macaulay den Weg zu ebnen.
»Es freut mich«, sagte ich und entzog ihm meine Hand.
»Sie haben nicht untertrieben, Edwin«, stellte Macaulay fest. Noch immer starrte er mich an. Seine Augen machten mich nervös. Sie bewegten sich unablässig, als wäre er nicht fähig, etwas länger als eine Sekunde zu fokussieren. »Sie ist zu einer wahren Schönheit geworden. Das Zepter wird ihr gut zu Gesicht stehen.«
»Und erst der Thron«, ergänzte mein Vater, um zu verdeutlichen, dass ich nicht die Frau seines Nachfolgers werden sollte, sondern selbst den Thron besteigen würde.
Macaulays Schmunzeln erstarrte und das erste Mal, seit ich ihm gegenüberstand, bewegten sich auch seine Augen nicht mehr.
»Natürlich«, stimmte er zu.
»Dann wollen wir uns mal nach draußen begeben, nicht wahr?« Mein Vater deutete auf die Türen zur Terrasse.
Macaulay folgte seiner Aufforderung und ich wartete ab, bis er außer Hörweite war.
»Was tun die Hallenders hier?«, fragte ich mit gesenkter Stimme.
Mein Vater sah mich nicht an, als er antwortete. »Sag mir lieber, was dich so lange aufgehalten hat.«
»Sie sind unsere Feinde«, beharrte ich.
»Und gerade deswegen muss ich wissen, was Macaulay im Schilde führt.«
»Und da lässt du ihn einfach hier einmarschieren?«
Edwin sah mich mit hochgezogenen Brauen an. Das Lächeln auf seinen Lippen war so falsch wie die Freundlichkeit, die er seinen Gästen entgegenbrachte. »Sie haben sich quasi selbst eingeladen. Es ist Lichterfest. Ich kann keiner Familie verwehren, daran teilzunehmen. Ganz Havendor feiert den heutigen Abend. Aber keine Sorge, sie werden keine Sekunde aus den Augen gelassen. Zudem kam Macaulay, wie er sagte, mit einer Angelegenheit zu mir, die für unsere beiden Familien von Vorteil sein würde.«
»Wie du meinst«, sagte ich und betrachtete Macaulay und seine Leute eingängig. An Selbstsicherheit fehlte es ihnen jedenfalls nicht. Sie waren bald von einer Menschentraube umringt und standen auf der Terrasse, als gehörte der Palast ihnen. Dass an allen Eingängen zum Festsaal Wachen postiert waren, beruhigte mich. Mein Vater hatte alle Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, um keine bösen Überraschungen zu erleben. Da war ich mir sicher.
Auch ich trat ins Freie. Die Terrasse war groß genug, um der ganzen Gesellschaft zu erlauben, dem Schauspiel des heutigen Abends beizuwohnen. Nur die Wachposten waren im Saal zurückgeblieben.
Auf dem Platz vor dem Palast hatte sich bereits das Volk versammelt.
Es war still. Niemand sagte etwas. Niemand bis auf Macaulay und seine Männer, die sich mit gesenkten Stimmen unterhielten. Von Ehrfurcht und Anstand hatten sie wohl noch nichts gehört.
Mein Vater trat an das Geländer und ließ seinen Blick über die Menge schweifen.
Er begann eine Rede über Hoffnungen und Träume. Es waren jedes Jahr dieselben leeren Worte. Denn das, wovon er sprach, hatten die wenigsten Menschen noch inne. Dennoch glaubten sie an die Magie der Sterne und die Gnade der Mondkönigin. Sie kamen jedes Jahr aufs Neue auf diesen Platz und beteten dafür, dass ihre Wünsche in Erfüllung gingen.
Ein Diener reichte meinem Vater eine Laterne. Sie war lila, wie die Farbe unserer Familie. In goldener Schrift prangten darauf die Worte »Gesegnet sei die Königin des Mondes, geküsst vom Glanz der Sterne, beschützt von den Kindern des Lichts«. Er entzündete sie und entließ das zarte Gebilde aus Papier und Draht in die Lüfte.
Kurze Zeit später flammten auch die ersten Lichter auf dem Platz unter uns auf. Nach und nach stiegen die Laternen in den Himmel und gesellten sich zu dem Wunsch meines Vaters, von dem er behauptet hatte, er wäre zum Wohle Havendors. Dass niemand seinen Wunsch laut aussprechen durfte, kam ihm gerade gelegen, denn sicher hatte er sich mehr Reichtum und Wohlstand für die Familie Lightgrow gewünscht und nicht etwa etwas, das den Thrall zugutegekommen wäre.
Ich trat an das Geländer und während die Gesellschaft sich nach und nach zurückzog und sich am Buffet bediente, beobachtete ich weiter die flackernden Lichter auf ihrem Flug ins Reich der Sterne, Wunder und Magie.
»Wunderschön, nicht wahr?«
Ich wusste, dass es Leland Lightgrow war, der mich angesprochen hatte. Ein Berater meines Vaters und der jüngste unter ihnen.
Er kam näher und legte mir etwas über die Schultern. Ich erkannte, dass es seine Jacke war, und wandte mich ihm zu.
»Sie wirkten, als wäre Ihnen kalt«, erklärte er.
»Ja, das ist es«, sagte ich und sah wieder nach vorne.
»Kalt oder schön?«, fragte er und gesellte sich neben mich. Auch er sah zu den Sternen auf. Er war ein großer, schlanker Mann, mit schmalem Gesicht und freundlichem Blick. Sein sonnengelbes Haar hing ihm in Strähnen vor den haselnussfarbenen Augen. Er war ein Lightgrow, aber unsere Stammbäume wiesen in fünf Generationen keine Übereinstimmungen auf. Genug, dass mein Vater in Erwägung zog, uns zu verheiraten, sollten die Avancen aus anderen Familien zu aufdringlich werden. Noch war nichts davon ausgesprochen und ich wollte auch nicht darüber nachdenken. Liebe, Hochzeit, eine Familie gründen. Das kam mir alles noch viel zu unwirklich vor, um weitere Gedanken daran zu verschwenden.
»Wunderschön«, antwortete ich und sah ihn lange an. »Kalt ist mir nicht. Aber danke.«
Ich gab ihm seine Jacke zurück und ging wieder rein.
***
Es war spät am Abend, als ich mich endlich entschuldigen konnte. In meinem Zimmer angekommen, wartete Emma bereits auf mich.
»Und?«, fragte sie neckisch. »Hast du die Hallenders überlebt?«
Ich verdrehte die Augen.
»Gerade so«, sagte ich. »Aber meinem Vater steht das Schlimmste noch bevor. Angeblich will Macaulay ihm ein Angebot unterbreiten.«
Emma lachte. »Da sind wir aber alle gespannt. Komm her, ich helfe dir aus dem Kleid.«
Ich drehte ihr den Rücken zu und sie löste den ersten Haken. Für sie war es ein Scherz, aber mich beschäftigte dieser Gedanke wirklich. Warum war Macaulay hier? Es musste einen triftigen Grund geben.
Ein plötzlicher Knall ließ uns beide aufschrecken.
»Was war das?«, fragte ich. Mein Herz pochte mit einem Mal wie wild. Es hatte sich angehört, als wäre etwas Großes in tausend Splitter zersprungen.
»Ich weiß nicht«, sagte Emma und schaute zur Tür.
Weitere Explosionen drangen zu uns vor, gefolgt von Schreien.
»Schüsse«, sagte Emma.
»Niemals«, wehrte ich ab. Hörten sich so Schüsse an? Waren sie wirklich derart laut? Ich konnte es mir nicht vorstellen. Bisher hatten die Wachen des Palastes noch nie auf jemanden feuern müssen. Ihre Übermacht alleine reichte aus, um jeden abzuschrecken.
»Ganz sicher«, bestätigte Emma, was ich nicht wahrhaben wollte. »Versteck dich.«
»Aber …«
»Keine Widerrede«, verlangte sie und schob mich zum Paravent.
Kaum dass ich dahinter verschwunden war, trat jemand die Tür ein. Es krachte so laut, dass ich beinahe aufgeschrien hätte. Ich schlug mir die Hände vor den Mund und versuchte ruhig zu atmen.
»Hier ist niemand«, hörte ich Emma sagen.
»Davon will ich mich selbst überzeugen«, entgegnete eine Männerstimme.
Mein Herz wollte sich einfach nicht beruhigen. Ich hielt die Luft an, doch das würde mich nicht retten. Nun, da die Tür offen stand, drangen die Todesschreie der Palastbewohner ungehindert zu mir vor. Immer wieder fielen Schüsse. Das Krachen von Türen war zu hören, gefolgt von dem Gebrüll der Männer, die den Palast stürmten.
»Tut das nicht!«, schrie Emma.
Der Paravent wurde mit einem Ruck zur Seite gestoßen, knallte gegen die Wand und zerbrach dort in seine Einzelteile.
Ich blickte auf und sah in die Mündung eines Gewehrs. Den Mann dahinter konnte ich in meiner Panik gar nicht erst erkennen.
Ohne über das, was ich tat, nachzudenken, rannte ich los. Ich stürzte auf die Tür zu, doch der Mann packte mich an der Hüfte und schleuderte mich auf mein Bett.
Ich hörte mich selbst schreien. Alle anderen Geräusche um mich herum verschwanden hinter dem Rauschen in meinen Ohren.
Ich versuchte über das Bett zu kriechen, doch der Fremde packte meine Beine und zog mich zu sich. Ich schlug nach ihm, hörte, wie Emma etwas schrie, und sah, dass sie hinter dem Mann etwas Großes erhoben hielt.
»Fallen lassen!«, verlangte er und warf Emma einen mahnenden Blick zu.
Ich begriff erst nicht, warum Emma ihm gehorchte, bis mir bewusst wurde, dass sich etwas Kaltes gegen meine Kehle drückte. Eine Klinge.
Emma stellte den Stuhl vorsichtig wieder ab.
»Tut ihr nichts«, bat sie.
»Zu dir komme ich noch«, sagte der Fremde und wandte sich wieder mir zu.
Mein Atem ging schnell, mein Herz drohte mir aus der Brust zu springen, doch es gelang mir trotz meiner Angst, dem Fremden direkt in die Augen zu blicken.
Er sah gar nicht so bedrohlich aus, wie ich gedacht hatte. Ich hatte mir ein Monster vorgestellt. Einen verschwitzten, übel riechenden, stoppelbärtigen Kerl mit gelben Zähnen und vernarbter Haut.
Der junge Mann aber, kaum älter als ich selbst, hatte weiche Züge und warme Augen in der Farbe des aufgewühlten Meeres. Wäre er heute Abend zu Gast gewesen, hätte er die Blicke aller unverheirateten Magnatinnen auf sich gezogen. Er sah ausgesprochen gut aus und schien auch nicht unter den Folgen von Inzest zu leiden, wie es unter den Zwölf Familien immer häufiger vorkam. Sein dichtes, dunkles Haar trug er kurz, in einem militärischen Schnitt, und in seinem Blick lag Entschlossenheit. Doch das täuschte beides nicht darüber hinweg, dass er nicht wirkte wie einer, der Gefallen an dem fand, was er vorhatte zu tun.
Das Messer drückte sich fester gegen meine Kehle.
Ich wusste, dass es egal war, wie ungerne er das tat. Er trug die schwarz-grüne Uniform eines Hallenders und ich war die einzige Erbin meiner Familie. Er hatte keine andere Wahl, als seinen Auftrag zu erfüllen und mich zu töten. War das der wahre Grund für Macaulays Besuch? Wenn der Fremde zu Ende gebracht hatte, wofür er gekommen war, würde ich es wohl nie erfahren.
Ich wollte nicht sterben, aber irgendwie hatte ich doch immer geahnt, dass es auf diese oder eine ähnliche Weise geschehen würde. Nun war der Tag gekommen.
Ich atmete durch und dachte seltsamerweise nur daran, dass ich lieber in einem einfachen Gewand mit offenem Haar unter dem Glanz der Sterne gestorben wäre, als eingeengt in dieses Kleid, in dem ich nicht noch einmal tief einatmen konnte. Wäre er doch nur wenige Minuten später gekommen, dann wäre ich von dieser Enge um meine Brust befreit gewesen.
Die Luft blieb mir im Halse stecken. Ich fühlte mich gefangen und eingezwängt – so sehr, dass ich beinahe darauf hoffte, er würde es schnell beenden, damit ich endlich frei sein konnte.
Tränen sammelten sich in meinen Augenwinkeln, doch schluchzen, jammern und flehen wollte ich nicht. Ich würde nicht um Gnade winseln.
So vergingen Sekunden, doch nichts geschah. Er zog mir die Klinge nicht über die Kehle, sah mich nur unverwandt an und bald gelang es ihm nicht mehr, mir in die Augen zu blicken.
»Verdammt«, fluchte er unverhofft und richtete sich auf.
Ich wagte es nicht, mich zu bewegen. Emma hingegen hatte sich schnell aus ihrer Erstarrung gelöst, packte meine Hand und zog mich von dem Fremden weg.
Der junge Hallender trat vor uns zurück. Er schien wütend, aber nicht auf uns, sondern auf sich selbst.
»Verschwindet!«, knurrte er uns an. »Haut ab. So weit weg wie möglich und denkt nicht daran zurückzukehren. Die Hallenders haben jetzt das Sagen und eine wie du wird keine Sekunde am Leben bleiben.« Er deutete mit dem Messer auf mich.
Emma zog mich fester an sich heran. Von den Korridoren her waren noch immer Kampfgeschrei und Schüsse zu hören. Selbst wenn er uns gehen ließ, hieß das noch lange nicht, dass wir heil aus diesem riesigen Gebäude kämen.
»Komm mit«, sagte Emma und zog mich zu einer der Wandvertäfelungen. Natürlich! Die Dienstbotengänge. Sie schlängelten sich durch die Wände des ganzen Palastes. Daran hatte ich nicht gedacht.
Emma öffnete die versteckte Tür, indem sie einen Knopf betätigte, der sich unter einem Querbalken verbarg. Sie verschwand in der Dunkelheit und zog mich mit sich.
Ich warf noch einen letzten Blick auf den Fremden. Er lief unruhig auf und ab, riss den Kopf hoch, als er bemerkte, dass ich ihn beobachtete, und sah mich finster an.
»Muss ich noch deutlicher werden?«, zischte er.
Emma zog mich von der Tür weg und schloss sie.
»Keinen Mucks«, flüsterte sie. Es war stockfinster, sodass ich nicht sehen konnte, wo wir uns befanden. »Wir wissen nicht, ob sie nicht schon zwischen den Wänden sind und uns hören können.«
02.
Die Nacht von Schüssen erfüllt
Wir kauerten in einer Ecke und lauschten den Schritten auf der anderen Seite der Wand. Emma hatte mir die Hand auf den Mund gelegt und den Zeigefinger auf den ihren.
Die Schritte kamen näher, Schatten zogen über die Lichtstreifen, die durch die Wandvertäfelung fielen, und verschwanden wieder.
»Weiter!«, flüsterte Emma und zog mich auf die Beine.
Wir huschten auf Zehenspitzen durch die schmalen Dienstbotengänge. Immer wieder hielten wir inne, wenn im Korridor etwas zu hören war. Schreie und Schüsse drangen zu uns vor, der Geruch nach Schießpulver und Blut füllte die schmalen Gänge.
Ich kannte die Menschen, die dort draußen starben. Sie waren vielleicht nicht meine Freunde, aber doch Bekannte, meine Familie, meine treuen Angestellten und womöglich auch mein Vater, den ich trotz allem liebte.
Meine Kehle schnürte sich mir bei diesem Gedanken zu. Alles war so unwirklich, wirkte so falsch und unberechenbar auf mich.
Die Hallenders lehnten sich gegen die Lightgrows auf. Wie glaubten sie, das vor den anderen Familien rechtfertigen zu können? Und was würden die übrigen Lightgrows tun, die in Residenzen außerhalb von Lymerik lebten? War das der Beginn eines Krieges, der ganz Havendor überschatten würde?
»Hier entlang«, zischte Emma und deutete auf eine Leiter. Wir stiegen ein Stockwerk tiefer und wollten unseren Weg gerade fortsetzen, als wieder Geräusche zu hören waren. Diesmal aber drangen sie nicht von der anderen Seite der Wand zu uns vor. Sie kamen aus dem Gang direkt vor uns.
Ich warf Emma einen unsicheren Blick zu.
»Zurück«, sagte sie und deutete auf die Leiter.
Ich griff nach der ersten Sprosse, als ein Licht um die Ecke fiel. Es war zu spät, um zu fliehen.
Eine schemenhafte Gestalt bog in den Gang. Eine Frau in langem Rock. Sie trug eine Laterne bei sich, die durch ihren weißlichen Schein ihr Gesicht geisterhaft wirken ließ.
»Emma?«, fragte sie mit leiser Stimme.
Ich fühlte die Anspannung von mir abfallen. Bis zu diesem Moment hatte ich mit dem Schlimmsten gerechnet.
»Mara? Bist du das?«, flüsterte Emma.
Mara kam eilig näher, zog Emma an sich heran und drückte sie fest.
»Ich war gerade dabei, zum Ostflügel zu gehen, um die Stube für den Tee vorzubereiten, als die ersten Schüsse fielen«, erklärte Mara hastig. »Wie konntet ihr entkommen?«
Sie warf mir einen kurzen Blick zu. Keine Freundlichkeit lag darin. Eher Missgunst. Es wunderte mich nicht, dass eine Thrall es mir übel nahm, diesem Angriff zu entfliehen, während andere für meine Familie starben.
»Wir hatten Glück«, sagte Emma knapp. »Wie viele haben es in die Gänge zwischen den Wänden geschafft?«
Mara schüttelte den Kopf. »Bisher bin ich noch niemandem begegnet.«
»Wir müssen schnell hier raus«, meinte Emma. »Ich schlage vor, wir versuchen bis zur Küche zu kommen. Von dort ist es nur ein kurzer Weg durch den offenen Raum bis zum Hinterausgang.«
»Falls der nicht bewacht ist«, sagte Mara. »Die Hallenders zeigen keine Gnade. Bei niemandem.«
Wie viel Glück wir tatsächlich gehabt hatten, wurde mir erst bei diesen Worten bewusst. Ausgerechnet mich hatte der junge Hallender verschont. Dabei gehörten doch die wenigsten Bewohner des Palastes meiner Familie an. Was war mit den Mitgliedern der anderen Familien? Den Vertretern der Redvers, Giffards und Thynsleys. Waren die Hallenders wirklich bereit all diese Familien gegen sich aufzubringen?
»Wir müssen es versuchen«, sagte Emma und lief voraus.
Mara warf mir einen abschätzigen Blick zu, dann folgte sie ihr.
Die beiden Dienstmädchen liefen gerade an einer Tür vorbei, als dahinter Stimmen zu hören waren.
»Psssst!«, hörte ich jemanden zischen. Auf der anderen Seite der Wand wurde es still. »Habt ihr das gesehen?«
Das Licht der Laterne musste durch die Ritzen gefallen sein. Schritte näherten sich und ich wagte es nicht, weiterzugehen. Ich sah fragend zu den anderen beiden. Plötzlich warf sich jemand so kraftvoll gegen die Tür, dass Staub von der Decke und den Wänden rieselte. Ich unterdrückte einen Aufschrei und stolperte einen Schritt zurück.
Emma fuchtelte wild mit den Armen in der Luft. Sie versuchte mir zu gestikulieren, schnell weiterzulaufen.
Wieder rammte jemand die Tür. Das Holz krachte und ich rannte los. Ein weiterer Schlag ließ die Bretter brechen. Geborstenes Holz schoss auf mich zu, traf mich an den Beinen und der Schulter. Ich schrie, stolperte und stieß gegen die Wand.
Mara packte mich an der Hand und zog mich mit sich. Ich konnte nur einen kurzen Blick auf den Hallender werfen, der mit bloßer Körperkraft durch die Tür gebrochen war.
Wir rannten durch den Korridor und unsere Verfolger setzten uns nach. Mara ließ die Laterne fallen. Sie zerbrach auf dem Steinboden, das Licht erlosch und nur unsere gehetzten Schritte und panischen Atemzüge verrieten uns.
Immer wieder schlug ich gegen die Wände. Die Gänge waren viel zu eng, um zu rennen.
»Stehen geblieben!«, rief einer der Männer.
Schüsse fielen.
Ich duckte mich, warf mich gegen die Wand und die Kugeln trafen den Gips direkt über meinem Kopf. Er bröselte mir ins Haar und färbte es weiß.
»Komm schon!«, rief Mara und bog um die Ecke.
Ich sprang auf, rannte weiter, schlitterte ebenfalls in den nächsten Gang und schaffte das gerade noch rechtzeitig, bevor weitere Schüsse abgefeuert wurden. Hinter mir schlugen die Kugeln durch die Wand und ließen das Licht des Palastkorridors wie Speere durch die Dunkelheit dringen.
An einer weiteren Leiter angelangt, sprang Emma nach unten, ohne sich mit den Sprossen abzumühen.
»Kommt schon!«, rief sie nach oben.
Ich warf einen kurzen Blick zurück. Mein Atem hetzte. Ich bekam in diesem Kleid keine Luft und musste mich auf den Knien abstützen, um nicht zusammenzubrechen. Lange würde ich diese Verfolgungsjagd nicht durchhalten können.
»Hörst du nicht zu?«, fauchte Mara und gab mir einen Stoß. Ich stolperte durch das Loch im Boden, schrie und schlug mit dem Kinn gegen eine der Sprossen. Unten angelangt, knickte mir der Fuß weg. Ein stechender Schmerz schoss durch mein Gelenk und ich wäre gestürzt, wenn Emma mich nicht gepackt und nach hinten gezogen hätte, damit Mara Platz für ihren Sprung hatte. Kaum war sie vor mir gelandet, fielen weitere Schüsse.
»Schnell jetzt!«, hetzte Mara und rannte voraus.
Emma drängte mich, ihr zu folgen. Mein Fußgelenk schmerzte unerträglich, aber darauf konnte ich keine Rücksicht nehmen. Wir durften keine Zeit verlieren.
Mara bog um eine Ecke und kurz darauf um die nächste. Es wirkte nicht wie der kürzeste Weg zur Küche, aber ich hütete mich nachzufragen oder Einspruch zu erheben. Schließlich kannte ich diese Gänge nicht, während die beiden Dienstmädchen sich jeden Tag hier aufhielten, um, wie es mein Vater gesagt hätte, die Korridore des Palastes nicht mit dem Anblick niederer Thrall zu beschmutzen.
Mein Vater … Ob sie ihn wirklich erschossen hatten? Oder war es ihm und vielleicht auch anderen Lightgrows gelungen zu entkommen? Meine Hand wanderte unwillkürlich zu der Kette um meinen Hals. Der Mondstein fühlte sich unwirklich warm und weich an. Ganz anders, als man es von einem ungeschliffenen Stein erwartet.
Mara war abrupt stehen geblieben und hatte den Arm gehoben, sodass ich dagegen stieß.
»Jetzt keinen Mucks, Mag«, mahnte sie mich.
Sie fixierte eine schmale Lichtlinie an der Wand. Eine weitere Tür. Schließlich wandte sie sich Emma zu.
»Sollen wir es wagen? Hören kann ich nichts.«
Emma nickte.
Irgendwo hinter uns waren die Schritte unserer Verfolger zu hören. Die Zeit lief uns davon.
Emma schob die Tür einen Spalt auf, lugte hindurch und winkte uns zu, ihr zu folgen.
Wir betraten ein kleines Kaminzimmer mit holzvertäfelten Wänden und Blumentapete. Es war niemand dort und dennoch war ein Feuer entzündet. Auf dem Beistelltisch neben einem gemütlichen Sessel lag ein Buch und daneben stand eine halb leer getrunkene Tasse Kaffee.
Maras Blick huschte zum Ausgang. Die Tür war angelehnt und von der anderen Seite drangen Geräusche zu uns vor.
»Beeilung«, flüsterte sie und durchquerte den Raum.
»Warte!«, rief Emma und wandte sich wieder dem Dienstboteneingang zu. »Hilf mir mal.«
Sie griff nach dem schmalen Regal gleich neben der Tür.
»Was hast du vor?«, fragte Mara.
»Wir schieben das Regal davor. Dann fällt kein Licht mehr in den Gang und sie übersehen die Tür«, erklärte sie.
»Das macht zu viel Lärm«, wehrte Mara ab. Wieder sah sie unsicher Richtung Korridor.
Ich näherte mich dem Fenster. »Wir ziehen die Vorhänge zu und löschen das Feuer«, schlug ich vor.
»Gute Idee!«, sagte Emma und lief zum Kamin.
Ich schluckte schwer, hob die Hand, griff nach einem der schweren Samtvorhänge und nahm mir fest vor, nicht nach draußen zu blicken. Doch ich konnte nicht anders. Ich hörte das Wimmern, die Schreie und Schüsse und musste einfach hinsehen.
Dort unten im Hof wimmelte es von Truppen der Hallenders. Ihre schwarz-grünen Uniformen standen in krassem Gegensatz zu den blasslila Kleidern der Dienstmädchen, die in einer Reihe auf dem nackten Steinboden knieten.
In ihrem Rücken lief ein Mann von einem Mädchen zum nächsten. Er schrie etwas, stellte wohl Fragen, die keine von ihnen beantworten konnte. Hinter einer der Frauen blieb er stehen und schoss ihr, ohne zu zögern, in den Hinterkopf.
Ich zuckte zusammen. Die junge Frau sackte vornüber, während die anderen wimmerten und schluchzten, es aber nicht wagten zu fliehen.
»Beeilung!«, drängte Mara ungeduldig.
Ich zog den Vorhang zu und lief zu ihr. Sie stand bereits an der gegenüberliegenden Wand und hatte dort die Tür zum Dienstbotengang geöffnet.
Wir tauchten wieder in die Dunkelheit und Emma zog die Tür hinter sich zu.
»Abgehängt«, sagte Mara erleichtert.
»Vorerst«, berichtigte Emma und legte mir die Hand in den Rücken. »Alles gut?«
Ich nickte, was Emma im Dunkel sicher nicht sehen konnte.
»Wir haben keine Zeit für Rührseligkeiten«, sagte Mara. »Von hier ist es nicht mehr weit bis zur Küche, also kommt jetzt.«
Ich presste die Zähne fest zusammen. Wenn Mara gesehen hätte, was ich gesehen hatte, würde sie nicht so reden. Diese Menschen hatten niemandem etwas getan. Sie dienten der Familie Lightgrow nur, weil sie es mussten. Sie brauchten diese Arbeit, um zu überleben, und hatten es nicht verdient, zwischen die Fronten zu geraten. Gerade Mara musste das doch verstehen. Aber sie hatte es nun mal nicht gesehen. Die Schüsse und Schreie hatte sie sicher gehört, aber die Angst in den Augen der Unschuldigen hatte sie nicht gesehen.
»Dann weiter«, sagte Emma und lief voraus.
Ich folgte ihr in kurzem Abstand.
An der nächsten Ecke blieben wir wieder stehen, als Stimmen zu hören waren.
»Pssst«, zischte Emma.
Licht fiel durch viele schmale Schlitze zwischen den Brettern der Wandvertäfelung und zeichnete Gitterstäbe auf unsere Gesichter.
»ENTKOMMEN?!«, brüllte eine Männerstimme auf der anderen Seite der Wand.
»Wie gesagt …«, antwortete ihm jemand.
Mein Herz pochte wild. Ich kannte diese Stimmen. Sie gehörten dem jungen Hallender, der mich verschont hatte, und niemand Geringerem als Macaulay höchstselbst.
Ein lauter Knall unterbrach den jungen Mann. Etwas hatte gegen die Wand geschlagen und ließ den Staub rieseln.
»Du kleiner Bastard«, knurrte Macaulay.
Emma bedeutete mit einer Geste, weiterzugehen, doch Mara weigerte sich mit einem Kopfschütteln. Direkt vor uns lag eine Tür. Wenn Mara die aufschieben würde und sie dabei quietschte, machte das womöglich zu viel Lärm. Wir mussten uns gedulden und abwarten, bis die Hallenders nicht mehr direkt auf der anderen Seite der Wand standen.
»Ich bin alles, nur nicht das«, entgegnete der Hallender in ruhigem, aber entschlossenem Ton. »Und das weißt du auch, Onkel.«
Ich sank auf den Boden und schob mich zur Wandvertäfelung. Durch ein herausgebrochenes Astloch konnte ich in den Raum dahinter blicken. Ich sah den jungen Hallender in seiner zugeknöpften Uniform und den Dolch, der meinen Tod hätte bedeuten sollen, in seinem Gürtel. Ihm gegenüber stand Macaulay. Dass er einen Neffen hatte, war mir neu. Aber die Hallenders neigten dazu, nicht alles über sich preiszugeben. So boten sie weniger Angriffsfläche.
»Pah!«, stieß Macaulay abfällig aus. »Dein Benehmen steht dem eines dreckigen Thrall in nichts nach, Hayes. Wenn ich dich Bastard schimpfe, ist das noch gnädig. Für deine Unfähigkeit sollte ich dich töten!«
Macaulay spuckte Hayes die Worte regelrecht vor die Füße und erwartete sicher, dass der vor Angst zurückwich, doch er blieb völlig ungerührt.
»Versuch es doch«, sagte er herausfordernd. Ein beinahe unmerkliches Lächeln ließ seine Mundwinkel zucken und in seinen Augen blitzte es. Wer vor Macaulay Hallender so viel Mut bewies, war entweder dumm oder sich seiner Sache ziemlich sicher.
»Versuch ja nicht mich zu provozieren!«, knurrte Macaulay und stürzte voran. Er wollte Hayes am Kragen packen, doch der wich ihm aus. Macaulay stieß einen unartikulierten Aufschrei aus und schlug mit der Faust nach Hayes. Das wäre für uns die Gelegenheit gewesen zu fliehen, doch ich starrte wie gebannt durch das Loch in der Vertäfelung. Gerade wollte ich die Hand heben und das Signal zur Flucht geben, da packten zwei weitere Männer in Uniform Hayes an den Armen. Einer von ihnen schlug ihm in die Rippen, der andere trat ihm die Beine weg, sodass er vor Macaulay auf die Knie fiel.
Ich hielt die Luft an.
»Noch habe ich hier die Macht und das Sagen«, zischte Macaulay und packte Hayes am Kragen. »Und wenn ich dir deine Aufmüpfigkeit aus der Visage prügeln will, hast du stillzustehen und es zu ertragen.«
Er hob die Faust, doch Hayes zuckte nicht einmal. Er sah mit festem Blick zu seinem Onkel auf. Angst vor den Schlägen schien er keine zu haben. Oder zumindest nicht zu zeigen.
Macaulay senkte die Faust unverrichteter Dinge und ließ Hayes’ Uniform los. Er strich sie sogar noch glatt und richtete den Kragen. Dann wanderte seine Hand zu Hayes’ Hals und seine Finger schlossen sich langsam darum.
Wortlos drückte er zu.
Mein Herz pochte schneller. Ich konnte nicht dabei zusehen, wie dieser Hallender starb, nur weil er mir geholfen hatte. Niemand, auch keiner wie er, hatte das verdient.
Hayes wehrte sich gegen die Männer, die ihn hielten. Sein Blick aber war ungebrochen auf Macaulay gerichtet, dessen Hand sich immer fester um seine Kehle schraubte. Seine Versuche, nach Luft zu schnappen, wurden von Sekunde zu Sekunde verzweifelter. Die Entschlossenheit in seinen Augen wich der Panik. Doch das genügte Macaulay scheinbar nicht. Er nahm auch die zweite Hand zu Hilfe und drückte fester zu.
Er sah dabei zu, wie Hayes’ Versuche, sich loszureißen, schwächer und die Panik in seiner Miene größer wurde.
Ein zufriedenes Lächeln umspielte Macaulays Lippen.
Hayes’ Augenlider begannen zu flattern. Erst dann ließ sein Onkel von ihm ab und trat einen Schritt zurück.
Ich sah, wie Hayes kraftlos vornübersackte, und atmete erleichtert auf, als er seine Lunge mit tiefen Atemzügen füllte.
»Ich gebe dir drei Tage«, sagte Macaulay. »Du wirst Luna Lightgrow finden und du wirst sie mir bringen oder ich knüpfe dich neben ihrem Vater auf und sehe dabei zu, wie die Krähen dir bei lebendigem Leib die Augen aus den Höhlen picken.«
Es hätte mir klar sein müssen, dass meine Flucht nicht unbemerkt bleiben würde. Sie würden mich bis an die Grenzen Havendors jagen und nicht ruhen, ehe ich tot war.
Macaulay gab seinen Männern den Befehl, ihm zu folgen. Sie ließen Hayes los und der fing sich mit den Händen ab.
Er zitterte und rang weiter nach Luft. Ich starrte wie gebannt durch das Loch in der Wand, wartete ab, bis Macaulay und seine Männer verschwunden waren, und wollte mich gerade zurückziehen, als Hayes aufsah.
Sein Blick fiel direkt auf das Astloch. Ich schrak zurück und wenn er mich nicht gesehen hatte, dann hatte er mich spätestens in dem Moment gehört.
»Weg hier!«, sagte ich und rappelte mich auf.
Wir liefen zur Tür, stießen sie auf und gelangten in eine kleine Rumpelkammer. Der Krach, den wir machten, als wir gegen Eimer und Besen stießen, musste gehört worden sein.
»Hier entlang!«, zischte Emma und deutete auf eine Tür. Wir nahmen den Weg, rannten, so schnell wir konnten, und stolperten schließlich in die Küche.
Es war still. Niemand folgte uns oder rief uns nach. Auf dem Herd stand ein großer Topf, dessen Inhalt heftig brodelte. Die Flammen züngelten an ihm hoch und hatten das Metall schwarz gefärbt. Auf der Arbeitsplatte stapelten sich die übrigen Speisen vom Buffet und dienten den Katzen als Festmahl. Das Blut, das sich quer über die Pasteten, gebratenen Rebhühner und Schweinekeulen zog, störte sie dabei reichlich wenig.
Mir jagte dieser Anblick einen Schauer über den Rücken.
Mara durchquerte die Küche und lugte durch den Hinterausgang.
»Nichts zu sehen«, sagte sie erleichtert und winkte mich und Emma zu sich.
Sie stieß die Tür vollends auf und trat ins Freie. Ich machte einen Bogen um die Blutspur auf den Fliesen, folgte ihr und tauchte in die Dunkelheit der Nacht ein. Draußen angekommen, warf ich einen Blick zurück, um noch einmal zum Palast aufzusehen.
Emma trat gerade ins Freie, als ein Schuss fiel.
Mara und ich duckten uns instinktiv. Nur Emma blieb stehen, riss die Augen weit auf und starrte mich voller Entsetzen an. Ein dünnes Rinnsal Blut floss ihr vom Haaransatz über die Stirn. Ihre Miene war wie zu Stein geworden, ihre Augen stachen hervor, als wären sie zu doppelter Größe angeschwollen.
Sie fiel vornüber und wo ihr Hinterkopf und ihr Haar gewesen waren, klaffte ein blutiges Loch.
»NEEEIIIIN!«, schrie ich und stürzte auf sie zu.
Mara packte mich am Arm und zog mich von Emma weg. Weitere Schüsse fielen und erstickten meine Schreie unter dröhnendem Lärm.
Verzweifelt versuchte ich mich aus Maras Griff zu befreien und zu Emma zu gelangen. Tränen füllten meine Augen. Mein ganzer Körper zitterte.
Mara ließ nicht locker. Sie zog mich mit sich und schleifte mich vom Palast weg. Weg von Emma, von der einzigen Freundin, die ich je gehabt hatte, von meinem Zuhause, meiner Familie und meinem Schicksal, das in dieser einen unwirklichen Nacht einer anderen, ungewissen Zukunft gewichen war.