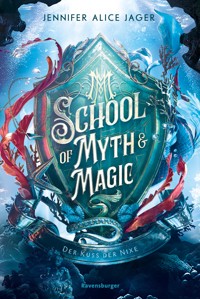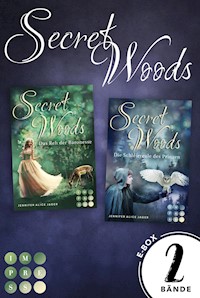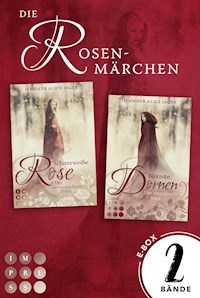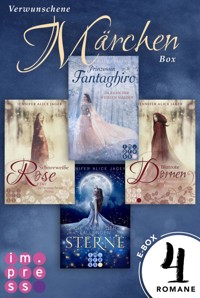4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
»Ein wahres Highlight!« »Atmosphärisch und bildgewaltig.« »Absolut gelungen!« (Leser*innenstimmen) **Ein Herz aus Eis** Die Schneekönigin beherrscht ihr kaltes Reich mit eiserner Hand. Wer sich nicht an ihre Gebote hält, wird mit Vergessen gestraft. Auch Malin wurden all ihre Erinnerungen genommen. Ohne zu wissen, wer sie ist oder welchem Verbrechen sie sich schuldig gemacht hat, führt ihr Weg sie ausgerechnet ans Schloss der Königin. Und damit zurück zu dem Mann, der ihre Erinnerungen stahl: dem geheimnisvollen Achatkrieger. Doch obwohl er sein Gesicht hinter einer Maske verbirgt, bringt etwas in seinem eiskalten Blick Malins Herz zum Schmelzen … »Frozen Queen. Das Lied des Winters« ist eine Adaption des Wintermärchens »Die Schneekönigin« von Hans Christian Andersen. Dieser Roman ist ein in sich abgeschlossener Einzelband. Weitere märchenhafte Romane der Bestseller-Autorin Jennifer Alice Jager bei Impress: -- Sinabell. Zeit der Magie -- Being Beastly. Der Fluch der Schönheit -- Secret Woods 1: Das Reh der Baronesse -- Secret Woods 2: Die Schleiereule des Prinzen -- Prinzessin Fantaghiro. Im Bann der Weißen Wälder -- Schneeweiße Rose. Der verwunschene Prinz (Rosenmärchen 1) -- Blutrote Dornen. Der verzauberte Kuss (Rosenmärchen 2) -- Die Nacht der fallenden Sterne//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Jennifer Alice Jager
Frozen Queen. Das Lied des Winters
**Ein Herz aus Eis**
Die Schneekönigin beherrscht ihr kaltes Reich mit eiserner Hand. Wer sich nicht an ihre Gebote hält, wird mit Vergessen gestraft. Auch Malin wurden all ihre Erinnerungen genommen. Ohne zu wissen, wer sie ist oder welchem Verbrechen sie sich schuldig gemacht hat, führt ihr Weg sie ausgerechnet ans Schloss der Königin. Und damit zurück zu dem Mann, der ihre Erinnerungen stahl: dem geheimnisvollen Achatkrieger. Doch obwohl er sein Gesicht hinter einer Maske verbirgt, bringt etwas in seinem eiskalten Blick Malins Herz zum Schmelzen …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Danksagung
© privat
Jennifer Alice Jager begann ihre schriftstellerische Laufbahn 2014. Nach ihrem Schulabschluss unterrichtete sie Kunst an Volkshochschulen und gab später Privatunterricht in Japan. Heute ist sie wieder in ihrer Heimat, dem Saarland, und widmet sich dem Schreiben, Zeichnen und ihren Tieren. So findet man nicht selten ihren treuen Husky an ihrer Seite oder einen großen, schwarzen Kater auf ihren Schultern. Ihre Devise ist: mit Worten Bilder malen.
Für Jene, die glauben, in Vergessenheit geraten zu sein.Der Verstand vergisst, das Herz nie.
Abschnitt 1
Der Fluch
Kapitel 1
An klaren Tagen konnte man das Schloss der Schneekönigin oben auf den hohen Bergen thronen sehen. Ähnlich einer Krone aus Kristall ragte es zwischen den schneebedeckten Gipfeln hervor und glänzte wie klares Eis im Schein der tiefstehenden Sonne – prachtvoll und unnahbar, genau wie die Herrin des Winters selbst.
Als ich am Morgen aufgebrochen war, um gemeinsam mit Alina und Navena Wurzeln im Wald zu suchen, hatte das Schloss noch hinter Nebelschwaden gelegen. Nun zeichnete es sich deutlich vor dem blauen Himmel ab und ich war trotz der Kälte stehengeblieben, um es zu bewundern. Ich zog mir meinen fadenscheinigen Überwurf enger um die Schultern, schaute hinauf zu den fernen Türmen und fragte mich, was dort hinter den Fenstern geschah, wer das Schloss bewohnte und ob sie genauso auf mich hinunterschauten wie ich zu ihnen hinauf.
»Immer wieder beeindruckend, nicht wahr?«, fragte Alina und versuchte vergebens, sich ihr strohblondes Haar hinter die Ohren zu streichen. Mir huschte ein flüchtiges Lächeln über die Lippen, weil es ein bisschen lustig aussah, wie sie das mit ihren dicken Fäustlingen versuchte. Im Gegensatz zu mir waren die Schwestern bestens für die Kälte ausgerüstet. Beide trugen sie Wollschals, Fellmützen und gefütterte Mäntel.
Ich nickte und rieb mir die frierenden Hände. Der Anblick des Schlosses flößte mir immer wieder Ehrfurcht ein. Und doch konnte ich die Augen nicht von ihm lassen. So häufig, wie es schneite, kam es schließlich selten genug vor, dass sich mir die Gelegenheit bot, es zu sehen.
»Aus dem Weg!«, blaffte jemand.
Wir wichen auf das angrenzende Feld aus, als auch schon ein Pferdekarren an uns vorbeipreschte. Der Kutscher hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, sein Tempo zu drosseln. Alina wäre beinahe gestürzt und Navena ließ ihren Korb fallen. »Der Blödsack hätte uns auch früher warnen können!«, fluchte sie.
Navena nahm selten ein Blatt vor den Mund, was im starken Kontrast zu ihrem puppenhaften Aussehen mit den goldenen Locken und rosigen Pausbäckchen stand. Sie schnaufte mürrisch, sah dabei eher niedlich als böse aus, und sank auf die Knie. Ihre gesammelten Wurzeln lagen überall auf dem Weg verteilt.
Ich ging ihr beim Aufsammeln zur Hand. »Vielleicht bringt er Nahrung«, mutmaßte ich und schaute dem Karren nach.
Der unfreundliche Mann war auf dem Weg nach Embird, unserer Heimatstadt. Die Waren, die er mit sich führte, hatte er unter einer Plane abgedeckt, sodass man nicht erkennen konnte, worum es sich dabei handelte. Mit etwas Glück war es Korn, vielleicht Brot oder Fleisch. Hauptsache etwas zu essen, denn das ging den Bewohnern des kleinen Städtchens allmählich aus.
»Schön wär’s«, murrte Navena.
»Oder Stoffe«, überlegte Alina und schaute dem Karren ebenfalls nach. »Stellt euch vor, die Schneekönigin gibt einen Winterball und lädt alle jungen Mädchen Avendars ein! Wir tanzen und schwingen die Röcke unserer neuen Kleider. Vielleicht lernt eine von uns einen Prinzen aus einem fernen Land kennen. Wäre das nicht schön?«
Sie hob ihren Mantel an, drehte sich im Kreis und begann leise zu summen. Mir versetzte das einen Stich. Ich sprang auf, packte Alina und drückte meine Hand auf ihren Mund.
»Schhh!«, zischte ich eindringlich. »Das ist verboten.«
Alina riss sich von mir los und stieß mich grob von sich. Ich verlor den Halt und stürzte in den Schnee.
»Lass deine Finger von mir!«, beschwerte sie sich und spuckte. »Du bist voller Erde und jetzt habe ich das Zeug im Mund. Das ist eklig.«
Mein Blick wanderte zu meinen ausgemergelten Händen. Sie waren vom Ausgraben der Wurzeln verschmutzt, rau und in der Kälte rissig geworden. Der Hunger tat sein Übriges, um sie wie dürre Äste aussehen zu lassen.
»Tut mir leid«, entschuldigte ich mich. »Aber du weißt, was passiert, wenn man gegen die Gesetze der Schneekönigin verstößt. Es ist nun mal verboten, zu singen und zu tanzen.«
»Malin hat recht«, stimmte mir Navena zu. »Was, wenn jemand gesehen hätte, wie du hier so blöd rumhüpfst?«
»Aber mich hat niemand gesehen«, entgegnete Alina gereizt. »Und ich hüpfe auch nicht blöd!«
Navena streckte ihrer großen Schwester die Zunge raus. »Bäääh!«
»Du benimmst dich wie ein Kleinkind!«, blaffte Alina.
Mein Blick wanderte wieder zum Schloss. Tanzen, wallende Kleider, königliche Bälle … allein der Gedanke daran war abwegig und doch hatte ich ein klares Bild davon vor Augen.
Vielleicht war ich früher einmal auf einem Ball gewesen? Immer wieder kam es vor, dass ich glaubte, mich an etwas aus meiner Vergangenheit erinnern zu können. Doch das verging schnell und verlor sich, wie ein Traum, der bereits kurz nach dem Aufwachen zu schwinden begann. Was zurückblieb, war Leere in meinem Kopf, wo die Erinnerungen an mein bisheriges Leben sein sollten.
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Königin keine Tanzbälle gibt«, meinte Alina und riss mich damit aus meinen Gedanken. »Worum wetten wir, dass man im Schloss singen, tanzen und musizieren darf?«
Navena lachte hämisch. »Wahrscheinlich hat sie es nur dem Volk von Avendar verboten, weil sie unser Gequake nicht ertragen kann.«
»Dann müsste sie uns auch das Lachen verbieten, denn du klingst dabei wie ein alter Esel!«
»Das ist überhaupt nicht wahr!«, beschwerte sich Navena. Sie sprang auf, verteilte dabei die aufgesammelten Wurzeln auf dem Boden und stürzte auf Alina zu. Die ließ ihren Korb fallen und suchte fluchtartig das Weite. Lachend rannten die beiden Schwestern über das verschneite Feld und bewarfen sich mit Schneebällen.
Zumindest das war nicht verboten. Lachen durfte das Volk von Avendar noch. Allerdings gab es nicht viele Gründe dafür. Nicht bei der Armut, die überall vorherrschte, bei dem Hunger und dem Verbot, auch nur zu Summen. In einem Land zu leben, das unter Eis und Schnee bedeckt lag, war für niemanden leicht. Dabei mochte ich den Winter. Ich liebte es, wie der Schnee bei jedem meiner Schritte leise knirschte. Wenn die Sonne ihn zum Glitzern brachte und die Welt aussah, als wäre sie von Diamantenstaub bedeckt. Jede Schneeflocke war ein einzigartiges Kunstwerk. Auf den ersten Blick mochten sie zart und vergänglich sein und doch waren sie in ihrer Masse eine unüberwindbare Streitmacht, die jeden Feind in die Knie zwingen konnte. Der ewige Winter war voller Wunder und Schönheit, die man ihm trotz seiner tödlichen Gefahren nicht absprechen konnte.
Ich schaute ein letztes Mal zum Schloss, dann sammelte ich die heruntergefallenen Wurzeln ein, nahm alle drei Körbe und machte mich auf den Heimweg. Es dämmerte allmählich und Wolken zogen sich am Himmel zusammen.
»Alina, Navena, kommt ihr?«, rief ich den beiden zu.
Die Mädchen lachten und jagten einander noch immer. Erst kurz bevor wir Embird erreicht hatten, schlossen sie zu mir auf.
»Jetzt hast du alles allein schleppen müssen«, entschuldigte sich Alina schwer atmend und griff sich ihren Korb.
Navena nahm mir ihren ab.
Wir durchquerten das beschauliche kleine Städtchen, mit seinen strohbedeckten Fachwerkhäusern und gepflegten Vorgärten. Hier und dort behaupteten sich darin ein paar Rosen, Veilchen, Kamelien und Krokusse gegen die eisige Kälte. Die Bewohner Embirds taten alles, um die einstige Schönheit ihrer Heimat zu bewahren. Dennoch konnte man den beginnenden Verfall nicht verleugnen.
Als wir den Marktplatz passierten, sahen wir den Händler mit seinem Pferdekarren. Die Waren darauf hatte er mittlerweile enthüllt und pries nun Töpfe und Pfannen bester Qualität an. Viel Aufmerksamkeit bekam er jedoch nicht. Die Stadtbewohner konnten sich kaum das Brot auf ihren Tellern leisten, geschweige denn Eisenwaren.
Vom Hof des Pferdewirts hörte man eine Glocke schlagen.
»Es gibt schon Essen!«, stellte Navena freudig fest.
»Ich habe so einen Hunger!«, jammerte Alina.
Die beiden beschleunigten ihre Schritte und hatten es so eilig, dass sie nicht bemerkten, wie ihnen immer wieder ein paar Wurzeln aus den Körben fielen. Ich folgte ihnen und klaubte eine Wurzel nach der anderen vom Boden auf. Wir konnten es uns nicht leisten, auch nur auf eine davon zu verzichten.
Am Hof angekommen stand die Hausherrin in der offenen Tür und schlug die Glocke. Marisol war eine stattliche Frau, mit eiserner Mimik, aber warmherzigen Augen. Der Pferdewirt gehörte zu den wohlhabenderen Bewohnern Embirds, was man seiner Gattin auch ansah. Trotz der vorherrschenden Armut trug sie stets ihre besten Kleider und steckte sich ihr Haar mit hübschen Spangen hoch.
»Ab rein mit euch, Mädchen!«, rief sie ihren Töchtern zu. »Lasst mal sehen, was ihr gefunden habt.«
»Was gibt es zu essen, Mutter?«, fragte Alina. Sie stellte ihren Korb an der Tür ab und klopfte sich den Schnee von den Stiefeln. Die Frau warf einen flüchtigen Blick auf die gesammelten Wurzeln der Mädchen. Ihre Enttäuschung über die karge Ausbeute des Tages konnte sie nur schwer überspielen.
»Rübensuppe, Liebes«, sagte sie und schob Alina ins Haus.
»Aber die gab es doch schon gestern«, maulte Navena.
Die Frau legte ein schmales Lächeln auf. »Wenn ihr morgen statt Wurzeln ein saftiges Schweinchen ausgrabt, gibt es Schweinebraten. Bis dahin müssen wir uns alle mit der Rübensuppe begnügen. Zumindest noch solange, bis euer Vater die Jungtiere verkauft hat.«
»Das ist so gemein!« Navena pfefferte ihre Handschuhe auf den Boden und stapfte ins Haus.
»Deine Schuhe, Navena!«, rief ihre Mutter ihr nach.
Ich trat vor und deutete einen Knicks an. »Mehr war leider nicht zu finden, Herrin«, erklärte ich und zeigte ihr meinen Korb.
Die Frau hob eine Braue, als sie die kümmerlichen Wurzeln sah. »Nun gut«, sagte sie. »Ändern lässt sich daran jetzt auch nichts mehr. Du siehst ganz durchgefroren aus, Kleines. Komm rein und wärm dich am Kamin auf.«
»Danke sehr.« Ich stellte den Korb neben die anderen und schlüpfte aus meinen Schuhen.
Die Mädchen waren bereits ins Esszimmer gelaufen, das gleich an die Wohnstube grenzte. Als ich ins Haus trat, konnte ich von dort Besteck und Geschirr scheppern hören. Mir knurrte der Magen. Aber das Feuer war in diesem Moment verlockender. Seine Wärme flutete den gemütlichen, kleinen Raum mit der einladenden Sitzecke und den Familienportraits an den Wänden. Ich sank auf das Schafsfell vor dem Kamin und wärmte mir meine durchgefrorenen Hände auf.
Die Hausherrin verschwand im Esszimmer. »Finger weg!«, drohte sie ihren Töchtern.
»Aber ich habe so einen Hunger«, maulte Navena.
In dem Moment ging die Haustür auf und der Pferdewirt betrat die Stube. Ich war sofort auf den Füßen und knickste höflich. Watheos, ein kräftig gebauter Mann mit Augenbrauen, aus denen man Perücken hätte knüpfen können, bedachte mich mit einem abfälligen Blick. Er entledigte sich seines schneeüberzogenen Mantels. Mütze und Schal folgten und dabei murmelte er etwas Unverständliches in seinen Bart hinein.
Seine Frau kam aus dem Esszimmer gelaufen. »Liebling, deine Töchter warten bereits sehnsüchtig auf dich!«, begrüßte sie ihn.
»Was macht die Kleine hier?«, fragte er mit einem Nicken in meine Richtung.
Sie warf mir einen flüchtigen Blick zu. »Es ist eiskalt draußen, die Mädchen waren den ganzen Tag unterwegs.«
»Gott weiß, wo sie herkommt und welchen Ärger sie uns noch einbringt«, murrte ihr Mann mit gesenkter Stimmte. »Ich will nicht, dass du sie mit den Mädchen losschickst und erst recht hat sie nichts in unserer guten Stube zu suchen. Gib ihr eine andere Arbeit, wenn du sie unbedingt behalten willst, aber halte sie von unseren Kindern fern.«
»Sie kann doch sonst nirgendwo hin«, erinnerte sie ihn.
»Vater!«, rief Navena.
Sie und Alina kamen angelaufen und umarmten den Mann. Er drückte die beiden fest an sich. »Wart ihr heute auch fleißig?«, fragte er.
»Das waren sie«, bestätigte ihre Mutter. »Und jetzt lasst uns essen, solange die Suppe noch warm ist.«
»Rübensuppe?«, fragte Watheos argwöhnisch.
»Sie macht satt, mein Lieber.«
Der Pferdewirt brummte unzufrieden und begab sich mit seinen Töchtern ins Esszimmer. Seine Frau wandte sich noch einmal an mich. Ihr Blick war nicht mehr ganz so warmherzig: »Geh jetzt und bring den Angestellten ihr Essen. Den Rest des Tages kannst du dir freinehmen.«
»Danke sehr«, sagte ich.
Die Frau musterte mich noch einmal nachdenklich, dann folgte sie ihrer Familie.
Ich schaute ihr nach. Wie lange mich ihr Mann noch dulden würde, wusste ich nicht. Zwar tat ich mein Bestes, um mich nützlich zu machen, aber die Wahrheit war, dass mich diese Familie nicht wirklich brauchte. Sie hatten genug Angestellte am Hof und brauchten kein weiteres Maul, das es zu stopfen galt.
Ich seufzte schwer, schaute noch einmal zum einladenden Kamin, dann warf ich einen Blick aus dem Fenster. Allmählich wurde es dunkel. Nach dem langen Arbeitstag hatten die Angestellten des kleinen Pferdehofs bestimmt großen Hunger und ich wollte sie nicht länger warten lassen. Also ging ich zur Tür, wo Brot, Käse und ein paar Äpfel auf mich warteten. Ich packte alles in einem Stofftuch zusammen und verließ das Haus.
Von der anderen Seite des Hofes fiel ein schmaler Lichtstreif über den ausgetretenen Schneematsch. Das Tor zur Scheune war dort nur angelehnt, fröhliche Stimmen drangen zu mir vor und ich lief darauf zu. Kurz bevor ich die Scheune erreicht hatte, begann es zu schneien. Dicke weiße Flocken tänzelten vom Himmel auf mein Haar herab. Ich blieb stehen und legte den Kopf in den Nacken. Am nächsten Morgen würde alles in der Umgebung, bis hin zum Schloss der Königin, wieder unter einer weißen Decke verschwunden sein. Und alle Spuren des vergangenen Tages wären verwischt, als hätte es sie nie gegeben. Alles würde wieder aufs Neue beginnen können. Der Gedanke hatte etwas Beruhigendes an sich und ich schloss die Augen, um mich ihm einen Moment lang hinzugeben.
»Keine Wurzeln schlagen, Malin«, rief mir jemand zu. Es war Dantos, einer der Stallburschen, der den Kopf aus dem Scheunentor gestreckt hatte. Er war ein schlaksiger junger Kerl, der immer einen Scherz parat hatte. »Wir verhungern hier noch, während du verträumt in den Himmel starrst.«
Ich lächelte. »So schnell wirst du schon nicht vom Fleisch fallen, Dantos«, versicherte ich ihm und schob mich an ihm vorbei in die Scheune, wo sich die Angestellten, Frauen und Männer, um eine Feuerschale versammelt hatten. Sie saßen auf Kisten und Strohballen, unterhielten sich und scherzten miteinander. Ein paar von ihnen warfen mir misstrauische Blicke zu, aber die meisten hatten hingenommen, dass mir die Frau des Pferdewirts Obdach bot. Gefallen musste ihnen das deswegen aber noch lange nicht.
Luger, der Vorsteher der Arbeiter, ein fülliger Mann mit Halbglatze und Knollennase, legte mir eine Pferdedecke über die Schultern. »Es gefällt mir gar nicht, dass sie dich jeden Tag in die Kälte schicken. Nur mit diesem schäbigen Überwurf, ohne Schal und Mütze.«
»Wenn ich nun mal nicht mehr besitze«, sagte ich.
»Du könntest im Haus aushelfen«, meinte Bathea. Sie gehörte zu den Wenigen, die ganz normal mit mir umgingen. Mit ihrem runden Gesicht, dem ergrauten Haar und den immerwährenden Lachfalten um die Augen hatte sie etwas Mütterliches an sich.
»Aber das machst du doch schon«, meinte ich. »Für mich gibt es da nicht mehr viel zu tun. Außerdem will mich der Hausherr dort nicht sehen.«
»Recht hat er«, hörte ich jemanden kleinlaut sagen.
Ich versuchte das zu ignorieren, ging in die Hocke und knüpfte das Stoffbündel auf. Um so viele Leute satt zu bekommen, reichte das Essen kaum aus, aber wir hatten schon weniger gehabt und niemand beschwerte sich.
»Wehe er spielt mit dem Gedanken, dich fortzuschicken«, sagte Luger in drohendem Ton. Er brach das Brot in mehrere Teile und verteilte es. Auch an mich reichte er ein Stück weiter. Ich sank auf einen Strohballen und biss von meinem Brotstück ab. Wie viel Hunger ich tatsächlich gehabt hatte, merkte ich erst in diesem Moment und ich schlang es gierig hinunter.
»Es ist sein gutes Recht«, sagte einer der Stallburschen. »Wenn er sie nicht mehr hierhaben will, muss sie sich halt etwas anderes suchen.«
»Aber sie leistet gute Arbeit«, meinte Bathea.
»Das tun wir doch alle, oder?«
In dem Moment war vom Hof her das Geräusch von Hufschlägen zu hören und zog alle Aufmerksamkeit auf sich.
»Besucher?«, fragte Bathea nervös. »So spät noch?«
Luger stand auf. »Ihr wartet hier«, entschied er und ging zum Tor. Aber niemand hatte die Geduld zu warten. Alle eilten ihm nach und wollten sehen, wer im Dunkeln auf den Hof des Pferdewirts geritten kam. Ich konnte nur einen kurzen Blick nach draußen erhaschen und sah die Flanke eines weißen Pferdes.
»Der Achatkrieger«, krächzte Dantos erschrocken und wich zurück.
Sofort brach Unruhe aus und auch ich wurde nervös. Mit etwas Glück war der Abgesandte der Königin nur auf der Durchreise, wollte sein Pferd versorgen lassen oder nach dem Weg fragen, aber wie wahrscheinlich war das? Wenn der Achatkrieger ein Ziel ausgemacht hatte, brachte ihn nichts davon ab. Dann setzte er ihm nach, bis seine Aufgabe erfüllt war. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er es nötig hatte, nach dem Weg zu fragen.
Ich musste an Alina denken und zeitgleich glitt mein Blick zu der Nische zwischen den alten Pferdeboxen, wo ich meinen einzigen Besitz vor den Augen aller verborgen hielt. Er hatte es doch nicht etwa darauf abgesehen?
Unweigerlich lief ich rückwärts, tiefer in die Scheune hinein, während Luger seine Haltung straffte, das Tor aufschob und ins Freie trat. Die anderen folgten ihm. Ein paar von ihnen warfen mir zuvor noch abschätzige Blicke zu. Sie mutmaßten wohl, dass der Achatkrieger meinetwegen gekommen war, sagten aber nichts.
»Kommst du?«, fragte Bathea. »Wir sollten keine Angst zeigen. Vor allem du nicht. Deine Strafe hast du bereits erhalten, also gibt es keinen Grund dazu.«
Damit hatte sie wahrscheinlich recht. Niemand konnte sagen, wie der Achatkrieger seine Ziele ausfindig machte. Gut möglich, dass er die Angst der Schuldigen von ihren Gesichtern ablas, vielleicht konnte er sie aber auch riechen oder sie bereits aus der Ferne spüren. Ihm mutig entgegenzutreten, war das Einzige, was ich machen konnte – denn entkommen konnte ihm niemand und wenn man sich auch noch so gut zu verstecken wusste.
Ich nahm all meinen Mut zusammen und verließ die Scheune an Batheas Seite, konnte im ersten Moment aber nur die Rücken der anderen sehen. Die Angestellten standen dicht an dicht, wagten sich nicht vor und tuschelten leise.
»Er sagt gar nichts«, meinte einer von ihnen.
»Mir macht er Angst«, flüsterte jemand anderes.
»Ob er wegen ihr hier ist? Besser, wir hätten sie nicht aufgenommen.«
Schließlich war es Luger, der sich räusperte und vortrat, wodurch ich freie Sicht bekam. »Wie können wir helfen?«, fragte er.
Der Mann auf dem stattlichen Schimmel wandte sich ihm zu. Er war von oben bis unten in Weiß gekleidet. Sein Umhang und die wallenden Stoffe, die ihn umhüllten, flatterten im Wind. Ich sah weder Schwert und Schild noch trug er eine Rüstung, wie ich vermutet hatte. Im Kampf wären seine ledernen Handschuhe und Stiefel, sowie die nietenbesetzten Riemen um seine Schultern, kaum von Nutzen gewesen. Die Kapuze hatte er sich tief ins Gesicht gezogen und wenn man versuchte, einen Blick auf sein Gesicht zu erhaschen, war alles, was man sehen konnte, eine schmalgeschnittene Maske. Mich erinnerte sie an das Abbild eines dämonischen Fuchses und im Grunde war der Achatkrieger auch genau das: Er war ein Dämon. Er suchte das Volk von Avendar heim und machte vor niemandem halt – nicht einmal vor den Alten, den Schwachen und den Kindern. Er zeigte keine Gnade und niemand wagte es, sich ihm in den Weg zu stellen.
Er musterte Luger von oben bis unten, dachte aber wohl nicht daran, ihm seine Frage zu beantworten. Erst als auf der anderen Seite des Hofes die Tür zum Haupthaus geöffnet wurde, schwang er sich vom Pferd.
Die Hausherrin und ihre Töchter traten ins Freie. Der Pferdewirt folgte mit einer Axt bewaffnet, schob sich vor seine Familie, senkte die Waffe aber, als er sah, mit wem er es zu tun hatte.
Panik überkam mich, als ich sah, wie der Blick des Achatkriegers an Alina hängenblieb. Mir rutschte die Pferdedecke von den Schultern und mein Herz begann wie wild zu pochen. Der Mann machte sich ohne Umschweife auf den Weg zu ihr, seine Schritte knirschten im Schnee, seine Hände ballten sich zu Fäusten.
»Was haben die Mädchen angestellt …?«, murmelte Bathea betreten.
Mein Atem ging schneller. Es waren doch nur ein paar Töne gewesen! Was Alina getan hatte, war von niemanden gehört worden. Niemand hatte sie dabei gesehen. Ich wollte nicht wahrhaben, dass nur so wenig ausreichte, um die Königin zu erzürnen. Alina dafür zu bestrafen, war einfach nicht gerecht.
Ich konnte nicht anders und setzte dem Achatkrieger nach. Wenn unter der Maske ein echter, lebender Mensch zu finden war, musste er Gnade kennen. Dann musste man doch mit ihm reden können!
»Wir haben nichts Falsches getan«, warf die Hausherrin dem Achatkrieger mit zitternder Stimme entgegen.
Ich hatte ihn eingeholt und verstellte ihm den Weg. Obwohl ich große Angst hatte, wusste ich nicht, was ich sonst hätte tun können. »Sie ist fast noch ein Kind«, flehte ich den Achatkrieger an.
Der Mann hielt inne, war mir aber so nah gekommen, dass ich ihm direkt ins Gesicht blicken und seine Augen unter der Maske erkennen konnte. Eines blauschimmernd wie klares Eis, das andere von einem warmen, fast rötlichen Braunton.
Er wirkte so viel jünger, als ich es vermutet hatte. Wahrscheinlich war er kaum älter als ich. Und so wie er mich anschaute, hatte er nichts Berechnendes, nichts Böses an sich. Wie konnte jemand so grausame Taten vollbringen und dabei so menschlich wirken?
Je länger ich ihm gegenüberstand, desto mehr hatte ich das Gefühl, alles um mich herum würde verstummen. Und für den Bruchteil eines Augenblicks kam es mir vor, als wäre ich an einem anderen Ort – als würden warme Sonnenstrahlen meine Haut küssen. Ich hörte das Zwitschern von Vögeln, spürte taunasses Gras unter meinen Füßen und lauschte einer Stimme, die mir Worte zuflüsterte, die zu leise waren, um sie zu verstehen. Als ich es dennoch versuchte, zerbrach der Moment wie hauchdünnes Eis und ich stürzte zurück in die eisige Wirklichkeit.
Der Achatkieger hatte seine Hand gehoben, als wolle er meine Wange berühren und ich war wie erstarrt. Ich hätte es geschehen lassen, dass mir seine Finger über die Haut glitten, weil mich sein Blick noch immer gefangen hielt. Doch kurz bevor er mich berührte, holte er aus und stieß mich grob von sich. Ich landete der Länge nach auf dem gefrorenen Boden und schlug mir dabei den Ellbogen auf. Der Schmerz schoss mir bis in die Fingerspitzen und ich biss mir auf die Lippen. Als ich mich wieder aufgerappelt hatte, war der Häscher der Königin bereits an die Familie herangetreten und hatte seine Hand nach Alina ausgestreckt. Sie versteckte sich hinter ihrer Mutter, aber jeder wusste, dass das nichts nutzen würde.
»Bitte«, flehte die Frau vergebens und schaute zu ihrem Mann, nachdem der Achatkrieger keine Reaktion zeigte. Doch der Pferdewirt senkte nur beschämt den Blick.
»Ich … ich habe doch nicht …«, wimmerte Alina noch, bevor ihre Augen glasig wurden.
Zarte Silberfäden begannen sich von ihrem Antlitz zu lösen. Wie eine vom Wind getragene Schneewehe schwebten sie auf die ausgestreckte Hand des Achatkriegers zu. Sie umwoben seine Finger und formten sich zu einer Kugel aus schimmerndem Licht. Alina ließ ihre Schultern hängen, während sie willenlos hinter ihrer Mutter hervortrat und sich dem Achatkrieger näherte.
»Aufhören!«, verlangte ich. Meine Kehle war wie zugeschnürt. Ich stürzte voran, wollte mich erneut zwischen ihn und Alina stellen, doch er hielt mich mühelos mit nur einer Hand auf und vollendete sein Werk, indem er seine Faust ballte, das Licht darin einschloss und gnadenlos erstickte.
In dem Moment sackte Alina kraftlos auf die Knie. Navena und ihre Mutter waren sofort bei ihr und hielten sie fest, während ich mich wie betäubt fühlte und Alina mit weit aufgerissenen Augen anstarrte – unfähig mich zu bewegen oder auch nur zu atmen.
Der Achatkrieger warf mir noch einen letzten Blick zu. Seine Hand hatte sich um den Stoff meines Überwurfs geschlossen. Er hielt mich fest und hätte mich erneut von sich stoßen können, wenn er willens gewesen wäre. Stattdessen schlug er die Augen nieder, ließ mich los und wandte sich seinem Pferd zu.
Ich taumelte. Es war mir vorgekommen, als hätte er mich wiedererkannt. Aber konnte das sein? Erinnerte er sich an seine Opfer? An jedes einzelne? Es musste ungefähr ein Jahr zurückliegen, dass er mir angetan hatte, was gerade mit Alina geschehen war. Auch mir hatte er alles genommen. Bei dem Gedanken wurde mir heiß und kalt zugleich und Wut kam in ihr auf.
»Du bist ein Monster«, rief ich ihm mit erstickter Stimme nach.
Der Achatkrieger stockte, ließ es dann aber doch auf sich beruhen und lief zurück zu seinem Pferd. Wahrscheinlich war das auch besser so. Obwohl sich ein Teil von mir wünschte, meine Worte hätten ihn berührt, vielleicht sogar verletzt. Dann hätte ich ihn angeschrien, auf ihn eingeschlagen und alles rausgelassen, was mich innerlich aufzufressen drohte – dann hätte ich gewusst, dass er ein Herz hatte, das genauso leiden konnte, wie er seine Opfer leiden ließ. So aber blieb mir nichts anderes, als hinunterzuschlucken, was so quälend in mir brannte.
Im Augenwinkel sah ich, wie er sich auf sein Pferd schwang und vom Hof ritt. Noch einen Moment lang blieb ich wie betäubt stehen, dann eilte ich zu Alina.
»Es tut mir so leid!« Tränen füllten meine Augen. Ich machte mir die größten Vorwürfe, nicht schneller eingegriffen zu haben, als sie begonnen hatte zu summen.
Alina schaute sich verwirrt um. »Wo … wo bin ich?«
»Zu Hause«, sagte ihre Mutter mit erstickter Stimme. »Du bist zu Hause, mein Schatz.«
»Wer seid ihr?«, fragte Alina bestürzt.
»Das ist unsere Mutter«, erklärte Navena unsicher.
»Mutter?«, fragte Alina.
Die Frau nickte, öffnete den Mund, doch kein Wort kam ihr über die Lippen.
»Ich bin deine Schwester, Navena. Erkennst du mich nicht?«
Alina schüttelte den Kopf. »Nein!«, stieß sie aus, sprang auf und lief rückwärts. »Ich kenne euch nicht! Ich kenne niemanden von euch!«
»Beruhige dich«, forderte sie ihr Vater auf. Dann wandte er sich mir zu. Sein Blick war voller Wut. »Und du, geh zu den anderen. Das hier ist Familiensache.«
»Ich … ich habe ihr den Mund zugehalten«, erklärte ich. »Es war nur ein Summen, mehr nicht. Wenn ich früher …«
»Du hättest uns sagen müssen, was passiert ist«, fuhr er mich an. »Durch dein Schweigen hast du uns um die letzten Stunden mit unserer Tochter gebracht. Geh mir bloß aus den Augen, bevor ich mich vergesse!«
Ich schaute zu Alina, deren Verzweiflung sich deutlich in ihren Zügen abzeichnete. Der Achatkrieger hatte ihr all ihre Erinnerungen genommen. Genau wie er es mit mir getan hatte. Geblieben war mir damals bloß mein Name. Mehr nicht. Nicht einmal eine Familie, die sich um mich sorgte und kein Zuhause, das ich neu kennenlernen konnte. Nichts. Alina so zu sehen fühlte sich an, als würde ich noch einmal alles verlieren.
Navena und ihre Mutter führten das verwirrte Mädchen ins Haus. Ihr Vater folgte ihnen.
»Malin?«, sprach mich Bathea vorsichtig an. »Alles gut bei dir?«
Ich sagte nichts. Ich konnte nicht. Die Worte waren mir ausgegangen, in meinem Kopf herrschte nur Leere.
»Das wird schon werden«, meinte Bathea. »Das Mädchen hat weder eine Ausbildung, die ihr verlorengegangen ist, noch steht es ganz allein da. Ihre Familie wird ihr alles erzählen, was sie wissen muss und dann schafft sie sich neue Erinnerungen.«
Ein Jahr … ein langes Jahr und niemand hatte je nach mir gesucht. Wo war meine Familie? Wo waren die Menschen, die mich liebten und vermissten? Völlig allein und verloren, mit Schnittwunden an den Armen, von denen ich nicht wusste, wie ich sie mir zugezogen hatte, war ich damals durch die Straßen von Embird geirrt. Einzig der Achatkrieger konnte wissen, was mit mir geschehen war. Doch dieser Dämon wäre der Letzte, der mir Antworten geben würde.
»Es geht schon«, sagte ich leise und wandte mich der Scheune zu, wo die Angestellten betroffen dastanden und leise miteinander tuschelten. Ihre Blicke zu ertragen, war schwer. Ich hatte mir irgendetwas zuschulden kommen lassen. Vielleicht war es bloß ein Summen gewesen, genau wie bei Alina. Aber sie malten sich anderes aus, glaubten, dass ich eine Diebin oder Kindsmörderin sein könnte – in jedem Fall eine Gefahr, die sie nicht einschätzen konnten. Vielleicht sogar ein Unglücksbringer, der den Achatkrieger direkt zu ihnen gelockt hatte.
Wenigstens das würde Alina erspart bleiben.
»Bist du sicher?«, fragte Bathea, während ich bereits losgelaufen war. Ich schob mich zwischen den Angestellten hindurch und mied dabei ihre Blicke.
»Das arme Mädchen«, sagte einer von ihnen.
Luger seufzte. »Jeder weiß, dass es verboten ist zu singen.«
»Aber sie ist noch ein halbes Kind«, verteidigte sie jemand.
»Wer weiß, ob sie nicht zum Singen verführt wurde«, mutmaßte ein anderer.
Ich schlüpfte durch das Scheunentor und lief zu meiner Schlafstätte. Dort, zwischen den Pferdeboxen, bewahrte ich alles auf, was mir von einem Leben geblieben war, das mir der Achatkrieger genommen hatte. Ich zog ein kleines Bündel unter dem Stroh hervor. Einen Samtbeutel mit goldener Kordel. Edel wirkte er, nicht so verlottert wie die Kleider, die ich am Leib trug.
In meinem Rücken hörte ich, wie jemand durch das Scheunentor trat. »Sie suchen dich bestimmt«, sagte Bathea. »Das ist es doch, was dich beschäftigt, oder? Du denkst, dass dich deine Familie nicht sucht, aber wahrscheinlich wissen sie nur nicht, wo du hingelaufen bist. Du hast doch gesehen, wie verwirrt Alina war. Wahrscheinlich hattest du Angst und bist davongelaufen und jetzt suchen sie dich.«
»Alle hier glauben, dass ich verstoßen wurde«, sagte ich und verbarg den Beutel unter meinem Überwurf. »Sie glauben, dass mein Verbrechen so schlimm war, dass mich meine Familie nicht mehr haben wollte. So ist es doch, oder?«
Bathea wirkte betroffen und sagte nichts dazu. Das brauchte sie auch nicht, ich wusste, dass ich recht hatte.
»Aber wenn es so war, warum erinnere ich mich nicht daran?«, fragte ich. »Warum weiß ich nur noch, wie ich durch die Straßen von Embird geirrt bin?«
»Ich weiß es nicht«, gestand Bathea. »Vielleicht wirkt der Fluch des Achatkriegers noch ein paar Stunden nach. Es kann gut sein, dass sich Alina morgen auch nicht mehr an ihn erinnert.«
Ich wandte mich dem Scheunentor zu. Nach und nach kehrten die Angestellten an die Feuerschale zurück. Ein paar von ihnen warfen mir verstohlene Blicke zu. Außer Bathea wagte es niemand, mich anzusprechen. Nicht einmal Luger.
Es war ihnen unangenehm. Vielleicht dachten auch ein paar von ihnen, dass es allmählich an der Zeit war, mich fortzuschicken. Und vielleicht wäre es auch für mich besser, mir eine Vergangenheit auszudenken und andernorts von vorne zu beginnen. Ohne den Fluch des Achatkriegers, der an mir haftete wie ein übler Geruch. Bloß war es nicht leicht Arbeit zu finden, wenn man keine Ausbildung hatte oder zumindest aus gutem Hause stammte.
»Ich brauche etwas frische Luft«, sagte ich und verließ die Scheune wieder.
Kapitel 2
Langsam durchquerte ich die Stadt. Dabei musste ich mich gegen den Wind lehnen, der den Schnee in Böen durch die Straßen peitschte.
In den ersten Wochen und Monaten, nachdem ich ohne Erinnerung in Embird aufgetaucht war, hatte ich bei jeder sich bietenden Gelegenheit nach meiner Familie gesucht. Ich war fest davon überzeugt gewesen, sie früher oder später zu finden und hatte mir Allmögliches ausgemalt, warum sie nicht nach ihrer verlorenen Tochter fragten. Dass sie mich verstoßen haben könnten, wollte ich einfach nicht wahrhaben. Ich war auf meiner Suche tief in den Wald vorgedrungen, in der Hoffnung, dort ein verstecktes Haus vorzufinden – ein Zuhause, an das ich mich bloß nicht mehr erinnern konnte. Mit einer Familie, die vielleicht nur am falschen Ort gesucht hatte.
Gefunden hatte ich etwas anderes. Kein Zuhause, aber eine Zuflucht, die ich immer dann aufsuchte, wenn alles über mir zusammenzubrechen drohte. Auch an diesem Abend ging ich dorthin. Ich lief tief in den Wald hinein, wo abseits der ausgetrampelten Pfade der Schnee so hoch lag, dass man kaum vorankam.
Die Bäume standen dicht an dicht, der Mondschein drang nur spärlich durch ihr Blätterdach und ich musste mich ganz auf mein Gefühl verlassen, um meinen Weg zu finden.
Als es allmählich wärmer wurde, wusste ich, dass ich den Ort erreicht hatte, an dem der Einfluss der Schneekönigin endete. Dort, zwischen hohen Hecken und mächtigen Lärchen, lag eine Lichtung, auf der es die Vögel wagten zu zwitschern. Die Bäume waren nicht kahl, sondern in ein rotleuchtendes Blätterkleid gehüllt, und der Boden war anstatt mit Eis und Schnee von weichem Moos bedeckt.
Ich hatte das Gefühl, alles hinter mir lassen zu können, wenn ich diese Lichtung betrat. Es gelang mir wieder frei zu atmen. Auch spät in der Nacht, wenn die Tiere des Waldes schliefen und die Stille mich wie eine Decke umhüllte, hatte ich das Gefühl, auf der Lichtung sicher und geborgen zu sein.
Schon oft hatte ich darüber nachgedacht, Bathea oder den Mädchen von diesem Ort zu erzählen. Aber ich hatte Angst. Angst davor, dass sie es nicht für sich behalten konnten. Was, wenn die Schneekönigin erfuhr, dass es einen Flecken in ihrem Reich gab, der nicht unter einer weißen Decke lag? Wenn sie wüsste, dass tief im Wald die Vögel ihre Lieder trällerten? Was würde sie dann tun? Alles abholzen? Ihre Macht ausweiten und die gesamte Umgebung zu Eis erstarren lassen? Die Angst, diesen Zufluchtsort zu verlieren, vielleicht sogar ganz Embird in Gefahr zu bringen, war einfach zu groß. Also behielt ich mein Geheimnis für mich.
Ich lief zu dem Baumstumpf am Rand der Lichtung, auf dem ich schon viele Male gesessen und dem Gesang der Vögel gelauscht hatte. So spät in der Nacht war bloß der Ruf einer Eule zu hören. Hier und dort raschelte es im Gebüsch und im hohen Gras fiepte ein Mäuschen.
Meine Hand glitt über den samtenen Beutel auf meinem Schoß.
Sorgsam knüpfte ich die Kordel auf und zog einen kleinen, hohlen Kasten daraus hervor. Er war aus dunklem Holz gefertigt, glattpoliert, mit Verzierungen an den Rändern. Über ein Loch, genau in der Mitte, bogen sich mehr als ein Dutzend Metallzinken.
Wie man diesen Kasten nannte, wusste ich nicht, und wie man ihn zum Klingen brachte, hatte ich mir selbst beibringen müssen. Ich konnte nur vermuten, dass mir der Achatkrieger meine Erinnerungen wegen eben diesem Instrument genommen hatte. Vielleicht war ich einmal gut darin gewesen, es zu spielen. Vielleicht stammte ich aus einem fernen Land, wo jeder wusste, wie der Name dieses kleinen Kästchens lautete und wo die Menschen sangen und tanzten und glücklich waren.
Ich kannte nur einen Weg, den Antworten auf meine vielen Fragen näherzukommen: Wenn ich das Instrument spielte, war es fast so, als könne ich meine Vergangenheit erahnen. Es gab da ein Lied, tief verschüttet in mir drinnen, und jedes Mal, wenn ich die wenigen Noten anstimmte, die mir davon wieder eingefallen waren, wurden meine verschollenen Erinnerungen beinahe greifbar. Ich war fest davon überzeugt, dass ich sie zurückbringen konnte, wenn es mir nur gelang, dieses Lied zu meistern. Und nur auf der Lichtung, wo die Schneekönigin keinen Einfluss hatte, konnte ich den Versuch wagen, ohne befürchten zu müssen, den Achatkrieger anzulocken.
Vielleicht, wenn es mir eines Tages wirklich gelang, mich zu erinnern, würde ich auch anderen Menschen helfen können. Ich würde sie herführen und ihnen das Lied vorspielen. Angefangen mit Alina.