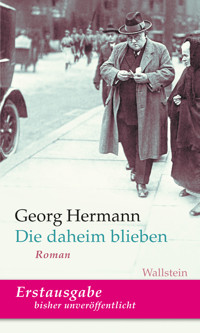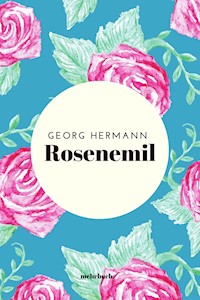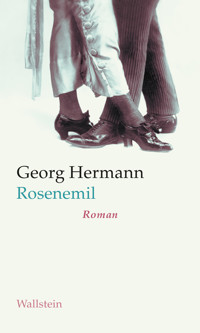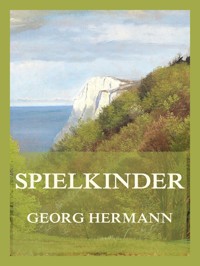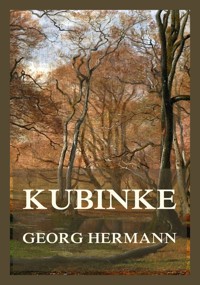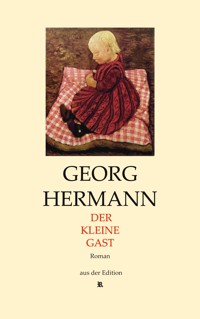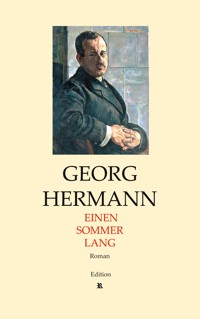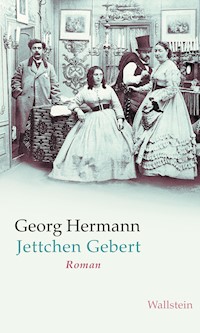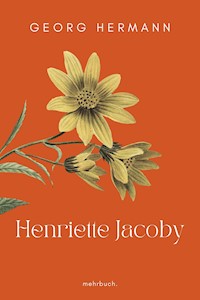Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das neue Berlin um den Kurfürstendamm an einem warmen Sommerabend. Doktor Herzfeld ist Abend für Abend Gast in einem Berliner Café. Die Personen, die sich hier treffen, pflegen das gebildete Gespräch, das sie von den menschlichen und gesellschaftlichen Unzulänglichkeiten und der individuellen Vereinsamung ablenkt. Aber der einsamste und dabei gebildetste unter ihnen ist Doktor Herzfeld. Als er endlich einen Ausbruch wagt, führt dieser ihn durch ein nächtliches Berlin voller Wonnen und Schrecken und in einen gedanklichen Exzess von Mord und Selbstmord. Georg Hermanns Zeitgenosse, der Autor Artur Brausewetter, schrieb über dieses Buch: "Eine Fülle der feinsten und wahrsten Anmerkungen, eine melancholische, bei aller Realistik von duftender Poesie erfüllte Welt- und Lebensanschauung, ein philosophisches über-den-Dingen-stehen und zugleich in ihnen Aufgehen – ein Buch mit einem Worte, das einem viel gibt, das bannt und begleitet, das man nicht los wird, nachdem man längst die letzte Seite gelesen ... Wer etwas lesen will, das tief ist und anregend, das zum Denken über uns selber anregt, indem es uns das Innenleben eines Einzelschicksals vor die Augen führt, das voller Poesie und Natürlichkeit und Wahrheit ist, dem sei dies Buch empfohlen." Mit "Die Nacht des Doktor Herzfeld" hat Georg Hermann ein eigenartiges, tiefes und rücksichtsloses Buch und zugleich ein literarisches Kunstwerk geschrieben, das die moderne Geschichte des jüdischen Bürgertums nachzeichnet und durch das bei alledem auch "der Geist des alten Fontane sehr deutlich spukt".-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Georg Hermann
Die Nacht des Doktor Herzfeld
Saga
Die Nacht des Doktor Herzfeld
© 1912 Georg Hermann
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711517215
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Qui m’ont conduit et t’ont conduite
Mélancoliques pélerins
Jusqu’à cette heure, dont la fuite
Tournoie au son des tambourins.
Paul Verlaine
Eines stand fest: musikalisch war Doktor Alwin Herzfeld nicht. Denn, wenn er gegen Abend oder am späten Nachmittag – eigentlich wohl immer zur gleichen Zeit, aber was im Winter Abend, ja beinah Nacht ist, das ist es ja im Sommer noch keineswegs... wenn Doktor Herzfeld da – er wohnte irgendwo ganz draußen im Westen in einem Gartenhaus – über den Hof ging, dann pfiff er stets: einmal, zweimal, auch dreimal – nie öfter. Und eben dieses Pfeifen verriet ihn. Durchaus nicht nur einen Ton flötete er, sondern eine ganze Tonfolge, immer die gleiche, sieben Töne hintereinander. Den Pfiff kannten alle im Haus, während den Doktor selbst bisher kaum jemand gesehen hatte. Er war wie der Vogel Bülow, dessen Ruf man kennt, den man aber nur selten und schwer zu Gesicht bekommt.
Und Fräulein Viola Maisberg, die da unten ein Institut für orthopädisches Turnen unterhielt und bestrebt war, blasse kleine Mädchen des beginnenden Buckels und der schiefen Hüfte zu entwöhnen, und die ihre Stunden stets bei offenem Fenster gab, – denn ihre Opfer sollten sich ja auch abhärten – sie war der Meinung, daß es ein weniger bekanntes Motiv einer weniger bekannten Oper des dafür desto mehr bekannten Richard Wagner wäre... vielleicht aus dem Parzival oder aus Tristan und Isolde. Die beiden Malfräuleins aber, die eine kunstgewerbliche Lehranstalt und eine Malschule betreuten und ihrer Schülerin alles beibrachten, was sie selbst konnten, und die sich schon unten am Eingang des Hauses durch einen Schaukasten bemerkbar machten, in dem ein Ölbild – ein märkischer See, von Birken umstanden, unter dem glühenden Farbenspiel des Sonnenunterganges am Brahmaputra – zwischen zwei Holztellern hing, die wiederum ihrerseits nicht etwa schlicht waren, sondern in Brandmalerei üppig mit Mohn und Schwertlilien verziert... eben jene beiden ehrlichen Maifräuleins, die zusammen addiert das biblische Alter um ein Bedeutendes überschritten, die stritten sich. Die eine versicherte, es wäre aus ‹Zampa›, – ihre selige Mutter hätte das immer gespielt; und die andere schwor, es wäre aus dem ‹Kalif von Bagdad›. Jedenfalls aus irgend einer alten Spieloper. Edith Mayer aber, das mausgraue Wesen, das im zweiten Stock des Gartenhauses eine Klavierschule leitete, war der Ansicht, daß hier ein Anfänger mit mangelhaftem Können sich an der von ihr so geliebten As–Moll–Tonleiter versündigte. Genug... der im Haus glaubte dies, und jener glaubte das.
In Wirklichkeit aber sollten die sieben merkwürdigen und rätselhaften Töne, die Doktor Herzfeld da jeden Abend ein, zwei oder auch dreimal mit scharfem Flöten ertönen ließ, gar nichts anderes bedeuten, als den Anfang jenes alten Liedes: Ach, du lieber Augustin! und nach einer Weile noch einmal: Ach, du lieber Augustin! und nach einer ganzen Weile zum dritten Mal: Ach, du lieber Augustin! Und wenn sich dann unten zu ebener Erde die Tür noch nicht geöffnet hatte und er, dem dieses Signal galt, – nämlich Hermann Gutzeit – in seinen alten braunen Havelock gewickelt, – er sah wie eine abblätternde Kutscherzigarre darin aus – noch nicht herausgetreten war, dann... ja dann klopfte Doktor Herzfeld ein paar Mal mit seinem Stock auf die Fliesen des Bodens und ging. Und nichts in der Welt hätte ihn bewegt, noch einmal seine Schalmeientöne anzustimmen oder etwa bei dem andern anzuklopfen.
Wenn Doktor Herzfeld jedoch immer wieder Abend für Abend die gleichen Töne flötete, so lag das vor allem daran, daß sonst sein Programm sich sehr schnell erschöpft hätte; und ebenso tat er es vielleicht auch deswegen, weil ihm dieses Lied besonders angenehm war. Denn besagter Augustin war ja, wie männiglich bekannt, in einem, wenn auch bedenklichen, so doch freiwillig herbeigeführten Zustande von der Straße aufgelesen und zu den Choleraleichen auf den Schüdderump geworfen worden, um endlich zu nächtlicher Stunde, – etwas ernüchtert und ziemlich entblößt, – inmitten eines Leichenhaufens, in offener Grube, also dort zu erwachen, wo er keineswegs glaubte, sich zum Schlafen gebettet zu haben. Und für diesen Mann, der gleichsam von den Toten auferstanden war, der sich noch einmal aus der Atemnähe der Verwesung zurückgerettet hatte, und dem nun sicherlich die ganze Welt nur wie ein bunter, unwirklicher Narrenspuk vorkommen mußte, sobald in seinem Schädel sich einmal für Augenblicke die Wolken hoben, – für diesen im Liede unsterblichen Augustin hatte Doktor Herzfeld viel Mitgefühl und ein schier kameradschaftliches Empfinden. Und das hatte er, obgleich ihn dieser Fall keineswegs medizinisch als eines der seltenen Beispiele für die Immunisierung durch Alkohol interessierte, sondern hatte es... trotzdem er nur menschlich mit ihm sympathisierte.
Es lag auch durchaus kein Grund vor, daß Doktor Herzfeld sich mit der wissenschaftlichen Seite dieses Falles besonders beschäftigen sollte, denn er gehörte keineswegs zu der äskulapischen Heerschar; ja, er ging ihr sogar, was seine Person anbetraf, in den letzten Jahren absichtlich aus dem Wege. Denn er war der Meinung, daß, wenn er sich noch weiter mit irgend einem Mitglied dieser Heerschar einließe, jener zwar bald eine Villa in einem westlichen Vorort bekäme, er sich aber mit einem weit kleineren Landsitz in einem östlichen Vorort mit stark proletarischer Bevölkerung begnügen müßte.
Nein, Doktor Herzfeld war vielmehr auf dem andern Flügel der Wissenschaft graduiert worden, dort, wo die Wissenschaft – wie der Rücken an einer bestimmten Stelle – eigentlich schon beinah ihren ehrlichen Namen verliert... nämlich an der äußersten Ecke der schöngeistigen Philosophie, allwo ein bißchen Systematik nach Schwegler und etwas Goethe-Philologie, mit Mittelhochdeutsch und den Madonnen Raffaels zusammenstoßen. Aber von all dem war – als lebenslängliche Siegesbeute – nur noch der Titel übrig geblieben, der bewies, daß man seinen Träger in die Kategorie der Gebildeten und innerhalb dieser wieder in die Unterabteilung der akademisch Gebildeten zu rechnen habe. Genug, – musikalisch war er trotzdem nicht.
Und es war wirklich auch wenig Aussicht vorhanden, daß er in dieser Materie noch Fortschritte in seiner Ausbildung machen würde. Denn wenn einer mit 48 Jahren (in Buchstaben achtundvierzig), das heißt zu einer Zeit, da er schon die bei weitem größere Hälfte der geliehenen Jahre zurückgezahlt hat – wenn einer da nicht mal richtig und allgemein erkenntlich sieben Töne hintereinander pfeifen kann, so ist nicht anzunehmen, daß er noch als Musiker Bedeutendes erreichen wird.
Immerhin muß festgestellt werden, daß Doktor Herzfeld selbst mit diesen sieben Tönen durchaus zufrieden war, und daß sie für seine Absicht, dem andern sich bemerkbar zu machen, auch ausreichten. Rein objektive, ästhetische Nebenzwecke verfolgte Doktor Herzfeld damit nicht.
Nun kann man ja endlich noch der Meinung sein, daß es für Doktor Herzfeld einfacher wäre, im Vorübergehen an die Tür zu klopfen, denn Doktor Herzfeld hat genau die gleiche Wohnung ganz oben, im dritten Stock nach der Rechnung des Hauswirts, das heißt gut und gern im vierten Stock, direkt unterm Dach, so hoch die Treppe führt,... genau die gleiche Wohnung, die Hermann Gutzeit, sein Antipode, ganz und gar zu ebener Erde hat. Aber Doktor Herzfeld gehört nicht zu den Menschen, die so ohne weiteres des Abends bei fremden Leuten an die Tür klopfen. Dazu ist er viel zu sehr Einsiedler. Und die Luft da unten behagt ihm auch nicht. Er würde vielleicht auch hineingerufen werden, müßte warten, Rede und Antwort stehen, mit Menschen sprechen, die ihm nicht genehm sind; – und dafür ist er durchaus nicht zu haben.
Und wenn auch wirklich auf dem Grundriß, auf dem Plan die Wohnung von Doktor Herzfeld da hinten im Gartenhaus die gleiche ist, wie die unten, so sind sie doch dabei so grundverschieden voneinander, wie nur eben zwei menschliche Behausungen sein können. Oben sieht dem Doktor Herzfeld doch die Sonne in die Scheiben hinein, – sofern sie sich überhaupt um den Steinhaufen Berlin zu kümmern beliebt, – mal hier, mal da, von früh bis abends. Da unten aber kommt sie nur ein paar Monate im Jahr, und dann auch nur ein paar Stunden am Tag hin. Und selbst da ist sie nicht einmal neugierig genug, um alles sehen zu wollen, sondern begnügt sich mit zwei Zimmern. Und hier sogar ist sie noch nie weiter als bis zum Eßtisch vorgedrungen, hat sich kurz einmal umgeblickt und ist, als ob es ihr nicht gefiele, ganz leise wieder hinausgeschlichen.
Wirklich, es ist eine dumpfige Wohnung, die von Hermann Gutzeit da unten; eine Wohnung, in der die Leute, die da zusammenhausen, wie von selbst mürrisch, zänkisch und unverträglich werden in dem ewigen Halblicht, in dem sie sich bewegen... ja... eine Wohnung ist es, in der die Männer vor der Zeit grau werden, ohne daß sie recht begreifen, wie es geschieht.
Und während Doktor Herzfeld da oben in seiner Wohnung doch unbeschränkter Herr und König ist und übergenug Raum für sich allein hat, ja zuviel, denn er hat nicht Kind und Kegel, – man weiß nicht recht, ist er Junggeselle, Witwer oder gar geschieden; genug, er lebt ganz allein – während bei ihm oft zehn Stunden des Tages und viele Stunden der Nacht die Einsamkeit zu Gast ist und lautlos und unheimlich vom Bibliothekszimmer ins Schlafzimmer, vom Schlafzimmer ins Eßzimmer, vom Eßzimmer ins Bibliothekszimmer pendelt, – ist Hermann Gutzeit in genau den Räumen nur ein armseliger, umhergestoßener Sklave, der keinen ruhigen Fleck für sich finden kann, ist zusammengepfercht mit lärmenden Dienstboten, schreienden und sich prügelnden Kindern und mit einer großen, weißblonden Frau, die unwirsch und zänkisch in der Wohnung herumhantiert und es seit Jahren verlernt hat, daheim mit ruhiger Stimme zu sprechen. Leute gehen aus und ein, die für Hermann Gutzeit so wenig bedeuten, wie er für sie: Geschwister der Frau, die Mutter der Frau, Jugendfreunde der Frau. – All das hat da eine Stätte, ein Heim, fühlt sich Herr im Hause, sitzt auf den Stühlen, bleibt zu den Mahlzeiten, kennt keine Rücksicht, dankt nicht mit einem Blick, geschweige denn mit einem Wort, hält es für Pflicht – einfach für Pflicht, daß dieser Mann hier für alles sorgt... Woher er es immer wieder nimmt, ist seine Sache. Warum sollte er deswegen Rücksicht verdienen?
Er hat es ja auch längst aufgegeben, Rücksicht zu fordern: die andern sind an Zahl viel mehr als er. Alle seine Leute, seine Hilfskräfte sind schon seit Jahren verdrängt; und jeder Sieg von ihm endete zum Schluß mit einer Niederlage. Er hat nur noch das eine Gefühl, als ob er irgendwie einmal durch einen unglückseligen Fehltritt ausgerutscht und in einen Strudel gefallen wäre, und nun immerfort, jeden Tag von neuem herumgeschleudert würde, – umhergewirbelt würde mitten in diesem Lärm und dem Brausen, ohne je zu sich selbst zu kommen und ohne Hoffnung, sich je wieder aufs feste Land zu retten. Kaum, daß er sich mal auf ein paar Stunden an einen herüberhängenden Ast klammern kann – auf ein paar Stunden des Abends aufatmen kann, wenn er sich zu den andern gesellt, zu den alternden, mürrischen und bedächtigen Menschenvögeln, die sich da immer im Café zusammenfinden. Aber er mag noch so lange die Rückkehr hinausschieben... sowie er wieder die Klinke in die Hand nimmt, sowie er wieder den Fuß in seine Wohnung setzt, beginnt ihn der Strudel von neuem umherzupeitschen.
Und da es nun der Zufall wollte, daß Doktor Alwin Herzfeld und Hermann Gutzeit im gleichen Hause wohnten, und da sie eigentlich beide vom gleichen Metier waren, md da sie sich ja vordem schon von ihren Abenden her kannten, so hatten sie sich mit der Zeit aneinander angeschlossen, ohne daß doch einer am täglichen Leben des andern teilnahm, ohne daß sie voneinander eigentlich etwas wußten oder in Erfahrung bringen wollten. Nein, sie hatten sich nur in dem Gespräch über dritte Dinge getroffen, indem sie darüber einer Meinung waren oder, was sie noch enger verband, indem sie entgegengesetzter Meinung waren. Sie hatten nie über diesem Zusammenstimmen die Formen der geselligen Rücksicht vergessen, die bei der Freundschaft meist als erstes hintangesetzt werden. Und gerade weil sich keiner in das Vertrauen des andern drängte, weil jeder sich hütete, an die wunden Stellen des andern zu rühren, hielten sie gut zusammen.
Ihr Leben außerhalb der Stunden, da sie sich sahen, war unantastbar. Kaum daß einmal Hermann Gutzeit den Weg die Treppe hinauffand, um sich ein Buch zu leihen, das er für irgend einen Artikel brauchte. Aber sowie Doktor Herzfeld des Abends über den Hof ging und ‹ihr› Signal pfiff, dann legte Hermann Gutzeit – und wenn es mitten im Satz war – die Feder nieder; stand selbst mit dem Bissen im Mund – vom Abendbrottisch auf; zog seinen Havelock über, das altersgraue, flatternde Möbel, das er in guten Tagen nicht abgelegt hatte, damit er immer seiner schlechten Tage eingedenk bleibe, und das abzulegen er jetzt schon gar keinen Grund mehr sah, und trat auf den Hof. Und er wußte auch ganz genau, nichts hätte Doktor Alwin Herzfeld bewegt, an die Tür zu pochen und nach dem andern zu fragen... Nach dem dritten Pfiff marschierte er eben allein ab.
Denn er fand schon immer Gesellschaft, der Doktor Herzfeld. Sie waren ja so ein richtiger Schwarm ähnlicher Vögel, die sich Abend für Abend da im Café trafen, die von allen Seiten her zusammengeschwirrt kamen, und die einander so nah und so fern standen, wie sich Menschen gemeiniglich zu stehen pflegen. Ein ganzer Kreis war es, ein ganzer Schwarm war es, alle so im gleichen Alter, alle fast von gleicher Bildung, alle wie Doktor Herzfeld selbst, vom Leben etwas ramponiert und mitgenommen. Und, daß sie sich zusammengefunden hatten, ist wahrlich kein Wunder. Denn die gleichen Menschenvögel sammeln sich immer zu Schwärmen, genau so wie die Krähen, die Spatzen, die Meisen. Es mag unter den Nebelkrähen ja mal eine Saatkrähe sein, oder ein paar Dohlen mögen mit ihnen den gleichen Acker umschreien; oder unter den Blaumeisen, die durch das Gehölz vagabundieren, mag wohl in seltenen Fällen eine Kohlmeise oder eine Haubenmeise sich befinden, mit den Spatzen mag mal für kurze Zeit ein Fink oder eine Goldammer mitziehen – aber nie, nie wird unter den Meisen ein Fink, und unter den Krähen ein Zeisig sein!... Nein, die gleichen Brüder halten zusammen, finden sich ganz von allein. Und genau so ist es unter den Menschenvögeln: die lustigen jungen Meisen finden sich zusammen, die schmucken Finken, die futterneidischen Spatzen, – und auch die alten, grauen, schweren, mürrischen Krähen. Sie alle dulden auf die Dauer keinen in ihren Reihen, der etwa zu den andern gehörte.
Und Doktor Herzfeld flog eben mit einem solchen Schwarm grauer, alternder, mürrischer Vögel schon eine geraume Zeit. Ja, er war sogar, ohne daß er sich dessen voll bewußt war, unter den Führern. Und, wenn er nach links flog, so breiteten die andern in der gleichen Richtung ihre Schwingen. Und flog er nach rechts, so änderten sie, ohne daß sie es merkten, den Kurs.
Vielleicht lag das daran, daß Doktor Herzfeld, wie alle Leute, die ihr Leben in keiner Weise in Taten umsetzten, mehr für den Alltag übrig behielt als jene um ihn, die schon vorher im immer sich erneuernden Kampf um die gemeine Notdurft der Existenz zermürbt wurden. Und die blickten deshalb auf ihn, wie auf jemand, der es doch besser hatte als sie, wie auf jemand, der schon glücklich – wenn auch ein wenig invalide – aus dem Feldzug heimgekehrt war; während sie noch in dem dreißigjährigen Krieg des Lebens täglich von neuem die Flinte in die immer lahmere Hand nehmen mußten. Ja, die meisten von ihnen durften die Flinte nicht einmal von sich werfen, wollten sie nicht dem Kriegsgericht des Hungers und Verkommens anheim fallen. Und all die Möglichkeiten, die sie umdrohten: von Kavallerieattacken niedergemäht, von Rosseshufen zerstampft, von Sprenggeschossen zerrissen zu werden, all die Möglichkeiten hatten nach ihrer Meinung für jenen, für Doktor Herzfeld, die Kraft der Drohung, die Wahrscheinlichkeit eingebüßt. Das gab Doktor Herzfeld, ohne daß er sich dessen klar war, ein gewisses Übergewicht in diesem langsam ziehenden Schwarm grauer, mürrischer, alternder Menschenvögel, die da Abend für Abend zusammengeschwirrt kamen.
Mal waren es mehr, mal weniger. Mal schieden welche aus – durch Tod, durch Krankheit, durch Fortzug, durch neue oder späte Ehen, – ohne daß man ihnen gerade nachweinte. Im Winter waren es viel, im Sommer wenig. Aber ein paar Unentwegte trafen sich doch stets in dem Café zusammen. Hier Freunde, kannten sie sich kaum auf der Straße. Der eine ging links, der andere rechts, sowie sie aus der Tür traten.
**
Und so wäre auch heute abend Doktor Herzfeld, nachdem er zum dritten Mal sein ti–ta ta ta-tum ta ti geflötet hatte, ohne weiteres allein losgezogen, – denn trotzdem es Sommer war, hätte er doch ein paar von dem Schwarm angetroffen, – aber gerade als er zum dritten Mal mit dem Stock auf das Pflaster stieß und dabei prüfend an den hellen Wänden, an den Fenstern hoch zum Himmel sah, der schon ganz weiß, und vom letzten Licht durchflutet, wie ein blanker Blechdeckel da oben zwischen den Dächern saß, und gerade als er sich schon umwenden wollte, da hörte er hinten im Haus eine Tür klappen, und dann trat Hermann Gutzeit heraus, groß, massig und schwer in seinem dunklen Havelock, und zupfte sich im Gehen noch die Krawatte zurecht.
Nebenbei war Hermann Gutzeit nur ganz wenig jünger als Doktor Herzfeld. Also guter Vierziger. Groß war er im Gegensatz zu Doktor Herzfeld, ein wenig aufgeschwemmt, schwer und graublond. Das Haar stand ihm nicht wie eine Gloriole um den Kopf, sondern schon mehr wie auf frühen Bildern jene Art von Heiligenschein, die in drei Strahlen vom Haupt der Märtyrer ausgeht: rechts und links von den Schläfen steht je ein Strahlenbüschel, und schnurgerade über dem Scheitel steigt ein drittes empor; dazwischen aber glänzt der kahle Schädel. So stand Hermann Gutzeit das Haar um den großen Kopf mit der übermäßig hohen Stirn. Ach, alles an diesem Kopf war zerarbeitet, verbraucht, gefaltet, übermodelliert. Jeder Teil des Gesichts hatte sich mit den Jahren durch tiefe Furchen vom andern getrennt: Augen von Wangen, Wangen von Mund, Mund von Kinn. Und doch herrschten in diesem Gesicht die Augen: ein paar graublaue, kurzsichtige, gewölbte Augen hinter scharfen Kneifergläsern; Augen, die immer gleich ernst und grübelnd, gleichsam erstaunt blieben darüber, daß alles so gekommen, das heißt ganz anders als Hermann Gutzeit und die Welt es vermutet hatten. Denn Hermann Gutzeit hatte einmal Erfolge gehabt; nette, verdiente Erfolge, in Büchern und auf dem Theater. Man war auf ihn aufmerksam geworden, und man hatte auf ihn gesetzt wie auf ein Rennpferd, das nächstens bei einem Hauptrennen einmal als Erster, als Allererster durchs Ziel gehen würde, um dann für lange Zeit Favorit zu bleiben. Aber das lag nun schon über fünfzehn Jahre zurück. Plötzlich jedoch, ohne daß ein Mensch sagen konnte, wie es geschah, war Hermann Gutzeit ins Hintertreffen geraten. Andere waren schnell in die Lücke eingesprungen, hatten sich mit breiten Schultern und festen Ellbogen vor ihn geschoben, er hatte kein Glück mehr gehabt, war dann unsicher geworden; die äußeren Umstände, die Verhältnisse waren stärker gewesen als er. – Hatte ihn all das erdrückt, weil er schwach war, oder war er schwach geworden, weil ihn das andere gerade niederzwang, als er schon glaubte, gesiegt zu haben? – Genug, er war, ehe er es dachte, ganz und gar aus dem Spiel geraten, das ohne ihn genau so gut und genau so sinnlos weiterging wie mit ihm. Ein geschlagener, ausgemerzter Schachstein war er geworden, der neben dem Brett auf dem Tisch steht und nur noch neidisch und kritisch zusehen darf, wie die anderen da auf den weißen und schwarzen Feldern hin- und herspringen und einander Schach! zurufen.
Eine Weile hatte es Hermann Gutzeit dann noch gemacht, wie es die Frauen machen, die einmal schön waren: wenn keiner mehr davon spricht, daß sie einmal schön waren, dann reden sie eben selbst davon. Aber langsam hatte er auch damit aufgehört. Er war mürrisch zurückgekrochen zu seiner alten Arbeit, irgendwo ein paar Vormittagsstunden etwas sehr Gleichgültiges zu redigieren und nebenher für zehn, zwanzig Stellen Artikel zu schreiben, die einzig dazu da waren, damit die Leute etwas zu lesen hatten. Und da er nicht geschickt war, auch kein guter Kaufmann, so quälte er sich sehr. Denn wie alle Schriftsteller, die bei voller Freiheit vielleicht etwas über das Mittelmaß leisten würden, fiel es ihm nicht leicht, jene farblose Dutzendware zu verfertigen, die für den Tagesbedarf gefordert wird. Und dazu kam noch das Eine, daß er im Gegensatz zu jenen anderen diese seine Arbeit unsagbar verachtete, – ohne sich auch nur einen Tag von ihr losreißen zu dürfen. Doktor Herzfeld aber war nicht mehr darauf angewiesen, zu verdienen.
«Na», rief Doktor Herzfeld und eilte ein paar Schritt dem andern entgegen und zeigte auf das lange Briefkuvert. «Na?! Die Sonntagsplauderei für das Malchiner Tageblatt mußte wohl erst fertig werden?»
«Falsch geraten», sagte Hermann Gutzeit und lachte schwerfällig. «Dieses Mal ist es für den Generalanzeiger von Weinbroda. Aber kommen Sie, Doktor, ich muß Luft haben, ich ersticke sonst. Finden Sie nicht auch, daß man hier überhaupt nicht atmen kann? – Luft, Clavigo!»
«Sie scheinen gut gelaunt zu sein, lieber Freund», meinte Doktor Herzfeld sehr ruhig.
«Nicht schlechter als sonst», sagte Hermann Gutzeit unwirsch. «Das heißt ungefähr so, wie eine Granate vor dem Krepieren. Den ganzen Tag sitzt man nun in der Bude und verlechzt nach einem bißchen Ruhe; und den ganzen Tag von Morgen bis Abend war heute für Hunderttausende Sonne – und nicht einen Strahl hat man davon abbekommen.»
«Und meinen Sie», sagte Doktor Herzfeld, «Sie wären glücklicher gewesen, wenn Sie heute statt am Schreibtisch am Feldrand unter den Weidenbäumen gesessen hätten, und statt über weißes Papier und über den grauen Hof über die schwankenden Roggenfelder weggesehen hätten? Oder wenn Sie im Tiergarten auf einer Bank eingekeilt zwischen zwei Kindermädchen in die Bäume geguckt und dabei den Finken bewundert hätten, der da nach grünen Raupen pickt? Oder wenn Sie sich am Strand die warme Sonne hätten auf den alten Leib scheinen lassen und zugehört hätten, wie die Wellen so gluck gluck auf den Steinen sich zerrieben? Wissen Sie, was Sie dann getan hätten? Sie wären nach einer halben Stunde aufgestanden, um zu sehen, ob die Zeitungen nicht endlich da wären, Sie wären dem Postboten entgegengelaufen, und Sie hätten jede Drucksache, in der Ihnen jemand Flaschenbier oder Gesundheitssocken empfiehlt, jeden Wisch, den Sie sonst sofort in den Papierkorb werfen, zärtlich ans Herz gedrückt. Und schon am Nachmittag in einem unbewachten Augenblick würden Sie sich fragen, was soll ich denn eigentlich hier? Was will ich denn eigentlich hier? Was geht mich das Meer an? Und die Roggenfelder und die Dienstmädchen und der Fink am Boden, der die grünen Raupen pickt? Was habe ich denn hier verloren? Sie würden es am ersten Tag wundervoll finden, daß der Tag dort achtundvierzig Stunden hat, statt kaum acht wie bei uns, daß dort kein Telephon nach Ihnen klingelt. Und am zweiten Tag würden Sie es nicht begreifen, was dem Tag nur einfiele, so rücksichtslos und deprimierend lang zu sein. Sie würden es nicht verstehen, warum durchaus kein Telephon nach Ihnen klingelt, und Sie würden es vermissen, wenn Ihre Kinder sich nicht prügelten in dem Augenblick, da Sie sich nach dem Essen aufs Sofa legen wollen. Am dritten Tag aber wären Sie sogar schon soweit heruntergekommen, daß Sie selbst nach Ihrer Frau Sehnsucht empfänden.»
«Lieber Freund», sagte Hermann Gutzeit halb bitter, halb mitleidig, «man merkt, Sie sind unverheiratet und reden nun daher wie der Blinde von der Farbe. Aber kommen Sie, was stehen wir hier.»
Doktor Herzfeld wandte sich um und schritt neben dem andern durch den Torgang auf die Straße hinaus.
«Mag sein», sagte er und blickte sehr nachdenklich die lange, noch eben helle Straße hinunter, über deren Ende sich wie ein rotes Tuch mit vielen flatternden malvenfarbigen Fransen der Abendhimmel spannte, und in der doch schon – ohne Licht zu verbreiten, – die ersten grünen Leuchtkäfer der Straßenlaternen phosphorn und schrill aufsprangen. «Mag sein, alter Freund, immerhin, Sie fühlen sich hier sicher noch am wohlsten. Wir sind nun einmal Städter – und das Land lehrt uns nichts mehr. Gewiß, man lebt in tausend Kümmerlichkeiten, aber man braucht sie. Es ist mit ihnen besser als ohne sie. Es geht uns eben wie dem Müller, der wacht erschrocken auf, wenn die Mühle nicht klappert, aber so lange sie klappert, hört er es nicht. Wir – ich und Sie – sind eben hier alle mit der Zeit solche Müller geworden. Und das beste ist, die Mühle klappert so ruhig weiter. Das beste ist, wir leben ruhig so weiter ohne Punkt und Komma, denn wer weiß, ob wir die olle Mühle wieder gut in Gang kriegen, wenn sie erst mal still steht.»
«Sie haben gut reden! Sie können, wenn Ihnen hier der Krempel nicht mehr gefällt, morgen Ihre Sachen packen. Sie haben ja nach keinem Menschen zu fragen», unterbrach Hermann Gutzeit – und seufzte tief auf.
«Was soll ich wo anders? Wo einem jede Minute zum Bewußtsein kommt, daß einem von der ganzen Gotteswelt auch nicht ein Fußbreit gehört. Hier sind wenigstens meine Menschen, meine Straßen, meine Wege, meine Automobile! Ich bin mit jedem Bäumchen in seinem Gitter, jeder weißen Bank auf dem Platz da drüben, jedem Rosenbusch da unten im Blumenparterre befreundet. Selbst mit den Laternen und den Vorgärten bin ich auf du und du. Ich kenne jedes Haus und jeden Laden, jeden rotnasigen Zeitungsverkäufer und jeden befrackten Kellner, jedes Dienstmädchen und jeden Schutzmann. Und wenn ich ihn nicht kenne, so könnte ich ihn doch kennen. Nichts an seiner Erscheinung ist mir fremd. Alles ist mir hier gleichgültig und vertraut in eins. Aber gehen Sie mal durch einen Wald, der kümmert sich überhaupt nicht um Sie, und all das, was Sie angeht, dafür hat er nur die weitgehendste Interesselosigkeit. Meinen Sie, die Sezession imponiert ihm? Er hat nie etwas davon gehört! Er ist in all diesen Sachen völlig renonce. Und das Niederträchtigste: er fühlt sich beleidigend wohl – geradezu sauwohl dabei.»
«Nein», rief Hermann Gutzeit und warf mit großer Bewegung seinen alten, altersgrauen Lodenmantel auf, «aber ich glaube, daß es im Wald jetzt besser riecht als hier, wo es aus jedem Keller anders stinkt, daß da jetzt kein Staub ist und kein Lärm, daß man nicht an jeder Ecke springen muß, um nur nicht unter die Räder zu kommen. Ich glaube, es muß dort jetzt nach Harz und nach Laub, und nach Gras und nach Boden duften. Der rote Himmel da, – eben der gleiche, der hier brandig und stumpf vor Dunst ist, – der müßte dort jetzt wie die Glut alter Kirchenfenster durch die Kronen der Bäume leuchten, während man nachdenklich am Waldrand liegt und zusieht, wie die ersten Rehe, scheu wie Schatten, sich ins Korn hinausschleichen.»
«Gewiß», unterbrach Doktor Herzfeld, «und Ihre alten Knochen würden von dem Waldhoden noch rheumatischer werden und Ihr Herz würde traurig, unerklärlich traurig werden mit der Dämmerung, die ihren Gürtel näher und immer näher heranschiebt. Sie würden plötzlich die ganze lächerliche Nutzlosigkeit, den verlogenen Stumpfsinn dieses Lebens erkennen. Sie würden sich Vorwürfe machen über tausend Sachen, die anders hätten kommen können. Und all die scheinbare Ruhe um Sie, – denn sie ist ja nur ein tausendfacher stummer Kampf um jeden Fußbreit Boden, um jedes Spürchen Leben, – gerade sie würde einen grellen Mißklang in Ihre Seele bringen. Sie würden plötzlich Sehnsucht bekommen nach einer Frau, die Sie gekannt und doch nicht gekannt haben, oder etwa danach, zu schlafen, sich hinzugeben, kurz, Sie würden Sehnsucht bekommen, so oder so Ihr Leben von sich zu werfen, es zu verträumen, seiner nicht bewußt zu werden. Nein, hören Sie auf einen alten Praktiker: nirgends in der Welt ist ein Sommerabend so schön, so lässig, so erfrischend, so geschmackvoll, so abenteuerlich, so phantastisch und sammetweich wie in der Großstadt. Vielleicht möchte ich jetzt statt in Berlin in Paris sein, oder in London... doch nirgends sonst.
Aber in Paris würde ich eben nur ein Fremder, ein halb betrogener Kostgänger sein, ohne Zusammenhang mit allem. Ich würde die wundervolle, streichelnde Weichheit des Abends mit den Menschen in den Reihen der Cafés, mit den blitzenden Lichtreklamen, die vorüber huschen und wechseln, bunt und aufgeschminkt wie die kleinen zärtlichen Dämchen, die einen anlächeln und doch nicht verweilen... gewiß, die würde ich empfinden! Aber ich würde endlich doch fühlen, daß ich in das Bild nicht hineinpasse... mit meinem armseligen Täßchen vor mir am Straßenrand, – selbst für die zwinkernden Verkäufer von Cochonnerien eine Belustigung. Und gar in London, auf den Anlagen des Embanquement in der ganz unerhört und unwirklich mattblauen Dämmerung dieser Abende dort... selbst da würden mich jetzt die schleierzarten, perlmuttrigen Nebelfarben über der Themse, durch die die Brücken – oh, diese Brücken! – wie ins Jenseits führen, nicht die drohende Armut ringsum vergessen machen, deren Anblick mich quält... jene tausendfache Armut, die in der Riesenstadt auf Bänken und Plätzen vegetiert, die zu dieser Abendzeit in Kolonnen, einer hinter dem andern, wie gepeitscht, mit Wahnsinnsworten, murmelnd und fluchend, durch die sinkende Nacht trottet. Und der bunte Menschenstrom, der am Hyde Park entlang gleitet, der sich unter den breiten Kronen der alten Bäume, die ganz von feuchter Dämmerung umsponnen sind, dahin schiebt, der in Hunderten von Karossen und breiten Autos weiter flutet, – diese ganze schöne Gedankenlosigkeit des Reichtums, an der wiederum Anteil zu haben mir verwehrt ist, – sie würde mich doch nur nachdenklich stimmen. Verstehen Sie: überall anders wäre ich – beglückt oder erschreckt, – eben nur ein Zuschauer, ein Zaungast, hier aber in Berlin spiele ich selber mit, spiele mit, solange ich denken kann, erst drinnen in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin und wo jetzt nur noch Kinderkleidchen in langen Reihen an der Stange hängen, statt daß noch Kinder in die Welt gesetzt werden, – und jetzt eben schon seit bald zwanzig Jahren hier draußen. Früher spielte ich mit als erster Liebhaber, wohl auch als jugendlicher Held, dann als Bonvivant und jetzt oftmals beinahe schon als komischer Alter. Mal war ich als Statist dabei, mal als Souffleur, mal als Inspizient, mal als Regisseur; – aber Teufel auch, ich spiel doch mit, und ich kann mich erinnern, mitgespielt zu haben, und ich seh nicht bloß aus dem Stehparterre für fünf Groschen zu, wie ich das jetzt in Paris oder London täte.
Gewiß, alter Freund, die Welt ist weit und reich, und ich habe oft noch Sehnsucht, zu reisen. Nachts vor allem, wenn plötzlich von weit drüben her so ein Eisenbahnpfiff kommt und zitternd und gell und langgezogen und unheimlich über die Dächer dahinstreift, gleichsam eine Weile in der Luft feststeht und nicht vergehen will, wie ein Lockruf von den weiten Fernen ringsum – o ja, dann packt’s mich schon! Und es gibt ein paar Dinge auf der Erde, wenn ich an die denke, wenn ich nur von ihnen geträumt habe, dann möchte ich des Morgens aus dem Bett springen und zu ihnen eilen. Aber es ist nie eine Stadt, nie ein Ort, nie ein Land, wohin es mich zieht. Kennen Sie den einen Paris Bordone in der Brera, das Sorghetto allegorico? Oder jenen Flußgott der Elgin Marbles? Erinnern Sie sich an das Familienbild in Braunschweig? – Aber nein, Sie sind ja ein Gedankenmensch. Sie lieben Bücher und Theater und solch einen Kram... Ja, das sind zum Beispiel so ein paar Dinge, zu denen es mich oft wieder zieht! – Aber vielleicht wissen Sie, alter Freund, ist es doch schöner, sich nach ihnen zu sehnen, als bei ihnen zu sein. Denn solange wir uns nach ihnen sehnen, vergessen wir unser Ich. Wo aber kann ich hinfliehen, ohne mich selbst zu treffen? Vor dem göttlichsten Rembrandt und den hingegossenen freien Gliedern des alten, halb zerschlagenen Flußgottes – seine volle, unberührte Schönheit könnten vielleicht unsere heutigen Augen nicht mehr erfassen – stände eben zum Schluß nur ein armseliges, ramponiertes, mürrisches Luderchen mit Magenschmerzen, weil es zum ersten Frühstück gebratenen Speck mit Eiern durchaus nicht mehr vertragen kann. Nein, es ist schon besser so. –Aber kommen Sie, gehen wir noch ein wenig, schlendern wir noch ein bißchen durch den Abend, lassen wir die Ditopassabeln heute ruhig einmal etwas warten.»
«Mir ist es recht», sagte Hermann Gutzeit, in einem Ton, dem man anhörte, daß es augenblicklich nichts in der Welt gab, was ihm recht war. «Ich wäre sowieso gern zum Bahnhof Zoo gegangen, damit der eine Brief noch mit dem Abendzug mitgeht. – Aber sagen Sie, Doktor, wie kommen Sie eigentlich auf ‹Ditopassabel›?»
«Man merkt», sagte Doktor Herzfeld, «Sie haben nie Schmetterlinge gesammelt.»
«Nein», meinte Hermann Gutzeit, «das ist wohl das einzige, was ich nicht getan habe.»
«Oh!» rief Doktor Herzfeld, «Sie haben viele Dinge nicht getan! Das ist eben Ihr Fehler, alter junge. Sie haben immer alles zu ernst und zu wichtig genommen und haben nie den Reiz solcher Dinge kennen gelernt, die entzückend sind und dabei gar keinen Sinn und gar keinen Endzweck haben – wie Schachspielen oder Schmetterlinge sammeln. Ja, wenn Sie je Schmetterlinge gesammelt hätten, so würden Sie eben wissen, daß Sie zum Beispiel nach dem Staudinger–Katalog in reinen Exemplaren Erebia ligea variante Philomela Lappland vielleicht für fünfzehn Groschen kaufen können; dito passabel jedoch, das heißt unscheinbar, abgeflogen, leicht lädiert, gerade noch gut genug, um die Merkmale kenntlich zu machen, – aber für die Sammlung keine Zierde – dito passabel kostet sie hingegen laut Katalog nur sechs Groschen. Und wenn man einen Menschenkatalog aufstellte, so müßte man eben – sofern man ehrlich ist – all unsere Freunde als dito passabel buchen. Denken Sie an Lang, an Goldschmidt, an Grübenau, an Kleemann, denken Sie einmal einen Augenblick an Hermann Gutzeit selbst, Verehrtester, oder bemühen Sie sich, sich den Sprecher zu vergegenwärtigen – alles ‹dito passabel›, das heißt: unscheinbar, abgeflogen, ziemlich ramponiert und des Schmelzes entkleiden – ich wenigstens würde für keinen mehr sechs Silbergroschen geben. Wie sagt doch Peter Altenberg? – Ich weiß, Sie lieben ihn nicht, er kann’s verwinden – er ist einer von den Wenigen, die sich heute nicht zu beeilen brauchen, um zu der Handvoll parnassischen Grünfutters zu kommen, er hat Zeit... ja, wie sagt er doch einmal? Richtig: ‹Ich bin fünfzig Jahr, glatzköpfig und ziemlich verkommen und habe es zu nichts gebracht trotz herrlicher Anlagen.› Ich kenne kaum ein Wort, das mich mehr ergriffen hat. Wissen Sie, das sollte bei uns allen in Riesenbuchstaben über der Tür stehen.»
«Bei Ihnen doch nicht», meinte Hermann Gutzeit, in jenem Ton, mit dem ein alter sturmerprobter Kapitän zu irgend einer harmlosen und armseligen Landratte spricht. «Sie können sich doch – weiß Gott – nicht beklagen!»
«Meinen Sie, weil ich meine Miete zahlen kann und mein Glas Tee des Abends; – meinen Sie, weil ich nicht mehr wie früher jedem Pfennig nachlaufen muß, weil ich mir nicht meine paar Zeitschriften im Café zu stehlen brauche und weil ich ein Butterbrot mehr essen kann, wenn ich Lust dazu hätte? – Lieber Freund: minima non curat praetor – bestechen lasse ich mich nicht. Ich verkaufe mich nicht um ein schmackhafteres Linsengericht!»
Sie standen an der Ecke des Kurfürstendamms und sahen an den langen Baumzügen hinab, die voll und ausladend in dieser breiten Häuserschlucht dahinfluteten, durchfressen vom grünlichen Licht der Laternen und überwölbt von einem sich langsam verdunkelnden Himmel, der schon seine Tageshöhe verloren hatte und sich tiefer und tiefer auf die Dächer herabzusenken begann.
Hermann Gutzeit legte die Stirn in Falten und schwenkte sein langes Briefkuvert hin und her. «Müssen wir hier entlang gehen?» sagte er und blickte den andern, wie es seine Art war, mit geneigtem Kopf über die Kneifergläser an. «Ich liebe diese Protzenburgen nicht besonders und noch weniger ihre Vasallen.»
«Ich gewiß auch nicht», sagte Doktor Herzfeld. «Wenigstens nicht am Tage. Aber gegen Abend kann ich mir kaum etwas Köstlicheres denken als hier entlang zu gehen. All der blöde Stuck, all die wilden Erker und Giebel, mit Goldstreifen überzogen, verschwinden dann, und es bleiben hohe, dunkle und tieffarbige Häuserketten, die mit ihren vielen Zacken und Klippen phantastisch von wechselnden Lichtern überflackert und überspielt sind. jede Einzelheit verschwindet; es bleiben nur Ketten breiter Spiegelfenster, in denen so lustig die erleuchteten mit den dunklen wechseln, als hätte es ein Juwelier mit blitzenden farbigen und tiefen blinden Halbedelsteinen ersonnen. Nur Ketten grüner Vorgarten bleiben, mit Büschen und Rotdornbäumchen, zwischen denen wilder Wein pendelt; mit Rosen, die einen Augenblick aufleuchten; mit dem glühenden Rot der Geranien in einem Beet, die plötzlich entflammen, weil sie ein Lichtschimmer trifft, und die ebenso schnell wieder ins Dunkel tauchen. Und diese Bäume hier: tags armselig, sonnendurchglüht und verstaubt, sind jetzt dicht und grün und voll von tiefen Schatten. Und ihre bunten Muster spielen über den Asphalt dahin, der von den Autospuren ganz spiegelblank geworden ist, so blank wie ein Fluß. – Am liebsten aber, alter Freund, gehe ich diese Straße deshalb entlang, weil ich die Bäume hier noch kannte, als sie nicht stärker als mein Arm waren, und weil hier, wo drüben jetzt die gelben Riesenkästen stehen, große Flecken von Heidekraut waren, zwischen denen kleine knorrige Kiefernbüsche standen, einzeln und verstreut, klein, ruppig und doch vielleicht schon uralt. Da auf der Seite habe ich mein erstes Lerchennest gefunden und da drüben bei dem Baum meinen ersten Ligusterschwärmer gefangen. Ein Haus stand nur auf dem ganzen Weg. Er war so sonnig, daß einem die Zunge zum Halse heraushing. – Und jetzt, wenn ich hier entlang gehe, dann habe ich das Gefühl, als hätte ich das alles mitgeschaffen. Und ob schön oder unschön – es ist etwas; ich freue mich damit. Vor allem jetzt, so um diese Dämmerzeit, in der man, wie es in der Bibel heißt, auf hundert Schritt keinen Hund mehr von einem Wolf unterscheiden kann.»
«Und das ist auch gut», sagte Hermann Gutzeit mit jenem leisen Einschlag von Futterneid, dem sich nun einmal selbst ein Mensch von Urteilsvermögen, sofern er nicht mit oben an der Lebenstafel sitzt, nur unschwer entziehen kann. «Das ist wirklich gut!»
«Gewiß, da mögen Sie recht haben!» rief Doktor Herzfeld. «Mir steigt auch oft die Galle auf, wenn ich hier am Tag entlang gehe. Aber es geht den Menschen hier genau wie den Häusern. Sehen Sie nur jetzt dort diesen wundervollen fließenden, rauschenden Seidenmantel und die große nickende rosa Feder auf dem Hut! Jetzt eben – um diese Stunde – ist es nicht mehr Frau Baumeister Meyer von zweihundertzehn, es ist nur Weib, nur Eleganz, nur Schönheit jetzt; es schwebt vorüber wie eine Wolke am Abendhimmel. Sie sehen, Sie empfinden nur noch, daß diese Frau hübsch und angenehm ist und gut erzogen, vom breiten amerikanischen Schuh bis zur Agraffe am Turban. Das streichelt uns angenehm, ach so wundervoll angenehm! Am Tag aber würden wir, alter Freund, nur zu gut erkennen, daß in diesem lieblichen Etui ein ganz gewöhnliches, beschränktes Wesen steckt, – kleinlich, oberflächlich, enghirnig, aufgeschminkt nur eingestellt auf Putz, Klatsch, Betrug – Betrug in jeder Form! Eben die Frau eines siebenfach gehängten Bauschiebers namens Meyer, gerade jenes Gentleman, der da mit dem Zylinder neben ihr geht. Und wenn auch sein Vater noch ganz hinten in Posen Geld an Gutsbesitzer geliehen hat zu einem Zinssatz, dem der Strafrichter ein keineswegs ungerechtfertigtes Interesse entgegengebracht hat – und wenn er selbst auch jeden Nachmittag, sobald er aus seinem Bureau kommt, seinen Rockärmel sehr lange und scharf abbürsten muß, – denn Zuchthauswände pflegen gewöhnlich nur geweißt zu sein, – was macht’s, lieber Freund? Er zieht des Abends ja seinen guten Londoner Gehrock an und stülpt seinen schönen Zylinder von Delion auf und ist ein Gentleman, – einzig und allein Gentleman –. Ich verstehe Ihr Kopfschütteln: Sie sähen diesen Zylinder gern auf einem andern Haupt? – aber das würde unserer geheiligten Gesellschaftsordnung widersprechen. – Und so etwas auch nur zu denken, sei fern von mir. Ja, und eben dieser Bauschieber Egon Meyer – der Vorname war einstmals ein wenig anders; ich gehe das zu – ja, der Herr Egon Meyer nebst Gattin präsentiert sich hier im versöhnenden Halblicht weit angenehmer als das große, struppige Musenkind Hermann Gutzeit in seiner Talentwindel und besagter Doktor Herzfeld in seinem vorjährigen verbügelten Sommeranzug nnd seiner vergilbten Kreissäge.»
Eine Weile gingen die beiden still nebeneinander her, unter dem Schatten der Bäume, der dunstigen Nacht entgegen, die da vorn sich herabsenkte, schritten gemächlich hinter dem breiten Seidenmantel her, der da vor ihnen im Wechseln des Lichts flatterte und schwebte, gleichsam wesenlos und losgelöst von seiner Trägerin. Und aus den sich immer mehr verdunkelnden Baumreihen schossen ihnen die Automobile entgegen wie große Hunde, die, den Kopf tief gesenkt, mit ihren Feueraugen eilends einer Spur folgten. Etwelche ratterten dunkel und schwer vorüber, andere wieder huschten lautlos vorbei, hell strahlend wie kleine, elegante Stuben auf Rädern, wie erleuchtete Schiffskabinen, die plötzlich sich auf Reisen begeben haben. Man erkannte nicht, wer darin saß; man hatte nur das Gefühl von zarten seidenen Stoffen, von Federn, von Hüten, von dunklen Anzügen und blendend weißen Oberhemden. Und dann blieb noch für Augenblicke der lichte Schimmer im Gedächtnis haften und schon huschten suchend hinten neue Feueraugen heran. Der duftige Seidenmantel aber, der den beiden vorangeflattert war – gleich einer Fahne, der sie folgten, auf die sie geschworen hatten, sie nie zuverlassen – er war plötzlich in ein Haustor eingebogen; und der Mann mit dem schönen Zylinder hatte recht energisch die Tör ins Schloß fallen lassen, als oh er damit sagen wollte: Leute mit Havelocks und fraglichen Strohhüten haben draußen zu bleiben!
Und jetzt gingen die beiden etwas weniger zielvoll und andächtig hinter einer kleinen trächtigen Dachshündin her, die ziemlich bekümmert und nachdenklich, lang und watschelbeinig, mit klatschenden Ohren vor ihnen hintrottete... gleich einer braunen Raupe, die auf vielen Beinchen lief.
«Wissen Sie, was ich hier drin habe?» begann Hermann Gutzeit und schwenkte sein langes Kuvert im Schein einer Laterne auf und nieder.
«Sie sagten es ja schon», meinte Doktor Herzfeld, durchaus nicht spöttisch, sondern eher bedauernd, daß die Dinge nun einmal so genommen werden müssen, wie sie sind: «Die Sonntagsplauderei für Weinbroda oder für Leipzig oder für Königsberg – kurz etwas, das, gut öder schlecht, am Montag vergessen ist.»
«Nein. – Haben Sie in den letzten Tagen die Zeitungen verfolgt?»
«Seit der Erfindung des Rollenpapiers», sagte Doktor Herzfeld brüsk, «sind doch die Zeitungen ziemlich überflüssig geworden.»
«Haben Sie wirklich nicht von dem neuen Ehrlichschen Mittel gehört?»
«O sehen Sie nur diesen prachtvollen Kerl!» rief Doktor Herzfeld, wandte den Kopf und zeigte auf einen Barsoi, der, schlankköpfig, hochbeinig, mit dem beweglichen Kreuz einer Eidechse, aus dem Dunkel ihnen entgegensprang.
«Haben Sie wirklich nichts davon gehört?» sagte Hermann Gutzeit noch einmal, blieb stehen und legte dem andern die Hand auf die Schulter.
«Gewiß», entgegnete Doktor Herzfeld, plötzlich sehr gleichgültig und nebensächlich, «ich lebe doch in der Welt! Meinen Sie, ich hätte als einziger das Blasen der Trompeten nicht vernommen?»
«Ich finde das eine berauschende Sache», rief Hermann Gutzeit laut und begeistert, und man hörte seiner Stimme an, daß die Gewalt dieses neuen Gedankens ihm mit scharfen Besen alles aus dem Kopfe fegte, was so lange schwer und bedrückend darin gelastet hatte: all seine täglichen Sorgen und seine tiefen Bekümmernisse, die ihm bisher gleichsam die Sprache geraubt hatten, so daß er nur unwirsch eilige Sätze hervorgestoßen hatte, immer sich selbst unterbrechend, als hätte das, was er spräche, gar nichts mit dem zu tun, was er eigentlich sagen müßte. «Ja, ich finde es berauschend schön, eine solche Tat mit erleben zu dürfen! Denken Sie, wenn das aus der Welt geschafft ist, diese Gottesgeißel, die ihre blutigen Ruten jahrhundertelang über die Menschheit hingeführt hat, lebenvernichtend, glückvernichtend, geistvernichtend, die schrecklicher gewütet hat, als je ein Attila und Dschingischan. Darüber habe ich geschrieben. Denken Sie nur, vielleicht in dreißig Jahren kennt man das bei uns nicht mehr, wie Pest und Pocken, – und dieser ganze abgrundtiefe Born von Tränen ist dann für alle Zeiten versiegt. Das Wort ist historisch geworden, ist aus der Geheimsprache, dem Rotwelsch der Menschheit gelöscht. Man wird sie studieren, diese Krankheit, wie wir heute den Hexenhammer von Sprenger und Institorus studieren... mit Grausen ob der Tiefe und Ausdehnung des menschlichen Leidens und mit einem geheimen Aufatmen, daß wenigstens diese eine Folterqual vom Leib der Menschheit gewichen ist. Ja, darüber habe ich hier geschrieben!