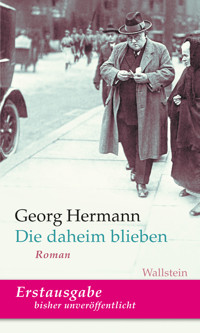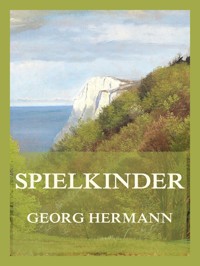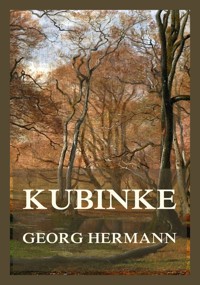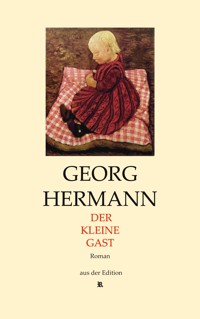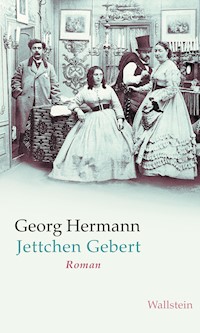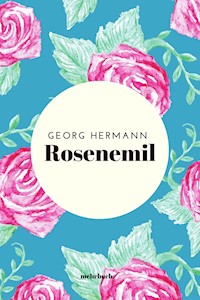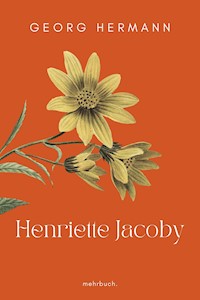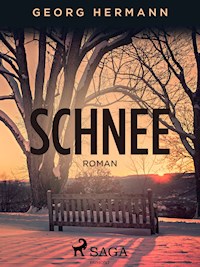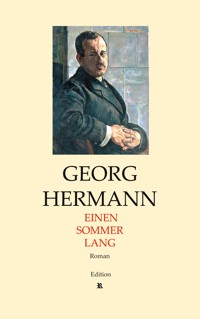
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Georg Hermann, Kette, Edition R
- Sprache: Deutsch
Während draußen der 1. Weltkrieg tobt und andere Autoren sich mit diesem mörderischen Wahnsinn bereits auseinandergesetzt haben, startet Georg Hermann im Jahre 1917 seine autobiographische Pentalogie (Die Kette) mit dem ersten Band "Einen Sommer lang". Die Handlung spielt von April bis Oktober des Jahres 1899 - den aktuellen Krieg lässt der Autor erst viel später an seine Romane heran. Junge Paare, zu denen auch Fritz Eisner, des Autors Alter Ego, gehört, finden sich zur Verlobung. Kleinbürgertum trifft Bildungsbürgertum, alles ganz Wilhelminisches Zeitalter, noch "gute alte Zeit". Wer es sich leisten kann, verbringt den Sommer in einer Sommerwohnung, in diesem Falle bei Potsdam, wo die Witwe Lindenberg und ihre Töchter Annchen und Hannchen Hof halten. Hier laufen vor den Augen des Lesers die gesellschaftlichen Ereignisse der Jahrhundertwende ab. Liebe, Intrigen, Betrügereien, ein unglaublicher Gerichtsprozess und all die zwischenmenschlichen Beziehungen der künftigen Protagonisten geben dem Leser einen Einblick in die Zeit. Ein Hauch Fontane, ein Hauch von Keyserling - wer hier opulente Handlung erwartet, wird nicht auf seine Kosten kommen. Selbst ein Liebesdrama mit Todesfolge wird hier dezent inszeniert und von vielen kaum zur Kenntnis genommen. Dafür wird er aber ausgiebig entschädigt durch die Beschreibung der Charaktere der Personen und ihrer Verhaltensweisen. Fein beobachtend, süffisant, manchmal maliziös, doch immer voller Toleranz, mit einer Schwäche für Außenseiter. Kabale und Liebe mit viel Humor und Augenzwinkern, Erotik in ihrer zeitgemäßen Form. Dabei kommen Literatur, Kunst und Natur nicht zu kurz. Wer sich auf diesen Roman einlässt, wird belohnt durch eine angenehme Sprache, die Einführung in die Vorkriegswelt und immer wieder zufrieden schmunzelnd weiterlesen wollen - und vielleicht auch den Lebensweg dieser Gesellschaft weiter verfolgen wollen: ihren Weg vom Kaiserreich über den Krieg bis in die Weimarer Republik mit ihrer Hochinflation, mit Fritz Eisner als Mittelpunkt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zwischen Feld und Hecken Führt ein schmaler Gang, Süßes, seliges Verstecken Einen Sommer lang.
Detlev von Liliencron
Diese Geschichte, die eigentlich keine Geschichte ist, hat eine Vorgeschichte.
Eine Dame – Frau Luise Lindenberg – hatte zwei Töchter: Annchen und Hannchen. Ich weiß, das ist leicht zu verwechseln. Aber wenn man sich angewöhnt, Annchen und Hannchen zu sagen, und das klingt besser als Hannchen und Annchen, wird man immer wissen, daß Annchen die ältere und Hannchen die jüngere ist. Und die hatten sich also verlobt. Mit der bestimmten oder nur unbestimmten Absicht, demnächst oder später einmal zu heiraten. Jede der Töchter hatte sich mit einem anderen und für sich verlobt. Aber beide – Annchen und Hannchen – ungefähr auf den Tag zur gleichen Zeit.
Frau Luise Lindenberg war nicht reich und auch nicht arm. Sie hatte bescheiden zu leben. Aber zu viel mehr als einem etwas erhöhten Leberecht-Hühnchen-Idyll1) reichte es nicht. Frau Luise Lindenberg war eigentlich noch viel zu jung dazu, um demnächst Schwiegermutter zu werden. Aber da sie seit weit über fünfzehn Jahren schon Witwe war, eignete sie sich vorzüglich dazu. Eine Tatsache, die die Beteiligten nicht sogleich erkannten, die aber später von Jahr zu Jahr mit stets zunehmender Bestimmtheit sich durchsetzte.
Alles, was zur Ehe gehörte, hatte Frau Luise Lindenberg in schnellster Form, sozusagen komprimiert, unter fünfzehn Atmosphären Druck erledigt. Sie hatte geheiratet mit einem Backfischzopf, in einem Alter, in dem selbst die Heldin von Emmy Rohdens »Trotzköpfchen« noch nicht einmal ohne Gouvernante in die Konditorei geht. Sie hatte zwei Kinder bekommen und ein paar Jahre später den weit älteren Mann verloren. Und so war sie mit diesem wichtigen Lebensthema schon fertig, wenn andere – und die meisten – noch gar nicht damit begonnen hatten. Warum und weshalb sie es nie ernstlich wieder aufgegriffen, entzieht sich unserer Kenntnis. In larmoyanten Auseinandersetzungen mit ihren beiden Töchtern versicherte sie ihnen häufig und nachdrücklich, daß sie es nur dieser beiden Töchter wegen getan, obwohl es ihr an wohlhabenden und ansehnlichen Bewerbern nicht gefehlt hätte.
Aber da die eine der Töchter – die ältere, Annchen Lindenberg – nur sehr bescheidene und brockenhafte Erinnerungen an den Vater hatte; und die andere – Hannchen Lindenberg – ihn in einem Alter schon verloren hatte, in dem man erst ganz dämmernd den Unterschied zwischen einem Menschen, einer Gummipuppe und einem Baubauhund empfindet, so war der Kausalnexus2) etwas schwer zu begreifen. Was (beiläufig) einen Kenner weiblichen Seelenlebens nicht in Erstaunen setzen wird.
Die Verlobungen der beiden Töchter dieser Dame aber waren gar keine rechten Verlobungen, indem daß die beiden Männer nach den Begriffen des bürgerlichen Mittelstandes durchaus nicht zu denen gehörten, die nach ihrer Lebensstellung das Recht auf die Gründung eines eigenen Hausstandes – einschließlich des damit verbundenen Eheglücks – hatten. Sondern – um es kurz herauszusagen: Sie berechtigten beide zu den schönsten Hoffnungen. Das heißt: Sie waren gar nichts, und es war zweifelhaft, ob sie je etwas werden würden.
Der eine – Eginhard Meyer (Eltern geben oft zu komische Vornamen, sogar wenn sie Meyer heißen), auch familiär Egi genannt – war Student. Sehr jung noch an Jahren, beschämlich jung, Gelehrtennatur, reichlich schrullenhaft; also rücksichtslos und ziemlich unerzogen. Und er hatte sich nach einer Schulzeit, die reich an Zwischenfällen war – denn es gibt sehr gute Schüler, die sehr schlechte und schwierige Schüler sind – nunmehr der Jurisprudenz zugewandt, stocherte aber ein wenig großsprecherisch in allen möglichen anderen Schüsseln der Wissenschaft herum, mit der Miene des geistig Überlegenen.
Eginhard Meyer hatte durchaus nicht die Absicht, sich einmal später auf dem Brotbaum der Advokatur anzusiedeln. Auch Öler, Bediener, Werkmeister, Ingenieur der großen preußischen Rechtsmaschine zu werden verschmähte er; obwohl für ihn väterliche Fürsorge schon frühzeitig gewisse Schritte unternommen hatte, daß ihm die Tore dieses Maschinensaals nicht verschlossen blieben. Nein, Eginhard Meyers Streben ging danach, selbst wieder einmal Lehrer nachwachsender Generationen von Rechtsverständigen zu werden, neuen Wein in die alten Schläuche zu füllen und die Zahl der Bücher über die Rechtswissenschaft um einige zu vermehren.
Wenn Nietzsche recht hat, so er sagt: »Je größer der Mann, desto größer seine Verachtung«, so mußte unser Mann, Eginhard Meyer – das heißt, durch Rückschluß festgestellt – sehr groß sein. Denn er hatte eine maßlose Verachtung für alles, was Leute vor ihm in seinem Gebiete geschaffen hatten; eine Verachtung, die nur noch durch die übertroffen wurde, die er für jene hegte, die heute auf dem gleichen Gebiete sich betätigten. Daß er am Rande dieses keineswegs dornenfreien Weges, den er zu betreten beabsichtigte, die ersten fünfundachtzig Jahre seines Lebens kaum große Reichtümer sammeln würde, war allen Beteiligten und auch ihm klar. Er fand sich aber mit dieser Tatsache in dem harten, entsagungsreichen Stolze des Idealisten ab.
Auch seine Braut, Hannchen Lindenberg – man muß das auseinanderhalten! – ein sehr junges Wesen, die von ihrer Mutter einen großen Wortreichtum von Pflichtbezeichnungen und sittlichen Erwägungen erblich überkommen und zeitgemäß ausgebaut hatte, fand gerade hierin einen Anreiz mehr, sich auf das pastorale Jahrzehnt einer gemeinsam durchkämpften Brautzeit vorzubereiten und zu versteifen. Es war eine Märtyrerkrone, die Hannchen Lindenberg sich mit redereicher Wollust auf die wundervollen kastanienbraunen Flechten ihres großäugigen Hauptes stülpte. Hannchen Lindenberg liebte (vielleicht mehr als ihren Bräutigam) solche Märtyrerkronen. Sie hatte das von je getan. Hannchen Lindenberg brauchte sie und suchte sich, wie spätere Jahre zeigten, stets wieder eine neue, wenn die alte schadhaft und unansehnlich geworden war und die Blicke der Umwelt nicht mehr genügend auf sich zog.
Zum Schluß lag aber nach menschlichem Ermessen der Fall keineswegs so verzweifelt und aussichtslos, wie die beiden – Egi Meyer und Hannchen Lindenberg – in langen Spaziergängen selbstzerfleischend sich ausmalten. Denn da die Eltern des jungen Herrn Meyer für recht wohlhabend gehalten wurden – es auch wohl waren –, so war anzunehmen, daß sie im Verein mit Frau Luise Lindenberg ein Machtwort sprechen würden, um eines schönen Tages den entnervenden Stellungskrieg der Brautzeit in die offene Feldschlacht der Ehe zu überführen. Die soziale Frage dieser beiden war – wie die meisten ihrer Art – nämlich einfach mit dem Geldbeutel zu lösen. Soweit also waren sich alle Außenstehenden eigentlich einig. Nur wann es geschehen würde, und wann – um es kurz und rund zu sagen – allen (außer den Brautleuten, die sich in ihrer Rolle gefielen) diese Hin- und Herzerrerei zu dumm würde ... darüber war man sich noch nicht im reinen. Denn es ist merkwürdig, wie schwerfällig Menschen von Entschluß sind, sowie es heißt, sich vom Geld trennen.
Ungünstiger, übler und dunkler lag der Fall der älteren Tochter der Dame – der Fall Annchen Lindenberg.
Der Mann, der in ihr Leben getreten war, hatte die ersten drei Jahrzehnte oder richtiger die ersten zweidreiviertel Jahrzehnte seines Lebens damit verbracht, es zu nichts zu bringen. Er konnte kaum sich selbst erhalten, geschweige denn hatte er die Aussicht, noch einen oder mehrere Passagiere jemals auf seinen Lebenskahn mitnehmen zu können. Er hieß nebenbei: Fritz Eisner.
Fritz Eisner hatte nach einer ziemlich nutzlos und beschränkt angewandten Jugend einige Jahre mit fast noch geringerem Erfolg Kaufmann gespielt, dann auf der Universität ein paar bescheidene Löcher sich in den dicken Mantel seiner Unbildung gerissen, ein paar Bücher geschrieben, die ihm nichts eingebracht als unendlichen Ärger mit der näheren und weiteren Familie, und die dem Verleger noch außerdem Unkosten bereitet hatten. Jetzt begann er für Zeitungen sich zu betätigen und war der Meinung, daß man das Wesen eines Malers und seiner Werke erschöpfe, wenn man diese möglichst eingehend mit schön gewählten Worten beschriebe. Und da das ein Geschäft war, von dem nur ein unverbesserlicher Optimist behaupten könnte, daß es seinen Mann nähre, so waren für das gute Mädchen, das sich an ihn und das er an sich gebunden hatte, die Aussichten scheinbar wirklich recht trübe. Denn hinter ihrem Freund stand keine Familie, die etwa in den Geldbeutel gegriffen hätte. Und wenn sie selbst den guten Willen dazu gehabt hätte – was man nachher immer behaupten kann – sie hätte die Hand verdammt leer aus eben diesem Geldbeutel zurückgebracht.
Daß es einige Leute in der Welt gab, die sich trotzdem von Fritz Eisner etwas versprachen, soll ebenso wenig verschwiegen werden, wie daß er sich um seine Zukunft aus angeborener Gleichgültigkeit wenig Sorgen machte. Aber mit dem Schriftsteller – und das war er nun mal – ist das stets eine üble und ungewisse Sache. Entweder kommt er früh zu Erfolg, so ist das zwar sehr nett, aber man kann versichert sein, es hält nicht lange an. Oder er kommt früh nicht zu Erfolg, dann beweist das durchaus noch nicht, daß er später welchen haben wird. Und so lag's hier und mit ihm.
Fritz Eisner jedoch sah den Dingen mit großer Ruhe entgegen. Er hatte zwar keine hohe Meinung von sich, denn er wußte, was wirklich gut ist. Hinwiederum war es ihm nach kurzer Tätigkeit doch schon zu Bewußtsein gekommen, daß die meisten anderen auf den Gebieten, auf denen er arbeitete und arbeiten wollte, auch sehr wenig Beachtenswertes boten und endlich nicht allzu Übel dabei fuhren. Und das ermutigte ihn, sofern er sich überhaupt einmal Gedanken machte, was selten vorkam. Denn er war Instinktmensch, nicht ungrüblerisch, hart, ziemlich verbittert in freudloser und enttäuschter Jugend, nicht sehr umgänglich, viel mit sich beschäftigt, und er ging dabei doch aller Selbstzerlegung vorsichtig aus dem Wege und war der festen Meinung, daß sein unbewußtes Ich sein bewußtes Ich schon richtig gängeln würde.
Immerhin war er das strikte Gegenteil von dem, was man sich als einen richtiggehenden Bräutigam vorstellt, und von dem, was eine Mutter sich als Gatten für ihre Tochter erträumt. Und da Fritz Eisner zwar der Geburt und Familie nach zum guten Mittelstande gehörte, aber bisher und zurzeit noch niemals sich dort bewegt hatte, vielmehr einsam, schlecht gekleidet oder in den Kreisen armer, kleiner und harmloser Boheme dahingelebt hatte, kurz das Mädchen aus gutem Hause, den Ball, die Gesellschaft, das Kränzchen, den Besuch, die Verwandten, das Theater, das Konzert, die Einladung, den Ausflug, das Picknick, den Badeort, die Sommerreise, den Flirt, den Sport – all die Dinge, die junge Männer und junge Mädchen aus guten Häusern zusammenbringen, nie kennengelernt hatte, ja, ihnen mit spanischem Stolz im Bogen aus dem Wege gegangen war, so eignete sich Fritz Eisner auch sehr wenig zu seiner neuen Würde und begriff noch weniger, wie er in diese merkwürdige Lage gekommen war. Er hatte nämlich vordem auch nie mit einem Gedanken daran gedacht, zu heiraten. Eine Möglichkeit war das, die so außerhalb seines Vorstellungskreises lag wie der Bau einer Dynamomaschine für einen Foxterrier.
Bevor wir nun von den beiden jungen Mädchen – Annchen und Hannchen Lindenberg – reden, müssen wir uns aber doch einmal die Frage vorlegen: Wie sind denn diese zwei merkwürdigen und im bürgerlichen Sinne unüberlegten und unklugen Verlobungen eigentlich zustandegekommen? Wie kamen diese beiden jungen Mädchen, bestimmt, Gattinnen braver Männer wie Kaufleute, Ärzte, Rechtsanwälte – also reputabler, durchaus prosaischer, zahlungsfähiger, im Leben stehender Menschen zu werden ... und die hierzu mit vielen reizenden Nichtigkeiten dressiert, geschaffen und erzogen waren, die in keiner Weise seelisch oder geistig auffallend vom Durchschnitt abwichen ... wie kamen Annchen und Hannchen dazu, auf so fragliche Versuche sich einzulassen? Und wie kam Frau Lindenberg dazu, sie, wenn auch unzufriedenen Gemüts und nicht allzu freudigen Herzens, zu billigen?
Wie kam es, daß zwei – oder richtiger vier – junge Leute in diese etwas schwierige Sache hineingeraten waren wie verirrte Wanderer in die Sümpfe?
Diese Fragen werden in ihren letzten Tiefen nie beantwortet werden. Und sie gehen uns eigentlich auch gar nichts an. Denn wir werden uns hier keineswegs mit der Kehrseite der Medaille zu befassen haben, sondern werden unsere Freude finden an den hübschen Lichtern, die über ihre blankgeputzte Vorderseite einst spielten.
Also woher diese überraschende Doppelheit der Fälle? Man könnte ja vielleicht meinen, daß die »jugendliche Übereilung« hier eine Lage geschaffen hätte, von der es kein Zurück gäbe. Aber ich bitte wirklich allerinständigst, auch nur den blassen Schatten dieses Gedankens weit von sich zu weisen. Ich würde mit solcher Belastung diese Geschichte gar nicht zu schreiben wagen. Sie ist eine ungewöhnlich sittliche Geschichte, und wer das Gegenteil in ihr zu finden hofft, der fange erst gar nicht an, sie zu lesen. Sie spielt nur in guter Gesellschaft, meine Geschichte, und außerdem noch im vorigen Jahrhundert, das noch nicht in jener verabscheuungswürdigen Leichtfertigkeit sich gehen ließ, wie sie leider das Kennzeichen des gegenwärtigen geworden ist. Und wenn sie auch im allerletzten Jahre des hingeschwundenen Säkulums spielt und dadurch manche Symptome der Übergangszeit kaum wird verbergen können – sie ist trotzdem eine in den Haupt- und Nebenpersonen streng sittliche Geschichte. Ich bitte, dies ein für allemal festzuhalten.
Die Verlobungen waren in ganz anderer Weise zustandegekommen. Es waren einfach zwei Verliebungen, wie viele ihrer Art täglich sich knüpfen und wieder verlieren, die aber eines schönen Tages in den Gesichtskreis der Familien kamen und dadurch zu Verlobungen wurden – und die, was die Sache noch reizvoller gestaltete, zuerst als geheime Verlobungen vor diesen galten; indem man sie nicht in die Zeitung rückte, sondern sich damit begnügte, sie auf sämtlichen Märkten Berlins ausschellen zu lassen.
Eine richtige Verlobung kann – wenn man einsieht, daß sie ein Irrtum war, und fürchtet, sie wird nichts Gutes im Gefolge haben – gelöst werden. Eine geheime Verlobung, von zwei Familien zusammengemanscht, ist unlösbar. Ich glaube überhaupt, daß der Bürgermeister von Magdeburg Guericke für seinen berühmten Versuch mit der luftleeren Kugel, die fünfundsiebzigtausend Pferde auf jeder Seite nicht auseinanderreißen konnten, gar keine Metallkugel, sondern – um sicherer zu gehen – eine geheime Verlobung genommen hat.
Nun zu den beiden jungen Damen. Da sie drei Jahre auseinander waren und die jüngere an neunzehn Jahre war, war die andere zweiundzwanzig Jahre.
Hannchen Lindenberg, die Neunzehnjährige, war ziemlich groß für eine Frau, sehr schlank, schmal, dünngliedrig, mit kastanienbraunem, rötlich angeflogenem Haar und sehr schönen, feuchtschimmernden, großen, grauen Augen, von denen sie reichlich nach allen Seiten Gebrauch machte; etwas englisch, etwas Rossettityp3). Mund, Nase, Stirn, kleines Kinn – nichts sonst an ihr war anders als gewöhnlich, und doch segelte dieses ganze junge Menschenwesen unter der Flagge einer absonderlichen Schönheit, die allerhand Dinge geistiger und seelischer Art versprach, die zu halten ganz außerhalb ihrer Macht lag. Denn Hannchen Lindenbergs natürliche Grenzen waren wirklich ziemlich eng. Trotzdem hatte Hannchen Lindenberg eine beispiellose szenische Begabung, wußte sich stets mit einem Nimbus von Streben, Interessiertheit, aufopfernder Tätigkeit wortreich zu umgeben, ohne hierbei im geringsten sich an die Tatsachen zu halten. Ja, es war geradezu bewundernswert, wie souverän und überlegen Hannchen Lindenberg mit ihnen schaltete und in freier Erfindung mit ihnen umsprang. Und zwar tat Hannchen Lindenberg das mit so einem Aufwand von Worten und unter so geschicktem Lavieren, daß manche lange Jahre brauchten, bis sie dahinterkamen, daß Hannchen Lindenberg wie eine halbleere Zigarettenschachtel nur amüsante Verpackung ohne nennenswerten Inhalt war.
Hannchen Lindenberg hatte, wie ihre Schwester Annchen, eine Höhere Mädchenschule unter privater Führung besucht, die ihre Schülerinnen nur nominell über das volle Analphabetentum der Fellachinnen erhob. Und auch hier noch hatte Hannchen – denn sie hatte einen harten Kopf zum Lernen – ungewöhnlich wenig mit hinausgenommen. Dann hatte sie unter Hängen und Würgen eine Prüfung als Kindergärtnerin bestanden; doch empfahl man, sie vorerst nicht ohne die Aufsicht einer wirklich geschulten Kindergärtnerin etwa gegen irgendwelche armen Opfer ihrer Erziehungswut loszulassen.
Seitdem aber trug Hannchen Lindenberg Stehkragen und galt bei ihren Freundinnen (sie hatte deren fünf Dutzend, neigte zur Freundschaft) als ein »wertvoller Mensch«. Seitdem versuchte Hannchen Lindenberg ständig, Väter, Mütter, Großmütter und Tanten über Erziehungsfragen zu belehren – Probleme, die man systematisch anfassen müsse. – Seitdem sprach Hannchen Lindenberg von ihren pädagogischen Arbeiten, stürzte mit einem kleinen Mäppchen unter dem Arm durch die Welt und sprang jedem Unbeteiligten mit Pestalozzi, Fröbel4) und Kant, über dessen Ansichten in diesen Fragen sie sich einmal grundlegend zu äußern gedachte, unter die Nase. Wie sie überhaupt ein sehr wortreiches Mädchen war. Auch erzählte sie gern, daß die Mitarbeit an den wissenschaftlichen Werken ihres zukünftigen Mannes und jetzigen Bräutigams Eginhard Meyer sicherlich einmal den schönsten Teil ihres ehelichen Lebens ausmachen würde. Hannchen Lindenbergs Gesundheit war nebenbei nicht gerade kapitelfest, und sie wurde ständig noch durch irgendwelche Gewaltsamkeiten – körperliche, geistige, seelische – überspannt.
Man wäre aber nun auf durchaus falscher Fährte, wenn man vielleicht glaubte, daß Hannchen Lindenberg dem männlichen Geschlechte etwa sehr kritisch gegenüberstand oder gar – bis auf die eine Ausnahme bisher – abhold gesinnt gewesen wäre. Nein. Trotz ihrer neunzehn Jahre – wir sind ja im allgemeinen geneigt, den Zeitpunkt des Erwachens der weiblichen Seele zu spät anzusetzen – also trotz ihrer neunzehn hatte Hannchen Lindenberg (vielleicht aus Klugheit) wohl schon so einem halben Dutzend von Jugendfreunden, angehenden Referendaren, werdenden Ärzten, Ingenieuren, Lehrern, ja sogar einfachen Kaufleuten (einzeln oder mehreren zu gleicher Zeit) zärtlich versprochen, »auf sie zu warten«. Und die waren nun alle von der neuen Wendung der Tatsachen ziemlich enttäuscht. Und sie ertrugen diese Enttäuschung je nach ihrem Temperament: schmerzreich in sich selbst zurückgezogen; brieflich sich austobend unter Zuhilfenahme von Heines »Buch der Lieder«, das ja hierfür manche treffliche Verszeile enthält; oder, sofern sie robustere Naturen waren, stellten sie, wie wir noch sehen werden, die Ungetreue und machten ihr bedenkliche Szenen. Ja, einer – wie wir noch hören werden – trug sich sogar damit, es dem Gottesurteile des Zweikampfes zu überlassen, wer die Braut heimführen sollte.
Das gibt natürlich gar keinen Grund, im geringsten abfällig über Hannchen Lindenberg zu urteilen, und es sei versichert: Trotz alledem war sie ein reizendes Mädchen: sehr lebhaft, ewig für andere beschäftigt, tausenderlei Dinge besorgend, für Menschen, die sie gar nichts angingen und es ihr nie dankten, unermüdlich fleißig im Haus und in der Wirtschaft, unordentlich vor Ordnungsfanatismus, der alles stets durcheinanderjagte – denn nur die ruhenden Dinge können ihre Ordnung bewahren, und ewig Staubwischen wirbelt den Staub auf –; war sehr handgeschickt, die geborene Dilettantin, die alles versuchte und sich immer leidlich aus der Affäre zog. Aber eine Schneiderin hätte die Bluse besser im Sitz, geschmackvoller und billiger, ein Tischler das Regal stabiler und für den halben Preis aufgebaut. Auch war Hannchen Lindenberg nicht witzlos und durchaus nicht ohne persönliche Eigenart, und nur durch die leidige uns krankhafte Sucht, immer mehr scheinen zu wollen, als sie war, nahm sie sich viel von dem Zauber, der wie von selbst und ohne all ihr Zutun ihre junge schlanke Person umspielte. Ein stärkerer Zauber als bei mancher sonst ... denn neunzehn Jahre sind ja auch so schon fast stets schön und blumenhaft.
Solcher Dinge war sich die ältere Schwester Annchen Lindenberg aber durchaus bewußt. Und Annchen war im Frauensinne viel zu klug, um sie etwa zu zerstören. Sie besaß viele jener netten und lieben Eigenschaften, die ein junges Mädchen vor Gott und Menschen angenehm machen. Ganz im Gegensatz zu ihrer Schwester Hannchen hatte Annchen auf der Schule einen guten Kopf gehabt, der das wenige, das man von ihm forderte, stets spielend bewältigte und sofort wieder mit Freuden vergaß, auch wohl in den Zusammenhängen oder seiner Notwendigkeit nie begriffen hatte. Aber auf so etwas wird ja in der Schule kein Wert gelegt. So war Annchen Lindenberg also zum Schluß von der Schule zwar ein halbes Dutzend leicht angefrömmelter Prämien in Goldschnitt und abscheulich gepreßten Leinewandbänden, aber sonst nichts Zusammenhängendes geblieben; – und auch sie begannen schon aus dem Leim zu gehen. Und später hatte Annchen Lindenberg sich auch mit dem wenigen begnügt, das ihr durch den Zufall irgendwelcher Gespräche und durch Freunde – denn, so eine Frau etwas von Astronomie versteht, hat sie sich sicher nie für den Sternenhimmel, sondern immer nur für den Assistenten der Sternwarte interessiert – also durch Freunde angeflogen war.
Es gab nichts in der Welt, das Annchen Lindenberg nicht spielend gelernt hätte, und nichts, das zu lernen Annchen Lindenberg etwa Lust verspürt hätte. Sah die andere, Hannchen, überall Probleme, selbst im Brotschneiden, so sah Annchen nirgends welche ... oder, wenn sie sie von der Ferne erblickte, so ging sie ihnen fürsichtiglich im Bogen aus dem Wege.
Annchen Lindenberg war dabei ebenso oder fast ebenso häuslich, fleißig, nähsam, mußte wie die anderen überall zugreifen, Blusen und Schürzen selbst waschen und plätten. Sie trug die kleinste Fahne wie eine Pariser Toilette und doch dabei etwas bohemehaft und mit leicht genialer Schludrigkeit. Und deshalb zausten Annchen die Robusteren, Mutter und Schwester, gern. Und da Annchen Lindenberg weicher war und die Tränen ihr locker saßen, hatte sie einen harten Stand zwischen ihnen, wie ein Singvogel zwischen den Spatzen.
Irgend so ein Tröpfchen überkommenes Theaterblut kam zudem stets wieder bei Annchen Lindenberg durch. Und sie war ganz und gar Weltkind ohne jegliche Mystik, liebte in bescheidenen Grenzen alles Hübsche dieser Erde und gab sich mit Aufrichtigkeit all den Dingen hin, die das Herz eines jungen Mädchens rascher schlagen lassen.
Annchen Lindenberg war klein, zierlich, hatte Pastellfarben und ein wenig kurzsichtige Gazellenaugen; dazu ein französisches Figürchen, und sie erzählte deshalb, wie viele ihrer Art, daß sie sicher schon einmal als Marquise im achtzehnten Jahrhundert gelebt und damals – sie erinnerte sich deutlich! – zum Schluß auf der Guillotine geendet habe. Was sie heute keineswegs bedauerte.
Von dieser Zeit war Annchen Lindenberg auch eine gewisse Vorliebe nicht für französische Literatur, aber für französische Bücher geblieben. Annchen las sie, um die Sprache nicht ganz zu verlernen, wie sie sagte. Schmale gelbe Heftchen waren das mit reichlichen Illustrationen, die alle im Wesen gleich waren, wie auch die Bücher im Inhalt gleich waren ... obwohl jedes einen anderen Titel hatte und jedes von einem anderen Verfasser stammte. Sie zeichneten sich durch die Bank dadurch aus, daß sie mit einem gewissen eleganten Freimut Dinge behandelten, die das deutsche Schrifttum jener Zeit nur erst zaghaft in die Debatte zog, wenn es nicht der Achtung aller gesitteten Menschen und besonders der lesenden Frauen anheimfallen wollte. Im Französischen aber waren diese Dinge durchaus diskutabel und durch die Ferne einer fremden Sprache gleichsam in ein transzendentales Entzücken erhoben.
Man denke aber deshalb nicht etwa schlecht von Annchen Lindenberg: Sie war trotzdem ein reizender Backfisch von zweiundzwanzig Jahren, berühmte Tänzerin, Ballkönigin von Beruf, schon auf der Schule die unvergessene Freude ganzer Generationen von Primanern, lebensfroh, schlagfertig und witzig.
Annchen dichtete zu allen Melodien von Operetten und Kommersliedern ellenlange Poeme, die bei Tafeln und Kaffeepausen wegen ihrer spitzen und lustigen Reime mit Lachen und vielem Hallo gesungen wurden. Sie wurde sehr verwöhnt und umschwärmt, hörte nicht auf, Bonbonnieren zu naschen, hatte viel Freunde, wenig Freundinnen – hübsche Mädchen haben keine Freundinnen – und alle Welt konnte Annchen Lindenberg gut leiden wegen ihres weichen und gefälligen Wesens, das – vielleicht das Beste an ihr – ganz im Musikalischen verankert war. Im Gegensatz zur Schwester Hannchen und zur Mutter Luise Lindenberg, die keinen Ton in der Kehle und im Kopf hatten.
Ja, Annchen Lindenberg hatte sehr früh schon durch Singen und Klavierspielen viele Hoffnungen erweckt, war auch unter Opfern eine Reihe von Jahren von guten Lehrern und Lehrerinnen ausgebildet worden. Aber es lag nun einmal nicht in ihrem Wesen, das jede Zielstrebigkeit im Innersten ablehnen mußte, Hoffnungen zu erfüllen.
So war alle Welt charmiert von Annchen Lindenbergs wunderhübschen musikalischen Gaben, die fast zu gut für einen Dilettanten waren; aber doch auf zu niederer Stufe standen, um irgendwie eine berufliche Verwendung zuzulassen oder sich in die Öffentlichkeit wagen zu dürfen. Ihrem netten schillernden Temperament war es eben nicht gegeben, bei irgendeiner Sache in die Tiefe zu gehen, und wenn ihr Lehrer, der einen berühmten Namen trug, auch jahrelang nur große Musik mit ihr getrieben hatte. Annchen Lindenberg war doch erst in ihrem Element, sowie sie einen lustigen wertlosen Reißer über die Tasten herunterwirbeln konnte. Und statt sich in die ernsten Lieder der Meister zu vertiefen – sie kannte sie wohl auch – erntete Annchen Lindenberg lieber billige Triumphe vor verzückten alten Damen mit Liedern, in denen zwitschernd Spatz und Spätzin sich unterhielten oder ein kleiner Fink Tirili-Tirili sang, nach jeder Strophe sechsmal. Immerhin, ihr Wesen war in Musik verankert, und das ist eine göttliche Begnadung.
Vielleicht hing mit dieser musikalischen Betonung ihres Wesens ein Mangel an Tatsachengefühl zusammen, der so stark war, daß man nie wußte, wie weit ihre Phantasie und ihre Fabulierfreude sie gerade treiben würde. Annchen Lindenberg erzählte gern Dinge, die ihr gerade einfielen, ohne daß sie in Menschen oder Ereignissen Begründung hatten. Und wie jemand, der springt, beim dritten Versuch meist weiter kommt als beim ersten, so hatte ihre Erzählung beim drittenmal auch bedeutend an Umfang und Ausrundung gewonnen. Und so kam es, daß sich öfters Menschen brieflich ausführlich beschwerten, weil sie zum Beispiel wider ihren Willen von Annchen Lindenberg mit Leuten verlobt worden waren, die sie gar nicht oder nur nebenher kannten, oder mit denen sich zu verloben sie gerade absichtlich auf das strengste vermieden.
Annchen Lindenberg hatte aber jetzt schon fünf bis sechs reichlich bemessene Ballwinter hinter sich, wenn sie auch durch eine schwere Krankheit, aus der sich ihr Fünkchen Leben nur wie durch ein Wunder wieder zur Welt zurückgefunden hatte, und die Annchen Lindenberg noch jetzt überaus zart und sehr jung erscheinen ließ, ein oder zwei davon nicht ganz so durchgetanzt und durchgejubelt hatte wie die anderen. Manche Bande hatten sich da geknüpft; und einmal hatten schon zwei beratende Familien das Schlagnetz über Annchen Lindenberg und irgendeinen nicht aussichtslosen Herrn fallen lassen, ohne daß es glückte, beide länger als wenige Wochen zu halten.
Wer von beiden wieder fortflatterte, wird ewig unaufgeklärt bleiben und geht uns ja hier eigentlich auch gar nichts an. Es sei nur erwähnt, um so einen leichten Hauch von Enttäuschung zu erklären, der ihre Sonnigkeit überschattete, ein erstes Mädchenaltern der Erfahrung; und um verständlich zu machen, warum Annchen Lindenberg sich jetzt mit ihrer kleinen lieben Seele an einen Menschen geklammert hatte, der von einem ganz anderen Lebensufer kam, der zäh und schwerblütig, robust und doch nicht grobnervig war, halb gefüllt mit tiefer Bitterkeit und halb mit trunknem Entzücken ob dieser Welt war, hart verbissen und vorwärtsdrängend, und der in allem das Gegenteil war zu ihrer gottgesegneten Leichtlebigkeit.
Fritz Eisner glaubte, daß es ein Leichtes sei, sie an die Hand zu nehmen und in sein Land hinüberzuführen, das Annchen Lindenberg im tiefsten Wesen stets fremd und nichtssagend sein und bleiben mußte.
Und Annchen Lindenberg sah nicht, daß ihre Welt nur dazu angetan war, ihn immer tiefer in sich hineinzutreiben. Wie ja überhaupt zwei Menschen, von denen der eine zentripetal und der andere zentrifugal ist, sich nie berühren können.
Natürlich waren sie jetzt beide, Fritz und Annchen, der Meinung, daß sie und nur sie füreinander bestimmt seien, und waren sehr glücklich in ihrer jungen, albernen, kaum getrübten Zuneigung. Sie waren fest überzeugt, daß sie aufeinander durch ein Leben schon gewartet hätten.
Denn vor allem der Mann redet sich in dieser Lage ja so etwas stets ein, und die Frau läßt ihn gern in dem Glauben. Der Mann sagt sich nie, daß es doch ebenso gut wie er ein anderer hätte sein können, und daß sich dann das Bild nur ganz wenig anders gestaltet hätte. Denn so ist das Wesen der Frau beschaffen, daß sie dem liebenden Mann, wer und was er auch sei – wie ein Spiegel, der jedem dient, der kommt – immer nur die Züge seines eigenen Ich zurückstrahlt.
Man hätte ja nun unbedachterweise den Einwurf erheben können, daß Frau Luise Lindenberg Annchen und Hannchen besser und weniger oberflächlich hätte erziehen müssen, um sie irgendwie einmal auf eigene Füße zu stellen. Denn Frau Luise Lindenbergs Haushalt sah nach außen zwar ziemlich großzügig und gastfrei aus, war aber innerlich doch unendlich klein und bescheiden.
Aber man vergißt, daß unsere Geschichte vor bald zwanzig Jahren spielt, da man, Gott sei Dank, noch nicht in allen Schichten davon überzeugt war, daß ein Mädchen durchaus etwas lernen und einen »Beruf« ergreifen müsse. Und dann möchte ich ein für allemal eines feststellen: Die Dinge sind, wie sie sind; und ich hasse Vorwürfe jeder Art. Außerdem gibt es wirklich genug Ameisen; und die zierliche Grille ist etwas Entzückendes auf der Lebenswiese. Ich jedenfalls möchte weder sie noch den süßen Schall ihrer Stimme missen.
So – – – nachdem ich nun diese fünf Menschen wortreich und ausführlich in diese Geschichte, die keine Geschichte ist, eingeführt habe, möchte ich bemerken, daß sie mit ihr gar nichts zu tun haben. Was hat der rote Faden mit der Französischen Revolution zu tun? Nichts. Und doch erzählt uns jeder Geschichtslehrer, daß er durch die Französische Revolution hindurchgeht. Verändert er sich? Wird er grün, gelb, hellblau? Reißt er? Nein – er geht hindurch, an einem Ende hinein und am anderen hinaus. Genau so werden diese Menschen durch diese Erzählung gehen. Am Anfang hinein und am Ende wieder hinaus. Unverändert. Annchen Lindenberg wird mit dem Schriftsteller, wie er sich nennt, Fritz Eisner zum Schluß genau so öffentlich heimlich verlobt sein wie Hannchen Lindenberg mit dem cand. jur. Eginhard Meyer, der zum Schlusse aber Doktor Eginhard Meyer heißt. Was soll man groß von ihnen sagen?! Und außerdem sind ja Brautpaare über die Maßen langweilig. Frau Luise Lindenberg wird sich vorerst nur wenig nach der Seite der Schwiegermutter hin entwickelt haben, wohin sie später doch mit der ganzen ihr innewohnenden Tatkraft ihrer früh selbständigen Persönlichkeit drängte. Keiner wird wankend werden; obwohl Annchen wie Hannchen dieses mehr als einmal nahegelegt wird – Mütter gönnen ihren Töchtern gern das Beste! – aber nichts derart wird sich mit ihnen ereignen.
Also rekapitulieren wir noch einmal: Frau Luise Lindenberg – eine Dame zu Beginn der Vierziger – wohnte im Westen Berlins in einer altmodisch behaglich eingerichteten Vier-Zimmer-Wohnung, deren Vorzüge sie, wie alles, was sie besaß, nicht genug preisen konnte. Da die Erzählung im April 1899 anhebt und das Haus wohl schon an die zehn Jahre damals stand, so stammte es aus der übelsten Bauzeit, die Berlin je durchgemacht hat. Und es ist erstaunlich, warum es Professor Schultze-Naumburg als eines seiner beliebten Gegenbeispiele bisher entgangen ist. Trotzdem bildete es die Quelle ständigen Entzückens für Frau Luise Lindenberg. Es war die schönste Wohnung im elegantesten Hause Berlins und nur noch durch die übertroffen, die sie einst in der Steinmetzstraße gehabt hatte. Diese Steinmetzstraße war ein Stichwort, auf das sich Mutter und Töchter in für sie reizende, für andere sterbenslangweilige Jugenderinnerungen viertelstundenlang vertieften. Das einzig Nette für den Außenstehenden war, daß sie fluktuierten und zu verschiedenen Zeiten von den verschiedenen Familienmitgliedern verschieden erzählt wurden. Nur das eine war von vornherein bestimmt: daß die, die sie erzählte, stets als Heldin im Mittelpunkt stand.
Und wiederholen wir weiter: Annchen Lindenberg hatte sich um die Iden des Märzes – sie sind schon seit dem Jahre 44 vor Christo stets verhängnisvoll – mit Fritz Eisner; und Hannchen Lindenberg – wunderbare Doppelheit der Fälle! Oder war es eitel Konkurrenzneid?! – mit dem cand. jur. Eginhard Meyer heimlich verlobt.
Und da ja solch eine heimliche Verlobung nicht Fleisch und nicht Fisch ist und gesellschaftlich allerhand Peinlichkeiten mit sich bringt – (soll man die jungen Leute einladen oder nicht? einzeln? oder zusammen? soll man ihnen eine Vase auf den Platz stellen mit Seerosenmuster oder nicht? soll man sie zusammen mit dem anderen offiziellen Brautpaar – Ernst Heymann und Elli Grummach – bei dem Toast hochleben lassen oder nicht? sollen die gleichen jungen Leute, die bisher in dem Hause verkehrten und den Töchtern den Hof machten, fürder dort verkehren oder nicht? da es eigentlich doch in seinem Endzweck nunmehr illusorisch geworden ist? lauter ernste Fragen!) – da es aber ferner Frau Luise Lindenberg nicht über sich brachte, mit rauher Hand in diese jungen Glücke einzugreifen; und da sie endlich doch wiederum etwas Distanz zwischen die Parteien zu legen – manches pflegt sich dann von selbst zu erledigen – für gut und heilsam hielt ... so also beschloß Frau Luise Lindenberg, keine Badereise zu machen, sondern schlichtweg den ganzen Sommer über, vom 1. April bis in den Oktober hinein, in die Nähe von Berlin in eine Sommerwohnung zu ziehen.
So weit ist alles klar; und Frau Luise Lindenberg hatte, nachdem sie genugsam sich umgetan, einer alten Liebe folgend – sie hatte, als die Kinder Annchen und Hannchen noch klein waren (ja, ja, Kinder wachsen heran, eh man sich's versieht!) einmal einen Sommer in Potsdam gewohnt – hatte wieder sich zu Potsdam entschlossen. Und bei »Potsdam«, im Hause der Witwe eines Kapitäns – ein gefährliches Handwerk! – hatte sie eine kleine möblierte Wohnung gefunden, die sie noch mit eigenen Möbeln und Küchenstücken etwas behaglicher gestalten wollte.
Potsdam, oder richtiger »bei Potsdam«, war für ihre Zwecke überaus geeignet. Es war nicht so nah, daß die beiden jungen Herren Fritz Eisner und Egi Meyer tagtäglich herauskommen konnten. Auch hätte ihr das bedenkliche Löcher in ihr Jahresbudget gerissen, da Verlobung und Freitisch bekanntlich Synonyma sind. Und es war doch nicht so weit, daß sie etwa allzu selten kämen. Für all ihre übrigen Bekannten und Freunde – denn Frau Luise Lindenberg lebte seit Jahren von Bekanntschaften und Verabredungen; sie nannte das einen »entzückenden Kreis« – war es gerade recht.
Resolut also, wie Frau Luise Lindenberg war, hatte sie ihre beiden Töchter Annchen und Hannchen bei befreundeten Familien für einen bis zwei Tage eingestellt, sich selbst am frühen Morgen aber schon mit drei Ziehleuten, die – der beginnenden Tageszeit entsprechend – noch leidlich nüchtern waren, herumgeschlagen (weil sie anscheinend dem großen Spiegel mit der Goldkonsole und dem Früchtekranz in Stuck nicht die nötige Schonung angedeihen ließen, die einem Spiegel, der noch aus der Einrichtung ihrer seligen Mutter stammte, entgegenzubringen ihr Pflicht der Pietät und der Denkmalspflege schien). Sie hatte dann, nachdem das letzte Küchenbord aus der Tür geschafft, die Wohnung verschlossen; dem Portier und dem Briefträger Verhaltungsmaßregeln für alle Eventualitäten gegeben; das Mädchen, das mit dem Staublappen hinter dem Mahagonikleiderschrank hergerannt war, endgültig entlohnt und mit Reisegeld unter Segenswünschen den Sommer über zu den Eltern in ihre Heimat nach Nakel an der Netze gesandt; und war langsam zum Bahnhof gepilgert, um nach Potsdam oder besser »bei Potsdam« hinauszufahren. Dorthin hatte sie auch Fritz Eisner bestellt. Denn als alleinstehende Frau fühlte sie sich Möbelleuten in etwas fortgeschrittener Tagesstunde nicht mehr gewachsen.
Man hätte ja auch Egi Meyers Hilfe hierbei in Anspruch nehmen können. Aber erstens hätte Hannchen nie geduldet, daß man ihren Bräutigam seiner wissenschaftlichen Arbeit – was für seltsame Bezeichnungen doch manche Leute für Schlafen haben – in der Vormittagszeit, die bekanntlich seine hierfür ergiebigste Zeit war, um eitler Nichtigkeiten willen entzogen hätte.
Zweitens jedoch pflegte Egi Meyer nicht einen Zug, sondern in der Regel drei Züge nacheinander zu versäumen. Und drittens war anzunehmen, daß er im Fall irgendwelcher Konflikte mit den Ziehleuten sich wortreich auf den Rechtsstandpunkt gestellt und den Ziehleuten auseinandergesetzt hätte, daß und warum ihre Ansichten und Forderungen selbst mit den unentwickelten Rechtsbegriffen der Ureinwohner Nordpatagoniens (siehe: Wilhelm Giesecke, Die Wiege des Rechts, pagina 373-392) nicht in Einklang zu bringen wären.
Da war Fritz Eisner schon eher für solche Dinge zu gebrauchen. Er war Schriftsteller und hatte deshalb nach der Meinung aller Leute überhaupt keinen Beruf und immer für sie Zeit. Daß er mehr Nächte in seinem Leben durchgearbeitet hatte als mancher Tage, zählte nicht. Zweitens war er schon älter, also männlicher von Erscheinung als Egi Meyer, der noch reichlich jungenhaft erschien. Und drittens und letztens war er von seinen Kaufmannsjahren her gewohnt, sich mit den Wirklichkeiten des Lebens auf einfache Weise auseinanderzusetzen. Und so war er beordert worden, gegen Mittag (eher konnte der Möbelwagen nicht draußen sein) »bei Potsdam« sich einzufinden und zu erscheinen.
Fritz Eisner war aber nun gerade der Meinung, daß es nötig wäre, daß er sich über einen Maler ausführlich vernehmen ließe, über den sich zu äußern damals noch nicht so die Pflicht eines jeden Kunstschreibers war, wie sie das heute ist. Überhaupt muß daran erinnert werden, daß Anno ehedem in Berlin die Kunst noch keineswegs so Mode war wie in unseren Zeiten, wo an jeder Ecke eine Ausstellung einer anderen Richtung ist und täglich dreimal an jeder Straßenbahnhaltestelle eine Versteigerung stattfindet. Trotzdem fühlte man sich ohne Kunst damals in Berlin wohler als heute mit ihr. Denn die Kunst war in Berlin zur Zeit noch durchaus keine Sache, die sich aufdrängte, sondern ein stilles, bescheidenes Blümchen war sie, das man suchen mußte, ein Reservat eines kleinen Hümpels von Menschen, die sich untereinander kannten, und die sich überall dort wiedertrafen, wo die Kunst in Berlin ihre paar Schlupfwinkel hatte. Die anderen Menschen ignorierten die Kunst völlig, hatten eine berechtigte Verachtung für sie und kamen nur in Harnisch, wenn sie sich etwa erfrechte, nicht das »Edle und Schöne« darzustellen, um das sie sich sonst den Teufel scherten, von dem sie auch nur sehr unklare Vorstellungen hatten, das sie aber zu diesem Behuf in Erbpacht genommen hatten.
Fritz Eisner hatte also beschlossen, über diesen Maler, den die Erbpächter des »Edlen und Schönen« noch ganz besonders in Verruf erklärt hatten, sich vernehmen zu lassen, nicht nur, weil er empfand, daß in diesem noch viel angefeindeten Manne einer der stärksten Maler der Gegenwart steckte, sondern auch ferner, weil er eingesehen hatte, daß Verlobtsein zwar ein äußerst angenehmer, aber auf die Dauer kein ausreichender Beruf sei. Und endlich, um den Leuten jetzt gerade zu zeigen, was er könne. Und außerdem war er überzeugt, daß die Menschheit auf ihn und diese seine Arbeit ganz besonders warte.
Er hatte sich also wider seine Art früh erhoben und diesen Mann aufgesucht. Der hatte ihn sehr freundlich empfangen, Bilder gezeigt, ihm Rede und Antwort gestanden – denn ein Künstler ist stets freundlich, wenn jemand über ihn schreiben will, und es mag der bescheidenste Anfänger sein. (Kleinvieh, sagt er sich, macht auch Mist.) Und durch diese Freundlichkeit irregeleitet, hatte Fritz Eisner sich bewogen gefühlt, dem Maler einen Einblick in seine persönlichen Verhältnisse zu gewähren und ihm strahlend zu erzählen, daß er sich versprochen, ja mehr als das: verlobt hätte. Und er war nun der Meinung gewesen, daß der andere sein Entzücken über diese Tatsache teilen würde. Aber der hatte ihm nur erzählt, wie er sich seinerzeit verlobt hatte. Der erste, dem er es gesagt hätte, wäre Menzel gewesen, aus der Promenade in Kissingen. Die kleine Exzellenz hätte wütend geknurrt, sich umgedreht und ihn ganz verdutzt stehen lassen. Darob enttäuscht, wäre er nach München gefahren und hätte von seinem Glück gleich brühwarm an Lenbach berichtet. »Zu solchen Sachen pflege ich nach zehn Jahren zu gratulieren“, hätte Lenbach gesagt. Sonst nichts. Und er, der Sprecher, hätte, durch Erfahrung gewitzigt, sich hierin jetzt Lenbachs Manier zu eigen gemacht.
Fritz Eisner beschloß bei sich, doch in der Würdigung des Malers – der Gerechtigkeit wegen! – eine gewisse Gemütskühle, die sich auch in der Tongebung seiner Bilder deutlich aussprach, nicht zu vergessen.
Und Fritz Eisner hatte sich weiter die Linden herunter in die schönen, still-feierlichen Räume des Kupferstichkabinetts begeben, um sich mit dem graphischen Werk seines Opfers noch mehr vertraut zu machen, das dort, in Mappen wohl verwahrt, in Schränken gut verschlossen, seiner harrte.
Dort aber saß an dem Pult der Assistent. Mit mächtigem, hängendem Schnauzbart unter einer gebogenen, amüsant beweglichen, großen und schmalen Nase. Kahl geschoren, mit dem kleinen Schädel auf dem großen Körper; ein Raunzer, ewig hilfsbereit dabei, unermüdlich für alle, die in irgendeinem Eckchen des großen Gebietes der von ihm betreuten Sammlungen etwas suchten; ein sarkastischer Herr, berühmt wegen seiner witzigen Grobheit.
Und da Fritz Eisner mit ihm gut stand, so konnte er sich nicht beherrschen, den anderen – gelegentlich einer Anfrage – von der letzten und neuesten Wandlung seines Zivilstandes in Kenntnis zu setzen. Wie gesagt, es war ganz still im Saal, der ziemlich voll war. Es war wie immer Kirchenstimmung. Und warum sollte das nicht sein, wo junge Adepten die Blätter Schongauers5), Dürers, Rembrandts und Goyas zum erstenmal mit klopfendem Herzen in der Hand halten durften? Man flüsterte nur, wandte Blätter, trat verzückt einen Schritt zurück. Selbst die Diener, uralt und freundlich, bewegten sich in Moderatissimo und schoben die auf Gummirädern leise gleitenden Wägelchen mit Mappen und Werken langsam und feierlich durch den langem Raum.
Aber der Herr am Pult da oben liebte es, diese Stimmung hin und wieder zu zerreißen. »Zum Donnerwetter!« brüllte er wie ein Waldesel, daß es von einem Ende des Raumes zum anderen dröhnte, und sah über die Gläser seines Kneifers von seinem erhöhten Sitz auf den armen Fritz Eisner, halb zornig, halb mit tiefem Mitleid, herunter. »Zum Donnerwetter, junger Mann, überlassen Sie derartige Dummheiten doch uns alten Eseln!«
Die Adepten aber blickten mit tiefem Mißmut nach Fritz Eisner, der durch offen verkündete Dummheiten ihre Andacht störte, so daß der es vorzog, alsbald ziemlich verdattert sich zu empfehlen.
Aber da es für seinen Zug noch zu früh war, so beschloß er vorerst noch einmal einen ihm wohlgesinnten Herrn, Kunstfreund, Sammler und Kunstschriftsteller aufzusuchen, der ihn gern bevaterte und mit seinen Kenntnissen und Büchern unterstützte, um bei ihm den neuen Monet zu betrachten und an seinen wohlgemeinten Glückwünschen sich von den Schicksalsschlägen des Vormittags zu erholen.
Er hätte es nicht tun sollen. Denn der Herr, der es liebte, Leuten den Kopf zurechtzusetzen, es sozusagen bei seinen jüngeren Freunden und Bekannten, die er unter seine Fittiche genommen hatte, beruflich betrieb, putzte – er war auch gerade ein wenig nervös, denn er hatte selbst etwas auf den Tag abzuliefern, und so etwas macht nervös – putzte Fritz Eisner herunter, als ob er silberne Löffel gestohlen hätte, als dieser ihm so nebenbei und hintenrum mit der Neuigkeit kam.
Hatte der vorher nur von einer Dummheit gesprochen, so erklärte er es für einen glatten Wahnsinn, der seine Existenz, sein Künstlertum, seine Entwicklung, alles zunichte mache und ihm Sorgen aufbürde, denen er nicht gewachsen sei.
Das einzig Schmeichelhafte für Fritz Eisner war, daß der andere auf Goethe exemplifizierte, der sicher nicht Goethe geworden wäre, wenn er in einem so lächerlichen Alter wie Fritz Eisner daran gedacht hätte, sich für sein Leben zu binden.
Und ehe Fritz Eisner es sich versah, stand er mit ein paar Zigarren in der Hand, die ihm von dem etwas cholerischen Herrn gleichsam als Trostpreis schnell zugesteckt worden waren, wieder vor der Türe.
Und als Fritz Eisner nun langsam durch die sonnige Straße zwischen Kindern, die Murmeln spielten und Kreisel schlugen und Himmel und Hölle sprangen – denn dadurch macht sich in Berlin der Frühling bemerkbar – zum Bahnhof schob, hatte er genugsam Muße, darüber nachzugrübeln, warum kluge ältere Männer doch ganz anders über manche Dinge dächten als die zunächst Beteiligten.
Der Zug war ziemlich überfüllt, und im Abteil war ein wenig Familienstimmung. Der schöne Tag – viel hatte es noch nicht davon gegeben – hatte die Menschen mitteilsam gemacht.