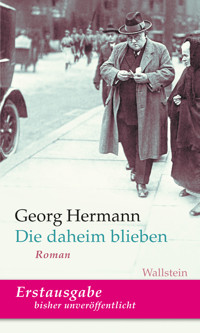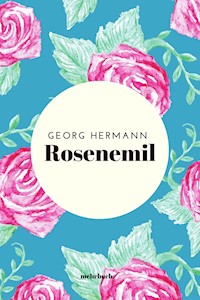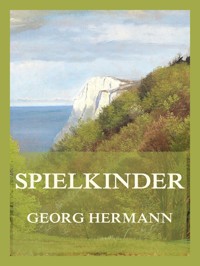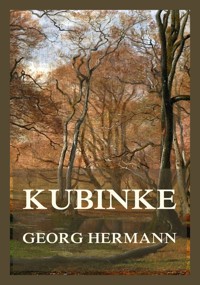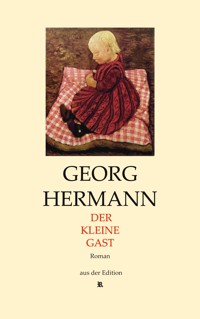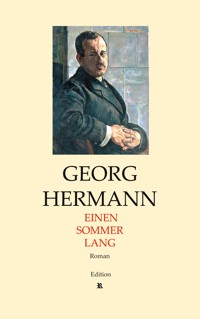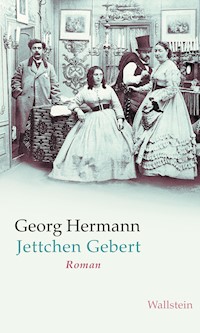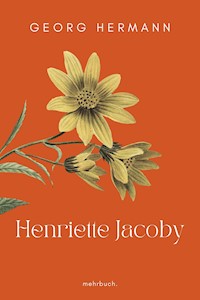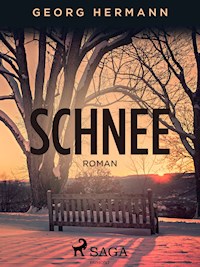Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Der Schall ist immer da. Richtig! Die Bilder sind immer in dem Spiegel. Sie werden ständig in das All von ihm geschleudert. Sicher! Und wenn ihre Schwingen eben wieder auf eine geeignete Empfangsstation für die gleiche Wellenlänge treffen, dann sind es wieder Bilder, dann sind es wieder Worte." Rom im Jahre 1935. Harry Frank, der alternde "Held" des Romans, kauft an einem Andenkenstand die Replik eines alten etruskischen Spiegels. Oder ist es vielleicht doch ein Original? Auf alle Fälle hat es mit dem Spiegel eine besondere Bewandtnis, denn er scheint Frank seinen eigenen Tod und noch vieles mehr vorauszusagen ... Der vielschichtige Roman legt mehrere Erzählschichten kunstvoll übereinander und verbindet sie auf raffinierte Weise: Da ist die Geschichte von Harry Frank, der wie der Autor selbst als Jude aus dem nationalsozialistischen Deutschland geflohen ist, da ist überhaupt die zeitkritische und autobiografische Ebene der Aufzeichnungen des Autors im niederländischen Exil, da ist Harry Franks traurig-unheilvolle Liebesgeschichte, in der besagter Spiegel eine tragische Rolle spielt, da ist das römische Reisebild aus der Zeit Mussolinis, das die Stadt Rom nicht nur in Harry Franks Augen spiegelt, sondern zitathaft auch römische Reisebilder von Goethe und Stendhal bis Taine und Otto Julius Hartleben aufschimmern lässt ... Die Geschichte von Harry Frank, der in Rom eine späte Liebe findet, zugleich aber auch eine geheimnisvolle Prophezeiung vom Untergang der abendländischen Welt erfährt, vereint noch einmal alle wichtigen Motive im Werk von Georg Hermann, jenem leider allzu vergessenen Lieblingsautor von Sigmund Freud, dessen umfangreiches Werk nun wiederentdeckt wird. 1936 im holländischen Exil geschrieben und nur dort veröffentlicht, ist "Der etruskische Spiegel" Hermanns letzter Roman. Sieben Jahre später wurde er in Auschwitz ermordet.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Georg Hermann
Der etruskische Spiegel
Roman
Saga
Der etruskische Spiegel
© 1936 Georg Hermann
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711517284
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com - a part of Egmont, www.egmont.com
Herausgegebenund mit einem Nachwortvon Gert Mattenklott
Dem Andenken meines Bruders,des Architekten Heinrich Borchardt,gestorben in Rom 1935
Urmutter Meer,
Aus der mein Leben kam,
Das tausendmal ein Gott
Zurück mir nahm.
Das immer wieder ich geschenkt bekam,
Als winzig Korn, das alles mit sich nahm,
Und blühte auf in einer Mutter Schoß,
Klein, arm, behütet, wurd’ es langsam groß,
Ward müde, frierend, leise, alt und kalt,
Und schwand dahin in wechselnder Gestalt,
Als Wurm, als Fisch, als Lurch, Millionen Jahre lang, –
Bis es als Mensch sein tiefstes Elend sang.
* *
»Jawohl, mein Herr, in meinem Paß«, – und er wollte ihn gerade wieder wegstecken –, steht, wie alt ich bin. Und außerdem, wie ich heiße. Zwei Dinge, die doch keinen Menschen, es sei mich selbst, etwas angehn. Aber Behörden sind nun mal überall indiskret und neugierig und behaupten, daß so ein Paß heutzutage notwendig ist. Ohne diesen hier wäre ich also tot, auch wenn ich noch im Leben wäre. Und mit einem abgelaufenen Paß wäre ich immerhin schon scheintot. Mit einem Paß ohne Visum läge ich jedoch nur erst im Sterben und wäre aufgegeben. Aber dank dieses kleinen braunen Büchleins hier bin ich ja also noch wirklich behördlich am Leben. Gottseidank oder leider Gottes. Je nachdem, von welcher Seite aus man es betrachten will.
›Sehr, sehr komische Welt das!‹ dachte er wieder, denn eben war gerade zum drittenmal innerhalb 24 Stunden sein Paß: »Passaporti Signori, les passeports s’il vous plait!« von einem schwarz behemdeten, aber höflichen Mann ernstlich beäugt worden, einem, der in berufsmäßiger Würde, mit Italienertum und Faschismus multipliziert, von Coupé zu Coupé, von Abteil zu Abteil, den Gang des überfüllten D-Zuges entlang wandelte. ›Sehr, sehr komisch, diese Welt heute!‹
Die meisten kennen’s ja nicht anders. Aber früher, so vor dreißig oder bald vierzig Jahren, fragte einen hier doch keine Katze nach einem Paß. Überhaupt niemand nirgendwo, und wenn man selbst nach Amerika fuhr. Man besaß einen solchen Paß da vielleicht, genau wie die bürgerlichen Ehrenrechte; verlor ihn auch – denn das kostete Geld – genau wie die bürgerlichen Ehrenrechte (die zwar kein Geld kosteten) ungern, wenn man ihn einmal sich hatte ausstellen lassen. Aber man machte doch keinen Gebrauch davon. Höchstens wenn einem das Reisegeld ausgegangen war und man den Konsul anpumpen wollte. Genau so, wie man als anständiger Mensch aus guter Kinderstube, der etwas auf sich hielt, von den bürgerlichen Ehrenrechten keinen Gebrauch damals machte. Politik galt als unfein.
Jener, der dieses lautlose Zwiegespräch mit sich selbst führte, schob also, wie das seine Art war, seinen schiefhängenden Kneifer etwas auf den Nasenrükken herunter und sah dann nochmals, wie aus alter Anhänglichkeit, in den Paß hinein, ehe er ihn sich sicher zwischen Ansichtskarten aus Orvieto ... die ihn von der Frühe aus dem Dom her an bronzegrüne Gliedmaßen und eisenharte Asketenköpfe Signorellis erinnerten ..., zwischen denen und einem bescheidenen Päckchen von bescheidenen Lirescheinen (das größere war im Brustbeutel!) in seine Brieftasche wieder vorsichtig verstauen wollte.
Also ganz vorzüglich! In so einem Paß steht doch alles drin. Einfach alles. Wann man geboren ist, steht da! WO man geboren ist, steht da. Welcher Nationalität man ist, steht da. Und welcher nicht, steht auch da. Welchen Beruf man hat sogar. Alles! Nur die Religion ist aus Zartgefühl verschwiegen und unterschlagen. Ganz recht auch. Nun frage ich in aller Welt: Was geht denn das auch die Leute, den Staat oder sonst jemand an?! Alle Bürger und alle Glaubensbekenntnisse sind ja vor dem Staat gleich und gleichberechtigt. Und dann steht fürder nicht darin, ob man verheiratet, unverheiratet oder Witwer ist. Gibt es noch eine vierte Möglichkeit? Ach ja: Geschieden! Ich habe, solange ich denken kann, für Gruppe 2 votiert. Früher hat’s mir oft leid getan. Heute bin ich froh deshalb. Ich belaste nicht gerne andere Leute mit meinen Sorgen: Und vor allem dann nicht, wenn ich sie lieb habe. Allein ist man letzten Endes (im doppelten Sinne!) immer abkömmlich. Allein ist man freischwimmendes Individuum, verheiratet ist man festgewachsen wie eine Entenmuschel an der Schiffsplanke. Der Junggeselle lebt wie ein Mensch und stirbt wie ein Hund, und der Ehemann lebt wie ein Hund und stirbt wie ein Mensch; und da man lange, viel zu lange Zeit lebt und kurze Zeit einmalig und unwiderruflich nur stirbt, ist das erste dem zweiten vorzuziehen. So was kann doch nur ein Franzose sagen; und dann auch wieder wohl nur Maupassant.
Also »ledig« haben sie bei mir unterschlagen, aber wen geht es auch etwas an? Wie gut, das Wort »ledig«. Ledig heißt frei, befreit; der Sorgen ledig, sagt man, der Fessel, der Ketten ledig.
Ja ... aber ... ist denn das andere alles richtig, was da steht?
Der Beruf stimmt doch zuerst schon mal nicht. Denn mein Beruf ist es ja gerade, keinen Beruf mehr zu haben, aber früher einen gehabt zu haben. Und warum die Religion nicht im Paß steht, begreife ich ja beim Zeus auch nicht! Denn wenn sich niemand zu Hause um meine Religion gekümmert hätte, wäre ich nicht hier, wo ich jetzt bin, sondern wäre mit leidlicher Bestimmtheit wohl noch dort, wo mich meine Nationalität hingewiesen hätte, sofern ich nicht sowieso mal wieder, wie so manchmal schon um diese Zeit, nach »Romchen« gefahren wäre und dann eben doch da wäre vielleicht, wo ich jetzt bin. Aber ich bin in so etwas nun mal merkwürdig. Ich lasse mir das nicht gefallen. Nachdem ich in meinem lieben Deutschland über sechzig Jahre als besteuerter Bürger zweiter Klasse gelebt habe, wünsche ich nicht den Rest meines Daseins von Hitlers Gnaden als besteuerter Bürger elfter Klasse zu verbringen. In so etwas gibt der Klügere nach, vor allem noch dann, wenn er der Schwächere ist, und weicht aus. Adio, mich seht Ihr nicht wieder da oben. Außerdem sind mir Eure Winter zu kalt. Wärmbde! Wärmbde! Gewiß, Ihr habt nicht viel an mir verloren, aber ich an Euch noch weniger. Also ich bin persönlich dagegen, daß man mir persönlich zwei S. A.-Leute vor die Tür stellt, wie das geschehen ist, damit niemand zu mir hinaufgehe, um sich eine Villa von mir bauen zu lassen. Einfach vor meine Tür stellt man zwei S. A.-Leute zehn Stunden lang. Nur deswegen, weil ich da aus alter Gewohnheit noch von früher her mein Schild neben der Haustür habe hängen lassen, das erzählte, daß ich »Architekt« bin. Wozu eigentlich diese bösartige Energieverschwendung?! Es hat sich ja auch so schon längst kein Hund mehr eine Villa von mir bauen lassen, nicht mal eine Hundehütte. Ich war ja nur noch ein Quasiarchitekt. Das war abgelaufen seit Jahren. Denn in Deutschland, und gar in Berlin erst, lagen wirklich die Villenaufträge nicht mehr so auf der Straße herum. Fünfzig Architekten kamen immer auf eine Villa, die gebaut werden sollte, statt ein Architekt auf fünfzig Villen. Und dann, dann: die anderen waren vielleicht nicht besser, aber jedenfalls jünger und fixer, moderner, wie es heißt, als ich. Ich komme noch aus der Zeit von vor der Pralinéschachtelmode! Und vor allem hatten sie auch die besseren Beziehungen. Je älter ein Mensch wird, desto schmaler wird die Insel, auf der er lebt. »Ja und dann?« Er schob den Kneifer, der keine festen Tendenzen hatte, wieder zurecht und blätterte in seinem Paß. Dann das da »Statur mittelgroß« ist auch schon übertrieben. Es kommt mir immer so vor, als ob ich schon wieder kleiner werde. »Augen dunkelbraun!« Ach! Haben auch etwas an Farbe eingebüßt, kriegen sogar schon ganz feine graue Ränder um die Iris.
»Haar schwarz meliert«, stimmt schon wieder nicht mehr. Ich würde zum mindesten nicht das Haar, sondern eher seinen Mangel als ein wichtiges Erkennungszeichen rechnen.
Besondere Merkmale »Keine«! Stimmt noch weniger. Denn, wie will man mich sonst von jenen Hunderttausenden von Menschenklischees, die auch über keine besonderen Merkmale verfügen, unterscheiden?! Und die Paßfotografie hier, die ist geschmeichelt und viel zu jugendlich. Aber der würdige Mann im Schwarzhemd hat sie mir doch, wenn auch erst zweifelnd, geglaubt. Auf Paßfotografien decouvrieren sich die meisten Minister als Raubmörder und alle Gräfinnen als Dienstmädchen; ich aber hier als: ... als ein Gentleman von vierzig Jahren. Also – von mir aus würde ich ja ganz gern ein oder zwei Jahrzehnte meines Lebens vermissen. Und eventuell sogar abschwören. Aber welches oder welche? Da ich an die ersten beiden nicht allzu angenehme Erinnerungen habe und an die beiden letzten nur unangenehme, so würde ich eigentlich diese vorziehen.
Komisch, wenn ich mal den Leuten beichte, wie alt, wie uralt ich bin, so tun sie erstaunt und sagen, daß sie mir ohne weiteres ein oder gar zwei Jahrzehnte abgeschrieben hätten. Und außerdem setzen sie dann höflich hinzu und, um mir etwas Tröstliches zu sagen – denn ich bin schon in dem Alter, wo einem die Leute, weil’s doch nichts kostet und zu nichts verpflichtet, und weil man ja doch nicht mehr zählt ... sogar die Damen! gerne etwas Angenehmes sagen, – setzen sie hinzu, es käme ja gar nichts darauf an, wie alt ein Mensch wäre, sondern nur darauf, wie alt er sich fühle. Womit sich die Sache bei mir nur noch schlimmer macht. Denn ich kann ihnen doch nicht ewig in die Ohren brüllen: »Aber liebe gnädige Frau, dann wäre ich ja hundert Jahre oder vielleicht sogar Zweitausendfünfhundert.« Vor fünf Monaten hätte ich das vielleicht noch nicht gesagt. Aber das habe ich jetzt eingesehen: Leben, nur um zu leben, ist langweilig und eine verdrießliche Beschäftigung und macht noch älter. Also: Gott! ... Eigentlich habe ich mich doch mein Lebtag danach gesehnt, mal nichts zu tun. Das heißt, nur das zu tun, was mir, wie man so sagt, Freude bereitet. Und nun, wo ich das seit geraumer Zeit tue und zwischen den schönsten Dingen der Welt hin und her flattern kann, sehe ich plötzlich den Sinn davon nicht mehr ein. Verstehe nicht recht, warum ich es tue und wozu ich immer noch Dinge in mir aufspeichere. Nachher stirbt man und kann es nämlich doch nicht weiter brauchen.
Naja ... wer durch über dreißig Jahre gewohnt war, daß das, was ihm aus den Händen wächst, zu Stein und Mauern und bleibenden Gebilden wird, daß es, ob gut oder schlecht, doch da ist, vorhanden ist, nicht wegzuleugnen und wegzudenken ist ... auch wenn es tausendmal anonym bleibt, wie die Arbeiten von Tausenden von andern ..., der paßt sich wohl nur schlecht noch zum bloßen Daseinsbeschauer, auch wenn er mit Aquarellkasten und Skizzenbuch durch die Welt zieht. Also zu blöd: Mein ganzes Leben habe ich mich danach gesehnt, meinen Neigungen zu leben und in Ruhe mir die Dinge anzugucken, an denen ich früher nur vorbeigeflogen bin. Und heute, wo ich es tun kann, möchte ich doch lieber Schweineställe bauen. Die alte Geschichte mit dem Kalbsbraten. Wenn man jung ist, hat man Appetit, gute Zähne und keinen Kalbsbraten, und wenn man alt wird, keinen Appetit, keine Zähne und Kalbsbraten. Aber endlich fängt doch die wahre Peinlichkeit und Tragik erst an, wenn man alt wird, keine Zähne, wohl aber Appetit, jedoch keinen Kalbsbraten hat. Gut, daß man da wenigstens keinen Anhang hat. Naja, vorerst ging es ja noch. Er hatte da mal irgendwie Glück gehabt, eine Konkurrenz gewonnen für das Direktionsgebäude für eine Schokoladenfabrik in Vevey – wenn er auch den Bau nicht gekriegt hatte, denn den bekam natürlich ein Schweizer Architekt – so hatte er doch den Preis bekommen und ihn vorsorglich gleich draußen gelassen. Immerhin, die guten Schwyzer Franken nahmen doch auch mal ein Ende ... Aber wann? Und was dann? Alte Menschen stellen sich schlecht um. Die Hauskatze, deren Napf immer gefüllt war, tut sich schwer, wenn sie plötzlich Mäuse fangen soll, vor allem, wenn es keine Mäuse gibt. Aber wer wird hier unten an das nächste Jahr oder das übernächste Jahr denken? Bei Leuten meines Alters pflegen sich erfahrungsgemäß Akten solcher Art meist, zumeist mindestens, indessen auch von selber zu erledigen. Jetzt bin ich hier, und jetzt komme ich also in einer Stunde wieder in Rom an. Das habe ich seit fünf Jahren nicht mehr getan. Es ist, nach Stendhal, ein uralter Brauch affektierter Leute, daß sie bei der Ankunft in Rom tief bewegt werden. Hartleben schrieb sogar: ›Rom ist keine Stadt, sondern eine Gemütskrankheit.‹ Ich habe damals gesagt, wie ich zum ersten Mal hier war, daß Rom die stärkste Enttäuschung meines Lebens gewesen sei. Ich widerrufe es hiermit feierlich: die war der Mensch überhaupt! ... und nachher bin ich doch gleich drei Monate in dieser Enttäuschung sitzen geblieben. Wie oft war ich hier? Ich glaube, acht Mal. Ein alter Romano di Roma. Mit Rom geht’s einem wie mit der Liebe und mit der Kunst, den Frauen, der Naturwissenschaft, dem Englischen, seinen Freunden ... wenn man welche haben sollte ... nach vierzehn Tagen weiß man genau mit ihnen und um sie Bescheid, und nach vierzehn Jahren weiß man weniger von ihnen, als man am ersten Tage zu wissen glaubte. Eigentlich ist es für einen letzten Augusttag gar nicht so heiß mal. Wenn der Zug fährt, kommt durch die flatternden Gardinen, die wie Segel knattern, ein ganz angenehmer Luftzug hinein und kühlt sogar die grünen, verstaubten Polster der Sitze und bläst durch die Maschen der Kantentücher, an die man doch nicht den Kopf anlehnt. So alte Eisenbahnwagen haben noch immer etwas von der verschollenen Eleganz der siebziger Jahre. Und wir da oben haben noch immer eine ganz falsche Vorstellung von einem italienischen Sommer. Im allgemeinen ist überhaupt der Italiener gegen Hitze viel empfindlicher und gegen Kälte viel unempfindlicher als wir da oben. Das muß man, wenn man hier unten lebt, umlernen, wie so manches andere auch.
Jetzt also fängt Rom an. Dieser lehmige und langweilige Fluß ist der Tiber schon. Mit seinen dünnen Schilfrändern und dem kargen grauen Buschwerk am Ufer. Das berühmteste und langweiligste Gewässer dieser alten Erde, ohne einen Schimmer von Idyll an seinen grasigen Ufern.
Ohne Dörfer, die sich in ihm spiegeln, ohne Städtchen an malerischen Wehren, vor denen Enten plantschen. Fast ohne Brücken, fast ohne ein Haus in seinem Umkreis. Höchstens eine Wellblechbude mit Gazefenstern und eine Gendarmeriestation, um die schwarze Schweine wühlen. Und wie armselig die Hügel, die zum Fluß abfallen mit ihren paar mageren zerfetzten Ölbäumen und ihren ausgewaschenen Runzen, durch die das Wasser, der Regen, seinen Abfluß zum Strom sucht! Die Ortschaften auf den Höhen liegen weit zurück, sehen kaum herüber mit ihren quadratischen Schachteln, in denen sie um die Kuppen aufsteigen.
Der schönen Aussicht wegen werden sie sich da oben auch nicht angebaut haben, sagt Taine. Hier vorne höchstens mal ein verfallener Turm – was mag es sein? Römisch, etruskisch oder Mittelalter? Man kann das im Vorbeifahren so wenig bestimmen wie Blumen. Oder ein halb gebrochener Steinbogen, um den Ziegen, braun und langhaarig, klettern und das bißchen Grün aus den Fugen und Ritzen zupfen. Vielleicht haben wir von diesem Hügel schon in der Schule gelernt, daß auf ihnen Samniter, Sabiner, Etrusker oder sonst wer wohnte, mit denen sich Tarquinius Priscus, Ancus Martius, Tullius Hostilius ... sich schon herumschlug, weil sie sich nicht unter Roms Oberhoheit stellen wollten. Mit wechselndem Glück, das, so oder so, zum Schluss, und darauf geht’s zusammen, kommt es einzig und allein an! – immer auf der Seite der Römer war und mit einem Triumphzug – den haben sie auch von den Etruskern abgeguckt, genau wie die Fasces, die Decemvirn, die Liktoren, den Bronzeguß und wer weiß was noch, diese Räuberbanden, selbst die Frauen haben sie ihnen gestohlen – also mit einem Triumphzug für den Römer und dem tarpejischen Felsen für die andern endete.
Und diese Campagnabüffel, weiß und doch leicht angeschmuddelt, wie das Bett in einer billigen Fremdenpension auf Ischia und mit den riesigen Hörnern wie zwei Sensen auf der breiten Stierstirn, diese Büffel- und Pferdeherden auf den endlosen Weiten, mit den niedrigen zertretenen Grasfeldern, aus denen gelbe und violette Blumen schimmern ... Oh, sicher waren sie nicht anders, als man hier auf sie bukolische Gesänge dichtete! Ein paar Zypressen umstehen einen kleinen Friedhof in einer Schlucht und drei Pinien da oben sind schon groß, richtige römische Pinien wie die vom Monte Mario und aus dem Borghesegarten; das sind die schönsten in Rom. Wie grüne Gewitterwolken schweben sie da über dem Hügelrand. Und die Einsamkeit dazu, die Sonne, die fast menschenlose Öde. Bis zu den violett schimmernden Bergen, da ganz hinten nach dem Meer zu. Die Campagna ist wie Absinth, erst schmeckt er bitter und scheußlich, und nachher kommt man nicht von los. Wie sich doch eigentlich in einer Stunde die Welt verändert hat. Da um den trasimenischen See herum, da vom Dom im Orvieto heute früh, da war alles noch grün und saftig. Die Hügel, die Kuppen, alles grün und saftig bis in die blauschimmernden Fernen hinein. Die Schmetterlinge flogen. Aber alles war gewiß Italien, und es war doch noch dabei wie ein verfeinertes hingeträumtes Thüringen, nur mit ein paar dunkeln Flecken von Lorbeern und Zypressen dazwischen und einer verirrten Tanne darin. Wo sind auf einmal in den Wiesen die kleinen durchscheinenden lichten flirrenden Pappelwälder mit den Bächen hin? Wo, mit den bösartigen Kastellen über sich gegen den Himmel, die grauen Städtchen auf den Höhen, die geschachtelten, die winzigen, die man immer für das nächste Mal sich vornimmt zu sehen, und in die man doch nie hinkommen wird? Wo all die hübschen Villen, diese Sommerpalazzi des alten Reichtums, mit den Säulenhallen davor, ganz einsam mitten im Land, die, gelb, mattblau oder ocker und rosig, stundenweit durch die Landschaft von den Höhen bis zu den allerfernsten am Abend ganz violetten Hängen hin, zwischen den Ulmen und Zypressen weithin durch die Landschaft und durch die klare florentinische und umbrische Luft herüberleuchten? Und die in einem die Illusion erwecken, daß noch auf jeder von ihnen da jetzt unter den Gästen eine Novelle des Dekamerone erzählt grade werden könnte, oder vielmehr in diesem Augenblick spielen könnte? Wo plötzlich diese ganze weiche Üppigkeit von Wein, Mais und Maulbeeren, diese roten Tomatenhügel, zwischen denen die Truthahnherden trippeln?
Rom ist nicht an einem Tage, aber auf sieben solchen langweiligen Hügeln, ähnlich wie die da, erbaut worden.
Ich habe es nie begriffen, wie aus dieser Öde, unbewohnbar und unbestellbar, eine Weltstadt wachsen konnte, die die ganze Erde, soweit sie bekannt war, und soweit sie ihnen, wie Germanien jenseits des Limes, nicht zu barbarisch und unzivilisierbar erschien, langsam auffraß und langsam umformte. Gewiß großartig, aber rigoros umformte; bis sie zuletzt, wie eine Spinne nur noch mitten im Netz saß und wartete, an welchem Faden jetzt noch eine Fliege zappelte, die sie abwürgen konnte. Zu merkwürdig, so etwas! Denn fiebrig war es ja auch noch überall hier herum, keineswegs gesund wie in der Toskana und Umbrien. Fiebrig, fast bis Neapel herunter. Überall war es fiebrig, selbst zwischen den sieben Hügeln gabs ehedem Sümpfe mal und Fieber. Sogar im Mittelalter war einmal Rom halb ausgestorben vor Fieber. Nur die Juden blieben noch da ... nicht einmal die Päpste mehr. Und das trinkbare Wasser war Meilen und Meilen fern. Bestimmtamento kann also das alles nur aus Verzweiflung geschehen sein. Es blieb ja den armen Leuten auch gar nichts anderes übrig, als anderswohin zu gehn, Weltgeschichte zu machen und die Welt zu unterjochen, wenn sie mit ihren ledernen Bürgertugenden, den catonischen (Lucretia war ja auch eine Römerin, die es mit ihrer Tugend nicht so genau nahm ... und Tarquinius ... oder irre ich mich da? ... ein Etrusker) ... wenn sie nicht jeden Tag dreimal Selbstmord vor Langeweile begehen wollten. Deshalb ist sicher der Römer so finster, so unangenehm, solch vorzüglicher Mörder und Gesetzmacher gewesen. Ein nüchterner Bursche, ein doktrinärer, ein verläßlicher Beamter mit hartgekochten Tugenden, und mit Göttern ohne Liebschaften und Schwächen, denen alles Menschliche fremd war. Zu eigentümlich: solange die Römer nur skrupellose Mörder und Kulturvernichter waren, haben sie eine Ia in dem Zensurenbuch der Geschichte bekommen. Und sowie sie anfingen, Menschen zu werden, unter Augustus schon bis weit über Marc Aurel hinaus, sprechen diese Esel von Historikern von Verfallzeit und geben ihnen, weil sie begannen, die Sklaven freizulassen, weil sie gern procul negotiis in Ruhe auf dem Lande lebten ... odi profanum et vulgus ... weil sie Kunst sammelten und dichteten und selbst zu filisofieren begannen und fein und abgeklärt wurden, da geben sie ihnen eine 5. Und die blonden Horden, die Goten und Vandalen, die Bilderstürmer, die alles zerschlugen, diese Stiere im Porzellanladen einer alten Kultur, die sinnlos mordeten, die bekommen, weil sie nichts mitbrachten und niemandem etwas schenken konnten, nun wieder eine Ia mit Sternchen. Geschichte ist nämlich eine Wissenschaft. Geschichte ist Quatsch, sagt Henry Ford. Ich kann doch hier nie entlangfahren, ohne mir vorzustellen, was hier Tag und Nacht in Hitze und unter Sternen und in dem Schein des Vollmonds, der die Aquädukte als tiefschwarze Schatten auf die Felder zeichnete, was hier in bald drei Jahrtausenden alles entlang gezogen ist. Über jeden Zoll Boden sind die Legionen gestampft. Die Karren der Völkerwanderung ihre Radspuren gezogen. Die Gäule der Hunnen ihre Hufe gedrückt. Die Karthager Hannibals klein und braun, die Gallier des Brennus, die Gefangenen aus Tausenden von Kriegen und Scharmützeln gesenkten Kopfes, die Sklaven aller Länder, die Ägypter und die Syrier. Parfümierte Graeculi, die Stellen als Hauslehrer suchten; Cherusker, die sich als Legionäre verdingen wollten. Leute aus Klein- und Großasien, Hannibals und Pyrrhus’ Kriegselefanten mit den schwankenden Türmen auf dem Rücken, die Widder und die Katapulte und Ballisten und die Kriegsmaschinen, Cicero in seiner Sänfte. Die Maler und die Bildhauer, die die Hoffnung auf Aufträge zu den Kardinälen und in den Vatikan lockte. Die Hohenstaufenzüge und die Schwyzer Landsknechte des Sacco di Roma mit ihren Hellebarden, die sie bald darauf wie eine Saufeder den jungen römischen Edelleuten in den Leib rennen sollten, um unbehindert beim Plündern zu bleiben. All das und tausendmal mehr ist über jeden Zoll hier hingestapft. Von diesen Bergkuppen da neben mir haben sich langsam die Etrusker von Jahrzehnt zu Jahrzehnt zurückgezogen, haben einen Posten nach dem anderen räumen müssen, bis ihre Kultur vor der Macht dieser besseren Mörder zusammensank und die Mörder selbst besiegte, wie sie von jenen besiegt worden war. Und heute sind da ein paar Büsche in der Sonne, ein paar Ziegen, die die Grashalme aus einem gebrochenen Bogen zupfen, von dem niemand ahnt, ob er mal zu einer Villa, einem Wachturm oder einem Stück Befestigung gehörte. Heute ist da Einsamkeit, eine Wellblechbude, und eine Carabinieristation, die wohl nötig ist, denn was hier so in den Hütten lebt, soll immer noch, trotz Mussolini, gewohnt sein, sich bei Auseinandersetzungen eher auf sein Messer als auf sein Wort zu verlassen.
Niemand versteht also, und ich ganz besonders nicht, wie hier so was wie dieses Rom fünfzig Kilometer weiter erwachsen konnte. Aber eines muß ich dafür zugeben. Die Sache mit dem Himmel haben sie aber hier schon wieder raus. Da oben in Florenz, da hat der Himmel immer noch etwas davon, wie wir es kennen über dem Wannsee, wenn auch nur in den allerglücklichsten Tagen des Jahrs. Er ist doch immer noch mit Aquarellfarben gemalt, und mit einem letzten Spürchen von Kremmer Weiß gemischt ... Aber da zwischen den beiden Pinien auf dem Hügel, das ist schon echter Pincio wieder. Sattgrün und sattblau aus schweren Tuben von Ölfarbe hingepatzt. Und da durch diesen Bogen sieht schon das tiefblaue, unergründlich blaue Auge des Jupiter wie durch einen der Bogen, wie durch eine der hohen Nischen des Kolosseums. Eines muß man ihnen ja zugeben: Vielleicht hat sie überhaupt nur der Himmel dazu bestimmt, sich hier anzusiedeln. Der romanische Himmel, der Himmel über der Campagna. Und die Abendwolken über den Campagna. Und die Abendwolken und die Gewitterwolken über der Campagna. ›Die Sache mit dem Himmel haben sie raus‹, würde man bei mir zu Hause sagen. (Was heißt zu Hause? habe ich denn ein Zuhause? Dreißig Millionen Deutsche sind im Laufe von 100 Jahren aus Deutschland hinausgegangen, aber wenn man einen deutschen Juden zwingt, herauszugehen, ist er natürlich ein Ausgewichener, ein Flüchtling, ein vaterlandsloser Bursche, der seiner geliebten Heimat, der er so zu Dank verpflichtet ist, untreu wird, um Greuelpropaganda zu treiben. Was heißt Vaterland? Ubi bene, ibi patria, haben dreißig Millionen Deutsche vor mir gesagt. Aber wenn ich ... ach, wozu sich ärgern? Gewiß man kann – das war wohl Danton, der nicht fliehen wollte – sein Vaterland nicht sich an den Stiefelsohlen mitnehmen. Ich jedenfalls weiß also, daß ich dort war, wo man sagte: schon mein Ur-Ur-Urgroßvater war dort und hat gewiß nicht viel anders gesprochen als Berlinerisch. Dort, wo man mal sagte: Die Sache mit dem Himmel haben sie hier raus. Bah, jetzt zieht also dieser Lausejunge da, weil die Sonne es wagt, ihm auf das Buch zu fallen, den Vorhang zu. Keinen Blick hat er die ganze Zeit von seinem Buch aus dem Draußen gegönnt. Also wirklich, ich möchte die Bücher von Wallace zwar nicht geschrieben, geschweige denn gelesen, aber in Italien verlegt haben. Von den drei Männern in meinem Coupé liest jeder einen anderen Band von Wallace, und der junge Herr da mit den gelben, narbigen Lederhandschuhen, der kleine fünfzehnjährige Schnösel, liest den vierten. Aber er hat vorhin gleich zwei Bände heraus aus seinem blauen Lackköfferchen genommen. Wohl einen fürsichtig schon für sein siebenjähriges Schwesterchen Berenice, das aber vorerst es vorzog, auf dem Schoß der Mutter einzuschlafen. Trotzdem – wundervoll ist der Bengel. So was sieht man bei uns gar nicht. Wirklich, auch eine wunderherrliche, ganz dunkle, schwere Frau. Fast zu schön für Italien. So etwas könnte man in Spanien antreffen. Der eine Wallace heißt »Der rote Kreis« und der andere »Die Zahl 17«. Irresistibile auf dem Deckel, »unwiderstehlich«. Aber den liest der andere, mein Nebenmann. Er hat zwar einen alten, schäbigen, hundertmal überlackierten Lederkoffer, der, weil seine Schlösser kaputt sind, mit Stricken zusammengebunden ist. Kein Dienstmädchen würde bei uns (warum bei uns?!) mit ihm mehr umziehen, aber der da hat dabei vier Brillantringe nebeneinander, außerdem ein Monokel, und eine goldene Armbanduhr breit wie ein Schild.
Er will aussehen – das ist so der Typ – mit seinem verwüsteten Gesicht, das von Säbelhieben modelliert zu sein scheint, wie ein ehemaliger Offizier, weil er gewiß einmal Offizierstellvertreter im Krieg in Florenz auf dem Bahnhof war und nun vor der Öffentlichkeit um vieles peinlicher angezogen ist als nötig, damit diese Tatsache nicht in Vergessenheit gerate. Seltsam, ich habe das bisher immer nur für eine heimische Spezialität gehalten, aber der Krieg hat doch in der ganzen Welt solche Narren gezüchtet.
Ja, und die beiden anderen neben mir, das werden so Treuhänder sein oder technische Beamte, die ein paar Maschinen abgenommen oder aufgestellt haben. Je nachdem, ob in ihren Aktentaschen außer Wallacebänden Bilanzen oder blaue Pausen von Schwungrädern und Motoren liegen. Ich habe nur von den beiden Wallacebänden Kenntnis genommen. Der Schwarze nickt immer ein über seinem Wallaceband, und sowie der Zug anhält, schreit der andere: »Roma!« und springt auf und reißt seinen Koffer vom Netz herunter, und der, der Schwarze, der Müde, gähnt, reibt sich die Augen, streckt sich wie eine vom Herd aufgeschreckte Katze, blinzelt umher, sieht halb lachend, halb geärgert zu dem Blonden herüber und sinkt wieder in seinen druselnden Schlaf zurück, bis der Zug von neuem bremst, und der Blonde hastig aufspringt und »Roma avanti« brüllt. Das Spiel geht nun schon bald zwei Stunden so.
Eine alte Dame, – alle belächeln es sonst! – eine Matrone in schwarz mit gelblichem Augenweiß, sehr alt und sehr vornehm, bleibt als einzige von all dem unberührt. Was mag sie sein? Früher – da wußte man innerhalb einer halben Stunde in Italien von jedem Abteil die ganze Lebensgeschichte und alles war eine Familie geworden. Sämtliche Lebensmittel, die Schokolade, der Wein, die Pfirsiche, die Trauben, das Eis, die kalten Geflügelstücke, der Gorgonzola und die Mortadella gingen rund um. Jeder bot jedem an, und man wußte nie, ist es höflich oder unhöflich, nichts zu nehmen, und der Forestiere, der Inglese war, – denn jeder Fremde war in dubio ein Inglese! – war der Mittelpunkt, mußte erzählen, wo er herkam, wobei er zu seinem Staunen feststellen mußte, daß bei den Italienern jenseits der Alpen die Geographie aufhörte und Berlin bei Petersburg als die Hauptstadt von Dänemark lag. Aber jetzt ist das doch schon ganz anders geworden. Jetzt spricht man nicht mehr miteinander, wenigstens nicht laut. Man fährt in einem Trappistenkloster. Seit bald zwei Stunden hat niemand mit niemand ein Wort gewechselt, nicht mal mit mir aus Neugier, trotzdem man doch sicher sieht, daß ich ein Fremder bin. Aber man redet eben nicht mehr gerne in Eisenbahnen miteinander. Man weiß nämlich nie, wer gerade spioniert und wie ein Gespräch ausgelegt und weitergetragen wird.
Vielleicht aber gehört überhaupt die Matrone zu der wunderschönen Frau in Schwarz da. Ist deren Mutter. Oder ist es nur Rassenähnlichkeit und keine Familienähnlichkeit? Wer kann das sagen?! Der Junge aber ist sicher ihr Sohn. Er hat blanke Haare wie ein Biberfell, leuchtend im Schwarz genau wie sie. Und außerdem reisen sie ja zusammen, auch wenn sie nicht miteinander sprechen. Einen grünen Schlips trägt der Bengel, gegerbte Lederhandschuhe und Lackstiefeletten mit weißen Zwickeln und einen rehbraunen Anzug dazu. Ein wenig farbenfreudig ist er immerhin. Aber er ist ein kleiner Ephebe dabei. Mit dem graden und doch leicht gebogenen Nasenrücken und dem schmalen Kopf, dem beweglichen Eidechsenkreuz und den ganz langen Oberschenkeln. Wirklich ein kleiner Ephebe steckt unter diesem Maskenkostüm. Ich möchte einmal mit 61 heute so würdig sein und so von mir und meinen Leistungen für diese alte Erde überzeugt sein, wie der es mit sechzehn ist! Die Mutter ist viel vornehmer. Außerdem scheint sie zu trauern.
In Italien sind überhaupt die Frauen den Männern überlegen. Das stellt schon Taine fest. Wenn eine Frau in Italien um ihren Mann trauert, so trauert sie doch eben mit der ganzen Seele, ohne rechts oder links. Eigentlich sagt das ja schon jeder römische Grabstein. Bei uns trauert sie nur im Hinblick auf den Nächsten. Dieser alte Offizierstellvertreter ist ein quälender Albdruck doch eigentlich, so etwas träumt man doch nur sonst. Man sieht doch immer wieder Leute, von denen man nicht begreift, wie sie mit sich selbst auch nur zehn Minuten, ohne einen Strick zu nehmen, existieren können. Wenn ich dagegen an meinen alten Beppo in Florenz denke, welche anima candida!
Achtundsechzig Jahre ist er und schleppt immer noch die schweren Koffer die steilen vier Treppen hoch in die Pension mit dem ergebenen Schmerzlächeln eines heiligen Sebastian von Botticelli.
Diese prachtvolle, unnahbare Mutter da, die nur noch Mutter ist, mit der kleinen Maria, ach nein, sie heißt ja Berenice, wenn ich mich nicht verhört habe, und der Junge sogar Achille, Achilles bei den Frauen. Was sie alles doch hier für Namen geben. Nun denke man Achilles Wasserscheitel und Berenice Hippauf. Aber Achilles Condotti oder Berenice Mediani klingt gar nicht so übel. Aber eigentlich ist es hier in Italien genau wie überall. Die Vornehmen und die Intellektuellen, reizende, wenn auch ein wenig übertriebene Menschen – aber es fragt sich, ob sie nicht anderswo zu untertrieben, zu sehr unbetont sind! – der einfache Mann, wie mein Beppo, manchmal geradezu zum Küssen, und der Mittelstand, wie diese Treuhänder oder der Offizierstellvertreter da, eigentlich doch zum Speien ... um keine härteren Ausdrücke zu gebrauchen. Nun, diese Stunde wird auch noch vorübergehen.
Nun immerhin sehe ich mir doch noch lieber die ödeste Campagna und den lehmigsten Tiberstrom an als diese Leute hier, mit Ausnahme natürlich der wunderherrlichen Signora. Schade, daß es auch in Italien unschicklich ist, Leute, mit denen man zusammen in der Bahn sitzt, selbst wenn die Frauen auch noch so schön sind, unentwegt anzustaunen. Wie traumhaft doch die Farben am Nachmittag hier werden, als ob man Goldpuder in sie hineingemischt hätte. Wirklich das hat schon Claude Lorrain erkannt.
Der Zug bremst und hält an. Der Blonde versäumt nicht, aufzuspringen und »Avanti Roma« zu schreien. Aber der Schwarze fällt diesmal nicht darauf herein. Droht ihm nur, blinzelt und versucht, wieder die Augen zu schließen.
Der Offizierstellvertreter schiebt mit seiner aderreichen, beringten, gierigen Hand – es gibt auch habsüchtige und lasterhafte Hände – die Vorhänge, die eben noch wie Segel geknattert hatten und nun schlapp hängen, ganz beiseite und sucht durch das Monokel nach dem Namen der Station. Aber es ist eigentlich nicht viel mehr da als eine Bahnwärterbude, vor der zwischen zwei rosablühenden Oleanderbüschen eine hübsche, verbrannte Frau und neben ihr drei kleine Mädchen in Seidenkleidern von sieben bis elf, mit den nötigen Respektspausen, wie die Orgelpfeifen aufgebaut sind und mit breiten Seidenschleifen und pechdunklem glatten Haar braun und lachend stehen und grün-weiß-rote Fähnchen salutieren, während die Mutter dazwischen die rote Fahne schwenkt.
Irgendein Signal ist noch nicht aufgezogen. Das ist alles!
Der Offizierstellvertreter sieht mißbilligend auf seine Armbanduhr, die wie der goldene Schild des Achilles um sein haariges Handgelenk hängt, und dann zu der schönen Witwe hinüber.
»Wir haben ein und eine halbe Minute Verspätung, Signora«, sagt er geheimnisvoll und macht ein Gesicht, als ob der Staat in Gefahr wäre und als ob es sich um ein Hochverratsverbrechen gegen die neue heilige Ordnung des Faschismus handelte. Die Signora lächelt auf, wird sehr liebenswert. In dem Lächeln liegt ihre ganze Stellung zum Menschen, und zwar lächelt sie nicht zum Offzierstellvertreter hinüber, sondern zu dem Forestiere, dem Mann mit dem Paß »Statur mittel, besondere Merkmale: keine«.
»Ah basso, diese preußische Pünktlichkeit!« sagt sie plötzlich auf deutsch. »Sie wird uns noch den letzten Schimmer von Poesie in unserm schönen Italien auslöschen«, sagt es auf deutsch in einem Deutsch, an dem nur der Tonfall ein wenig italienisch ist, eigentlich florentinisch.
»Oh, welch ein gemütliches – das ist unübersetzbar! – Land war doch früher unser Italien: Wenn man in einen Zug stieg, wußte man genau, daß man ankam, und ließ sich überraschen, wann.«
»Ja, Signora«, sagt Harry Frank und setzt seinen Kneifer ab und sein verbindlichstes Lächeln auf. »Aber man ist doch gerade in Italien jetzt sehr stolz darauf, daß die Züge pünktlich ankommen. Man schätzt so etwas sehr für die Zivilisation, auch wenn man mit der Zeit, die man dadurch gewinnt, nichts Vernünftiges anfangen kann. Genau so wenig wie mit der Zeit, die man früher verlor. Aber in Preußen sind wir deshalb noch lange nicht. Bei uns marschieren selbst die Telegrafenstangen steil und gerade und genau im Parademarsch. Und hier sind sie schief und krumm, und jede marschiert, wie es ihr gerade paßt. So etwas würde man in Preußen nie dulden!«
Die schöne Witwe lächelt zurück: »Nun ja – etwas von dem alten Italien muß uns doch noch bleiben. Ach Gott, ja, und daß man nicht mehr angebettelt wird. Die Pünktlichkeit der Eisenbahn, die Bettler von der Straße. Alle Fremden, die doch wenigstens etwas Lobendes über den Faschismus und den Duce sagen wollen, preisen ihn, weil er das erreicht hat. Es ist zu närrisch!« sagt die schöne Witwe etwas allzu temperamentvoll.
Harry Frank denkt die ganze Zeit: ›An wen erinnert sie mich eigentlich? Wo kann ich diese wundervolle Frau nur unterbringen, in welches Zeitalter? Sie erinnert mich an irgendein Bild, das ich mal sah oder nicht sah. Ich glaube, ich kenne nur ein Foto davon oder eine Abbildung in irgendeinem Buch. Aber ich hatte mir danach vorgenommen, es einmal zu sehen. Nun schön, jetzt habe ich eben das Original vor mir – desto besser! Woran nur? Woher mag sie nebenbei so gut deutsch sprechen?
Aber ich glaube, es ist besser, wir reden weiter nur deutsch; denn solche Gespräche wie diese sind heute auf italienischem Boden nicht sehr geschätzt von Behörden. Deutsch kann man noch eher sagen, was man will und denkt, da versteht einen so leicht keiner, kein zufälliger Lauscher: Deutsch ist eben keine Weltsprache. Französisch und ein wenig Englisch radebrecht so zur Not jeder!‹
»Ich begreife«, sagt die temperamentvolle Dame, »daß Sie kein Freund des Faschismus sein können«, und lächelt dabei vielsagend, als ob sie damit nochmals unterstreichen will: »Verteidigen Sie sich nicht, Herr Forestiere, wir sind vollkommen im Bilde!«
Was war das? Wollte man ihn hier aus seiner Verschanzung herauslocken? Wollte man ihn in ein politisches Gespräch hineinziehen? War diese Dame vielleicht ihm nachgesandt, um ihn zu überwachen? »Vor Achille müssen wir uns in acht nehmen zwar, vor Berenice weniger, denn sie ist ein Kind, und vor Mamina gar nicht, denn sie ist eine Contessa. Aber vor Annibale immerhin.«
›Wer ist Annibale?‹ denkt Harry Frank.
»Aber Annibale«, sie zeigt auf den Offizierstellvertreter, »ist viel zu dumm, stupido, und eingebildet, trotzdem er ein Carracci ist, um je eine fremde Sprache zu lernen; und mio Achille ist zweiter Unterführer einer Balilla und hat sogar den ersten Juniorenpreis im concours hippique von ganz Toscana bekommen. Das genügt ihm bislang. Er wäre viel zu stolz, um eine fremde Sprache, oder gar noch das barbarische Idiom der Tedesci zu erlernen. Er behauptete, als ich es ihm zumutete, es höre sich so an, als ob unsere Hengste in Tesserete wiehern. Und die signori Forti und Grando können Bücher führen und Abrechnungen abschließen, aber auf der Handelsschule hat man nicht Deutsch von ihnen verlangt. Wozu auch?«
»Dann können wir doch wohl lieber Italienisch sprechen!« sagte Frank etwas betont. »Wenn ich auch nicht, wie Sie, die lingua toscana in bocca Romana spreche, Signora.«
»Das wäre wieder vielleicht allzu mutig, nicht nur für Sie, Signore.«
»Nein, Signora, ich bin nicht dafür, und bin auch nicht dagegen. Ich bin oder war Architekt, und deshalb kenne ich den Unterschied zwischen einem Bauplan und einem Haus, in dem man wohnen soll, sehr genau. Methoden interessieren mich deshalb nicht, nur Resultate; und auch sie nur noch bedingt, das heißt für die andern. Ich werde nicht mehr umziehn. Ich bin es ja eben. Ich liebe es aber nicht, daß es mir schlecht geht, habe es nie geschätzt, und wünsche deshalb, daß es auch den andern gut gehen soll. Wie das geschieht, ist mir gleich. Das ist meine ganze politische Einstellung, Signora. Und sie beschränkt sich auch nicht auf ein Volk, sondern gilt für den Menschen überhaupt. Sämtliche Staaten dieser Welt, von Athen an und Babylon, haben es nur fertiggebracht, daß zehn von hundert ihrer Menschen wie die Menschen, und neunzig von hundert schlechter als diese Herde schwarzer Schweine da draußen gelebt haben, weil diese schwarzen Schweine da doch nicht das Bewußtsein haben, daß sie nur deshalb gemästet werden, um geschlachtet zu werden, weil diesen schwarzen Schweinen da der Gutshof, auf dem sie wühlen, und der Himmel über ihnen genügt, und weil sie nicht fühlen, wie jene neunzig von hundert, daß sie ausgeschlossen von allem, von den seelischen, geistigen und irdischen Gütern dieser Erde sind, ohne Anteil und ohne Rechte daran. Ob man sie nun Sklaven nannte, wie zu des Spartakus und Tarquinius Priscus’ Zeiten, oder heute Arbeiter nennt oder Proletarier. Und wer immer es fertig bekommen wird, dieses Verhältnis von zehn zu neunzig auch nur um einige Zehner vom Hundert zu verschieben, der wird von mir einen goldenen Lorbeerkranz bekommen, ganz gleich ob er es mit Kapitalismus, Sozialismus, Kommunismus oder Faschismus zuwege bringt. Sofern natürlich seine Methoden nicht aller Menschlichkeit entbehren. Aber ich rede nicht gern von Politik, Signora, und wenn wir miteinander befreundet bleiben wollen, Signora, so wollen wir diese Gespräche für alle Zukunft meiden. Ja, ich denke nicht einmal gerne daran. Denn ich habe es im letzten halben Jahr zur Genüge getan. Es reicht aus, um mir das Recht erworben zu haben, Politik ganz aus meinem Leben auszustreichen.
Wenn einmal von Henry Ford kein einziges Rad keines einzigen Autos auf irgendeinem Autokirchhof der Welt mehr zu finden sein wird, so wird immer noch sein herrliches Wort im Munde und im Hirn aller vernünftigen Menschen meinesgleichen sein: ›Geschichte ist Quatsch!‹
Ford vergaß nur zu sagen: Politik ist Quatsch in fünfter Potenz. Genau so, wie weise Leute noch heute sich immer wieder das Wort vorsprechen sollten, das vor zweitausendfünfhundert oder mehr Jahren ein chinesischer Weiser seiner Erkenntnis gab: ›Nur nicht regieren wollen, es regelt sich alles von selbst.‹
Aber, um das Thema zu wechseln: Woher, Signora, sprechen Sie so gut deutsch?«
Die Dame lachte, es klang sehr nett. »Sie wissen doch gar nicht, ob ich mit Ihnen befreundet bleiben will, Signore«, sagte sie. »Woher ich Deutsch kann?! Nun, weil ich als Kind drei Jahre in Dräse war. Eine Stadt zum Küssen.«
»Ach, Sie waren dort in Pension, Signora?« meinte Harry Frank.
Denn er erinnerte sich, daß früher alle ausländischen Zeitungen voll mit Inseraten von Dresdener Mädchenpensionen waren.
»Ja, bei meinen Eltern. Mein Vater war damals Militärattaché in Dresden, um als Freund Deutschlands Spionaggio gegen Deutschland zu treiben. Nicht wahr, Mamina?« Mamina sagte nichts und nickte nur ernst unter ihrem schwarzen Kantenschal, den sie wie eine römische Matrone der Kaiserzeit über den Kopf gezogen hatte.
›Also sie gehören alle zusammen‹, sagte sich Harry Frank. In Italien gibt es immer solche familiären Karawanen.
»Mamina möchte ja so gern wieder in Dresden leben oder in Heidelberg, aber nun kann sie das nicht. Sie liebt Deutschland, aber nicht die Deutschen von heute ... ein Geschmack, den Sie ihr gewiß nachfühlen können, mein Herr. Wie hießen Sie doch, Frank, ... ah so.«
›Richtig‹, dachte Harry Frank, ›Italien hat sich doch nicht geändert. Innerhalb einer halben Stunde erfährt man immer noch die ganzen Familienverhältnisse eines ganzen D-Zuges ... wenn man Glück hat.‹
»Mamina will wieder nach drüben, sie liebt Europa nicht mehr. Sie sagt: da drüben fressen sich wenigstens die Tiger nicht gegenseitig auf. Und dann will sie mal neben dem Padre, neben ihrem marito begraben sein in Lima. Aber ich will, daß sie bei uns bleibt, und Achille wünscht es auch.«
›Was hat Achille zu bestimmen?‹ denkt Harry Frank.
»Aber alte Leute werden merkwürdig. Statt sich hier noch so gut einzurichten, wie sie können, denken sie immer nur an ihre nächste Wohnung. Doch Achille wird es schon durchsetzen, daß sie bei uns bleibt. Nicht wahr, Achille?«
Aber Achille liest stumm und reserviert in seinem Wallaceband weiter.
›Ein hübscher Kerl, dieser Achille‹, denkt Harry Frank, ›wo kenne ich ihn doch eigentlich her? Mit diesem gebogenen Näschen, den ruhigen und doch mutigen Augen. Dieser Gertenfigur. Wirklich ein Körper wie eine Reitgerte, so geschmeidig. Dem Jungen müßte man eigentlich einen Helm aufsetzen.‹
»Achille will Flieger werden. Heute wollen sie alle Flieger werden. Früher wollten sie alle Carducci werden.«
»Aber endlich wollten doch beide in den Wolken schweben«, sagte Harry Frank.
Die schöne Frau lachte. ›Wie billig ist es, für sie den Geistreichen zu spielen‹, denkt Harry Frank.
»Er ist mir trop sportif. Er hat schon einen ersten Preis im concours hippique, natürlich für Jugendliche, und das genügt ihm. Schade, er hat zu früh den Vater verloren. Ich möchte ja Achille gern in seinem Sinn erziehen. Er war Gelehrter. Aber es wird nicht angehen. Doch ich sage mir manchmal, man nimmt uns ja doch unsere Kinder fort, und man macht ja doch heute mit unsern Kindern, was man will, und nicht das, was wir wollen. Und unsere Kinder machen es dann mit uns so. Damit muß man sich abfinden. Was kann man heute mit solch einem Jungen groß tun?! Man gibt ihn als Gegengewicht zu den Padres, man gibt ihn eben zu den Professoren, und sie gehen trotzdem ihren Weg.«
Ja und dann begann die schöne Frau, Harry Frank auszufragen. Denn sie sagte sich vielleicht: wenn ich dem alten Signore Forestiere da von mir spreche, so wird er doch wohl dagegen auch von sich erzählen dürfen: woher er also käme? was er für einen Beruf hätte? wohin er wolle? ob er lange überhaupt in Italien zu leben gedenke? ob er Roma gut kenne? wie oft er in Roma schon gewesen? Ob er wisse, wo er unterkäme? Ob er lange bliebe? Ob er Empfehlung brauche? Ob er besondere Zwecke mit dieser seiner Reise verbände? Ob er Zimmer bestellt? Wo er vorzöge zu wohnen, am Pincio oder am Borghesegarten? Anderes käme wohl nicht in Frage. Sonst nämlich könne sie ihm eine gute Pension zu angemessenem Preise empfehlen. Sehr sauber; sie täte das gerne, denn sie läge in ihrem Palazzo, und da freue sie sich, wenn sie der Frau zu Diensten wäre. Vor allem, da für Rom jetzt nicht die Zeit wäre, und die Signora sicher viel frei hätte. Sie selber wäre ja in jedem Jahr nur zwei oder drei Mal wenige Wochen in Roma, um geschäftliche Abwicklungen zu machen. Dieses Mal, da es sich um den Verkauf einer Besitzung der Mamina samt der Landwirtschaft handelt, würde es länger währen. Die Mamina mit einem Gesicht, in das sich ein Schmerz eingefressen hatte, nickte dazu, denn die signori avvocati machen das nicht so schnell, weil sie davon leben müssen. Außerdem müsse über die einzelnen Posten verhandelt werden. Man wäre immerhin noch um 165.000 Lire auseinander. Man müsse die Bücher vorlegen und die Gutachten vom Landwirtschaftsministerium, daß der Boden sich zum Getreidebau vorzüglich eigene. Ob er