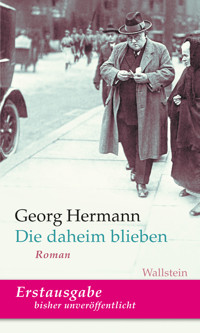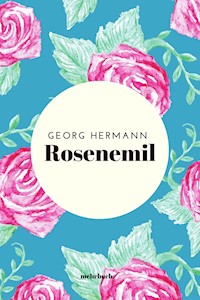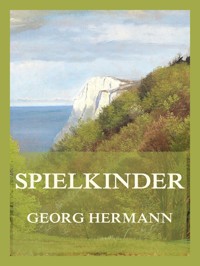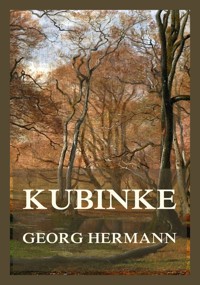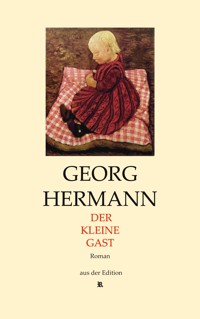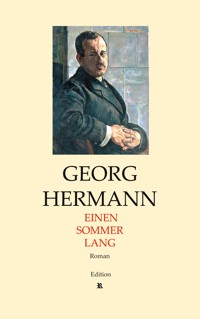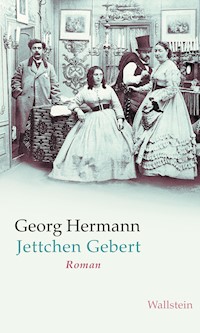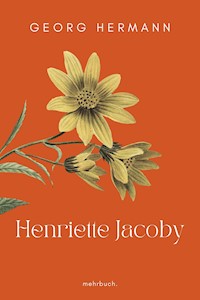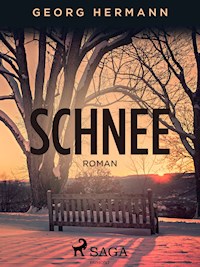Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Georg Hermann. Werke in Einzelbänden
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte eines jüdischen Emigranten, der als Flaneur in Paris auf der Suche nach einer besseren Zukunft seiner Vergangenheit begegnet Der Berliner Journalist Benno Meyer hält sich mit belanglosen Arbeiten für Zeitungen über Wasser und führt das unauffällige Leben einer »ganz gewöhnlichen Großstadtfliege mittlerer Größe«. Als 1933 die Nazis an die Macht kommen und ihm als Juden in Folge des Boykotts die weitere Arbeitsgrundlage entzogen wird, beschließt er, nach Paris zu emigrieren und begegnet auf der Fahrt gen Westen immer wieder einem Sportwagen, in dem eine Dame sitzt, die ihm irgendwie vertraut erscheint. Auf seinem ersten hoffnungsfrohen Spaziergang durch Paris kommt es schließlich zu einer tragisch-schicksalhaften Begegnung mit der Vergangenheit … 1934 im niederländischen Exil entstanden, überschreitet der Roman souverän die Grenzen etablierter Genres, Erzählmuster und Stilregister. Hermann zeigt sich hier als ironischer Kulturkenner und genauer Beobachter der Zeitumstände, der aber auch ins Phantastische ausgreift. Damit schlägt er im Kontext der Exilliteratur einen ganz neuen, eigenen Ton an. »Hervorragend und ganz original, mit voller Kraft«, urteilte Alfred Döblin über »B.M.«.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Georg Hermann
B. M. – der unbekannte Fussgänger
Roman
Herausgegeben und mit einem Nachwort von Christian Klein
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet
diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2024
www.wallstein-verlag.de
Umschlaggestaltung: Susanne Gerhards, Düsseldorf
© SG-Image unter Verwendung eines Fotos vom Café du Dôme auf dem Montparnasse,
um 1925, unbekannter Fotograf
ISBN (Print) 978-3-8353-3585-1
ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-8667-9
ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-8668-6
Inhalt
B. M. – der unbekannte Fussgänger
Anhang
Nachwort (Christian Klein)
Editorische Notiz
Er war so uninteressant … doch wäre es zu viel, wenn man ihn etwa deshalb einen niveaulosen Idioten nennen wollte, im Gegenteil, er war weder ein dummer, noch ein ungebildeter Mann, also weder das andere, noch das erste, nur etwas heruntergewirtschaftet durch das Leben … so uninteressant also, dass man ihm nicht mal einen Namen hier geben brauchte. Wir können ihn deshalb ruhig Meyer nennen. Zur Unterscheidung von anderen dieses Titels Benno oder B. M. und Benno Meyer hiess er auch. Und B. M. pflegte er zu unterzeichnen jene Belanglosigkeiten, die er für Zeitungen schrieb.
Wären es keine Belanglosigkeiten gewesen, so hätte er auch stolz Benno Meyer unterzeichnen dürfen oder »Dixi«, oder »Audifax«, wenn es sich um Dinge von einer besonderen Prägung gehandelt hätte. Bei seinen Arbeiten jedoch genügte eine Chiffre vollkommen, die meist noch, so säuberlich ER sie auch hingetippt hatte, von dem Redakteur in bm. zusammengezogen wurde; und die oft, weil allzu irrelevant, von diesem ganz fortgelassen wurde, sodass vom dem ganzen Benno Meyer nur die zwei Pünktchen übrig blieben. Und davon lebte er. Oder existierte er. Denn leben wäre hierfür eigentlich übertrieben gewesen. Das heisst, nicht der Redakteur lebte davon, sondern B. M. Das war die eine Sparte in B. M.’s doppelter Buchführung.
Und weiter lebte B. M. bescheidentlich davon, der Bekannte von Bekannten zu sein, die wiederum sich geweigert hätten, B. M. unter ihre Bekannten zu zählen; indem ER nur irgendein Bekannter von jenen, und sie wirklich »Bekannte« waren. Zu Deutsch: Prominente.
Brauche ich noch hinzufügen, dass in den letzten fünfzehn Jahren B. M.’s Dasein sich in Berlin im Romanischen Café, von 12-2 ausserdem im Zeitungsviertel, und sonst im Bezirk dreier Nebenstrassen um das Romanische abgespielt hatte, bei möblierten Wirtinnen, die alle verschiedenfarbig gestickte Morgenröcke und nuancenhaft zwischen blond und rot gefärbte Haare trugen, aber – bis daraufhin, dass sie verschiedene Namen hatten – vollkommen gleich waren und B. M. in Zimmer sperrten, die ebenfalls, trotzdem sie alle verschieden waren, durchaus gleich ausgestattet waren. Denn im Kitsch gibt es keine Abstufungen.
Ausserdem war B. M. vor zwanzig Jahren Mitte der Zwanzig gewesen und hatte noch keinen halb ausgewachsenen Bauch gehabt und keine halb ausgewachsene Glatze in einem melierten Haarkranz gehabt; im Gegenteil, damals war B. M. ein schwärzlicher, gut rasierter, hoffnungsvoller junger Mann mit überzüchtetem Intellekt von üppigem Haarwuchs, jedoch von so dürftigem Körperbau gewesen, dass er daraufhin dann selbst als Schipper versagte, aber, dank des ersten sich in einer Schreibstube in Ober-Ost derart bewährte, dass er durch bald vier Jahre seinem Hauptmann, der weder hoffnungsvoll, noch von dürftigem Körperbau war, immer unersetzlicher wurde; sozusagen dessen Kopf, der ihm fehlte.
Doch das war vorübergegangen wie alle Schmerzen, an denen man bekanntlich vorübergehen soll, weil auch sie vorübergehen. So also auch die in seinem, B. M.’s, Dasein.
Noch früher, vor 1914, hatte sich B. M., in dem seine Eltern eine zukünftige Leuchte der Wissenschaften sahen, insgeheim mehr für einen werdenden Dichter und eine Zukunft gehalten. Und heute hielt er sich für die Vergangenheit einer versäumten Gegenwart und insgeheim nur noch für das Erste. Selbst wenn er auch nicht mehr versuchte, es auf die Probe zu stellen.
Und das war gut so. Denn, im Vertrauen, wenn er es etwa öffentlich getan hätte, so hätte ihm das gar nichts genützt, und er hätte schnell eingesehn, dass der Dichter seit Jahren in seiner deutschen Heimat an sich schwer diskreditiert war. Und weiter hätte er eingesehn – und das hätte die Enttäuschung nur verschlimmert! – dass einige Bildung, viel Klugheit und ein wenig Beweglichkeit, ja sogar etwas Geschmack, Nerven und Empfindsamkeit, alles zusammen, durchaus und noch längst nicht dazu ausreichen, ja vielfach daran hindern, ein Dichter oder ein Schriftsteller von Rang zu sein. Also, wenn selbst, was nicht der Fall war, ein solcher in ihm gesteckt hätte, und unglücklicherweise bei ihm noch zum Durchbruch gekommen wäre, so hätte sich unser B. M. keineswegs besser befunden dabei, sondern eher schlechter, als er es die ganzen Jahre hindurch getan hatte. Ob Dichter oder nicht, geglaubt hätte es ihm doch keiner. Die Zeiten waren nicht mehr danach. Im Gegenteil: man hätte es ihm übel genommen. Und so nahm wenigstens niemand B. M. seine persönliche Existenz übel. (Was die Zugehörigkeit zu einer Menschengruppe anbetrifft, so war das etwas anderes, wie wir noch sehen werden.)
Also zum Schluss, das wusste jeder, und auch B. M. war das endlich nicht verborgen geblieben (wenn er es sich auch ungern eingestand!), war B. M. nicht viel mehr, als eine Fliege auf einem abgegessenen Tisch einer Fremdenpension. Natürlich nur bildlich gesprochen.
Es krabbeln da eine Menge Fliegen herum. Sie kommen und gehn, setzen sich mal auf den Zucker, mal auf die Puddingreste und mal auf die Backpflaumenkerne, und mal auf die Weinflaschen, und mal auf den Brotkorb. Aber niemand weiss nun, welche Fliege das war, und kann etwa die eine von der andern unterscheiden. Jede ist eben, um mit Knut Hamsun zu reden, eine jener »ganz gewöhnlichen Fliegen mittlerer Grösse«.
Und so war B. M. in all der Zeit einfach eine jener ganz gewöhnlichen Fliegen mittlerer Grösse gewesen, die sich mal auf ein Zeitungsblatt setzen, mal in ein Radio summen, mal ihre Ideenlosigkeit über ein Filmband kriechen lassen, mal eine Anthologie oder eine Novellensammlung zusammentragen, oder den Kehrreim zu einem Chanson verkaufen – es wird ja soviel gedruckt, gesagt, gefilmt und gemimt! – kurz sich auf irgendetwas setzen, wo solch eine Fliege mittlerer Grösse ein wenig Geld heraussaugen kann, um dann weiter zu schwirren auf einen andern Platz, wo man auch etwas heraussaugen kann. Solch eine ganz gewöhnliche Grossstadtfliege mittlerer Grösse war B. M. gewesen – bislang.
Es hat kein Mensch etwas gegen Fliegen auf einem abgegessenen Pensionstisch. Sie gehören dazu. Mich heimeln sie sogar an. Es wäre zu langweilig ohne sie. Und gegen B. M. habe ich überhaupt nichts. Im Gegenteil, er ist mir aus vielen Gründen ausserordentlich sympathisch. Wie alle Leute angenehmer Farblosigkeit, die Farbe vortäuschen, uns menschlich sympathischer sind, als solche, die wirklich Farbe haben. Eigentlich war B. M. also ein ganz feiner Kerl, nur ein bisschen weich und ein bisschen schwach und enttäuscht (aber wie sollte er auch anders sein!). Er masste sich, wie es sonst im Kreise seiner Berufskollegen üblich war, auch keine Bildung an, die er nicht hatte. Im Gegenteil: Er war ein in vielen Dingen wohl unterrichtetes und ganz sensibles Männchen. Nur fand er wenig Gelegenheit, davon Gebrauch zu machen. Und er hatte sich auch mit der Zeit abgewöhnt, diese Gelegenheiten zu suchen. Nicht etwa aus geistigem Stolz und Überlegenheit, sondern weil – was man bei seiner Rundlichkeit gar nicht vermutete! – er doch zu wenig Ellbogen hatte, um sich bis an die Stellen durchzuboxen, wo Geist und Bildung auf seinen Zeitungen als Handelsware gewertet wurden.
So jedoch, als ganz gewöhnliche Fliege mittlerer Grösse, hatte B. M. sich gerade noch durchgefressen und meist so wenig verdient, dass er ausser seinem Essen und seiner Miete sogar noch seinen Kaffee bezahlen konnte, der obligatorisch war, sofern er sich bis halb zwei in der Nacht den verruchten Sensationen des Romanischen Cafés hingeben wollte, die darin bestanden, Neuigkeiten, die allen seit acht Tagen bekannt waren, aus einer Welt zu hören, die keine war, und Menschen für interessant zu halten, die weder das erste, noch das zweite waren.
Da B. M. ziemlich betriebsam war, und ausserdem wie ein echter Zeitungsmensch sich alsbald angewöhnt hatte, die Dinge von heute zu wichtig, und die von gestern zu unwichtig zu nehmen, so war es ihm dabei nicht mal ungewöhnlich schlecht ergangen. Ohne dass er dem Geld und der Arbeit mehr nachlief, als unbedingt nötig – genau so wie den Frauen: Und auch hier hatte er die gleichen Resultate zu verbuchen, wenn auch, was jeder Kenner zugeben wird, die Sache mit den Frauen immer leichter, und die mit dem Geld vom Jahr zu Jahr immer schwieriger geworden war.
Langsam also (das heisst nicht mit den Frauen) war es immer weniger und weniger geworden, eine Quelle nach der andern war versickert und verschlammt. Und als B. M. am Tage des Boykotts zu seinem Staunen noch feststellte, dass er wirklich Jude war – vordem hatte er keinen Gebrauch davon gemacht – waren auch die letzten dünnen Rinnsale für B. M. versiegt, und wollten nun gar keinen Tropfen mehr hergeben.
Einige Monate hatte B. M. das so mit angesehen, leicht gekränkt darüber, dass nicht einmal die kleinste Haussuchung bei ihm gewesen war, und niemand in Uniform seine Bibliothek durchwühlt hatte, die, da sie längst bei Antiquaren gelandet war (bis auf sechs Ullsteinbände, die sich als unabsetzbar erwiesen hatten), nicht vorhanden war.
Dann jedoch war in B. M. ein Entschluss gereift: koste es was es wolle – das heisst so wenig wie möglich! – den Zwischenraum zwischen dem Romanischen Café und dem Café de Dome zurückzulegen, eventuell sogar bis zur Rotonde, die gerade gegenüber lag, vorzustossen. Doch da verkehrten mehr die Maler. Während im Dome, wie man ihm gesagt hatte, immer noch die ganze Literatur nächtigte. Mitbestimmend war, dass man für ein Drittel einer Tasse Kaffee des Romanischen im Dome dort nach wie vor ein Kelchglas voll weissen Burgunders bekommen sollte; und ausserdem, wie ein altes Wort sagt, es sich in Paris immer noch angenehmer verhungert, als in Berlin lebt. Und weiter, dass man ja ebenso bei rotgefärbten Wirtinnen im Umkreis des Café de Dome wohnen könnte, wie jetzt im Umkreis des Romanischen, und dass sich so für B. M. eigentlich – Einschneidendes nicht ändern würde. Wovon er in Paris auf die Dauer leben sollte, war ihm schleierhaft. Aber, wovon er weiter in Berlin auf die Dauer leben sollte, noch schleierhafter.
Jedenfalls war in Berlin alles, was ihn als Kunst, Differenziertheit und Lebensausdruck gereizt hätte, erst wertlos geworden, und heute sogar, als Asphaltliteratur, verpönt und strafbar. Vielleicht hatte es in Berlin nie Wert gehabt. Aber man hatte es sich doch einreden können. Nun aber ging auch das nicht mehr.
Und gerade das hatte B. M. am tiefsten deprimiert. Man kann nämlich mit einem Menschen machen, was man will, aber man darf ihm nicht sein Steckenpferd zerschlagen. Irgendeine verkappte Religion muss der Mensch haben. Und, wer weiss, da drüben in Frankreich, glaubte man gewiss noch an diesen Quark wie Literatur und so.
Und da B. M. keine Angehörigen hatte, keinen Anhang, keine Liebste, nur flüchtige Liaisons, die seine Abwesenheit kaum unangenehmer bemerkten als seine Anwesenheit, so war in ihm der Entschluss gereift, rücksichtslos Fäden zu zerreissen, die keine waren.
Es ist nebenbei falsch, anzunehmen, dass B. M. Frauen wie Krawatten wechselte, denn er trug seine Krawatten sehr lange; und wenn er schon sich eine neue kaufte, warf er die alte deshalb noch lange nicht fort, – im Gegenteil also, die Frauen wechselten ihn. Was hatten sie auch auf die Dauer an B. M.?! Geld hatte er nicht, wenn sie Geld brauchten, und protegieren konnte er sie nicht, wenn sie Protektion brauchten. Und sonst war er wie jeder andere, vielleicht kein dummer, aber sicher kein heiterer Gesellschafter. Wenn er das erste mehr, und auch das zweite mehr gewesen wäre, hätten sie ihm seinen chronischen Geldmangel und seine Einflusslosigkeit vielleicht verziehen. Aber so sahen sie sich das eine Weile so mit an, und flatterten dann davon.
Da drüben also, jenseits des Rheins, würde alles wieder Geltung haben, ohne das er nicht leben konnte; und wenn es auch dort selbst nur noch ein Scheindasein führte. Und es würden die Leute da sein, mit denen man unbefangen reden, statt befangen flüstern könnte, und die auch noch daran glaubten. Sodass wenigstens eines von B. M.’s Lieblingsworten aus einem Briefe von van Gogh: ›und wenn es ein auch melancholisches Gefühl bleibt, nicht im richtigen Leben zu stehen, so empfindet man doch wenigstens, dass man lebt, wenn man bedenkt, dass man Freunde unter solchen hat, die auch nicht im wirklichen Leben stehen‹; wenigstens das da drüben noch Geltung haben würde.
Hier waren sie alle auseinandergejagt, wie verängstigte Hühner, die in einem fremden Garten gescharrt hatten. Drüben würden sie sich sicher wieder zusammenfinden.
Als junger Dachs war B. M. schon ein paar Monate in Paris gewesen, weil das für einen angehenden Gelehrten und Schriftsteller von internationaler Zukunft vorausgesetzt werden musste. Wie ihn das Leben dann in die Krallen genommen hatte, vorerst an eine Schippe, und dann in Wilna an den Stuhl einer Schreibstube gebunden hatte … wie das Vermögen seiner Eltern solange in Milliardenscheine zerflattert war, bis deren beider Seelen ihnen nachgeflattert waren, und B. M. die Gasrechnung bezahlen musste … wie er mit Artikelchen von Redaktion zu Redaktion gehetzt wurde, da war von Paris nicht mehr viel die Rede gewesen. Und jetzt, wo ihn das Leben wieder aus den Krallen gelassen hatte, B. M. als kleinen, dicklichen, schlecht rasierten Mann mit Bauch und Glatze, ja, das Leben sich schon gar nicht mehr um ihn bekümmerte, weder im Guten noch im Bösen eigentlich, und er alle Zeit der Welt hatte … Zeit ist Geld, sagen die Leute –, ist ja nicht wahr! man hat nie mehr Zeit, als wenn man kein Geld hat …, da war plötzlich wieder Paris für ihn aufgetaucht. Man bekommt nämlich alles, was man will. Wenn auch meist anders, als man erwartet. Man muss nur lange genug leben.
Sehr romantisch hatte sich B. M. das mit seiner Flucht ausgedacht. Aber das Leben legt – im Gegensatz zum Film! – nun mal auf Romantik gar kein Gewicht. Zum mindesten nicht da, wo man es erwartet.
B. M. hatte sich ausgemalt, wie er auf geheimnisvollen Umwegen, bei Freunden sich verbergend, sich bis zum Rhein durchschlagen würde, bis endlich zwei Männer, denen er nicht in Dunkeln begegnen möchte, ernst und schweigsam wie Erbbegräbnisse, ihn an ein Haus bringen würden, das unter schattenden Pappeln mit weissen Wänden und grünen Fensterläden, weinumrankt, inmitten von Wiesengrün und Blumenbuntheit, unweit des Rheins, in einer lichten Abenddämmerung dahinträumte. Auf den Boden musste er über eine knarrende Leiter kriechen. Als echter Flüchtling da oben unter einem Berg von Heu liegen, bis der erste Stern durch die Dachsparren flimmerte, und dann erst durfte er, als harmloser Fuhrknecht maskiert (er sah sich mit einem blauen, mit Edelweiss bestickten Leinenkittel, der ihm viel zu gross war, über seinem Sakkoanzug mit einem blauen Leinenkittel, als ob er direkt aus Hebels – Peter Hebels, nicht Friedrich Hebbels, bitte! – Schatzkästlein käme …) dürfte er den schmalen Uferweg zwischen blühenden weissen Spiräen und duftender Salbei (duftet sie oder duftet sie nicht?) zum Strom herunterschlendern. Um im Stil zu bleiben würde er die Wacht am Rhein pfeifen. Man muss immer auf Stil halten. Sein Gepäck, aber es war ein sehr bescheidener Coupékoffer (alles sonst hatte er in der undankbaren Heimat zurückgelassen), würde er im Nachen … ein leerer Nachen treibt im Rhein, siehe Stefan Georges »Die Günderode«… wiederfinden. Denn B. M. lebte noch von früher her durch Bücher. O, was wären das für bange Sekunden bis der Ferge – Ferge nennt man so etwas immer in Balladen – die Ketten gelöst und den Nachen vom Ufer abgestossen. Ohne Ruderschlag gleitet er über den nächtlichen gurgelnden Strom, durch die atmende Finsternis dahin. Er, B. M., liegt flach auf dem Rücken im Boden des Kahns (es riecht nach Teer) und hat nur die kreisenden Sternbilder und den dämmrigen Silberstaub der Milchstrasse über sich. Der dunkle Mensch dahinten, der auf dem Schiffsende sich zusammenkauert, steuert allein mit kleinen paddelnden Bewegungen hin und her, damit sie von der Strömung nicht zu weit herübergetrieben werden. SSSSSt kommt von drüben eine Kugel ihnen nach – wirklich man schiesst hinter ihnen her! – und peitscht mit einem langen Strich das Wasser neben ihnen auf. B. M. sieht es ganz deutlich, wie es Fächer spritzt, trotzdem er sich sagen muss, dass er ja flach auf dem Rücken auf den Boden des Kahns liegt und in die Sterne guckt, und dass es ausserdem Nacht ist, sodass er eigentlich überhaupt nicht sehen könnte. Aber mit solchen Kleinigkeiten halten sich unsere Vorstellungen nun mal nicht auf! …
Gottlob … da sind sie ja doch endlich in einen Durchstich hineingetrieben, gleiten, während hinter ihnen der Strom weitergurgelt, im stillen Wasser unter Weidenzweigen dahin, die einem das Gesicht streifen, und an die sich B. M. klammert. Und dann rutscht der Kahn in das ölglatte Stauwasser hinein, das als ein dichtverschilfter kleiner Teich (wie ein schwarzer Spiegel voll von Sternbildern auf seinem Grund) in den Wiesen liegt: Frankreich!! Vive la France!!! O mon jardin de France!!!! Gerettet!!!!
Stundenlang regt sich keiner von ihnen, und langsam dämmern so Büsche und Kräuter aus der säuselnden Frühlingsnacht auf, von einem ganz feinen Dunst umzogen. Die ersten Blumen bekommen Farbe. Und in der zitternden Ruhe heben so die frühsten Grillen an zu zirpen. (Ach nein – das werden wohl Lerchen sein. Aber Lerchen zirpen wieder nicht.) Und riesige blühende Kirschbäume, wie aus Elfenbein modelliert, ringen sich aus der Dämmerung heraus, während drüben an den Vogesenhängen das Lichtgrün der knospenden Buchenwälder im Weiss der Margaritenauen, wie Juno vor Zeus, sich entschleiert.
Ach Gott – man sieht B. M. war auch in seinen Wachträumen ein hoffnungsloser Stadtmensch, ein Stubenhocker, ein Strassengänger, und er wusste, als solcher zwar aus tausend Erfahrungen sehr genau wie das Licht zu jeder Jahreszeit morgens über der Tauentzienstrasse hinter der Kaiserwilhelmgedächtniskirche aufkeimt, aber von Grillen und Schilf, und Knospen und Buchenwäldern, und blühenden Obstbäumen hatte er nur sehr nebelhafte, weil literarische Vorstellungen. Denn sonst hätte er Ende Mai nicht die Kirschbäume blühn, – was zu spät! … und nicht zugleich das Schilf wogen lassen, was zu früh ist. Selbst nicht im Spiel seiner Phantasie …
Ja und dann käme eben (O Strassburg, O Strassburg!!) im ersten Morgendunst, der zart und bunt wie ein indischer Seidenbatist weht, gleich dem einsamen Riesenfinger aus einer gekrümmten Faust, mit seinem einzigen Turm das MÜNSTER am Horizont auf. Vorher würde er noch in einem alten Gasthaus mit Mullgardinen und hohen lavendelduftenden Federbetten sich noch einmal hinlegen … in einem Gasthof mit einer Rebenlaube und einem Wirt mit einem Käppelchen, der den »Woin« aus dem Keller heraufholt. >Hier muss schon der Studiosus Goethe übertagt haben, wenn er nach durchwachter Nacht von Friederike kam. Vielleicht in demselben Bett sogar. Und bis in den Nachmittag hinein würde er sich die Gefahren, denen er entronnen, aus den Knochen schlafen. Doch dann würde er fröhlich fürbass wandern (ein echter Wanderer wandert immer fröhlich fürbass) auf die Stadt zu, die da mit ihrer Silhouette aus dem Merian seit 1668 unverändert vor ihm aus dem Licht emporsteigen würde. ›Durch die weit umherliegenden, mit herrlichen dichten Bäumen durchflochtenen Auen würde er wandern, die überall von unendlichen kleinen Bächen durchschnitten sind, durch das zum Fruchtbau schickliche, trefflich bearbeitete Land.‹ B. M. freute sich, wie schön er in seinen Phantasien die Worte setzte … aber richtig: da fiel ihm ein, dass er das doch vor gerade dreissig Jahren wörtlich aus »Wahrheit und Dichtung« abgeschrieben hatte, in dem Aufsatz »Goethe in Strassburg«. Aber trotzdem hatte er nur eine V und »Stil« mit zwei Ausrufungszeichen bekommen. Pauker erkennen nämlich nie das Genie! Und nicht mal dann, wenn es bei Goethe einen Pump anlegt.
Am Judentor – wie konnte es auch anders sein! – würde er seinen Pass vorweisen, und das erste mal seit langem seine eingefrorenen französischen Kenntnisse wieder auftauen. Und dann erst richtig seinen Einzug halten in das Land der fraternité, égalité, liberté … in das Land, das die Menschenrechte ersann, die diesseits des Rheins zum mindesten für ihn jetzt aufgehoben waren. Börne, Heine! Und die vielen andern. Kinkels Flucht (oder war es Schurz?). Also ganz egal, wer immer vor hundert Jahren über den Rhein ging … all das hatte sich in B. M.’s Vorstellungswelt zu einem farbigen und verlockenden Ganzen versponnen, an dem B. M. wochenlang Nacht für Nacht vor dem Einschlafen weitergebaut hatte.
Doch, wie ich schon so richtig bemerkte, das Leben von 1933, im tiefsten Kern unromantisch, dafür aber rationalisiert und durchstandardisiert, kühl, herz- und poesielos, kümmerte sich einen Dreck darum, wie B. M. sich das vorstellte. Es verfügte durchaus anders über ihn.
Kein Mensch hatte sich nämlich für B. M. noch interessiert. Nicht mal eine Behörde. Niemand hatte etwas gegen ihn gesagt und gehabt. Man war sogar kühlfreundlich zu ihm gewesen Man hatte ihm sofort seinen Pass visiert – wenn auch nur für vier Wochen. Und B. M. war, wie jeder normale Sterbliche, ganz ruhig und ohne Aufsehen vom Anhalter Bahnhof abgefahren, in einem halbbesetzten gemütlichen D-Zug, der wie immer lief, hatte erst in Karlsruhe noch eine Freundin besucht, die da mit einem Arzt verheiratet war, und war am nächsten Tag unter den blaudunklen Schwarzwaldhängen entlang bis Appenweier gefahren. Im Grün der Rheinebene hatte er die Störche auf den Wiesen in Mengen melancholisch auf- und abstolzieren sehen; gewiss weil sie wegen des Geburtenrückgangs jetzt auch auf Arbeitslosenunterstützung angewiesen waren.
Ja, es wäre sogar irrtümlich anzunehmen, dass B. M. auf der Fahrt in bedrückendem Schweigen egalweg Trübsal geblasen hätte. Leuten mit einem halb ausgewachsenen Bauch und einer Glatze, die zur Dicklichkeit neigen, liegt so was nicht mehr. Cäsar wusste schon, warum er solche Leute um sich liebte.
Nein, B. M. freundete sich über die melancholischen Störche mit Arbeitslosenunterstützung mit einer Dame an. Einer Dame mit schlohweissen Haaren wie eine Angorakatze und dazu mit einem jungen Gesicht, in dem die Augen eines Schneemannes sassen, rund und gross wie zwei Eierkohlen. Die Schwarzgekleidete war lebhaft, liebenswürdig und charmant und literaturbeflissen, jonglierte mit Proust, Roger Martin du Gard, Maurois und Mauriac, Paul Valéry und Jules Romain wie ein Jongleur mit sechs Bällen auf einmal. Und all das in einem vollendet eleganten Französisch. Wirklich, es war die französischste Französin, der B. M. je begegnet war, die Frankreich, le beau pays de France, ihm gleichsam als Heroldin, um B. M. wie einen prinzlichen Bräutigam einzuholen, schon vor der Grenze entgegengeschickt hatte.
Alle Vorzüge gerade der älteren Damen dieser gesellschaftlich gewandten, bestimmten und geistesbeweglichen Rasse der Franzosen waren, so sagte sich B. M., in Reinkultur in ihr zu einem köstlichen Ganzen vereint. Ausserdem widerlegte sie, trotz Grossmutter, wie sie immer wieder betonte, und trotz der 55 Jahre, die, wie sie gleichfalls immer wieder betonte, sie auf ihrem rosigen, weiss gepuderten, (denn sie war auch dort décolletiert!) hübschen Nacken trug, jedem, der so etwas zu lesen wusste, wie B. M. nicht ohne Behagen registrierte – die sonst meist so zutreffenden Worte Wilhelm Busch’s »Ach die Tante liebt nicht mehr«.
Nur eine Enttäuschung bereitete sie B. M., als sie ihm hinter Appenweier anvertraute, dass sie eigentlich durch ihre Heirat Jugoslavin, Dalmatinerin aus Abbazia, Ragusa, Zara oder sonst woher wäre. Und eine noch grössere, als sie dann kurz vor Kehl auf ihre Vaterstadt Krakau zu sprechen kam! ›Daher auch der Speckhals!‹ sagte sich B. M.
Und mit Überspringen einer ganzen langen Gedankenkette frug sie B. M., denn irgendwie wollte er doch seinen Einzug bei einer halben Flasche Volney festlich begehen, leise vor sich hinschmunzelnd, wo man eigentlich in Strassburg gut doch pour le bon prix essen könnte. Davon nämlich, mutmasste B. M., würde sie, da Jugendeindrücke meist für das Leben bestimmend sind, zumindestens ebensoviel verstehen, wie von André Gide und Duhamel.
Und dem war auch so. Denn die aparte Angorakatze mit den Eierkohlenaugen schien jetzt erst wirklich in ihren Element, und sie beschwor B. M. mit der ganzen Zungenfertigkeit zweier Rassen, ja nicht etwa dorthin, leichtfertig dorthin zu gehen, wo alle Fremden hingehen, und wo man es gut, aber auch schlecht treffen könnte, sondern in jenes moderne Lokal am Markt, wo es trefflich, aber dafür billiger und durchaus gleichmässig in den Darbietungen wäre. Wenn sie nicht bei ihrer Freundin dinieren müsste, würde sie auch hinkommen.
Diese Aussicht lockte und erschreckte B. M. in gleichem Masse, lockte ihn der amüsanten Gesellschaft wegen, die mit ihrem espritvollen Geplauder sein Französisch auffrischte und erschreckte ihn der Landessitten wegen, die einen Herren zwangen, in solchen und ähnlichen Fällen für eine Dame zu bezahlen. In Deutschland war so etwas längst abgekommen.
Aber da sich die französische Zollbehörde etwas länger als für andere Sterbliche für die Angorakatze mit den Eierkohlenaugen interessierte, und sie aus dem Coupé herausbat, verlor B. M. die Heroldin des Nachbarstaates aus den Augen, behielt aber ihren goldenen Rat in Sinne.
Weder auf der deutschen Zollseite noch auf der französischen also, war B. M. belästigt, angefahren, ausgefragt, visitiert, beklopft und befühlt worden. Nicht mal nach Geld geforscht hatte man bei ihm. So sah er nicht aus. Er hätte so viel mitnehmen können, wie er wollte, wenn er es gehabt hätte. Es war gar nicht nötig gewesen, dass er die beiden anderen Hunderter in die Wattierung seines Sommermantels selbst und allein bei verhängten Fenstern, in geheimer Nachtstunde – sowas konnte B. M. wie jeder Berufsjunggeselle – sich eingenäht hatte.
Und die Sache mit dem Rhein war auch sehr enttäuschend für B. M. Da gab’s natürlich, wie überall jetzt, Fabriken und Hafenanlagen, und auf dem regulierten Rhein, der lehmgelb gerade dahin sich wälzte, schwammen breite Schiffe, die von kleinen Schleppern gezogen wurden, die ebenso energisch wie die Fabrikschornsteine qualmten (was diese auch noch ausserdem taten), sodass der Kohlendunst sich in zwei Schichten übereinander um Strom und Landschaft legte. Ein Rangierbahnhof breitete seine vielverzweigte Nüchternheit, und gelangweilte Zollwächter markierten lässige, aber eisige Würde.
Mit dem Postmenschen, dachte B. M., kann man etwas anfangen. Er ist mutatis mutandis ein uns ähnliches Wesen. Mit dem Eisenbahner schon weniger. Aber der Zöllner stammt aus einer uns unbekannten Welt … Er ist immer ganz Staat. Er benimmt sich auch in Unterhosen wie ein Soldat im besetzten Gebiet. Jeder Blick sagt: ›Sie sind durchschaut, junger Mann!‹ Wenn es zwischen den Buschnegern und den Kaffern eine Zollgrenze gäbe und Zöllner, die deshalb einen schwarzroten und einen grüngelben Schurz aus Cocosfasern trügen, würden sie sicher auch nicht viel anders aussehen, als die hier.
Und von der Meriansilhouette war keine Spur. Nur dahinten ein Strich gegen den Himmel … das mochte das Münster sein … aber Staub gab es, und Festungwerke, und müde heimkehrende Arbeiter, und Schuppen und Lagerhäuser, Getreideelevatoren, Trupps von dahinschlendernden Soldaten und Lastautos und Holzplätze und Alt-Eisen und Lumpenballen. Kurz, es war da, wie überall, der ganze Klimbim und Plunder, den die einen Technik, die andern Zivilisation, und die dritten Kultur nennen; und der deshalb wie ein Feuermal das schönste Gesicht die schönste Gegend verschandelt.
Ach, und für B. M.’s inneren Menschen, oder, um es volkstümlicher zu sagen, für seine Seele, verlief die Angelegenheit noch weit beschämender. B. M. empfand gar nichts, weder Erleichterung noch Beseligung. Weder Kummer noch Freude. Er weinte innerlich keine ungeweinten Tränen seiner ihm bestrittenen Heimat nach, noch hatte er ein befreiendes Glücksgefühl, als er sie hinter sich gelassen hatte. Sein Herz schnürte sich nicht zusammen, noch weitete sich seine Brust. Er trommelte weder die Marseillaise gegen die Fensterscheibe, noch summte er »Muss i’ denn, muss i’ denn aus Deutschland hinaus«, als sein Wagen langsam und bedächtig zwischen den Guitarrensaiten der Eisenkonstruktionen über die Rheinbrücke dahinrollte, und er auf das gen Norden hinziehende Wasser hinunterblickte. Nur ein Reisegefühl hatte B. M. Sonst nichts. Es war mal etwas anderes, als die ganzen letzten Jahre. Er empfand weder Kummer, noch Freude, nicht mal Sorgen, Sorgen ob seiner Zukunft. Denn, wer seit 10 Jahren und länger gewohnt ist und länger gewohnt ist, von Zwanzigmarkschein zu Zwanzigmarkschein zu vegetieren, ist, was die Sorgen anbetrifft, ein Dickhäuter. Sie kommen nicht so leicht durch das Fell seiner Seele. Es wird schon irgendwie gehen, sagt er sich gleichmütig. Es ist ja bisher gegangen, sagt man sich gleichgültig. Und ausserdem: wer allein im Leben steht, – und das stand B. M. ja zur Genüge! – dem ist es letzten Endes auch ziemlich schnurz und piepe, ob sein Boot leck wird und untergeht, und er mit ihm absackt. Erst, sowie er andere mit an Bord hat, kompliziert sich für ihn die Angelegenheit. So ist der Mensch nun mal konstruiert. Und warum sollte B. M. da eine Ausnahme machen?!!