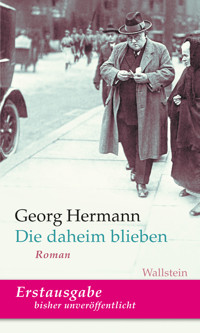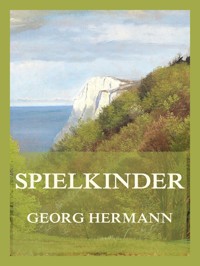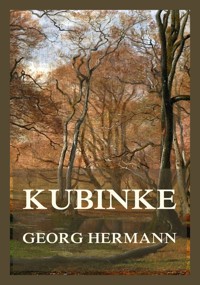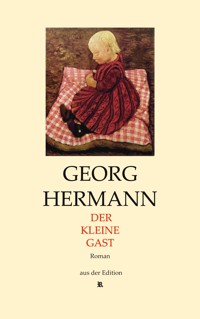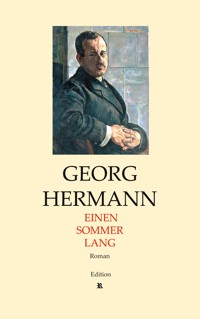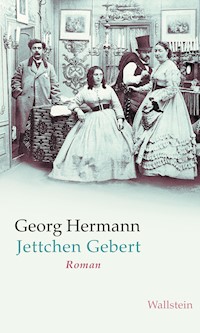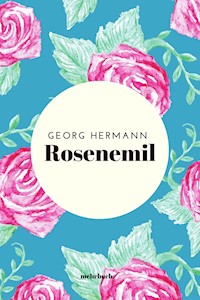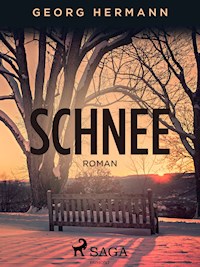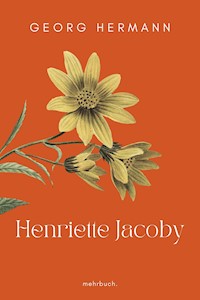
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit dem Roman -Henriette Jacoby- setzte Georg Hermann auf Drängen des Publikums die Geschichte Jettchen Geberts fort, die -in jener windklaren, sternenhellen Novembernacht des Jahres 1839 ihrer Hochzeit den Rücken gekehrt- und die Ehe mit dem ungeliebten Mann abgebrochen hatte. Doch Henriettes mutiges Aufbegehren mündet nicht in eine harmonische Lösung des Konflikts. Auf unheilvolle Weise verliert sie sich wieder an die Familie Gebert und gerät in den Teufelskreis von Konvention und Entschlusslosigkeit. Die Tragödie neigt sich dem unausweichlichen Ende zu.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 478
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Henriette Jacoby
Georg Hermann
Vorwort
Es ist seltsam, wenn ich denke, daß sie nun wieder alle, auch alle um mich sein sollen, die schon weit draußen in der Welt leben und die mancher kennt oder zu kennen wähnt, sie, die allein mir gehören und doch wieder mir nicht mehr gehören. Und es ist seltsam, wenn ich denke, daß ich es nun wieder bin, der – ein neuer Charon – sie ihrem Schicksal entgegenführt, unerbittlich wie jener; einzig den Bord des Nachens darf ich mit Blumen umflechten.
Und wenn es fürder das Leben nicht gut mit ihnen meinte, ich könnte ja die Karten anders mischen; aber was würde es nützen? Über Glück und Unglück, über Behagen, Wunsch und Wehe ist ja schon lange der Pflug gegangen, der alles in den Boden reißt. Nehmen wir Gewesenes und Seiendes für das, was es ist: für ein Spiel; traurig oder schön ... immer nur für ein Spiel, dessen Sinn wir nicht kennen.
Georg Hermann
Ich weiß nicht, ob man sich der Geschehnisse erinnert. Genug: Onkel Jason war zuerst fortgefahren, als allererster von Jettchen Geberts Hochzeit. Er hatte eine gute Entschuldigung, daß er doch noch krank wäre. Noch vor Jettchen hatte er das Fest verlassen. Noch ehe Jettchen in jener windklaren, sternhellen Novembernacht des Jahres 1839 (ich weiß nicht, ob man sich dessen erinnert) ihrer Hochzeit in der »Gesellschaft der Freunde«, oben in der Neuen Friedrichstraße, den Rücken gekehrt hatte, ohne abzuwarten, daß Madame Spiro den Kaffee servierte, und, was noch merkwürdiger war, ohne sich zu gedulden, bis ihre schöne, mit weißem Atlas ausgeschlagene Chaise – die beste, die Onkel Ferdinand überhaupt besaß – bis der Hochzeitswagen sie nach ihrer neuen Wohnung brächte, in der Tante Hannchens Mädchen indes alle vier Zimmer geheizt hatte, damit Jettchen sie nicht zu kalt und ungemütlich fände. Jettchens Mädchen sollte nämlich erst übermorgen zuziehen. (Ich weiß wirklich nicht, ob man sich all dessen erinnert.)
Nicht eine Sekunde also hatte Jason Gebert den Wagen warten lassen. So pünktlich war er selbst nie zu einem Stelldichein gegangen, und doch konnte ihm hierin gewiß niemand Unpünktlichkeit vorwerfen. Die halbe Zeit hatte er unter dem Tisch mit seiner Uhr gespielt und die Zeiger verwünscht, die so langsam um das silberne Stundenglas krochen. Und dann hatte er wieder stocksteif dagesessen, in die Lichter gesehen und sich mit der Hand unter die weiße Halsbinde gegriffen, weil es ihm schien, als ob er erdrosselt werden sollte und als ob jemand immer wieder von hinten die Binde zuzöge, kaum daß er sie zurechtgerückt hatte. Jason Gebert begriff seinen Bruder Salomon nicht, der so breit und würdig dasaß, und Ferdinand – seinen Bruder Ferdinand –, der über die eigenen Witze lachte, daß man es durch den ganzen Saal hörte, und der immer wieder den Lohndiener Pieper rief, er solle ihm noch mal anbieten. Jason selbst bekam keinen Bissen herunter. Er hatte ja auch eine gute Entschuldigung, nichts zu nehmen; er wäre noch in der Genesung, sagte er, und der Rat Stosch hätte es ihm streng verboten. Aber Tante Rikchen, die sich als Brautmutter fühlte und für jedes Kuvert zahlen mußte, ob es nun gegessen wurde oder nicht – seine Schwägerin Rikchen wollte das nicht gelten lassen. Und sie kam selbst mit einer Schüssel und tat Jason Fisch auf – Fisch dürfe er doch essen, es gäbe nichts Leichteres als Fisch. Auch Onkel Naphtali erinnerte sich, daß er hier als Senior aller Jacobys Standesperson wäre, und sagte: »Aberr der junge Mann scheint dem teuren Menü gar keine Ehre antun zu wollen«, während der alte Onkel Eli sich begnügte, seine brave Ehehälfte, die ihm schrägüber saß, nur mit dem einen Auge anzublinzeln. Die kleine Tante Minchen schüttelte darauf zwar unwillig ihrer Marabutoque, aber sie verstand schon, was jener meinte. Als aber Salomon Gebert endlich aufstand, um Mahlzeit zu wünschen, da war sein Bruder Jason auch schon aus der Tür. Und ehe nur einer sonst recht den Stuhl gerückt hatte, hatte jener auch schon draußen seinen grauen Spenzer umgenommen und hatte die Klinke in der Hand. Ja, sie mochten oben noch nicht einmal recht aufgestanden sein – denn nach einer so reichen Hochzeitstafel läßt man sich damit Zeit –, da hatte Jason sich mit geschlossenen Augen auch schon unten in die roten Polster des Wagens zurückgeworfen, und die Pferde zogen an.
Jason Gebert konnte keinem Menschen sagen, wie ihm zumute war. Jedes Rattern des Wagens, jeder Huf schlag der Gäule traf ihn ins Hirn und gab ihm noch zu der Empfindung trostloser Leere und dumpfer Starrheit, die sich in ihm breitete, unleidliche körperliche Schmerzen. Nun hatte er gekämpft und gekämpft – und die Schlacht endlich doch verloren. Stein für Stein hatte er in Jahrzehnten aufeinandergeschichtet, und wie er dachte, nun bald den Schlußstein einfügen zu können, da war das alles, krach, in sich zusammengebrochen, und nie mehr würde er es wieder aufbauen können. Was war denn für ihn Jettchen bis heute gewesen? Ihm wurden die Augen feucht, wenn er daran dachte. Und nun war sie die Frau dieses Julius Jacoby, dieses Vetters aus Bentschen! Er sah sie als junges, fünfzehnjähriges Ding vor Augen, hinten in ihrem Zimmer nach dem Hof mit dem Nußbaum vor der Galerie. Wie hatte er sie so Schritt vor Schritt gegängelt, sie dahin gebracht, wo er sie hin haben wollte. Von Woche zu Woche hatte er sich gefreut, sie wiederzusehen. Und nun war das alles entzwei. Denn dieser Löbel Groschenmacher würde es ganz und gar niedertreten. Das wußte Jason Gebert. Und das war heute sein Abschied gewesen. Ein trauriger Abschied – nicht einmal ein Rückzug, nein, vielmehr eine Flucht, eine wirre, haltlose Flucht war es gewesen.
Nun was denn? Er würde eben noch einsamer sein, das hätte eben auch ein Ende gefunden wie alles andere hier. Noch ein Jahrzehnt würde er sich so hinschleppen, vielleicht noch länger, dies und jenes beginnen, so ungefähr, wie man nutzlos Steine in einen Brunnen wirft. Herrgott im Himmel, warum hatte er nicht schon jetzt wegtreten können, links in die Seitenkulissen hinein! Warum mußten diese lahmen alten Knochen schon wieder standhalten! Nun ja, nun wäre eben auch das zu Ende. Was scherte er sich eigentlich darum. Was ging es ihn an. Er würde sich jetzt schlicht und friedlich oben in sein schönes, warmes Zimmer setzen, auf seine grüne Damastbergere, würde die Beine von sich strecken und würde auf seine Art Abschied feiern. Richtig, da war ja noch eine Flasche Sillery, des Ernst Theodor Amadeus Hoffmann Sillery, die ihm Onkel Eli gebracht hatte – der würde er den Hals brechen. Und dann würde er sich dazu »La Vie des Dames galantes« von Brantôme vom Bücherbord herabholen, um, das halbgeleerte Glas in der einen Hand und das Buch in der anderen, den geheimen Sinn dieses schmerzhaften und närrischen Daseins zu ergründen. Bis zum Bett würde er wohl endlich immer noch herüberkommen. Wozu brauche er nach irgend jemandem in der Welt zu fragen. Nach ihm frage ja auch keiner. – Und damit kletterte Jason Gebert mühselig mit seinen lahmen Beinen aus dem Wagen.
Aber Jason Gebert hatte eben den Fuß auf das Trittbrett gesetzt, als etwas ganz Wunderbares und ganz Seltsames sich ereignete. Etwas, was Jason Gebert sich nicht erklären konnte, soviel er auch später darüber nachsann. Es war wie ein Aufblitzen in ihm, ein plötzlicher weißer Schein, so wie wir ihn zu sehen glauben, wenn wir von Explosionen oder Kanonaden träumen und dann, vom Pulverblitz geblendet, auffahren, nur damit wir um uns alles grausig finster und knisternd still finden. Jason wußte gar nicht, wie er dazu kam. Er hatte nicht mit einem Gedanken an diesen Menschen gedacht, wirklich, den ganzen Tag nicht. Und plötzlich stand doch die greifbare Gewißheit vor ihm: Doktor Kößling, da oben in seiner einsamen Stube, hinten in der Neuen Friedrichstraße, der jetzt da herumirrt, hungrig und verzweifelt wie ein Tier im Käfig – Doktor Friedrich Kößling wird sich jetzt in dieser Stunde etwas antun. Und wie Jason das aussprach, zögernd, mit einem Fuß auf dem Trittbrett, da sagte er sich auch schon, daß es nicht wahr wäre, daß es nicht mehr als eine haltlose Idee von ihm wäre, eine Einbildung – daß der andere nicht daran dächte. Aber kaum daß er es sich zu widerlegen suchte, befiel ihn eine solche drückende Angst, eine solche innere Unruhe, daß es ihm ganz eng um die Brust wurde und der Hals ihm wie zugeschnürt war. Jason Gebert glaubte nicht an Fernwirkungen und Mesmerismus. Er war viel zu sehr Skeptiker, um an irgend etwas zu glauben. Aber er wollte Klarheit haben – Klarheit, was das war. So rief er dem Kutscher zu, er möchte ihn noch einmal die Königstraße hinauffahren, gleich oben hin nach der Neuen Friedrichstraße.
Langsam zog der Kutscher, als wolle er dem Herrn Zeit lassen, sich anders zu entschließen, die Leine an, drehte langsam sein Handpferd und bog wieder schräg in die Königstraße ein. Jason Gebert aber saß da, weit vorgebeugt, hatte das Wagenfenster niedergelassen und blickte in die graue Nacht, die vom flackernden Schein der hüpfenden Gasflammen – ganz weit standen sie voneinander entfernt – nur trübe und unregelmäßig unterbrochen wurde. Von einer unerklärlichen Unruhe gepackt, starrte er hinaus, verfolgte jeden, der auftauchte und verschwand, mit den Blicken, ob es nicht Kößling wäre. Er wußte nicht, was ihn in diese Lage hineinzwang. Er kam sich vor wie ein Jäger auf dem Anstand, so spähte und lauschte er in die bewegte Dämmerung hinein, Erwartung in jedem Muskel. Da aber erblickte er ganz von ferne einen grauen Schatten, er hörte den Klang von Schritten, und er fühlte am Rhythmus der Bewegung, daß das ein Gang war, den er kannte, und daß das ganz jemand anders war als der, den er hier suchte. Und plötzlich schien Jason Gebert all das, was eben mit ihm geschehen, so unheimlich, daß es ihm vor sich selbst graute. Und er schrie dem Kutscher: »Halt!«, und er sprang mit beiden Füßen hinaus – er vergaß ganz seine Schwäche und seine Unbehilflichkeit –, und er hinkte über die krachenden Wasserlachen, den Hut im Genick und den Spenzer weit offen.
»Jettchen! Um Himmels willen, Jettchen!« rief er. »Was ist?«
Jettchen fuhr zurück und blieb stehen. Sie war noch eben mit ihren Gedanken weit fort gewesen.
»Ach, Onkel Jason«, sagte sie, sonst nichts, und lächelte so wie ein Kind, das man beim Naschen ertappt. Sie war ganz rot von der Luft. Das sah Jason. Und sie lächelte konnte noch lächeln.
»Du wolltest zu mir?«
»Vielleicht«, sagte Jettchen, »ich weiß nicht. Jedenfalls wollte ich fort.«
»Dir hat's da oben bei der Hochzeit wohl auch nicht gefallen«, sagte Jason, und jetzt mußte er gleichfalls lächeln, »ebenso wie mir.« Und damit griff er nach Jettchens Hand, die den Mantel zuhielt, und streichelte sie leise, während durch die Tränen, die er im Auge hatte, die Gestalt vor ihm verschwamm. »Aber du wirst dich in deinen leichten Schuhen erkälten, du großes Kind, du«, meinte er dann. »Das ist kein Wetter zum Promenieren. So kannst du dich anziehen, wenn erst wieder im Charlottenburger Schloßgarten die Vögel singen. Komm, Jettchen, da drüben hält mein Wagen.«
Jettchen schüttelte traurig den Kopf.
Jason nahm wieder ihre Hand. »Sage mal, Jettchen, bin ich nicht immer, solange du denken kannst, auf deiner Seite gewesen? Und meinst du, ich bin nun mit einmal gegen dich? Komm, wir sprechen im Wagen. Denke nur, wenn uns hier jemand sieht ...«
Jettchen ließ sich ruhig und ohne Widerstand von Onkel Jason führen. Beim Einsteigen stützte sie sich sogar schwer auf seine Schulter, während Jason Gebert dem Kutscher sagte, er möchte hier auf und nieder fahren und dann zu seiner Wohnung zurückkehren.
Jason konnte nun Jettchens Gesicht nicht mehr sehen, denn sie hatte sich tief in den Fond des Wagens zurückgelehnt. Aber er spürte mit dem ganzen Körper ihre Nähe, und ihm kam mit einmal zum Bewußtsein, was ihm dieses Mädchen war – viel mehr, als er sich gestehen konnte.
»Jettchen«, begann er endlich, »wollen wir nicht einmal als zwei vernünftige Menschen miteinander reden? Weißt du denn auch, Jettchen, was du getan hast, wenn du jetzt deinem Mann nach der Trauung davongehst?«
Jettchen nickte nur; dann sprach sie, und jedes Wort rang sich von ihr los. »Ich kann nicht, Onkel Jason – ich kann nicht. Ich habe die ganzen Tage gewartet und gewartet – irgend etwas, habe ich gedacht, muß geschehen. Ich habe gefiebert und gebebt jede Sekunde. Ich habe immer gemeint, Onkel Salomon müsse es mir doch ansehen und zu mir sprechen. Und dann – dann hätte ich es gesagt, daß ich es nicht kann. Ich habe geglaubt von Minute zu Minute, es käme noch irgend etwas Unerwartetes, etwas, was man sich gar nicht ersinnen könnte. Aber plötzlich hatte man mir schon die Schlinge über den Hals geworfen, ich habe schreien wollen, ich habe nicht glauben wollen, daß es wahr sein kann. Und da bin ich – weißt du, Onkel ...«
Jettchen beugte sich vor, und Jason sah Jettchens Gesicht, das vom Schein einer Laterne mit einer scharfen Lichtkante umzogen war, und wie ein rotblitzendes Juwel hing ihr eine Träne an der Wimper. Jason aber hatte das Gefühl, als müsse er diese Träne fortküssen. Denn in dem grenzenlosen Mitleid, das er für Jettchen empfand, flammte plötzlich etwas anderes auf, was er sich vordem nie eingestehen wollte und dessen er sich vordem nie bewußt war. Aber gerade deshalb ergriff er nur Jettchens Hand, und er hatte sie immer noch in der seinen, die schöne, fleischige Hand mit dem breiten Brillantring und dem Goldreif an dem schlanken Finger – Jason Gebert fühlte den neuen Goldreif –, immer noch in der seinen, als er schon geendet und als der Wagen, der sich hinten jenseits des Alexanderplatzes in einem Wirrnetz und einem Bergauf und Bergab halbdunkler, ausgestorbener Straßen verirrt und verfangen hatte, wieder neben den flammenden Kandelabern der Königsbrücke entlangratterte.
Jason sprach lange, ruhig und klug. Zuerst von den Tatsachen, dann von den Aussichten. Jettchen wollte nicht zu ihrem Mann? Nein? Gut, damit müsse man sich abfinden. Zwingen könne sie niemand. Aber sie müsse auch wissen, daß das nun ihr Mann sei. Das Gericht habe nicht zum Scherz heute mittag sein Siegel darunter gedrückt. Der Herr Staat sei eine Person, die keine Sentiments kenne und nicht mit sich spaßen lasse. Er könne davon ein Lied singen, und das wäre ebenso schön wie der »wackere Lagienka«. Soweit er die Lage überschaue, wäre Jettchen völlig mittellos, und alles, was sie besäße, wäre von Salomon in die Hände ihres Mannes gelegt. Das würde Schwierigkeiten ergeben. Denn wenn Julius Jacoby sie auch wohl endlich losließe – er habe ja keine Macht, sie zu binden –, so glaube er den neuen Vetter genug zu kennen – vom Geld würde er sich nicht trennen. »Die Sache, liebes Jettchen, wird – das sehe ich jetzt schon – sehr schmutzig werden und viel Lärm geben. Wir müssen zusehen, daß wir in aller Stille auseinanderkommen. – Du liebst Doktor Kößling?« Jettchen nickte.
»Ich will dich nicht fragen, wie du mit ihm stehst. Du bist ja Herrin deiner Entschließungen und längst alt genug, um alles vom Leben zu erfahren.«
»Nein!« rief Jettchen, fuhr auf und umklammerte wie flehend Jasons Hände. »Glaube das doch nicht von mir, Onkel.«
Jason lächelte, denn nicht ohne Absicht hatte er diesen Seitensprung getan, und fuhr dann freier fort: »In das Haus von Onkel Salomon kannst du nicht zurück, Jettchen, und selbst wenn man es dir freistellt, wirst du über kurz oder lang dort gerade das tun, was du nicht willst. Dafür kenne ich meine lieben Schwägerinnen viel zu gut. Überhaupt, das begreifst du wohl, hast du jetzt mit einemmal die ganze, aber auch die ganze brave Familie gegen dich. Da darfst du dich gar keinen Hoffnungen hingeben. Kein Mensch wird auf deiner Seite sein, und kein Mensch wird dich verstehen, vielleicht nicht einmal der, den's am nächsten angeht.«
»Doch, doch«, rief Jettchen.
»Und deshalb, meine Freundin« – Jason überhörte die Einwendung –, »wirst du vorerst bei mir bleiben. Ich werde dich unter meine Fittiche nehmen, du armes, verirrtes Küken, du. Wie eine Löwin ihr letztes Junges werde ich dich verteidigen. Aber – mache mir keine Dummheiten, Mädchen. Setze dich nicht damit ins Unrecht. Du brauchst die Sympathie der Leute. Du hast einen Kampf angefangen, Jettchen, verstehst du – einen Kampf, du konntest nicht anders. Ich sage nicht ein Wort dagegen. Ich will dir helfen. Aber – keine Dummheiten. Du bist jetzt nicht mehr Jettchen Gebert, sondern Frau Henriette Jacoby, die man überall unmöglich machen kann. Und dann, Jettchen, mußt du dir ja selbst sagen, daß null und null erst hundert ergibt, wenn eine Eins davorsteht. Solange sind die zusammen nur ein kümmerliches Nichts, das eben nicht auf die Dauer bestehen kann. Und nun, mein altes Mädel, reden wir von etwas anderem. Fürs erste also wohnst du bei mir. Alles andere findet sich. Paß auf, wie nett wir's uns machen werden, du mein kleines Hausmütterchen, du. Eigentlich freue ich mich doch recht, daß ich dich erwischt habe. Mir ist es nämlich eben ganz eigen gegangen, und wer weiß, was du sonst getan hättest – jedenfalls nichts Gutes. Denke nur, was du denen da oben allen, die doch nicht wissen, wo du hin bist – was du denen für einen Schreck eingejagt hast!«
So sprach Jason, lang und bedächtig, klug und doch sarkastisch, wie das so seine Art war. Jettchen saß ganz still dabei, und nach all der Angst und all der Unruhe, all der Kälte und Benommenheit der letzten Tage hatte sie hier in dem dunklen, weichen Wagen das erste Mal wieder das Gefühl von Wärme und Geborgensein, und sie sah halb erstaunt nach den blinzelnden Laternen, die da draußen vorübertanzten, während der Wagen leise und langsam weiterschwankte. Für den Augenblick hatte sie die Empfindung, als ob all das, was sie erlebt, ganz fern läge und als ob sie das gar nicht sei, die das getan, sondern irgendwer Fremdes. Dann aber drang wieder die ganze Ungewißheit ihrer Lage auf sie ein, und Jettchen schmiegte sich an Jason und umfaßte ihn mit ihren Armen und begann zu weinen, von tief auf zu schluchzen. Und unter Tränen sagte sie ihm, wie gut er zu ihr wäre, daß er sie nicht verließe, da doch keiner etwas von ihr wissen wolle. Aber Jason antwortete ihr, daß sie eine Närrin wäre und daß sie immer der Liebling von allen gewesen wäre und daß sie das auch bleiben würde. Sie sollte nur sehen, sie würden es so nett zusammen haben. Und später würde sich alles für sie schon gut gestalten. Dafür wolle er sorgen – das verspreche er.
So redete Jason. In seinem Innern aber klangen ganz andere Stimmen, die Trauer und Besorgnis kündeten.
»Und ahnt denn Kößling, was du getan hast?«
»Ich glaube nicht, Onkel, ich glaube es nicht.«
»Soso«, meinte Jason, und er wiegte nachdenklich den Kopf. Er merkte gar nicht, daß der Wagen schon hielt.
Dann aber kletterte er langsam zur Chaise hinaus, denn seine Füße waren müde geworden, und half Jettchen beim Aussteigen. Hell in der Dunkelheit der Sternennacht sah Jason sie vor sich stehen. Er hörte in der Finsternis das Knistern ihres Atlaskleides, und er spürte die Kühle ihrer freien Arme. Und im Augenblick kam ihm dabei die Erinnerung an so manches liebe Mal, da er hier einer Schönen aus dem Wagen geholfen; und lächeln mußte er über die seltsame Rolle, die er heute dabei spielte. Sie zeigte ihm, daß er doch nun alt und abgetan war, während ihm irgendwie doch wieder dabei der Gedanke durch den Kopf schoß an den Mann aus der Bibel, der auszog, seines Vaters Eselin zu suchen, und statt ihrer ein Königreich fand.
»So, nun führe ich meine Braut heim«, sagte Jason fast spöttisch, in jenem Ton, den er so liebte und von dem er glaubte, daß er seine eigentliche Meinung und seine eigentliche Stimmung ganz verbarg; und er küßte Jettchen mit einer gesucht altmodischen Bewegung die Hand. Dann öffnete er das schwere Haustor, ließ Jettchen den Vortritt und hinkte schnell wieder zum Wagen zurück: der Kutscher solle warten, er bekäme auch nachher ein gutes Biergeld.
Einen Augenblick stand so Jettchen in der Dunkelheit allein in dem Vorflur, und sie war ihr lieb, die Stelle. Sie wunderte sich über den Kreislauf, daß sie nun wieder hier wäre. Alles andere, die letzten drei Tage schienen verblaßt und verklungen, die Gedanken an Doktor Kößling, ihren Liebsten, kamen ihr zurück und mit ihnen wieder die Tränen, daß sie sich an die Wand lehnte und still in sich hineinschluchzte.
So fand sie Jason; und scherzend, als sähe er es gar nicht, bot er ihr den Arm und geleitete sie vorsichtig die spärlich erleuchteten Treppen hinauf. Sie erschienen so weit, unheimlich und spukhaft mit ihren geschweiften, geschnitzten Geländern, den breiten Stufen, den hohen, weißen Türen und dem schwarzen Nachthimmel, der mit vielen Sternen durch die riesigen, vielscheibigen Flurfenster hineinsah. Und als Jason oben schloß, flatterte das alte Fräulein Hörtel in ihrem geblümten Kleid wie ein Käuzchen vorbei.
»Komm, Jettchen, du sollst hier vorne dein Reich bekommen, du altes Mädchen, du.« Damit öffnete Jason die Tür zum grünen Zimmer und ging zum Tisch, auf dem die Moderateurlampe stand. Er schlug mit seinem Taschenfeuerzeug Licht, das das Zimmer zuckend und unruhig durchflammte und riesige, unbestimmte Schatten warf. Aber Onkel Jason hatte noch nicht die Lampenglocke gehoben, als er die Empfindung hatte, es fiele hinter seinem Rücken ein schwerer Gegenstand dumpf zur Erde. Ohne sich zu wenden, rief er schrill nach Fräulein Hörtel.
Als er sich dann umdrehte, lag Jettchen neben einem Stuhl auf der Erde. Sie hatte sich vielleicht noch setzen wollen, hatte sich vielleicht auch niedergesetzt, aber plötzlich hatte ihre Willenskraft versagt, und sie war zusammengebrochen, war seitlich vom Stuhl geglitten.
Fräulein Hörtel steckte erschrocken ihren alten Kopf durch die Türspalte.
»Mein englisches Salz«, sagte Jason halblaut, »es steht auf der kleinen Spiegeltoilette.« Dann kniete er nieder, öffnete den schweren Mantel, daß Jettchen in ihrem weißen Atlaskleid auf der roten Innenseite des Mantels wie auf einem roten Teppich lag, und hielt der Ohnmächtigen das geschliffene Kristallfläschchen vors Gesicht. Als Jason aber – Jettchen lag wie tot und war weiß wie ihr Brautkleid – keine Veränderung an ihr gewahrte, schob er vorsichtig den einen Arm unter ihren Rücken und den anderen unter ihre Knie, und ganz langsam und zitternd erhob er sich mit der schweren weißen Last und trug sie – die weiße Schleppe schleifte dabei über den Boden – zu seinem Bett.
»Wir müssen das Kleid öffnen, Fräulein«, sagte er. Und während das alte Fräulein Hörtel, die noch nicht mit einem Wort ihr Erstaunen geäußert hatte, an Jettchens Taille herumbastelte, suchte Jason draußen unter den Weinflaschen nach dem Sillery, den er ja noch heute hatte trinken wollen. Da er aber die Schnur, die den Kork hielt, so schnell nicht lösen konnte, so schlug er der Flasche den Hals ab, daß ihm Wein und Schaum über die Hände sprudelten. Und er nahm einen silbernen Löffel und lief wieder vor in das grüne Zimmer.
Fräulein Hörtel hatte es Jettchen ein wenig frei gemacht, ihr auch das Haar gelockert, und Jettchens Brüste atmeten ganz leise unter den breiten weißen Spitzenbesätzen, und das goldene Medaillon bewegte sich ganz leise zwischen ihnen bei den Atemzügen. Die Augen aber waren noch immer geschlossen und der Mund fest zusammengepreßt. Und als Jason ihr den Kopf hob, um Jettchen – das Haupt in seinem Arm – mit dem Löffel den gelben, sprühenden Wein einzuflößen, und als nun in dem Gesicht die dunklen Augen wieder langsam zu sprechen begannen ... und als Jettchen, ganz von fern herkommend, Jason zuerst so fremd und scheu anblickte, bis sie mit langsamem Lächeln und dankbarem Staunen alles um sich wieder erkannte und sich ihre Lage wieder zurückrief – da spürte Jason Gebert zum ersten Mal, heute an diesem Abend, wie schön doch dieses Mädchen sei, von welcher seltenen und erlesenen Schönheit, zart und unergründlich, fremd und rätselhaft wie das Leben selbst. Und eine ganze Weile saß er so vor ihr und blickte sie an, nachdenklich lächelnd, ohne zu sprechen. Er fühlte den Reiz und die Fremdheit allen Frauenlebens, das neben uns ist und doch so unendlich fernbleibt, um das wir unser Lebtag kämpfen, und das wir doch nie erringen, ja, das selbst nicht unser wird, wenn wir es in den Armen halten. Und in Jason quoll zugleich ein Mitleid mit dieser Schönheit auf, deren Schicksal es war zu leiden, wie eben Schönheit leiden muß.
Endlich aber, als Jettchens Augen wieder die alte Klarheit zurückgewonnen hatten, sprach Jason noch einmal zu ihr, daß alles gut werden würde, daß sie sich nur keine Gedanken machen sollte und daß sie fürs erste ruhig bei ihm bleiben sollte. Er würde für sie eintreten und für sie sorgen. Sie solle jetzt hier nur ruhig liegen, ganz ruhig, und sich nicht regen. Fräulein Hörtel würde ihr Gesellschaft leisten. Da wäre noch Wein, und da wären Biskuits. Aber sie solle entschuldigen, er wolle sich nun auch zurückziehen, denn er sei sehr müde.
Jettchen hatte nichts dawider. Die Anspannung und Erregung der letzten Tage, die ihre Kräfte gesteigert hatten, waren plötzlich gewichen, und es war zu einer Erschöpfung und zu einem Zusammenbruch ihrer Seele und ihres Körpers gekommen, die keiner erneuten Entschließung mehr fähig waren und nur ein weichmütiges Sehnen nach Ruhe und Auflösung noch kannten. So sah Jettchen statt jeder Antwort Onkel Jason nur tief und dankbar in die Augen, als er sich leise über sie neigte, um mit seinen Lippen ihre kühle, weiße Stirne zu streifen.
Auf den Zehen zog sich Jason zurück und winkte dem alten Fräulein, sie dürfe nicht von Jettchens Seite, und sie solle ihr ab und zu noch einmal Champagner geben; die Tür aber sollte sie hinter ihm schließen, ganz leise, damit Jettchen nicht merke, daß er fortginge.
Sehr vorsichtig schlich Jason im Halbdunkel das dämmrige Treppenhaus hinab und weckte unten den Kutscher, der auf seinem Bock eingenickt war. Er solle ihn wieder zurückfahren zur Hochzeit.
Der Kutscher aber, der ein galantes Abenteuer hinter alldem vermutete, sagte nur: »Uff mir können Se Häuser bau'n, ick schweig' Ihnen wie't Jrab.«
Als Jason vor der »Gesellschaft der Freunde« ausstieg, hörte er es schon brausen wie von einem Bienenschwarm. Zuerst war Tante Minchen darauf aufmerksam geworden, daß Jettchen fehlte, und da mochte sie schon eine ganze Weile fort sein. Denn, wie das so bei Festen geht, jeder feiert nur sich selbst, und niemand kümmert sich um den, den man eigentlich ehren will.
»Wo ist doch Jettchen?« fragte Tante Minchen und sie zog mit ihrem langen Kometenschweif von Schleppkleid hier- und dorthin in den Saal und in die Nebenräume.
»Ich hab' sie eben noch gesprochen«, sagte das Fräulein mit den Pudellöckchen und verfestigte einen Faden an ihrer Näharbeit.
Julius Jacoby saß bei Onkel Naphtali und entwickelte ihm seine Tendenzen der Geschäftsführung.
Rikchen war liebenswürdig gegen irgendwelche Gäste, die ihr gleichgültig waren, denn gerade gegen die muß man immer am liebenswürdigsten sein, weil sie »draußen« erzählen, und Rikchen hatte infolgedessen für Minchens Frage keine Zeit. Nur Ferdinand, der seit Vormittag nicht so recht nüchtern geworden war, lachte und rief ganz laut: »Jettchen wird rausgegangen sein – 'ne Braut ist sozusagen auch ä Mensch.« Und das hielt er, bescheiden in geistigen Dingen, wie er immer war, für den besten Witz, den er an diesem Tage gemacht hatte.
Aber Tante Minchen gab sich damit nicht zufrieden und trieb weiter ihren Zickzackkurs. Diese und jene blickten auf und sahen dann einander fragend an. Wolfgang beteiligte sich am Suchen und steckte den Kopf hinter alle roten Vorhänge. Und die kleine Tante Minchen brachte so plötzlich eine seltsame Unruhe und Befangenheit in die Gesellschaft. Keiner wußte eigentlich recht, weshalb.
»Was suchst du, Minchen?« fragte Salomon.
»Ich seh' Jettchen nich. Wo is se doch?«
Salomon bekam einen Schreck. Er winkte Ferdinand, und die Bewegung, mit der er Ferdinand winkte, machte, daß er im Augenblick vollkommen nüchtern wurde. »St, Ferdinand«, sagte Salomon, faßte seinen Bruder beim obersten Knopf seines Gilets und zog ihn in eine Ecke des hohen Fensters. »St, Ferdinand!« Salomon wiegte den Kopf im Genick und sah sehr ernst aus seinen beiden Augen. »Jettchen – hm –, sie ist weg!« Salomon sagte kein Wort mehr, aber die beiden Brüder verstanden einander.
»Ich werde mal nach der Wassertür gehen«, sagte Ferdinand, denn das Grundstück ging auch zu dem breiten, trägen Wasser der Spree hinaus. »Und Max soll den Türsteher fragen, ob jemand fortgegangen ist.«
Drinnen begann die Musik den »Liebeszauber« zu spielen. Aber man lief hinein – sie sollte aufhören.
Hannchen kam hinzu. »Wo willst'n hin, Ferdinand?«
Aber in Ferdinand, dem rohen, derben Ferdinand, quoll plötzlich eine wilde Wut auf, wie er seine kleine, breite Frau in ihrer ganzen behäbigen Selbstgefälligkeit so vor sich stehen sah. In seinem Hirn, das sich sonst nie mit Gedanken abgab, die über Tag und Stunde und über die gröbsten Bedürfnisse des Genusses und des Erwerbs hinausgingen, dämmerte plötzlich, wenn auch unbestimmt und verschwommen, die Wahrheit und Möglichkeit der Zusammenhänge. Und all das, was sich hier ereignet hatte, und sein ganz wildes und verfehltes Leben dazu, begriff er plötzlich, fühlte es in seinen Wurzeln, ohne daß er dem Worte geben konnte. Nur eine Wut, eine haltlose Wut kam über ihn; und ohne zu bedenken, wo er war, ohne auf Ort und Stunde zu achten, schrie er laut in den Saal hinein, daß Jettchen fort wäre und daß er seine Hände in Unschuld wüsche. Sie hätten es gewollt, nun hätten sie es ja.
Alles lief zusammen. Auch Julius, der ganz ernst und kleinlaut war, kam hinzu.
»Nu, nu, regt euch nicht auf«, sagte er, »sie wird schon wiederkommen.«
»Wenn se auf mich gehört hätten«, sagte Eli, den doch schon nicht mehr so recht etwas aus der Ruhe brachte, »dann wär' das nich passiert. Ich weiß nich, frieher sind se immer alle zu mir gekommen; aber seitdem ich kein Geld mehr habe, meinen die Leit, ich hätt' auch keinen Verstand mehr. Aber jedenfalls werd' ich doch mal nach de Königstraße zum Herrn Viertelswachmann gehen, der kennt mich sogar sehr gut.«
Onkel Naphtali aber mußte man mühsam erklären, was sich ereignet hatte. Als er es aber endlich begriffen hatte, sagte er nur: »E so – ich hab's kommen sehen. Se hat mer gleich nich gefallen. So is keine Braut!«
Pinchen und Rosalie saßen umgefaßt in einer Ecke und weinten sich einander in die Augen und schluchzten ein Mal über das andere: »Die Schande! Die Schande! Unser armer Junge!«
Auch Hannchen, die stets Lachen und Weinen in einem Sack hatte, war nun sogleich aufgelöst in Tränen und fuhr sich kreuz und quer mit dem Spitzentuch über ihr breites Kindergesicht. Daß so etwas in ihrer Familie passieren müßte! Solange wäre nun alles gut gewesen. Aber sie wisse schon, wo Jettchen hingelaufen wäre.
Rikchen, die ganz weiß geworden war, meinte, das könne sie doch von Jettchen nicht glauben.
Aber das Fräulein mit den Pudellöckchen sah, völlig eingewickelt in einen alten bauschigen Flauschmantel, wieder zur Tür hinein. »Ich geh' mal nach den Obstkähnen, Herr Gebert«, sagte sie. »Vielleicht hat sie da einer gesehen.«
Julius Jacoby meinte, ob man nicht Jettchen hier durch Soldaten suchen lassen könnte; bei ihnen könnte man das.
Aber Hannchen sagte immer bestimmter, sie wüßte, wo Jettchen zu finden sei, sie hätte das lange schon beobachtet; aber sie hätte nichts sagen wollen. Und wenn man Hannchen jetzt gefoltert hätte, sie hätte ihre Aussage nicht widerrufen. Sie wüßte, was sie wüßte; sie wüßte es schon lange und hätte es vorher sagen können, wenn sie auch Jettchen für so niedrig und verderbt nicht gehalten hätte.
Die Gäste bildeten Gruppen, und alle steckten die Köpfe zusammen wie Schafe beim Gewitter.
Ferdinand kam zurück, er rief Salomon zu sich. Die Wassertür sei gottlob verschlossen gewesen. Der Türsteher hätte sich nicht vom Platz gerührt, und er hätte dabei nichts gesehen, gar nichts – sagte Max. Aber was er nicht sagte, weil er es nicht wußte, war, daß der Türsteher die ganze Zeit über oben bei den Dienstmädchen gewesen war, allwo er seinem kummervollen Leibe und Herzen neue Nahrung zugeführt hatte. Oder meinte einer, daß man von Amt und Gehalt eines Türstehers diesen Körperumfang gewinnen könnte?
Ob man nicht alle Mädchen, die von Rikchen, Hannchen, Minchen, die Näherin, die Scheuerfrauen aus dem Geschäft, die im Hintergrund tafelten, ausschicken sollte, Jettchen zu suchen – schlug Minchen vor.
»Man wäscht seine schmutzige Wäsche nicht vor fremden Leuten«, sagte Ferdinand so laut, daß es alle fremden Leute hören konnten. »Oder meinste, se werden nich schon so genug reden?«
Julius Jacoby hatte einen sehr roten Kopf bekommen und trippelte hin und her. »Wenn Jettchen nur nichts passiert ist«, sagte er jetzt.
Einige Gäste rüsteten sich zum Gehen, denn sie verstanden eigentlich nicht, was sie hier noch sollten. Die Unruhe und Ungewißheit hielt sie noch am Ort. Ganz laut und ohne Rücksicht auf den Gastgeber besprachen sie den Vorfall.
Das arme Mädchen! Man hätte es sich sagen können, daß das kein gutes Ende nähme. Sie hätten schon deshalb nicht kommen wollen, und nur um nicht zu beleidigen, hätten sie nicht abgesagt. Aber man hätte es Salomon Gebert auch so zu verstehen gegeben ... Der Madam Spiro war vor Aufregung das Spitzenhäubchen ganz auf die linke Seite gerutscht, und sie lief umher, ratlos und hilflos, als ob sie irgendwelche Schuld träfe. Nur der brave Onkel Naphtali hatte ein kleines, dünnbeiniges Tischchen vor sich und trank in aller Ruhe seinen Kaffee; aber ohne Milch – vor sich hin summend wie eine Fliege in der Ofenecke. Er war nicht zufrieden: Erstens war mit der Trauung was passiert; den einen Absatz hätte nicht der Geistliche, sondern Salomon sagen müssen. Bei ihm zu Hause käme so etwas nicht vor, des könnte man versichert sein. Zweitens hatte er dem Essen mißtraut. Denn er war ein wirklich frommer Mann. Und jetzt endlich war die junge Frau sogar nicht mal da. Lauter Ungelegenheiten!
Eli kam wieder. Der Viertelswachmann wäre nicht zu Hause gewesen, aber er hätte bei ihm eine Botschaft hinterlassen. Das Fräulein mit den Pudellöckchen trat auch ein ganz außer Atem. Einer hätte jemand da langgehen sehen; aber die Beschreibung hätte wohl nicht auf Jettchen gepaßt. Und Max kam zurück und nach ihm Wolfgang, der, ohne einem etwas zu sagen, heruntergelaufen war, gleich so, wie er ging und stand, und der nun ganz durchgefroren war und nur so zitterte wie ein geschorenes Windspiel. Hannchen sagte, der Junge wolle sich wohl mit Gewalt krank machen, er könne sich ja den Tod holen – und das wäre es nicht wert. Und sie gab ihm eins gegen den Hinterkopf. Aber Madame Spiro brachte ihm eine Tasse heißen Kaffee, er solle sich mal aufwärmen. Der Junge kriegte vor Tränen nicht einen Schluck hinunter. Und Salomon sagte, man müsse nun doch die Stadtwache benachrichtigen; und dann setzte er sich in eine Fensternische und nahm den Kopf zwischen beide Hände. Ferdinand meinte, man solle noch etwas warten, denn man liefere sich damit einfach der Öffentlichkeit aus, und tun könnte sie ja doch heute nichts mehr. Vielleicht wüßte Jason Rat. Man sollte einmal zu ihm schicken. Aber Salomon schüttelte nur traurig, mit müden Augen, den Kopf.
»Lieber Ferdinand, lassen wir Jason aus dem Spiel dabei«, sagte er. »Was soll's ihm – er ist doch noch krank.«
In Wahrheit fürchtete Salomon, seinen Bruder Jason jetzt wiederzusehen, denn jetzt wußte er, daß er trotz allem, was er getan hatte, trotz der vielen Tausende von Talern, die er für Jettchen hingegeben ... er recht schlecht für Jettchen gesorgt hatte, daß er ein Gut vergeudet und vertan hatte, das in seine Hände gelegt worden war. Ja, er wußte nicht, was er antworten sollte, wenn jener kam und ihm wortlos Rechenschaft abverlangte. Und auch jedesmal, wenn Salomon Elis Stimme hörte – und der alte Onkel Eli sprach heute sehr laut, denn er hatte seinen tauben Tag und war deswegen der Meinung, daß alle Welt schwer hörte –, jedesmal, wenn der alte Onkel Eli den Kopf schüttelte, daß der weiße Puder stäubte, und irgend jemand versicherte, daß sie es in »seine« Familie, bei »de Geberts«, von jeher alle immer »als mit de Liebe« hätten und daß er gleich gesagt hätte, zu solche Sachen wie die hier pflegt man nach fünfundzwanzig Jahre zu gratulieren; daß man aber leider nich auf ihn gehört hätte ... jedesmal, wenn Salomon Elis Stimme hörte, fuhr er zusammen, als ob gegen ihn eine Anklageschrift verlesen werden sollte.
Rikchen und Hannchen hatten Julius umzingelt und redeten auf ihn ein. Rikchen sagte, er solle sich nicht erregen, Jettchen würde schon Vernunft annehmen: sie wisse das, sie kenne Jettchen, und sie verstehe sie. Aber Hannchen sprach nur von ihrem Verdacht. So würde es schon sein. Auch Naphtali sagte, daß er sich genau erinnere, daß mal »ä ähnliche Geschichte vorgekommen sei mit de geborene Reitzenstein«. Minchen aber ging überall umher und sagte immer dasselbe: Jettchen würde schon wiederkommen, sie könne das nicht glauben! Ferdinand eilte wieder zu Salomon. Man müsse Jason holen. Man müsse zu erfahren suchen, wo der andere wohne. Salomon sträubte sich. Er würde dazu nie und nimmer seine Zustimmung geben.
Von Minute zu Minute wuchs die Unruhe. Jeder schlug etwas anderes vor. Jeder wollte den andern überstimmen und überschreien; und jeder dachte, je lauter er seiner Meinung Ausdruck gab, desto eher würde die Stimme in seinem Innern zur Ruhe gebracht werden, daß ja doch alles zwecklos wäre und daß sich Jettchen nur von der Tafel gestohlen hätte, um in dieser Welt nie wieder an ihr teilzunehmen. Denn so ist nun einmal der Mensch, daß er eine Gewißheit nie glauben will und sie nie sogleich in ihrer ganzen Bedeutung zu begreifen vermag. Immer wieder sträuben wir uns, unsere Hilflosigkeit den Tatsachen gegenüber einzugestehen. Und wir versuchen sie niederzureden wie einen überlegenen Gegner, der uns mit seinen Gründen in die Enge treibt. Und deshalb sprach auch hier alles durcheinander. Jede Gruppe hatte ihren Sprecher, jede Meinung ihren Verteidiger; jeder Vorschlag wurde erwogen und bestritten, und keiner kam zur Ausführung.
Mitten in diesen Lärm und in dieses Gewoge und in das Hinundherlaufen und in die Unruhe von den vielen knisternden Schleppen hinkte Jason in den Saal hinein. Ruhig und ernst, mit seinen harten Zügen, die noch schärfer als sonst erschienen nach der Krankheit und nach der Erregung der letzten Stunde. Keiner achtete zuerst auf ihn, trotzdem Jason Gebert seinen grauen Spenzer nicht abgelegt hatte und seinen hohen, geradkrempigen braunen Zylinder in der Hand hielt. Denn jeder war mit sich selbst beschäftigt; und wer Jason etwa sah, dachte eben, man hätte ihn geholt oder er wäre nur fortgewesen und käme nun zurück.
Jason ging auf Salomon zu, der vor einem Tischchen saß und den Kopf in die Hände gestützt hatte.
»Nun, Salomon«, sagte er und berührte seinen Bruder an der Schulter, »was gibt es?«
Salomon Gebert blickte auf und sah Jason fragend an. »Weißt du: Jettchen ist fort, Jason.«
Jason zuckte nur mit den Schultern. »Das war zu erwarten«, meinte er. »Ich habe nicht geahnt, daß es so kommen würde«, sagte Salomon, und zwei dicke Tränen liefen ihm übers Gesicht.
»Willst du einen Augenblick mit mir in das Zimmer gehen?« meinte Jason. »Bitte, ich hätte mit dir zu reden.«
Und Salomon stand auf und folgte ihm in das kleine Zimmerchen, das am Flur lag.
Alle blickten ihnen nach.
»Jason weiß was«, meinte Minchen.
»Laß ihn nur, er wird schon machen«, versetzte Eli, denn er hielt große Stücke auf seinen Neffen Jason Gebert.
»Du, jetzt spricht Jason mit Salomon«, rief Hannchen.
»Pst. Jason Gebert spricht mit ihm«, schwirrte es durch den Saal.
»Nu, ich werd' wohl auch noch dabeisein dürfen«, rief Julius Jacoby.
»Ich rat dir gut, bleib draußen«, meinte Rikchen.
Und Jason sprach. Er sagte zuerst, daß Jettchen fort wäre. Man hätte sich hier wohl sehr um sie geängstigt.
Wo sie wäre, meinte Salomon. »Bei ihm.« Salomon stutzte. Wie das käme? Ja, sie müsse hier fortgelaufen sein – weiß Gott, wo sie hin wollte –, kurz nachdem er gegangen. Durch einen Zufall, durch ein Glück hätte er sie aufgegriffen. Mit aller Mühe und aller Überredung hätte er Jettchen in seine Wohnung gebracht, da wäre sie ihm aber ohnmächtig geworden, und er hätte sie in sein Bett gepackt. Ferdinand solle doch ja noch zu Stosch schicken, vielleicht sieht er noch heute nacht nach ihr.
Salomon ging auf und ab. Er hatte den Kopf gesenkt und beide Hände an den Schläfen. »Ja, jetzt, jetzt läuft sie fort. Warum ist sie denn nicht eher gekommen? Bin ich denn ein Hund? Beiße ich denn – Was soll denn nun werden? – Was soll denn nun werden? – Kannst du mir das vielleicht sagen, Jason?«
»Scheidung«, sagte Jason ganz kurz und trocken.
Salomon hatte sich schnell erholt; er begann jetzt, die Angelegenheit sogleich wie ein Geschäft zu behandeln, zu dem man einen klaren Kopf braucht, um nichts zu verprudeln.
»Ja«, meinte er, »vielleicht ließe sich das so ordnen. Man muß zusehen.« Aber im Innern hoffte er schon, man würde es doch des lieben Friedens willen umgehen können.
»Aber Jason, da kann man natürlich heute oder morgen nichts tun, und vor allem Julius muß da ...«
»Nun«, meinte Jason, »jedenfalls ist sie doch in Sicherheit. Und das ist doch mir wie dir vorerst wohl die Hauptsache.«
»Ja, warum soll ich es nicht sagen, ich hab' mich wirklich sehr um Jettchen geängstigt; denn weißt du, sie ist doch gerade, als ob sie mein Kind wäre; und Rikchen – so hab' ich sie überhaupt noch nicht gesehen, solange wir verheiratet sind!«
»Na«, unterbrach Jason, und dieses »Na« klang sehr eindeutig, »das hätte sie sich ersparen können, denn die Rechnung deiner Frau hätte um ein Haar ein sehr schlimmes Resultat ergeben. Darüber sind wir uns doch wohl beide – wie wir hier stehen – vollkommen einig. Jedenfalls versprich mir nur das eine, Salomon, lassen wir den Dingen ruhig ihren Lauf. Vorerst ist und bleibt Jettchen bei mir, und in ein paar Tagen reden wir einmal darüber.«
»Sie kann ruhig zu uns zurück. Wir werden ihr nichts in den Weg legen.«
»Das ist ja jetzt nicht so wichtig, lieber Salomon.«
»Gewiß nicht«, sagte Salomon, und er hatte seine ganze alte Festigkeit wiedergewonnen. »Und meinst du, daß Jettchen mit dem andern ...«
»Sie hat mir nichts davon gesagt, ich weiß nichts«, versetzte Jason, und zwar in einem Ton, der hieß: Gewiß, mein Lieber, aber was geht es mich an?
Doch Salomon hörte nur das, was er hören wollte.
»Nun, desto besser«, sagte er und atmete auf.
»Ja, dann wollen wir hineingehen.«
Drinnen vor der Tür standen die Herren mit langen Hälsen, und die Damen mit ihren breiten schwarzen Atlasmiedern und den grauen Taftkleidern, in ihren silbrigen und hellroten, mattblauen und apfelfarbenen Glockenröcken, in den streifigen Krepproben – sie bildeten einen dichten Wall hinter ihnen. Das mochte vielleicht unhöflich sein, denn den Damen gebührt der Vortritt; aber bei dem Ernst des Lebens pflegt gemeiniglich die Höflichkeit aufzuhören.
»Nun, was bringt Jason?« rief Ferdinand ungeduldig.
»Es ist gut«, entgegnete Salomon sehr würdig.
»Was hat er gesagt?« fragte Eli; und als man dem alten, heute gerade besonders tauben Onkel Eli in die Ohren schrie, daß es »gut« wäre, nickte er nachdenklich und meinte: »Nu scheen! Aber wo ist Jettchen doch?«
»Ja«, sagte Salomon, und er fühlte sich als Diplomat aus der Schule Metternichs, »es ist ihr jedenfalls nichts Ernstliches zugestoßen. Trotzdem, lieber Ferdinand, gehst du wohl noch mal bei Stosch vorüber, er möchte nachher nach Jettchen sehen.«
»Wo ist sie denn?« fragte Tante Rikchen ganz hoch und schnell.
»Jettchen ist bei mir«, sagte Jason sehr ruhig und fast galant, aber doch in einem Ton, als ob er dabei einem Gegner den Fehdehandschuh hinwerfe.
»Sie ist bei Jason! Das hab' ich gewußt!« schrie Tante Hannchen und brach in Tränen aus. »Solche Schande, immer Jason!«
»Hat man so etwas schon erlebt? Sie heult wie ein Schloßhund«, polterte Ferdinand und schlug, da er keinen Tisch in seiner näheren Umgebung sah, an dem er seinen Unmut auslassen konnte, mit der Faust aufs Fensterbrett, daß die gewölbten Scheiben klirrten.
Julius Jacoby fühlte sich unbehaglich, denn er sah, man nahm nicht seine Partei.
»Jettchen ist krank?« sagte er endlich. »Da werd' ich doch gleich zu ihr müssen.«
»Es ist für Jettchen besser, Sie lassen es«, sagte Salomon sehr förmlich, und Rikchen hörte nur das eine, daß ihr Mann jetzt wieder »Sie« zu Julius sagte.
»Gewiß«, sagte sie freundlich und drängte sich mit ihrer ganzen Fülle vor Julius, »lasse nur Jettchen heute ganz ruhig machen, was sie will. Sie wird schon wieder zur Vernunft kommen.«
Naphtali hatte bisher ganz ruhig zugehört und nur gesummt, wie das wohl so seine Art war, wenn er etwas überlegte.
»Weißt du, Joel«, begann er endlich und packte Julius an der Krawattennadel, »da is mer ä sehr ähnlicher Fall bekannt, von der Familie Goldstein bei uns in Posen, un sie is nachher doch zu ihm gegangen, und se haben sogar serr gut gelebt miteinander. – So was kann immer mal vorkommen.«
»Die gemeine Person kommt mir nicht mehr über die Schwelle«, zeterte Hannchen. »So wahr ich hier stehe, für mich existiert sie nicht mehr.«
»Ich verstehe Jettchen auch nicht«, wagte sich Jenny hervor, die sich bisher ganz verschüchtert in einen Winkel geduckt hatte, »Julius ist doch so nett.«
Pinchen und Rosalie aber weinten immer noch. »Die Schande, die Schande.« Sie erklärten sich mit Julius solidarisch und sagten, daß Jettchen damit ihre ganze Familie beschimpft und beleidigt hätte.
»Na, Gott sei Dank«, sagte Eli ganz vergnügt, »nu wären wir doch endlich soweit. Ich geh' nach Hause.« Die kleine Tante Minchen aber puffte und puffte ihren alten Ehegemahl, er solle um Himmels willen nicht so was reden. Aber da kam sie schön an.
»Warum nich?« rief Eli, der fühlte, daß er, seine Leute und seine Meinung jetzt das Oberwasser hatten. »Warum nich? Meinste, ich wer' mich hier genieren? Recht, ganz recht hat se. Se hätt's nur schon eher tun müssen. Das ist der Fehler.«
Und dann ging Eli hinaus und kam gleich darauf mit seinem großen blauen Schirm in der Faust wieder herein, als Zeichen, daß er sich unweigerlich entschlossen habe, seine Zelte hier abzubrechen.
»Nun, Minchen«, sagte er, »woran liegt's noch?«
Salomon hatte jetzt auch ganz die Würde des Gastgebers wiederbekommen und versicherte jedem, daß er den Zwischenfall von Herzen bedauere, Jettchen hätte wohl in der letzten Zeit durch alle die Vorbereitungen ihren Nerven zuviel zugemutet, und so wäre das zu erklären. Aber es hätte wohl nichts auf sich ... Und Rikchen unterstützte ihren Gatten darin und gab zugleich einen heimlichen Wink, noch etwas Brötchen herumzureichen, und bat die Leute, doch noch etwas zu verweilen. Sie würde schon morgen alles ins Lot bringen. Aber niemand wollte mehr nehmen, niemand mehr bleiben. Sie sagten, sie wären ja auch sowieso jetzt gegangen. Nur das Fräulein mit den Pudellöckchen huschte noch umher und sah, ob sie sich Kuchen und Näschereien in den perlgeschmückten Strickbeutel – er war so groß wie ein kleiner Fußsack – stecken könnte. Denn sie hatte den Kindern, die bei ihr im Hause wohnten, fest versprochen, ihnen etwas von der Hochzeit mitzubringen.
Julius stand bei alledem mitten zwischen diesen Verabschiedungen und Komplimenten ganz hilf- und ratlos umher, und eigentlich kümmerte sich auch so keiner recht um ihn. Was sollte man ihm sagen? Davon hatte nämlich für den guten Vetter Julius Jacoby aus Bentschen nichts im Buch gestanden, und das war für ihn derart überraschend gekommen, daß er noch gar nicht recht fassen konnte, was denn eigentlich geschehen war. Bisher war ihm alles in diesem Leben immer geglückt, alles nach Wunsch und Willen gegangen, stets, wenn er sich mit dem einen Chef entzweit hatte, hatte er wieder eine bessere Stelle gefunden. Und jetzt – kaum daß er nach Berlin gekommen war, so hatte er ein Geschäft, Geld, ein warmes Nest und eine schöne Frau ... und was für eine, eine berühmt schöne Frau bekommen. Er war fest davon überzeugt, daß er all das nur seinen ungewöhnlichen Gaben als Mensch und Kaufmann verdanke, und diese Erkenntnis hatte dem guten Vetter Julius seinen felsenfesten Glauben an sich selbst noch gestärkt und gefestigt, so daß dieser »Glaube an sich selbst« jetzt gleichsam sein ganzes Wesen durchtränkte und ihm, wenn man es so sagen darf, wieder aus allen Poren drang. In jeder Bewegung seiner kurzen, dicken Finger sprach er sich aus; er ließ sein Haar noch starrer und lustiger emporweisen denn ehedem, er gab seinem Hals und seinem Gesicht die lachende Röte von beleidigender Gesundheit; und seine kleinen schwarzen Jettknöpfe von Augen endlich machte er blitzen und blinkern, als ob sie jeden Morgen frisch geputzt würden. Ja, dieser Glaube ... gab dem Vetter Julius Jacoby sogar die Überzeugung von der bestechenden Anmut seiner Manieren, die ihm vordem doch nicht so ganz einwandfrei erschienen waren, und er pflanzte in ihn die Erkenntnis von der Überlegenheit seiner Bildung und seines Geistes.
Nun hielt er sich für liebenswürdig und gefällig genug, um jedes Erfolges bei den Frauen sicher zu sein, und er pries in seinem Innern eigentlich die, die so glücklich wäre, ihre Gunst an solch einen, wie er es war, auf die Dauer zu verschenken und sich dadurch zur beneideten Rivalin aller derer zu machen, die sich nur begnügen durften, ihn von fern anzuschauen. Und all das, was er zu bieten hatte! – War er vielleicht nicht der Mann, eine Frau glücklich zu machen? – Das war mißachtet worden, einfach weggeworfen, mit Füßen getreten worden. Und zwar war es so plötzlich gekommen, so überraschend, so ganz aus heiler Haut, daß es dem guten Vetter Julius beinahe den Atem versetzt hatte und er ordentlich nach Luft schnappen mußte, wie ein Karpfen, den man aus dem Wasser nimmt. Nur eines sah er bis jetzt ganz deutlich vor sich: Er müßte verzeihen. Auch sagte er sich in ruhigen Augenblicken – und er hatte als gewitzter Kaufmann Erfahrung darin –, es käme oft vor, daß ein Käufer oder ein Verkäufer noch im letzten Moment scheinbar zurückschnappe, während der Handel zum Schluß trotzdem zustande käme.
Aber selbst diese Gedanken benahmen ihm nicht seine Zweifel und ernstlichen Bedenken; und besonders war es noch ein dumpfes Gefühl, daß es sich doch eigentlich für ihn um mehr und um Höheres drehte, nämlich um sein »Geschäft«. Und um das würde er kämpfen. Denn wenn ihm das Glück endlich einmal einen Schimmel zwischen die Knie gespielt hätte, so würde er auch im Sattel bleiben und reiten – und wenn das Vieh darüber an Gurgelschwindsucht verrecken sollte.
Jason sprach noch ein paar Worte mit Salomon und hinkte hinaus, denn er meinte, daß er müde wäre, und hier wäre ja auch seine Mission erledigt.
Von den Gästen hatte eigentlich keiner recht das Wort an Jason gerichtet; denn die Art, wie er auftrat, machte, daß man eine geheime Scheu vor ihm empfand. Und einer nach dem anderen bedankte sich nun bei Salomon und Rikchen und sagte, daß es sehr hübsch gewesen wäre – was man ja auch, abgesehen von dem einen kleinen Zwischenfall, wohl behaupten konnte. Julius lief dabei auf und ab wie der große Löwe beim Tierbändiger Martin, und Hannchen blieb in einem Reden, ließ keinen Menschen zu Worte kommen, sie überschwemmte alles mit ihrem Geschwabbel: Sie fand das unerhört; für sie existierte die Person nicht mehr und für ihren Mann und ihre Kinder auch nicht. Sie wisse schon, wie das zusammenhinge, wolle aber schweigen, weil ihre Kinder da wären, sonst würde sie mehr sagen.
Rikchen war auch sehr mißgestimmt, ließ sich aber nichts merken, sondern plinkte ihrer Schwester nur zu, sie solle doch stille sein, sie gösse ja Öl ins Feuer, und man wüsche seine schmutzige Wäsche nicht vor den Leuten. Aber das brave Hannchen ließ sich das nicht anfechten, denn sie hätte eben nicht sie selbst sein müssen, wenn sie diese Gelegenheit, ihre besten Gaben zu zeigen und gleichsam in bengalischer Beleuchtung dazustehen, unbenutzt hätte vorübergehen lassen. Rikchen wußte schon, weswegen sie still war. Sie kannte diese Geberts ... nur nicht aufputschen! Morgen würde ja alles von selbst anders aussehen.
Minchen und Onkel Eli waren gegangen, und Eli hatte Minchen noch ein Schaltuch umgebunden über die schwere graue Enveloppe, denn Minchen hätte sich echauffiert und könne sich sonst leicht verkühlen. Der alte Onkel Naphtali aber fand nun keinen Grund mehr, kein Brötchen zu essen, und er hatte sich – da auch die vorgeschriebene Frist verstrichen war und sich die ganze Angelegenheit ja, wie er hörte, in höchst friedlicher Form gelöst hatte – einige davon gesichert und sich mit ihnen an einen bescheidenen Fensterplatz zurückgezogen. Er sah nicht ein, warum man das nicht tun sollte, es gehörte doch sicherlich mit zum Kuvert. Mit dem letzten Bissen im Munde jedoch erhob sich nun der alte Onkel Naphtali aus Bentschen in seinem braunen Rock und ging mimmelnd auf die wenigen Gäste zu, die zwecklos umherstanden und sich nicht so recht darüber klarwerden konnten, warum sie eigentlich noch hier waren. Einzig das Bedürfnis, miteinander zu sprechen, hielt sie zusammen.
»Weißt du, Joel«, sagte Naphtali bedächtig, »ich hab' mir die Sache reiflich überlegt. Ich hab' doch nun schon die teure Reise gemacht, und das Gasthaus kost't auch e Stange Gold ... Jetzt hast du doch de große Wohnung für dich ganz solo, mit e Masse Platz drin; allein wirste auch sein ... weißte was: Da könnt' ich doch eigentlich solange bei dir wohnen.«
Salomon Gebert, der sich ermüdet für einen Augenblick hingesetzt hatte, sprang auf: »Ich geh' nach Hause, Rikchen«, sagte er ganz kurz und kniff dabei die Lippen zusammen; dann schlug er die Tür der Garderobe hinter sich zu, daß es wie ein Böllerschuß durch den Saal knallte. Tante Rikchen eilte ihm nach, so schnell es ihre fette Umfänglichkeit und ihr schweres taubengraues Moirékleid, das lang hinschleppte, nur zuließen.
Eine ganze Weile stand der Onkel Naphtali, der Senior aller Jacobys, mit offenem Mund da. »Verstehst du, Joel, was der Mann will?« meinte er endlich kopfschüttelnd. »Ich nicht!«
Hannchen sagte auch, daß man so Gäste nicht behandeln dürfe; und es war niemand da, ihr darin zu widersprechen, denn ihr Gemahl war auch schon gegangen, wer weiß, wohin? Und die Jacobys waren nunmehr ganz unter sich – keine fremde Nase. Pinchen und Rosalie machten sich um Julius zu schaffen, ihren Bruder, der ihnen ein und alles war, und drangen in ihn, er möchte, er solle, er müsse notwendig noch etwas zu sich nehmen, er könnte sonst »Gott behüte« krank werden bei all der Aufregung, die er gehabt hätte.
Auf der Treppe war es Jason eingefallen, daß er nun noch einen Weg hätte, aber den wollte er sich auf morgen versparen. Dann jedoch dachte er wieder, es wäre vielleicht richtig und besser, er täte ihn heute, täte ihn gleich. Und Jason lehnte sich wieder in den Wagen zurück und schloß die Augen und folgte den roten und tiefblauen, feuergelben und schwefligen Mustern und Sternen, die ihm das erregte Blut auf den schwarzen Grund seiner Nacht malte gleich bunten, wechselnden Vorhängen, die vor zwei dunklen Höhlen ausgespannt sind. Gewiß, er hatte durchgesetzt, was er wollte, aber wie war er müde, zum Umsinken müde. Und wie war er hoffnungslos! Denn ob das, was er selbst verteidigte und zu seiner Sache gemacht hatte, das Spiel verlöre oder gewänne, er selbst, Jason Gebert, hatte dabei immer verloren. Das fühlte er, und das war es, was ihn so traurig stimmte. – Ob er Kößling treffen würde? Spät war's noch nicht; es war kaum neun Uhr. Zu Hause würde er sein. Denn heute wäre ein Tag, wo man zu Hause bliebe, so einer wie er ... auch solch Einsamer und Eigenbrötler, ganz allein und knurrig zu Haus wie ein Hamster in seinem Bau.
Das waren seltsame Tage für Doktor Kößling gewesen, die drei letzten Tage. Alle Stunden hatten ihre Bedeutung verloren, Lichtzeit und Nachtzeit verkehrten sich, das Wachen war Schlaf und das Schlafen Wachen geworden. Denn sein Tag war Träumen – und die Träume waren taghell. Kößling war auf die Bibliothek gegangen, ohne zu wissen, wie er hingelangte; und er hatte dort seine Arbeit getan, ohne daß er ein Buch recht vor Augen gesehen. Er war zurück über die Plätze geirrt, am Wasser entlang, den Blick auf den Schloßbau, über dem die Wolken wie Gespenster jagten, und dann hatte er sich hineinverloren in die Straßen, zweck- und ziellos, ihrem Netzwerk folgend. Er ertappte sich, wie er in der Post durch die langen grauen Labyrinthe der Gänge irrte, ohne daß er sich sagen konnte, was er dort wolle; und er fand sich immer wieder an jenem Ausgang nach der Spandauer Straße, wie er auch seine Wege geführt hatte. Und dann blieb er eine Weile aufatmend stehen, gleichsam, als müsse er Mut sammeln, ehe er in diesen Wirbel von engen Straßen untertauchte, ehe er die alten steinernen Brücken wieder zu sehen wagte, die engen, dampfenden Kanäle, die sich zwischen Häuserzügen plötzlich und rätselhaft verloren. Da irrte er so dahin. Er wußte es gar nicht, welche Kirche es war, deren Turm in den Wolkendunst ragte, oder ob jener Orgelton, den er empfand, nun von den Baumzweigen herrührte, die in irgendeinem Fleck Garten der Wind gegen eine Mauer peitschte; ob er oben aus dem offenen Dach der Gerbereien durch die Luft klang oder ... ob es ihm nur so im Blut brauste. Vor irgendeinem Fenster stand er dann wieder, bis das Gesicht, das er dort hinter den Scheiben erblühen sah, verschwamm und sich in Nichts löste. Und dann sagte er sich, daß es unmöglich wäre, daß er mit wachen Augen träumen müsse, da Jettchen sicher nicht hier sei und auch