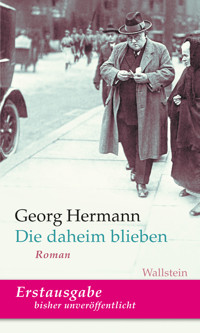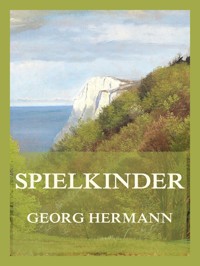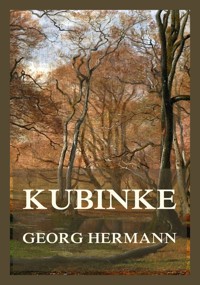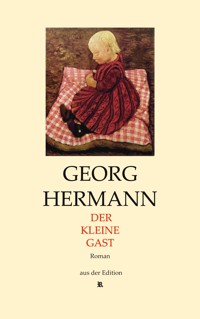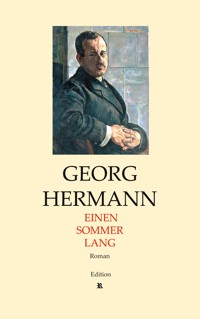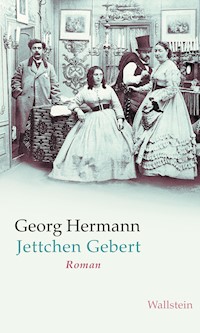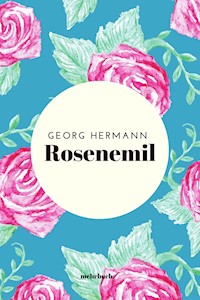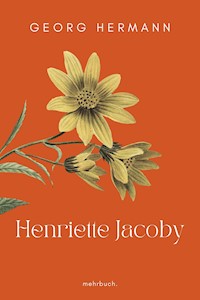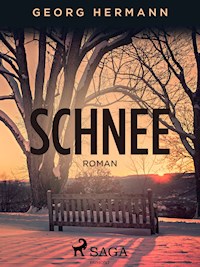Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Berlin am 23. November 1927: Ellen Stein, ledig, die wie fünfzig aussieht, dabei noch keine vierzig ist, ist Untermieterin bei Herrn Brenneisen, und beide sind sich in inniger Abneigung verbunden, was aber vor allem auch daran liegt, dass Ellen Stein überhaupt in einem gespannten Verhältnis zu dem Berlin, den Menschen von heute steht, deren Repräsentant Brenneisen nun einmal ist. Eine engere Verbindung hat das "hagere, vermännlichte, ältere Fräulein mit scharfen Zügen und einem graumelierten Haarknoten" vor allem noch zu Ruth, der Tochter ihrer Schwester. Doch Ruth will nun heiraten, und Ellen ist weder diesen Eheaussichten noch ihrem Bräutigam Fred Meirowitz besonders zugeneigt. Einstmals, so vertraut sie der geliebten Nichte an, hatte auch sie Verehrer, Ernst Weinberg, Dr. Slop, Herman Müller, Benno Bernauer, und hätte mehrmals fast geheiratet, was aber jedes Mal scheiterte, unter anderem daran, dass Dr. Slop in einem fernem Lazarett irgendwo an der Ostfront an Flecktyphus verstorben, Herman Müller bereits im August 1914 gefallen ist und Benno Bernauer noch immer in den Pripetsümpfen vermisst wird. In ihren Träumen jedoch lebt sie das ungelebte Leben an Seite ihrer Männer und anderer geliebter und weniger geliebter Menschen nach. Dann fährt wieder die Straßenbahn vorbei, sie wacht auf, ist allein und einsam und muss sich des drohenden Verlustes der geliebten Nichte Ruth gewärtigen. "Träume der Ellen Stein" ist ein eindrucksvoller, psychologisch dichter Roman voll menschlicher Tiefe und Wärme, voller Einsamkeit, Verlust, Erinnerung, Leid, zuletzt aber auch Nähe und Liebe ... Ein fast vergessenes Hauptwerk Georg Hermanns, das wiederzuentdecken sich mehr als lohnt!Georg Hermann, eigentlich Georg Hermann Borchardt (1871–1943), war ein deutscher Schriftsteller. Georg Hermann wurde 1871 als jüngstes von sechs Kindern einer alteingesessenen jüdisch-berlinerischen und später verarmten Kaufmannsfamilie geboren. Nach dem Besuch des Gymnasiums durchlief er eine Kaufmannslehre und arbeitete als Gehilfe in einem Krawattengeschäft. Von 1896 bis 1899 besuchte er literarische, kunstgeschichtliche und philosophische Vorlesungen an der Universität Berlin. Später war er beim Statistischen Amt Berlin beschäftigt, schrieb daneben Texte für Zeitungen und Zeitschriften und machte sich durch Feuilletons, Kunstkritiken und als Verfasser kunsthistorischer Werke nach und nach einen Namen. Obwohl er sich bereits als Schüler schriftstellerisch versucht und später unter anderem drei Bände Prosaskizzen veröffentlicht hatte, setzte er sich als Schriftsteller allerdings erst relativ spät durch: Erst der Roman "Jettchen Gebert" (1906) machte ihn mit einem Schlag berühmt. "Jettchen Gebert" und sein Fortsetzungsband "Henriette Jacoby", die ein Bild des liberalen Geistes im Berlin der 1840er Jahre in einer jüdischen Familie zeichnen, waren Bestseller mit zusammen mehr als 260 Auflagen. Hermann lebte fortan als vielgelesener Romancier in Berlin, zeitweise in Neckargemünd bei Heidelberg. Sein literarisches Vorbild war Theodor Fontane, was ihm auch die Bezeichnung "jüdischer Fontane" eintrug. Neben oft stark autobiografisch getönten jüdisch-bürgerlichen Themen griff er auch Stoffe aus den unteren sozialen Schichten ("Kubinke", 1910, der Zuhälterroman "Rosenemil", 1935) und aus der preußischen Geschichte auf. Seine Romane sind Unterhaltungsliteratur von Rang, wie sie in Deutschland selten ist.Durch die nationalsozialistischen Machthaber ständig bedroht, entschloss sich Hermann nach dem Reichstagsbrand im Jahre 1933, Deutschland zu verlassen und ging nach Holland ins Exil. Seine Werke standen auf der "Schwarzen Liste" und wurden bei den Bücherverbrennungen im Mai 1933 den Flammen übergeben. Im Exil schrieb Hermann unter schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen weitere Romane.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Georg Hermann
Träume der Ellen Stein
Roman
Saga
Träume der Ellen Stein
German
© 1929 Georg Hermann
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711517253
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Vorspruch
Da der Wirt behauptete, dass ihn die Steuern für das Haus auffrässen, und dass er seinen Mietern ein Geschenk mache, wenn er ihnen dort zu wohnen gestattete, so liess er seit Urzeiten im Haus nichts mehr machen, nicht einmal eine geplatzte Gummischeibe im Badezimmer. Der Mieterrat aber rechnete ihm vor, dass er an diesem Haus gerade gegen alle früheren Besitzer goldene Berge scheffle, weil er ja die meisten grossen Wohnungen mit der Zeit geteilt hätte, aber nicht die alten Mieten. Die Wohnungen waren mitten durchgeschnitten worden; und wie bei einem Regenwurm in gleicher Lage ein zweiter Kopf bei dem Schwanzstück nachwächst, so war hier, ähnlich, am Kopfstück, eine zweite Küche nachgewachsen ... Die ersten Wohnungen waren in der Inflation geteilt worden, und die anderen dann bei der Stabilisierung ... bis auf eine! Denn beide hatten unter den Mietern solcher Luxuswohnungen — wie sie Herr Brenneisen, der Wirt, stolz nannte — mächtig aufgeräumt. In der Inflation waren die alten Reichen verarmt, und in der Stabilisierung — warum eigentlich sagt man nicht Stabilisation? ... das würde sich schlecht und recht doch reimen! — waren die neuen Reichen verarmt, ohne dass aber deswegen die alten wieder an ihre Stelle gerückt wären. ‚Also, da der Wirt ja die meisten Wohnungen mit der Zeit geteilt hätte durch Einziehen einer oblatendünnen Rabitzwand in die Kegelbahn des hinteren Flurs, die wie eine empfindsame Membrane dem Schall gegenüber sich verhielt, und so jetzt für zwei Luxuswohnungen er mehr Miete erhielte, als er je für eine hätte beanspruchen können, so sehe man nicht ein ... und so weiter, und so weiter ...!‘ Ausserdem rechnete man dem Wirt seine schamlos bereinigten Hypotheken vor, derenthalben eine Fabrikbesitzerswitwe den Gashahn geöffnet hatte, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, wer nachher die Gasrechnung bezahlen sollte. Sie jedenfalls nicht mehr. Hätte es auch nicht gekonnt, selbst wenn man sie wieder ins Leben zurückgerufen hätte. Der Wirt aber stellte nur fest, dass er die Hypothek sogar teilweise in Dollars bezahlt hätte; vergass aber hinzuzusetzen, wieviel Greenbacks er als Lockspeise den fünfmalhunderttausend Papiermark hinzugefügt hatte. Wenn er sagte, dass man später dafür halb Berlin hätte kaufen können, so war das unglaubhaft und Übertreibung. Ebenso war es aber übertrieben, wenn die Mieter behaupteten, die Mieten müssten herabgesetzt werden, weil ihre Vornehmheit durch die Elvirabar litte. Auch entsprach es nicht ganz der Wirklichkeit, dass die Jazzkapelle sie in ihrem Schlummer störte. Im Laufe der Jahre hatten sie sich vorzüglich daran gewöhnt, schliefen ungewiegt dabei und wachten nur immer auf, wenn sie zufällig mal aussetzte. Was aber selten der Fall war. Ausserdem aber brächte die Elvirabar — so argumentierten die Mieter weiter — ihm, dem Wirt, ungezählte Tausende ein. Wogegen wiederum der Wirt beschwor, dass er dabei zusetze und nur der Kunst — denn ein Konferenzier ödete allnächtlich im Kreise einiger Komplizen, die wiederum von einem Dutzend nackter Beine akkompagniert wurden, die Gäste an — nur der Kunst ein Opfer brächte. Auch hätte sich ihm der Umbau und die feenhafte Ausstattung, die Fräulein Stein in einer Mieterversammlung einst den expressionistischen Harem genannt hatte, bis heute keineswegs verzinst, geschweige denn amortisiert. Was wiederum nicht der Wahrheit und den Tatsachen entsprach, da ja gerade an diesem Ausbau der erste Besitzer der Elvirabar Pleite gemacht hatte. Was — so seltsam ist das Leben! — auch wieder erstaunlich zu nennen ist, weil er ja die Handwerker nicht bezahlt hatte, und meinte, dass ihm das unmöglich gewesen wäre, da erstens die Gegend ein toter Fisch sei, und zweitens der Wirt ihm die Abendkassen gepfändet hätte.
So also stand hier Aussage gegen Aussage ... und man begriff nicht, warum der Wirt, Herr Brenneisen, jedem, der es hören und nicht hören wollte, verkündete, dass er lieber ein einfaches Arbeiterhaus in der Müllerstrasse besässe, als drei solcher ruhigen und feinen Häuser mit Luxuswohnungen auf dem Kurfürstendamm; denn in der Müllerstrasse hätte man für seine Gutmütigkeit zwar auch keinen Dank, aber weniger Ärger. Was wiederum in mehrfacher Beziehung sich von der Wirklichkeit entfernte, denn das Haus lag gar nicht „auf“ dem Kurfürstendamm, sondern man konnte nur über drei Querstrassen weg von dem einen Eckfenster aus die kahlen Zweige der Rüstern des Kurfürstendamms in der staubgrauen Novemberluft noch gerade ahnen; und des Abends konnte man vom Kurfürstendamm her den Schimmer einer Lichtreklame konfettihaft in Dreissigsekundenpausen — wie das Warnungszeichen eines Leuchtturms — aufblitzen, schwinden und wieder aufblitzen sehen. Das war alles. Der Versuch nebenbei, den Besitzer der Elvirabar zu einem ähnlichen Dachfeuerwerk zu animieren (bei weitgehendem Entgegenkommen des Herrn Brenneisen für die Miete des Dachstuhls) war gescheitert oder doch vorerst als gescheitert zu betrachten.
Und ruhig?! Den ganzen Tag gingen die Pistonsoli der Autos, die sich, was Geschwindigkeit und Lärm anbetraf, hier in der „stillen Nebenstrasse“ keinerlei Zwang auferlegten; und wenn fürder alle drei Minuten die Strassenbahn ihre Pflicht erfüllte, dann kam sie mit dem Brausen ferner Brandung schon von weitem angesaust, steigerte diesen ihren Ton, anschwellend wie eine Sirene, und liess ihn unvermittelt in einem hohen Zwitschern verklingen, wenn vor der Haltestelle die Bremse scharf angezogen wurde. So oft sie gutmütig war, die Elektrische, so klang der Ton nur wie das hohe Zwitschern einer Kohlmeise im Birnbaum; wenn sie jedoch schlecht gelaunt war, als ob ein Kind auf der Schiefertafel kratzt ... sofern man beide in eine vorsintflutliche Welt saurierhaft-vergrösserter Lebewesen verlegen will. Und sie war meist schlecht gelaunt.
Im ganzen wäre aber der Herr Brenneisen auch wohl mit diesem Haus, wie mit seinen übrigen vierzehn, ganz gut ausgekommen — denn zum Schluss ist der Mensch dumm, nachlässig und geduldig, selbst als Mieter, und scheut Streit, auch wenn ihm Unrecht geschieht — und Herrn Brenneisens Taktik, um jeden Dreck von einem jungen Rechtsanwalt geharnischte Briefe schreiben zu lassen, hätte sich wohl auch hier gut bewährt, wenn nicht an der Spitze des Mieterrats ein Fräulein, ein ältliches Fräulein gestanden hätte, die Herr Brenneisen aus innigster Seele zu hassen gelernt hatte, und vor der er, der doch sonst ein tapferer Mann war, eine Heidenangst hatte, weil er genau wusste, dass sie ihm über war. Und sie brauchte ihn nicht. Aber er sie. Erstens hatte sie die grösste Wohnung im Haus, die einzige, die noch ungeteilt war; zweitens war dieses ältliche Fräulein von durchaus solidem Reichtum, so dass er ihr nicht imponieren konnte. Drittens war sie ihm an Dialektik fünffach überlegen; und viertens behandelte sie ihn mit einer ausgesuchten Höflichkeit, war weder aus der Ruhe, noch aus der Fassung zu bringen, und durchtränkte jedes gesprochene und geschriebene Wort mit einer unfassbaren Ironie, die ihn innerlich zerplatzen liess, ohne dass sie ihm einen Grund gab, auch nur grob zu werden. Im Gegenteil: sie lockte ihn auf das Glatteis der gleichen Höflichkeit und liess ihn dann jämmerlich straucheln. Und nicht genug damit, sie organisierte sozusagen den Widerstand seiner Mieter ... er schmeckte ihren Ton aus deren Briefen heraus, so dass er sich gleichsam wie ein gehetzter Eber von dreissig ihresgleichen ständig umstellt und in die Enge getrieben fühlte. Ja, als er einmal geäussert hatte, er würde gern, um den Ärger los zu werden, Fräulein Stein das Haus zum Selbstkostenpreis überlassen — möge sie dann sehen, wie sie auf ihre Rechnung käme — zog jene nur vor versammeltem Kriegsvolk ein Scheckbuch aus der Handtasche und sagte, sie würde sofort ihm einen Scheck über die fünfhundert Mark ausstellen, die er 1921 für das Haus gegeben hätte. Nein ... mit der wurde er nicht fertig!
Trotzdem aber wagte er ihr nicht zu kündigen, denn grosse Wohnungen sind schwer los zu werden; und, wenn er sie teilen liesse, das machte Kosten, und wer weiss, wen er dann bekäme. Sicher niemand, der für die Miete so gut wäre, und der ausserdem noch die Hälfte des Jahres auf Reisen ist, und der als einzelner Mensch mit dem alten Mädchen die Wohnung so schonte, wie jene. Sogar ihr alter Hund war derart wohlgezogen, dass sich noch nie ein Nachbar über ihn beschwert hatte. Er bellte selten, winselte nie, und nicht einmal dem Portier machte er Schwierigkeiten. Nur missbilligte Herr Brenneisen, in seiner Eigenheit als Wirt, das eine, dass Fräulein Stein immer noch die Zwangsmieter in dem einen vorderen Zimmer behielte, trotzdem sie sie nach den neuen Verfügungen längst an die Luft hätte setzen können, und nicht nur, weil sie seit Jahr und Tag ihr nicht zahlten. Nun, sie wusste gewiss, weshalb sie es tat. Nur schwankte Herr Brenneisen darin, ob da eine persönliche Bindung an Herrn oder Frau Gross vorläge, entschied sich aber innerlich — wie bei seiner räudigen Phantasie nicht anders zu erwarten —, durchaus für das zweite. Der Gedanke, dass vielleicht Herr und Frau Gross ... heute arme Luders und betrogene Betrüger im Lombardhaus der Weltstadt, einst aber wohlbegüterter Bürger Kinder ... Fräulein Stein einfach leid taten, lag ausserhalb seines Vorstellungskreises.
Nebenbei hatten sich in den letzten Jahren die Beziehungen von Brenneisen zu seiner Hauptmieterin zwar nicht gebessert, trotzdem sie sich sogar auf der Treppe wieder grüssten, aber die offene Feldschlacht von einst, als der Mieterrat noch in Flor stand, war in einen Stellungskrieg übergegangen, der nur hin und wieder durch einen Briefwechsel unterbrochen wurde, wie jener durch den Abendsegen, damit die vorn in den Gräben nicht etwa vergässen, dass immer noch Krieg ist. Soviel von den Beziehungen des Herrn Brenneisen zu Fräulein Ellen Stein.
In Wahrheit waren sie durchaus einseitiger Art; denn Fräulein Ellen Stein war gar nicht gegen Herrn Brenneisen besonders voreingenommen, ja sie beschäftigte sich sogar innerlich sehr wenig mit ihm. Sie war vielmehr einfach kriegerisch gegen die ganze Welt gestimmt; doch auch das eigentlich nicht: Russland liebte sie zum Beispiel! ... sondern präziser: sie stand vor allem in einem gespannten Verhältnis zu dem Berlin von heute, dessen Repräsentant und Prototyp (wenigstens einer der herrschenden Gruppen!) für sie eben dieser Herr Brenneisen — man beachte das „dieser“ — war. Das war alles.
Und wenn er, Herr Brenneisen, weiter dachte, dass sie besonders stolz war, weil sie von je die allergrösste Wohnung in seinem Luxushaus „auf“ dem Kurfürstendamm innehatte, so irrte er sich schmählich. Im Gegenteil. Fräulein Stein empfand diese Wohnung, ebenso wie diese Gegend, und noch mehr deren Bewohner, als einen tiefen Abstieg und Verfall ihrer Person, und sie verzieh ihrer Mutter nichts weniger, als dass sie nach Vaters Tode ihr Haus in der Rauchstrasse unnötigerweise, weil sie behauptete, dass es ihr zu viel Mühe zu bewirtschaften mache, verkauft hatte, um trotz ihres, der Tochter, Widerspruch, hier in diese Pöbelgegend zu ziehen ... deren Segnungen sie nebenbei nur noch kurze Zeit geniessen konnte.
Ja, Ellen Stein liebte ihre alte Gegend und das Grün der Eichen, die vom Tiergarten aus nach ihren Schlafzimmerfenstern einst gewinkt hatten, derart, dass sie noch heute einen Umweg machte, wenn sie zufällig ihr Weg dort hätte vorüberführen können, weil sie festgestellt hatte, dass jedesmal es sie zwei Tage lang aufregte und verstimmte. Herr Brenneisen überschätzte sich also, wenn er sich von Fräulein Stein besonders gehasst und verfolgt glaubte. In Wirklichkeit lag er nur an der äussersten Peripherie ihres Wesens. Da gab es schon sehr andere Dinge in ihrem Dasein, die sie innerlich beschäftigten, auch wenn sie sich das nicht anmerken liess, und vor die sie, — wie das so geht! — wieder andere Dinge vorgeschoben hatte; wie ja der alte Spruch, schon lange bevor die Wissenschaft sich seiner annahm, im Leben der meisten von uns seine Geltung hat: Haut den Sack und meint den Esel.
I. Die Tante
Leute, die Ellen Stein von früher kannten, behaupteten, dass sie von je sehr klug und bildungsbeflissen, ja mehr als das, geistvoll und recht hübsch, oder zum mindesten doch sehr apart dabei gewesen wäre. Das erste hatte sich wohl modifiziert, aber kaum ganz verloren, aber das andere war spurenlos fast vergangen im Laufe von nicht zwei Jahrzehnten; so wie ungefähr die antike Kultur nach dem Einfall der Barbaren. Heute war Ellen Stein ein hageres, vermännlichtes, älteres Fräulein mit scharfen Zügen und einem graumelierten Haarknoten, der sich über einem glatt gebürsteten graumelierten Scheitel hochdrehte. Sie sah so aus, wie man sich die Pflicht vorstellt, wenn man jung ist. Grau, scharf und ohne Lächeln und mit hastigen und bestimmten Bewegungen, die maschinenmässig geregelt sind; und sie war so gekleidet, wie die Pflicht — die ja nun mal eine Frauensperson ist —, es nur sein kann. Also so, wie vor zwanzig Jahren ein älteres Fräulein zwar nicht aussah, aber wie man sich vorstellte, dass sie aussehen müsste. In ihrem dunklen Kleid, das sich auch im wärmsten Sommer nur um einige Nuancen auflichtete, und von dem ein Mann leicht glauben könnte, dass es immer das gleiche sei, trotzdem eine Frau sofort sehen würde, dass es nie das gleiche und immer ein anderes ist ... betonte sie aufdringlich, dass sie auf Kleidung keinen Wert legte und niemandem mehr gefallen wollte, ja es übelnähme, wenn es trotzdem der Fall wäre. Die Frauen aber sahen sofort (nicht ohne Neid), dass die Kostüme dieses Fräulein Stein aus dem teuersten Stall kämen; während die Männer — doch auf die kam es ja auch nicht an! — keinen Blick für so etwas hatten. Nebenbei hätte Ellen Stein sich wie ungewaschen gefühlt, wenn sie etwa billig oder gar unsolide — ein Wort, das Schüttelfrost bei ihr auslöste — angezogen gewesen wäre. So war sie also alles in allem gewiss kein angenehmer Mensch; aber ihre sämtlichen Bekannten waren sich darin einig, dass sie das wäre, was man einen: hochanständigen Menschen nennt. Auch wenn sie gern an ihnen Kritik übte, ohne dazu aufgefordert zu sein, und zwar mit einer Ironie, die unfassbar war und zu ihren verknitterten Zügen, die seit langem wohl das Lächeln verlernt hatten, das geistige Gegenspiel bot. Ebenso hatte — ausser Herrn Brenneisen, und der zählte ja nicht zu ihren Bekannten — noch nie jemand bei ihr Gemüt, Mitfühlen und Herzlichkeit vermisst, oder sie nicht verlässlich und hilfsbereit gefunden, wenn es darauf ankam. Sogar von der Familie wurde sie mit jener Achtung behandelt, die selbst die Familie jemand zukommen lässt, den sie einmal beerben will. Die Familie lächelte über ihre Schrullen, die darin bestanden, dass sie Nebensächliches, wie Sprachkurse und Vorträge, Museen, Goethe oder Politik und Friedensbewegungen blutig ernst nahm ... dass sie ihre Tagesarbeit systematisch eingeteilt hat ... und dass sie, ehe sie — sagen wir — eine Reise nach Spanien machte, viele Dutzende von Büchern über Land, Leute, Geschichte und Kunst und Geologie dieser langweiligen Halbinsel monatelang wälzte, und bei einer armen flüchtigen spanischen Sozialistin mit Augen wie leere Teller auf einer abgegessenen Tafel, vergeblich sich in den Gutturalen dieses Idioms zu vervollkommnen suchte ... in jenen Kehllauten, die, wie sie gern allen die es nichts anging, erklärte, sicher arabische Reminiszenzen sind ... verzieh ihr also, dass sie all das blutig ernst nahm, was keinen vernünftigen Menschen etwas anging, während sie für die wirklich-wichtigen Dinge, wie eine Kinopremiere im Kapitol, einen Grosskampftag der Boxer im Sportpalast, einen Fünfuhrtee im Esplanade und eine Modenschau bei Adlon, nicht zu haben war, ja nicht einmal dahin mitzuschleifen war, wenn ihre Schwester, Frau Bergheim oder ihre Nichte Ruth Bergheim, sie im Wagen dazu abholen kamen. Und dabei hing sie doch mit einer wahren Affenliebe an Ruth. Und war unglücklich, wenn das Kind sie drei Tage nicht besucht hatte.
Dennoch — so kompliziert sind die menschlichen Beziehungen — kann nicht verkannt werden, dass sowohl ihre Schwester, Frau Bergheim, und ganz besonders Ruth, doch insgeheim sehr stolz auf Ellen Stein und ihre Schrullen waren, weil jene den Mut hatte, inmitten einer Gesellschaft, die ganz anders geartet war, das Leben auf eigene Manier zu führen. Und weiter waren sie auch stolz darauf (vor allem Ruth!), weil Tante Ellen in sich noch die Tradition der Familie verkörperte, sie pflegte und der Gegenwart keine Konzessionen machte. Nicht einen, sondern drei Buick konnte sie sich anschaffen; — tut es nicht. Hätte hundertmal sich zum Beispiel neu einrichten können ... nein, sie lebt immer noch zwischen dem altmodischen Plunder von Eltern und Grosseltern, zwischen dem sie geboren ist. Und wenn Besuch da ist, lässt sie Kerzen brennen, weil sie das intimer findet, und elektrisches Licht zu hassen behauptet. Sie hat aus ihrer Wohnung ein Familienmuseum gemacht, was lächerlich und rührend zugleich ist. Hat sich selbst als Kustodin dieses Museums zur alten Tante gemacht, rein aus Pietät, was gar nicht nötig und durchaus vorzeitig war. Will aussehen wie fünfzig und ist noch nicht einmal vierzig. Vielleicht tut sie das auch nur, weil heute andere Frauen, die fünfzig sind, wie dreissig aussehen wollen. Man weiss es doch, wie alt sie ist, man kann es ja nachrechnen, auch wenn sie sich seit Jahren verbeten hat, dass man ihr zu ihrem Geburtstag etwas schenkt oder überhaupt Notiz davon nimmt. Wenn Ruth ihr mal sagt, dass sie heute gut und jung aussieht — und das tut sie manchmal — wird sie sogar grob.
Ebenso ist Tante Ellen (das weiss Ruth) allen Versuchen ihrer Mutter, ihr einen ihrer verflossenen Liebhaber als Mann aufzuhängen, — und das spielt mit immer neuen Reflektanten noch bis in die letzte Zeit hinein —, geschickt und energisch stets ausgewichen, so fein und unauffällig es Ruths Mutter auch eingefädelt haben mochte. Und aus reiner Pietät hält sie zum Beispiel noch Johanna, sonst niemand (ausser der Hülfe), weil sich natürlich Johanna mit keinem anderen Mädchen verträgt, da sie sechsundvierzig Jahr im Haus ist und vom zweiten Küchenmädchen zur Alleinherrscherin avanciert ist. Ruths Mutter sagt immer, man soll ihr doch endlich etwas aussetzen, sie wollen sie beide wo einkaufen. — Tante Ellen will nicht. Denn sonst würde Johanna — meint sie — in wenigen Monaten verrosten und kaputt gehen, wie eine alte Waschmaschine, die ausser Betrieb gesetzt ist. Und Johanna will es natürlich erst recht nicht; denn welcher Autokrat will je in Pension gehen?! Und dabei ist es mit ihr kaum noch auszuhalten. Wenn sie wenigstens ein Haarnetz trüge über den weissen Zotteln oder ein Häubchen; aber es ist doch beinahe schon unappetitlich, wenn sie einen Teller Suppe vorsetzt. Und zudem stehen sie wie Hund und Katze miteinander, und sie ärgert Tante Ellen mit ihren plumpen Vertraulichkeiten, die die immer wieder von sich wegschiebt, manchmal bis aufs Blut. Tante Ellen möchte sie ja gerne los werden, ist auch stets wieder dazu fest entschlossen; aber sie behält sie dann eben doch, weil sie genau weiss, dass sie ohne sie und das Haus nichts mehr im Leben anfangen kann. Und so quälen sich beide immer weiter. Ruths Mutter meint zwar, dass das vielleicht andere Gründe haben könnte, weshalb Ellen dem kein Ende macht. Dass sie irgendwie ihr ausgeliefert sei. Weiss Gott, wodurch. Aber das ist natürlich Unsinn. Mutter redet leicht doch so etwas.
Und deshalb hat sie auch Fifi, den alten maroden Sprengwagen von Hund, immer noch nicht vergiften lassen, nur weil Ruth mit ihm vor sechzehn Jahren lieber als mit all ihren Puppen gespielt hat. Und sie lässt Lora schreien, trotzdem, oder weil er seit dreissig Jahren sie damit im Arbeiten stört. Er sieht jetzt wie ein halb gerupfter Hahn aus, ist nur Krallen, Schnabel und Bösartigkeit. Aber er schreit immer noch.
All das — angefangen bei den griechischen Vasen, dem Arabischen und den Koransuren und der Friedensgesellschaft, dem Spanischen und dem Kommunismus, dem Goethe-Fimmel und der Flaubert-Sammlung (und dabei hat sie doch gar nicht zu Ende studiert!) ... bis zu ihrem Pflichtgefühl Johanna, Fifi und Lora und auch ihrer Schwester, Ruths Mutter, gegenüber, über die alle sich Tante Ellen keinerlei Illusionen macht ... aber auch gar keine! ... und die sie völlig durchschaut und doch nicht fallen lässt, ... findet Ruth furchtbar lächerlich, und doch imponiert es ihr gewaltig. Irgendwie ist ihr die Tante Ellen zugleich Vorbild und abschreckendes Beispiel. Ein komisches, antiquiertes Überbleibsel aus vergangenen Tagen; und doch das, was sie gern erreichen möchte und nie erreichen kann. Ganz heimlich ist Ruth Bergheim nämlich verliebt in sie, und fühlt sich mit ihren neunzehn, die die Reife und Selbständigkeit und Erfahrung in allen menschlichen Sensationen von ehedem fünfunddreissig vorweggenommen haben, doch sehr zu ihr hingezogen ... zu dieser Tante Ellen (besonders jetzt, da sie sich Knall und Fall mit Doktor Fred Meirowitz verlobt hat. Sonntag wird Empfang sein). Ebenso empfindet sie es aber, dass sie nicht zu ihr hinüber kann. Denn — was niemand so auf den ersten Blick sehen wird — unter dem Firnis einer snobistischen Lebenslust, die eine lachende Unverwüstlichkeit und echte Sportliebe erträglich machen, steckt bei Ruth ein durch die Zustände im Elternhaus tief zerquältes Menschenkind, das doch zu schwach ist, um anders zu sein, als es ist, oder durch die Umgebung wurde. Und dass wieder, leider ein Familienerbteil von dem alten Grosspapa Stein, viel zu klug ist, um all das nicht selbst zu fühlen.
Tante Ellen wiederum hängt an ihrer Nichte mit all ihren ungenützten Gefühlen von Mütterlichkeit und mit einer geheimen Bewunderung, weil jene ein Dasein lebt, das sie zu leben kaum je den Mut fand, und dieses Dasein als selbstverständlich und zu ihr gehörig nimmt. Trotzdem häkeln sie sich natürlich und bewitzeln einander, wo sie sich sehen. Nur damit sie sich ihrer eigentlichen Gefühle füreinander nicht bewusst werden brauchen. Das ist nun schon seit einigen Jahren so und wird heute, am 23. November 1927 auch nicht viel anders sein. Immerhin sieht Ellen Stein diesem Besuch heute — nur eine Tasse Tee nach dem Abendbrot! — mit sehr gemischten Gefühlen und nicht ohne Bangen entgegen. Denn sie weiss von dieser Verlobung mehr als Ruth, und ahnt mehr, als ihr selbst lieb ist. Eigentlich wollte sie sogar noch abtelephonieren. Was sollte sie da noch? Ihre Rolle war doch ausgespielt; und ändern könnte sie doch nichts mehr; würde sich nur wieder durch unvorsichtiges Reden den Mund verbrennen. Und das bisschen Freude, das sie an dem Kind hätte, durch solchen Familienstunk (denn ihre Schwester liebte es nicht, dass man ihre Kreise störte, ... dann wurde sie brutal!) auch noch verlieren. Wenn Ruth erst verheiratet wäre, würde sie sich ja doch von ihr entfernen. Hoffnungslos in anderer Richtung hin. Schade!
All das hatte sich Ellen Stein lange überlegt, und trotzdem hatte sie doch lieber dem jungen Russen abtelephoniert, bei dem sie seit einem Vierteljahr russisch nahm, aber nicht recht weiter kam, weil er von einer Stunde dreiviertel von seinen Onkeln und Vettern und Tanten und Basen erzählte, die alle entweder Minister, Generäle oder Gouverneure und Hofdamen waren und beim Zar oder bei der Zarewna (Ça dépend) sehr in Gunst gestanden hätten, und von denen dann jeder auf eine andere raffiniert-grausame Art ums Leben gekommen war. Er gehörte eben wie alle russischen Emigranten einer sehr vornehmen und sehr weitverzweigten Familie an. So vornehm und so weitverzweigt, dass man gar nicht begriff, wie er jetzt so allein sein und so tief herunterkommen konnte. Also er würde statt heute abend um neun, morgen früh um neun kommen, der Herr Jwanoff Maljukin. Und dann ... ja ... dann gab es noch von sieben bis acht den Vortrag: „Der englische Arbeiter nach dem Kriege.“ Aber den mochte sie deshalb doch nicht versäumen.
Es war nebenbei ein sehr interessanter Vortrag. Nur dass er, wie alle Vorträge, zu wenig bei den Hörern voraussetzte und deshalb eigentlich aufhörte, bevor er angefangen hatte. Das, was man gern hören wollte: ‚Was ist los mit dem englischen Arbeiter? Was wird geschehen? Und wo steht er im Kampf gegen den Kapitalismus?‘ verschwieg der Vortragende, weil er es selbst nicht wusste, legte aber Wert darauf, alle englischen Worte englischer als der Engländer auszusprechen. Kurz, der Vortrag unterschied sich nicht viel von den hundertfünfzig Vorträgen, die an diesem Tag in Berlin gehalten wurden; ebenso, wie dieser Novembertag sich nicht viel von anderen Novembertagen früherer Jahre, und sehr wenig von denen dieses Jahres unterschied. Das heisst: die Wetterberichte behaupteten, dass man noch nie einen so kalten November gehabt hätte, aber gerade als sie das feststellten, hörte es schon wieder mit der Kälte auf, und der Schnee wurde zu Wasser und Schlamm, den die Autos in Fächern weit um sich spritzten, wobei sie, spasshaft, wie sie von Natur sind, nach den Strümpfen der Damen zielten. Aber nach wenigen Stunden, als die Strassenreinigung eingesetzt war, hatten sie auch dieses kleine Vergnügen nicht mehr, und die Strasse lag so grau wie immer im November, und Bürgersteig und Asphalt trocknete langsam in den amüsanten Ornamenten der Vorsatzpapiere bei einem scharfen Wind auf, der — eine Eigenart von Berlin! — an jeder Strassenecke aus einer anderen Richtung blies. Die Menschen jedoch waren gut und schlecht angezogen, je nach der Gegend; und sie gingen nach Hause oder ins Kino oder ins Sechstagerennen, in die Gesellschaft, in die Bar, ins Café, in die Kneipe, in die Kaschemme, auf Arbeit oder auf Einbruch, ins Theater oder ins Varieté, je nach dem Geldbeutel. Pärchen trafen sich und lächelten sich entgegen, und dieses Sich-schon-weitem-entgegenlächeln war vielleicht ihr Poetischstes an diesem Abend. Das andere war nur Amüsement oder Stumpfsinn und schlechte Laune, Missverständnisse und Nörgelei. Um die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche flammten in buntem Wechsel die Giebelreklamen und die gleichen Leute, die noch nie einen Blick von länger als einer halben Sekunde auf den ausgestirnten Augusthimmel hatten verweilen lassen, blieben hier einen Augenblick doch stehen und waren sehr begeistert davon; andere ergötzten sich mehr an den Spiegelungen, in dem noch teilweise feuchten, von tausend Gummirädern blankpolierten Asphalt, die kaleidoskopartig wechselten, und sagten dabei: „Lesser Ury.“ Alle aber waren stolz darauf, dass soviel Menschen und soviel Autos und Trams und Omnibusse sich in verschiedenen Richtungen durcheinanderschoben, vorwärtsstrebten, hielten, wieder anrückten und im Karussell um den Kirchenbau tanzten, nach den Taktschlägen der Verkehrsschutzleute und zu der Jazzmusik der Autohupen; und dass bei diesem Weltstadtspielen der Erwachsenen eigentlich doch viel weniger Menschen zu Schaden kamen, als man erwartete, und die meisten mit heilen Knochen dort landeten, wo sie hin wollten. Erst im Theater oder im Café gaben sie mit der Garderobe die Sensation der Strasse ab. Jeder Mann sah dabei jede Frau an, wie der Jäger einen Hasen, der in der Ackerfurche davonhoppelt. Wenn er ihn nicht gerade heute erlegte, nun so könnte er es ja ein anderes Mal tun. Und sie richteten die Attacken ihrer Blicke und auch ihrer Worte wahllos gegen solche, die sie ermunterten, und gegen solche, die sie im voraus entrüstet oder gleichgültig abwiesen, ohne, was das Alter und das Aussehen anbetraf, hier besonders wählerisch zu sein.
Und nachdem Ellen Stein dreimal Annäherungsversuche hatte abwehren müssen, der eine konnte an Alter ihr Vater sein, er schob seinen Bauch nur schwerfällig durch das Gewühl und mimmelte etwas von „Schönes Kind“ und „Abendessen“ vorsichtig aus dicken Lippen. Der andere konnte ihr Sohn sein. Er begann damit, ob er ihr die Pakete tragen dürfe, ... (denn Ellen Stein hatte noch schnell vor Ladenschluss, bevor sie sich über die Absichten der englischen Arbeiterschaft nicht instruieren liess, etwas Schokolade und Teegebäck und ein paar besondere Raffiniertheiten, die man nur an einer Quelle bekam, gekauft, weil sie wusste, dass Ruth so etwas über alles liebte. Ganz gleich, was es war. Es musste nur eine Verpackung haben, auf der englisch, französisch, italienisch, russisch oder chinesisch stand, dann war sie schon begeistert und knabberte und knusperte mit spitzen Zähnen und seligem Gesicht daran herum, als beginge sie damit eine sakrale Handlung) ... Aber Ellen Stein konnte sich doch nicht der Meinung anschliessen, die jener Jüngling vertrat, dass diese paar kleinen Päckchen für ihre zarten Hände viel zu schwer wären. Der junge Mann sagte nebenbei sein Sprüchlein her, als ob er es aus dem Buch „Der scharmante Gesellschafter in allen Lebenslagen“, Kapitel acht: „Anknüpfung einer Damenbekanntschaft“, auswendig gelernt hätte.
Und dem dritten verzieh Ellen Stein nicht, dass er, ein hübscher, geradegewachsener ostpreussischer Schnoesel mit Wasserscheitel, der Wunschtraum jedes Ladenmädchens, so wenig Geschmack hatte, seine unzarten Werbungen gegen ein ältliches und unauffälliges Wesen, wie sie es war, nutzlos zu verschwenden. Was versprach er sich nur davon?! Als aber dann noch ein junges, hageres, frierendes Ding, bei der die Schminke sich mit der hektischen Röte vermischte, mit einer Lederkappe mit zwei Schlaufen, wie die Ohren eines Wiesels, in einer Pelzboa und zu kurzem Röckchen, aus denen wie zwei Stearinkerzen zwei lange, dünne, weissbestrumpfte Knabenbeine zur Erde wuchsen, sie erst frech anblinzelte, dann, nachdem sie eine Weile neben ihr gegangen war, unauffällig leise mit der Zunge schnalzte, und endlich sogar irgend etwas zu zwitschern begann, zog es Ellen Stein doch vor (nicht angewidert, sondern mehr beschämt und tieftraurig darüber, wozu Menschen, und besonders ihre Schwestern, alles greifen mussten, um in einer Grossstadt ihr armseliges Leben zu fristen) — zog es vor, zog es vor ... sie wäre ja viel lieber noch etwas gegangen! ... ein vorüberfahrendes Auto anzuhalten. Es war auch Zeit ... vielleicht warteten Ruth und Fred schon bei ihr auf sie. Der Chauffeur wiederholte mit sehr unfreundlichem Gesicht, da die Entfernung zu kurz war — nur ein paar Minuten — Strasse und Hausnummer. Währenddessen könnten ihm die dicksten Fuhren durch die Nase gehen und nachher konnte man wieder bis halb elf warten, wenn die Theater aus waren, bis man wieder eine ordentliche Fuhre kriegt. Denn auch die Strasse hat ihre Gezeiten, ihre Ebbe und Flut, deren Rhythmus nur der kennt und beachtet, der von der Strasse zu leben hat. Der Zeitungshändler, die Prostituierte, der Chauffeur, der Taschendieb und der Schupomann, der Kokainverkäufer und der Schlepper. Und diese Ebbe und Flut sind fast in jeder Strasse und in jedem Stadtteil andere. Um Viertelstunden, ja um Stunden voneinander getrennt.
Das Auto aber warf sich mit jener Ungeduld in das Gewühl seiner Konkurrenten jeglichen Kalibers, die eine Charaktereigenschaft des Grossstadtautos ist: es hat seinen Autoehrgeiz, schneller zu fahren als das andere. Aber zumeist und gerade hier ist es ja — und um diese Zeit vor allem — gezwungen, nach Zählen auf der Stelle zu marschieren. Aber sowie es fünfzig Meter freie Fahrt wittert, kurbelt es auch schon auf Prestissimo an und bringt seinen Eifer gerade noch zehn Zentimeter vor seinem Vordermann zu stehen, schnauft tief auf vor Ungeduld, und nimmt alsbald einen neuen Anlauf, um an jenem möglichst vorbeizufahren, der aber ebenso resultatlos verläuft, ... bis es plötzlich in eine Nebenstrasse abbiegt und nun zeigt, was es kann. Manchmal sausen die grossen hellen Spiegelfenster in all ihrer Buntheit des Lichts und der Seidenstoffe und Blumen und Lederwaren und Hüte, der Parfümflakons und der Pyramiden aus Schuhwerk dem da drinnen vorüber, wie mit dem zitternden Fächerschlag japanischer Gaukler die bunten Bälle durcheinanderwirbeln. Und dann maikäfert das Auto wieder eine Minute auf einem Fleck, und er betrachtet stieren Blicks und halb bewusst einen mit Lotterielosen beklebten Zigarrenladen, oder die triefenden Spiesse des Gitters eines melancholischen Vorgartens, der eigentlich kein Garten, sondern nur ein Stückchen eingefriedeter Erde ist, die die kaum glaubliche Tatsache erhärtet, dass, bevor es hier Granitplatten und Steine und Asphalt und Leitungsdrähte und Häuser und Kanalisationsröhren in den Schächten gab, dass da hier doch Erde, richtiger Erdboden, Sand, Wiesen oder Kiefernschonung war, und dass sich immer noch Erde unter all dem findet, und auch eines Tages — wenn auch wohl erst in Jahrhunderten! — wieder zum Vorschein kommen wird.
Ja, selbst Ellen Stein erinnerte sich sogar noch so ganz dämmerhaft der Zeit, da hier noch Erde und kein Haus war; ja nichts von alledem, was hier jetzt — scheinbar für ewig — die Herrschaft übernommen hat. Sie war jetzt missgestimmt, Ellen Stein. Nicht etwa durch die kleinen Erlebnisse von vorhin, die die üblichen für eine alleingehende Dame in dieser Gegend und um diese Tageszeit waren, und die sie nicht einmal besonders tragisch nahm. (Ja sie dachte sogar manchmal: ‚was würde sein, wenn ...? Und was sind das wohl für Menschen? Man kann sicherlich nicht zehn Worte mit ihnen reden. Es gibt gewiss nicht einen Punkt, in dem man gleich denkt. Sie haben weder den Schlüssel zu meiner Welt, noch besitze ich ihn zu der Welt jener, die primitiv und berechnend zugleich ist‘.) Aber deshalb war sie jetzt nicht missgestimmt: nein, es war wohl eher jenes merkwürdige Gefühl, der zwecklosen Einsamkeit, das uns so leicht befällt, wenn wir allein in dem dämmerigen Kasten aus Glas und Metall und Leder dahingetragen werden, und mitten aus allem Lärm und Gewühl, die uns umgeben, plötzlich auf uns selbst zurückgeworfen sind. Zu zweien ist eine Autofahrt immer eine erfrischende Sache. So allein an einem Novemberabend aber, in dem dämmerigen Vogelkäfig des Taxi, ist es stets nur eine nachdenksame und leicht verstimmende Angelegenheit ... und so war Ellen Stein froh, wie sie vor ihrem Haus ... doch das hätte man nicht Herrn Brenneisen sagen sollen! ... also vor ihrer Luxuswohnung im Hause des Herrn Brenneisen (der Chauffeur hatte noch einen kleinen Umweg sich schnell geleistet, was bei dem niedrigen Fahrpreis sein gutes Recht war) endlich ausstieg.
II. Johanna
Nein, oben war noch nicht hell. Also war das Brautpaar, wie alle wohlerzogenen Menschen, unpünktlich; aber Ellen Stein kannte das auch genau, es war nicht eine Minute unpünktlicher, als es sein konnte. Besonders, da es wusste, dass keine anderen Gäste kämen. In zehn Minuten, spätestens einer Viertelstunde würde das Brautpaar also da sein. Natürlich war das Haus schon wieder abgeschlossen, denn der Portier hatte seine eigene Zeitrechnung. Überall sonst brannte noch das Licht drüben in den Fluren, er aber hatte wohl die Eigenheit seines Dorfes beibehalten, im Winter früh schlafen zu gehen. Aber die Treppenbeleuchtung war wenigstens in Ordnung und der Fahrstuhl auch ... warum auch nicht, die Mieter hatten ja eben erst für beides Reparaturkosten von turmhafter Höhe zahlen müssen. Jedesmal, wenn Ellen Stein des Abends auf den Lichtknopf drückte, hoffte sie, es würde einmal ihr altes weisses Treppenhaus aus der Rauchstrasse mit den hohen breiten Fenstern, den dünnen vergoldeten Gitterstäben des Treppengeländers, mit dem Gipsabguss der Herkulanerin auf dem Podest, und mit den Lorbeerbäumen in Kübeln, die dort überwinterten, (im Sommer standen sie hinten an der Gartentreppe) und dem grossen Kamelienbusch, der seit vierzig Jahren jeden Januar voller Blüten gewesen war, und auf den alle sehr stolz waren, würde einmal all das nun aus der Dunkelheit ihr entgegenspringen. Und immer wieder war es nur diese fatale Ansammlung von Holz- und Marmorplatten, die man Vestibül nannte, und von denen das Holz seinen Ton eingebüsst hatte, weil es nur auf Edelholz eingefärbt war. Und die Marmorplatten stumpf in der Politur geworden waren und schmuddelig, weil sie eben keine Marmorplatten waren, sondern nur so aussahen (man so duhn!, wie ein Lieblingswort Fontanes war). Das da war ja auch nichts gewesen, nur ruhig und hell und weiträumig; ... aber es war doch wenigstens kein „falscher“ Marmor.
Auch oben war alles noch dunkel und still. Und als Ellen Stein aufschloss, während eben wieder die Treppenbeleuchtung abschnappte, um mit einem Schlag das Treppenhaus samt den Goldtapeten in ein erbarmungsvolles Dunkel zu hüllen, rief sie, halb noch draussen, halb im Korridor, schrill und missmutig ein paarmal: „Johanna!“ und murmelte, als sich nichts regte, ein: „Unerhört!“ hinterher. Vielleicht waren sie schon inzwischen dagewesen und wieder fortgegangen, kamen nochmal. Auch das Ehepaar Gross schien entflattert zu sein. Jedenfalls hatten sie kein Licht in ihren Zimmern. Und im Salon, — was dachte diese alte Person sich eigentlich! — war der Teetisch noch nicht gerichtet. Das stellte Ellen Stein erschrocken fest, während sie noch mit der einen Hand im Mantelärmel war und mit der anderen das Licht knipste. Und warf, ganz wider ihre Art, den Mantel über einen Stuhl des Korridors, und ging daran, die Nippes vom Tisch zu räumen, während sie in gemessenen Abständen ihren Schlachtruf „Johanna“ durch die Wohnung gellen liess.
Die einzige Konzession, die dieser Salon von einst an die Gegenwart machte, war die Zentralheizung und das Tischtelephon, das sich aber auf einem Seitentisch vor dem Sofa zwischen allerhand Whistkästen und geschnitzten Reiseandenken aus Olivenholz und Perlmutter verbarg, weil es wusste, man würde es schon finden, wenn es um Hilfe schrie. Und die Zentralheizung hatte sich ebenso in eine Art von durchbrochenem schwarzen Schrank versteckt. Nur die Intimen des Hauses, und das waren ausser Johanna und Ruth nicht viele, wussten, dass weiter die beiden hohen Petroleumlampen mit den gemalten Porzellanbecken und den gemalten Glasschirmen und den vergoldeten Bronzefüssen mit Bronzegriffen und Ketten (wozu?!), die aus Paris stammten, und denen einst nachgerühmt wurde, dass die Kaiserin Eugenie in ihren Privatgemächern die gleichen gehabt hätte, nicht mehr von der Marmorplatte des Trumeaus weggeräumt werden konnten, weil sie nämlich für Elektrizität angeschlossen und dort festmontiert waren.
Man muss nebenbei nicht glauben, dass sie, Ellen Stein, diese Lampen besonders schön fand oder sich über die Palisandermöbel des Salons irgendwelchen falschen Vorstellungen hingab ... Gewiss, sie waren so das beste, was sich wohlhabende Leute vor sechzig und fünfzig Jahren als das Neueste und Modernste anschafften, aber sie waren trotzdem das Schlimmste, das damals seit vierhundert Jahren gemacht worden war, sofern man nicht an das dabei denken wollte, was nachher kam. Mit den Jahrzehnten aber hatten sie die Patina von Behaglichkeit bekommen, ebenso wie Mutters Nähtisch mit Troddeln, der wie neu war, da Madame Stein in dreissig Jahren nie eine Nadel in die Hand genommen hatte, und da ihre Tochter die Pietät soweit getrieben hatte, dass sie es auch in den folgenden fünfzehn Jahren nicht tat. Selbst das vergoldete Stühlchen, das mit dem Nähtisch verheiratet war, und dessen Vergoldung nirgends an Glanz eingebüsst hatte, weil niemand auf seine Zierlichkeit sich je zu setzen gewagt hatte, schien hier am Platze. Die Polsterstühle hingegen luden gerade dazu ein, und sie gleichen einer freundlichen, alten Kinderfrau, die gewiss keine Schönheit ist, aber bei der man sich geborgen fühlt. Nur dass eine Kinderfrau keine weiten Seidenkleider trägt mit vielen Falten und Knöpfen und einem Volant von Quasten. Auch würde Ellen Stein nie eine Alabasterschale sich hinstellen, auch wenn in ihr Früchte aus Gummipapier lägen, oder in Vasen künstliche Blumen mehr dulden. Und noch weniger würde sie etwa grosse Photographien von gleichgültigen Leuten sich hinhängen mit geschnitzten Holzrahmen aus Ranken und Blüten von Gartenwinden, nur weil die Urbilder vorgaben, mit ihr verwandt zu sein. Sogar über den künstlerischen Reiz der ovalen Ölbilder in ihren Goldrahmen gab sie sich keiner Täuschung hin. Diese Herren mit den flatternden Habsburger Koteletten, und jene mit der Fliege und dem dicken gedrehten Schnurrbart, wie man es heute nur bei Stallmeistern im Zirkus noch findet, waren doch menschlich gleichgültig, und nur dadurch belustigend, dass man heute eben nicht mehr so aussah ... wie vor sechzig Jahren und mehr man ausgesehen hatte, wenn man bekannt dafür war, der „schöne Mann“ zu sein. Aber ihre Frauen waren damals weicher und vor allem frauenhafter, als die heute ... mit einem verschleierten Blick der Augen unter sich senkenden Wimpern und mit einem Silberschimmer des Nackens, der mit einer leichten Drehung aus einem schwarzen Kantenschal emporwuchs. Man fühlte, dass der Maler sie verehrt und nicht nur begehrt hatte.