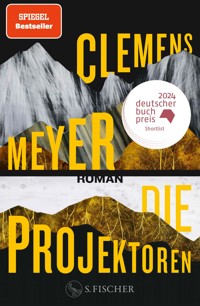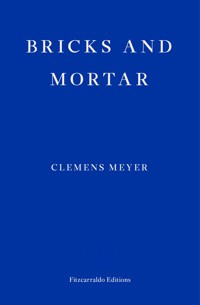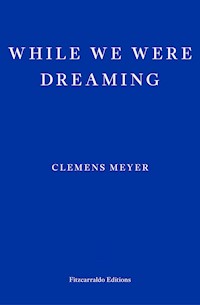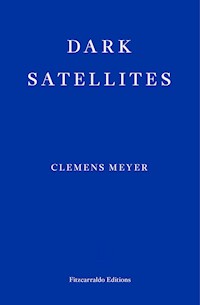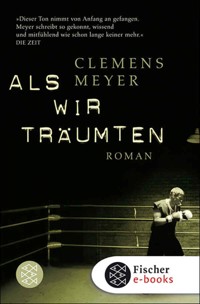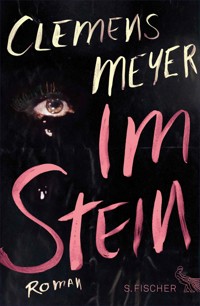9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ich will Geschichten schreiben, die leuchten.« Clemens Meyer Sie reden eine Nacht lang, der junge Mann und eine Freundin. Sie haben einander zufällig wiedergetroffen, sie denkt vielleicht an ein gemeinsames Leben, doch er weiß, dass es anders kommen wird. Clemens Meyer erzählt von der verpassten Liebe, der Hoffnung, einmal im Leben den großen Gewinn einzustreichen, und von dem Willen, etwas aus sich zu machen. Seine Helden sind Menschen, die mit dem Leben kämpfen, strauchelnde Glückssucher und ruhelose Nachtgestalten. Ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 2008
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Clemens Meyer
Die Nacht, die Lichter
Stories
Erzählung/en
Fischer e-books
Der kleine Tod
»Mach’s gut«, sagt sie und nimmt ihre Tasche vom Bett. Ich nicke, und sie geht.
Ich höre sie auf dem Wohnungsflur, ich habe dort kein Licht, und sie braucht eine Weile, bis sie die Tür findet. Ich drehe mich an die Wand, aber sie macht die Wohnungstür ganz vorsichtig zu. Das Gehen, der Abschied, die Hand, die an der Schulter und am Arm ins Leere gleitet, das Liegenbleiben. Und die Träume. Der kleine Tod. Nein, der Tod ist später, wenn du allein bist und niemand mehr kommt.
Ich höre eine S-Bahn über die Brücke fahren. Ich drehe den Kopf und sehe die Lichter der doppelstöckigen Waggons durch die Jalousie. Die S-Bahn fährt langsam, und ich höre sie noch eine Weile, als die Lichter längst verschwunden sind. Ich greife hinter mich auf den Tisch und suche die Zigarette, die ich dort jedes Mal hinlege. Ich habe schon vor einiger Zeit aufgehört zu rauchen, aber es ist jedes Mal diese eine Zigarette. Ich gehe vorher immer zu dem Zahnlosen, der ganz oben wohnt, ein spindeldürrer Kerl, der mit einer Dicken zusammenlebt.
»Die Zigarette«, nuschelt er und grinst. Er nennt mich immer »Christian«, obwohl ich nicht so heiße, und ich blicke auf die letzten, braunen Stummel in seinem Mund. Ich bleibe immer an der Tür stehen, und er dreht sich um, läuft durch den Flur ins Schlafzimmer. Ich höre ihn dort rumwirtschaften, und dann blickt die Dicke aus der Schlafzimmertür. Sie trägt eine Art Nachthemd, und ihre Brüste liegen auf ihrem Bauch. Sie lächelt, und ich habe Angst, dass sie ganz rauskommt. Aber der Zahnlose schreit irgendwas, und sie ist verschwunden. Die Bude riecht ziemlich nach Schnaps, und auch der Zahnlose stinkt wie ein Spritfresser, als er wieder vor mir steht und die Zigarette mit seinen dürren Händen festhält. Ich verstehe ihn kaum, wenn er was sagt, und das liegt nicht nur daran, dass fast alle seine Zähne verschwunden sind. Manchmal stelle ich mir vor, wie die Dicke ihm das Essen vorkaut. Ich nehme die Zigarette und zünde sie an. Ich drehe mich auf den Rücken und taste nach dem Kissen, aber ich finde es nicht.
»Du bist so kalt«, sagt sie manchmal zu mir. Ich blicke an die Decke. Sie hat das Kissen zu sich rangezogen und liegt mit dem Kissen ein ganzes Stück von mir weg. Ich strecke meinen Arm nach ihr aus, berühre aber nur das Kissen. Ich stehe auf. Ich gehe zum Fenster und blicke durch die Jalousie rüber zum Bahndamm. Eine Treppe führt hoch zur S-Bahn-Station, Laternen mit gelbem Licht, da kommt ein Mann, ganz langsam läuft er die Treppe runter, und ich drehe mich weg. »Du bist so kalt«, sagt sie, und ich befühle mein Gesicht mit beiden Händen, aber es ist ganz warm.
»Gehst du morgen aufs Amt«, fragt sie. Ich nicke. »Letzte Woche warst du auch nicht.«
»Nein. Aber morgen.« Ich schnippe die Asche aufs Fensterbrett und lege mich wieder neben das Kissen. Auf dem Nachttisch ist Asche, und ich puste sie weg. Ich habe die Zigarette bis runter zum Filter geraucht und stelle den Filter ganz vorsichtig, mit der Glut nach oben, auf den Nachttisch. Ich beobachte den Rauch, der in einer dünnen Linie sehr gerade nach oben steigt, die Glut verschwindet langsam, und ich schließe die Augen. Ich höre eine S-Bahn über die Brücke fahren, bis zehn kommt sie alle zwanzig Minuten, ich fahre aufs Amt, und früh am Morgen, wenn dort alles noch schnell geht und ich schnell wieder gehen darf, kann ich denselben Fahrschein für die Rückfahrt benutzen, aber das ist nur zwei- oder dreimal passiert in den Jahren.
Ich laufe durch die hellen weißen Flure, ich bin müde und sehe die Nummern neben den Türen, in der S-Bahn bin ich eingeschlafen, und der kleine Mann mit dem Schnauzbart hat mich geweckt, »Termine«, sagt er, »Termine«, er wohnt ein paar Häuser weiter, aber ich habe ihn nicht einsteigen sehen. Er fährt viel zum Amt, und auch sonst sehe ich ihn oft in der S-Bahn sitzen, alleine am Fenster, vielleicht fährt er manchmal von Endstelle zu Endstelle.
Ich laufe durch die hellen weißen Gänge, der kleine Mann ist irgendwo verschwunden, ich sehe die Nummern neben den Türen, Stühle, Leute, und ich setze mich hin. Türen gehen auf, Leute verschwinden, Leute kommen wieder raus und laufen durch die Gänge, ich blicke noch mal auf die Nummern neben den Türen, irgendwas stimmt nicht, und ich stehe auf. »Hier war doch immer ...«
»Nein«, sagt die Frau mit dem Schild an der Brust, ich bin müde und will nicht auf ihre Brust blicken, »die sind jetzt drüben in Haus B.«
»Haus B«, sage ich und blicke mich um, aber sie ist nicht mehr da. Ich schiebe den Ärmel zurück, aber ich habe keine Uhr, wo ist meine gute silberne Uhr?, ich habe sie geschenkt bekommen, aber das ist ein paar Jahre her. »Termine«, sagt sie, »damit du immer an deine Termine denkst.«
Ich laufe durch die hellen weißen Gänge, der kleine Mann mit dem Schnauzbart ist wieder da, er steht in einer offenen Tür, den Rücken ein wenig gekrümmt.
Er sagt wohl was, denn sein Kopf bewegt sich, aber ich höre nur die Stimme einer Frau: »Und da kommen Sie erst jetzt?«
Ich laufe an ihm vorbei zum Fahrstuhl. Ich drücke auf beide Knöpfe, ein Pfeil nach unten, einer nach oben, und warte. Es macht ding, aber das ist irgendwo anders, und ich warte, und der Fahrstuhl kommt ganz leise, die Türen öffnen sich, und ich gehe rein. Keiner weiter drin, und auch kein Spiegel da, ich drücke auf »Erdgeschoss«, die Türen schließen sich, und wir fahren.
Wir fahren. Ich blicke auf meine gute silberne Uhr. Sie hält meinen Arm fest und sagt: »Wir kommen zu spät, du kommst zu spät, die geben’s dir nicht, weil du zu spät kommst.«
Ich will was sagen, blicke aber nur auf die Zeiger meiner Uhr. Wir sitzen in der S-Bahn, sie hält meinen Arm fest, dass es wehtut, und ich blicke mich um und suche den kleinen Mann mit dem Schnauzbart. »Weil du kein Auto hast«, sagt sie, und ich versuche, den Jackenärmel über meine Uhr und ihre Hand zu schieben. Ich schließe die Augen und höre, wie die S-Bahn über die Brücke fährt. Ich öffne die Augen und sehe vier Zigarettenfilter, die neben mir auf dem Nachttisch stehen. Es macht ding und dann dong, und ich stehe auf. Ich gehe zum Fenster und blicke durch die Jalousie nach draußen. Ein Mann steht vor der Haustür, hinter ihm ein kleiner silberfarbener VW. Wieder ding und dann dong, ich will zur Klingel gehen und den Draht abklemmen, das habe ich schon eine Weile vor, aber ich gehe zum Bett und lege mich hin.
Die Klingel ist still, gleich wird er es woanders versuchen, aber das Haus ist leer, nur die beiden Schönen wohnen ganz oben, und ich hoffe, dass sie nicht da sind oder dass die Dicke auf ihm liegt und er nicht zum Summer gehen kann, und bevor sie es zur Tür schafft, ist der kleine silberne VW verschwunden.
Ich ziehe mir die Decke bis hoch zum Gesicht, nur meine Augen sind noch da, und dann, nach einer Weile, oder sind es nur paar Sekunden gewesen?, höre ich, wie eine Autotür zugeworfen wird, und dann, wieder dauert es, Motorengeräusche. Dann ist es still. Es ist so still, dass ich Angst habe, das Telefon könnte anfangen zu klingeln. Ich lausche und warte. Den Stecker will ich nicht rausziehen, und vielleicht ist die Leitung längst tot. Sie müssen nicht kommen um abzuschalten.
»Die Zigarette«, nuschelt der Dürre und grinst, und dann fragt er noch: »Willst du reinkommen, auf ’n Bier«, aber ich sage: »Nein, sie müsste bald kommen«, und er grinst mich an, es scheint mir, dass er jedes Mal weniger Zähne hat.
»Christian«, nuschelt er und zwinkert mir zu. Einmal bin ich doch in seiner Wohnung gewesen, das muss paar Jahre her sein, denn damals hatte ich noch ein Auto, einen silberfarbenen VW-Golf, irgendwas stimmt nicht, ich hatte einen kleinen Japaner, und der war weiß. Wir gucken Fernsehen, der Dürre schläft langsam ein, die Schnapsflasche zwischen seinen Beinen. Ich will ihn aufwecken, aber sie hält meinen Arm fest und nimmt die Flasche. »Bist viel allein, Christian«, sagt sie. »Nein, nein«, sage ich, »sie müsste bald kommen ...«
»Christian«, sagt sie und hält jetzt meine Hand. Wieso wissen sie nicht, wie ich heiße? Ich habe das Namensschild von der Tür abgemacht, aber erst vor ein paar Wochen, und sie wohnen schon seit Jahren in dem Haus, genau wie ich. »Du bist so kalt«, sagt sie.
Wir fahren. Es wird Herbst, und wir waren das letzte Mal Anfang August am See, oder war es der Sommer davor? »Ist zu kalt zum Baden«, sagt sie, aber ich sage: »Wir können auch nur so aufs Wasser schauen.« Und ich schaue. Ich habe mein Fahrrad an den Baum gelehnt und blicke auf den See. Keiner weiter da. Ist ein ziemlich kleiner See. Das Wasser ist dunkel, das liegt am Himmel. Ich habe ein paar Briefe in der Jackentasche, vom Amt, von den Stadtwerken und von Leuten, die ich nicht kenne. Ist auch einer von ihr dabei, und ich gehe zum Wasser, so dass es fast meine Schuhe berührt. Jetzt kommt eine kleine Welle, ist windig geworden, aber ich bleibe stehen und werfe die Briefe in den See. Sie bleiben eine Weile in der Nähe des Ufers, dann verteilen sie sich, ich drehe mich um und gehe zurück zu dem Baum. Hinter dem Baum ist eine kleine Böschung und dahinter die Autobahn. Ich kann ihr Summen hören. Wir fahren. Entlang der Böschung liegen kleine Haufen Müll, leere Flaschen, Zigarettenschachteln, Papier. Ich fahre langsam, drehe mich um und blicke aufs Wasser, aber die Briefe sind verschwunden. Als ich mich noch mal umdrehe, sehe ich einen, ein winziger weißer Fleck in der Nähe des Ufers. Ich fahre und blicke nicht noch mal zurück, denn ich weiß, dass der kleine weiße Fleck dann verschwunden ist.
Ich sitze auf einer Bank an der Landstraße. Ein paar hundert Meter vor mir ist ein Dorf, dahinter noch eins und dann die Stadt. Es wird Abend, und hinter meinem Rücken ist der Himmel rot. Ich rauche eine Zigarette, ich weiß nicht, wo die herkommt, ist eine andere Marke als die, die der Dürre raucht. Ich bin lange nicht bei ihm gewesen, ich höre nur manchmal seine Schöne, so nennt er sie, sie zerrt die leeren Aschentonnen ins Haus und hinter auf den Hof, wenn die Müllabfuhr da gewesen ist. Vielleicht ist die Zigarette von dem kleinen Mann mit dem Schnauzbart, aber der raucht Selbstgedrehte. »Hab’s mir angewöhnt, als ich gedient hab«, sagt er. »Wo hast du gedient«, frage ich. »So hier und da«, sagt er, »hab lang genug gedient«, und ich weiß, was er meint. Er hat ein paar Tätowierungen und ein paar Kinder, die fast den ganzen Tag oben auf dem Bahndamm spielen. »Weil ich so lange weg war«, sagt der kleine Mann und zieht die Schultern hoch, dass sein Kopf fast verschwindet, »hab lang genug gedient.« Seine Frau ist genauso klein wie er, ich sehe sie manchmal, wenn sie die Kinder vom Bahndamm holt. Zwei Fliegen sitzen auf meinem Bein. Sie bewegen sich nicht, auch nicht, als ich sie wegpusten will. Es ist die Jahreszeit, in der die Fliegen sterben. Sie sitzen einfach auf meinem Bein, dicht nebeneinander, jetzt bewegt eine ihre Flügel, ganz kurz nur, und ich stehe vorsichtig auf.
Zehn Uhr. Die blaue Null wird zur Eins. Ich habe lange gesucht, bis ich einen Wecker mit blauer Digitalanzeige gefunden habe. Wir waren in einem Laden, in dem es nur Uhren gab. Hat sie mir dort die gute silberne Uhr gekauft? Die kleine blaue Eins wird zur Zwei. Ich stehe im Dunkeln und bewege mich nicht. Es wird nicht hell an diesem Morgen, das liegt am Himmel. Die Digitalanzeige des Weckers ist leer, aber ich beobachte die Zeiger an meinem Arm. Die Stadtwerke waren da gewesen, und die Wohnung ist dunkel. Ich weiß nicht, wie lange schon, und ich vermisse die kleinen blauen Zahlen. Ich will mich wieder hinlegen, aber ich kann das Kissen nicht erkennen. Sie haben oft angerufen, das Telefon geht auch im Dunkeln. »Wieso sind Sie nicht zu Ihrem Termin gekommen?« Ich will ihnen von dem kleinen Mann mit dem Schnauzbart erzählen, der nicht mehr S-Bahn fährt, aber ich sage nur: »Ich bin oft müde in letzter Zeit.«
»Wir müssen Ihnen das Geld sperren.«
»Es liegt am Wecker«, will ich sagen, aber sicher wissen sie von der guten silbernen Uhr an meinem Arm.
»Ich bin’s«, sagt sie irgendwo, und ich sage: »Wie geht’s dir, wo bist du?«
»Gut«, sagt sie, »ich habe geklingelt, paar Mal.«
»War wohl spazieren«, sage ich, und dann macht es klick, irgendwo dort, wo sie ist, und ich kenne das Geräusch. Ist ein Feuerzeug, und sie raucht nicht.
Ich halte den Hörer ein Stück weg, denn das Klick bewegt sich immer noch in meinem Ohr. »Wo bist du«, sage ich und höre ihre Stimme und schweige dann und warte, bis es wieder klick macht, ein anderes Geräusch, ein ganz anderes Geräusch, und sie ist weg. Ich gehe zum Nachttisch und nehme das Feuerzeug. Ich mache es an und wieder aus und wieder an. Ich habe die Filter zu einem Kreis angeordnet. Ich lasse die Flamme ein wenig brennen, und dann will ich noch einmal das Geräusch hören. Der kleine Tod. Kein Laut in der Wohnung, auch der Kühlschrank ist still in der Küche, ich lege das Feuerzeug vorsichtig aufs Kissen und gehe zum Fenster. Ich blicke durch die Jalousie rüber zum Bahndamm. Die Laternen leuchten gelb, es muss schon Abend sein.
Ich stehe in dem gelben Licht und blicke auf die Straße und dann auf mein Haus. Alle Fenster sind dunkel, auch der Dürre und seine Schöne sitzen im Dunkeln, aber vielleicht sind sie weggegangen, es ist Monatsanfang. Die Straße runter ist eine kleine Kneipe, aber vielleicht sind sie auch bei dem Italiener im Nachbarviertel, der Dürre saugt Spaghetti in seinen zahnlosen Mund, und sie schaut ihn dabei an und lächelt.
Ich setze mich auf die Treppe, die Flasche klemme ich zwischen meine Beine. Ich schraube den Verschluss ab und werfe ihn weg. Ein paar Autos fahren die Straße entlang, es ist kühl geworden, und ich trinke. Dann geht das Licht an, ganz oben im vierten Stock. Die Gardinen sind zurückgezogen, ist aber keiner zu sehen am Fenster, nur ein großer Teddybär sitzt auf dem Fensterbrett. Ich spüre, wie ich lächle, ich höre die S-Bahn hinter mir und die Autos unten auf der Straße, aber ich sehe nur den großen Teddybären mitten auf dem Fensterbrett. Ich weiß nicht, wie lange ich ihn anschaue, ich spüre das Lächeln an meinen Mundwinkeln, dann nehme ich die Flasche und lege den Kopf zurück und trinke. Da ist ein Flugzeug am Himmel, es neigt sich ein wenig auf die Seite und fliegt einen Bogen zum Flughafen draußen vor der Stadt.
»Wie geht’s?«
Ich setze die Flasche ab und reiche sie dem kleinen Mann. Sein Schnauzbart ist weg, sein Gesicht ist geschwollen und seine Oberlippe unter einem großen Pflaster versteckt. Er legt den Kopf zurück und trinkt und sieht das Flugzeug.
Dann setzt er sich neben mich. »Das sind so Wunderfäden«, sagt er und tippt an seine Oberlippe, »die lösen sich auf, nach einer Weile, von ganz alleine.« Er versucht zu lächeln, lässt es aber, sicher tut das weh. »Wunderfäden«, sage ich, und er nickt. Er reicht mir eine von seinen Selbstgedrehten. »Fährst du noch S-Bahn?« Ich schüttele den Kopf, und er nickt wieder. Er sitzt ziemlich dicht neben mir, und ich spüre, wie er ganz schlaff wird und sich mit seiner Schulter an mich lehnt. Wir trinken und schweigen.
Ich stehe am Fenster und blicke durch die Jalousie rüber zum Bahndamm. Die Laternen leuchten gelb, es muss schon Abend sein. Da steht ein Mann im Licht der Laternen. Er dreht sich weg.
Warten auf Südamerika
Seine Mutter saß im Dunkeln. »Was ist los«, sagte er, »willst du nicht Licht machen, es wird Abend.«
»Ach«, sagte sie, »ich sitze ganz gerne hier und sehe zu, wie es langsam dunkel wird.« Sie saß in ihrem Sessel, direkt am Fenster, und das letzte Licht der Dämmerung fiel auf ihre Hände und den Tisch. Er sah die Kerzen dort, und jetzt wusste er, dass sie nicht freiwillig zusah, wie es langsam dunkel wurde. Sie hatten ihr den Strom abgestellt. Er blickte auf die Datumsanzeige seiner Uhr, der Zwanzigste, noch mehr als zehn Tage, bis sie neues Geld bekam. Und auch er musste noch mehr als zehn Tage warten, er war es gewohnt zu warten, nach all den Jahren, die er schon wartete. »Ich muss dann wieder los, Mutter«, sagte er.
»Ja«, sagte sie, »ich hab auch noch zu tun.«
»Soll ich dir was dalassen? Bin gerade flüssig.« Er wusste, dass sie Nein sagen würde. Als er auf der Treppe war, dachte er wieder an sein Auge, dachte, dass es vielleicht ganz gut gewesen war, dass seine Mutter im Dunkeln saß und so sein Auge nicht sehen konnte. Es war nicht weiter schlimm, nicht mal stark geschwollen, nur ein kleiner dunkelblauer, fast schon schwarzer Halbmond, der unter seinem Auge war und seit Tagen nicht verschwinden wollte, obwohl er Eiswürfel dagegendrückte und irgendein Gel aus der Apotheke benutzte. Er wusste nicht mal mehr genau, wie es passiert war, irgendein junger Kerl in irgendeiner Kneipe im Viertel. Er selbst hatte nicht angefangen, war sich da ganz sicher, denn wenn er in einer Kneipe saß und sein Geld vertrank, obwohl noch über vierzehn Tage vor ihm lagen, wollte er nur seine Ruhe haben und alles vergessen. Vielleicht hatte er nicht aufgepasst und jemanden angerempelt, und manche von den jungen Kerlen schlugen verdammt schnell zu und fingen Streit wegen Kleinigkeiten an. Die meisten von ihnen warteten genauso wie er, noch nicht so lange, aber sie warteten, Arbeit, Geld.
Er lief durch die Straßen, blickte nicht nach links und rechts, er kannte hier ja alles, jede Straße, jedes Haus, er wohnte seit über vierzig Jahren im Viertel, und er hörte die Stimmen aus den offenen Fenstern, das Klappern von Geschirr, Kinder, und er spürte, wie die Leute an ihm vorbeiliefen, und er sah das gelbe Licht der Straßenlaternen und das bunte Licht der Kneipen und Läden aus den Augenwinkeln. Nur ein paar Kneipen hatten sich noch gehalten, früher gab es an jeder zweiten Ecke eine, und auch die kleinen Läden verschwanden langsam.
Er lief an dem Spielplatz vorbei, auf dem sich an den Abenden und in den Nächten die Jugendlichen trafen, und auch jetzt konnte er sie hören, vielleicht war sogar der dabei, der ihm das Auge verpasst hatte.
Jemand sagte: »Entschuldigen Sie«, und er trat zur Seite und fragte: »Wie geht’s Ihnen«, und die Frau mit dem großen Zwillingskinderwagen, die ein paar Häuser neben ihm wohnte, lächelte und sagte: »Ach, ganz gut.« Sie tippte an ihr Auge und fragte dann: »Doch nichts Ernstes passiert, hoffentlich«, dabei hatte sie selbst dunkle Augenringe, die an manchen Tagen, wenn er sie auf der Straße traf, so dunkel waren, als hätte sie auch paar draufgekriegt. »Nein, nein«, sagte er, »nur bisschen Sport gemacht.« Sie nickte und schob den Kinderwagen an ihm vorbei, und er blickte auf ihre ausgebeulte Jeans, die so aussah, als wäre sie ihr ein paar Nummern zu groß.
Er stand vor seinem Briefkasten. Er hatte seit einigen Tagen nicht nach seiner Post geschaut, und als er jetzt den kleinen Schlüssel ins Schloss schob und die Briefkastentür öffnete, fielen drei Briefe vor ihm auf den Boden. Er bückte sich und hob sie auf. Einer vom Arbeitsamt und einer von einer Firma, bei der er sich vor etlichen Wochen beworben hatte, und er wusste, dass es keinen Sinn hatte, ihn zu lesen, riss aber trotzdem den Umschlag auf. Er zog das gefaltete Blatt heraus, hielt es ins Licht der Treppenhauslampe, dann zerknüllte er es und steckte es mit dem leeren Umschlag und dem Brief vom Amt in seine Jackentasche. Den dritten Brief hielt er eine Weile in seinen Händen, bis das Licht ausging. Er stand im Dunkeln und strich über den Umschlag. Er konnte die Briefmarke fühlen. Ein großer Schmetterling war darauf, so bunt, dass er glaubte, ihn noch im Dunkeln zu erkennen, und über dem Schmetterling stand in großen Druckbuchstaben »CUBA«. Er kannte niemanden in Kuba. Er hatte den Brief umgedreht, aber dort stand kein Absender, kein Name, keine Adresse. Er machte das Licht an und ging mit dem Brief langsam die Treppe hoch. Er wohnte ganz oben im vierten Stock, und während er Stufe um Stufe nach oben stieg, dachte er immer wieder: »Cuba, Havanna, Cuba«, vielleicht war der Brief für jemand anderen, aber groß und deutlich standen seine Adresse und sein Name auf dem Umschlag. Er schloss seine Wohnungstür auf, steckte den Schlüssel innen ins Schloss und drehte ihn zweimal um und machte dann das Licht an. Er dachte an seine Mutter und daran, dass er bald wieder bezahlen musste, sonst kamen sie auch zu ihm. Cuba. Er hängte seine Jacke an den Haken, ging in die Küche und legte den Brief auf den Tisch, genau ins Licht der Lampe. Dann nahm er ein Bier aus dem Kühlschrank, stellte es aber wieder zurück und kochte Kaffee. Er hatte fast kein Geld mehr, und das Bier musste noch zehn Tage reichen. Er konnte Flaschen abgeben, er hatte über vierzig leere Bierflaschen auf seinem kleinen Balkon, dazu einige Mineralwasser- und Cola-Flaschen, für das Pfand würde er ein paar neue Bier bekommen, aber er schämte sich, mit großen, klimpernden Beuteln zur Kaufhalle zu gehen, vor der die Trinker des Viertels standen. Nur manchmal im Winter, wenn es besonders kalt war, waren sie nicht da. Warum, dachte er, gehe ich nicht mit einem kleinen Beutel zur Kaufhalle und schaffe die Flaschen nach und nach weg? Er goss sich eine Tasse Kaffee ein, Milch und Zucker, dann setzte er sich an den Tisch. Er trank einen Schluck, etwas Kaffee tropfte auf den Tisch, und er holte einen Lappen, wischte ein paar Mal über die Tischplatte, dann stellte er die Tasse auf den Lappen. Er setzte sich wieder hin. Er betrachtete den Brief, versuchte, die Handschrift zu erkennen, aber er hatte schon seit Ewigkeiten keine private Post bekommen, nur Ämter und Firmen, bei denen er sich beworben hatte. Er hielt den Brief gegen das Licht der Lampe, konnte aber nichts in dem Umschlag erkennen. Auch in dem Poststempel stand »Cuba«, und dann waren da ein paar kleine Zahlen, wahrscheinlich das Datum, »08« konnte er lesen, der Rest war verwischt, vielleicht nass geworden auf der Reise. War der Brief mit dem Schiff gekommen oder in einem Flugzeug? Aber dann müsste doch »Air Mail« auf dem Stempel stehen, seine Mutter hatte einmal einen Brief bekommen, aus New York, von einer Cousine, und auf dem Umschlag hatte er irgendwas von »Air Mail« gelesen. »Paula macht Urlaub in New York, stell dir vor, New York, acht Stunden in der Luft, du erinnerst dich doch noch an deine Großcousine Paula?« Aber er konnte sich an keine Paula erinnern, und was interessierten ihn Flugzeuge und Schiffe und New York.
Er riss den Brief auf, er riss ihn so heftig auf, dass er den Schmetterling kaputt machte dabei, und dann hielt er ein dicht beschriebenes A4-Blatt in der Hand. Die Schrift war so klein, dass er noch einmal aufstand und seine Lesebrille aus der Stube holte. Er musste sie eine Weile suchen, sie lag auf dem Fensterbrett. Er setzte sie sich auf und blickte über die Gläser hinweg aus dem Fenster. Es war jetzt Nacht, und er sah die dunklen Häuser gegenüber, nur in wenigen Fenstern brannte Licht. Viele Wohnungen im Viertel standen leer. Er zog die Gardinen zu und ging zurück in die Küche. Er setzte sich und trank einen Schluck Kaffee. Der Kaffee war jetzt genau richtig, nicht mehr zu heiß, und er trank noch einen Schluck.
Er hustete laut, bevor er anfing zu lesen.
»Lieber Frank, es ist schon eine Weile her, dass wir beide voneinander gehört haben, und es ist schon viel länger her, dass wir uns gesehen haben. Drei oder vier Jahre? Ich weiß es nicht mehr genau. Bevor Du Dir jetzt den Kopf zerbrichst oder ganz unten nachschaust, wo ich ›mit besten Grüßen, Dein Wolfgang‹ hingeschrieben habe, jetzt muss ich lachen, denn ich habe doch erst angefangen zu schreiben.«
Er legte einen Finger auf die Zeile und strich mit der anderen Hand übers Papier. Wolfgang. Er kannte nur einen Wolfgang, seinen alten Schulfreund Wolfgang, mit dem er hier im Viertel aufgewachsen war. Was verdammt nochmal machte Wolfgang in Kuba? Er war doch arbeitslos gewesen, genau wie er, hatte gewartet, genau wie er. Vor zwei Jahren vielleicht hatte ihn Wolfgang aus Berlin angerufen, dort hatte er wohl mehr Chancen, Arbeit zu finden.
»Du wirst Dich fragen, was ich in Kuba mache. In meinem Kopf ist alles durcheinander, denn ich bin auf dem Weg nach Südamerika. Brasilien. Weißt Du noch, wie wir früher von Brasilien geträumt haben. Pelé, der große Pelé. Der weiße Zuckerhut und die Mädchen am Strand, weißt Du das noch? Da waren wir zehn, die Fußballweltmeisterschaft 1970. Die war in Mexiko. Brasilien gegen Italien im Endspiel. Wir haben das bei meinem Onkel in der Kneipe geguckt. Und auch das Halbfinale, BRD gegen Italien. Das war ein Riesenspiel, 4:3 für Italien, ich weiß das noch ganz genau, weil mein Onkel nach der Verlängerung eine Schnapsflasche in den Bildschirm geworfen hat. Rudi hat doch gewettet, dass Deutschland Weltmeister wird. Du erinnerst Dich doch noch an meinen Onkel Rudi? Die kleine Kneipe unten am Park. Steht das Haus noch, was ist da jetzt drin? Onkel Rudi hat ja seine Kneipe im Sommer 89 verkauft und ist in den Westen gegangen. Aber bestimmt weißt Du das alles selbst noch.
Du wohnst ja noch im Viertel, und das ist gut so, einer muss die Fahne hochhalten, auch wenn die Zeiten hart sind.
Lieber Frank, ich bin reich geworden. Nein, keine Angst, ich hab keine Bank ausgeraubt, wie ich das vor Jahren mal im Spaß gesagt hab. Ich glaub, ich hätte das gar nicht gekonnt, einfach so in eine Bank reinspazieren und irgendeine Waffe ziehen. Und wenn ich bis an mein Lebensende arbeitslos gewesen wäre, ich hätte versucht, es mit Anstand durchzustehen.
Lieber Frank, fast schäme ich mich ein bisschen, Dir aus Kuba zu schreiben, dass ich reich geworden bin, denn ich habe gehört, dass es Dir nicht besonders gut geht, und Du bist immer noch mein ältester und bester Freund, auch wenn wir uns so lange nicht gesehen haben, und ich wünsche mir, dass Dir mein Brief Kraft und Mut gibt. Einer von der alten Garde hat es geschafft!
Aber Du weißt ja, dass ich immer ein bisschen großspurig war, und deshalb muss ich gleich etwas zurückrudern. Richtig reich bin ich natürlich nicht geworden, aber es ist so viel Geld, wie ich noch nie in meinem Leben gehabt habe. Wenn ich es gut anlege und ein bisschen sparsam bin, werde ich wohl einige Jahre davon leben können, aber Du kennst mich ja, richtig mit Geld umgehen konnte ich noch nie und werde es wohl auch nie lernen, auch wenn ich versuchen will, es nicht mit vollen Händen auszugeben. Aber ich will ein kleines Stück der Welt kennenlernen und Dir davon erzählen. Ich bin jetzt 46 wie Du, aber ich will jetzt nicht davon anfangen, wie die Zeit vergeht, denn das weißt Du genauso gut wie ich. Ich trinke gerade einen 30 Jahre alten Rum, weißt Du noch, vor 30 Jahren, vielleicht ist es auch schon bisschen länger her, da waren wir das erste Mal richtig betrunken gewesen. In Onkel Rudis Kneipe, da haben wir uns die Seele aus dem Leib gekotzt, und trotzdem denk ich immer wieder gern dran zurück, und jetzt gerade, wenn ich diesen wunderbaren Rum trinke, der ist ganz dunkel im Glas, fast schon schwarz. Ich sitze auf dem Balkon, ein kleines Hotel, direkt am Meer. Ein Strand, wie ich ihn noch nie gesehen hab, ganz weiß, und das Meer ist grün und wird dann weiter draußen blau. Türkis, das kannte ich nur von Fotos. Und ich will Dir von der Abendsonne schreiben, die so riesengroß ist, aber ich muss immer wieder daran denken, wie wir bei Onkel Rudi am Tresen saßen und diesen billigen Rumverschnitt tranken und uns vorstellten, wir wären in Rio de Janeiro und würden den allerfeinsten Rum trinken mit frischer Minze drin, und draußen wären das Meer und der Zuckerhut, und kaffeebraune Brasilianerinnen würden am Strand Tango tanzen. Tango in Brasilien. Und wenn wir so vor uns hin träumten, waren wir doch irgendwie glücklich, auch wenn wir dann meistens furchtbar kotzen mussten. Gestern war ich in einer Bar in Havanna, die hatten über 100 Sorten Rum. Manche Flaschen waren so alt, da waren wir noch nicht mal geboren. Und Zigarren, die allerfeinsten kubanischen Zigarren, handgedreht, ich will versuchen, Dir eine zu schicken, aber ich weiß nicht, ob die durch den Zoll geht. Aber bevor Du Dir weiter den Kopf zerbrichst, will ich Dir erzählen, wie ich zu dem Geld gekommen bin. Onkel Rudi ist gestorben. Für seine Kneipe hat er ja damals nur wenig Geld bekommen. Er wollte ja unbedingt in den Westen, und ein halbes Jahr später ist die Mauer gefallen, aber er ist nie zurückgekommen, und keiner hat gewusst, was er macht. Er hat auch nie geschrieben, ich wusste nicht mal, dass er überhaupt noch lebt. Und dann krieg ich einen Brief, und dann erfahr ich, dass mein Onkel Rudi, dieser verrückte Hund, eine gut gehende Bar in Hamburg gehabt hat. Kannst Du Dir Onkel Rudi hinter dem Tresen einer guten und noblen Bar vorstellen? Ich konnte es auch nicht, aber genau so ist es gewesen. Onkel Rudi hat all die Jahre eine kleine, schicke Bar auf dem Kiez gehabt, und er hat Geld zurückgelegt. Du weißt ja, dass meine Eltern schon seit über 10 Jahren tot sind, er war ja der Bruder meiner Mutter, und Onkel Rudi hat nie geheiratet, und Kinder hatte er auch keine. Er hat sich nie gemeldet in den Jahren, aber ich stand in seinem Testament, nur ich. Und bestimmt wäre noch viel mehr Geld übrig gewesen, wenn er nicht auf so großem Fuß gelebt hätte, aber Du kennst ja Onkel Rudi. Es ist jetzt fast dunkel, wenn ich Dir nur diese riesige rote Sonne auf dem Ozean genau beschreiben könnte. Ich muss mir einen Fotoapparat besorgen, nicht einmal daran hab ich gedacht, aber es ist ja meine erste große Reise.
Unten vorm Hotel führt eine kleine Straße entlang, dort fahren manchmal richtige Oldtimer. Es gibt fast keine neuen Autos in Kuba, wegen dem Embargo. Ich habe noch nie solche herrlichen Oldtimer gesehen, Chevrolets mit großen Kühlerfiguren, uralte, schwarze Fords, manche Autos sind aus mehreren Teilen der unterschiedlichsten Marken zusammengebaut, aber sie fahren.
Lieber Frank, ich möchte Dir die Hand schütteln. Wenn Du durchs Viertel gehst, grüß alles von mir! Ich schreibe Dir bald wieder, egal, wohin ich reise.
Dein alter Freund Wolfgang.«
Er stand auf dem Balkon, zwischen den leeren Bierflaschen. Wenn er sich bewegte, klirrten sie leise. Er hatte den Brief zusammengefaltet und hielt ihn in der Hand. Er blickte auf die dunklen Häuser, in einigen Fenstern flimmerte jetzt blaues Licht. Er hielt ein Glas in der anderen Hand, billigen Jamaika-Rumverschnitt, er war extra zur Tankstelle gegangen und hatte sich eine kleine Flasche gekauft, obwohl die fast dreimal so viel kostete wie im Laden. Im Winter hatte er manchmal Rum im Haus, weil er sich gern einen Grog kochte, wenn ihm kalt war, aber jetzt war noch nicht einmal Herbst. Er trank einen Schluck. Das Zeug schmeckte scheußlich, und er trank es sonst nie pur, aber jetzt war ihm das egal. Er hob das Glas und bewegte es vor seinem Gesicht hin und her, und der Rum bewegte sich im Glas und sah fast schwarz aus in der Dunkelheit. Er hatte das Licht in der Küche ausgemacht, die Balkontür war angelehnt, und er hörte das leise Summen des Kühlschranks. Er hielt den Brief immer noch fest in seiner linken Hand, er hatte ihn mit zur Tankstelle genommen, hatte ihn den ganzen Weg über so fest in seiner Hand gehalten, dass seine Fingerabdrücke drauf zu sehen waren, als er vorm Schnapsregal stand und den Brief in seine Jackentasche steckte und mit seiner feuchten und zitternden Hand die Flasche aus dem Regal nahm.
Als er zurück in seine Straße ging, hielt er den Brief wieder in der Linken und die Rumflasche in der Rechten wie eine kleine Keule. Männer und Jugendliche liefen an ihm vorbei Richtung Tankstelle, einige hatten leere Beutel oder Tüten dabei, einige blickten zu Boden, andere blickten ihm direkt ins Gesicht und liefen so, dass sie ihn leicht anrempelten, aber er machte seine Schultern breit unter seiner Jacke, lief in der Mitte des Gehwegs und hielt den Brief auf Brusthöhe, dass ihn jeder sehen konnte, als würden sie dadurch verstehen, dass sein alter Freund Wolfgang in Kuba am Meer saß, die große rote Abendsonne beobachtete und Rum trank und viel Geld hatte. »... und ich wünsche mir, dass Dir mein Brief Kraft und Mut gibt. Einer von der alten Garde hat es geschafft!«
Er drehte sich um und sah die Neonlichter der Tankstelle, schon ein ganzes Stück weit weg, ein leuchtend blaues Schild auf dem Dach. Wenn er die Augen zusammenkniff, verschwamm es, und er versuchte, sich ein Rauschen vorzustellen, lauter und immer lauter, nur dieses Rauschen und das Blau. Ein paar Mopeds knatterten die Straße entlang, er drehte den Kopf ein wenig und sah ein Mädchen, das hinter dem Fahrer saß und beide Arme gehoben hatte und lachte.
Die Flasche war leer. Nur ein kleiner Schluck noch im Glas. Er stand an die Brüstung gelehnt. Die Nacht war kalt geworden, aber das spürte er nicht.
»Ich stehe auf der Spitze einer uralten Mayapyramide auf der Yucatán-Halbinsel in Südmexiko. Wenn Du auf der Karte schaust, siehst Du, dass es nicht weit von Kuba nach Yucatán ist.«
Er holte seinen alten Schulatlas aus dem Beutel, den er extra mitgenommen hatte. Es war ein sehr großer Atlas, und er musste ihn auf beide Knie legen und den Brief unter den Atlas klemmen, und die Leute, die neben ihm und an der Wand gegenübersaßen, blickten ihn ein wenig komisch an. Er blätterte und suchte, er hatte den Briefkasten geöffnet, als er aus dem Haus gehen wollte. Er hatte sich auf eine Treppenstufe gesetzt und angefangen zu lesen. Dann war er wieder nach oben gerannt, er durfte seine Straßenbahn nicht verpassen, hatte den alten Schulatlas aus dem Regal gerissen, ihn in einen etwas fleckigen Stoffbeutel gesteckt, hatte die Wohnungstür zugeschmissen ohne abzuschließen und war die Treppen runter und bis zur Haltestelle gerannt. Er sah die Bahn schon von weitem um die Kurve kommen, er rannte und winkte, der Beutel schlug gegen sein Bein, und als er durch die sich schließende Tür sprang, wurde der Beutel eingeklemmt, und er musste ihn rauszerren, und dann setzte er sich, schwer atmend. Er wollte den Atlas rausholen und den Brief weiterlesen, aber die Bahn wurde von Haltestelle zu Haltestelle immer voller.
Er blätterte und suchte, Kanada, USA nördlicher Teil, USA Nordwesten, Mexiko, dort ganz am Rand war Yucatán, aber wo war Kuba?, er blätterte weiter, Mittelamerika und Karibik. Dann sah er wieder die Halbinsel Yucatán, groß und breit, und ein Stück oberhalb der Spitze lag das schmale, langgezogene Kuba. Er legte den Zeigefinger auf die Karte, dann den Daumen. Nur ein daumenbreit Meer war zwischen Yucatán und Kuba. Ob Wolfgang auf einem kleinen Boot dort rübergefahren ist? Wie lange ist er wohl auf dem Meer unterwegs gewesen? Ein Fischerboot, ein kleines Fischerboot, das ganz oben auf den Wellen trieb und dann verschwand und dann wieder auftauchte. Er zog den Brief unter dem Atlas vor und legte ihn auf Venezuela und die Antillen. »Chichén Itzá ist die größte Mayastadt Mittelamerikas. Ich kann von hier oben den dichten Dschungel sehen, ein Grün, das kein Ende nimmt. Ich habe mir eine kleine Hütte ganz in der Nähe gemietet, und in den Nächten macht der Dschungel Geräusche, ein Pfeifen, ein Singen, hohe Schreie wie von Kindern, ich glaube, die Vögel und die anderen Tiere schlafen fast nie.«
»Herr Mose, bitte!« Eine Frauenstimme, und er sah die Frau in der offenen Tür stehen, die jetzt noch einmal rief: »Herr Mose, bitte!«, und ihre Stimme schien ihm jetzt hoch und schrill, die Vögel und die anderen Tiere schlafen fast nie. Herr Mose lief an ihm vorbei, blickte böse auf ihn runter, weil er lachte und Herr Mose bestimmt dachte, er lachte über ihn, so wie die Kinder früher über seinen Namen gelacht hatten. Eine Tür wurde zugeworfen, und dann las er weiter, einen Finger auf dem kleinen schwarzen Punkt auf der Karte, neben dem »Chichén Itzá« stand.
»Ich bin schon 10
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: