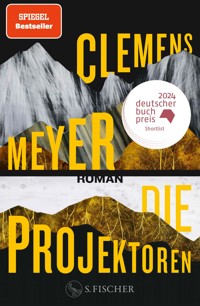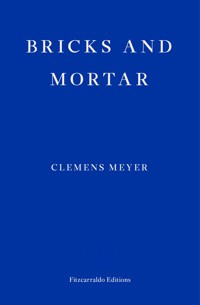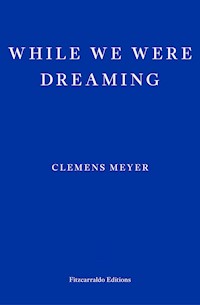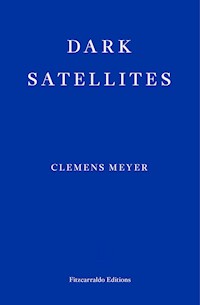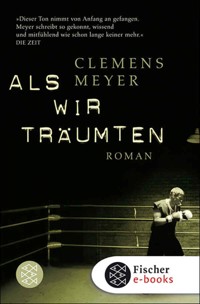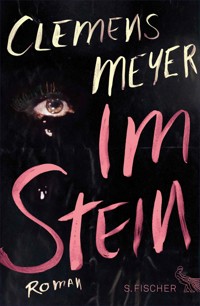8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Clemens Meyer schreibt ein Tagebuch über die Gewalten unserer Zeit: Eine Stadt sucht ihren Mörder, Jubel beim Pferderennen, der beste Freund liegt im Hospiz. Ein Hund stirbt. Endlose Zahlenreihen fließen über einen Bildschirm in einer menschenleeren Fabrikhalle. Die psychiatrische Notaufnahme wird zur Endstation einer heillosen Nacht. Roh, unheimlich und geheimnisvoll ist die Welt, durch die wir täglich gehen. Clemens Meyer entwirft Szenen von großer poetischer Kraft und verstörender Klarheit. Ein Jahr lang erkundet er Seelenlandschaften, reale Orte und imaginäre Welten. Er erzählt von Alpträumen, jubelnder Euphorie und dem Irrwitz unseres Lebens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Clemens Meyer
Gewalten
Ein Tagebuch
Tagebücher
Fischer e-books
Gewalten
Ich hänge. Meine Beine sind vom Körper abgespreizt, an der Wand fixiert. Meine Arme sind vom Körper abgespreizt, an der Wand fixiert. Ich kann meinen Kopf bewegen, sehe Manschetten aus Plastik und festem Stoff, die meine Unterarme umschließen. Ich streiche mit den Fingerspitzen über die Wand, die sich seltsam weich anfühlt. Meine Brille ist weg, und ich drehe meinen Kopf, sehe den Raum um mich herum verschwommen, Neonröhren an der Wand gegenüber strahlen mich an, eine flackert, und in dem Flackern des Lichts dreht sich das Bild ganz langsam, ich sehe mich, wie ist das möglich?, wie ich da so an der kippenden Wand hänge, das Bild dreht sich, plötzlich die Neonröhren unter mir, ich spüre, wie mich diese Manschetten an Armen und Beinen halten und mein Kopf nach vorne fällt und an meinem Hals, der sehr lang ist, in den Raum baumelt, mir ist wie Kotzen, und ich drehe mich mit dem Bild und dem Raum, und ich liege, bin auf ein großes Bett geschnallt, Arme und Beine vom Körper abgespreizt, fixiert.
Ich sehe, wie ich da so liege auf dem Bett, sehe das von weit entfernt, werde immer kleiner, als ob die Decke dieses Raumes sich nach oben verschiebt, immer weiter hinauf in diesen Himmel im Dezember, das weiß ich noch, 30.Dezember auf den 31.Dezember, Jahr 2008.
So klein bin ich da unten und weiß nicht, wie ich da hingekommen bin, ein Flackern in meinem Kopf, ich will mich nicht alleinlassen in diesem weißen Raum auf dem weißen Bett, ich muss doch frieren, denn ich sehe, dass ich nur Unterwäsche trage, schwarzes Unterhemd, schwarze Unterhose, Kontrapunkte in der Arktis, keine Strümpfe, keine Schuhe, und dann plötzlich bin ich wieder ich auf dem Bett, die Neonröhren über mir, bin dann wieder ich über dem Bett, der sich im Bett sieht, der im Bett sieht nur die Decke, bin ich also mehrfach vorhanden?, da stimmt doch was nicht, mein eigenes Gesicht jetzt direkt vor mir, Großaufnahme, Augen aufgerissen, Mund aufgerissen, Falten wie Krater um Augen, um Mund, ich denke: 2028 vielleicht, ich brülle, bis ich nicht mehr brüllen kann. »Hilfe, hilfe, bitte helft mir doch!«
Aber da kommt keiner, da ist keiner, eine Tür, zwei Fenster mit heruntergelassenen Jalousien, es muss noch Nacht sein draußen, das weiß ich. Ein Waschbecken neben der Tür, sonst nichts in dem Raum außer dem Bett; später, als ich mit dem Bett durch den Raum reite und dabei ein wahnsinniges Krachen und Scheppern erzeuge, werde ich noch eine Tür bemerken, zwei Türen, zwei Fenster, aber die Zeit scheint sich nicht zu bewegen in diesem Würfel, und bevor ich so durch den Raum reiten kann, dass sich kleine, kaum sichtbare Risse durch die Wände und die Türen und das Glas der Fenster und der Neonröhren ziehen werden, gewaltige Vibrationen, ich liege und warte, eine Stunde, zwei Stunden ... vielleicht auch nur dreißig Minuten, eine Stunde, anderthalb Stunden. Ich warte. Ich versuche nachzudenken. Ich verstehe langsam, wo ich bin und warum ich bin, wo ich bin. Ich kann es noch nicht richtig greifen, eine dünne Eisschicht darüber in meinem Kopf, aber viele kleine und mittelgroße Fische stoßen schon von unten dagegen, ein kugeliges Aquarium, ich kann sie sehen als Schemen und Schatten, wenn ich die Augen schließe, und das Knirschen und Klirren des Eises in meinem Kopf, ich sehe einen Arzt, vollbärtig mit einer runden Brille, er erinnert mich an einen evangelischen Pfarrer, deswegen die Fische?, die Fische ergeben doch keinen Sinn, aber sie stoßen gegen das Eis. Ich friere. »Hatten Sie schon häufig die Absicht, Suizid zu begehen?«
»Ich hatte noch nie die Absicht, Suizid zu begehen.«
»Konsumieren Sie Drogen?«
»Sie sind falsch informiert, ich hatte noch nie die Absicht, Suizid zu begehen.«
»Leiden Sie unter Depressionen?«
»Das ist ein Irrtum, ich würde nie auf die Idee kommen, Suizid ...«
»Waren Sie schon einmal in Behandlung wegen ...« Der Ton ist weg, sein Mund bewegt sich, auf und zu, auf und zu, Blasen steigen zur Decke, und ich hasse diesen Pfaffen, ich stelle mir vor, wie ich seinen Bart mit beiden Händen packe und mit einem Geräusch wie beim Öffnen eines Klettverschlusses von seinen Backen reiße, die Haut darunter ist voller Blasen und Poren wie gekochte Hühnerhaut. Ich habe die Hände auf dem Rücken, während ich mit ihm spreche, irgendwo sind die Polizisten ...
Ich drehe den Kopf und begutachte die Manschette, die meinen rechten Arm festhält. Ich muss sie loskriegen und den Pfaffen aufspüren. Was soll ich ihm den Bart abreißen, so was funktioniert schlecht in der Realität, ich werde ihn aufspüren und packen und durch ein geschlossenes Fenster werfen, die Scherben im Scheinwerferlicht begleiten ihn nach unten, Knastmonde, aber ich bin nicht im Knast. So ähnlich, nur so ähnlich.
Später, irgendwann, Stunden, Tage, 2008, 2009, werde ich durchs Innere des Gebäudes laufen, ein langer Gang, meine rechte Schulter und mein Ellenbogen schmerzen, ich laufe, nein, ich humpele schwankend, etwas nach vorne gebeugt, der rechte Ellenbogen vom Körper abgespreizt, wie ein Körperklaus, das hat ein Junge immer benutzt, dieses Wort Körperklaus, das muss 1997 gewesen sein in der Jugendarrestanstalt Zeithain, der lag mit mir auf dem Zimmer und hat alle möglichen Leute so bezeichnet, hinter ihrem Rücken, obwohl er selbst klein und dick und hässlich war und sich in den paar Wochen kaum gewaschen hat und mir stinkende Lügengeschichten erzählt hat Nacht für Nacht; spastisch, auch so ein Wort, den Ellenbogen abgespreizt und spastisch durch die Luft rudernd, bewegen sie sich wie in Zeitlupe auf mich zu, Zombies würde ich sagen, sie schwanken, wie auch ich schwanke, als würden sie gleich umkippen, Night of the Living Dead, obwohl schon Nachmittag ist. Einige brabbeln, strecken ihre Arme nach mir aus, Zombies können nicht sprechen, aber sie sind hungrig nach menschlichem Fleisch und infizieren ihre Opfer, wenn sie sie beißen, die dann auch zu Zombies werden, Dawn of the Dead, der ist in Deutschland nicht ungeschnitten zu bekommen, mein Tätowierer kennt einen DVD-Dealer, der ihn mir besorgt hat, ein paar Überlebende der globalen Zombie-Katastrophe verschanzen sich in einem riesigen Einkaufszentrum, das von den Zombies belagert wird, wie 2007, als in Berlin am Alexanderplatz um Mitternacht ein Einkaufszentrum eröffnet wird, Schnäppchen – Schnäppchen – Schnäppchen, rennen Tausende Zombies auf Koks, viel schneller und agiler als die von George A. Romero, durcheinander und übereinander, es gibt viele Verletzte auf der Jagd nach dem Fleisch, Scheiben gehen zu Bruch, und ich sehe die Glassplitter im Scheinwerferlicht der Monde, »Das Vieh wurde geschlachtet, und nun will jeder ein Stück Fleisch«, hat mir mal ein Zuhälter gesagt, ich bevorzuge die modernere Berufsbezeichnung Manager, als er die großen Machtkämpfe im ostdeutschen Rotlicht-Milieu nach der Wende beschrieb ... Und über all das denke ich nach, während ich da festgeschnallt im Bett liege und meine Arme irgendwie aus diesen Manschetten kriegen will und noch gar nicht wissen kann, dass da welche über den Gang stolpern und nach mir greifen, denen der Sabber übers Kinn läuft, deren Augen tot sind, später, wie bei George A. Romero, dessen Meisterwerk von 1978 in Deutschland der Zensur zum Opfer fällt, dreißig Jahre lang, und hier 2008, 30. auf den 31.Dezember, das letzte Zimmer auf der linken Seite, ich.
Es muss doch möglich sein, diese Manschetten zu lockern, zu lösen. Ich muss nur eine Hand losbekommen, dann kann ich nach der Axt greifen, die neben dem Bett steht, nein, zu Hause, heeme, so sagen wir in Sachsen, heeme steht meine Axt neben dem Bett, eine wunderschöne Feuerwehraxt aus den dreißiger Jahren, ratzfatz mit der Axt befreit und mit riesen Hieben durch die Tür ins Innere des Komplexes und diesen bärtigen Schubladenöffner und Schließer zerhacken auf meinen Weg. Und ich schlage mich durch Türen mit meiner Axt ... Moment, wer kümmert sich um meinen Hund, der ist schon alt, wenn sie mich hier gefangen halten?, aber so lange bin ich noch nicht weg von Heeme und Hund, und wenn es Nacht ist, schläft er, und ich schwinge meine Axt, will raus aufs Feld, denn das weiß ich jetzt wieder, dass draußen vorm Fenster, hinter den Mauern, Felder sind, draußen vor der Stadt, dorthin haben sie mich gebracht, und ich schwinge die Axt, schreiend. Und an Magister Steinbauer muss ich denken, während ich so schreie, den Österreicher, der am 13.Mai 2008, ob das ein Freitag war, will ich wissen, aber verdammt nochmal, niemand antwortet!, der ist also am 13. los und hat fünf Leute erschlagen mit seiner Axt, Familie war das. »Darunter ein kleines Mädchen, das den Tod kommen sah und noch Abwehrbewegungen machte.« Das lese ich in der Zeitung, die ich aufgehoben habe, weil ich dachte, darüber muss ich mal was schreiben, und jetzt schreibe ich was ganz anderes, während ich wieder daliege und an diesen verdammten Manschetten fummle.
Magister Steinbauer hat also offenbar seiner eigenen kleinen Tochter die Hände weggehackt, als sie ihm die in dieser Abwehrbewegung entgegenhielt, denn anders können sie diese Abwehrbewegungen nicht konstatieren, wo sie doch nichts mehr sagen kann dazu. Der Magister Steinbauer hat seinen Magister gemacht an der Universität. Um mit einer Axt fünf Menschen zu erschlagen, braucht man eine gute, langstielige Axt und nicht unbedingt einen Magister, ich habe nur ein Diplom, und vielleicht braucht man das Moment der Überraschung, eine Axt ist eine Axt, und eine Rose ist eine Rose. Deswegen habe ich eine Axt im Haus, falls jemand mit einer Axt kommt. Rosen für den Axtmörder. Und ich will hier raus, weil ich es nicht aushalte, so hilflos hier zu liegen, Arme und Beine fixiert, und nichts verändert sich im Raum, nur die dünne Eisdecke ist längst gesprengt, und Axtmörderfische und Wut und Angst ... und ich ziehe und zerre an diesen Kunststoffmanschetten, die meine Unterarme festhalten, und sie werfen ihm vor, dass er feige sei, weil er sich umbringen wollte danach, es aber nicht getan hat, wie willst du dich mit einer Axt umbringen, aber ... »Es findet sich schon irgendwo ein Berg, von dem man sich herunterstürzen kann, ein Strick, eine Eisenbahnschiene.« Sagt das Gericht. »Konsumieren Sie Drogen?« Das ist in meinem Kopf, weil ich die Zeitung viel zu oft studiert hab, der Magister Steinbauer benimmt sich wie die Axt in Österreich, der Magister Steinbauer rottet seine Sippe aus, weil sein kleiner Betrieb pleite ist, die Wirtschaftskrise dezimiert die Menschheit, und jetzt schweige ich und konzentriere mich auf den Würfel, in dem ich liege, denn die Angst fängt an, mich zu zerreißen.
Wenn ich mich, so weit es geht, auf die Seite rolle, kann ich mit der rechten Hand unter das Bett greifen. Ich muss ganz schön arbeiten, um meinen Körper in diese Position zu bringen. Die Manschetten geben mir mehr Spielraum, als ich gedacht habe. Ich wuchte meinen Körper immer weiter auf die Seite, stoße meinen Arm so weit wie möglich durch den Ring dieser verdammten Manschette, Zentimeter um Zentimeter erobernd, bis ich, und das Bett kippt bereits, unter dem Bett einen Lattenrost aus Metall greifen kann. Räder sind unter den vier Beinen des Bettes, die kann ich sehen mit verdrehten Augen, wenn ich meinen langen, verdrehten Hals mit meinem Kopf hinunterwuchte, dort sind die Bremsen festgestellt, an den Rädern. Ich drehe und wende mich und beuge mich aus dem Bett heraus, so weit es geht, und die Manschette auf der anderen Seite und die an meinen nackten Beinen zerreißen mir fast die Haut.
Und ich greife das Metall des Lattenrostes. Und dann beginne ich, mit dem verdammten Bett zu reiten. Ich werfe meinen Körper hin und her, links, rechts und nach vorn, und das Bett bewegt sich. Bamm, bamm, bamm! Es springt ein paar Zentimeter Richtung Tür. Bamm, bamm, bamm! Und ein paar Zentimeter Richtung Fenster. Ich bäume mich auf, habe das Gefühl, mein Körper schnellt auf die Neonröhren an der Decke zu, eine flackert, das macht mich krank, Mister Magister, wie gut, dass dieser Mann keinen ausgebauten Keller hatte, über meiner Bar im Schlafzimmer, heeme, hängen zwei Bilder, die leuchten nachts, Öl, phosphoreszierend, der englische Künstler Liam Scully hat die gemalt, um zwei kleine, auf die Leinwand geklebte Zeitungsartikel herum, The Sex und The Beast, das sind der Fritzl und die Kampusch (sie mit einem Tuch vor dem Mund), die sehe ich, wenn ich einschlafe und wenn ich aufwache, und in manchen Nächten grinsen sie ganz besonders hell, und jetzt zerre ich, mich immer noch halb aufbäumend, frag mich keiner, wie ich das gemacht habe, diesen Lattenrost raus, Stück für Stück, Zentimeter um Zentimeter.
Bamm! Und da liegt er auf den weißen Fliesen. Und ich frage mich, ob das Bett, auf dem ich festgeschnallt bin, wirklich so klein ist wie dieses Eisengestänge auf dem Boden. Und dann bäume ich mich wieder auf, bamm, bamm, bamm!, reite ein paar Zentimeter, Dezimeter, werfe mich zur Seite und kippe, ich und das Bett, kann mich irgendwie abstützen, greife dieses Gitter mit der anderen Hand, so viel Spielraum lässt mir diese verdammte Fessel jetzt, und brauche sehr lange in diesem Raum, bis ich einhändig, und so ist meine Erinnerung und so wird sie auch bleiben, bis ich dieses sperrige Teil auf meine Brust gewuchtet habe. Nachgreifen, immer wieder nachgreifen.
Der Lattenrost liegt kühl auf meiner Brust, ich trage ja nur ein Unterhemd, und dann, fragen Sie mich nicht, woher ich die Kraft nehme in diesem festgeschnallten Zustand, und dann fliegt der Lattenrost die paar Meter, wahrscheinlich weniger als das, Richtung Tür, bis dorthin haben meine Anstrengungen mich und das Bett gebracht, und weil das so schön aussieht, spule ich die Szene immer wieder vor und zurück, dieses Metallteil von meiner Brust Richtung Tür, zurück auf meine Brust, wieder in den Raum, hin und her, gehe direkt in das große Gebäude draußen auf dem Feld, begib dich direkt dorthin, gehe nicht über Los und ziehe nicht 4000DM ein ... Und was ist das für ein herrlicher Lärm, als das Geschoss an der Tür detoniert und in einer zweiten, zeitverzögerten Detonation auf die Fliesen kracht. Gäbe es eine Weltmeisterschaft im Bettreiten, dann würde ich in der Disziplin des Kurzstreckensprints in geschlossenen Räumen hoch überlegen gewinnen, so wie das Wunderpferd Overdose im Jahr 2009 in ganz Europa wieder konkurrenzlos sein wird auf der Kurzdistanz, vier, fünf und mehr Längen in Front und durchs Ziel, »eine Laune der Natur«, sagt sein Trainer, Die Goldene Peitsche in Baden-Baden gewonnen 2008, der wunderbare Overdose, der nur ein paar tausend Euro gekostet hat, den lange keiner auf der Rechnung hatte, weil seine Abstammung fraglich war, der den Prix de l’Arc de Triomphe (mein liebstes Buch von Remarque, Arc de Triomphe, dort trinken sie Calvados um Calvados, immer nur Calvados, habe ich nicht auch Calvados getrunken irgendwann in dieser Nacht?) im selben Jahr gewonnen hätte und eigentlich hat und Bahnrekord lief gegen die weltbesten Sprinter, aber dann war das Rennen ungültig, wegen eines Fehlstarts, den nicht alle Jockeys registrierten, und gut die Hälfte des Feldes ging auf die Reise, und ich bekam all mein Geld zurück, eine Monatsmiete immerhin, aber wenn das Rennen gültig gewesen wäre, hätte ich fünf Monatsmieten bezahlen können; aber was ich nicht wissen kann, während ich in Sekundenbruchteilen an der Tür bin und den Lattenrost wieder auf meine Brust zerre, schreiend, weil mir alles weh tut dabei, dass das Wunderpferd Overdose verletzt sein wird, den Besitzer wechselt, nach England geht, und nur einmal an den Start 2009, Mailand, 1000 Meter, Gruppe III, acht Längen und acht Welten besser als der Rest, und wieder reite ich zurück und schleudere aus der Distanz den metallenen Rahmen gegen die Tür, das ist ein Fest, ein Fest der Angst zugleich, »Lasst mich hier raus, ihr Schweine!«
Und ich beschließe, endlich hier zu sein, nicht mehr Räume und Zeiten in diesem Tempo zu durcheilen, denn mir ist schwindlig, und ich bin im Zustand einer Verwirrung, aber ich muss hier sein, denn es tut sich was, Schritte. Draußen. Der Lärm hat endlich eine Reaktion hervorgerufen, hat sie an meine Existenz erinnert. Schritte. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich dieses Teil geschleudert habe, der Lärm ist noch da, verhallend, braucht lange, um aus diesen geschlossenen Räumen ganz hinauszufinden, damit wieder Ruhe herrscht, dieselbe Ruhe, die dort war, bevor ich kam.
Ich reite ein Stück zurück. Die Tür öffnet sich. Eine Frau in Weiß, ziemlich dick, ziemlich groß. Und noch größer wird sie, als sie ein paar Schritte durch den Raum geht. Sie steht genau unter der flackernden Neonröhre, sie trägt eine weiße Haube auf dem Kopf. Sie blickt mich an, dann schaut sie auf den Lattenrost, der neben ihr liegt. »Was machen Sie hier für einen Lärm.« Sie fragt nicht, sie stellt es fest.
»Ich ...« Jetzt erst spüre ich, dass meine Kehle so ausgetrocknet ist, dass ich nur noch krächzen kann. »Ich will ...«
»Sie sollten aufhören zu randalieren.« Sie bewegt kaum den Mund, wenn sie spricht. Und wenn sie nicht spricht und mich anschaut, ist ihr Gesicht ganz konturlos und ihr Mund ein Strich. Und mit aller Kraft, die ich habe, und meine Zunge ist wie die vertrocknete abgeworfene Haut einer Schlange: »Ich möchte telefonieren.«
»Sie sollten jetzt aufhören zu randalieren.«
»Ich habe das Recht auf ein Telefonat.«
Sie schaut mich an, und der Strich bleibt ein Strich: »Sie haben überhaupt keine Rechte, wenn Sie sich nicht benehmen können.«
Und das muss so eine Art Zauberformel sein, lebensspendend für diese verdorrte Hülle in meinem Mund, die plötzlich wieder feucht und geschmeidig wird, durch die Mundhöhle flitzt und sich genug Schleim zusammenzüngelt, und ich höre ein Geräusch wie das Husten eines Tuberkulosekranken, das bin ich, und dann spucke ich dieser großen, dicken Frau in Weiß über zwei, drei Meter hinweg ins Gesicht, und ich finde, dass das eine noch größere Leistung ist als die Sprints mit dem Bett und der Flug dieses Phönix Richtung Tür, der metallen neben ihr liegt unter dem zuckenden Licht. Sie dreht sich um und geht.
Und dann die Stille. Ihre Schritte vor der Tür sind schnell wieder weg, und nur das Summen der Neonröhren und das Geräusch meines Atems sind noch da. Und auch das wird immer leiser, und ich liege, bewege mich nicht und lausche in diese Stille. Wie lange werde ich hier liegen müssen, wann werden sie mich wieder losmachen? Wie lange kann ein Mensch angebunden auf einem Bett ausharren, bevor er verrückt wird oder Teile seines Körpers und seines Geistes sich ausschalten? Lange, denke ich und denke an Menschen, die über Stunden und Tage und Wochen und Monate eingepfercht sind. Auf und ab gehen, das ist doch, verdammt nochmal, das mindeste, was man einem Menschen gestatten sollte, auch wenn er eingesperrt ist. Das Gefängnis, der Knast, das Eingesperrtsein schien mir immer mein Schicksal zu sein, schon meine Mutter drohte mir als Kind mehrfach mit Jugendwerkhof und Heim, aber vielleicht denke ich mir das jetzt nur aus zugunsten der Dramatik. Nemesis. Star Trek – Nemesis. Ein Planet am Rande der neutralen Zone, das Raumschiff Enterprise empfängt fremdartige Signale, Teile eines Androiden werden gefunden, ein Klon des Kapitäns entsteht ...
»Ich rufe Dich, Nemesis! / Höchste! / Göttlich waltende Königin!«
Damokles. (Phönix – Nemesis – Damokles. Komm schnell zurück zur Erde, Ikarus!, bevor die Sonne der Antike dir den Arsch verbrennt, und wenn du dort oben nicht angerußt wirst, da unten, bei deiner Rückkehr, wirst du zermalmt, denn du landest, aber das kannst du nicht wissen, genau dort, wo der alte Sisyphos seinen gewaltigen Stein rollt.) Ich bin auf der vollkommen falschen Spur, aber draußen höre ich jetzt wieder Schritte, viele, da kommen welche.
»Und nimmer entzieht sich Dir die Seele / Hochmütig und stolz / Auf den verschwommenen Schwall der Worte. / In alles schaust Du hinein, / Allem lauschend, alles entscheidend. / Dein ist der Menschen Gericht.«
Die Schritte werden lauter, aber ich liege und rühre mich nicht. Die Tür wird geöffnet.
Ein Kissen ist das Erste, was ich sehe, in der Tür. Die dicke, große Frau in Weiß hält dieses Kissen, das auch weiß ist, wie sollte es anders sein. Sie trägt es vor sich her wie einen Schild. Sie läuft nicht besonders schnell, aber mit Nachdruck, würde ich sagen, und sie ist nicht allein. Hinter ihr drei Männer, jung, auch in Weiß, einer davon mit Zopf. Sein Zopf pendelt bei diesem energischen Gehen von einer Schulter zur anderen. Komm nur, mein Junge, denke ich und will mich aufrichten, schnell hab ich dich an deinem Zopf gepackt. Das Kissen nähert sich meinem Gesicht. Bevor sie zudrückt, blicke ich ganz kurz in ihr Gesicht. Was soll ich sagen, da ist nichts, nur eine bleiche Leere. Ich kann ihre Ellenbogen spüren, sie liegt in ihrer ganzen Schwere auf mir. Ich will atmen und kann es nicht. Ich will schreien und kann es nicht. Ich will meine Hände benutzen und kann auch das nicht. Ich spüre Hände auf meinen Schultern, an meinen Armen. Jemand reibt etwas Kühles in meine rechte Armbeuge. Meine Hilfeschreie gurgeln in das Kissen. Ich weiß, dass ich jetzt sterben muss. Keine Luft. Meine Beine zucken, alles zuckt und wehrt sich, aber die drei Männer halten mich fest, und das Kissen immer noch auf meinem Gesicht. Ganz kurz sehe ich mich von oben, wie sie mich halten, aber ich weiß, dass ich mich nicht von oben sehen darf. Etwas unglaublich Dünnes fährt mir kühl in den Arm. Ich spüre, wie es tief in meiner Ader steckt, viel zu starr für dieses weiche und biegsame Blutgefäß. Und da ich mich bewege, viel mehr noch: da ich kämpfe, um nicht zu ersticken, da ich zu ersticken glaube, stößt dieser dünne Fremdkörper gegen die Wände in meinem Blutgefäß, und die feine Spitze ritzt mir Zeichen ein von innen. Etwas Warmes schießt in meinen Arm. Das Kissen geht nicht weg, und mir ist, als würde ich ertrinken, immer tiefer sinken in einem dunklen Waldsee. Tote Bäume um das Ufer, stehen halb im Wasser. Die Stämme sind weiß. Viel Schatten, das Wasser ist dunkel, und ich sinke immer tiefer.
Als Kind, da war ich vielleicht zehn oder elf, bin ich fast ertrunken. Ich hatte ein Schiff gebaut aus Holz, mit Masten und Segeln und Takelage, und es mit an den See genommen. Es gab zwei Seen dort, der Waldsee mit den toten Bäumen war ein Stück weit entfernt. Auf dem Weg dorthin kam man an einem großen Sumpf vorbei, mitten im Wald, die Oberfläche grün von Entengrütze, und Skelette von Bäumen lagen auf dem Grün. Eine Schicht aus Laub und fauliger Erde bis an das Ufer. Auch der etwas entferntere See war halb versumpft, nur an einer Stelle konnte man ins Wasser gehen und schwimmen. Ich konnte nicht schwimmen, habe das erst gelernt, als ich vierzehn oder fünfzehn war. Und ich bin an diesen See gegangen damals, mit meinem Schiff. Ein Dreimaster, Vollschiff, auf dem Deck standen Kanonen, das waren Patronenhülsen, die hatte ich im Wald gefunden, nicht unweit des Sumpfes. Das war in Mecklenburg, zwischen Güstrow und Krakow am See, wo der Schriftsteller Uwe Johnson einen Teil seiner Kindheit verbracht hat. Einmal kam uns der Schriftsteller Fred Wander, der eine Zeitlang dort in der Nähe lebte, besuchen, der war weltberühmt durch sein Buch Der siebte Brunnen, aber all das verschwindet und verschwimmt, ich versuche, nach Luft zu schnappen, sehe den Rand und die braunen Wände dieser Torfgrube wie durch eine große unscharfe Brille, sehe den Kiel meines kleinen Schiffes über mir, sehe die Luftblasen, schlage um mich mit Händen und Füßen, sehe Grasbüschel, die unter Wasser wachsen, versuche, nach ihnen zu greifen, Grasbüschel wachsen auch am Ufer, ich kann sie sehen, muss nur nach ihnen greifen, aber ich sinke. Mein Großvater, der das Dach des Hauses teerte, vielleicht einen Kilometer entfernt, erzählte später, er habe den Schrei irgendeines sterbenden Tieres gehört, aber jetzt kein Schrei, nicht mal ein Flüstern, denn sie haben mich stumm gemacht.
Ich sehe aus den Augenwinkeln ihre Rücken, sehe die Tür, wie sie sich schließt. Sie haben mich zugedeckt, die Decke bis hoch zum Hals gezogen. Erst versuchen sie, mich umzubringen, dann decken sie mich zu. Ich spüre das Zeug, das sie in mich reingeschossen haben, ich kann meine Augen nicht mehr offen halten. Ich merke, wie ich wegdrifte. Heute ist Silvester, denke ich noch. Vielleicht werde ich schlafen bis 2009. Und während ich wegdrifte, zwischen Schlaf und Rausch und Ohnmacht, bin ich wieder in dieser Bar, wo alles angefangen hat. Brick’s heißt sie, eine der besten Bars in der Stadt, die eigentlich in keinem Touristenführer fehlen sollte, täglich geöffnet bis mindestens vier, ein kleiner, halbdunkler, niedriger Raum unten im Keller, am besten sitzt man an dem halbrunden Tresen, die Cocktails sind gut, die Barmänner und -frauen klassische Schule, auf einer Leinwand laufen Musikvideos, meistens aus den Achtzigern, ein Absacker geht immer im Brick’s, und wer ein paar Mal dort war und immer wiederkommt, wird zum Brickser. Ich sollte Barführer schreiben, und vielleicht mache ich das, wenn ich irgendwann wieder aufwache. Zwerg Nase schlief sieben Jahre lang. Wir sitzen da und trinken, ich und mein Freund und Mit-Brickser UKG, der in Leipzig eine Galerie betreibt, wir haben schon oft hier gesessen, manchmal mit einem seiner Künstler, einmal sind wir am Ostersonntag, morgens, es schneite, aus der Bar getaumelt und zur Nikolaikirche gezogen, die nicht weit weg ist. Hier pilgern die ewigen 89er hin und beten zur friedlichen Revolution, eine weiße Säule steht auf dem Kirchenvorplatz, aus der wachsen oben grüne Palmenblätter aus Gips, das hat auch irgendwie mit 89 zu tun laut Inschrift, der Erlöser (alles hat ein Ende, nur der Durst ist frei) kam in einem Trabbi in die Stadt und nicht in einem Mercedes oder Audi, und die Proleten haben ihn mit Grünzeug beschmissen, das er sammelte und an all die Vegetarier weitergab, die sich leckere Salate damit anrichteten, Palmsonntag, ich habe eine Tätowierung, eine Kette mit einem Kreuz auf meiner Brust, die habe ich mal Theologiestudenten gezeigt, auf einer Theologenparty war das, 2004, ich habe mir das Hemd vom Leib gerissen, weil die mir kein Bier mehr verkaufen wollten und ich sie mit meinem tätowierten Kreuz bekehren wollte zum Bierverkauf von jetzt an bis in alle Ewigkeit, die Ewigkeit habe ich nie begriffen im religiösen Sinn, wäre es nicht furchtbar, Milliarden Jahre Bier zu trinken in der Gartenkantine Eden und kein Ende in Sicht, und der Kater nach fünf Millionen Jahren endlich ausgestanden, und die nächste Runde wartet schon ... und wir stehen also vor der Kirche im Schnee und schlagen mit den Fäusten gegen die Tür, »Lasst uns rein, wir suchen die Erlösung!« Wir versuchen, die Wände hochzuklettern, um zu den Fenstern zu gelangen, ich brülle: »Pfarrer Führer, Pfarrer Führer, komm raus!«, der ist nämlich der Chef von dem Laden, 89 bis in alle ... aber wir begreifen nicht, dass es aus unbegreiflichen Gründen keine Ostermesse gibt, dass die Kirche leer und verrammelt ist. Der Maler Paule Hammer ist dabei (Ich habe ein Bild von ihm, ziemlich groß, das heißt Aua, auf schwarzer Fläche Hunderte Punkte wie Sterne, auf jedem ein Aua geschrieben in winziger, blauer Schrift. Jemand schrieb mir mal dazu: »An deiner Wand: ein Bild aus tausend Wehklagen, schmerzenden Punkten im Weltall. Diese berstende Fläche, durchbrochen von einem Licht, dessen Konsistenz der Künstler – sagtest du mir – nicht verrät. Schon dort, denke ich heute, war alles erahnbar.«), Paule Hammer findet einen riesigen Dietrich in einer Nische im Mauerwerk, der muss hundert Jahre und noch älter sein, UKG versucht, damit die Tür zur Sakristei zu öffnen, eine Polizeistation nur ein paar Straßen weiter, und wir ziehen grölend zur nächsten Kirche, um um Einlass und Erlösung zu bitten. Schon damals hätte ich hier schlafen sollen, Ostersonntag, Silvester, Nemesis.
Und wir taumeln aus dem Brick’s, die Nacht vom 30. auf den 31., Jahr 2008, schneit es?
Ich singe Lieder. »Ja, ja, Chemie, ja, ja, Chemie, ja, ja, Chemie steigt wieder auf ...« Chemie, das heißt der FC Sachsen Leipzig, taumelt gerade auf die x-te Insolvenz zu, aber mit mehr Tempo als wir Richtung Taxistand.
Und dann hält ein Streifenwagen neben uns, wir laufen nämlich auf der Straße, eine ziemlich kleine Straße, auf der um diese Zeit keine Autos fahren, außer den Bullen und ein paar Taxis. Als sie aussteigen und auf uns zukommen, sage ich: »Verpisst euch, ihr Arschlöcher«, oder so ähnlich.
Und da stehe ich halbnackt in dieser gefliesten Zelle und schreie: »Ich habe das Recht auf ein Telefonat, wenn ich nicht telefonieren darf, hänge ich mich auf!« In diese Gegensprechanlage schreie ich das. Eine Menge Polizei plötzlich in dieser kleinen Straße, da sind wohl noch mehr gekommen, die Dynamik der Situation, und ich mal am Boden, dann zwischen den Bullen, dann mal an diesem Drahtzaun vor dem leeren Grundstück, dort führte früher mal ein kleiner Weg durch, direkt zum Bahnhofsvorplatz, UKG will schlichten, hält mich fest, »Hilfe«, schreie ich, »holt doch die Polizei, zu Hilfe, Uwe, ruf die 1-1-0!« Zwischen den Körpern sehe ich den großen Glaswürfel des Museums, auf dem die Lichter blinken. Blau.
»Nimm deine Pfoten weg«, schreie ich und schlage sie auch weg, das sind aber nicht die Hände von UKG, dieser Bulle mit den kurzgeschorenen Haaren, der auf mir kniet, ist ein Lok-Leipzig-Fan, dem haben meine Lieder nicht gefallen, nur so kann es gewesen sein. Deswegen, und nur deswegen, beschimpfe ich ihn während der Fahrt, und deswegen, nur deswegen, rammt er mir seinen Ellenbogen in die Seite und setzt sich auf mich, und jedes Mal, wenn ich ihn beschimpfe, ist da sein Ellenborgen oder seine Hand. Die Dynamik der Situation, wie sollte ich ihm da böse sein, diesem Dreckschwein, in Amerika hätten sie mich schon halb tot geprügelt.
Ich war erst einmal in Amerika, New York, Anfang März 2008, und bin mit einer Schnapsflasche nachts durch China Town getaumelt, weil ich nicht wusste, wo ich bin. Ich sollte mir Gedanken machen, warum das manchmal außer Kontrolle gerät. »Wenn ich nicht telefonieren darf, hänge ich mich auf!« John Barleycorn hat Jack London ihn genannt, diesen alten, krummen Meister, der neben dir am Tresen kauert und dir immer wieder die neuen Bestellungen einflüstert und, wenn du schon gehen willst, mit einem Sprung auf deinen Schultern sitzt, dass du genauso krumm wirst wie er und dich auf dem Tresen abstützt, John Barleycorn, der auch dann noch da ist, wenn alles weiß wird in deinem Kopf, mit John Barleycorn bin ich durch diese fremde, große Stadt getaumelt, irgendwann im Frühjahr 2006 nach einer Lesung, nur noch auf einem Auge sehend. »Wo bin ich?« Ein großer Bahnhof, das muss München sein. Was verdammt nochmal mache ich in München? Gut, gut, das wird schon seine Richtigkeit haben, es ist Morgen, und dann werde ich einfach nach Hause fahren, München – Leipzig, in fünf, sechs Stunden bin ich heeme, bei meiner Axt und meinem Hund. Aber dann sehe ich FRANKFURT/MAIN HBF. Mein Gepäck, ich muss mein Gepäck irgendwo auf diesem Bahnhof stehengelassen haben. Aber das Gepäck ist weg, und der krumme Meister führt mich zu einem Laden, wo es Dosenbier gibt, Glas ist gefährlich um diese Zeit. »Sie möchten sich also umbringen, Herr Meyer? Wir bringen Sie dorthin, wo man sich darum kümmert.« Wir sind zusammen durchs Bahnhofsviertel gewandert, ein paar Stunden zuvor, haben Geld verteilt an Bedürftige, Huren und Heimatlose, die Taschen waren voller Geld wegen dieser Lesung. »Und versprich mir, Mädchen, dass du dir eine heiße Wurst davon kaufst. Kein Junk, versprich mir das, Mädchen, dass du dir kein Junk für mein Geld holst!« Und kurz bevor ich in den Zug steigen will, finde ich diesen Hotelschlüssel in meiner Jackentasche. Nur ein Name drauf und keine Straße und keine Erinnerung, und ein Türke fährt mich durch die halbe Stadt, der Erlöser der Huren und Heimatlosen wird kommen in einem Mercedes, und das Hotel ist ein paar Straßen vom Bahnhof entfernt. Zeig mir ein Bett, John Barleycorn, bevor alles weiß wird.
Und ich liege und komme wieder zu mir. Ich friere. Ich friere so, dass Arme und Beine an den Manschetten reißen. War da nicht eine Decke gewesen? Ich drehe den Kopf und sehe sie auf dem Boden neben dem Bett. Obwohl die Neonröhren leuchten und flackern, sehe ich das Dämmerlicht, das durch die Jalousien fällt. Ich drehe mich auf die Seite und versuche, an die Decke zu kommen. Ich friere so erbärmlich, dass ich an diese Decke kommen muss. Wieder kippe ich das Bett ein Stück, und ich schaffe es, die Decke mit einer Hand zu greifen. Ich versuche, sie nach oben zu zerren, aber sooft ich es auch versuche, es gelingt mir nicht. Ich schäme mich plötzlich für meine Nacktheit und spüre einen Ständer in meiner Unterhose. Es gibt einen sogenannten Schwäche-Ständer, wenn das Blut überall absackt und sich dort sammelt. Ich spüre, wie er wieder schlaff wird, während ich weiter an der Decke zerre. Jetzt könnte ich doch rufen, um Hilfe rufen, damit jemand die Decke auf meinen Körper legt, aber ich kippe das Bett wieder an und kralle meine Finger in den Stoff. Bis zur Bettkante kann ich sie hochziehen, aber weiter geht es nicht, weil ich keinen großen Spielraum habe unter diesen verdammten Fesseln, wieder kippe ich das Bett und versuche es und versuche es, während draußen die Morgendämmerung immer heller wird. Es wird spät hell Ende Dezember. Irgendwann komme ich auf die Idee, die Decke mit meinen Zähnen zu packen. Und tatsächlich liegt sie nach weiteren langen Minuten, es kann auch eine halbe Stunde sein, zur Hälfte auf mir, beginnt aber sofort wieder zu rutschen. Wieder schlage ich meine Zähne in den Stoff, mein Mund ist voller Fusseln, ich huste und spucke, die Decke liegt auf dem Boden, und ich beginne wieder von vorne. Wieder und wieder, ich weiß nicht, wie lange, nur ich und die Decke. Irgendwann höre ich Stimmen und Schritte. Ich presse den Teil der Decke, den ich habe, an mich. Ich muss lachen. Eine Seite warm, eine Seite kalt. »Ich bin noch da, ihr Schweine!«
Gewalten. 2009.
Im Bernstein
Es ist unser erstes Treffen, und ich weiß nicht, wie er aussieht. Der Zug aus Berlin ist schon ein paar Minuten da, und ich stehe am Bahnsteig. Immer noch steigen Leute aus, laufen an mir vorbei. Es ist ein langer Zug, einer von diesen zweigeteilten ICEs, er fährt in genau elf Minuten nach München. Vielleicht ist er ziemlich weit hinten eingestiegen, ich sitze meist im Speisewagen auf kurzen Strecken. Vielleicht hat er reserviert und einen Platz im letzten Wagen bekommen, der fast schon außerhalb der Bahnhofshalle steht. Leipzig hat einen Kopfbahnhof, und die Letzten werden die Ersten sein, zumindest auf dem Weg von Leipzig nach München.
Jetzt kommen kaum noch Menschen aus den Wagen, meist sind es Frauen, direkt neben mir fallen sich zwei um den Hals, ein Mann und eine Frau. Ich höre Gesprächsfetzen, aber konzentriere mich weiter auf den Zug und den Bahnsteig, blicke in die Gesichter der wenigen Männer, die mir entgegenkommen, bestimmt weiß er, wie ich aussehe, ungefähr zumindest. Ich halte mein Telefon in der Hand, vielleicht ruft er an oder schreibt eine SMS. Es ist kalt, Februar, und ich schiebe die Hand mit dem Telefon in meine Manteltasche. Es hat geschneit und schneit immer noch hin und wieder, und der Schnee liegt seit ein paar Tagen, wird aber bald schmelzen, haben sie gesagt. Ich trage einen braunen Wildledermantel mit Pelzfutter und Pelzkragen, den mir mein Opa vererbt hat. Das heißt, meine Oma hat ihn mir gegeben, denn der Opa war damals schon tot. Der Mantel sitzt wie angegossen, und das verstehe ich immer noch nicht, war mein Opa doch ein kleiner, untersetzter Mann, und seine anderen Mäntel haben mir nicht gepasst. Aber er muss ihn getragen haben, wie ein Fürst mit einer Schleppe hat das sicher ausgesehen, denn ich fand eins seiner großen Stofftaschentücher in einer der Seitentaschen. Benutzt war es und klebte zusammen, und ich hab es in irgendeine Schublade gesteckt. Im Haus der Oma, oben an der Küste, nicht weit von Usedom, am Tag vor der Beerdigung, fast ein Jahr her. »Du siehst aus wie ein verarmter russischer Adliger mit diesem Mantel«, hat mal eine Frau zu mir gesagt. Oder war es ein polnischer?
Das kleine Elektroauto mit dem Nachschub für die Speisewagen kommt mir aus der Ferne entgegen, fährt am ersten Speisewagen vorbei. Die kleine Tür für die Waren ist noch offen, ein Zugbegleiter steht davor, und der Fahrer winkt ihm kurz zu.
Ich trete zur Seite, und das kleine Auto mit dem Anhänger summt an mir vorbei.