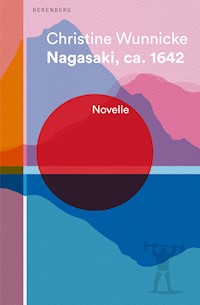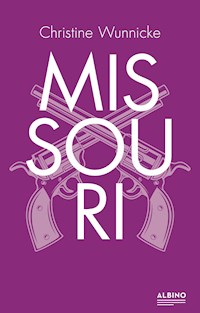Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Allitera Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: edition monacensia
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Die schier unglaubliche Lebensgeschichte eines Gesangsvirtuosen, seine eigenen romanhaften Aufzeichnungen, sorgfältig ediert von Christine Wunnicke.
Das E-Book Die Nachtigall des Zaren wird angeboten von Allitera Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Kastrat, Filippo Balatri, Edition Monacensia, Sänger, Biografie, Musikgeschichte
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
AlliteraVerlag
CHRISTINE WUNNICKE, geboren 1966, veröffentlichte neben zahlreichen Rundfunkbeiträgen vier Romane. Außerdem besorgte sie die erste deutsche Ausgabe der Gedichte von John Wilmot, Earl of Rochester. Christine Wunnicke erhielt unter anderem den Tukan-Preis der Stadt München sowie den Bayerischen Staatsförderpreis für Literatur für »Die Nachtigall des Zaren«
edition monacensia Herausgeber: Monacensia Literaturarchiv und Bibliothek Dr. Elisabeth Tworek
Christine Wunnicke
Die Nachtigall des Zaren
Das Leben des Kastraten Filippo Balatri
Allitera Verlag
Dieses Buch erschien erstmals im Claassen Verlag, München 2001.
Weitere Informationen über den Verlag und sein Programm unter:
www.allitera.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im
Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Juni 2010
Allitera Verlag
Ein Verlag der Buch&media GmbH, München
© 2010 für diese Ausgabe: Landeshauptstadt München/Kulturreferat
Münchner Stadtbibliothek
Monacensia Literaturarchiv und Bibliothek
Leitung: Dr. Elisabeth Tworek
und Buch&media GmbH, München
Umschlaggestaltung: Kay Fretwurst, Freienbrink
Umschlagmotiv: Hofkonzert in Schloss Ismaning
© Bayerisches Nationalmuseum München
Foto © Bayerisches Nationalmuseum, Karl Michael Vetters
Herstellung: Books on Demand GmbH, Norderstedt
Printed in Germany · ISBN 978-3-86906-125-2
In einem Saal der Sommerresidenz meines durchlauchtigsten Herrn hängt ein großes Gemälde. Darauf bin auch ich zu sehen. Das Bild zeigt Seine Hoheit mit dem ganzen Hof, im Schlossgarten, bei verschiedenen Lustbarkeiten. Ich sitze am Cembalo, ein paar Herren spielen Instrumente, Damen und andere Herren vergnügen sich an Spieltischchen, und an einer großen Tafel schickt man sich an zu dinieren. Die Leute sind so lebensecht gemalt, dass ein Kind sie beim Namen nennen könnte. Ich gehe immer wieder in diesen Saal und betrachte mein Bild. Wahrscheinlich tuscheln die Leute schon: »Guckt euch bloß diesen vermaledeiten Eunuchen an, wie er sich anhimmelt!« Aber ich stehe dort und stelle mir vor, ich sei ein wirklich guter Freund von mir, und selber längst schon tot, und dieser Freund, stelle ich mir vor, betrachtet das Gemälde und sagt: »Da, schau, das da ist der arme Filippo.« Mein Freund erinnert sich, stelle ich mir vor, wie er mich hat singen hören, diese und jene Oper, diese und jene Arietta, und es scheint ihm alles wie ein Traum. Er wird ganz weich, wie er mich da sitzen sieht, unbeweglich auf der Leinwand, lebendig nur durch die Farben: einer, der einmal gewesen ist, und jetzt nicht mehr ist und nie wieder sein wird. Eine Weile wird es noch Leute geben, die stehen bleiben und fragen: »Wer ist das?« – und man wird antworten: »Ach der, das war ein gewisser Filippo B.« Aber bald wird die Zeit kommen, wo keiner mehr fragt, und wo auch keiner mehr antworten kann, und eines Tages wird das Bild dann in einem Ankleideraum landen, und dann auf einem Dachboden, und dann dort, wo das Original ist: in der Gruft. So bete ich denn den Rosenkranz und sage mein Miserere und das De Profundis, und ich sammle, wie eine Ameise, meine Vorräte für die Ewigkeit; denn hier auf Erden, denke ich, sollte man sich besser nicht auf anderer Leute schlechtes Gedächtnis verlassen.
Filippo Balatri, München, 1738
Prolog
Die Geschichte von Filippo Balatri hat drei Anfänge. Der erste ist einfach: Am 21. Februar 1682 bekommen die Eheleute Balatri in Pisa einen Sohn. Der zweite Anfang ist weniger genau zu datieren und nicht ganz so alltäglich, obwohl auch dies durchaus den Sitten der Zeit entspricht: Der Ministrant Filippo, ungefähr elf Jahre alt und bekannt für seinen hübschen Sopran, wird in die Praxis eines Luccheser Wundarztes gebracht, der seine Hoden amputiert. Damit sind die Weichen für sein Leben gestellt. Filippo weiß jetzt, er muss ein guter Sänger werden; es gibt für einen Eunuchen keinen anderen ehrbaren Broterwerb. Der dritte Anfang spielt in München. Dort greift Filippo Balatri 1725 zur Feder und macht sich an die Arbeit. Er hat eine schöne Schrift, gut zu lesen, unverkennbar der kühle Schwung des geübten Notenkopisten. Jahrzehntelang hat er Tagebuch geführt, nun schreibt er seine Erlebnisse ins Reine. »Spuckt mir ins Gesicht«, schreibt er, »wenn ich nicht die Wahrheit sage!« Filippo geht ins Detail. Seine Lebensgeschichte füllt insgesamt fast fünftausend handschriftliche Seiten.
Filippo Balatri zählt nicht zu den prominentesten der vielen kastrierten Sänger, die im 17. und 18. Jahrhundert Karriere machten. In den Annalen der Oper ist er eher eine Fußnote. Dabei ist seine Laufbahn eine der spektakulärsten, die einem Sopranisten je beschieden war – auf den Weidegründen der Kalmücken an der unteren Wolga hat der große Farinello nicht gesungen. Hätte Balatri seine Geschichte nicht niedergeschrieben, wäre sein Leben heute nur sehr lückenhaft zu rekonstruieren. Dank seiner Memoiren weiß man jedoch mehr über ihn als über jeden seiner berühmteren Kollegen.
Als Filippo Balatri 1715 eine feste Anstellung in der Münchener Hofkapelle bekommt, hat er schon viel von der Welt gesehen: Italien und Frankreich, England und Deutschland, Russland und die wilde Tatarei. So nennt er auch eines seiner Werke: »Frutti del Mondo, esperimentati da F. B., nativo dell′Alfea in Toscana« (»Früchte der Welt, gekostet von F. B., gebürtig aus Alfea [Pisa] in der Toskana«). Das Manuskript wurde im August 1735 fertig gestellt und liegt heute in der Bayerischen Staatsbibliothek. Es ist eine Autobiographie in Versform, endgereimte Vierzeiler, gut zweitausend Strophen; ein literarisches Genre, welches das 18. Jahrhundert in dieser Form sonst nicht kennt.
Der Adressat der Geschichte ist die Welt persönlich: »Signor Mondo«, Filippos falscher Freund und heiß geliebter Feind, der Verursacher aller Schikanen und aller trügerischen Triumphe, die dem Sänger in seinem Leben zuteil geworden sind. Es ist die abgegriffene barocke Allegorie – nicht ohne Grund steht das »Vanitas Vanitatis« gleich unter dem Titel –, aber zugleich auch ein sehr persönlicher Vorwurf. Wer sonst sollte das gewesen sein, der den jungen Italiener ungefragt entmannte, ihn ein paar gefällige Koloraturen lehrte und dann ohne Sinn und Verstand jahrzehntelang um den Erdball scheuchte? Der liebe Gott etwa? Niemals! Filippo schimpft seitenlang: Mondo Porco! Mondo Perverso! Mondo Canaglia! Manchmal schimpft er aus vollstem Herzen. Dann wieder klingt es fast wie eine Pflichtübung. Ein paar Jahre später wird er sich entschließen, Zisterziensermönch zu werden, da gehört die Weltverachtung zum Programm. Manchmal, oft, ahnt man aber auch ein Lächeln. Hasst er ihn wirklich so, den albernen Herrn Welt? Kennt er ihn vielleicht schon viel zu gut, um sich noch ernsthaft über ihn aufzuregen? An Balatris Frömmigkeit besteht kein Zweifel, aber deshalb weiß man noch lange nicht, woran man eigentlich bei ihm ist.
Das Manuskript »Frutti del Mondo« sieht aus, als sei es erst gestern geschrieben worden. Die beiden großen kalbsledernen Bände sind in makellosem Zustand: gute Tinte, teures Papier und hier und da, wenn man genau hinsieht, die feinen Abdrücke, die der Streusand des Autors hinterlassen hat. Mit Balatris Opus Magnum, »Vita e Viaggi di F. B.« (»Leben und Reisen von F. B.«), das zwischen 1725 und 1732 entstanden ist, gingen die Jahrhunderte weniger gnädig um. Neun Bände, gut dreitausenddreihundert Seiten, blieben von der Prosafassung seiner Memoiren erhalten. Sie sind reichlich malträtiert – abgeschabt, wurmstichig und stellenweise fleckig bis zur Unleserlichkeit – und auch unvollständig. Dank »Frutti del Mondo« ist deutlich auszumachen, dass nach einem Bruch im Handlungsablauf ungefähr zehn Jahre der Lebensgeschichte fehlen, wahrscheinlich ein, vielleicht auch zwei Bände des Manuskripts. Wo und wann diese abhanden kamen, ist heute nicht mehr festzustellen.
Während »Frutti del Mondo« Bayern anscheinend nie verlassen hat, ist »Vita e Viaggi« weit gereist. Von München gelangten die Bücher nach England in die Bibliothek der Familie North Guilford. Von dort verschiffte man sie nach Italien, in den Laden des Florentiner Buchantiquariats »De Marinis & Co«. Anfang des 20. Jahrhunderts fanden sie den Weg nach Prag.
»Frutti del Mondo«, Manuskript, München 1735, Bd. 1, 52v/53r
»Vita e Viaggi«, Manuskript, Bd. 1, S.15
Hier erhielten die neun Bände – also bereits das lückenhafte Werk – einen Ehrenplatz in der Privatsammlung eines russischen Hydrologen namens Otozkij. Er verzierte Balatris Zeilen mit einigen Randbemerkungen in kyrillischer Schrift und riss die Titelblätter der letzten drei Bände aus, um zu vertuschen, dass das Manuskript nicht vollständig war. Von Prag ging die Reise schließlich nach Russland: 1962 schenkte die Staatsbibliothek der ČSSR das auf dem freien Buchmarkt erworbene Manuskript »Vita e Viaggi« der Moskauer Lenin-Bibliothek zu ihrem hundertsten Geburtstag. Dort liegen die Bände noch heute.
Ebenso wie »Frutti del Mondo« ist »Vita e Viaggi« nicht immer eine leichte Lektüre. Balatri schert sich wenig um die Regeln der Schriftstellerei, nicht als Dichter und nicht als Prosaist. Er verliert sich in Einzelheiten. Er verliert sich in vermischten Betrachtungen. Er verliert den Faden, schlägt Haken, landet an der falschen Stelle und erzählt dort seelenruhig weiter. »Frutti del Mondo« ist wahrscheinlich eine Reinschrift, »Vita e Viaggi« wirkt wie ein Entwurf – der Autor hat im Manuskript verbessert, allerdings nur Kleinigkeiten.
Filippo Balatri versteht sich nicht als Literat. »Ich kann kaum lesen, schreiben kann ich erst recht nicht, und dichten kann ich am allerwenigsten.« Aber schließlich gehe es nicht um den Wohlklang, sondern um die Wahrheit, und die Wahrheit müsse man schreien, nicht singen. Er scheint es ein wenig leid zu sein, das ewig harmonische Do Re Mi, mit dem er so lange sein Brot verdiente; wenn der Sänger schreibt, kümmert er sich wenig um Konventionen. Das Ergebnis sind zwei denkbar krude Meisterwerke, die zu den originellsten und persönlichsten Autobiographien des 18. Jahrhunderts zählen – übersehen von der Literaturgeschichte und bis heute nicht vollständig publiziert.
Den ersten Seiten von »Vita e Viaggi« ist zu entnehmen, dass Balatri seine Lebensgeschichte auf die Bitten eines »hoch geschätzten Freundes« hin geschrieben hat und in keinen anderen Händen wissen möchte. Die Identität dieses Freundes bleibt ein Geheimnis. Balatri geizt nicht nur mit Zeitangaben – eine Datierung seiner Lebensgeschichte ist ohne zusätzliche Quellen nicht möglich –, sondern auch mit Namen. Auch seinen eigenen versteckt er meistens hinter den Initialen. Ob er es sich in langen Jahren bei Hofe angewöhnt hat, persönliche Geschichten vorsichtshalber anonym zu erzählen? Da das Manuskript, wie aus den eingeklebten Exlibris zu ersehen, in den Besitz der englischen Barone North Guilford gelangte, ist man natürlich versucht, hier den namenlosen Auftraggeber zu vermuten, zumal Balatri mehr als zwei Jahre in London lebte. Die Vermutung, dass es sich bei dem »hoch geschätzten Freund« um den musikliebenden englischen Literaten Roger North (1651–1734) handeln könnte, ist zwar reizvoll, aber nicht zu beweisen. Auch der plötzliche Wechsel der Anrede bleibt rätselhaft. Im fünften und sechsten Band wird aus dem »hoch geschätzten Freund« plötzlich ein »ehrwürdiger Vater«, ab Band sieben findet sich kein Hinweis mehr auf ein geistliches Amt des Adressaten. Schreibt Filippo für seinen Münchener Beichtvater? Schreibt er für den Abt des Klosters Fürstenfeld, wo er 1739 die Kutte nahm? Oder ist der anonyme Freund nichts anderes als der Wunsch nach einem Leser und Vertrauten, eine Allegorie wie der »Signor Welt«? Wir werden es nicht erfahren.
An eine Veröffentlichung seiner Manuskripte scheint Balatri nie gedacht zu haben. In seinem Testament gibt er genaue Anweisungen, was nach seinem Tod mit seinen gesammelten Aufzeichnungen zu geschehen habe. »Frutti del Mondo« solle gut aufbewahrt und wenn möglich auch ein wenig herumgereicht werden. Es könne ja sein, dass das Buch einen Liebhaber finde, Schaden anrichten werde es wohl kaum. Auch ein zweites Manuskript, das den Titel »Fibel für einen jungen Kastraten« trägt, empfiehlt der Autor der Nachwelt zur gefälligen Beachtung. Von einem solchen Werk fehlt bis heute jede Spur. Über »Vita e Viaggi« urteilt Balatri knapp und barsch: Man möge das schlecht geschriebene Zeug verbrennen, bevor das viele Papier als Lockenwickler in einem Necessaire sein Ende fände.
Balatris so genanntes Testament, in dem diese Bestimmungen enthalten sind, ein etwas mitgenommenes Bändchen von gut zweihundert Seiten, liegt wie »Frutti del Mondo« in der Bayerischen Staatsbibliothek. Balatri hat es 1737–38 geschrieben, ein Jahr bevor er sein Noviziat antrat und achtzehn Jahre vor seinem Tod. Wie immer bei Balatri ist die Stimmung schillernd. Abrupt, oft innerhalb eines einzigen Satzes, springt er vom Ernst zum Scherz, von tiefer Andacht zu purer Blödelei, »bald Truffaldino, bald der heilige Augustinus, wie ich nun einmal bin«. Schnell ist auch der Sprung von den Gemeinplätzen des Katechismus zu sehr persönlichen, anrührenden Gedanken. Allzu viel Rührung gestattet Balatri allerdings nie, weder sich selbst noch seinem Leser. Auch im Testament kommen seine Geheimwaffen gegen die Sentimentalität oft zum Einsatz: Selbstironie und viele verrückte Geschichten. Er erzählt von ekelhaften Begräbnissitten und brutalen Leichenwäscherinnen, von den Abscheulichkeiten des Ehelebens, die ihm selbst erspart geblieben sind, von der Unfähigkeit der bayerischen Bürokratie, einen italienischen Namen zu buchstabieren, und von der hohen Kunst, frittierte Frösche zu essen, ohne sich dabei zu übergeben. »Wer verrückt geboren wird«, schreibt Balatri, »der wird nie geheilt. So sagt das Sprichwort. Und mir gefällt es nun einmal, gute Laune zu haben, und dabei werde ich bleiben, bis ich alle viere von mir strecke.«
Gegen Ende des Testaments, eine Zukunft im Kloster vor Augen, schwört Filippo Balatri der Schriftstellerei ab. Jemand anderes möge den geplanten Roman für ihn schreiben, dessen Titel lauten soll: »Leben, Tod und Mysterien des zu steinigenden Heuchlers und Erzesels aller Esel, des allerwertesten Leib-Eunuchen von Prinz Ahmet dem Ersten.« Filippo will die Feder niederlegen und fortan nur noch beten. Kaum ist er Novize, wird er diesem Vorsatz aber schon untreu. Er schreibt ein geistliches Schauspiel über die heilige Margarete von Cortona, aufzuführen auf der hauseigenen Bühne des ehrwürdigen Zisterzienserklosters zu Fürstenfeld. Dieses Manuskript wird heute in der Bibliothek der Accademia Etrusca in Cortona aufbewahrt. Und Balatri wäre nicht Balatri, wenn nicht sogar die höchst erbauliche Geschichte der Büßerin Margarete in seinen Händen merkwürdig komödiantische Züge bekäme – einschließlich eines toskanischen Teufels, der auf Bairisch fluchen kann.
Seltsamerweise ist »Santa Margherita« Balatris einziges vollständig publiziertes Manuskript. Es wurde erst 1974 als Werk des Autors von »Frutti del Mondo« identifiziert und 1982 herausgegeben. Die beiden Manuskripte in München, »Frutti del Mondo« und das Testament, hat der deutsche Romanist Karl Vossler 1924 in Auszügen und in teilweise modernisierter Orthographie veröffentlicht. Weder Vossler noch die Herausgeber von »Santa Margherita« wussten um die Existenz des Moskauer Manuskripts. Auch die spärlichen Erwähnungen von Balatri in der westlichen Literatur- und Musikgeschichte gehen bis weit in die 1990er Jahre davon aus, dass »Frutti del Mondo« seine einzige Autobiographie ist. Jahrzehntelang lag »Vita e Viaggi« gut verborgen hinter dem Eisernen Vorhang. Erwähnung fand es nur in zwei russischen Artikeln, die kurz nach der Schenkung des Manuskripts in der Publikationsreihe der Handschriftenabteilung der Lenin-Bibliothek erschienen sind – eine Zeitschrift, die bei Romanisten oder Experten für barocke Musikgeschichte nicht zur täglichen Lektüre gehört.
Erst in den späten 90er Jahren fand »Vita e Viaggi« den Weg zurück in den Westen. Auch hier sind es Osteuropa-Historiker, die sich mit Balatris Hauptwerk beschäftigen: Daniel L. Schlafly in St. Louis, der zwei Artikel über »Vita e Viaggi« schrieb, und schließlich Maria Di Salvo in Mailand: Ihre Edition des Manuskripts steht kurz vor der Publikation.
I
Dionisio Filippo Balatri kommt am 21. Februar 1682 als dritter Sohn von Messer Antonio Francesco di Pietro Balatri und seiner Frau Maria Teresa, geborene Peralique, in Pisa zur Welt und wird zwei Tage später in der Kirche San Sisto getauft. Sein Rufname ist Filippo. Erst als er 1739 sein Noviziat antritt, entsinnt sich Balatri seines zweiten Namens: Das Theaterstück »Santa Margherita« nennt Dionisio Balatri als Autor, und auch die Annalen des Klosters Fürstenfeld sprechen von einem »Dionysius«. Hat er den Namen Filippo abgelegt, sobald er der Welt Lebewohl sagte? Balatri macht hierzu keine Angaben. Solange er dem »Signor Welt« diente, rief man ihn mit Sicherheit Filippo.
Namenspate der Familie ist das Dorf Balatro bei Florenz. Dass »balatro« auf Lateinisch so viel wie »Possenreißer« oder »Schwätzer« bedeutet, ist nichts als ein eigenartiger Zufall. Wenn man, so der Autobiograph etwas missmutig, weitere Ahnenforschung in Sachen Balatri zu betreiben gedenke, so möge man sich bitte nicht an ihn wenden, sondern an die zuständigen Ämter in Florenz; die Stadt liege schließlich nicht im Kongo.
Filippos ältester Bruder stirbt in jungen Jahren. Der zweite, Ferrante, ist 1677 geboren. Er wird in Filippos Leben eine wichtige und nicht immer einfache Rolle spielen. Die Mutter ist eine Französin, die im Gefolge von Marguérite d′Orléans, der Frau des Großherzogs der Toskana, nach Italien gelangte. Filippos Vater, ein gestrenger Herr mit klassischer Bildung, großer Gottesfurcht, wenig Herzlichkeit und schlimmen Anfällen von Podagra, stammt aus einer angesehenen, aber verarmten Florentiner Familie und steht unter der direkten Protektion des Großherzogs, Cosimo III de′ Medici. Bei Filippos Geburt ist Messer Balatri bereits an die fünfzig Jahre alt. Auf Cosimos Befehl zog er von Florenz nach Pisa, wo er zunächst als Schuldiener und stellvertretender Kassenwart der Universität angestellt wurde, bis er später ein »ehrenvolles Amt« in der mittleren Charge des Stefansordens erhielt.
Das Ansehen von Pisa beruht zu einem wesentlichen Teil auf dieser Ordensgemeinschaft, deren Bauwerke noch heute das Stadtbild des historischen Zentrums prägen. Der Stefansorden ist der wichtigste Ritterorden der Toskana und die repräsentative Gemeinschaft des toskanischen Adels. Cosimo III de′ Medici liegen die Belange des Ordens sehr am Herzen. Die Funktion des Gran Maestro, die der Großherzog der Toskana von Amts wegen innehat, zelebriert er mit größter Akribie und Feierlichkeit, und für die Sicherstellung der Reliquien des heiligen Stefan wendet er mehr Zeit und Geld auf, als das seinen sonstigen Regierungsgeschäften gut täte. Wer dem Stefansorden dient, dient Cosimo. Und wenn er, wie Messer Balatri, zudem auch noch ein Haus bewohnt, das dem Großherzog gehört, eine jährliche Pension von ihm bezieht und außerdem eine Frau hat, die einst Hofdame der Großherzogin war, so sind die Fesseln eng und die Wohlgesonnenheit des Landesherrn ausschlaggebend für das Glück der Familie.
Vater Balatri plant den Lebensweg seiner Söhne mit Vorbedacht. Ferrante soll eine Universitätslaufbahn einschlagen, für Filippo ist ein geistliches Amt in der Kirche des Stefansordens vorgesehen. Für beide Karrieren hofft man auf die Unterstützung des Großherzogs.
Die Brüder Balatri werden in der Schule des Stefansordens unterrichtet: Latein, Religion und Musik. Filippo hilft bei der Messe und bekommt mit elf Jahren sein erstes geistliches Gewand. Er weiß, wo er hingehört, die Zukunft liegt klar vor seinen Augen. Er weiß auch um seinen schönen Sopran. Der Musiklehrer lobt ihn, und Filippo singt mit Vergnügen, ein Naturtalent, das »lernt wie ein Papagei«, was jedoch kein Grund ist, sich etwas einzubilden oder gar nervös zu werden. Aber in einer schicksalhaften Weihnachtsnacht erlaubt dann der Maestro dem Chorknaben Filippo, eine Solomotette zur Orgel zu singen, und diese wird ihm zum Verhängnis. Das Publikum staunt. Das ist nicht irgendein Sopran, womit der liebe Gott den kleinen Balatri gesegnet hat, das ist ein Geschenk, welches seinesgleichen sucht. Schließlich kommt jemand, nicht Filippo, auf eine grausame Idee. Danach wird nichts mehr sein wie zuvor.
In Italien ist die Kastration von Knaben zum Erhalt der hohen Stimme zwar ein offenes Geheimnis und ein geduldetes Delikt, offiziell ist sie jedoch gesetzeswidrig und zeitweise sogar bei Todesstrafe verboten. Die oft erzählte Geschichte über die römischen Barbierläden, die mit dem Schild »Hier lassen sich die Herren Sopranisten der päpstlichen Kapelle kastrieren« um Kundschaft werben, gehört ins Reich der Legende und stammt von einem französischen Touristen, der »kastrieren« mit »rasieren« verwechselte und die Herren Sopranisten dazu erfand. Man kastriert großzügig, wahrscheinlich tausende von Knaben pro Jahr, von denen nicht alle überleben und noch weniger gute Sänger werden – aber man schweigt. Der neugierige Charles Burney verbrachte erfolglose Stunden damit, auch nur die Ortschaften zu erfragen, in denen die Wundärzte tätig wurden: »In Mailand sagte man mir, man täte es in Bologna, in Bologna verwies man mich nach Florenz, von Florenz schickte man mich nach Rom, von dort nach Neapel, und hier sagte mir der britische Konsul, man täte es in Leocia in Apulien …« Die Geheimnistuerei wird fortgesetzt, auch wenn die Operation zum gewünschten Erfolg führte. Es gibt kaum einen Kastraten, der nicht eine kleine Geschichte parat hätte, die seine schöne Stimme erklärt. Die lebensbedrohliche Unterleibsentzündung, der Sturz vom Pferd, Bisse von bösen Hunden, Schweinen, ja sogar Gänsen – natürlich glaubt das niemand, aber man wahrt so zumindest die Form.
Nur Filippo Balatri hält nichts von derartigen Fabeln. In »Frutti del Mondo« schreibt er zwar, er wolle die Erlebnisse seiner Kindheit lieber »mit finsterem Schweigen übergehen«, aber in der Langfassung der Memoiren kommt er auf den Punkt. Man erfährt, was geschah, und man ahnt, was das für den Autor bedeutet:
»Es wurde befunden, dass meine Stimme von bestem Metall war, der Trillo natürlich und gut geschlagen, die Geläufigkeit in den Passagen hervorragend, und der allgemeine Geschmack im Singen von Natur aus vorhanden. Aufgrund dieser Beurteilung haben die Freunde meines Vaters und besonders der Herr Maestro dringend geraten: Schneiden! Schneiden! Und schließlich, nach all dem vielen ›Schneiden! Schneiden!‹, befahl mein Vater das selbst. So wurde ich denn zum Wundarzt Accoramboni nach Lucca geschickt, und der behielt mich zwei Monate in seinem Haus, damit man mir dort ein wenig der allerangenehmsten Unterhaltung angedeihen lassen konnte. Diese kleine Unterhaltung war von so liebreizender Art, dass man mir nun, statt der Doktorwürde (die ich ja irgendwann hätte erwerben können), den Titel ›Frigidus et Maleficatus‹ verlieh, und zwar für den Rest meines Lebens. Und jenes süße Wort, das ich sonst eines Tages vielleicht hätte hören dürfen, würde ich nun sicher nie hören: ›Herr Papa‹.«
Bei all seiner verblüffenden Offenheit: Über die genauen Beweggründe für Vater Balatris schwerwiegende Entscheidung schweigt sich Filippo aus. Er lässt zwar ein paar Bemerkungen über das gute Gehalt und die großzügige Altersversorgung der Kastraten im Dienst des Stefansordens fallen und deutet an, dass solches seinen Vater bewogen hätte, die Einwilligung für den Ausflug nach Lucca zu geben. Plausible Gründe sind dies jedoch nicht. Die Operation ist lebensgefährlich, und das Risiko, dass der verschnittene Junge kein guter Sänger, sondern ein trauriger Eunuch wird, ist beträchtlich. Neben Farinello ist Filippo Balatri einer der wenigen Kastratensänger, von denen man weiß, dass sie aus gehobenen Verhältnissen stammen. Für gewöhnlich waren es arme Leute, die sich, um ihren Söhnen eine bessere Zukunft zu ermöglichen, zu solch einer Verzweiflungstat entschlossen. Es bleibt rätselhaft, warum Filippos sonst so starrsinniger Vater plötzlich all seine wohl durchdachten Pläne über den Haufen wirft, nur weil einige obskure Freunde nach dem Messer rufen – zumal er wissen muss, was das für seinen Sohn bedeutet. Nicht von ungefähr gibt sich der Autobiograph den merkwürdigen Titel eines »Maleficatus«, eines Übeltäters. Von klein auf hat er gelernt, dass es für einen Kastraten einer fast übermenschlichen Anstrengung bedarf, um der ewigen Verdammnis zu entgehen. Es sind nicht nur die Verlockungen des Künstlerstandes, die Sünden der Gefallsucht, des Hochmuts und der Habgier, denen ihn sein »besonderer Zustand« anheim gibt; am schwersten wiegen die Versuchungen des Fleisches. Ein Eunuch kann keine Kinder zeugen, weshalb er nicht heiraten darf, und das Konkubinat führt geradewegs in die Hölle. So hat man es Filippo beigebracht, sobald seine Wunde verheilt war – eine Lektion, die er explizit in seinen Memoiren beschreibt. Und er schreibt noch mehr: Die Operation habe wenig Geheimnisvolles, es seien »tatsächlich dieselben Schnitte, mit denen man ein Lamm zum Hammel macht«. Was hat Vater Balatri zu dieser Untat bewogen? Filippo verrät es nicht. Der Verdacht liegt nahe, dass der Großherzog den Befehl gab, und der weitere Verlauf der Geschichte wird diesen Verdacht erhärten.
Cosimo III de′ Medici (1642–1723), der sechste und vorletzte Großherzog der Toskana, ist, in Balatris Worten, ein »Fürst von heiligem Lebenswandel«. Andere drücken das weniger freundlich aus; schon zu seinen Lebzeiten wird »Cosimo bigotto« fast sprichwörtlich gebraucht. Der Glaubenseifer des Großherzogs prägt die Stimmung im ganzen Land. Bisweilen verordnet er so viele Prozessionen und Kirchenfeste, dass die Bürger der Toskana vor lauter Beten nicht mehr zum Arbeiten kommen. Cosimos Pläne sind ehrgeizig, kostenintensiv und kurios: Er will nicht nur England und Norddeutschland in den Schoß der römisch-katholischen Kirche zurückholen, sondern auch ganz Indien bekehren. Daneben kümmert er sich mit Hingabe um die Vernichtung unmoralischer Schriften und kontrolliert die Prostitution: kein jüdischer Freier bei einer katholischen Hure!
Cosimos Ehe mit Marguérite d‘Orléans, einer Kusine von Ludwig XIV., ist ein Desaster. Die lebenslustige Prinzessin, in Versailles erzogen und längst schon in einen anderen Mann verliebt, sträubt sich von Anfang an gegen die verordnete Ehe mit dem toskanischen Heiligen und macht ihm das Leben zur Hölle. Um seiner Frau zu entkommen und auf den Rat seines weltgewandten Vaters Ferdinando II de′ Medici begibt sich Cosimo 1667 auf Reisen. Dies ist der Beginn einer zweiten Leidenschaft, die nun neben der Religion sein Leben prägt: fremde Völker und die Wunder von Kunst und Natur. Cosimos Sammelwut und sein aufrichtiges Interesse an der Vielfalt der Welt stehen seltsam unverbunden neben seinem fanatischen Katholizismus. Sein persönliches Exerzitienbuch schreibt täglich an die zwölf Gottesdienste vor, aber gleichzeitig ist er ein barocker »Virtuoso«, nicht anders als seine aufgeklärteren Zeitgenossen. Cosimo reist mit offenen Augen, Interesse und Gewinn. Zu Hause empfängt er ausländische Gäste und hört ihre Geschichten. Er füllt seine Villen mit exotischen Pflanzen, Tieren und Menschen – Mohren, Kalmücken, Inder und Türken, wohlgenährt und katholisch getauft. Ein Teil des Staatsbudgets, das noch nicht für Missionsprojekte verbraucht ist, wird in Kunst- und Wunderkammern investiert, die mit allerlei Mineralien, Antiken, Gemälden und Statuen gefüllt werden. Dazu gehört auch eine gute Auswahl von sorgsam beschrifteten Beispielen für den Mutwillen der Schöpfung: ein zweiköpfiges Kalb, ein blumenkohlartig verwachsenes Schäfchen, eine viel zu groß geratene Melone und ein unidentifizierbares gefiedertes Tier, das, so die Erläuterungstafel, »der Wind am Strand von Grossetto angespült hat, welches ein sehr wunderbares Ereignis war«.
Man sollte den Großherzog nicht verdächtigen, dass er das »menschliche Neutrumswort«, in das sich der Ministrant Filippo plötzlich verwandelt sieht, als neues Ausstellungsstück in sein Museum einreihen wollte. Dafür ist ein Kastrat in Italien nicht exotisch genug. Auch wird die weltliche Musik an Cosimos Hof nicht gefördert. Ein einziges Mal, so Balatri, habe der Großherzog eine Oper besucht, und zwar unter Zwang und mit geschlossenen Augen. Einen guten Solisten für die Kapelle des Stefansordens weiß er jedoch zu schätzen, denn dies ist Musik zum Lobpreis des Herrn und des Hauses Medici.
Der frisch gebackene Kastrat verlässt sein Elternhaus und zieht nach Florenz. Er bekommt Unterricht im Singen, in musikalischer Theorie, Cembalospiel, Latein, Religion und gutem Benehmen. Zum Glück hält seine Stimme, was sie versprach. Filippo studiert fleißig und bereitet sich auf eine bescheidene Karriere als Sopranist des Stefansordens vor. Aber auch diesmal kommt alles anders als geplant.
Zu Beginn des Jahres 1697 schickt Zar Peter der Große neununddreißig russische Adelige in die Staaten Europas. Neben den diplomatischen Kontakten erwartet er sich vor allem eine Fortbildung seiner Untertanen in Militär- und Marinewesen. Außerdem sollen die Gesandten internationale Experten anwerben, die den Zaren bei seinen ehrgeizigen Reformprojekten für Russland unterstützen können. Auch eine allgemeine Belehrung in westlichem Benimm steht auf dem Stundenplan – eine Lektion, auf die Zar Peter viel Wert legt und die Filippo Balatri mit gesundem Dünkel bedichtet:
Sie sollen Menschen werden, sagt der Zar, und sich auch so benehmen: Ihre Sitten, die würden europäisch wunderbar, wie von Franzosen, Welschen oder Briten.1
Einer der Abgesandten ist Peter Alexejewitsch Golizyn (1660–1722), ein einflussreicher Fürst aus dem nächsten Umkreis des Zaren. Sein Empfehlungsschreiben an den Dogen von Venedig hat Peter der Große im Januar 1697 unterzeichnet, überreicht wurde es im Juni. Es scheint nicht so, als hätte es Peter Golizyn noch nötig, ein Mensch zu werden. Er ist ein kultivierter Herr, bewandert in westlicher Lebensart, mehrsprachig, weltoffen und gebildet. Nach einem Jahr in Venedig besucht er Cosimo de’ Medici in Florenz, wo er mit großen Ehren empfangen wird. Golizyns Auftrag, Künstler und Wissenschaftler für Moskau zu rekrutieren, ist fast erfüllt; als einzige »Fakultät« in seiner Sammlung fehlt noch die Musik. In dieser Sparte muss es etwas Besonderes sein: Peter der Große wünscht die italienische Landesspezialität, er will einen Kastraten. Für Fürst Golizyn eine schwierige Aufgabe, denn der Ruf der Moskowiter ist nicht der beste, und die italienischen Nachtigallen haben wenig Ehrgeiz, sich an einer Expedition in die Wildnis zu beteiligen:
Dem ersten ist das Land an sich ein Graus, dem zweiten weite Reisen widerstreben, der dritte sagt: »Ich melk’ ein Opernhaus und will nicht Monate statt Jahren leben.«
Moskau, das bloße Wort, erschreckt den einen, der and‘re traut den Leuten dort nicht recht, »Barbaren sind‘s!«, pflegt Nummer drei zu greinen: Sie wollen alle nicht. Der Fall steht schlecht.
Nach vielen erfolglosen Verhandlungen in Venedig wendet sich Fürst Golizyn vertrauensvoll an Cosimo de’ Medici. Der Großherzog möchte seinem Gast behilflich sein und den Wunsch des Zaren erfüllen – er unterhält gute diplomatische Beziehungen zu Moskau und kann Peters Sehnsucht nach regionalen Künsten und Kuriositäten bestens nachvollziehen. Cosimo löst das Problem auf naheliegende Weise: Man schicke einfach einen Sänger, der sich nicht wehren kann. »Und so«, sagt Filippo, »richtete Seine Hoheit die Augen auf meine kleine Person.«
Nun geht alles sehr schnell. Der junge Kastrat singt vor Fürst Golizyn und gefällt ihm gut. Cosimo de’ Medici bittet Messer Balatri um seine Einwilligung, Messer Balatri sagt nein, Cosimo wird nachdrücklich, Messer Balatri sagt ja. Fürst Golizyn fährt zurück nach Venedig. Filippo soll ihm dorthin folgen, und dies möglichst bald. Man schickt ihn heim nach Pisa, um Abschied zu nehmen, für lange oder für immer. Filippo begreift nicht, wie ihm geschieht. Moskau? Wo soll das sein? Ein Bündel Wäsche und ein »gutes Kleidchen«, dazu ein paar fromme Bücher als Reiselektüre, das ist sein ganzes Gepäck. Schließlich gibt ihm Vater den Segen und spricht lange von Gottes Allmacht und Gerechtigkeit. Die Mutter bringt kein Wort heraus. Sie flüchtet weinend in die Arme einer Freundin.
Ehe er sich‘s versieht, sitzt Filippo wieder in der Kutsche nach Florenz. Diesmal in einer Staatskarosse, denn Filippo ist plötzlich zur Staatsaffäre geworden, ein Geschenk des Großherzogs der Toskana für den Zaren von Russland. Filippo wird übel in der Staatskarosse. Gott sei Dank ist der große Bruder bei ihm. Ferrante darf ihn bis nach Venedig begleiten, aber dann wird er wieder nach Hause fahren, und Filippo muss alleine weiter, bis ins Reich der wilden Moskowiter.
»Da hast du ja eine hübsche kleine Reise vor«, sagt Cosimo de’ Medici und grinst. Schließlich wird er ernst und spricht von Gott, genau wie Vater. Der Allmächtige sieht alles. Der Großherzog sieht auch alles, sogar in Russland. Die Moskowiter sind keine Katholiken und deshalb auch keine wirklich guten Menschen. Ein Fehltritt, Filippo, und deine Seele ist für immer verloren. Der junge Sänger küsst schweigend Cosimos Rocksaum und wird weitergereicht an einen Sekretär, Signor Bassetti, der ihm seinerseits eine Predigt hält, sieben Viertelstunden lang. Hier fällt der Autobiograph plötzlich aus der Rolle. Bislang hat er alle frommen Belehrungen getreulich niedergeschrieben, aber was der Chorherr Bassetti zum Besten gab, bleibt uns erspart. »Ich hatte die Missioniererei allmählich so satt«, gesteht Balatri, »dass ich mich gefreut hätte, wenn ich endlich in Moskau gewesen wäre.«
Der Jüngling hat andere Gedanken im Kopf als die ewige Verdammnis. Bekommt er vielleicht ein Pferd oder eine Taschenuhr, wenn man ihn schon in so eine schöne Kutsche setzt? Die Bediensteten nennen ihn »mein Herr«. Er genießt berittenen Geleitschutz für die Weiterfahrt nach Venedig, und wenn er Hunger hat, darf er ein Kommando geben, und man hält bei einem Wirtshaus. Zwar begreift Filippo noch immer »nicht mehr als eine junge Katze«, aber allmählich beginnt ihm die Sache Spaß zu machen: »Heiliger Strohsack, sagte ich zu mir selbst, wenn das so weitergeht, ist das Diskantistchen bald ein Signor Marchese!«
In Venedig werden Filippo und Ferrante in Peter Golizyns Haushalt aufgenommen, wo sie mehrere Monate bleiben, bis der Gesandte seinen Konvoi geordnet und die Heimreise nach Moskau organisiert hat. Der Empfang ist huldvoll, beinahe herzlich. Fürst Golizyn, der mehr Verständnis für Filippos eigentümliche Situation zu haben scheint als dessen eigener Vater, stellt den Sänger unter seinen persönlichen Schutz und nimmt ihm bald die Angst vor der viel geschmähten russischen Barbarei. Golizyn ist ein untersetzter Herr von Ende dreißig, blass, blond, mit freundlichen blauen Augen. Er ist nicht schön, aber sehr sympathisch, und selbst wenn er ernst oder zornig wird, sieht sein Mund immer aus, als ob er lächle.
Golizyn spricht fließend Italienisch, wenn auch mit einer eigenwilligen Grammatik. Filippo amüsiert sich still über sein ständiges »ich gehen, du stehen, ich wollen, du machen«. Die verbleibenden Monate in Italien werden genützt, um dem Geschenk für den Zaren den letzten Schliff zu geben: drei Privatlehrer täglich, Gesang, Cembalo und Latein. Filippo hat gewisse Schwierigkeiten mit der Intonation, aber die Stimme ist hervorragend, und wenn er in dem einen oder anderen Salon eine Arietta zum Besten geben darf, nennen ihn die feinen Damen von Venedig ein »gutes liebes Knäblein«. Eine von ihnen, selbst eine Sängerin, lässt sich auf eine Diskussion über Filippos fremdbestimmte Reisepläne ein. Was heißt hier Gehorsam? Wie kann man dem armen Kind das antun? Warum geben Vater und Landesherr das Kommando, diesen netten Jungen in die Hölle zu schicken? Filippo hat dazu keine Meinung. Fürst Golizyn läuft rot an, springt auf, wünscht eine gute Nacht und verlässt wutentbrannt mit seinem Schützling das Haus. Am Tag darauf schickt er ein wertvolles Geschenk an die unhöfliche Dame. Sie soll nur sehen, dass die Moskowiter Teufel sich zu benehmen wissen!
Nachdem Filippo den Spruch von der Hölle gehört hat, beginnt er seinen Herrn etwas genauer zu beobachten. Erleichtert stellt er fest, dass dieser, wenn auch nicht katholisch und somit irgendwie verdammt, zumindest kein Teufel ist. Golizyn betet jeden Morgen, er besucht die griechische Kirche und über seinem Bett hängt ein Kruzifix. Filippo schreibt heim an die Eltern, sie sollen sich keine Sorgen machen. Noch ein paar Tage Vergnügen in Venedig – die Brüder Balatri fahren mit der Gondel und stören die Schausteller am Markusplatz bei der Arbeit –, dann fährt Ferrante zurück nach Pisa, und der inzwischen sechzehnjährige Filippo macht sich auf den Weg nach Moskau.
Im Herbst 1698 setzt sich Fürst Golizyns Zug in Bewegung. Es sind ungefähr zweihundert Personen, aufgeteilt in kleinere Gruppen, die zeitversetzt reisen, damit es keine Probleme mit der Unterkunft gibt. Zum größten Teil handelt es sich um Fachleute des Marinewesens und des Schiffsbaus, ein Gebiet, das dem Zaren besonders am Herzen liegt. Außerdem hat Golizyn Mathematiker, Architekten, Bildhauer, Maler und Ingenieure angeworben – und einen einzigen Sänger, Filippo, den er in seiner eigenen Reisegruppe unterbringt, damit ihm nichts passiert.
Zweihundert Leute, und niemand versteht etwas von Musik. Auch wenn drei moskowitische Kavaliere aus Golizyns Entourage in Italien gelernt haben, die Theorbe zu spielen, so ist das nicht besonders überzeugend. Einer kann zwar ein paar Sonaten zupfen, aber nicht begleiten, der zweite übt nicht genug und hat bis Wien das Gelernte bereits wieder vergessen, und der dritte wird in zwei Monaten nicht einmal mehr wissen, wie man das unhandliche Instrument richtig stimmt. Bis auf weiteres muss sich Filippo dazu bequemen, a cappella zu singen. Wenn man bedenkt, dass die Intonation ohnehin nicht seine Stärke ist, kann man ihn dafür nur bedauern.
Cosimo de’ Medici hat Filippo befohlen, ein Reisetagebuch zu führen. Er nimmt diese Aufgabe sehr ernst. Man kann wohl davon ausgehen, dass die alten Kladden auf Filippos Schreibtisch lagen, als er seine Memoiren niederschrieb. Städte, Dörfer und Landschaften gleiten an ihm vorüber, Woche um Woche, und er notiert, was ihm auffällt: vermischte Betrachtungen eines aufmerksamen und ein wenig überforderten Touristen.