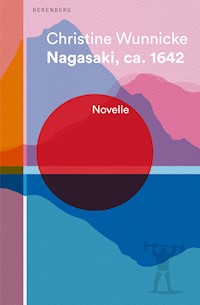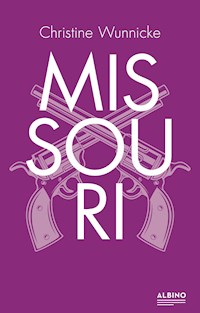Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Albino Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Der schwedische Professor Simon Chrysander ist berühmt für seine Fähigkeit, Dinge zu ordnen und zu bestimmen. Davon hat auch die britische Royal Society Wind bekommen. Im Jahr 1678 bestellt sie den Skandinavier nach London, um ihre naturkundliche Sammlung zu sortieren. Chrysander folgt dem Ruf. Doch je mehr Struktur er in das obskure Durcheinander aus konservierten Kuriositäten bringt, desto mehr stürzt sein eigenes Dasein ins Chaos. Dafür sorgt eine Begegnung mit dem jungen Lord Fearnall, der haltlos durch die Paläste und Lasterhöhlen des barocken Londons treibt und dessen irrlichternde Persönlichkeit sich allen Ordnungsrastern entzieht. Als Chrysander erkennt, dass Fearnalls Unberechenbarkeit seine Existenz gefährdet, ist es zu spät. Längst hat sich der junge Lord in den Kopf gesetzt, von dem kauzigen Professor "bestimmt" zu werden. Ein Kräftemessen zwischen Abwehr und Zuneigung, Ratio und Ungewissheit, Leben und Tod beginnt. Fast zwanzig Jahre nach seiner Erstveröffentlichung erfährt der dritte Roman von Christine Wunnicke mit dieser Neuausgabe seine Renaissance. "Die Kunst der Bestimmung" ist nicht nur ein erzählerisches Meisterstück, randvoll mit skurrilen Charakteren, historischen Anekdoten und brillierendem Sprachwitz – der Roman ist auch mehr denn je auf der Höhe der Zeit. Von der Leichtigkeit, mit der er Gender-Normen hintertreibt, Queerness im Subtext miterzählt und Beziehungskonventionen auf den Kopf stellt, können heutige Diversity-Experten viel lernen. "Ein klug komponierter, intelligenter und spannender Roman mit Sinn fürs Skurrile und philosophischem Tiefgang." (Bayerischer Rundfunk)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DIE KUNST DER BESTIMMUNG
ÜBER DAS BUCH
London, 1678. Die Royal Society bestellt Professor Chrysander zum Kurator ihrer Sammlungen, und der schwedische Naturforscher kehrt die verlotterte Wunderkammer mit eisernem Besen aus. Für den exzentrischen Lord Fearnall hingegen ist das Leben ein Maskenstück. Als er Chrysander begegnet, prallen zwei Welten aufeinander. Ein Spiel von Verführung und Gegenwehr beginnt …
Der schwedische Professor Simon Chrysander ist berühmt für seine Fähigkeit, Dinge zu ordnen und zu bestimmen. Davon hat auch die englische Royal Society Wind bekommen. Im Jahr 1678 bestellt sie den Skandinavier nach London, um ihre naturkundliche Sammlung zu sortieren. Chrysander folgt dem Ruf. Doch je mehr Struktur er in das obskure Durcheinander aus konservierten Kuriositäten bringt, desto mehr stürzt sein eigenes Dasein ins Chaos. Dafür sorgt eine Begegnung mit dem jungen Lord Fearnall, der haltlos durch die Paläste und Lasterhöhlen des barocken Londons treibt und dessen irrlichternde Persönlichkeit sich allen Ordnungsrastern entzieht. Als Chrysander erkennt, dass Fearnalls Unberechenbarkeit seine Existenz gefährdet, ist es zu spät. Längst hat sich der junge Lord in den Kopf gesetzt, von dem kauzigen Professor «bestimmt» zu werden. Ein Kräftemessen zwischen Abwehr und Zuneigung, Ratio und Ungewissheit, Leben und Tod beginnt.
Die Kunst der Bestimmung ist nicht nur ein erzählerisches Meisterstück, randvoll mit skurrilen Charakteren, historischen Anekdoten und brillierendem Sprachwitz – der Roman ist auch mehr denn je auf der Höhe der Zeit. Von der Leichtigkeit, mit der er Gender-Normen hintertreibt, Queerness im Subtext miterzählt und Beziehungskonventionen auf den Kopf stellt, können heutige Diversity-Experten viel lernen.
ÜBER DIE AUTORIN
Christine Wunnicke, geboren 1966, lebt in München und schreibt über ungewöhnliche Menschen. Ihre Romane Der Fuchs und Dr. Shimamura (2015), Katie (2017) und Die Dame mit der bemalten Hand (2020) wurden für den Deutschen Buchpreis nominiert. 2020 erhielt sie den Literaturpreis der Landeshauptstadt München und den Wilhelm Raabe-Literaturpreis. Bei Albino erschien zuletzt ihre Erzählung Missouri.
Christine Wunnicke
DIE KUNST DER BESTIMMUNG
Roman
1. Auflage
© 2021 Albino Verlag
Salzgeber Buchverlage GmbH
Prinzessinnenstraße 29, 10969 Berlin
Die Kunst der Bestimmung erschien zuerst
im Jahr 2003 im Kindler Verlag.
Umschlaggestaltung: Johann Peter Werth
Umschlagabbildung: Jacques Barraband
Printed in the Czech Republic
ISBN 978-3-86300-309-8
Mehr über unsere Bücher und Autor*innen:
www.albino-verlag.de
PROLOG
IM JAHR 1679, zwei Tage vor Martini, erreichte ein später Reisender den Marktflecken Kalix bei Torneå. Er blieb nur eine Nacht. Dennoch hinterließ er einen bleibenden, nicht sonderlich günstigen Eindruck.
Es hatte viel geschneit. Das Land war kaum wegbar. Der Reisende kam zweispännig, allein und von Norden, wo man kein Schwedisch sprach und das Vaterunser nicht betete. Er war bärtig, in mittleren Jahren, die Lippen weiß vom Frost. Die Schlittenfelle hatte er nach Art der Lappen fest um den Leib gebunden, damit sie sich im Fahrtwind nicht bauschten. Hinten im Schlitten lag ein Ding, in Stroh und Decken gepackt, ein Schrank vielleicht oder eine große Kiste. Die Leute hatten Licht geholt. Selten kamen Fremde nach Kalix, man wollte den Mann nicht unbeleuchtet passieren lassen. Die Zügel hatten seine Handschuhe aufgescheuert und die Handflächen. «Nichts weiter», sagte er, als er vor der Kirche vom Kutschbock stieg, «nur tut mir die Gnade, ihr guten Leute, und erlöst die Rentiere von ihrem Leiden, denn sie werden nicht weiter laufen können.»
«Ja so», meinte der Schlachter. Er schirrte schweigend aus. Der Reisende bat um ein neues Gespann für die Weiterfahrt, um ein Nachtquartier und einen Stellplatz für seinen Schlitten. Er sprach besonnen und im Tonfall des Südens. Er hatte Gold. Das war in Kalix ein seltener Anblick. Gefragt nach Herkunft und Namen, stellte er sich vor als Simon Chrysander, Professor Upsaliensis. Keinem hier war ein solcher Titel geläufig. Er nannte die Leute noch einmal «ihr Guten», das kam ihnen in gewisser Weise verdächtig vor. Kalix ist nicht der Ort für Vertraulichkeiten und die Zeit um Martini keine gute Zeit. Die Leute schwiegen. Der Schlachter tat seine Pflicht mit den Rentieren, hinten im Hof der Schlachterei. Dann zeigte jemand auf das Ding im Schlitten und murmelte: «Zoll».
Kalix hatte kein Zollrecht. Der Mann aus Uppsala wusste nichts vom Zollrecht im Norden. Er bot Gold an, man wollte kein Gold, was soll man mit Gold in Kalix? Zoll sind Waren und Waren sind gut im Winter. Man holte mehr Licht. «Um der Liebe des Herrn willen ...», begann Chrysander, als man unter Stroh und Decken nach seiner Fracht tastete, doch keiner beachtete ihn. Das Ding war schwer. Man stellte ein Brett schräg und zog es mit zwei Stricken vom Schlitten. Vier Männer richteten es auf und lehnten es gegen den Kutschbock. Die Decken glitten zu Boden.
Das Ding war ein Eisblock, klar gefroren ohne Riss oder Blasen. Er stand übermannshoch. Oben lief er spitz zu und hinten, wo er am Schlitten lehnte, war er gerundet wie ein gläsernes Boot. Darin eingeschlossen, gleichsam schwebend, den Kopf geneigt, das linke Bein leicht angewinkelt wie in einem zaghaften Sprung, war ein Mensch. Er schien unverletzt und ohne Spuren von Verwesung, ein junger Mann, ins Eis geraten, bevor die Zeit ihr Werk an ihm tun konnte. Er trug dunkle Hosen, weder Strümpfe noch Schuhe, ein weißes Hemd, die Bänder an Kragen und Manschetten erstarrt zu verflochtenen Schnörkeln. Einige Strähnen seines langen hellen Haares umschlangen den Hals, der Rest floss in einer wirren Spirale über Augen und Stirn. Seine Lippen waren leicht geöffnet. Die Fingerspitzen berührten sich vor der Brust. Im Eis brach sich das Licht der Fackeln. «Nun denn», sagte Simon Chrysander, «ich hatte euch gebeten, den Zoll in bar zu nehmen.»
Hierauf wussten die Leute von Kalix nicht recht viel zu erwidern.
Man holte den Pfarrer aus dem Pfarrhaus, damit jemand zu dem Fremden sprach. Der Pfarrer betrachtete den toten Jüngling im Eis und befahl, ihn wieder hinzulegen; in dieser Stellung, aufrecht wie eine Statue, hatte das Bild etwas Unverschämtes. Niemand wollte das Eis berühren. Der Besitzer der unverzollbaren Fracht entschuldigte sich, allein könne er den Block nicht bewegen. Er versicherte dem Pfarrer, nichts Unrechtes sei geschehen. Er fügte hinzu, der Transport der Leiche habe diplomatische Gründe. Als Mitglied des englischen Oberhauses unterstehe der Tote nicht der schwedischen Krone und müsse die Bürger von Kalix folglich nicht kümmern. Auch der Pfarrer wusste nicht viel zu erwidern. Er begriff jedoch den Nutzen von Gold. Am Morgen würde der Mann aus Uppsala ein neues Gespann bekommen und Helfer zum Beladen; dafür wollte der Pfarrer Sorge tragen. Er befahl den Leuten, zu Bett zu gehen, und verschwand im Pfarrhaus.
Simon Chrysander bekam kein Quartier in Kalix. Man ließ ihm zwei Fackeln und zog sich zurück. Die Nacht dauerte noch viele Stunden. Chrysander ging auf und ab, die Arme hinterm Rücken. Die erste Fackel erlosch. Im Schein der zweiten betrachtete er noch eine Weile den Toten. Er hatte ihn liegen sehen im Eis, doch aufgerichtet, wie er halb sprang und halb schwebte und den Kopf neigte in einem vielleicht scheuen, vielleicht auch trotzigen Gruß, kannte er ihn erst seit dieser Nacht. Er versuchte, dem Toten in die Augen zu blicken, doch auch hochkant war dies nicht möglich, das Haar verhüllte sein halbes Gesicht. Er betrachtete ihn lange. Ein dreistes Schaustück in einer vergänglichen Vitrine. Chrysander zog seine durchgeriebenen Handschuhe aus und legte die Handflächen aufs Eis, bis es sich wärmer anfühlte als seine Haut.
Inhalt
Über das Buch
Übef die Autorin
Prolog
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Epilog
I
«MIT DEM MORGENURIN», sagte Mr. Hooke bei der Sitzung der Royal Society am 15. Juli 1678, «habe ich heute einen Stein ausgeschieden, welcher jenem, den uns Sir William Throgmorton gütigst für das Kabinett überlassen hat, vielleicht in Größe und Gewicht ein wenig nachsteht, nicht aber in allgemeiner Merkwürdigkeit.»
Josiah Blane, der Stenograph, nahm dies zu Protokoll. Er schrieb es in die Experimentalkladde und nicht in die Vermischten Bemerkungen, obschon Mr. Hooke den Stein nicht herzeigte. Er würde noch nach ihm schicken, dessen war sich Josiah gewiss, und dann wäre der Stein ein Ding und kein Wort mehr und gehörte somit in die empirischen Vermerke.
«Ich wüsste gerne», sagte Dr. Croune versonnen, «woher der Schleim der Aale kommt.»
«In Kensington», sagte Mr. Aubrey, «wo einer im Pranger stand, leckten Hunde von seinem putriden Eiter und starben, und einem Mann, der die Schuhe eines Toten auftrug, faulten die Füße ab. Quid mirum, nicht wahr, und zum Wohl!»
Mr. Aubrey hob sein Glas. Er trank Wein, als Einziger, und er trug Rot, Feuerrot, wie ein junger Stutzer. Voriges Jahr hatte er Josiahs Horoskop gestellt und gesagt, er habe Geistesgaben. Dann hatte er ihm gezeigt, wie man mit der rechten Hand schreibt und mit der linken zeichnet. Einer mit Geistesgaben müsse vieles auf einmal tun. Mr. Aubrey konnte sogar reiten und zeichnen zugleich, und dabei noch denken und sprechen und trinken. Josiah schrieb die Sache mit dem Eiter nieder und zeichnete dabei, mit der Linken, Mr. Hooke. Er zeichnete ihn in ein Koordinatensystem, damit sein schiefer Wuchs besser zur Geltung kam. Seit er sich mit Mr. Newton über die Lichtbrechung gestritten hatte, wurde Mr. Hooke immer schiefer. Er trug schon keine Perücke mehr, weil sie rutschte. Er trug sein eigenes Haar, braun, lang und fettig. Sein Kopf war zu groß, sein Mund zu klein, seine Knochen drückten von innen gegen die Haut wie bei den morschen indianischen Affen, die im Kabinett ihrer Beschriftung harrten.
Mr. Hooke wusste alles. Mr. Hooke war die Royal Society. Die Royal Society war Mr. Hooke. Bisweilen träumte Josiah, Mr. Hooke verdopple und potenziere sich, bis lauter Hookes das Sitzungszimmer füllten, Allwissen und Affenknochen unendlich gespiegelt, als blicke Josiah durch das Prismenauge der Gemeinen Stubenfliege, wie es dargestellt war auf Mr. Hookes mikroskopischen Tafeln.
«Die Aufklärung der Herkunft des Schleimes an Aalen», bemerkte Dr. Croune, «läge mir durchaus am Herzen.»
Josiah Blane setzte den Schleim der Aale auf die Liste der Disputanda und zeichnete gleichzeitig ein wenig schmeichelhaftes Membrum zwischen die Beine des Mr. Hooke. Josiah bewohnte eine Kammer, die Wand an Wand mit Mr. Hookes Schlafzimmer lag, oben im Ostflügel des Gresham College. Dort wurde er stets Zeuge von Mr. Hookes Erfreuungen. Bis zu drei Erfreuungen pro Nacht gelangen Mr. Hooke, mit Doll, seiner Magd, oder Grace, seiner Nichte. Letzte Woche hatte sich Mr. Hooke eine Totgeburt aus Blackfriars kommen lassen, wegen Gaumenspalte und doppelten Rückgrats. Die lag nun im Kabinett und stank. Josiah hätte sie gerne präpariert. Vielleicht wäre es ihm gelungen. Vielleicht zufriedenstellend. Vielleicht gut. Vielleicht hätte Mr. Hooke genickt. Vielleicht hätte er «brav» gesagt. Josiah Blane traute sich nicht zu fragen, ob er die Totgeburt aus Blackfriars präparieren dürfe.
«Der Trigonalaspekt zwischen Mars und Saturn begünstigt die Fäulnis», sagte Mr. Aubrey, «und ihre Konjunktion den trockenen Zerfall.»
«Mein Stein ist pfriemenförmig, fast lanzettlich», berichtete Mr. Hooke, «eine gute halbe Drachme schwer, von hellgrüner Färbung, die Oberfläche warzig und kristallin. Ich trank Meerrettich-Bier, die Entleerung war schmerzlos. Der Stein ist überaus beachtenswert.»
Josiah stenographierte, mit der Linken näherte er das Radiermesser Mr. Hookes abgebildeter Männlichkeit. Er saß allein an seinem Schreibpult. Die Herren sahen nicht, was er tat, sie prüften nur später die Reinschrift. Josiah Blane war einmal in Cambridge gewesen. Josiah Blane hatte Arzt werden wollen. Geld und Gaben reichten nicht hin. Als Protokollant der Royal Society hatte er mit jährlich zwanzig Pfund sein Auskommen, dazu Kost und Logis. Er teilte die Kammer mit den zwei Dienern, Harry und Tom. Manchmal kaufte er einen Traktat über Anatomie. Manchmal schaute er Grace Hooke hinterher. Oft zeichnete er die Konterfeis der Gentlemen am Sitzungstisch. Josiah Blane war fünfundzwanzig und sein Leben war eigentlich vorbei.
«Ich vermute», sagte Dr. Grew, «der Schleim auf Aalen wird durch ähnliche Glandulae hervorgerufen wie der Schleim in unserem Hals.»
Mr. Hooke schickte Harry hinauf zu Grace, um seinen Stein zu holen.
«Der Schleim in unserem Hals dringt nicht nach außen», stellte Mr. Colwall fest.
«Bisweilen schon», entgegnete Mr. Aubrey.
«Nicht durch die Haut, Sir», meinte Mr. Colwall.
«Der Schleim auf Aalen», erklärte Mr. Hooke, «ist eine Transpiration, welche, sobald sie sich mit Wasser oder Luft vermischt, schleimige Eigenschaften annimmt.»
«Die Haut des Aals hat in der Tat erkennbare Poren», setzte Dr. Grew hinzu.
«Nein, Sir», sagte Mr. Colwall.
«Ich sehe die Poren unter dem Mikroskop, sie sind dreieckig, ich sehe, wie sie transpirieren!»
Josiah Blane zeichnete Affenohren zwischen die perückenlosen Haare des Mr. Hooke.
«Die Haut des Aals hat keine Poren», sagte Mr. Colwall.
«Die Haut des Aals», fuhr Mr. Hooke fort, «besteht aus zwei Stoffen, von denen einer fest ist, der andere flüssig. Der feste Stoff ist gewebt aus einzelnen Fäden, locker, wie grobes Linnen. Der flüssige Stoff gewährleistet die Elastizität, ein Teil aber dringt nach außen und mischt sich mit Wasser oder Luft zu Schleim.»
«Die Haut des Aals hat keine Poren», beharrte Mr. Colwall.
«Die Poren sind dreieckig», wiederholte Dr. Grew.
«In der Vakuummaschine wird der Aal trocken», sagte Mr. Hooke.
«Und stirbt», fügte Mr. Aubrey hinzu.
«Er stirbt an Austrocknung», erklärte Mr. Hooke.
«Er stirbt, dann trocknet er», sagte Mr. Aubrey.
Mr. Colwall schickte Tom zum Markt nach einem Aal und Harry, der soeben ein samtenes Läppchen mit Mr. Hookes Stein brachte, ins Kabinett nach der Vakuummaschine.
«Zum Wohl», sagte Mr. Aubrey und leerte sein Weinglas, «des Weiteren wurde mir aus Kensington berichtet, dass ein Knabe, der seinen Daumen in das Fleisch eines Gehenkten steckte, seinen Arm an den Wundbrand verlor.»
«Wie lange hing er?», fragte Dr. Grew.
«Lange», entgegnete Mr. Aubrey lächelnd. «Wie möchte wohl ein Knabe frisches Fleisch mit dem Finger durchstoßen?»
Bis Tom mit dem Aal zurückkam, hatten die Herren die Experimentalkladde und die Vermischten Bemerkungen um manchen Beitrag bereichert. Nach einem kurzen Disput hatte man beschlossen, Mr. Hookes Stein nicht dem Kabinett, sondern einer chemischen Analyse zuzuführen. Man hatte ihn im Mörser zerstoßen, mit Aquafortis geschüttelt, gefiltert, das Sediment probiert, alles ohne rechtes Ergebnis. Vom Aquafortis war man zur Reinigung von Perlen gelangt, von dieser zur Herstellung rostfreier Nägel, von dort zum Schiffsbau und von jenem zu dem Vulkanausbruch, der von Teneriffa berichtet wurde. Dr. Grew und Mr. Colwall gerieten in einen Wortwechsel über die Ursachen unterirdischen Feuers. Dazwischen sprach Dr. Croune über die Formung des Kükens im Ei und den Wandel der Dichte des Wassers. Mr. Aubrey beschrieb ein Tier, das in Kensington als Bastard eines Kaninchens und eines Katers das Licht der Welt erblickt habe und seither ein etwas unentschiedenes Leben führe. Mr. Hooke wollte das Tier kaufen, Dr. Grew zweifelte dessen Existenz an, woraufhin sich Mr. Colwall erinnerte, es mit eigenen Augen gesehen zu haben bei seinem letzten Ausflug nach Kensington. Mr. Aubrey und Mr. Colwall wurden beauftragt, das Tier zu erwerben und auszustopfen, während man Mr. Hooke bat, bis zur nächsten Sitzung die Analyse seines Steins abzuschließen, was er sich ohne Murren, wenn auch ein wenig unfroh zu eigen machte, hätte er den Stein doch lieber unversehrt im Kabinett gesehen. Mr. Aubrey war bei der zweiten Flasche Wein angelangt, Dr. Croune stärkte sich mit Barbados-Likör, Mr. Colwall erläuterte die jüngste Testreihe des Florentiner Experiments und Josiah Blane zeichnete.
Er zeichnete Regale, ähnlich jenen im Kabinett, dazu Wandhaken, Tischchen, Vitrinen, alles, was man braucht in einer Naturaliensammlung, um die Objekte angenehm auszustellen. Als der Raum bestückt und nach den Regeln der Perspektive mit Fluchtpunkt und kunstfertigen Schrägen versehen war, widmete sich Josiah den Schaustücken selbst. Er zeichnete die Halswirbelsäule des Mr. Hooke, aufgestellt auf einer Konsole als Lehrstück naturwidrigen Wuchses, er zeichnete auch Mr. Hookes eifrige Männlichkeit in ein Glas mit rektifiziertem Öl, und daneben, in Wachs präpariert, Mr. Aubreys mitgenommene Leber. Von einem einzigen Haken baumelten die Schädel des Mr. Colwall und Dr. Grew, wie sie einander feindselig beäugten aus vier weiß gescheuerten Augenhöhlen. Josiah verschönerte seine Zeichnung weiter, mit Fingern, Blasen, Kniegelenken der anwesenden und auch der abwesenden Mitglieder der Royal Society, mit den Augen des Mr. Pepys und Dr. Kings geblähtem Gehirn, mit der abgezogenen Haut des jungen Earl of Fearnall, eines Mitglieds honoris causa, und mit allen gewesenen und künftigen Steinen des Mr. Hooke. Zuletzt zeichnete er sich selbst ins Museum, ausgestopft und lebensecht hingestellt an ein Pult in schreibender Haltung. Josiah protokollierte, während er zeichnete, und eben schrieb seine Rechte Dr. Grews Meinung zur Ausschmelzung von Antimon mit Eisen nieder, während er mit der Linken die Mundwinkel seines eigenen Konterfeis hinabzog zu einer trüben Grimasse, als Tom mit dem Aal kam und die Tür zufallen ließ.
«Meine Herren», sagte Sir Christopher Wren, der bislang wie die Statue der Geduld mit zwar offenen, aber blicklosen Augen unbewegt und stumm im Sessel des Vorsitzenden verharrt hatte, «ich möchte Sie nun, wie letzten Mittwoch und bereits mehrmals zuvor vereinbart, um Ihre Stimmen zur Bestellung des korrespondierenden Mitglieds Dr. Chrysander zum Kurator unserer Sammlungen bitten.
Josiah Blane schnitt die Feder nach und öffnete die Kladde Beschlüsse und Ergebnisse.
«So er denn sein kaltsinniges Nordmoos nicht in meinem Garten zu kultivieren beabsichtigt», sagte Mr. Aubrey, «soll mir der Herr Kollege aus Uppsala willkommen sein, obschon ich bedauere, dass er mir seine Geburtsstunde verschweigt.»
Mit diesem Satz begann jede Diskussion über das Thema Chrysander, an der Mr. Aubrey teilnahm. Er hatte den Schweden bereits vor zwei Jahren nach seiner Geburtsstunde gefragt, da ihm einiges an dessen Wesen, wie es zutage trat in seinen Briefen und Publikationen, auf eine ungesunde Ballung diverser Planeten hinzudeuten schien; eine Antwort hatte er nicht erhalten. Bei dem Moos, welches Mr. Aubrey missfiel, handelte es sich um eine flache, dunkle und stets ein wenig verfilzte Art aus Lappland, welche der Schwede vor einigen Jahren beschrieben und mit gutem Recht Chrysandria getauft hatte, da sie zuvor niemandem aufgefallen war. Das lappländische Moos lag Dr. Chrysander sehr am Herzen; ein halbes Dutzend Traktate hatte er bereits darüber geschrieben, obschon die Chrysandria, so Mr. Aubrey, das langweiligste Geschöpf auf Gottes Erde war. Sie hatte keinen Samen, keinen Keim, kein Geschlecht, und selbst im kurzen und wilden nordischen Frühling, der sonst, wie man aus den Büchern wusste, die ganze Welt unverhofft zu Bocksprüngen trieb, blieb die Chrysandria saftlos, filzig und von einer ungerührten Keuschheit, die weder Pollen kannte noch Pistillum und keinen Wunsch nach Vermehrung. Freiwillig breitete sie sich nicht aus; wollte man sie kultivieren, musste man ein Stielchen im Mörser zerreiben und es dann aussäen auf einem trockenen und schattigen Stein, wo das Moos sodann, lustlos, wie es schien, und sehr langsam, ein neues Polster bildete, welches wiederum allen Anfechtungen des Frühlings widerstand.
Der Eifer, mit dem Simon Chrysander dem lappischen Moos anhing, wäre ihm fast zum Verhängnis geworden. Seine Abhandlung De Origine Animalium a Vegetabili Regno führte in der Universität Uppsala zu einem Skandal, da man mutmaßte, Chrysander wolle behaupten, in seinem Lieblingsmoos läge der Ursprung des Lebens und alle anderen Arten seien aus ihm hervorgegangen. Sehr zu Mr. Aubreys Belustigung hatte es hierbei stets auch den Anschein, als werfe der Autor jeder Pflanze, jedem Tier und zuvörderst dem Menschen vor, sich aufgrund einer unheiligen Degeneration von der paradiesischen Demut der Chrysandria ab- und stattdessen einer auf Geilheit und Kampfeslust fußenden Lebensform zugewandt zu haben. Was Mr. Aubrey ebenfalls, die theologische Fakultät von Uppsala dagegen wenig amüsierte, waren einige verwaschene Sätze, denen man, wenn man denn wollte, entnehmen konnte, Chrysander vertrete die Theorie, der Gott der Genesis habe Wasser, Erde und Chrysandria geschaffen und sich sodann zur Ruhe gesetzt, um den Fortgang der Geschichte dem Zufall zu überlassen.
Nachdem ihn diese Abhandlung beinahe den Lehrstuhl für Medizin gekostet hatte, den er seit nunmehr zehn Jahren besetzte, wurde Dr. Chrysander besonnener und publizierte nun meistens in England, da hier das Interesse an der Heiligen Schrift als Fundament der empirischen Wissenschaft doch geringer war als in Schweden. Auch gab er kaum mehr solch gewagte Thesen in den Druck, sondern wandte sich den Details der Schöpfung zu, die er einzeln beschrieb und verglich, mit einer Ausdauer, die fast darauf schließen ließ, er würde keine Ruhe geben, bis er nicht jedes Tier, jede Pflanze, jedes Mineral oder Salz, jede Naturkraft und jedes Gesetz der Physik, kurz, alles, was auf Erden zu beobachten war, erschöpfend dargestellt, erklärt und gemäß seiner jeweiligen Eigenschaften zweifelsfrei in eine Vitrine seines hypothetischen Museums eingeordnet hätte.
Viele seiner Werke trugen dieses Wort im Titel: Musaeum Vermium Occidentalium. Musaeum Cerebri Animalis. Musaeum Regni Lapideum incl. Fossiliae. Dabei begnügte sich Dr. Chrysander nicht damit, die Dinge der Natur zu schildern, sondern er fasste sie auch in mathematische Formeln, die er Rationes nannte. Die Ratio einer Art bestimmte sich, soweit man dies begriffen hatte in der viel beschäftigten Royal Society, gemäß ihrer Stellung zu benachbarten Arten und vermutlich auch immer zu jener fragwürdigen Prima Causa, dem lappländischen Moos; denn von diesem wollte Dr. Chrysander nicht lassen. Mehrere Rationes ergaben eine Ratio höherer Ordnung, die wiederum mit anderen Rationes verrechnet werden konnte, bis schließlich, so schien es, die ganze unruhige Welt in einer einzigen Formel erfasst und gebändigt wäre. Es war vermutlich klug, dass Dr. Chrysander in England publizierte; denn stets blieb ein wenig im Dunkeln, welchen Platz Gott der Herr fand in jenem Koordinatensystem und welchen die christliche Demut, und es hatte auch bisweilen den Anschein, als sei dem Autor die unsterbliche Seele abhandengekommen bei all seinen Vergleichen zwischen Pflanze, Tier und Mensch.
«Das soll vorkommen», seufzte Dr. Grew.
«Nun denn, die Seele ...», gähnte Mr. Aubrey.
«Dafür gibt es die Kirche», meinte Dr. Croune, «teuer genug wird sie ja bezahlt.»
Weder Moos noch Rationes waren der Grund, weshalb man im Gresham College über Dr. Chrysander beriet. Er klassifizierte, so Sir Christopher, wie ein Engel, und das Kabinett bedurfte in der Tat eines klassifizierenden Geistes. Die Sammlungen wurden größer von Woche zu Woche und hatten weder Ordnung noch Katalog. Ein Mann wie Chrysander, der ausfegte und aufräumte in den Reichen der Natur, und der seine Seele, wie Mr. Aubrey dies ausdrückte, schon vor Jahren dem Ordnungsteufel verkauft hatte unter Umgehung des ersten Buches Mose, schien vielen der richtige für diese Aufgabe.
Man sang schon Spottverse über das liederliche Kabinett der Royal Society. Vor kurzem erst hatte Mr. Hooke wutschnaubend die Komödie verlassen, als der Hanswurst ein Lied anstimmte, das von dem Liebesspiel eines schiefen Professors, zweier brasilianischer Moorhennen und einer gewachsten Gallenblase erzählte, welche in ihrer Glut über faulige Föten und namenlose Nüsse stolperten; und solche Scherze waren zäh und fruchtbar wie Ratten.
Ratten lebten auch im Kabinett. Man fand immer wieder geheimnisvolle Objekte im Treppenhaus, herausgenagt aus größeren Geheimnissen, verdreckt und verschleppt und verloren. Ein solches Überbleibsel schickte Mr. Aubrey eines Tages nach Uppsala, um zu prüfen, ob Dr. Chrysanders Gaben seinem Ruf entsprächen. Postwendend erhielt man die Antwort: Partikel eines Hodens eines Bären, benagt von einer Ratte. Man setzte das Examen fort. Klaglos folgte Bestimmung auf Bestimmung, Gewebe des menschlichen Dünndarms, Kralle einer Fledermaus, Meerwurmnest verbacken mit Teer, Rose von Jericho, Ziegenhorn mit Spuren von Feile und Leim. Sir Christopher Wren hatte nach dem letzten Brief eigenmächtig einen gehörnten Hasen aus Sachsen fortgeworfen und plädierte seitdem dafür, Dr. Chrysander einzuladen, um in der Frist eines halben Jahres dem Kabinett mit seinem Wissen und seiner kurz angebundenen Gefälligkeit zu einem Glanz zu verhelfen, welchen es, so Sir Christopher, wahrscheinlich verdiente, aber ohne Kurator wohl nicht bekommen würde bis zum Jüngsten Tag.
«In den Augen der Welt», sagte Sir Christopher sanft, «erscheinen die Wangen der Royal Society ein wenig blass in diesen Tagen.»
«Und Dr. Chrysander», fragte Mr. Colwall, «wäre nun das Schminköl, um dem beizukommen?»
«Ein Öltuch gegen den Regen der Verleumdung?», schlug Dr. Croune vor.
«Pariser Öl gegen Altersfalten?», bot Mr. Aubrey an.
«Die letzte Ölung, gegebenenfalls», murmelte Mr. Hooke.
«Zumindest ein wenig Rosenöl wäre durchaus vonnöten im Kabinett», meinte Mr. Aubrey, «seit Mr. Hooke das Terpentinöl ausgegangen ist. Allerdings bewies auch Herkules seine Stärke zunächst in einem Misthaufen.»
«Mit einem Ölbaum als Keule», setzte Dr. Crew hinzu.
«Terpentin?», fauchte Mr. Hooke. «Ich präpariere in Wachs, Sir, und ich präpariere, wann ich will!»
So sprachen die Herren und so schrieb Josiah Blane, und eine unsichtbare Sonne wanderte draußen über den Himmel. Zwei Stunden später warf Sir Christopher sein nussbraunes Haar über die linke Schulter zurück. Dies war das Signal für Josiah, ein Ergebnis zu notieren. Wie so oft, hatte er dessen Geburt nicht zu folgen vermocht. Schwer schlugen Sir Christophers Locken gegen seinen samtenen Rücken, das teuerste Haar der Gesellschaft. Josiah schnitt die Feder nach. Der Vorsitzende diktierte: Die anwesenden Mitglieder beschlössen, dem Konzil zu empfehlen, Dr. Simon Chrysander für das Gehalt eines Ordinarius nach London zu bitten, um die Objekte der Sammlungen im Gresham College zu sichten, zu bestimmen, zu beschriften, zu vergleichen, einzuteilen, zurechtzumachen und übersichtlich aufzustellen, wie dies ihrer Form, Art, Natur und Bedeutung entspreche. Die Empfehlung sei einstimmig, diktierte Sir Christopher. Mr. Hooke zog dazu ein Gesicht, das Josiah nicht hätte zu Protokoll nehmen mögen. Sir Christopher machte sein Kompliment und beendete die Sitzung.
Die Herren brachen auf, um in Garraways Kaffeehaus hinter der Börse den Abend zu beschließen. Nur Mr. Aubrey machte sich davon zu einem Lokal mit allen Lizenzen. Er zwinkerte Josiah zu, als er am Stenographenpult vorüberkam, schnitt sogar eine Grimasse; ein Scherz, ähnlich jenem, mit dem ein Hagestolz einen Säugling neckt.
Josiah Blane stand auf und verharrte verbeugt, bis er alleine war. Dann bündelte er seine Niederschriften. Nun würde er also kommen, Dr. Chrysander aus Uppsala, dessen Liebe der Ordnung galt, den Rationes und einem dürftigen Moos aus Lappland. Bald wäre er hier und Josiah könnte ihn zeichnen. Würde Dr. Chrysander London gefallen? Josiah bezweifelte das. Auf dem Tisch stand der Kübel mit dem Aal. Er zuckte in seinem kleinen Gefängnis, fast hob er den Deckel. Josiah schloss leise sein Tintenfass. Er lauschte. Ein Aal, der pocht, bedeckt mit Schleim. Josiah kratzte eine Weile seinen Nacken, dann nahm er den Kübel und brachte ihn in die Küche. Später aß er den Aal zu Abend.
II
IM NOVEMBER 1678 bezog Simon Chrysander sein Quartier in London. Robert Hooke, der Sekretär der Royal Society, hatte in dem Haus, das die Throgmorton Street mit der Broad Street verband, das erste Stockwerk für ihn herrichten und möblieren lassen, das er nun, wenn alles nach Wunsch verlief, zusammen mit seinem Diener Kauppi und einer Köchin namens Peg, die ihm ebenfalls Mr. Hooke überlassen hatte, ein halbes Jahr lang bewohnen würde. Wenn Dr. Chrysander aus dem Fenster blickte, sah er zur Linken die Kirche St. Peter Le Poor, zur Rechten die Steuerbehörde, und dahinter, tief im Nebel, die Schornsteine des Gresham College.
Chrysander war ein grobknochiger Mann in den Dreißigern, von mittlerer Statur, kantigen Zügen und einem dunklen, fast südländischen Teint. Seine Augen standen ein wenig eng, die Brauen berührten sich und der Bartschatten widerstand jeder Rasur. Das Haar, schwarz mit dem ersten Grau, trug er nackenlang; Kauppi schnitt es unter einem Topf. Schwarze Haare wuchsen auch auf Chrysanders Händen und bildeten um die Knöchel kleine Wirbel. Seine Finger waren kurz und gedrungen, zwei Nägel der Rechten dafür lang, einer flach gefeilt, der andere spitz, Werkzeuge für unterwegs. In Uppsala hatten ihn manche für einen Bauern gehalten, zumal er sich oft nicht sorgfältig kleidete; die Engländer verwechselten ihn mit einem Priester oder Schlimmerem. Erst hatte er jedermanns «Hochwürden» korrigieren müssen, später sah er verwundert, wie ihn fremde Passanten mit der Geste für Galgenstrick begrüßten oder sogar Kot nach ihm warfen. Erst allmählich begriff er, dass hier ein schwarzer Rock und kurzes Haar Bekenntnisse waren, für allzu viel Frömmigkeit und gegen den Hof mitsamt der französischen Mode. Chrysander wusste, warum er in England publizierte. Dass Gottesfurcht mit Kotwerfen geahndet wurde, befremdete ihn allerdings doch.
Vor drei Tagen war er in London eingetroffen. Übermorgen würde er die Royal Society besuchen. Eine außerordentliche Sitzung war anberaumt, um den Kurator des Kabinetts zu begrüßen. Chrysander würde sprechen müssen. Darauf freute er sich nicht. Er freute sich allerdings auf Mr. Hookes Fossilien und auf die Farne und Pilze aus Übersee.
Kauppi rückte mit finsterer Miene das Mobiliar. Wahrscheinlich versuchte er, Chrysanders Wohnung in Uppsala nachzustellen, denn Kauppi fühlte sich in London nicht wohl. Er war ein Lappe von ungefähr sechzehn Jahren, kurz und rundlich, mit flachem Gesicht, der nur selten sprach und nie fragte; Chrysander schätzte dies sehr. Vor fünf Jahren hatte er Kauppi gefunden, ein herrenloses Kind auf einem Hügel bei Jukkasjärvi, den der Professor erklomm auf der Suche nach den Geheimnissen der nordischen Fauna und Flora. Er hatte das Kind zur Seite geschoben, was es sich leise fauchend gefallen ließ, und unter ihm jenes Moos entdeckt, das er später Chrysandria taufte. Beide hatte er nach Süden gebracht und behalten, den lappischen Knaben und das lappische Moos, und während der Erste soeben einen englischen Teetisch aus seinem Blickfeld zu entfernen suchte, lebte das Zweite, flach hingeduckt auf einen Granitstein, unter einem Glassturz in Chrysanders Arbeitszimmer und zeigte sich keineswegs beeindruckt von der Reise nach London. Das Moos bedurfte keiner Erde und kaum eines Tropfen Wassers, muckste sich nicht und wünschte weder Paarung noch Luft, und in den nunmehr fünf Jahren, da es seinem Herrn für jeden wissenschaftlichen Vergleich als Bezugspunkt diente, hatte es sich nicht einen einzigen Zoll vorgewagt auf den noch unbewachsenen Grund.
Kauppi verwahrte den Schlüssel zum Arbeitszimmer. Kauppi bewachte das Moos. Auch Kauppi war genügsam. Wenn er Möbel rückte, bis alles die rechte Ordnung hatte, so konnte sein Herr diesen Wunsch gut verstehen.
Simon Chrysander war der Sohn des Pfarrers von Söderfors in Dalarna, das älteste Kind von sechs lebenden und sechs toten Geschwistern. Er hatte selbst Pfarrer werden sollen in Söderfors. Stattdessen wurde er Professor in Uppsala und ging nicht mehr zur Kirche. Wieder blickte er aus dem Fenster. Nie klarte es auf. Jedes Metall lief an in dem rötlichen Dunst, Kofferschließen, Knöpfe, Sezierbesteck, alles sah aus wie Bronze. Dicht lag der Nebel über der Broad Street, über Männern, Frauen, Kindern, Kutschen, Hunden, Bettlern und allerlei Unrat in den Gossen, über einem entlaufenen Pferd, das in einen Laden drängte, über einem Greis, der gestürzt war und nicht mehr aufstand, über einer Sänfte ohne Träger, schräg in den Schlamm gerammt, als solle sie dort Wurzeln schlagen. Es wurde schon dunkel. Es war nie hell gewesen. Chrysander graute es vor dem Gresham College und ihn graute auch sonst. Die Welt war groß. Der Arten waren viele. Kaum reichte eine Lebenszeit hin, dies alles recht zu sortieren. Schon dreimal hatte Chrysander heute das Moos aufgedeckt, um sich an seiner Verlässlichkeit zu freuen. Er spürte Kauppis Hand an seinem Rockschoß. Kauppi roch, wenn die Furcht zum Professor kam. Chrysander scheuchte ihn fort. Er schloss die Fensterläden und griff nach Ogilbys Stadtplan von London.
Als er das Haus verließ, war Nacht. Er hatte Kauppi zu Bett geschickt und die Tür von außen verriegelt, denn er wollte nicht, dass Kauppi nach ihm suchen kam, wie er es in Uppsala manchmal tat. Nicht immer hielten Riegel den Lappen zurück; aber Chrysander wollte ihm doch wenigstens den Ausbruch erschweren.
Er ging zu Fuß, die Kapuze über den Hut und das halbe Gesicht gezogen, den Degen griffbereit und einen Dolch im Ärmel. Er bezahlte einen Jungen, der ihm leuchtete, vorbei am Church Market und bis Walbrook. Dort kaufte ihm Chrysander das Licht ab und setzte seinen Weg alleine fort.
Er wusste, was er brauchte, aber er wusste nicht, wo es war. Ogilbys Tafeln hatten ihm wenig Aufschluss gegeben über Londons verworrene Anatomie. Zunächst ging er viel zu nah ans Wasser. Er geriet in die Docks von Dowgate und musste umkehren. Er stolperte über einen Betrunkenen oder Toten, bog ein in die Thames Street und folgte ihr hartnäckig nach Westen. Ein verirrtes Schwein stieß ihn bittend mit der Schnauze an. Chrysander unternahm diese Wanderung nicht gern, aber es war an der Zeit und es half nichts, sich zu sträuben. Chrysander war kein Moos. Er bedauerte dies täglich, doch ändern konnte er es nicht.
Er nahm Witterung auf von der Stadt. Es war nicht einfach. London hatte sein Aroma verloren in den Flammen von ’66 und die neuen Häuser wiesen ihm nicht den Weg. Sie waren schnell gebaut und oft schon rissig. Chrysander passierte Kirchhöfe ohne Kirchen, öde Flecken voller Unrat und Morast. Hier und da standen noch Brandruinen, in denen man Waren feilbot oder fertigte, in denen man schlief, wenn man kein Obdach hatte, in denen man gewiss auch mordete, wenn man ein Mörder war und ein Opfer fand in der Nacht. Chrysander tastete nach seinem Dolch. Er ging zügig voran, Blackfriars vor sich, dahinter Alsatia, dahinter der linke Rand von John Ogilbys ungenügendem Stadtplan.
Schließlich wurde er fündig, oder man fand ihn, noch bevor er das kartographierte Gebiet verließ. Ein Jüngling, der an einer Hauswand lehnte, abgerissen, aber im Putz. «Huren, Sir?» Chrysander nickte.
Er folgte dem Schlepper in eine Seitengasse, in einen Durchgang, in einen dunklen Hof. Man hielt dort Kaninchen und Geflügel. Die Ställe stanken. Die Hühner glucksten und scharrten leise im Schlaf. In der Haustür hingen gefilzte Vorhänge, der Zubringer schob Chrysander hindurch, dann machte er kehrt und bezog wieder Posten auf der Straße. Chrysander schlug die Kapuze zurück. Die Wirtin des Lokals nahm den neuen Gast in Empfang. Sie knickste, ließ ihn ein, ließ ihn stehen. Chrysander kannte hier nicht die Gepflogenheiten. Er blieb allein in einem düsteren Gang, Steinboden, an der Wand zwei Stühle, über der Tür eine Feuerglocke, daneben ein Gemälde von Susanna im Bade. Zaghaft folgte er dem Licht und fand den Salon.
Es war ein bescheidenes Unternehmen, sparsam mit Mobiliar und Mädchen. Chrysander verharrte schweigend in der Tür. Auf einem Sofa saß eine Frau und stickte. Ein Alter befühlte vergnügt zwei kleine Mädchen, eines auf jedem Knie. Chrysander atmete auf. Dies waren Huren, die schlichteste Spezies in der Klasse der Res Humanae, hilfreich gegen das Grauen und einfach zu fassen in einer Formel aus Körper und Geld.
Ein weiteres Mädchen, schon besser gerundet, plauderte an einem Tisch mit drei jungen Herren in vollem Staat. Sie blickten auf, als Chrysander eintrat, grinsten, grüßten nicht, sprachen weiter. Sie sprachen vom Theater. Eben kamen sie aus der Vorstellung. Kleopatra hatten sie gesehen, davor einen Prolog, Scherze, wie dumm der König sei. Der König war in seiner Loge gewesen. Der König hatte gelacht. Darüber lachte nun die Hure, artig und etwas matt. Die drei Männer lasen ihr den Prolog vor, den sie gedruckt besaßen, mit einer Rollenverteilung, die keinen Sinn ergab. Huren, Theater, das Gerede vom König, draußen die Hühnerställe und hier die Männer im Galakleid, saphirblau, lavendel, maron, Brokat über Brokat über Satin über ellenweise Brüsseler Spitzen, die längst nicht mehr weiß waren nach einem nebeligen Tag: Auch dies ergab wenig Sinn für Chrysander. Die Ratio für Hurenhaus, so trostreich in Uppsala, hatte hier nicht die beste Kontur. Chrysander wollte kehrtmachen. Doch ein Mädchen wollte er auch. Dem Ding war Genüge zu tun. Andernfalls schrie es Alarm. Wenn das Ding pochte, konnte Chrysander nicht denken, und er musste denken, tagaus, tagein, denn das war sein Beruf. Er wich einen Schritt zurück. Er tat einen Schritt nach vorne. Die jungen Herren blickten auf.
«Gott zum Gruße, Hochwürden», rief der Saphirblaue.
«Beau jeu, Sir», kicherte der in Maron.
«Er soll Maudlin haben», bestimmte der Lavendelfarbene. «Maudlin wird Hochwürden gefallen.»
Die Hure am Tisch lachte. Die Hure auf dem Sofa schlug ein Kreuz und lachte dann auch. Der Alte mit den Kindern hob an zu einer Frage, besann sich aber und schwieg.
«Ich wähle selbst, Sir», sagte Chrysander, «und ich habe kein geistliches Amt.»
Die Herren ließen sich nicht beirren. Sie riefen «Mutter Bushell», das war die Wirtin, sie erschien, bekam ein Trinkgeld und nickte. Ob Maudlin umgekleidet sei? Jawohl. Ob Maudlin bereit sei? Zu Diensten in ihrer Kammer.
Chrysander wollte Maudlin nicht. Er mochte keine Huren mit Namen. Daheim in Uppsala, bei den Mädchen von Svartbäcken, war es Brauch, dass der Kunde sie taufte. Hesperis, Clematis, Nymphäa – viele gaben ihnen die Namen, die im nahe gelegenen Botanischen Garten auf den Schildern standen. Chrysander tat das nie. Er mochte keine Huren mit Namen. Gespräche mit anderen Kunden mochte er indes noch weniger. Er wollte die Ware, ihren Preis entrichten, und fort.
«Wo ist das Mädchen», fragte Chrysander, «und wie und bei wem wird bezahlt?»
Die Wirtin bestand auf Vorkasse. Sie bat Chrysander, Umhang und Degen abzulegen, dann schickte sie ihn die Treppe hinauf, erster Stock, erste Tür rechts. «A votre plaisir», rief der Herr in Lavendel und lachte. Chrysander verließ den Salon.
Er fand die Tür und klopfte. Niemand gab Antwort. Er wartete. Dann trat er ein. Eine Kammer, karg möbliert, ein Schrank, ein Stuhl, ein Bett. Die Wand zur Rechten war aus Brettern genagelt und reichte nicht ganz bis zur Decke. Sie trennte den Raum vom nächsten Verschlag, die zweckdienliche Bauart eines Stalles. Vor dem Fenster hing eine grüne Gardine, über dem Bett ein Stich aus dem Aretin, zwei nackte Leiber, vielleicht auch drei, kunstvoll ineinander verschlungen. Neben dem Schrank stand ein Mädchen vor einem kleinen Spiegel. Als Chrysander eintrat, wandte sie sich um, stutzte, dann lächelte sie.
Sie war schmal und hoch gewachsen, um einiges größer als ihr Gast. Rotes Haar, unberührt von der Brennschere, fiel über ihre Schultern und fast bis hinab auf die Taille. Rotblond waren auch Brauen und Wimpern. Den Kohlestift kannte sie nicht. Nur die Lippen waren geschminkt, ungeschickt hingepinseltes Rouge, ein greller Fleck in ihrem blassen Gesicht. Sie war übersät mit Sommersprossen, helle Tupfen auf noch hellerer Haut, im Gesicht, auf Händen und Armen, im Ausschnitt ihres Kleides. Schlüsselbeine und Brustbein zeichneten sich ab, kaum Busen. Im Mieder steckte ein zerknittertes Stoffblumensträußchen, Goldlack und Maßliebchen. Sie trug ein schlichtes weißes Unterkleid, knapp, vielleicht einfach zu klein, und blassgelbe Pantoffeln aus zerschlissenem Atlas. Ihre Füße waren groß, auch die Hände, lange getupfte Finger, ineinander verschränkt vor einem flachen, kaum geschnürten Bauch. Sie war nicht sehr jung; über zwanzig. An eine Hure gemahnte nichts. Sie war schön und sonderbar, wie ein Einhorn, ein Meerweib, ein Wappentier. Ungerufen kam ein Gedanke in Chrysanders Kopf, kauf sie frei, nimm sie mit. Er erschrak. Das Mädchen legte den Kopf schief. Dann faltete sich ihr langer Körper in einem tiefen Knicks.
«Maudlin?»
«Ja, lieber Herr.»
Sie sprach rau, ein wenig heiser, ein wenig gedehnt; der Tonfall einer ländlichen Gegend. Nur langsam richtete sie sich auf. Sie rückte den Stuhl für Chrysander zurecht, wischte den Sitz mit dem Rockzipfel ab und bat ihn Platz zu nehmen, mit einer etwas zu großartigen Geste, als spiele ein Kind die Prinzessin. Sie kicherte, nur kurz, fast ein Schluckauf. Dann lächelte sie. Chrysander wollte sich nicht setzen. Er wollte fort und nicht fort. Etwas war nicht in der Ordnung. Maudlin kräuselte die Nase, als röche sie Chrysanders Zweifel. Feuerrot waren ihre Lippen, weiß die Zähne, wie bei einer Dame von Stand. Sie betrachtete ihren Gast aufmerksam. Sie tat nicht ihre Hurenpflicht. Sie schaute und blinzelte, als traue sie nicht ihren Augen. Chrysander setzte sich doch. Seine Kunst der Bestimmung versagte. Animalia. Viviparos. Oviparos. Vegetabilia. Cruciferae. Saxifraga. Zoophythes. Chrysanders Denkmaschine spuckte Begriffe aus, schnell und furchtsam, wie ein Gebet in Not. Er hob den Kopf und blickte in Maudlins helle Augen.
Irgendwann trat sie einen Schritt zurück. Sie senkte den Kopf und nestelte an ihren Maßliebchen.
«Aus Cheshire komm ich, lieber Herr. Schweinemagd bin ich gewesen. Ich war im Stall und draußen sind alle an der Pest gestorben, sie haben mich draußen nicht wollen, Mama und Vater und das Dorf, weil Ihr seht ja, ich bin zu rot, und der Teufel hat mich scheckig gespuckt, und zu lang bin ich, das Stalltor ging viel zu weit runter, ich haute mir den Kopf und alle lachten, und dann hat sie die Pest geholt, oh ja, das weiß der Herr, nicht wahr, der liebe kluge Herr weiß um die Pest in Cheshire?»
Chrysander schauderte. Quadrupedes. Amphibia. Eine Hure, die biographisch vorgeht, sah sein System nicht vor.
«Cheshire ist grün», fuhr Maudlin fort, «grüne Wiesen, sonst nicht arg viel, aber fein grün in Cheshire, vor der Pest, guter Herr, und nach der Pest auch, und nun, nun, einer nahm mich mit, hat mich malen wollen als die heilige Magdalene, aber froschnackt, der Schelm, und nun, nun bin ich hier, lieber Herr, das bin ich, eine femme de plaisir, und Ihr?»
Maudlin bückte sich. Ihr Haar streifte Chrysanders Hände. Sie verharrte reglos. Sie wiederholte: «Und Ihr?»
«Schweden», murmelte Chrysander.
«Was?»
«Aus Schweden, mein Kind. Ein anderes Land.»
«Grün?»
«Im Frühling.»
«Und habt Ihr Heimweh, lieber Herr?»
Chrysander gab keine Antwort. Maudlin ging in die Hocke und hielt sich mit beiden Händen an seinen Knien fest. Chrysander betrachtete ihr Brustbein, die Linie ihres Halses. Er wollte sie haben, jetzt und weiterhin. Er würde davonlaufen müssen. Das Mädchen richtete Schaden an in seinem Gehirn.
«Seid Ihr Priester?», fragte Maudlin. «Sprecht Ihr mich los?»
«Nein. Du musst zur Kirche gehen.»
«Was seid Ihr sonst?»
«Arzt und Professor.»
«Professor? Was ist das?»
«Einer, der ordnet. Der die Ordnung sucht.»
«Ihr ordnet, guter Herr? Was?»
«Alles. Die Dinge der Welt. Es sind viele. Es ist eine Frage der Zeit.»
Chrysander hörte sich sprechen wie einen Fremden. Hatten sie ihm eine Hexe gegeben? Gab es solche? Eine noch offene Frage in der Klasse der Res Humanae.
«Ordnung», sagte Maudlin, den Kopf gesenkt, «das ist schön. Das erstaunt mich. Das ist wie Friede. Könnt Ihr das? Wo lerntet Ihr das? Ordnet Ihr alles? Auch Leute?»
«Auch diese.» Chrysanders Zunge war schwer. Maudlin streichelte abwesend sein linkes Bein. Schatten huschten über ihr Gesicht, Kummer, Freude, Furcht, Verwirrung oder nur eine nervöse Verschiebung der Muskeln.
«Verzeiht, Sir. Ich bin neu hier. Ich muss das Spiel noch lernen.»
Chrysander versuchte aufzustehen. Maudlin hielt ihn fest, ein harter Griff um beide Knie, als packe sie ein Ferkel im Stall.
«Wie geht das?», fragte sie laut, fast befehlend. «Wie macht Ihr das, ein jedes Ding recht zu ordnen?»
«Ich sehe es an, ich bestimme es, dann gebe ich ihm einen Namen.» Es klang einfach, wenn Chrysander das sagte. Er wagte nun, sich zurückzulehnen. Er wagte einen langen Blick auf Maudlins unfassbares Haar.
«Tut es mit mir, guter Herr.»
«Dich bestimmen?»
«Nun ja!»
Chrysander verzog den Mund. Es wurde fast ein Lächeln. Maudlin neigte den Kopf, tief und tiefer, und berührte mit den Lippen seine Hand.
«Es ist schwer», sagte Maudlin, «nicht wahr?»
«Es ist einfach», sagte Chrysander.
«Glaubt Ihr?»
«Oh ja!»
«So tut es denn!»
«Du bist ein Mädchen, Maudlin», begann Chrysander, «du bist ein gutes Mädchen», ergänzte er verblüfft, «das einen Wirrkopf hat und den rechten Weg versäumte.»
Maudlin überlegte. Dann sagte sie leise, «nennt mich nicht so, nennt mich Lucy.»
Chrysander blickte sie fragend an. Ein Name war ihm mehr als genug.
«Lucy heiß ich. Maudlin war meine Schwester. Sie war bös und starb und ich stahl ihren Namen. Aber Lucy ist meiner. Mein eigener. Ich ...»
Sie stockte. Sie verschränkte ihre Finger sorgfältig über Chrysanders Knie und legte den Kopf in den Nacken.
«Ich mag Euch. Lieber Herr. Nennt mich Lucy.»
«Ich muss dich nicht nennen, mein Kind.»
«Das ist schade.»
Mit Entsetzen beobachtete Chrysander seine Hand. Sie hob sich und öffnete sich, als wolle sie etwas nehmen. Chrysander hatte der Hand nicht befohlen, dies zu tun. Sie öffnete sich weiter und bewegte sich weiter und dann geriet sie in das Haar des Mädchens, das Maudlin heißen sollte und Lucy hieß, das sich anbot als Hure und sich nicht wie eine Hure benahm. Ihr Haar war weich und fein. Chrysander hielt eine Strähne und hob sie hoch, nah vor seine Augen, als sei das ein Farnwedel, ein Faden der Seidenraupe, die Mähne eines fremdartigen Tieres.
«Man könnte nachsehen», murmelte Chrysander, «wie du zu bestimmen bist, Kind, unter deinen Kleidern.»
«Ihr seid galant, Sir?» Lucy rückte beklommen ab.
«Ich möchte», sagte Chrysander, «nicht sprechen.»
«Nicht?»
«Ich weiß es nicht. Ich dachte, ich käme als Kunde. Du bist nicht zu Hause in deinem Gewerbe.»
«Mögt Ihr Huren?»
«Manchmal.»
«Warum?»
«Weil sie schweigen. Weil sie nicht fragen.»
«Oh», sagte Lucy. «Oh, lieber Herr. Das ist schlimm.»
Langsam rückte sie weiter ab und langsam stand sie auf. Noch immer hielt Chrysander eine Strähne ihres Haares und Lucy ließ ihn gewähren, sie stand krumm und wartete geduldig, bis ihr Gast genug hatte von dieser Betastung.
Er hatte nicht genug. Dennoch ließ er die Strähne los. Lucy blickte ihn an. Etwas wandelte sich in ihrer Miene, unbestimmt, unbestimmbar, sie wischte über ihre Augen, als verscheuche sie einen Traum.
«Es ist nicht gut hier», sagte sie leise. «Ich komme mit Euch. Nicht jetzt. Ich lass Euch fort, und dann komme ich in Euer Haus, wann Ihr wollt, wann Ihr befehlt. Ich will auch schweigen. Ich will auch tun, was die Huren tun. Ich will auch bei Euch bleiben, wenn Euch das gefällt. Es ist nicht gut hier. Glaubt mir, lieber Herr. Geht jetzt fort. Dann ruft mich. Dann komm ich.»
Chrysander schwieg. Auch er war aufgestanden. Er stand nahe vor Lucy. Sie neigte höflich den Kopf, um ihren Gast nicht allzu sehr zu überragen. Chrysander spürte ihren Atem und roch ihre Haut.