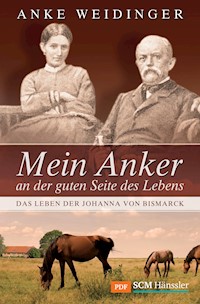Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SCM Hänssler
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 1665: Die Pest wütet in England. Als sie das Dorf Eyam in Derbyshire erreicht, entschließen sich die Bewohner zu einem großen Opfer: Sie begeben sich freiwillig in Quarantäne, um die Ausbreitung der Krankheit aufzuhalten. Der Arzt Gordon Tulliver macht sich auf, um den Menschen in seinem Heimatdorf zu helfen und lässt seine junge Frau Amy in der Obhut der Cravens auf Morton Hall. Während Gordon um das Leben der Menschen von Eyam kämpft, muss Amy erkennen, dass sie in eine Falle geraten ist. Bald schon wird das Warten auf Gordons Rückkehr zur Zerreißprobe …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses E-Book darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer,E-Reader) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der dasE-Book selbst, im von uns autorisierten E-Book Shop, gekauft hat.Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der vonuns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor unddem Verlagswesen.
ISBN 978-3-7751-7145-8 (E-Book)ISBN 978-3-7751-5334-8 (lieferbare Buchausgabe)
Datenkonvertierung E-Book:Satz & Medien Wieser, Stolberg
© der deutschen Ausgabe 2013SCM Hänssler im SCM-Verlag GmbH & Co. KG · 71088 HolzgerlingenInternet: www.scm-haenssler.de; E-Mail: [email protected]
Die Bibelverse sind, wenn nicht anders angegeben, folgender Ausgabe entnommen:Lutherbibel, revidierter Text 1984, durchgesehene Ausgabe in neuer Rechtschreibung 2006,© 1999 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Umschlaggestaltung: OHA Werbeagentur GmbH, Grabs, Schweiz;www.oha-werbeagentur.chTitelbild: 123rf.comSatz: Satz & Medien Wieser, Stolberg
Greater Love hath no man than thisthat a man lay down his life for his friends.1John 15,13
Meinem Wolfgang gewidmet
Inhalt
1 | Ein nächtlicher Reiter
2 | Die Ankunft
3 | Ellen
4 | Ein unerwarteter Besuch
5 | Die stillste Nacht
6 | Auf Morton Hall
7 | Ein Schrei in der Nacht
8 | Stimmen im Wind
9 | Ein unerwarteter Retter
10 | Im Cucklet Delph
11 | Ein Schritt vom Wege
12 | Das Rehkitz
13 | Die Blutvergiftung
14 | Was am Bachufer geschah
15 | Der Tanz
16 | Das kostbarste Geschenk
17 | Susanna
18 | Ebenfalls Susanna
19 | Ein verhängnisvoller Sturz
20 | Die Falle schließt sich
21 | Eine Resolution
22 | Ohne Erinnerung
23 | »Es steht schlimm um Eyam.«
24 | Neue Hoffnung
25 | Auf der Riley-Farm
26 | Mrs Talbot
27 | Eine denkwürdige Begegnung
28 | »Sie ist tot.«
29 | Ein wenig Regen tut nicht weh
30 | Zwei einsame Liebende
31 | Im dunkelsten Tal
32 | Wie süß duftet die Nacht …
33 | In die falschen Hände gelangt
34 | Zwischen Vater und Sohn
35 | In der Stille danach
36 | Ein gehaltenes Versprechen
37 | Die Kerze im Fenster
Epilog
Nachwort
Dank
Anmerkungen
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
1Ein nächtlicher Reiter
»Doktor, Doktor, machen Sie auf! Öffnen Sie die Tür, ich habe dringende Nachricht! Es geht um Leben und Tod! Machen Sie auf, ich flehe Sie an, machen Sie schnell auf!«
Das Rütteln an der Tür weckte die Magd und schließlich auch den Hausherrn, der im Dunkeln die Treppe hinuntereilte, einen Finger verärgert auf die Lippen gelegt.
»Ich komme ja schon! Emma, geh wieder schlafen, es braucht dich keiner im Nachtkleid zu sehen um diese Stunde, schon gar kein Fremder. Geh, geh nur. Ja, ja«, rief er, zur Tür gewandt, »sogleich! Du weckst mir noch meine Frau mit deinem wilden Gerüttel, gleich wird die Tür mitsamt deiner selbst ins Haus fallen. Was gibt’s?«
Der Bote, der auf der Türschwelle stand, sein vor Erschöpfung bebendes Pferd am Zügel, hielt ihm wortlos die Papierrolle entgegen. »Lassen Sie mich wissen, ob ich Antwort bringen soll oder ob Sie gleich selbst hinreiten wollen. Ist Botschaft aus Eyam, Sir, und keine gute. Nur machen Sie schnell, ich muss noch bis Matlock. Ich kann nicht warten.«
Hastig den Inhalt des Schreibens überfliegend, warf der Hausherr dem Boten zuerst eine Münze, dann einen flüchtigen Blick zu und nickte kurz. »Reite weiter. Ich weiß, was ich zu tun habe. Gott sei mit dir!«
Das Geldstück unter sein Gewand schiebend, schwang sich der Bote im selben Augenblick auf sein Pferd, riss den Zügel herum und stieß ihm die Hacken in die Flanken. »Und auch mit Ihnen, Doktor!«, rief er über die Schulter zurück. »Hey!«
So stob er davon, eine Wolke von Staub und einen sorgenvoll die Stirn runzelnden Doktor auf der Türschwelle hinter sich lassend. Noch einmal las dieser die Nachricht durch und schüttelte verärgert den Kopf. Sodann stürzte er hastig ins Haus und die Treppe hinauf, immer zwei Stufen auf einmal nehmend, die Papierrolle fest in der Hand.
»Wer war das?«, rief ihm eine Stimme von oben entgegen. »Was ist geschehen? Braucht man dich auf Morton Hall?«
Eine junge Frau im weißen Nachtkleid, das sich über dem Bauch wölbte, unter welchem deutlich sichtbar ein Kind heranwuchs, kam ihm auf dem Treppenabsatz entgegen, die blauen Augen fragend auf ihn gerichtet. »Was ist es, Liebster, sprich – kann man helfen? Ist es …«
»Es sind schlechte Nachrichten aus Eyam, Amy. Traurige Nachrichten. Dieser Brief ist von Reverend Stanley. Er bittet mich um Hilfe – viele unserer Freunde und Nachbarn sind krank; deinen Bruder Robert haben sie gestern begraben müssen –, oh, Amy, Liebstes, es tut mir so leid! Stanley schreibt, Robert sei bereits das siebte Todesopfer gewesen, seit Anfang September der Schneidergesell Viccars, der bei den Hadfields zur Miete wohnte und Alexander im Geschäft zur Hand ging, daran starb. Es muss irgendetwas mit diesem Bündel Tuch zu tun haben, das man Hadfield aus London schickte. George Viccars packte es aus, ließ es am Feuer trocknen, da es feucht war und unangenehm roch – eine Woche später war er tot. Du weißt, dass in London schon Hunderte auf dieselbe grauenvolle Weise starben. Jetzt …« Die Stimme versagte ihm, als er den Schmerz in den Augen seiner Frau sah, und er nahm ihre kalten Hände in die seinen und küsste sie. »Amy! Du musst jetzt sehr stark sein. Ich muss nach Eyam – noch heute Nacht.«
»Nein!«
Amy warf sich schluchzend in seine Arme. »Das darfst du nicht! Oh Gott, das darfst du nicht! Wenn es – oh, Gordon, wenn es die Pest ist, dann …«
Der Doktor strich seiner Frau beruhigend über das hellblonde Haar, das in losen Locken bis auf die Hüften hinabfiel. »Schscht… nicht, Amy, nicht. Nicht weinen jetzt. Du darfst dich nicht so aufregen, denk an das Kind – und denk an deine Eltern, an deine Geschwister. Sie brauchen Hilfe, Amy, dringend! Ich muss gehen – ich muss, verstehst du?«
Die Augen voller Tränen, die Lippen fest aufeinandergepresst, nickte sie kaum merklich. Er zog sie rasch in seine Arme, küsste sie und murmelte, das Gesicht in ihrem Haar vergraben: »Glaube mir, liebste Amy, ich weiß, wie groß deine Angst ist, und es schmerzt mich, dich in dieser schweren Zeit allein lassen zu müssen. Gerade jetzt, wo das Kind unterwegs ist und sicher auch bald kommen wird. Aber die Menschen von Eyam haben auch Angst, große Angst, Amy. Sie brauchen Hilfe! Deshalb bittet man mich, nach Eyam zu kommen. Sofort. Reverend Stanley schreibt, die Menschen seien so verzweifelt und er und Mompesson könnten nicht überall zur selben Zeit sein. Sie versuchen alles, um ihnen so gut es geht zu helfen, aber was sie wirklich brauchen, ist ein Arzt – und deshalb … deshalb rufen sie nun mich, Amy. Ich muss ihnen helfen, es ist meine Pflicht – das verstehst du doch, nicht wahr, Amy?«
Furcht spiegelte sich in Amys Augen, und sie hielt schweigend seinem Blick stand, während sie versuchte, das, was sie gehört hatte, zu verstehen.
Sie dachte an ihren Bruder, an die anderen Geschwister und an ihre armen Eltern. Was, wenn sie alle starben – wenn sie keinen von ihnen jemals wiedersehen sollte?
Langsam, kaum merklich, begann sie zu nicken. Auch wenn alles in ihr schrie, er solle nicht fortgehen, wusste sie doch, dass es sinnlos war, sich dagegen zu wehren. Sie musste ihn gehen lassen, schon um ihrer Familien willen. Wenn einer den Menschen von Eyam helfen konnte, dann war es Gordon. Er war ein guter Arzt und sie war sehr stolz auf ihn. Doch …
Gordon strich ihr liebevoll das Haar aus der Stirn und küsste sie. »Gut. Ich wusste, dass du mich verstehst. Und nun komm, leg dich wieder ins Bett, dass du nicht noch kälter wirst.«
Damit ließ er sie los und ging an ihr vorbei in die Schlafstube, wo er in fieberhafter Eile ein paar Sachen und Kleidung zusammenzusuchen begann.
Amy stand einen Moment lang wie betäubt da, dann folgte sie ihm. Sprachlos vor Schreck und Furcht wankte sie zum Bett hinüber und ließ sich mit letzter Kraft darauf nieder. Ihr war schwindelig, und ihr Rücken schmerzte, doch sie mochte nichts sagen, wollte sich nicht beklagen. Jetzt war nicht die Zeit, an sich selbst zu denken. Stattdessen faltete sie die Hände im Schoß und beobachtete stumm ihren Mann, wie er sein Bündel zusammenpackte.
Es waren kaum mehr als zwanzig Meilen bis Eyam, doch die Straßen waren beschwerlich und führten zum Teil durch raues, unwegsames Gelände. Das Pferd, das sie besaßen, war zwar kräftig und gutmütig, doch es war nicht besonders schnell. Amy fragte sich, ob Gordon nicht lieber Lord Craven um ein schnelleres Pferd bitten sollte. Andererseits würde der ihn vielleicht gar nicht gehen lassen; Gordon war der Leibarzt der Cravens von Morton Hall und hatte sich bei ihrer Ankunft hier verpflichtet, stets für die Familie verfügbar zu sein.
Ob er in diesem Augenblick an seine Pflichten den Herrschaften gegenüber dachte, schien ihr allerdings fraglich.
Aber war nicht das Leben der anderen im Augenblick viel wichtiger?
Gordon kniete vor ihr nieder, nahm ihre Hand und begann, sie sanft zu streicheln. »Weine nicht, mein Liebes. Weine nicht um mich! Ich komme wieder. Das verspreche ich dir. Und unser Kind … nun, das wird schon auch ohne mich gesund zur Welt kommen. Du kannst nach Fanny schicken lassen, sie hat alle Kinder auf Morton Hall auf die Welt gebracht. Es ist ja noch Zeit – vielleicht bin ich sogar schon zurück, bevor es so weit ist. Sei ohne Sorge, Amy. Ich komme wieder!«
Unter Tränen nickend, fühlte sie, wie seine Hand sich von der ihren löste, und sie wusste, dass es Zeit war. Unfähig, den Kopf zu heben und den geliebten Mann anzusehen, biss sie sich auf die Lippen und versuchte, ein Schluchzen zu unterdrücken. Sie musste für ihn tapfer sein, so wie er um das Leben der anderen willen tapfer war.
»Leb wohl, meine Amy, und fürchte dich nicht. Gott, unser Herr, wird nicht zulassen, dass dir ein Leid geschieht. Und denke an mich, wenn du singst: Ich höre dein Lied, wo immer ich bin!«
Nachdem er sie noch ein letztes Mal geküsst und ihr ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet hatte, ging er hinaus.
Amy blieb stumm und reglos auf dem Bett sitzen und starrte auf ihre Hände hinab, bis sie unten die Haustür ins Schloss fallen hörte. Dann aber warf sie sich in die Kissen und weinte bitterlich.
Die Nacht war pechschwarz, der Mond von Wolken verhüllt. Gordon Tulliver konnte den Weg kaum erkennen, auf dem er ritt, er musste seinem Gefühl und dem Wegweiser vertrauen, den er etwa vor einer Stunde passiert hatte. Er wusste auch um die Schwäche seines Pferdes, wusste, dass er es nicht zu sehr antreiben durfte, wenn es die ganze Strecke über durchhalten sollte. Er konnte keine Rast einlegen, die wenigen Wirtshäuser, die auf dem Weg lagen, hatten alle geschlossen. Er wusste auch nicht, in welchem er um diese Zeit ein frisches Pferd bekommen würde. Hinzu kam, dass man nicht allen Wirten vertrauen konnte, es waren unsichere Zeiten, nicht nur der Pest wegen, die seit Monaten schon die Menschen in England in Angst und Schrecken versetzte. Der Schwarze Tod, wie man die Krankheit nannte, war vom europäischen Festland nach England gekommen, wie, das wusste im Augenblick keiner genau zu sagen. Innerhalb weniger Wochen waren in London Tausende und Abertausende von Menschen gestorben, und jetzt, da die Zahl der Toten dort allmählich zurückzugehen schien, hatte die Seuche Derbyshire erreicht.
Gordon war seit seiner Heirat im vergangenen Jahr nicht mehr in seinem Heimatdorf gewesen und der Gedanke, womöglich keinen Einzigen seiner Verwandten lebend dort anzutreffen, jagte ihm eine solche Angst in die Glieder, dass er bald schon alle Vorsätze vergaß und dem treuen Pferd seine Stiefel in die Seiten stieß.
»Heya, lauf, lauf, mein Guter! Lauf!«
Der Hengst wieherte unwillig, legte jedoch an Geschwindigkeit zu und galoppierte mit bebenden Nüstern die steile Straße hinauf, um scharfe Kurven und immer noch steiler bergan. Das dumpfe Geräusch der beschlagenen Hufe auf Splitt und feinem Geröll war neben dem Keuchen des Tieres das Einzige, was Gordon über seinem angstvoll klopfenden Herzen hörte. Geschwind, geschwind, schien der Hufschlag zu sagen, geschwind, geschwind!
»Du schaffst es, mein Guter«, murmelte Gordon leise und wusste nicht, ob er sein Pferd oder sich selbst meinte. Er hielt den Kopf zum Schutz vor dem eisigen Oktoberwind tief gesenkt, sein Atem bildete kleine Wölkchen vor seinem Gesicht, so schneidend kalt war die Luft. Es schien früh Winter werden zu wollen in diesem Jahr.
Hatte Amy genügend Holz im Haus? Würde sie es warm genug haben?
»Du schaffst es! Bald sind wir da, dann können wir ihnen helfen … bald sind wir da.«
Und Gott schütze meine Amy. Gott schütze meine Amy …
Ein Schäfer, der bei seinen Schafen die Wacht hielt, sah den Reiter vorbeihetzen und rieb sich nachdenklich das Kinn. Dann schüttelte er den Kopf und suchte mit den Augen den Horizont ab. Obwohl es bald dämmern musste, schien es gerade jetzt besonders dunkel. Von der Sonne war noch immer nichts zu sehen, nicht der schmalste Lichtstreif war im Osten zu erkennen, sosehr der alte Mann seine Augen auch anstrengte. Im Westen aber hatten sich dichte Wolken zu einer schwarzen Wand zusammengezogen. Auch der kalte Wind, der schon am Tag zuvor über die Ebene gefegt war, hatte jetzt zugenommen, und der Schäfer pfiff nach seinem Hund, dass dieser ein paar abseits liegende Mutterschafe und deren Lämmer zusammentrieb. Wenn ein Unwetter kam, war Eile geboten. Zur Schutzhütte war es zu weit, die lag unten im Tal, und im Dunkeln ließen sich die Schafe ungern treiben, vor allem dann nicht, wenn sie Angst hatten.
Der Hund kam, stellte sich vor seinen Herrn und sah ihn erwartungsvoll an. Sobald er seinen Befehl erhalten hatte, machte er sich sofort wieder auf den Weg, während der Schäfer am selben Platz zurückblieb, die Augen unbeweglich nach Westen gerichtet. In der Ferne hörte er eine Nachtigall schlagen, sie schien ohne Angst. Eine andere gab Antwort, dann war alles wieder still.
Irgendetwas lag in der Luft, etwas, das dem alten Schäfer weit mehr Unbehagen bereitete als das bevorstehende Unwetter. Doch er konnte nicht sagen, was es war – so wandte er den Blick noch einmal nachdenklich in die Richtung, in die der Reiter verschwunden war.
Amy erwachte in der Morgendämmerung von einem rasenden Schmerz, der wie eine Welle zuerst ihren Rücken, dann den ganzen Unterleib erfasste und sie, als er endlich nachließ, keuchend nach Luft schnappen ließ. Mit schmerzverzerrtem Gesicht versuchte sie, sich aufzurichten, tastete im Halbdunkel nach der Kerze, doch ihre Hand zitterte und das Streichholz fiel ihr zu Boden, ehe es brannte.
Wimmernd nahm sie ein neues Streichholz, versuchte es abermals, doch da überfiel sie schon die nächste Schmerzwelle, weniger stark als die vorige zwar, aber schlimm genug, dass Amy stöhnend in die Kissen zurücksank.
War es schon so weit? Konnte das die Geburt ihres Kindes sein, das sich mit diesen Schmerzen ankündigte? Ihre Mutter hatte nie darüber gesprochen, obwohl sie nach Amy noch fünf weitere Kinder bekommen hatte, in regelmäßigen Abständen von zwei Jahren. Amy war es immer so vorgekommen, als seien die Babys ihrer Mutter ganz von allein auf die Welt gekommen, während sie selbst beim Wasserholen gewesen war oder dem Vater etwas zu essen in seine Werkstatt gebracht hatte.
Nie hatte sie ihre Mutter bei einer Geburt schreien oder wimmern hören, und jedes Mal war sie noch am selben Tag aufgestanden, um wie gewohnt ihrer Arbeit im Haus nachzugehen und die Familie zu versorgen. Deshalb hatte Amy immer geglaubt, dass eine Geburt nichts Außergewöhnliches sei; nichts, weswegen man sich fürchten musste. Ganz gewiss hatte sie nicht mit diesen Schmerzen gerechnet.
Wenn doch nur Gordon bei ihr wäre! Er würde wissen, was zu tun war, er bräuchte nicht einmal Fanny zu rufen, und sie könnten ihr erstes Kind allein zur Welt bringen, ohne dass ein Fremder dabei sein musste. Wie sehr hatte sie sich gewünscht, dass es so sein würde! Hätten die Wehen doch nur sechs Stunden früher eingesetzt, wäre er noch hier gewesen. Aber jetzt – jetzt war es zu spät …
Ich brauche Hilfe, dachte Amy, während sie die Zähne aufs Neue zusammenbiss und mit fest geschlossenen Augen wartete, bis der Schmerz nachließ. Aber wie sollte sie Fanny erreichen? Sie wusste ja nicht einmal, wie sie es anstellen sollte, Emma herbeizurufen, die jung und unerfahren war und vielleicht größere Angst haben würde als sie selbst. Amy bezweifelte, dass sie ihr eine große Hilfe sein würde.
»Emma!«, rief sie, doch ihre Stimme war so schwach, dass kaum mehr als ein ersticktes Krächzen herauskam. Ihr Körper krümmte sich erneut vor Schmerzen und sie musste in das Laken beißen, um nicht laut zu schreien.
Als der Schmerz für eine kurze Zeit nachließ, schüttelte Amy den Kopf. Dann rief sie noch einmal nach Emma, so laut sie konnte: »Emma!« Und noch einmal: »Em-ma!!!«
Gleich darauf stürzte das verschreckte Mädchen ins Zimmer, eine flackernde Kerze in der Hand. »Was ist, Mrs Tulliver, warum schreien Sie so? Geht es denn schon los? Soll ich nach Fanny schicken, Madam?«
Amy konnte nur nicken, presste die Lippen fest aufeinander und sank zurück auf ihr Bett, das Gesicht aschfahl. »Schnell, Emma. Schnell …«
»Lassen Sie mich noch ein wenig Holz nachlegen, Madam, das Feuer ist fast verlöscht …«
»Geh jetzt, Emma! Geh!!!«
Erschrocken fuhr Emma zusammen. Dann aber nahm sie ihre Röcke auf, die Kerze in die Hand und lief so schnell sie konnte aus dem Zimmer und die Treppe hinab.
Wie durch einen dichten Nebel hörte Amy, wie Emma die Treppe hinunterlief und kurz darauf zum zweiten Mal in dieser Nacht die Haustür ins Schloss fiel, dann war alles still und schwarz um sie herum.
Ich laufe. Ich laufe einen Hang hinab, mein Kleid weht im Wind. Es ist Frühling, ich kann das frische Gras unter meinen nackten Füßen spüren und den Wind in meinem Gesicht. Die Blumen, sie duften so süß. Ich sauge ihren Geruch auf, bis ich wie trunken davon bin. Leicht, so leicht fühle ich mich, ich fliege schon fast.
»Amy!«, höre ich meinen Geliebten rufen. »Amy! Ich bin hier!«
Ich wende meinen Kopf, sehe ihn am anderen Ende der Wiese stehen, wie er seinen Hut schwenkt. Sein Gesicht vermag ich nicht zu erkennen, es ist zu weit entfernt, doch da höre ich ihn wieder rufen, höre die Freude in seiner Stimme: »Amy, Liebes, ich bin wieder da! Ich bin wieder da, hörst du mich?«
Ja, ich höre ihn. Ich sehe ihn, er ist es wirklich! Und ich halte im Lauf, winke freudig, die Blumen, die ich eben pflückte, in meiner rechten Hand. Dann ändere ich die Richtung, laufe auf der anderen Seite den Hügel hinab, immer schneller, immer schneller …
»Gordon!«, rufe ich. »Gordon, hier bin ich! Ich komme! Fang mich auf, ich komme!«
Und er breitet seine Arme aus, wirft den Hut zu Boden, um mich aufzufangen. Nur wenige Meter noch, gleich bin ich da …
»Amy, Amy, gib acht, du bist zu schnell! Amy!«
Ich stolpere, stürze zu Boden, rolle den Abhang hinunter, über Steine und Felsen hinweg. Ein brennender Schmerz durchfährt meinen Körper, ich schreie …
»Gordon! Gordon!!!!«
Das zarte und zugleich erstaunlich durchdringende Geschrei eines neugeborenen Kindes weckte Amy jäh aus ihrem Traum. Sie schlug verwirrt die Augen auf, blinzelte. Fanny war da, und Emma, und im Schein der Kerze sah Amy zum ersten Mal ihr Kind.
»Sie haben es geschafft, Madam. Es ist ein Mädchen. Sehen Sie, es ist ganz gesund. Und wunderschön.«
Die Hebamme, eine dicke, rothaarige Frau mit einem freundlichen Gesicht, hielt ihr lächelnd das winzig kleine, rosige Baby entgegen, das in ein reines Laken gehüllt worden war. »Da sehen Sie, Ihre Tochter.«
Amy streckte beide Hände nach dem kleinen Bündel aus und presste es gleich darauf glückstrahlend an sich. Tränen rannen ihr das Gesicht hinab, sie war zu schwach, um zu sprechen. In Gedanken aber sprach sie ein stilles Dankgebet und nannte ihr erstes Kind Grace – Gnade.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
2Die Ankunft
Im fahlen Morgenlicht, das sich mühsam seinen Weg durch den dichten Nebel zu brechen suchte, lag das Dorf Eyam still da und sah so friedlich aus, dass es Gordon Tulliver, der oben auf einem Hügelkamm sein Pferd angehalten hatte, das Herz brach, als er an das Leid dachte, das ihn hinter den Türen der Häuser erwartete. Häuser, die sich in der unter ihm liegenden Straße eng aneinanderdrängten, eines so winzig und gelblichgrau wie das andere. Er kannte diese Häuser – mit grauen Schindeln gedeckte Hütten: ein kleiner Vorgarten, in dem Gemüse gezogen und die Wäsche getrocknet wurde, ein kleines Fleckchen hinter dem Haus, wo die Kinder spielten. Das war alles, was die meisten an Grund besaßen. Nur diejenigen, die eine gute Bleimine ihr Eigen nennen konnten, hatten sich am Bach entlang auf der anderen Seite der Kirche größere, schönere Häuser gebaut; die meisten aber besaßen gerade so viel, dass es zum Leben reichte. Die Bauern wohnten weiter außerhalb, aber auch ihre Häuser waren oft nicht viel größer und keinesfalls besser als die der Minenbesitzer und Handwerker im Dorf: die Küche, die der Familie zugleich als Wohnraum diente, die Schlafstube, der Stall, notdürftig getrennt durch eine Bretterwand. Die meisten Leute konnten ihr Vieh nebenan schnaufen, scharren und kauen hören, während sie selbst ihre Suppe löffelten. Oben auf dem Dachboden gab es dann noch einen – je nach Beschaffenheit des Daches – meist zugigen Raum, in dem die Kinder schliefen und an Regentagen auch spielten, das war alles. Es musste genügen. Manche Leute verdienten sich ein wenig Geld hinzu, indem sie Mieter aufnahmen, so wie Alexander Hadfield es getan hatte, als er den jungen Schneidergesellen George Viccars bei sich aufnahm – natürlich auch, damit dieser ihm half, denn sein Geschäft ging gut und er schaffte es kaum allein, die Aufträge zu bewältigen. – So hatte das Schicksal seinen Lauf genommen. Innerhalb weniger Wochen waren fast alle direkten Nachbarn der Familie gestorben, dazu Edward Cooper, Mary Hadfields Sohn aus ihrer ersten Ehe.
Gordon fröstelte es, als er an die Symptome der Beulenpest dachte, die er eingehend studiert hatte, um im Falle einer Epidemie vorbereitet zu sein. Das plötzlich auftretende, hohe Fieber, die Übelkeit, unerträgliche Gliederschmerzen, und schließlich die charakteristischen eitrigen Beulen. Dass er sein Wissen nun hier in Amys und seinem Heimatdorf unter Beweis stellen musste, wäre ihm nie in den Sinn gekommen. Er hatte nicht damit gerechnet, Eyam überhaupt so schnell wiederzusehen – und nun stand er hier auf diesem Hügel und getraute sich kaum hinabzureiten.
Noch einmal schloss er die Augen, lauschte innig dem leisen Geplätscher des Baches, der hinter ihm verlief; dann trieb er seinen Hengst energisch an und trabte den Hang hinunter ins Dorf.
Eine Frau saß vor einem der Häuschen nahe der Kirche auf einem umgestülpten Holzfass und stillte ihr Baby. Sie hatte den Kopf tief gesenkt und wirkte auf den ersten Blick vollkommen entspannt; erst beim Näherkommen bemerkte Gordon, dass etwas nicht stimmte. Das Baby bewegte sich nicht und die schmalen Schultern der Mutter hoben und senkten sich im leisen Schluchzen.
»Elizabeth?«, rief Gordon und brachte sein Pferd neben der Kate zum Stehen. »Bist du das?«
Die Frau hob den Kopf nur so weit, dass Gordon ihr Gesicht erkennen konnte. Es war tatsächlich Elizabeth, eine gute Freundin seiner Schwiegermutter und die Frau von George Ragge. Das Baby in ihren Armen war, wie Gordon befürchtet hatte, tot.
»Was tust du da, Elizabeth? Wo ist George?«
Elizabeth starrte ihn nur mit leerem Blick an, ohne zu antworten. Ihre Augen schienen durch ihn hindurchzusehen, was sein Unbehagen noch verstärkte. Hatte sie durch den Verlust des Kindes auch den Verstand verloren? Und wo war George?
»Elizabeth.«
Er stieg vom Pferd, band den Zügel lose an die Holzstange vor dem Haus und kniete sich neben Elizabeth nieder. Behutsam nahm er ihre Hand, die sich zu seiner Überraschung ohne Widerstand vom Körper des toten Kindes löste, und neigte den Kopf, um ihr ins Gesicht zu sehen. Doch sie reagierte auch jetzt nicht, sondern starrte nur weiterhin schweigend ins Leere, als ob sie den Besucher überhaupt nicht wahrnahm.
Gordon nahm ihr das Kind aus dem Arm und trug es ins Haus, obwohl er keine Ahnung hatte, warum er das tat. Sollte er George wider Erwarten lebend und gesund in der Kate vorfinden, würde er ihn fragen, was sie tun sollten. Am besten wäre es sicher, das Kleine sofort zu begraben. Es trug keine äußeren Anzeichen der Pest am Körper, aber sicherheitshalber würde er es noch einmal genauer untersuchen, damit er wusste, woran es gestorben war.
Jonathan, der zehnjährige Sohn der beiden, hatte jedenfalls auf der Liste der Toten gestanden, die der Reverend mitgeschickt hatte, insofern konnte er davon ausgehen, dass es sich bei dem Mädchen ebenfalls um die Pest handelte. Gordon hoffte allerdings, dass man wenigstens den Jungen inzwischen begraben hatte und dass er ihn nicht verwesend und stinkend in der Stube vorfinden würde.
Von dem toten Sohn war Gott sei Dank keine Spur im Inneren der dunklen Kate zu sehen, wohl aber konnte Gordon das schwere Atmen eines Mannes vernehmen, das aus der Ecke hinter dem Kamin kam. Ein übelkeiterregend süßlicher Geruch, ähnlich dem von verfaulten Äpfeln, erfüllte den niedrigen, dunklen Raum und Gordon musste das tote Kind auf dem Tisch ablegen, um sich sein Tuch vor die Nase zu halten.
»George!«
Ein schwaches Murmeln war die Antwort; Gordon eilte zum Bett, das Tuch fest vor die Nase pressend. George Ragge – oder das, was von dem ehemals starken und gut aussehenden Besitzer einer Bleimine übrig geblieben war – lag dort, ein schreckliches Bild des Jammers und des Elends, und wimmerte vor Schmerzen. Sein Körper war nur halb bekleidet und übersät mit großen, hässlichen schwarzen Beulen, aus denen der stinkende Eiter lief.
Gordon blieb wie angewurzelt stehen. Er hatte viel über die Symptome der Pest gelesen und auch eindrucksvolle Bilder gesehen, die Ärzte und andere kluge Menschen gezeichnet hatten, nachdem sie Patienten behandelt hatten, aber auf diesen Anblick war er nicht vorbereitet.
»Oh mein Gott«, murmelte er. »Herr Jesus, hilf!«
Gordon hatte den Schwerkranken gewaschen, sein von Schweiß und Wundflüssigkeit durchtränktes Kissen gegen ein sauberes getauscht, das er in Elizabeths Wäscheschrank gefunden hatte, und ihm etwas Wasser eingeflößt. Dann ging er, da ihm nichts anderes zu tun übrig blieb, wieder nach draußen, um nach Elizabeth zu sehen.
Unter der Tür stieß er mit einer Frau zusammen, die einen Korb mit frisch gewaschenen, in der Sonne getrockneten Leinentüchern trug. Sie war noch sehr jung, höchstens Anfang zwanzig, sehr schlank und hatte eine Fülle goldblonder Locken unter ihrer Haube, was ihr Gesicht noch kleiner wirken ließ. Sie war sehr hübsch – Gordon musste beim Anblick ihrer Locken an Amy denken und lächelte. Es war Catharine Mompesson, die Frau des anglikanischen Reverends, bei dem er wohnen sollte.
»Herr Doktor«, sagte sie und knickste. »Wir haben Sie schon erwartet. Sie erinnern sich vielleicht nicht an mich – ich bin Catharine Mompesson, die Frau von Reverend Mompesson. Ich komme, um frisches Leinen zu bringen – wie geht es ihm?«
Damit deutete sie in das Innere der Hütte. Gordon wunderte sich, dass sie Elizabeth nicht zu beachten schien, die noch immer reglos auf dem Holztrog saß. Ob Mrs Mompesson nicht wusste, dass die Kleine gestorben war?
Gordon nahm den Hut ab und verbeugte sich. »Sehr erfreut, Madam. Natürlich erinnere ich mich an Sie – so lange ist es noch nicht her, dass Ihr Gatte mich und meine Amy traute. Ich freue mich, bei Ihnen wohnen zu dürfen und hoffe, Ihre Gastfreundschaft nicht über Gebühr beanspruchen zu müssen. – George geht es übrigens nicht gut. Ich habe ihn notdürftig versorgt – ein paar Tropfen Wasser, mehr konnte ich ihm nicht seine Kehle geben. Wie lange liegt er schon mit diesen Symptomen?«
»Seit Sonntag. Sie hatten ihren Jonathan gerade beerdigt, da fing’s bei Master George an. Erst das Fieber, dann der Ausschlag … Was ist mit deiner Kleinen, Elizabeth, geht es ihr heute etwas besser?«, wandte sie sich an Mrs Ragge. Anscheinend glaubte Mrs Mompesson, dass das kleine Mädchen im Haus in der Wiege lag und schlief.
Gordon wartete gespannt, ob sie der armen Elizabeth eine Antwort entlocken konnte, doch die schüttelte nur stumm den Kopf.
»Ich habe sie ihr abgenommen«, flüsterte Gordon, »und sie hier auf den Tisch gelegt. Die Kleine ist tot – die arme Elizabeth hat versucht, sie zu stillen, als lebte sie noch …«
Mrs Mompesson hob erschrocken eine Hand zum Mund, dann ließ sie sie wieder sinken und schüttelte traurig den Kopf. »Ich hätte es wissen müssen. – Verzeih mir, Liebes«, sagte sie, an Elizabeth gewandt, und legte ihr kurz eine Hand auf die Schulter. »Der Doktor und ich werden uns um sie kümmern. Bleib du nur hier draußen an der frischen Luft – oder geh ein Stück spazieren, das wird dir guttun. Wir lassen dich holen, wenn er nach dir fragt.«
Mechanisch erhob Elizabeth sich von ihrem unbequemen Sitz und ging langsam die Straße hinauf in Richtung Kirche. Gleich darauf war sie hinter der Mauer, die den Kirchhof einfriedete, verschwunden.
»Sie geht zu Jonathans Grab«, bemerkte Mrs Mompesson und seufzte. »Jeden Tag geht sie hin. Sie war immer so stolz auf Jonathan, weil er so groß und so stark war. Er hätte eines Tages die Mine des Vaters übernehmen und für seine Familie sorgen können. So war es jedenfalls gedacht. Aber dann …«
Sie zuckte mit den Achseln und ging durch die offen stehende Tür ins Haus. Mit einem kurzen Blick auf das Baby sagte sie: »Dann ist alles anders gekommen. Nun, ich werde auf dem Rückweg Marshall Howe Bescheid sagen, dass er kommt, um sie abzuholen. Hier«, sie reichte Gordon ein Fläschchen, das sie unter dem Leinen hervorgezogen hatte, »geben Sie davon etwas auf seine Wunden, wenn er es zulässt. Es ist eine milde Essiglösung mit ein wenig Lavendel. Das reinigt und nimmt zugleich etwas von dem üblen Geruch.«
Gordon nickte knapp, nahm das Fläschchen und ging zurück zu der Ragge'schen Bettstelle, wo Elizabeths Mann noch ebenso dalag wie vorhin. Er schien jetzt zu schlafen und Gordon nutzte das, um ihm die Essiglösung in die offenen Geschwüre zu träufeln. Nützen würde es nichts, aber Mrs Mompesson hatte recht: Es roch angenehm und ließ George leidlich frischer wirken. Und falls es so sein sollte, dass Elizabeth sich noch heute von ihm verabschieden musste – was zu befürchten stand, da George von seiner Krankheit schon sehr geschwächt war und selbst im Schlaf nur unregelmäßig atmete –, dann konnte sie wenigstens an seinem Totenbett stehen, ohne das Bewusstsein zu verlieren.
Allzu nahe durfte sie ihm ohnehin nicht kommen, um eine Ansteckung zu vermeiden. Wenn ein Patient gerade gestorben war, war die Infektionsgefahr am größten, deswegen hatten auch der Totengräber und der Pfarrer die gefährlichsten Aufgaben in der Gemeinde.
Und der Arzt natürlich, dachte Gordon, als er sich aufrichtete, das Fläschchen wieder verschloss und es Mrs Mompesson zurückgab, die hinter ihm stand.
Sie nahm das Fläschchen und legte es in den Korb zurück, in dem jetzt nur noch eine alte, in schwarzes Leder gebundene Bibel und ein getrocknetes Bündel Lavendel lagen.
»Ich habe die Tücher in den Schrank gelegt und ein frisches Handtuch neben den Wassertrog. Und ein Stück Seife. Sie kann sich damit die Hände waschen, wenn sie kommt. Hygiene ist jetzt das oberste Gebot, aber das wissen Sie ja besser als jeder andere.«
Sie trat aus dem Haus und drehte sich lächelnd zu dem Arzt um, der sich ducken musste, um sich nicht den Kopf an dem niedrigen Türbalken zu stoßen. »Und für Sie habe ich auch ein Stück Seife, Doktor – bei uns zu Hause, wo mein Mann schon mit einem guten Frühstück auf Sie wartet.«
Noch am selben Abend setzte Gordon Tulliver sich an den kleinen Tisch in der Kammer, die man im Rektorat für ihn hergerichtet hatte, und schrieb beim flackernden Schein einer Kerze an seine Frau.
Meine liebste Amy,
nach einem langen, aber gut verlaufenen Ritt ohne besondere Zwischenfälle erreichte ich heute in den frühen Morgenstunden Eyam. Das Bild, das sich mir bot, kann ich und will ich Dir auch nicht in Worten beschreiben. Es ist so furchtbar, dass ich nur froh bin, dass Du es nicht sehen kannst.
Bitte frage unbedingt auf Morton Hall nach, ob man uns Morphium nach Eyam schicken kann. Oder, noch besser, auf Chatsworth. Der gute Graf wird uns sicher gerne helfen, bei Lord Craven bin ich mir nicht sicher …
Einige Menschen haben das Dorf verlassen, unter ihnen die Witwe Bradshaw und die Sheldons. Auch meine Eltern fand ich nicht in ihrem Haus, sie sind zu Vaters Bruder nach Sheffield gegangen. Wäre ich ein paar Tage eher hier gewesen, ich hätte sie noch gesehen. Nun hoffe ich, dass es ihnen dort gut geht und wir sie dann wiedersehen, wenn alles ausgestanden ist und das Dorf wieder zu neuem Leben erwacht. Um Deinetwillen aber bin ich froh, Amy, dass Du nicht mit mir gekommen bist und überhaupt bin ich sehr dankbar, dass wir damals nach Bakewell gingen, wenngleich wir natürlich nicht ahnen konnten, was diesem Dorf bevorsteht. So aber weiß ich zumindest Dich dort in Sicherheit, bis ich wiederkomme.
Wie Du siehst, wohne ich nicht bei Reverend Stanley, sondern bei dem neuen Reverend und seiner Frau, Mrs Catharine Mompesson. Es ergab sich so, weil Stanley sagte, es sei in seiner kleinen Kate zu eng und im Rektorat stünden so viele Kammern leer; außerdem wäre William Mompesson durchaus froh, in diesen Zeiten einen zweiten Mann im Hause zu haben. Er ist immerzu besorgt um seine Frau und die Kinder, die er am liebsten alle davongeschickt hätte, aber Mrs Mompesson will davon nichts hören. Sie ist eine bewundernswerte Frau, die sich nicht nur um das Haus, die Kinder und alles hier kümmert, sondern auch noch von früh bis spät im Dorf unterwegs ist, um anderen zu helfen.
Mompesson selbst ist ein guter Mann und von rechtem Glauben, er hat es nur noch schwer, die alten Puritaner – zu denen ich mich selbst, wie du weißt, ja immer noch zähle, auch wenn ich zugeben muss, dass mir diese Dinge nicht mehr so wichtig sind, wie sie mir einst schienen; das verdanke ich unter anderem Dir, meine süße Nachtigall – auf seine Seite zu ziehen. Sie haben all die Jahre immer nur auf Reverend Stanley gehört, wer kann ihnen ihr Misstrauen gegenüber allem Neuen nun vorwerfen? Was aber schlimmer ist – und in diesem Punkt bin ich ganz eins mit Master Mompesson –: Die Leute halten so fest an ihrem Aberglauben, dass es zum Verzweifeln ist. Die Pest sei Gottes Strafe dafür, dass man Reverend Stanley seines Amtes enthoben habe, sagen die Alten, und viele glauben ihnen. – Mompesson selbst nimmt das mit bewundernswerter Gelassenheit. Er sagt, er sei hier, um für die Menschen zu sorgen, nicht, um sich um ihr Gerede zu kümmern. Ja, ich bewundere ihn und als Mensch gefällt er mir jeden Tag besser. Ich bin froh, hier zu sein und helfen zu können.
Sei ohne Sorge, meine Amy, und vergiss nicht, dass ich Dich über alles liebe.
Dein Dir ergebener Ehemann Gordon S. Tulliver
[Zum Inhaltsverzeichnis]
3Ellen
Das kleine Mädchen saß zusammengekauert in einer Ecke auf dem Heuboden der Hancocks, einer Familie mit sieben Kindern, die etwas außerhalb des Dorfes wohnte. Da ihre Mütter miteinander befreundet waren und George Ragge sie oft mit hinausgenommen hatte, wenn er etwas mit John Hancock zu bereden hatte oder ihm etwas beim Haus oder auf den Feldern zu reparieren half, war sie bereitwillig mitgegangen, als die Hancocks sie nach der Beerdigung ihres Bruders mitgenommen hatten. Hier draußen glaubte man sicher zu sein vor der Seuche, die sich immer rascher im Dorf auszubreiten schien, und vor deren schrecklichen Gerüchen, Geräuschen und Bildern vor allem die Kinder sich fürchteten.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!