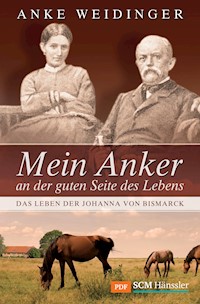Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SCM Hänssler
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Mit dem Tod ihres Mannes bricht für Elizabeth eine Welt zusammen. Sehnsucht nach ihrer englischen Heimat keimt auf. Zusammen mit ihren Töchtern zieht sie aus Deutschland nach Warwickshire. Als der charmante William Bentley in Elizabeths Leben tritt, machen die Mädchen ihm das Leben schwer. Plötzlich taucht William unter und die aufkeimende Liebe wird auf eine harte Probe gestellt. In ihrem Gefühlschaos erfährt Elizabeth Hilfe, die bis in die Ewigkeit reicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 675
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anke Weidinger
Insel der Zuflucht
Bestell-Nr. 394.987
ISBN 978-3-7751-5115-3 (E-Book)
ISBN 978-3-7751- 4987-7 (Buchausgabe)
© Copyright der deutschen Ausgabe 2009 bySCM Hänssler im SCM-Verlag GmbH & Co. KG ⋅ 71088 Holzgerlingen
Internet: www.scm-haenssler.de
E-Mail: [email protected]
Umschlaggestaltung: oha werbeagentur gmbh, Grabs, Schweiz; www.oha-werbeagentur.ch
Titelbild: istockphoto.de, shutterstock.de
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Die Bibelverse sind folgender Ausgabe entnommen:
Neues Leben. Die Bibel, © Copyright der deutschen Ausgabe 2002 und2006 by SCM Hänssler, D-71087 Holzgerlingen.
Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei bleiben.Aber am größten ist die Liebe.1. Korinther 13,13
TEIL I
1
Ein eisiger Nordostwind fegte über die schiefergraue, aufgewühlte See hinweg, gelbliche Schaumkronen tanzten auf den beinahe zackenartigen Wellen, die gegen den weißen Bug des Fährschiffes schlugen, das sich auf dem Weg von Newcastle nach Esbjerg befand. Weit und breit war kein Mensch an Deck zu sehen; die meisten Passagiere saßen im Café und vertrieben sich die verbleibende Zeit bis zur Ankunft bei Kaffee und Kuchen oder versuchten, ihre letzten britischen Pfund noch im Duty-free-Shop loszuwerden. Einige sehr aufgeregte und vorsichtige Menschen standen auch bereits seit acht Uhr morgens mit gepackten Koffern in den Gängen, wo sie spielenden Kindern und geschäftig hin und her eilendem Schiffspersonal ein Ärgernis waren.
Mit einem leisen Knarren wurde eine der schweren Metalltüren aufgedrückt, und eine zierliche, in einen schwarzen Wintermantel mit Webpelzkragen gekleidete Frau trat durch den schmalen Spalt hinaus auf das von Gischt und Regen nasse Deck. Nachdem sie sich noch einmal umgesehen hatte, setzte sie vorsichtig einen Fuß vor den anderen, dann, als ihre hochhackigen Stiefel auf dem rutschigen Holzboden Halt gefunden hatten, ging sie zielstrebig auf die vordere Spitze des Decks zu und lehnte sich an die weißlackierten Metallsprossen der Reling.
Elizabeth Webster schluckte hart und schloss die Augen, in denen Tränen brannten, die sie glaubte schon alle geweint zu haben, und die dennoch immer weiterflossen, wie ein endloser Strom, der ins Nirgendwo führte. Ins Nirgendwo schien sie auch diese Reise zu führen – das leere Haus, in das sie mit ihren beiden Töchtern zurückkehren würde, war kein Zuhause mehr. Sie hatte ihr Zuhause an dem Tag verloren, an dem Patrick gestorben war.
»Dort, wo du bist, da bin ich zu Hause«, hatte sie gesagt, als er damals vorgeschlagen hatte, ihre gemeinsame Heimat in Mittelengland zu verlassen, um in Deutschland ein neues Leben zu beginnen. Sie öffnete die Augen und starrte mit leerem Blick auf das wogende Meer hinaus. Damals – wie unendlich lange das zurücklag! Fast zehn Jahre. Zehn Jahre, in denen sie – auch wenn nicht immer alles so verlaufen war, wie sie es sich erhofft hatte – glücklich und unbeschwert gewesen war, in dem sicheren Gefühl, dass alles gut war, solange sie nur einander hatten. Ein trügerisches Gefühl von Sicherheit, wie sich herausstellen sollte. Denn als ihr Schwager Paul an jenem Freitag im Januar anrief, um ihr mitzuteilen, dass ihr Mann bei einem Autounfall ums Leben gekommen war, konnte sie regelrecht spüren, wie ihr der Boden unter den Füßen weggezogen wurde.
»Elizabeth, Liebes, ich muss dir etwas Schlimmes sagen. Etwas sehr, sehr Schlimmes ... Es ist wegen Patrick ... Er hat einen Unfall gehabt ...«
NEIN!!!
Ein gellender Schrei durchdrang den Raum, in dem sie sich befand, das Telefon fest an ihre Brust gepresst, doch niemand außer ihr konnte diesen Schrei hören: Es war der Schrei ihres Herzens, das nicht glauben konnte, nicht verstehen wollte, was ihr Schwager ihr zu sagen versuchte. Und während Pauls tiefe, beruhigende Stimme wie durch einen dicken, wabernden Nebel an ihr Ohr drang, schienen sich unsichtbare Mauern immer enger um ihr Herz zu schließen, bis sie kaum noch atmen konnte ...
Als Mary, ihre Älteste, sie schließlich fand, hatte sie schon seit zwei Stunden regungslos auf den kalten, harten Fliesen im Flur gelegen, das Telefon neben sich, ihre Hände an der Brust, als könnte sie den furchtbaren Schmerz, den sie darin fühlte, irgendwie wegschieben. Doch in dem Moment, als sie in das erschreckte, verängstigte Gesicht ihrer Tochter sah, wusste sie, dass dieser Schmerz nie vergehen würde, und – schlimmer noch – dass sie ihn auch ihren Kindern würde zufügen müssen, indem sie ihnen vom Tod ihres Vaters erzählte.
Es war das Schwerste, was sie jemals hatte tun müssen.
Ein heftiges Schluchzen erschütterte Elizabeths Körper, als sie sich daran erinnerte, wie Mary und Vicky sie angesehen hatten, wie viel Verzweiflung in ihren Blicken gelegen hatte, und wie viel Hoffnung. Hoffnung darauf, dass ihre Mutter ihnen helfen würde, das Unfassbare zu begreifen, das Unerträgliche zu ertragen, irgendwie. Doch sie hatte ihnen nicht helfen können. Alles, was sie an diesem Tag hatte tun können, war, sie zu halten und mit ihnen zu weinen. Stunde um Stunde, bis tief in die Nacht. Vicky war als Erste vor Erschöpfung eingeschlafen, und während Elizabeth sie instinktiv nach oben in ihr Schlafzimmer gebracht hatte, hatte Mary es irgendwie noch fertiggebracht, Tee zu kochen, den sie schweigend getrunken hatten, bevor sie Vicky nach oben gefolgt waren. Wie eine Fuchsfamilie in ihrem Bau waren sie schließlich, eng aneinandergekuschelt im Ehebett, eingeschlafen.
Elizabeth lehnte sich langsam zurück, während ihre Hände das Metallgeländer umschlossen hielten, und schüttelte den Kopf, als wollte sie die Gedanken abwehren, die einmal mehr von ihr Besitz zu ergreifen drohten. Doch die Woge der Trauer erfasste sie so stark, so mächtig, dass sie schon im nächsten Moment von immer heftigeren Schluchzern geschüttelt wurde. Ihr ganzer Körper bebte, und sie warf sich nach vorne zurück, klammerte sich an die Stangen, als wären sie das Letzte, was sie noch halten könnte, und begann gleichzeitig, sie zu erklimmen. Stange um Stange kletterte sie empor. Sie öffnete die Augen.
Schau nicht ins Wasser. Schau nicht hinunter.
Doch der Drang, sich über das Geländer zu beugen und in die Tiefe hinabzusehen, wurde immer stärker, bis sie schließlich ihre vor Kälte und Anspannung steif gewordenen Finger von der obersten Sprosse löste, einen nach dem anderen. Langsam versuchte sie, sich aufzurichten. Sie schwankte und schloss die Augen wieder. Oh Gott, nein. Ich kann nicht. Ich kann es nicht.
Sie legte ihre rechte Hand wieder an das Geländer, lehnte sich an die oberste, breitere Sprosse, atmete mehrere Male tief ein und aus, bevor sie die Augen abermals öffnete, sich zwang, hinunterzusehen.
Du lässt dich einfach fallen, einfach hinunterfallen, und dann – dann wird dieses Meer dich verschlucken, du bist einfach verschwunden, so schnell kann dich keiner finden, es geht ganz leicht ... nur noch ein kleines Stück, ein winzig kleines Stück nach vorne ... und dann, wenn alles vorbei ist, wenn du die Kälte nicht mehr spürst, dann wachst du auf und – und bist da. Dort, wo Patrick ist – dort, wo dein Herz ist ...
»Beth, Beth, nein! Was machst du da? Beth! Komm da herunter! Beth – Beth!!!«
Elizabeth wirbelte herum, als sie die Stimme ihrer Schwester hörte, und blieb dabei mit ihrem Schuh an einer der Metallsprossen hängen. Sie verlor das Gleichgewicht und stürzte mit dem Gesicht zuvorderst auf die harten Schiffsplanken, wo sie einen Moment reglos liegen blieb. Dann drehte sie den Kopf zur Seite und begann leise zu weinen.
Catherine kniete neben ihrer Schwester nieder. »Beth! Beth, bitte sag doch was. Bist du okay?«
Nein, ich bin nicht okay. Ich bin nicht da, wo ich sein wollte. Ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich sein will. Auf jeden Fall nicht hier, nicht auf diesem Schiff.
Dann war da auf einmal noch eine andere Stimme, eine fremde Männerstimme. Ein Offizier kam angelaufen und rief schon von Weitem: »Sind Sie okay, Miss?«
Er kniete ebenfalls neben Elizabeth auf dem Boden nieder und fühlte instinktiv nach ihrem Puls.
»Nein, alles okay«, murmelte er, wohl eher zu sich selbst. »Aber mein Gott, Sie zittern ja ganz fürchterlich. Ist Ihnen kalt – natürlich ist Ihnen kalt, was für eine Frage! Warten Sie, ich hole eine Decke ...«
Sekunden später kam er mit einer Wolldecke angerannt, die er fest um Elizabeths vor Schock und Kälte zitternden Körper wickelte. Vorsichtig hob er sie vom Boden auf und trug sie zu einem der Deckstühle, wo er sie sanft niederlegte.
»So, das ist besser ... Wie konnte das denn nur passieren? Soll ich einen Arzt holen?«
Elizabeth schüttelte stumm den Kopf und versuchte sich aufzurichten, aber ihr war seltsam schwindelig.
Catherine nahm ihre Hand, streichelte sie. »Es geht schon, Sir, vielen Dank«, sagte sie zu dem eifrig besorgten Offizier, der noch recht jung aussah und offensichtlich nicht wusste, wie er sich verhalten sollte. Es kam bestimmt auch nicht alle Tage vor, dass jemand fast über Bord ging. »Es war ein Unfall, Sir. Sie hat sich nur mit ihrem Schuh verfangen und dabei das Gleichgewicht verloren. Nicht wahr, Beth, so war es doch? Ich gehe am besten gleich eine Tasse Tee mit ihr trinken – oder einen starken Kaffee, was meinst du, Beth?«
Elizabeth nickte. Der Schreck über das, was sehr leicht hätte passieren können, saß ihr noch tief in den Gliedern. Wie hatte sie nur so dumm sein können?
Der Offizier bot an, ihnen eine Kanne Tee zu bringen, aber Catherine lehnte dankend ab. »Die Kinder meiner Schwester warten sowieso unten im Café auf uns, sie werden sich vielleicht schon Sorgen machen. Wir gehen gleich hinein, nicht wahr, Beth? Danke für Ihre Hilfe, Sir. Vielen Dank.«
Schließlich konnte sie den sichtlich mit der Situation überforderten Offizier davon überzeugen, dass sie wirklich keine weitere Hilfe benötigten. Er ließ die beiden Frauen allein, nahm sich jedoch vor, den Vorfall zu melden.
Als sie endlich ihre Sprache wiedergefunden hatte, berührte Elizabeth mit einer Hand leicht das Gesicht ihrer Schwester und murmelte: »Danke, Cathy ...«
Dann richtete sie sich vorsichtig auf und sah sich um. Kein Mensch war an Deck. Kein Wunder, es war ja auch bitterkalt, und zu allem Überfluss hatte es auch noch angefangen zu nieseln.
Nur Depressive und Lebensmüde gehen bei so einem Wetter nach draußen.
Catherine lächelte. »Keine Ursache, Beth. Ich bin ja froh, dass dir nichts passiert ist. Kannst du aufstehen? Ja? Gut, dann lass uns mal ins Café hinuntergehen und endlich diese Tasse Tee trinken, die du so dringend brauchst. Oder Kaffee, ganz wie du möchtest. Vicky und Mary warten dort auf dich, sie haben ihre Sachen gepackt – das Schiff legt ja auch schon bald an. Bist du sicher, dass du okay bist?«
Elizabeth nickte stumm, nahm dann die Hand ihrer Schwester und folgte ihr nach drinnen, den Kopf tief gesenkt. Sie fühlte sich so elend, so leer ... so vollkommen leer.
Wie soll ich das bloß jemals schaffen, wie soll es bloß weitergehen? Wie? Wie?
Sie wusste nicht, wie sie den Rest der Reise überstanden hatte. Glücklicherweise waren um diese Jahreszeit nicht allzu viele Leute von Dänemark nach Deutschland unterwegs, und weil es noch dazu ein Sonntag war, war die Autobahn relativ leer. Dennoch war Elizabeth froh, nicht selbst fahren zu müssen.
Ihre Schwester hatte sich sofort ins Flugzeug gesetzt und war zu ihnen gekommen, nachdem sie von Patricks Tod erfahren hatte, und war anschließend gemeinsam mit Elizabeth und den Mädchen nach Warwickshire zurückgefahren, wo am Freitag die Beerdigung stattgefunden hatte. Jetzt war Catherine O’Connor fest entschlossen, so lange zu bleiben, bis es den dreien besser ging – wenigstens ein bisschen.
»Wenn ich das Gefühl habe, dass ich sie einigermaßen guten Gewissens allein lassen kann, komme ich zurück, aber rechnet in den nächsten zwei Wochen nicht mit mir!«, hatte sie zu ihrem Ehemann Paul gesagt, als dieser sich von ihr verabschiedet hatte. Von ihren drei Kindern wohnte nur noch die vierzehnjährige Sarah zu Hause, die schon immer sehr selbstständig gewesen war und bestimmt gut für sich und ihren Vater sorgen konnte. Außerdem würden sich Freunde aus ihrer Kirchengemeinde während Catherines Abwesenheit um die beiden kümmern. Darum machte sich Catherine also keine Sorgen. Sehr viel größere Sorgen bereitete ihr der schlechte Gesundheitszustand ihrer jüngeren Schwester. Elizabeth, schon immer überaus zierlich, hatte in den vergangenen zwei Wochen mit Sicherheit mehr als fünf Pfund verloren, und ihr Kreislauf war seit ihrer Ankunft in England mehr als einmal zusammengebrochen.
Catherine wandte den Kopf zu ihrer Schwester, die tief zusammengesunken auf dem Beifahrersitz neben ihr saß und aussah, als sei sie schon wieder meilenweit weg. Wie viele Energiereserven brauchte ein so zarter, kleiner Körper wohl, um so etwas durchzustehen?
Das Wetter hatte sich nicht verändert, seit sie England verlassen hatten: derselbe graue, wolkenverhangene Himmel, keine Sonne, nasskalt, ungemütlich. Es entsprach genau der Stimmung im Wagen der kleinen Familie: Selbst Mary Ann, die sonst beinahe unaufhörlich reden konnte, hatte die meiste Zeit über geschwiegen. Als ihre Tante den schwarzen Escort auf den Hof fuhr und sie das verlassene Haus mit den heruntergelassenen Rollläden sahen, schlug sie die Hände vors Gesicht und weinte bitterlich.
Elizabeth schluckte schwer. Ihre Brust bebte schon wieder gefährlich, und sie musste sich zusammenreißen, um nicht haltlos zu weinen. Wenigstens um der Kinder willen wollte sie stark sein. Und musste sie stark sein. Musste einfach ... Sie war heilfroh, dass Catherine sie begleitete und in den nächsten Wochen bei ihnen bleiben würde, bis sie das Schlimmste überstanden hatten. Das Schlimmste. Was konnte noch schlimmer werden?
2
»So«, sagte Catherine und stellte den Motor ab. »Da wären wir ... Was soll ich tragen?«
»Bring ruhig erst mal deine eigenen Sachen ins Haus, Cathy, die Mädchen können mir ja helfen. Mary, setzt du dann gleich den Teekessel auf, bitte? Wir wollen es uns erst mal gemütlich machen. Oh, und Vicky, könntest du bitte überall die Heizungen aufdrehen? Das Haus wird ziemlich ausgekühlt sein, fürchte ich. Ich habe bei der Abreise nicht daran gedacht ...«
Wie an so vieles nicht, dachte sie mit einem Blick in den Kühlschrank, aus dem ihr ein unangenehm säuerlicher Geruch entgegenströmte. Sie nahm die angebrochene Milchtüte heraus und goss den Inhalt mit geschlossenen Augen und angehaltenem Atem in den Abfluss. Dann ging sie zurück in den Flur, nahm den Schlüssel von dem Haken neben der Haustür und holte die Post aus dem überfüllten Briefkasten. Sie warf nur einen flüchtigen Blick auf die Umschläge, bevor sie sie auf die Kommode im Flur legte: hauptsächlich Trauerkarten, ein paar Rechnungen und eine Paketbenachrichtigung. Darum konnte sie sich morgen kümmern, wenn die Kinder in der Schule waren.
Vicky, die ihre Sachen bereits nach oben gebracht hatte, kam die Treppe herunter. Ihr schulterlanges, glattes, rotblondes Haar war ganz zerzaust, und sie sah aus, als hätte sie gerade wieder geweint.
Elizabeth fuhr sich mit dem Handrücken über die Stirn. Wie viele Tränen würden sie noch weinen, wie lange würden sie den Verlust des Vaters und Ehemannes noch so schmerzhaft spüren wie jetzt – gerade hier in diesem Haus ... Würde dieser Schmerz jemals nachlassen, würden sie je darüber hinwegkommen? Sie – und die Kinder?
»Mama, kann ich Sina anrufen? Ich würde gerne noch mal hinfahren, wenn ich darf. Nur für eine Stunde oder so ... bis zum Abendessen bin ich wieder zurück.«
Im ersten Moment wollte Elizabeth Nein sagen, weil es schon bald dunkel wurde, und Sina Friedrichs ein wenig außerhalb wohnte. Doch dann nickte sie.
»Aber nimm bitte nicht das Fahrrad, geh lieber zu Fuß. Vielleicht kann Sina dir ja mit dem Hund entgegenkommen. Ich hole dich nachher mit dem Auto ab, okay?«
Vicky drückte ihrer Mutter einen flüchtigen Kuss auf die Wange. »Danke, Mama! Ich ruf Sina gleich an, ja?«
Schon war sie wieder verschwunden. Die Mädchen teilten sich im oberen Stockwerk einen Telefonanschluss, der auch eine eigene Nummer hatte. Das war Patricks Idee gewesen, und es hatte sich als eine sehr praktische Lösung herausgestellt – vor allem hatten er und Elizabeth nicht mehr mit ihren eigenen Telefonaten warten müssen, bis die beiden jungen Damen endlich mit ihren Dauergesprächen fertig gewesen waren. Erstaunlicherweise stritten die Mädchen sich auch selten untereinander um das Telefon, was aber größtenteils daran lag, dass Mary immer öfter auf den Computer zurückgriff und E-Mails schrieb oder im Chat war, anstatt zu telefonieren.
Jetzt kam sie mit einem Tablett aus der Küche, auf dem sich ein Becher Tee und ein Teller mit Keksen befand. Sie sah sehr blass und sehr müde aus, ihre Augen waren rot gerändert. »Ich gehe nach oben, wenn das okay ist ... kann ich bei Malin anrufen und ihr sagen, dass wir wieder da sind?«
»Du kannst auch gerne noch hingehen, Liebes. Vicky geht auch zu Sina. Ich hole euch dann beide so gegen sechs ab. Malins Haus liegt ja praktisch auf dem Weg zu Friedrichs ...«
Mary nickte. »Danke, Mama. Bin gleich weg, ja?«
Elizabeth schaute ihrer Ältesten nachdenklich hinterher. Die Fünfzehnjährige sah Catherine erstaunlich ähnlich: das kastanienbraune Haar mit nur einem leichten Hauch von Rot, das ihr bis weit über die Schultern fiel, die großen, ausdrucksvollen, haselnussbraunen Augen ... ja, sogar die leicht nach oben geschwungene Stupsnase hatte sie anscheinend von ihrer Tante geerbt; Elizabeths Nase war schmal und ganz gerade. Vicky hingegen war ihr Vater durch und durch, mit ihrem glatten rotblonden Haar, den blauen Augen und den vielen Sommersprossen. Nur die Gesichtszüge und die überaus grazile, fast zerbrechliche Figur hatte sie eindeutig von ihrer Mutter.
Im Moment sieht sie aus, als könne sie der Wind davontragen, dachte Elizabeth. Hoffentlich schafft Cathy es, sie in den nächsten Tagen ein bisschen aufzupäppeln.
Sie sah aus dem Fenster und bemerkte, wie sich ein paar Sonnenstrahlen langsam, aber sicher einen Weg aus der Wolkendecke bahnten. Im Vogelhaus draußen im Vorgarten saßen zwei kleine Spatzen und pickten emsig nach den übrig gebliebenen Körnern, die Vicky ihnen am Morgen vor ihrer Abreise noch rasch hingestreut hatte. Vermutlich war es dasselbe Spatzenpaar, das ihre Tochter schon den ganzen Winter über durchgefüttert hatte. Kein Wunder, dass sie immer wieder zurückkommen, dachte Elizabeth lächelnd.
»Ach, jetzt fühle ich mich schon viel besser!«, seufzte Catherine und setzte sich mit einem Becher dampfenden Tees an den Küchentisch. Dann warf sie ihrer Schwester einen besorgten Blick zu. »Wie geht es dir, Liebes? Bist du okay?«
»Ja«, erwiderte Elizabeth. »Zu meinem eigenen Erstaunen, ja. Es geht mir besser, als ich erwartet hatte, viel besser als auf dem Schiff jedenfalls. Und ich bin froh, dass die Mädchen sich gleich verabredet haben. Ich glaube, es wird ihnen guttun erst mal ein bisschen rauszukommen, bevor morgen in der Schule alle auf sie losstürmen. Hoffentlich sind zumindest die Lehrer ein wenig zurückhaltend und stellen nicht gleich so viele Fragen. Ich habe zwar mit der Schulleiterin gesprochen, aber ...«
»Das glaube ich nicht«, wandte Catherine ein. »Ich meine, ich glaube nicht, dass es für die beiden so schrecklich sein wird, zur Schule zu gehen. Natürlich werden einige Kinder fragen, die Lehrer auch, aber das wird sich bald legen, und dann kehrt der Alltag wieder ein, schneller, als du denkst wahrscheinlich. Sie haben hier ihre Freundinnen, die etwas mit ihnen unternehmen, die sie ablenken können ... das wird schon werden. Mach dir mal nicht allzu viele Gedanken. Glaube mir, die beiden werden bald wieder lachen. Und du auch, Liebes, auch wenn du dir das im Moment noch nicht vorstellen kannst. Das Leben geht weiter – auch für dich.«
Auch für mich ... aber wie? Wie nur?
Die Lippen fest zusammengepresst, rührte Elizabeth stumm nickend in ihrem Becher herum und sah wieder aus dem Fenster, wo sich das Vogelpärchen inzwischen lautstark um die letzten Körner stritt. Man konnte das Gezeter sogar durch die geschlossenen Fenster hindurch hören. Bei diesem Anblick spielte ein winziges Lächeln um Elizabeths Mundwinkel, doch dann wandte sie rasch den Blick wieder ab, und Catherine bemerkte, wie ein paar Tränen ihre Wangen hinunterliefen.
Vorsichtig streckte sie eine Hand nach ihrer Schwester aus und strich ihr sanft die Tränen aus dem Gesicht. »Ich weiß, es ist schwer. Und es wird noch lange Zeit wehtun, vielleicht dein Leben lang. Aber du wirst es schaffen, Beth, glaub mir. Du wirst es schaffen ...«
Am späten Nachmittag, kurz bevor es anfing zu dämmern, beschlossen die beiden, einen Spaziergang zu machen und die Mädchen zu Fuß abzuholen. Dabei sprachen sie über dieses und jenes, jedoch nicht über Patrick, und auch nicht darüber, wie es weitergehen sollte. Elizabeth war dankbar, dass ihre Schwester so einfühlsam und verständnisvoll war. Das war sie immer gewesen, schon früher, als sie beide noch zu Hause gewohnt hatten und Elizabeth oft solche Probleme mit ihren Eltern gehabt hatte, dass sie manchmal nicht mehr ein noch aus gewusst hatte. Sie hatten sich zwar nie wirklich gestritten, aber das Verhältnis war selbst heute noch äußerst schwierig, und es lag immer eine gewisse Spannung in der Luft, wenn sie sich trafen, vor allem zwischen Elizabeth und ihrem Vater.
Matthew und Emily Grace Thompson waren beide pensionierte Lehrer, die ihren Ruhestand auf der walisischen Halbinsel Angelsey genossen – was die Familientreffen auf einige wenige Geburtstage und Beerdigungen reduzierte. Sie waren zwar auf Patricks Beerdigung gewesen, hatten sich aber erwartungsgemäß sehr kühl und distanziert verhalten und waren gleich nach dem Kaffee wieder abgereist – wegen des langen Weges, hatten sie gesagt. Catherine und Elizabeth wussten aber sehr gut, dass das nicht der wahre, oder zumindest nicht der einzige Grund war. Sie hatten einfach nicht gewusst, wie sie mit Elizabeths Trauer umgehen sollen, und waren deswegen geflüchtet.
Catherine streckte eine Hand nach ihrer Schwester aus. »Hey, Beth – wo sind deine Gedanken?«
»Hm ... ich habe gerade an die Beerdigung gedacht und an all die Leute, die da waren – Leute, die ich teilweise seit Jahren nicht gesehen hatte. Seltsam, nicht?«
»Ja, aber irgendwie nett. Sie haben dich alle sehr gern, Beth.«
Elizabeth nickte langsam. Und sie haben vor allem Patrick sehr geliebt. Vor allem seine Mutter, die es sich nicht hatte nehmen lassen, mit einer ganzen Wagenladung voller Kuchen und Gebäck den weiten Weg von Dorset an der Südküste bis hinauf nach Warwickshire auf sich zu nehmen, um ihrem Sohn noch einmal »etwas Gutes zu tun«, wie sie unter Tränen erklärt hatte. Natürlich hatte er nichts mehr davon gehabt, aber Elizabeth, die ihre Schwiegermutter fast mehr liebte als ihre eigene Mutter, hatte genau verstanden, wie sie es gemeint hatte.
Granny Webster – wie sie seit Geburt ihres ersten Enkelkindes von allen genannt wurde – hieß in Wirklichkeit Dorothy Ann Webster und führte gemeinsam mit ihrer besten Freundin Margaret J. Fitzpatrick einen traditionsreichen, sehr beliebten Tea Shop, das Annabel’s, in einem malerischen, kleinen Ort namens Christchurch. Bis zur Hochzeit ihrer Tochter Melanie, die um einige Jahre jünger war als Patrick, hatte sie mit ihrem Mann, Benjamin Webster, ein Hotel in Bournemouth geführt, das Whitesands. Nachdem Melanie und ihr Ehemann John die Leitung des Whitesands übernommen hatten, hatten die Senioren sich aus dem Hotelbetrieb zurückgezogen. Aber weil Dorothy Ann Webster eine Frau war, die es einfach nicht ertragen konnte, den ganzen Tag lang zu Hause herumzusitzen, hatte sie sich zwei Jahre später, nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes, noch einmal eine neue Aufgabe gesucht. Im Alter von fast sechzig Jahren noch ein Café zu eröffnen, war zwar etwas, das Leute wie Matthew Thompson schlichtweg als Verrücktheit bezeichneten, doch Elizabeth hatte Granny dafür schon immer bewundert.
Jetzt seufzte sie und steckte die Hände in die Manteltaschen. »Ich werde eine Menge Sachen zu erledigen haben, Cathy, und ich bin froh, dass du mir dabei helfen willst. Danke, dass du da bist! Du bist wirklich ein Schatz. Wenn wir nachher zu Hause sind, werde ich uns beiden erst mal ein Glas Sherry einschenken. Komm, hier entlang. Wir sind gleich da, das schöne Holzhaus da drüben gehört den Friedrichs. Ich höre schon den Hund bellen.«
»Oh, sehr hübsch. Denen scheint es ja gut zu gehen. Was hältst du übrigens davon, wenn wir uns heute einen gemütlichen Fernsehabend machen? Mein Deutsch ist total eingerostet, und heute Abend kommt bei euch Sinn und Sinnlichkeit, das würde ich gerne mal wieder sehen. Es lief damals im Kino, als Melanie und John geheiratet haben, weißt du noch? Wir haben es alle zusammen in Birmingham gesehen.«
»Ja, das weiß ich noch. Ich erinnere mich vor allem an die Szene, wo dieser Typ den Hügel herabgeritten kommt, um sie zu retten, und das ganze Publikum aufgestanden ist, um zu applaudieren. Das war wirklich eine tolle Stimmung!«
Beide lachten, und Catherine legte ihrer Schwester einen Arm um die Schulter.
»Na, siehst du, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Schau mal, da vorne hat noch jemand seine Weihnachtsdeko leuchten. Im Februar! Na, das nenne ich grotesk.«
Elizabeth kuschelte sich eng an ihre Schwester. Liebe Catherine! Liebe, liebe Catherine ...
Die erste Nacht war furchtbar. Elizabeth warf sich unruhig im Bett hin und her, schlief immer wieder für kurze Zeit ein, tastete im Halbschlaf nach der vertrauten Hand, die nicht mehr da war – und erwachte jedes Mal weinend. Wenn sie schlief, träumte sie von Patrick. Patrick, der früh am Samstagmorgen zu ihr ans Bett kam, wenn die Kinder noch schliefen und er schon wieder seit Stunden auf den Beinen war, einen Becher Tee und einen Teller mit Honigtoast in der Hand, und ihr Guten Morgen wünschte. »Guten Morgen, mein Schatz«, hatte er immer ganz leise gesagt und dabei eine Hand nach ihr ausgestreckt, nachdem er das Frühstück auf dem Nachttisch abgestellt hatte. »Hast du gut geschlafen?«
Hast du gut geschlafen?
Gegen fünf Uhr stand sie schließlich auf, schlüpfte in den wunderbar weichen, cremeweißen Bademantel, den Patrick ihr letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt hatte, und in die Mokassins, über die er immer gelacht hatte, weil er sie albern fand. Es war ein liebevolles, zärtliches Lachen gewesen; nie war Patrick spöttisch oder gar sarkastisch gewesen, nicht einmal dann, wenn er sich über wirtschaftliche oder politische Themen aufgeregt hatte.
So schlich sie nun in ihren Mokassins die Treppe hinunter, schaltete das kleine Licht auf der Fensterbank in der Küche an und setzte den Kessel auf. Dann drehte sie die Heizung hoch und ließ sich auf der Eckbank nieder. Gedankenverloren griff sie nach der Post, die sie am Nachmittag vom Flur mit in die Küche genommen und auf den Tisch gelegt hatte, um sie dann doch nicht zu öffnen. »Hm, alles Rechnungen und die üblichen Beileidskarten ...«, murmelte sie und wollte den Stapel schon wieder beiseiteschieben, als ihr Blick auf einen blassgelben Umschlag mit englischer Briefmarke fiel. Sie hielt inne.
Komisch – es waren doch eigentlich alle bei der Beerdigung gewesen. Wer sollte ihr dann jetzt noch einen Brief hinterherschicken?
Plötzlich lächelte sie, als sie die Handschrift erkannte. »Ach, Sarah ...«
Sie nahm eine Karte und drei einzeln gefaltete Blätter aus dem Umschlag – je ein Brief für Mary, für Vicky und für sie. Auf der Karte war ein dicker, kleiner Bär mit rosa Bauch abgebildet, darunter stand Cheer up!. Elizabeth schmunzelte und klappte die Karte auf, in die ihre Nichte einen kurzen Gruß gekritzelt hatte. Für eine Engländerin hatte sie eine kaum leserliche Handschrift. Catherine sagte immer, wenn die Lehrer wollten, könnten sie ihr jedes zweite Wort als falsch durchstreichen, nur, weil sie es nicht lesen konnten! Aber Sarah war sehr klug, das wussten auch die Lehrer, also quälten sie sich notgedrungen durch ihre Hausaufgaben und Aufsätze.
Nachdem sie die anderen beiden Briefe sorgfältig in den Umschlag zurückgesteckt hatte, machte sie sich einen Becher Tee und holte die Keksdose vom Regal über der Spüle. Inzwischen war auch die Heizung warm geworden, und Elizabeth zog sich in ihre Lieblingsecke auf der Bank zurück, wo sie begann, den Brief zu lesen.
Liebe Tante Elizabeth,
wenn du diesen Brief liest, seid ihr wahrscheinlich gerade aus England zurück, und vielleicht habt ihr schon den ersten Montag überstanden. Hoffentlich bist du okay. Ich schicke dir eine ›Forever Friends‹-Karte als kleine Aufmunterung – gefällt sie dir? Wir sind ganz traurig wegen Onkel Patrick, und wir machen uns Sorgen um dich. Du hast ja niemanden in Deutschland, mit dem du mal reden kannst, und wer soll dich denn dann trösten, wenn Mama wieder hier ist?
Elizabeth rieb sich die Augen und nahm den Teebecher in beide Hände, starrte lange Zeit aus dem Fenster in die Dunkelheit hinaus. Gute Frage. Wer?
Sie nippte an ihrem Tee, nahm den Brief wieder zur Hand und las weiter.
Wir kommen übrigens bestens zurecht, Papa und ich, kannst du Mama sagen. Misses Baxter kocht jeden Tag für uns und bringt uns das Essen höchstpersönlich vorbei – mit Nachtisch! Und um die Wäsche kümmert sie sich auch, hat sie gesagt. Mama kann also ruhig etwas länger bleiben, wenn ihr sie braucht.
Ich habe eine Idee: Könnt ihr nicht nach England ziehen? Vielleicht kannst du wieder bei der Bank anfangen, bei der du früher mal gearbeitet hast, da könnte Papa doch bestimmt ein gutes Wort für dich einlegen. Und Mary und Vicky könnten mit mir zur Schule gehen, das würde ihnen doch gefallen, oder?
Ich habe Mary und Vicky übrigens nichts davon geschrieben, weil ich nicht weiß, wie sie das finden. Vielleicht sagen sie dann, ich mische mich in eure Angelegenheiten. Wenn du das auch denkst, dann verzeih mir bitte. Aber wir haben euch alle sehr lieb, Tante Elizabeth, und Mama und Papa freuen sich bestimmt auch, wenn ihr zurückkommt. Sie haben es nicht gesagt, aber ich glaube schon, dass sie das denken.
Gibt es bei euch eigentlich schon Krokusse im Garten? Bei uns ja – Hunderte, kannst du Mama sagen!
Ganz viele liebe Grüße und Gottes Segen für euch alle
von deiner Nichte Sarah
Nachdenklich legte Elizabeth den Brief beiseite und trank langsam ihren Tee. Sarah war wirklich ein ungewöhnliches Mädchen – sehr erwachsen für ihre fünfzehn Jahre, sehr sensibel – und unglaublich gut im Umgang mit anderen Menschen. Besonders bei den Kindern in der Nachbarschaft und bei den Senioren war sie sehr beliebt. Sie engagierte sich in der freikirchlichen Gemeinde, zu der sie und ihre Eltern gehörten, und war Mitglied einer Jugendgruppe, zu der sie auch Mary und Vicky voriges Jahr schon einmal mitgenommen hatte. Elizabeth hatte ihren Ohren kaum trauen können, als ihre Töchter ihr davon erzählt hatten. Normalerweise machten sie sich nichts aus Kirche; sie und Patrick hatten keiner Kirche angehört und besuchten nur dann einen Gottesdienst, wenn sie zu einer Hochzeit oder einer Taufe eingeladen gewesen waren. Nicht einmal zu Weihnachten waren sie gegangen. Patrick hatte nichts von dieser »scheinheiligen Heuchelei« gehalten, wie er es genannt hatte.
Catherine und ihre Familie hingegen waren seit vielen Jahren gläubige Christen, und Elizabeth hatte sich schon oft gefragt, ob es ihr Glaube war, der ihnen diese innere Ruhe und Zufriedenheit gab. Ihre Schwester konnte in jeder Situation etwas Positives sehen, in jedem Menschen etwas Gutes. Es war erstaunlich, wie wunderbar sich alles in ihrem Leben zu fügen schien, auch wenn es manchmal nicht ganz so lief, wie sie oder Paul es sich vorgestellt hatten. Jetzt wünschte sie fast, sie könnte auch so glauben ...
Ob Gott eine Antwort auf ihre Fragen hatte? Und ob er ihr überhaupt zuhören würde? Schließlich hatte sie über vierzig Jahre lang nichts von ihm wissen wollen.
Sie seufzte wieder und schüttelte resigniert den Kopf. Nein, wohl nicht, sonst hätte er auch nicht zugelassen, dass Patrick starb. Oder?
So! Energisch schob sie ihre Gedanken, zusammen mit der Teetasse, beiseite und wollte gerade auf die Uhr sehen, als sie oben ihren Wecker klingeln hörte: sechs Uhr, Zeit zum Aufstehen.
Vielleicht würde sie später mit Catherine über den Brief sprechen, wenn die Mädchen in der Schule waren. Die Idee, nach England zurückzugehen, gefiel ihr ausgesprochen gut. Sie wusste sowieso nicht, wie sie es auf Dauer in diesem Haus aushalten sollte, in dem sie alles immerzu an Patrick erinnern würde. Eigentlich war sie hier auch nie wirklich zu Hause gewesen, sie war nur wegen Patrick mit hierher gekommen, und gemeinsam hatten sie sich hier so etwas wie ein Heim geschaffen. Aber jetzt war Patrick nicht mehr da. Er würde nie wieder da sein – nie wieder ...
Auch wenn es ihr schwerfiel, es sich einzugestehen, so wusste sie doch tief in ihrem Inneren, dass ihr Herz irgendwo in den sanft gewellten, grünen Midlands von England hängen geblieben war, im Shakespeare’s County Warwickshire.
3
Elizabeth schloss die Badezimmertür hinter sich und ließ sich auf einen Hocker fallen. Puh, das wäre geschafft. Mein erster Einkauf im Ort, und ich bin nicht zusammengebrochen. Sie hatte darauf bestanden, alleine loszufahren, damit ihre Schwester sich ein wenig ausruhen konnte, und auch – das war ihr bewusst – ein Stück weit, um sich selbst zu beweisen, dass sie es konnte. Dass sie »alltagstauglich« war.
»Beth!«, rief Catherine im selben Moment von unten, und sie hörte sie die Treppe heraufkommen. »Telefon für dich! Möchtest du mit Anne sprechen?«
Elizabeth sprang auf und kam aus dem Badezimmer gestürzt.
»Ja! Danke!«
Dankbar nickend nahm sie das Telefon entgegen und setzte sich damit auf den Treppenabsatz.
Anne Petersson war ihre ehemalige Nachbarin, die im letzten Herbst mit ihrer Familie nach Süddeutschland gezogen war. Elizabeth vermisste sie, denn mit Anne verband sie eine innige Freundschaft. Anne war Englischlehrerin, so konnten sie nach Lust und Laune zwischen beiden Sprachen hin und her wechseln, was für Elizabeth gerade zu Beginn eine große Erleichterung gewesen war. Außerdem hatte Mary im letzten Sommer gerade angefangen, für ein kleines Taschengeld hin und wieder auf die beiden lebhaften Petersson-Jungs, Lasse und Matti, aufzupassen. Björn und Anne hatten es genossen, einmal ohne Kinder ausgehen zu können. Annes Eltern wohnten nahe der dänischen Grenze und Björns Eltern in München, sodass sie nie Großeltern in der Nähe gehabt hatten. Diese Situation konnte Elizabeth natürlich gut nachempfinden; schließlich hatte sie hier in Deutschland auch keine Familie.
Wie oft hatte sie sich gerade in den letzten Wochen gewünscht, Anne wäre noch hier – und wie gut es jetzt tat, die vertraute Stimme zu hören!
»Hallo, liebe Elizabeth ... Ich wollte mal hören, wie es euch so geht. Hast du das Schlimmste überstanden?«
Was hielten die Leute eigentlich immer für das Schlimmste? Die ersten drei Tage? Die ersten drei Wochen? Und woran wurde das Schlimmste gemessen?
»Ja, danke, es ging eigentlich ganz gut. Die Beerdigung war natürlich ein Albtraum, aber meine Schwester und ihr Mann sind ganz super gewesen und haben uns da richtig durchgetragen, vor allem auch die Kinder. Catherine ist mit uns zurückgefahren, um uns ein bisschen unter die Arme zu greifen, bis ... na ja, bis es halt ein bisschen besser geht ...«
Oder bis das Schlimmste überstanden ist.
Wie lange würde das dauern, bis es besser ging? Wochen? Monate? Sie konnte ihre Schwester wohl schlecht den ganzen Sommer über hierbehalten.
»Sie haben nur noch eine Tochter zu Hause, die beiden Jungs studieren, und Sarah geht nach der Schule immer zu einer Freundin. Eine ältere Dame aus ihrer Kirchengemeinde kümmert sich wohl um Essen und Wäsche, also scheint das alles ganz gut zu klappen. Na ja, und hier ... hier wird’s wohl noch eine Weile dauern, bis wir uns gefangen haben, schätze ich. Die Mädchen sind in der Schule – wollten auch beide gleich wieder los. Ich hätte sie ja sonst auch noch ein paar Tage hierbehalten, aber, wie gesagt, sie wollten los. Kann ich ja auch verstehen. Ablenkung ist das Beste. Sagt man.«
Sie zwang sich, tief durchzuatmen. Ablenkung war genau das, was ihr fehlte. Ein Job, ein Hobby, irgendetwas. Aber ihr ganzer Lebensinhalt war Patrick gewesen – Patrick und die Kinder –, die sie vermutlich bei Weitem nicht so sehr brauchten wie umgekehrt. Wenn sie nicht aufpasste, würde sie sich von den Mädchen abhängig machen, ihr eigenes Leben aufgeben. Und das durfte nicht passieren.
Schnell wechselte sie das Thema. »Und wie ist es bei euch? Kommst du da unten klar? Und wirst du im Sommer wieder anfangen zu arbeiten?«
»Uns geht es gut. Aber mit dem Arbeiten wird es wohl so bald doch noch nichts werden – wir bekommen nämlich noch ein Baby!«
Elizabeth hörte sich zu ihrem eigenen Erstaunen laut juchzen. »Oh, Anne, das freut mich aber für euch! Wann soll es so weit sein? Und wisst ihr schon, was es wird?«
Anne lachte. »Nein, es ist noch ganz am Anfang – du bist die erste außer Björn, die es erfährt, nicht einmal Lasse und Matti wissen davon. Ich wollte mir erst ganz sicher sein, weißt du. Das Baby soll Mitte August kommen, es ist also noch eine Weile hin. Na ja, natürlich wäre ein Mädchen nett, aber wir nehmen auch einen dritten Jungen. Egal, hauptsache, gesund!«
»Dann ist Matti ja nicht mehr der Kleinste, das wird ihn freuen. Reicht euch denn dann die Wohnung noch? Ich meine, ihr habt sie gerade erst gekauft ...«
»Das wird schon eine Weile gehen, vier Zimmer sind es ja, und im Moment teilen sich die Jungs sowieso eins, weil Björn ein Arbeitszimmer braucht. Wir möchten uns dann nach einem erschwinglichen Reihenhaus umsehen, aber das wird sicher schwierig – hier bezahlt man glatt das Doppelte wie oben in Schleswig-Holstein! Aber viel höher ist der Verdienst hier nicht ... Trotzdem, wir freuen uns. Sag mal, was ich fragen wollte – ich meine, nun ist ja deine Schwester da, aber würde es dir und den Kindern nicht vielleicht guttun, uns in den Osterferien mal zu besuchen? Tapetenwechsel, weißt du? Die Jungs freuen sich, wenn sie mal ein paar Tage bei der Oma sein können, dann ist auf jeden Fall ein Zimmer frei. Und wir kommen mal wieder richtig zum Klönen ...«
Elizabeth schloss die Augen und lächelte. Liebe Anne! Die Aussicht darauf, ein paar Tage in München zu verbringen, gefiel ihr ausgesprochen gut. Sie war noch nie dort gewesen und für die Mädchen war München bestimmt spannend ...
In diesem Moment fiel ihr jedoch siedend heiß ein, dass Patrick bereits vor Weihnachten eine Familienreise nach Mallorca gebucht hatte, die sie bis jetzt noch nicht storniert hatte. Sie rieb sich mit dem Handrücken die Stirn. Wieso musste das denn alles so furchtbar kompliziert sein?
»Weißt du, Anne, eigentlich hatten wir im November schon einen Familienurlaub gebucht – Mallorca. Ich habe bis eben überhaupt nicht daran gedacht, erst als du das von München sagtest, fiel es mir plötzlich wieder ein. Vielleicht storniere ich die Reise einfach. Ich habe sowieso keine Lust, alleine am Strand zu liegen, zwischen lauter Pärchen, und mir unendlich dumm dabei vorzukommen. Aber erst muss ich mit den Mädchen sprechen. Ich kann sie ja nicht einfach übergehen, weißt du?« Sie zögerte. »Ich weiß sowieso noch nicht, wie es hier weitergehen soll, oder ob wir vielleicht nach England zurückgehen ...« Die Tränen brannten in ihren Augen, und sie blinzelte rasch. »Ach, Anne, wie schön wäre es, wenn du jetzt hier sein könntest, um einen Kaffee mit mir zu trinken! Ich trinke im Moment nur noch Tee, und das literweise. Die englische Art der Trauerbewältigung, nehme ich an.«
Wow, ich werde sarkastisch. Aber im Moment schien sie einfach alles zu nerven. Sogar der Tee.
»Hey, ich vermisse dich auch«, meinte Anne. »Aber ich bin nicht aus der Welt, weißt du? Und Kaffee kannst du selbst kochen. Zumindest, seit ich dir den schönen Porzellanfilter geschenkt habe. Benutzt du den oft?«
Elizabeth rutschte unruhig auf dem Treppenabsatz hin und her. Sie wollte nicht, dass ihre Freundin sie für unselbstständig hielt. Schließlich war sie eine erwachsene Frau von vierzig Jahren, da brauchte sie wohl niemanden, der ihr den Kaffee kochte, oder? »Ja, schon ... wenn ich Kaffee trinke halt. Vielleicht sollte ich mir gleich mal eine Tasse machen.«
Anne lachte. »Tu das. Also, pass auf, ihr seid hier jederzeit willkommen, ihr drei. Wirklich jederzeit, wir können immer irgendwie zusammenrücken. Überlegt euch ganz in Ruhe, was ihr in den Ferien machen wollt. Vielleicht tut euch die Sonne von Mallorca ja auch gut, hm? Was meinst du?«
Die Sonne von Mallorca, in der Tat ...
Sie zögerte, bevor sie antwortete: »Ja, vielleicht. Ich melde mich dann ... entschuldige, Anne, ich muss los. Ich habe den Kindern versprochen, sie heute an ihrem ersten Tag abzuholen.«
Nachdem sie aufgelegt hatte, blieb sie noch eine Weile auf dem Treppenabsatz sitzen und dachte nach. Mallorca oder München – die Frage brauchte sie den Mädchen wahrscheinlich gar nicht erst zu stellen. Natürlich würden sie in die Sonne wollen. Wahrscheinlich würde es ihr auch guttun, aber ...
»Elizabeth?«
Catherine kam die Treppe nach oben, ein Geschirrtuch in der Hand. »Soll ich den Auflauf schon in den Ofen schieben? Es ist gleich halb eins. Ich kann auch gern die Mädchen abholen, wenn du ...« Sie blieb stehen, als sie das tränennasse Gesicht ihrer Schwester sah.
»Ach, Beth«, murmelte sie, kniete sich vor ihr auf die Stufe und schlang beide Arme um ihre schmalen Schultern. »Ach, Beth ...«
Als Catherine später mit den Mädchen nach Hause kam, duftete es bereits köstlich nach dem Kartoffel-Hack-Auflauf, den Catherine eigens für ihre Nichten gemacht hatte.
»Mmmmh, das riecht aber gut!«, rief Mary und warf ihren Rucksack achtlos in die Ecke. »Kannst du nicht hierbleiben und immer so leckere Sachen für uns kochen, Cathy?«
Catherine drehte sich zu ihr um, die Topflappen noch in der Hand, und entgegnete freundlich, aber bestimmt: »Deine Mutter ist eine ganz ausgezeichnete Köchin, Mary, und macht ein besseres Roastbeef als ich. Aber wo wir gerade von Hausarbeit sprechen, trag doch bitte deinen Rucksack in dein Zimmer und wasch dir die Hände, bevor wir essen, ja? Und dann kannst du uns eine Flasche Apfelsaft aus dem Keller holen.«
Mary zog ein Gesicht, tat aber sofort, was ihre Tante gesagt hatte. Niemand anderes durfte so mit ihr sprechen, da war sie sehr empfindlich. Aber Tante Cathy war eben etwas Besonderes, und sowohl sie als auch Vicky würden absolut alles für sie tun – und alles vermeiden, was sie verärgern oder verletzen könnte.
Erst am Nachmittag, als die Mädchen ihre Hausaufgaben machten, fand Elizabeth Zeit, um mit ihrer Schwester über Sarahs Brief zu sprechen.
»Du hast wirklich eine liebe Tochter, Cathy, und die Idee mit England gefällt mir auch sehr gut – ehrlich gesagt, finde ich sie geradezu verlockend. Aber ... aber ich weiß nicht, ob es eine Lösung ist, oder vielleicht genau das Gegenteil. Vielleicht wäre es leichter für uns in England – vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es einfach nicht, Cathy!«
Sie fuhr sich mit den Fingern durch die dichten, dunkelbraunen Locken und schüttelte seufzend den Kopf. »Als Anne vorschlug, dass wir in den Ferien zu ihr nach München kommen könnten, war das zunächst auch sehr verlockend für mich, und vielleicht fahren wir tatsächlich – wenn wir nicht doch nach Mallorca fliegen. Das muss ich noch mit den Mädchen besprechen. Aber weißt du, ich kann nicht so weitermachen, so bin ich immer irgendwie auf der Flucht, und das geht nicht. Ich muss mich auch irgendwann dem Alltag stellen. Und Alltag heißt, mich hier alleine zurechtzufinden, mir eine Arbeit zu suchen, neue Freunde zu finden ... hier. Wenn wir nach England zurückgehen, ist das doch auch eine Art von Flucht, oder? Ich meine, ich kann mich doch nicht ständig an irgendjemanden klammern, weder an dich noch an Anne. Gott weiß, wie gerne ich Anne noch hier hätte! Aber sie ist nun einmal nicht mehr da, und auch dich müssen wir irgendwann wieder gehen lassen ... hast du eigentlich schon einen Flug gebucht?«
Catherine schüttelte den Kopf. »Um diese Jahreszeit gibt es genug Flüge. Und ob ich nun direkt nach Birmingham fliege oder bis nach London und dann mit dem Zug nach Coventry weiterfahre, ist mir eigentlich einerlei. Das macht für mich keinen allzu großen Unterschied.«
Sie sah ihre Schwester mitfühlend an. »Aber sei nicht so hart mit dir, Beth. Es ist erst wenige Wochen her, weißt du ... du musst hier jetzt nicht die Heldin spielen – schon gar nicht vor mir. Okay?«
Elizabeth biss sich auf die Lippen, nickte jedoch tapfer. Dann lehnte sie ihren Kopf an Cathys Schulter und murmelte: »Danke, Cathy ... Tagsüber geht es schon ganz gut, zumindest, solange ich beschäftigt bin. Aber nachts ...«
Bei dem Gedanken an die leere Seite in ihrem Ehebett versagte ihr die Stimme. Sie presste die Lippen fest aufeinander und schüttelte den Kopf, als könnte sie damit die Tränen zurückhalten, die sich bereits in ihren Augen gesammelt hatten und jeden Moment über ihre Wangen strömen würden. Doch dann hielt sie es nicht mehr aus und warf sich ihrer Schwester weinend in die Arme. Es tat so weh! So weh!
Catherine hielt sie und wiegte sie hin und her, wie sie es auf dem Schiff schon getan hatte – und in den Tagen davor, seit ihre Schwester in England angekommen war, um sich für immer von ihrem geliebten Mann zu verabschieden. Wie tapfer sie das alles durchgestanden hatte! Und wie tapfer sie jetzt schon der Zukunft entgegenblickte, sich Gedanken darüber machte, wie sie einen Job finden, wie es weitergehen sollte. Sie wüsste nicht, was sie tun würde, wenn Paul jemals etwas zustoßen sollte ... Sicherlich, ihre Gemeinde würde sie schon irgendwie auffangen, und da wäre immer noch Pauls Familie in Atherstone, nur etwas über fünfzehn Meilen entfernt. Aber sie wollte sich lieber nicht vorstellen, wie es wäre, wenn Paul tatsächlich etwas zustieße. Mir würde der Boden unter den Füßen weggezogen werden, so viel steht fest, und ich wüsste nicht, wie ich jemals wieder stehen sollte.
Es verging eine lange Zeit, ehe das Schluchzen allmählich nachließ und schließlich ganz aufhörte. Catherine strich ihrer Schwester behutsam einige vom Weinen feucht gewordene Haarsträhnen aus dem Gesicht und reichte ihr ein Taschentuch.
»Wollen wir einen Spaziergang machen? Meinst du, die Kinder kommen eine Weile alleine klar?«
Elizabeth putzte sich die Nase und nickte. Dann stand sie auf, um die leeren Tassen zur Spüle zu bringen. Ihre Beine zitterten, und sie musste langsam gehen. »Sicher. Und wenn etwas ist, können sie mich ja auf dem Handy erreichen. Auch wenn ich nicht glaube, dass ich ihnen im Moment eine große Hilfe bin ... Ich gehe eben schnell nach oben und sage Bescheid. Hast du Handschuhe mit? Es ist kalt, glaube ich.«
Zunächst stapften sie eine Weile schweigend nebeneinander her. Das Wetter war nicht besonders schön, frostig, grau und kalt – keine Sonne weit und breit. Aber immerhin war es trocken, und die Luft war angenehm frisch.
Elizabeth schnupperte. »Es riecht schon nach Frühling, findest du nicht?«
Catherine lachte. »Du mit deiner Häschennase! Aber sieh mal, dort im Garten blühen schon einige Frühchen, Krokusse und auch andere ... wie heißen die gelben, weißt du das?«
»Ich glaube, sie nennen sie hier Winterlinge. Wir haben auch ein paar hinten im Beet. Patrick hat ganz viele neue Zwiebeln gesetzt im letzten Herbst. Wenn die Blumen herauskommen, werden sie mich an ihn erinnern ...« Sie spielte nervös mit dem Ende ihres Schals. »Cathy? Glaubst du, dass Patrick im Himmel ist?«
Dabei sah sie ihre Schwester hoffnungsvoll an. In ihrem Blick lag so etwas wie eine unausgesprochene Bitte, ein Flehen fast.
Catherine zögerte eine Sekunde lang, bevor sie Elizabeth einen Arm um die Schulter legte und weiterging, während sie sprach. »Ehrlich gesagt, Beth, kann ich dir darauf keine Antwort geben. Es war noch keiner von uns dort und ist wieder zurückgekehrt, um uns zu erzählen, wie es im Himmel ist. Gott allein hat die Macht zu entscheiden, wer in den Himmel kommt und wer nicht, aber wir Menschen dürfen uns nicht anmaßen, diese Entscheidung beeinflussen zu können. Genauso wenig, wie wir etwas über die letzten Sekunden im Leben eines Menschen sagen können, in denen dieser vielleicht noch umkehrt und so seinen Weg zu Gott findet. Wir wissen es einfach nicht, Beth. Aber wir wissen, dass wir einen liebenden, gütigen Vater im Himmel haben, dem es wichtig ist, dass möglichst keiner verloren geht, und darauf können und dürfen wir hoffen.« Sie hielt einen Moment inne und dachte über das nach, was sie gerade gesagt hatte. Sehr tröstlich war es wohl nicht und sicherlich auch nicht gerade das, was Elizabeth zu hören gehofft hatte, aber was hätte sie ihr anderes sagen können? Natürlich war Patrick ein überaus liebenswerter Mensch gewesen – aber er hatte sich ihres Wissens nach nie für Jesus entschieden, und das war in Catherines Augen das Einzige, was wirklich zählte, denn so stand es in der Bibel. Aber vielleicht war diese Entscheidung noch im letzten Moment gefallen, wer konnte das wissen?
Elizabeth nickte langsam, wie zu sich selbst. »Ich hoffe, dass du recht hast, Cathy ...«
Doch plötzlich brach es aus ihr heraus: »Ich habe ihn doch so sehr geliebt!!! Wie kann ich es ertragen, ohne ihn zu leben und nicht einmal zu wissen, ob es ihm jetzt gut geht? Wie soll ich das ertragen, Cathy, wie??!«
Catherine schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht, Liebes. Ich weiß es einfach nicht ...«
Ach, Beth, wie soll ich es dir erklären? Und wie soll ich dich trösten – wie soll man jemanden trösten, der so verzweifelt trauert wie du? Er war die Liebe deines Lebens, und nichts und niemand kann ihn ersetzen. Nichts und niemand. Niemals.
Am späten Nachmittag begann es zu schneien. Mary sah aus dem Fenster und schüttelte den Kopf. »Es ist fast März, man sollte meinen, es könnte mal Frühling werden! Mama, du musst mir mit Mathe helfen, ich kann das einfach nicht! Bitte, ja?«
Elizabeth seufzte und hob ihre mehligen Hände. »Kann ich noch den Brotteig fertig kneten, bitte? Sonst gibt’s nämlich morgen nur Knäckebrot, weißt du. Oder Zwieback. Mach du doch inzwischen mal die Badezimmer sauber, dazu bin ich noch gar nicht gekommen.«
Zu ihrem Erstaunen sprang ihre Große sofort auf und eilte zum Putzschrank im Flur. »Welchen Lappen nimmst du fürs Bad, Mama? Den grünen?«
»Ja. Und sieh bitte nach, ob wir noch WC-Reiniger haben, sonst muss ich morgen welchen besorgen. Wenn ihr noch etwas aus der Drogerie braucht, müsst ihr mir Bescheid sagen.«
Es fiel ihr leicht, sich mit solchen Alltäglichkeiten auseinanderzusetzen, leichter, als sie angenommen hatte. Aber wovor ihr wirklich graute – und sie wusste, dass sie es nicht ewig würde hinausschieben können –, war das Ordnen und Aussortieren von Patricks persönlichen Sachen. Der Gedanke, seine ganzen Hemden, Jacken, Hosen und andere Kleidungsstücke aus dem gemeinsamen Schrank räumen und in Kisten verpacken zu müssen, verursachte bei ihr Magenschmerzen. Das Ganze hatte etwas so Unabänderliches, Endgültiges ...
Niemals wieder würde sie ihm morgens etwas zum Anziehen hinlegen, wenn er einen geschäftlichen Termin hatte, nie wieder in letzter Minute sein einziges Smokinghemd bügeln, während er noch schnell duschte, eine Stunde vor Beginn der Oper. Bei dem Gedanken musste sie schmunzeln. Was für ein charmanter Chaot er doch gewesen war! Wenn es um Geschäftliches gegangen war, war er beinahe schon ein Pedant gewesen und hatte kaum jemals etwas vergessen, aber im praktischen Leben ... oh je! Wie oft hatte sie dann die Dinge selbst in die Hand nehmen müssen. Sie erinnerte sich an Marys Geburt, als wäre es gestern gewesen. Als am frühen Nachmittag die Wehen eingesetzt hatten, hatte sie Patrick in seinem Büro in Leicester angerufen und in Ruhe angefangen, ihre Tasche für die Klinik zu packen. Als Patrick kurze Zeit später hereingestürmt gekommen war, hatte er seine Schlüssel im Kofferraum des Autos liegen lassen – und diesen natürlich zugeschlagen. Während er noch mit sich selbst schimpfend im Wohnzimmer auf- und abgelaufen war, hatte Elizabeth bereits das Taxi gerufen.
Als Mary Ann Webster fünf Stunden später das Licht der Welt erblickt hatte, war ihr Vater draußen auf dem Krankenhausflur vor Erschöpfung eingeschlafen.
4
»Also, ich hätte schon Lust, nach Mallorca zu fliegen. Wieso denn auch nicht? Ein bisschen Sonne wird uns allen guttun«, fand Mary. Sie hatte es sich in einer Ecke des Sofas gemütlich gemacht und wickelte ein Kaubonbon aus.
Elizabeth sah zu Vicky hinüber, die sich wie eine kleine Katze in dem Lieblingssessel ihres Vaters zusammengerollt hatte. Sie antwortete nicht gleich, sondern zog sich eine Decke über die Knie und murmelte schließlich etwas, das wie »egal« klang. Ihrem Blick nach zu urteilen, war sie mit ihren Gedanken ziemlich weit weg – und nicht auf Mallorca.
»Wollen wir es uns noch ein paar Tage überlegen? Dann kann ich die Reise am Wochenende immer noch stornieren, wenn wir uns entscheiden, nicht zu fliegen.«
»Aber wird dann die Stornierung nicht immer teurer?«
»Darum geht es nicht, Mary, auf die paar Euro kommt es nun wirklich nicht an. Aber ich habe das Gefühl, dass Vicky sich die Sache noch einmal überlegen möchte. Sonst gibt es am Ende nur Gemaule, und davon hat keiner was.«
»Es ist mir egal! Es ist mir vollkommen piepegal!«, rief Vicky, plötzlich zornig. Damit sprang sie auf, warf die Decke zur Seite und rannte aus dem Zimmer.
Mary sah ihr verwundert nach. »Was hat sie denn auf einmal?«
Elizabeth seufzte. »Ich weiß es nicht, Mary. Vielleicht war heute einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Lass uns mal ein paar Tage nicht dran rühren, okay?«
Mary zog ein Gesicht. »Toll! Und wenn sie dann immer noch bockig ist und sagt, ihr sei alles egal? Fliegen wir dann oder nicht? Ich jedenfalls will hier nicht zwei Wochen lang nur herumsitzen. Ann-Kristin fährt in die Schweiz zum Skilaufen, Vivien fliegt nach Gran Canaria, und Malin fährt mit ihrem Vater nach Dänemark – und ich?!«
Elizabeth fühlte, wie eine unbändige, heiße Wut in ihr hochstieg. Am liebsten wäre sie aufgesprungen und hätte ihre Tochter angeschrien, die so selbstsüchtig war und nur an ihr eigenes Vergnügen zu denken schien. Ist es denn meine Schuld, dass alles so anders gekommen ist? Glaubt ihr nicht, ich wäre gern mit euch und eurem Vater nach Mallorca geflogen wie geplant? Aber so ist es nun einmal nicht, und wir können es nicht ändern! Das Schicksal hat es anders gewollt, wie man so schön sagt.
Stattdessen schüttelte sie nur schweigend den Kopf.
Schließlich zuckte Mary mit den Schultern. »Na gut, da bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis Lady Victoria sich da oben abgekühlt hat ... Wie lange bleibt Tante Cathy eigentlich noch hier?«
»Wenigstens noch eine Woche, denke ich. Sarah hat nächste Woche Ferien. Hast du ihren Brief gelesen? Was schreibt sie?«
»Ach, nichts Besonderes, sie erzählt von ihrer Schule und ihrer Kirche und dass sie in den Ferien zu Maggie und Simon fährt.«
Pauls älterer Bruder Simon bewirtschaftete zusammen mit seiner Frau Maggie, einer gebürtigen Schottin, die elterliche Farm in Atherstone, einem kleinen, verschlafenen Ort, der etwa zwanzig Kilometer nördlich von Nuneaton lag. Sie vermieteten im Sommer zwei ihrer Zimmer auf Bed-and-Breakfast-Basis und züchteten außerdem Border Collies. Ihre einzige Tochter Murron war Lehramtsanwärterin im benachbarten Tamworth, wohnte allerdings noch bei den Eltern. Dann waren da noch die alten O’Connors, die den erst kürzlich angebauten Flügel des alten Farmhauses bewohnten und dort ihren wohlverdienten Ruhestand und die herrliche Aussicht über die Felder und Wiesen genossen – und den Blick auf das Gutshaus Mayfield Manor, das unweit auf einem Hügel lag.
Bei dem Gedanken an das Herrenhaus lächelte Elizabeth still vor sich hin. Als junges Mädchen hatte sie – wie viele andere an ihrer Schule auch – für den einzigen Sohn und Erben der Bentleys geschwärmt, die ihres Wissens nach noch immer auf dem Gut lebten. Er hieß William, wenigstens mit erstem Namen, und war damals der bestaussehende Junge an der Rugby School gewesen, an der ihr Vater zu der Zeit unterrichtet hatte; jedes Mädchen in Rugby hatte ihn wenigstens vom Namen her gekannt. Sie war William auf einer Tanzveranstaltung zum ersten Mal begegnet und war dann einige Male mit ihm ausgegangen, doch schon bald nachdem er sein Abitur gemacht hatte, hatten sie sich wieder aus den Augen verloren. Jahre später hatte sie ihn noch ein- oder zweimal auf der Farm wieder getroffen, als Catherine mit Paul verheiratet und sie bereits mit Patrick verlobt war. Wie lange das alles doch schon her war!
»Hörst du mir überhaupt zu, Mama? Ich hab dich was gefragt!«
Elizabeth zuckte zusammen, als fühlte sie sich ertappt. »Entschuldigung, Liebes, ich war wohl in Gedanken. Was sagtest du?«
»Ich fragte, ob du nach England zurückgehen willst. Willst du?«
Am liebsten sofort. Aber ihre Antwort war nur ein Vages: »Ich weiß nicht, mal sehen. Aber wir versuchen es erst mal hier, glaube ich. Zusammen werden wir es schon irgendwie schaffen, was meinst du?«
Ein Lächeln der Erleichterung breitete sich auf Marys Gesicht aus. »Klar schaffen wir das, Mama. Bestimmt.«
»War aber ein lieber Gedanke von dir. Weißt du, natürlich vermisse ich Catherine und Paul und all die anderen, und bestimmt wäre vieles leichter da drüben.«
Aus dem Augenwinkel bemerkte sie, wie Marys Gesicht lang wurde. Sie fuhr hastig fort: »Aber nun lasst uns erstmal sehen, wie wir das mit dem Urlaub machen, und wenn wir wieder da sind, schreibe ich mal ein paar Bewerbungen. Wenn es gar nicht klappt, können wir immer noch weiterreden. So, und nun Ende der Diskussion, ich bin müde und gehöre ins Bett. Und du sicher auch – du lieber Himmel, es ist ja fast zehn! Musst du morgen nicht zur ersten Stunde?«
»Zur nullten! Wie immer in diesem Halbjahr. Der neue Stundenplan ist wirklich nichts für Langschläfer! Aber wir haben als Erstes Geschichte bei Herrn Meyer, da kann man so herrlich schlafen ... oh, Entschuldigung. Ich gehe jetzt mal nach oben und packe meine Schultasche. Gute Nacht!«
Nachdem Mary hinausgegangen war, sah Elizabeth sich verträumt im Wohnzimmer um. An den Wänden hingen Fotografien aus verschiedenen Urlaubsreisen, von den Hochzeiten, die sie im Laufe der Jahre besucht hatten, von ihren Töchtern, Nichten und Neffen. Über dem Sideboard befand sich ein Ölbild der O’Connor’schen Farm, das Murron gemalt hatte. Dafür, dass sie immer behauptete, nicht besonders gut malen zu können, war es ziemlich gelungen. Im Hintergrund konnte man sogar die Silhouette des alten Herrenhauses erkennen. Plötzlich überfiel Elizabeth furchtbares Heimweh. Wie schön wäre es, jetzt bei Maggie am Kachelofen in der alten Bauernküche zu sitzen und Maggies selbst gebackene Rosinenbrötchen zu essen ... mmmh, ganz frisch aus dem Ofen, mit viel Butter und Erdbeermarmelade ...
»Hey, Beth, störe ich oder kann ich reinkommen? Ich wollte mir gerade einen Kaffee machen, trinkst du einen mit?«
Catherine stand in der Tür, ein Schulheft von Vicky in der Hand. Sie war die ganze Zeit über im Dachgeschoss gewesen, wo sie in Patricks Büro gesessen und gelesen hatte, um ihrer Schwester und ihren Nichten Gelegenheit zu geben, in Ruhe miteinander zu sprechen.
»Nein, danke, ich glaube, ein Sherry würde mir jetzt eher guttun. Ehrlich gesagt.«
»Trinke ich auch gerne einen mit.«
Catherine kam herein und setzte sich neben ihre Schwester auf die Couch. »Vicky hat mir einen Hausaufsatz gegeben, den sie in Englisch geschrieben hat. Ich soll ihn mir mal durchlesen – wirklich faszinierend! Ich glaube nicht, dass Sarahs Deutsch annähernd so gut ist, und sie hat schon im dritten Jahr Deutsch.«
»Vicky ist in einer sogenannten bilingualen Klasse, in der sie in den ersten zwei Jahren zwei Zusatzstunden Englisch pro Woche bekommt und dann ab Klasse 7 Erdkunde auf Englisch lernen wird«, erklärte Elizabeth und stand auf, um die Karaffe mit dem Sherry aus der Vitrine zu holen. »Außerdem darfst du nicht vergessen, dass hier zu Hause praktisch nur Englisch gesprochen wird.«
»Hm. Klingt interessant, diese bilinguale Sache. Macht Mary das auch?«
Elizabeth schüttelte den Kopf. »Nein, das gab es vor drei Jahren noch nicht. Vickys Klasse ist sozusagen das Pilotprojekt der Schule.«
Catherine nickte nachdenklich. »Aha. Damit hätte Vicky doch die besten Voraussetzungen in England, oder? Ich meine – ich weiß ja nicht, ob du inzwischen noch einmal darüber nachgedacht hast. Aber du sagtest ja selbst, dass du dich hier nie wirklich zu Hause gefühlt hast, und jetzt ...«
»Doch, ich habe schon darüber nachgedacht, aber ich fürchte, dass die Kinder da einiges gegen einzuwenden hätten. Für sie ist das hier ihr Zuhause, weißt du?«
Sie goss den goldfarbenen Sherry in zwei Gläser und reichte eines ihrer Schwester.
»Auf dich, Cathy. Danke, dass du da bist!«
»Das ist doch selbstverständlich. Lass uns lieber auf dich trinken, meine tapfere, kleine Schwester. Cheers!«
»Ach was, tapfer ...«, murmelte Elizabeth, nachdem sie einen Schluck getrunken hatte. »Ich muss ja. Irgendwie muss es doch weitergehen, oder?«
»Irgendwie, ja.« Catherine schwenkte nachdenklich ihr Glas hin und her. »Wahrscheinlich wäre die Woche auf Mallorca gut, um mal Ordnung in deine Gedanken zu bringen, die Dinge aus dem nötigen Abstand zu betrachten, meinst du nicht? Ich an deiner Stelle würde jedenfalls fliegen. Bewerbungen schreiben kannst du ja dann immer noch, wenn du zurückkommst, sonnengebräunt und mit hoffentlich einem Pfund oder zwei mehr auf den Rippen. Versprichst du mir auch gut zu essen, wenn ich wieder weg bin?«
Elizabeth grinste. »Ja, Mama ...«
Dann nahm sie das Schulheft und begann zu lesen. »My favourite animal – so so ...«
Als sie den Aufsatz zu Ende gelesen hatte, stand sie auf und ging nach oben zu ihrer Tochter, die, halb unter ihrer Decke vergraben, im Bett lag und – wie könnte es anders sein? – ein Hundebuch las. Lassie come home.