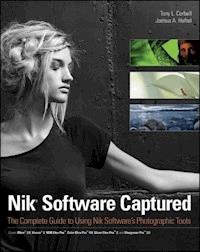Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: oekom verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Unsere Rechtsordnung behandelt die Natur wie eine Ansammlung von Gegenständen, die der Mensch nach Belieben gestalten und gebrauchen kann. Aber die Natur ist ein lebendiges System. Wir sind aus der Natur hervorgegangen und stehen mit ihr in einer dynamischen Beziehung. Dies sollte sich auch im Recht widerspiegeln. Für eine gemeinsame Zukunft von menschlichen Gesellschaften und allen anderen Lebensformen auf der Erde müssen wir daher einen Perspektivwechsel schaffen: hin zu einem Rechtssystem, das die Natur nicht nur als Ressource, sondern wegen ihres Eigenwertes als Rechtssubjekt betrachtet. Zentral dabei sind eigene Rechte der Natur und ein ökologisches Grundprinzip. Wie können die Eigenrechte der Natur ausgestaltet sein? In welchem Verhältnis stehen sie zu menschlichen Grundrechten, und welche Auswirkungen hätte eine solche Rechtsgemeinschaft mit der Natur? Dieses Buch öffnet den Blick auf eine Gemeinschaft mit der Natur im Rahmen einer freiheitlichen und demokratischen Rechtsordnung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernd Söhnlein
Die Natur im Recht
Vision einer ökologischen Rechtsordnung
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
© 2024 oekom verlag, München oekom – Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbH, Goethestraße 28, 80336 München +49 89 544184 – 200
www.oekom.de
Layout und Satz: oekom
Umschlaggestaltung: Laura Denke, oekom verlag
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9783987263835
DOI: //doi.org/10.14512/9783987263828
Menü
Cover
fulltitle
Inhaltsverzeichnis
Hauptteil
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1 :
Eigenrechte der Natur – eine verrückte Idee?
Kapitel 2 :
Die Natur als rechtlicher Begriff
Kapitel 3 :
Das überholte Weltbild europäischer Rechtsordnungen
Kapitel 4 :
Gründe für eine Rechtsgemeinschaft mit der Natur
Kapitel 5:
Bekenntnis zur Koexistenz von Mensch und Natur in der Verfassung
Kapitel 6 :
Ökologisches Grundprinzip
Kapitel 7 :
Rechtssubjekt Natur
Kapitel 8 :
Repräsentanten der Natur in der gemeinsamen Rechtsgemeinschaft
Kapitel 9 :
Einbindung von Eigenrechten der Natur in die Rechtsordnung
Kapitel 10 :
Rechtsverhältnis zwischen Menschen und Naturelementen
Kapitel 11 :
Denkanstöße für eine Rechtsgemeinschaft mit der Natur
Kapitel 12 :
Globale Rechtsgemeinschaft mit der Natur
Kapitel 13 :
Die Transformation der Rechtsordnung – ein Ausblick
Danksagung
Über den Autor
Literaturverzeichnis
Anmerkungen
Kapitel 1 Eigenrechte der Natur – eine verrückte Idee?
In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschien im August 2022 ein Gastbeitrag zum Thema »Die Natur braucht eigene Rechte«. In dem Kommentarblog zur Onlineausgabe fand sich folgende Anmerkung: »Kann mich dann mein Kaktus verklagen, wenn ich ihn nicht gieße?«
Vielleicht fand der Leser oder die Leserin die Idee, der Natur eigene Rechte zu geben, etwas verrückt und sah sich deshalb zu einer scherzhaften Bemerkung veranlasst. Vielleicht hat der‐ oder diejenige mit diesem Satz aber auch hinter die Forderung nach eigenen Rechten für die Natur ein dickes Fragezeichen setzen wollen.
Das Fragezeichen hat seinen guten Grund. Denn das Postulat, jemand anderem als Menschen ein eigenes Recht zusprechen zu wollen, klingt erst einmal unerhört. Noch dazu für Juristinnen und Juristen, die es gewohnt sind, sich in festgefügten Denkmustern zu bewegen.
Betrachtet man das Ausmaß der Zerstörung, die wir Menschen in den vergangenen Jahrhunderten der Natur auf dem Planeten Erde zugefügt haben – mit sich beschleunigendem Tempo in den zurückliegenden Jahrzehnten –, werden wir nicht umhinkommen, den Umgang mit der Natur auf dem Gebiet des Rechts fundamental zu überdenken. Die Forderung, die Natur als Rechtssubjekt anzuerkennen, ihr eigene Rechte zuzusprechen, bewegt weltweit die Menschen in zahlreichen Ländern. In einigen Staaten ist sie bereits Bestandteil der Rechtsordnung geworden.1
Ich möchte in diesem Buch zeigen, dass die Idee einer rechtlichen Gemeinschaft mit der nichtmenschlichen Natur nicht so abwegig ist, wie es auf den ersten Blick erscheint. Sie lässt sich nicht nur ethisch begründen, sondern auch in unsere geltende Rechtsordnung integrieren.
Der Forderung nach Eigenrechten für die Natur begegnen ausgerechnet Teile der Umweltverbände bislang mit Skepsis. Möglicherweise deswegen, weil sie es als untaugliches Mittel ansehen, um kurzfristige politische Erfolge im Kampf gegen den Klimawandel und den Verlust der biologischen Vielfalt zu erzielen. In der Tat würde man das Konzept »Rechte der Natur« missverstehen, wenn man es lediglich als juristisches Werkzeug begreifen wollte, um das geltende Umweltrecht wirksamer als bisher durchzusetzen.
Eigene Rechte für die Natur bedeuten in Wirklichkeit einen tiefgreifenden Wandel in unserer (Rechts‑)Kultur. Es handelt sich nicht nur um eine »Modeerscheinung«, sondern um ein fundamentales Anliegen mit dem Ziel, unsere Rechtsordnung an die heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse und an die Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte anzupassen, indem man die Natur nicht weiter als Ressource behandelt, sondern als Rechtssubjekt.
Wie müsste man die Rechtsordnung ergänzen, um das Verhältnis des Menschen zur nichtmenschlichen Natur neu zu ordnen? Welchen Teilen der Natur könnten eigene Rechte eingeräumt werden? Welchen Inhalt hätten solche Rechte? Wer kommt als Sprecher für die Rechte der Natur in Betracht? In welchem Verhältnis stünden Rechte der Natur zu menschlichen Rechtspositionen? Diesen Fragen möchte ich in dem Buch auf den Grund gehen.
Ich maße mir allerdings nicht an, auf alle Fragen eine umfassende Antwort zu geben, geschweige denn, alle Facetten der Thematik erschöpfend zu behandeln. Wer mit dem Umweltrecht etwas vertraut ist, weiß, dass ein Großteil der nationalen Umweltvorschriften durch europäische Gesetze vorgeprägt ist. Wie sich die Rechte der Natur in das Europarecht einpassen würden, lasse ich offen. Dieser Gesichtspunkt würde ein eigenes Buch füllen. Da sich die oben erwähnten Fragen aber auf europäischer Ebene in gleicher Weise stellen wie im bundesdeutschen Recht, weisen die Ausführungen dazu über das deutsche Recht hinaus und sind auch auf den europarechtlichen Kontext übertragbar.2
Bei dem Verhältnis zwischen den Rechten der Natur und menschlichen Grundrechten setze ich einen Schwerpunkt auf Aspekte der Landnutzung. Zu den Auswirkungen von Rechten der Natur auf unser Wirtschaftssystem insgesamt, auf unsere Energieversorgung, auf unseren gesamten Lebensstil gäbe es vieles zu erörtern. Den Anspruch, ein allumfassendes Kompendium zu den Rechten der Natur vorzulegen, kann und will ich mit diesem Buch nicht erfüllen. Ziel ist es vielmehr, zur Diskussion, zum Nachdenken und zum Weiterdenken anzuregen.
Kapitel 2 Die Natur als rechtlicher Begriff
Dieses Buch handelt vom Umgang der Rechtsordnung mit der Natur.
Je nachdem, aus welcher Perspektive man sich dem Begriff der Natur nähert, ob aus naturwissenschaftlicher, ästhetischer oder ethischer Perspektive: Die Vorstellungen darüber, was Natur ist, sind überaus vielschichtig. Man kann sie unter dem Aspekt der sinnlichen Wahrnehmung als Landschaft betrachten, als Mosaik oder Gesamtheit von Ökosystemen, in den Gegensätzen Wildnis und Kulturlandschaft usw. Alle diese Aspekte der Natur sind zudem subjektiv, kulturell und zeitgeschichtlich beeinflusst.3
Um Missverständnissen aus dem Weg zu gehen, möchte ich eingangs erläutern, was gemeint ist, wenn ich im Folgenden von Natur als rechtlichem Begriff spreche.
In der Rechtsordnung sind – fachsprachlich – unbestimmte Rechtsbegriffe nichts Außergewöhnliches. Im Gegenteil: Eine Rechtsvorschrift kann gar nicht alle denkbaren Einzelfälle beschreiben, die man sich in der Theorie ausdenken kann und die in der Praxis vorkommen.
Juristinnen und Juristen helfen sich mit Interpretationshilfen, indem sie zum Beispiel dem Sinn und Zweck einer Regelung nachgehen, ihren Zusammenhang mit anderen Vorschriften in den Blick nehmen oder die Gesetzgebungsgeschichte erforschen.
Einer Auslegung mit den eben erwähnten Mitteln der Rechtswissenschaft ist der Begriff »Natur« jedoch nur im Kontext einer bestimmten Regelung zugänglich. Für eine allgemein gehaltene Erörterung wie diese helfen herkömmliche Methoden der Rechtsauslegung nicht weiter. »Natur« ist ein so ungemein bedeutungsreicher und interpretationsoffener Begriff, dass man sich angreifbar macht, wenn man ihn nicht inhaltlich einzugrenzen versucht. Denn wenn jeder etwas anderes darunter versteht, wird man bei Debatten um die Rechte der Natur leicht aneinander vorbeireden oder Missverständnisse hervorrufen.
Klarstellen möchte ich, dass der hier gebrauchte Naturbegriff zum einen auf seine Funktion als Rechtsbegriff zugeschnitten ist. Zum anderen erhebt er nicht den Anspruch, allgemeingültig und über jede Kritik erhaben zu sein. Es soll lediglich klar sein, was gemeint ist, wenn nachfolgend von Natur die Rede ist.
Nähern wir uns der Begrifflichkeit von den Rändern her: Verfehlt wäre es, »Natur« als Oberbegriff im Sinne von Wesen oder Gesamtheit der Dinge mit der Gesamtheit ihrer Eigenschaften zu verstehen.4 Natur wäre dann alles, eingeschlossen das gesamte Universum. Bei der Fragestellung, wie wir Menschen gemeinsam mit der Natur (über)leben können, stehen die Geschehnisse auf unserem Erdball im Mittelpunkt. Natur kann also sinnvollerweise nur Prozesse und ihre Erscheinungsformen auf dem Planeten Erde umfassen, einschließlich seiner ihn umgebenden Atmosphäre.
Andererseits wäre ein Naturbegriff, der nur Dinge einschließt, »wie sie unabhängig von allen menschlichen Eingriffen sein würden«,5 zu eng. Denn dieser Naturbegriff würde alle Kulturlandschaften ausschließen, mithin den überwiegenden Anteil der Erdoberfläche, der von menschlichen Eingriffen geprägt wird.
Man trifft den Kern, wenn man alles Lebendige in den Begriff der Natur einschließt. Wesentliches Merkmal des Naturbegriffs ist die Gesamtheit der Lebewesen. Ich rechne dazu neben den Lebewesen, die wir den Tieren und Pflanzen zuordnen, ausdrücklich auch Pilze, »Mischwesen« (z. B. Flechten) und Mikroorganismen.6
Es sind aber nicht nur die Lebewesen selbst, aus denen die Natur besteht, sondern vor allem ihre Wechselbeziehungen untereinander sowie zwischen den Lebewesen und den unbelebten Elementen. Wechselbeziehungen unter den Lebewesen sind die Nahrungsaufnahme, Akte der Fortpflanzung, des Sozial‐ und Schwarmverhaltens, der Symbiosen und jegliche Arten der Kommunikation. Mit unbelebten Elementen tauschen sich Lebewesen aus, indem sie Stoffe aufnehmen und ausscheiden, Luft, Boden und Wasser zur Fortbewegung und zum Aufenthalt nutzen. Zu den unbelebten Elementen zählen die tote Materie (Gesteine/Erde, Wasser, Luft) ebenso wie physikalische Erscheinungen (Feuer, Wind, Temperatur, Vulkanismus, Erdbeben usw.). Auch sie muss man mit in den Naturbegriff aufnehmen.
Zur Natur gehören auch vom Menschen beeinflusste Lebensvorgänge und deren Erscheinungsformen, soweit sie in einem Austausch mit den Naturkräften und anderen Lebewesen stehen. Das Getreidefeld ist Teil der Natur, auch wenn es von Menschenhand gesät, gedüngt und mit Pestiziden behandelt wird. Denn die Saat geht nur auf, wenn es regnet, der Boden warm genug ist und ein Mindestmaß an Bodenleben die Pflanzen wachsen lässt. Kulturlandschaften, forstwirtschaftlich genutzte Wälder und Gärten sind Natur.
Die Grenze ziehe ich dort, wo unbelebte Materie außerhalb des Wirkungsgefüges der lebendigen Welt steht: Gestein, Öl, Gase in einer Tiefe, in der diese Stoffe nicht mit Lebewesen in Kontakt stehen, schließe ich aus dem Begriff »Natur« aus, jedenfalls solange diese Stoffe nicht an die Oberfläche gelangen oder geholt werden und dadurch mit den Lebensvorgängen in Berührung kommen.
Nicht zur Natur rechne ich alles, was (nahezu) ausschließlich von Menschen geschaffen wird. Das sind alle künstlich hergestellten Gegenstände, die ohne Mitwirkung von Naturkräften entstanden sind und die nicht in einem Austausch mit der belebten Welt stehen (Artefakte).7 Auch dasjenige, was nur in der geistigen Vorstellungswelt der Menschen existiert, ist keine Natur im Sinne dieser Definition, auch wenn es für uns als Menschen tatsächlich existiert, z. B. juristische Personen, ein musikalisches Werk, Ländergrenzen (außer sie sind mit Mauern und Stacheldraht befestigt) usw.
Zugegebenermaßen gibt es Grauzonen des Naturbegriffs: Eine Pflanzkultur in einem Gewächshaus, das klimatisiert und mit einem künstlichen Bewässerungssystem ausgestattet ist, wird man nicht mehr als Natur bezeichnen können. Ob eine künstlich bewässerte Freilandkultur für Gemüse oder Blumen in einem nicht standortheimischen Pflanzsubstrat noch zur Natur gehört, mag fraglich sein. Solche Grenzfälle stellen allerdings den oben umrissenen Naturbegriff nicht infrage.
Irreführend wäre es, den Begriff der Kultur dem Begriff der Natur gegenüberzustellen. Sieht man Kultur im weitesten Sinne als Ausdruck all dessen an, was spezifisch menschlich ist, insbesondere die Sprache, die Künste und jede Form technischen und kreativen Gestaltens, überlagern sich Kultur und Natur vielfach. Teile der Natur sind Gegenstand menschlicher Kultur (Land‐ und Forstwirtschaft, Gartenkultur, Gestaltung von Gewässern usw.).
Der in diesem Buch verwendeten Definition von Natur liegt ein ökologischer Naturbegriff zugrunde.8 Natur ist keine bloße Ansammlung einzelner Lebewesen, sondern ein Geflecht von Interaktionen zwischen den Organismen mit vielfältigsten gegenseitigen Wechselwirkungen und Abhängigkeiten. Innerhalb dieses global miteinander verbundenen Netzwerks haben sich Lebensgemeinschaften mit bestimmten Akteuren entwickelt, die an die physikalischen und chemischen Bedingungen des jeweiligen Standorts angepasst sind. Die Natur ist zwar den physikalischen Gesetzmäßigkeiten unterworfen, die im gesamten Universum gelten: Gravitation, Magnetismus, der Aufbau von Elementarteilchen, die Gesetze der Thermodynamik usw.
Sie folgt aber eigenen Spielregeln, die den Gesetzen der Physik scheinbar widersprechen: Während Materie und Energie danach streben, sich im Weltraum gleichmäßig und zufällig zu verteilen, baut die Natur mithilfe der Sonnenenergie geordnete, nicht zufällige und sich selbst organisierende Strukturen auf. Das gilt für die einzelne Zelle ebenso wie für das einzelne Lebewesen und für ganze Gemeinschaften aus Organismen. Die Geowissenschaften beschreiben solche Lebensgemeinschaften als Ökosysteme.
Selbst bei annähernd konstanten Standortfaktoren sind Ökosysteme keine statischen Gebilde. Sie verändern sich ständig als Reaktion auf Einflüsse von außen und innen. Beispielsweise durchlaufen Ökosysteme nach Bränden oder Überschwemmungen Wiederbesiedelungsphasen bis hin zu reiferen Stadien, die fortbestehen, bis das Spiel von Neuem beginnt. Ökosysteme verändern sich aber auch im Inneren, indem die an ihnen beteiligten Organismen im Zuge der Fortpflanzung zufälligen Veränderungen (Mutationen) in ihrem »Betriebssystem« (d. h. ihrer genetischen Ausstattung) unterworfen sind. Diejenigen Organismen, die sich am besten an ihre Umweltbedingungen anpassen, können sich erfolgreicher als andere fortpflanzen. So entstehen neue Arten, andere verschwinden.
Die Ökologie als »Beziehungswissenschaft« geht auf Ernst Haeckel zurück, der diesen Begriff bereits im 19. Jahrhundert in die wissenschaftliche Diskussion eingeführt hat.9 Der ökologische Naturbegriff deckt sich größtenteils mit der vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) vorgeschlagenen Definition des Begriffs »Biosphäre«.10
Auch die Menschen zählen als Lebewesen, biologisch gesehen, zur Natur, sind mit ihr verwoben. Für die vorliegende Abhandlung gehe ich deshalb von folgendem Naturbegriff aus: Natur ist die Gesamtheit der Lebewesen auf der Erde in ihren komplexen Wechselbeziehungen untereinander sowie mit den unbelebten Elementen.
Auch das Recht beschäftigt sich mit Beziehungen, und zwar mit sozialen Beziehungen zwischen den Menschen. Zu einer Beziehung gehören mindestens zwei Akteure. Ist es deshalb unmöglich, den Menschen einerseits als Teil der Natur anzusehen und andererseits Mensch und Natur in eine rechtliche Beziehung zueinander zu stellen? Kann man juristisch gleichzeitig Teil eines Ganzen und etwas Eigenständiges sein? Die Rechtsordnung hat damit kein Problem: Wenn man als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer eines Unternehmens tätig ist, ist man, juristisch gesehen, Mitglied einer rechtlichen Einheit, z. B. einer GmbH. Zugleich steht man aber im Rahmen des Arbeitsverhältnisses in einer rechtlichen Beziehung zur Arbeitgeberseite. Rechtliche Beziehungen können auch zu Kolleginnen und Kollegen bestehen, etwa wenn der Betriebsrat bei einer Personalentscheidung mitwirkt.
Naturwissenschaftlich betrachtet, ist die Menschheit Teil der Biosphäre. Diese Tatsache steht einer rechtlichen Beziehung zwischen Mensch und Natur jedoch nicht entgegen.
Kapitel 3 Das überholte Weltbild europäischer Rechtsordnungen
Die Biosphäre mit all ihren Elementen hat sich im Laufe der Erdgeschichte immer wieder gewandelt, und sie wandelt sich weiter. Keine einzelne Art dürfte die Erde aber in ähnlicher Weise verändert haben wie der Mensch. Manche Wissenschaftler sehen darin bereits den Beginn eines neuen Erdzeitalters, des Anthropozän.11 In der Fachwelt unumstritten ist, dass die dramatischen Umwälzungen, die sich im weltweiten Klimasystem, im Verlust der Artenvielfalt, in der Verschmutzung und Überfischung der Meere und vielem mehr zeigen, auf Handlungen von Menschen zurückgehen.
Die Ausbeutung der Natur mag vielerlei Ursachen haben. Ein ganz wichtiger Grund liegt in dem Selbstverständnis des Menschen gegenüber der nichtmenschlichen Natur. Schon in der Antike hat der Mensch Natur zerstört, ging äußerst grausam und rücksichtslos mit Tieren um und versuchte, sich auf eine Stufe mit den Göttern zu stellen. Die Folgen für den Planeten blieben aber zeitlich und regional begrenzt. Die Erkenntnisse von Wissenschaftlern zu Beginn der Neuzeit haben den Europäern das technologische Werkzeug in die Hand gegeben, tief in die Naturabläufe einzugreifen. Infolge des europäischen Kolonialismus haben diese Technologien ihren weltweiten Siegeszug angetreten.
Mit dem Eintritt in das fossile Zeitalter verfügte der Mensch über Energieressourcen in einem nie zuvor da gewesenen Ausmaß, mit deren Hilfe er die Natur beinahe nach Belieben umgestalten konnte. Die Idee eines unbegrenzten Fortschritts war geboren. Die von der nichtmenschlichen Natur gezogenen Grenzen wurden bedenkenlos überschritten.
Mit dem Glauben, die Welt vollständig kontrollieren und gestalten zu können, hat der (europäisch denkende) Mensch aus den Augen verloren, dass seine Zivilisation in ein größeres planetares System integriert ist. Diese seinen eigenen Untergang heraufbeschwörende Selbstüberschätzung – die griechische Mythologie nannte sie Hybris – fordert angesichts der dramatischen Folgen (Klimawandel, Artenverlust, Vermüllung) zu einem Paradigmenwechsel in der Beziehung des Menschen zur Natur heraus.12
Die heutigen Rechtsordnungen europäisch‐nordamerikanischer Ausprägung beruhen auf der ungeschriebenen Annahme, der Mensch stehe im Zentrum der Welt, ausgestattet mit einem natürlichen Herrschaftsanspruch über den gesamten Planeten Erde. Die Würde des Menschen ist das zentrale Leitbild heutiger europäischer Verfassungen. Die Natur kommt in diesem Leitbild nicht vor.
Woher kommt diese Selbstbezogenheit und Naturvergessenheit des Menschen, der sich als etwas ganz Besonderes innerhalb der Natur sieht? Gehen wir dazu in das Zeitalter der Renaissance zurück. Ende des 15. Jahrhunderts schrieb der italienische Philosoph Pico della Mirandola sein Traktat über die Würde des Menschen, wobei er Gottvater als Schöpfer der Welt folgende an den Menschen gerichtete Worte in den Mund legte: »Die Natur der übrigen Geschöpfe ist fest bestimmt und wird innerhalb von uns vorgeschriebener Gesetze begrenzt. Du sollst dir deine ohne jede Einschränkung und Enge, nach deinem Ermessen, dem ich dich anvertraut habe, selber bestimmen. (…) Weder haben wir dich himmlisch noch irdisch, weder sterblich noch unsterblich geschaffen, damit du wie dein eigener, in Ehre frei entscheidender, schöpferischer Bildhauer dich selbst zu der Gestalt ausformst, die du bevorzugst.«13
Mit dieser geradezu euphorischen Hymne auf die Fähigkeiten des Menschen hat Pico ein Menschenbild gezeichnet, das großen Einfluss auf die europäische Geistesgeschichte genommen hat.14 Der Mensch soll nach Pico die Welt um sich herum beobachten, über sie nachdenken und sie gestalten. Dieses geistige Vermögen, die Fähigkeit, in kreativer Weise sich mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen, ist der Kern der Würde des Menschen.
Picos Menschenbild ist bis heute für die Definition der Menschenwürde als Eckpfeiler des deutschen Grundgesetzes prägend geblieben. Der Menschenwürde liegt, so das Bundesverfassungsgericht,15 die Vorstellung vom Menschen als einem geistig‐sittlichen Wesen zugrunde, das darauf angelegt ist, sich in Freiheit selbst zu bestimmen und sich zu entfalten.
Das Traktat Picos kam weder aus dem Nichts, noch war es Zufall, dass es in Oberitalien im Zeitalter der Renaissance veröffentlicht wurde. Pico hat vielmehr in Worte gefasst, was in den europäischen Handelsmetropolen seit dem Hochmittelalter mehr und mehr zum Gedankengut wurde: Der einzelne Mensch tritt aus der festgefügten göttlichen Ordnung heraus, erschafft sich durch seine geistigen Kräfte seine eigene Welt und entwirft sein Leben nach eigenen Vorstellungen. Dieses Menschenbild ist nach Meinung des Anthropologen Joseph Henrich Ausdruck einer besonderen psychologisch‐kulturellen Entwicklung in Europa, die von engen verwandtschaftsbasierten Sozialnormen weg und zu einem im Vergleich zu außereuropäischen Gesellschaften ausgeprägteren Individualismus führte.16
Auch wenn die Realität für die allermeisten Menschen damals anders aussah, nahm die Idee des frei denkenden und wirkenden Menschen nachhaltigen Einfluss auf die europäische Geistesgeschichte. Sie war Anstoß für die Forderung, jeder Mensch solle ein freies und selbstbestimmtes Leben führen können. Diese Entwicklung fand letztlich ihren Niederschlag in den Grund‐ und Menschenrechten, die den Zugriff des Staates auf den einzelnen Menschen beschränken sollen.17
Das beschriebene Menschenbild setzte aber auch in anderer Hinsicht ungeahnte Kräfte frei. Denn freieres Denken und Forschen versetzte Angehörige privilegierter Schichten, die über eine gewisse Freiheit sowie über Macht und Geld verfügten, in die Lage, den von Pico vorgezeichneten Weg als Gestalter der Welt in einem vorher nicht gekannten Ausmaß umzusetzen. Die lebendige Natur, der die Menschen in früheren Zeiten das für ihr Überleben Notwendige entnahmen, es ihr manchmal abringen mussten und ihr oft genug hilflos ausgeliefert waren, wurde zu Naturkapital und Handelsware.
Dafür war aber nicht allein das Weltbild des freien, sich selbst entfaltenden Individuums verantwortlich, zumal die Einbindung in familiäre, gesellschaftliche, kirchliche und politische Strukturen zur damaligen Zeit noch wesentlich ausgeprägter war als heute. Maßgeblich war, dass sich der (europäisch denkende) Mensch von der nichtmenschlichen Natur emanzipierte, indem er sie zum Objekt degradierte, das man zum Nutzen des Menschen beliebig umgestalten und ausbeuten darf. Geistige Wegbereiter dieses Dualismus – der denkende, vernunftbegabte Mensch auf der einen Seite, die nichtmenschliche Natur auf der anderen Seite – waren unter anderem die Philosophen René Descartes und Francis Bacon. Die überwiegend bis heute gängige Interpretation der biblischen Schöpfungsgeschichte in Genesis 1,28, der Mensch solle über die Welt »herrschen« und sich die Natur »untertan machen«, bot eine willkommene ethisch‐religiöse Rechtfertigung, um die Natur zu unterjochen.18
Die allumfassende Befugnis, die Natur für eigene Zwecke nutzen zu dürfen, ist nicht nur Teil des heute vorherrschenden Weltbildes. Sie ist in den westlichen Verfassungsordnungen auch grundrechtlich abgesichert. Das Eigentumsgrundrecht und die Gewerbefreiheit berechtigen zum freien Gebrauch und Verbrauch von Naturgütern, soweit der Staat dies nicht reglementiert hat.19
Seit Darwin wissen wir jedoch, dass die Vorstellung eines an der Spitze der Hierarchie innerhalb der Natur stehenden Menschen eine grandiose Selbstüberschätzung ist. Homo sapiens ist keineswegs der Schlussstein der Evolution, sondern ein Seitenzweig eines riesigen und uralten Lebensbaumes. Ein Säugetier aus der Familie der Menschenaffen, dem das Spiel des Lebens besondere Gaben zugeteilt hat. Vor allem: Wir leben in einer komplexen Biosphäre, die nicht beliebig ausgebeutet und umgestaltet werden kann, ohne dass sich die Lebensbedingungen des Menschen und vieler anderer Arten dramatisch verschlechtern. Diese Erkenntnisse der Biologie, Anthropologie, Geografie und anderer Wissenschaften sind heute Teil der menschlichen Kultur. Das zur Selbstüberschätzung neigende Menschenbild der Renaissance, auf der unsere Rechtskultur basiert, ist es aber ebenfalls.
Um diesen Widerspruch aufzulösen, muss sich das Bild des Menschen von sich selbst und seiner Stellung innerhalb des Gesamtsystems des Planeten Erde auch in Bezug auf den rechtlichen Rahmen ändern, den die Gesellschaft sich selbst setzt. Hin zum Bild eines Natur‐ und Kulturwesens, das sich, sei es aus ethisch‐religiösem Impetus, sei es aus Einsicht in die Ergebnisse seiner eigenen wissenschaftlichen Erkenntnisse, gegenüber der nichtmenschlichen Natur selbst beschränkt. Das die nichtmenschliche Natur nicht als lebloses Objekt betrachtet, welches man sich umfassend aneignen und als selbstverständliche Verfügungsmasse betrachten darf. Wenn wir die Erde für uns bewohnbar halten wollen, müssen wir eine (verfassungs‑)rechtliche Basis schaffen, um die skizzierten Entwicklungen des Anthropozäns umzukehren und den Einfluss des Menschen auf die Biosphäre zurückzunehmen. Deshalb ist es unausweichlich, dass die Rechtsordnung um einen entscheidenden Baustein ergänzt wird, indem sie anerkennt, dass die menschlichen Zivilisationen mit der Natur verbunden sind, über die der Mensch eben nicht grenzenlos verfügen kann, ohne sich selbst zu schaden.
Der Philosoph Klaus‐Michael Meyer‐Abich hat für einen solchen Wandel der Rechtskultur schon vor Jahrzehnten geworben und eine »Rechtsgemeinschaft mit der Natur« angemahnt.20 Diesen Gedanken möchte ich im Folgenden aufgreifen.
Kapitel 4 Gründe für eine Rechtsgemeinschaft mit der Natur
Ethische Grundannahmen europäischer Verfassungen und ihr »blinder Fleck«
Das Selbstverständnis des Menschen, den Planeten Erde ausschließlich als seine eigene Umwelt zu betrachten, die er nach Belieben benutzen, umgestalten und nach seinen Regeln verwalten kann, ist mit den naturwissenschaftlichen Kenntnissen über die Natur als Biosphäre nicht mehr in Einklang zu bringen. Wir haben keinerlei Bedenken, naturwissenschaftliche Forschungsergebnisse für unsere technologische Fortentwicklung zu nutzen, beharren aber auf dem Standpunkt, die Natur juristisch weiterhin als eine Ansammlung von Gegenständen zu betrachten und nicht als lebendiges System, dessen Teil wir sind. Wenn wir die Rechtsordnung in dieser Hinsicht nicht grundlegend ändern, werden wir auch den Niedergang der Biosphäre nicht in den Griff bekommen.
Die Rechtsordnung ist hierarchisch aufgebaut. Rahmen und Richtschnur für die Gesetzgebung ist die bundesdeutsche Verfassung, das Grundgesetz. Das Grundgesetz enthält gleichsam die rechtlichen Spielregeln für die Gesellschaft. Es regelt aber nicht nur, wie die staatlichen Strukturen aufgebaut sind und wie sie funktionieren. In seinem Grundrechtskatalog offenbart sich auch eine objektive Werteordnung, wie das Bundesverfassungsgericht schon frühzeitig in dem vielfach zitierten Lüth‐Urteil vom 15.01.1958 (Az. 1 BvR 400/51) hervorgehoben hat. Eine Rechtsgemeinschaft mit der Natur muss an dieser Werteordnung ansetzen, muss sie im Hinblick auf den Umgang mit der Natur neu justieren.
Das Grundgesetz könnte keine Werteordnung abbilden, wenn es nicht auf ethischen Fundamenten ruhen würde, die ihm selbst vorausgehen.21 Verfassungen ohne ein Wertesystem wären bloße Instrumente der Machtausübung ohne moralischen Anspruch. Die ethische Basis einer Verfassungsordnung kann man nicht beweisen, man muss sie als konstitutiv voraussetzen.22
Ethische Grundannahmen sind in den meisten Verfassungen entweder ausdrücklich formuliert oder lassen sich aus der Präambel erschließen. Sie können auch in nicht hinterfragten Traditionen und Prinzipien bestehen, die die stillschweigende Grundlage einer Staatsverfassung bilden, aber aus dem Verfassungskonzept erschlossen werden können. Es handelt sich dabei um religiöse oder quasireligiöse23 Grundsätze, die als absolut gültig vorausgesetzt werden und keiner weiteren Begründung bedürfen. Sie bilden den Ausgangspunkt für Verfassungen und beruhen auf ethischen, gleichsam vorstaatlichen Prämissen.
Solche grundlegenden Annahmen haben auch Eingang gefunden in völkerrechtliche Dokumente, namentlich in die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahr 1948. Beispiele für explizite Verfassungsprämissen finden sich in der französischen Verfassung und im deutschen Grundgesetz. Die französische Verfassung und das deutsche Grundgesetz machen gleich zu Beginn deutlich, dass es ethische Grundlagen gibt, die nicht hinterfragt werden. Die französische Verfassung der Fünften Republik verweist auf die Präambel der Verfassung von 1946, die die Erklärung der Menschenrechte vom Juli 1789 weiterhin als Grundlage der französischen Nation bestätigt. Gemäß Art. 1 dieser Erklärung sind alle Menschen von Natur aus frei und gleich. Art. 1 Abs. 1 des Grundgesetzes erklärt die Würde des Menschen für unantastbar. Mit dem gleichen Wortlaut und der gleichen Funktion beginnt auch die Europäische Grundrechtecharta. Den genannten Verfassungsgrundlagen gemeinsam sind ein Menschenbild, das dem Einzelnen eine Würde zuspricht, und ein Staatswesen, das auf dem Dreiklang aus Freiheit, Gleichheit und Solidarität aufbaut, welches man als »demokratischen Verfassungs‐Humanismus« bezeichnen kann.24
Das im vorangegangenen Kapitel beschriebene Selbstverständnis des Menschen im Verhältnis zur Natur, der cartesische Dualismus zwischen Mensch und Natur ist als unausgesprochene Grundannahme den allermeisten zeitgenössischen Rechts‐ und Verfassungsordnungen gemein. Mit ihr rechtfertigt der Mensch die uneingeschränkte Befugnis, über die nichtmenschlichen Lebewesen und die nichtbelebten Elemente auf dem Planeten zu verfügen, sie sich anzueignen, sie umzugestalten, sie zu verdrängen und zu zerstören. Die ethische Berechtigung zur allumfassenden Machtausübung über die Natur wird bislang von fast keiner staatlichen Ordnung infrage gestellt. Darin unterscheiden sich die westlich‐abendländischen Verfassungskonzepte im Ergebnis kaum von fernöstlichen oder islamisch geprägten Staaten.
Bisher einzige Ausnahme ist die Verfassung von Ecuador aus dem Jahr 2008. Sie nennt als eines ihrer ethischen Fundamente in ihrer Präambel die Einbindung des Menschen in die Natur: »Wir preisen die Natur, Pacha Mama (Mutter Erde), deren Teil wir sind und die lebenswichtig für unsere Existenz ist (…) Deshalb haben wir beschlossen, eine neue Form des öffentlichen Zusammenlebens zu errichten, in Vielfalt und in Einklang mit der Natur, um nach einem erfüllten Leben, der ›sumak kawsay‹, zu streben (…).«25
Die europäischen Verfassungen, auch das deutsche Grundgesetz (GG), schweigen zu der Frage, in welchem Verhältnis der Mensch und seine Zivilisation zur Natur stehen. Zwar erklärt Art. 20a GG den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen zum Staatsziel. In welchem rechtlichen Verhältnis der Mensch zur Natur steht, bleibt aber offen.
Angesichts des heutigen Wissensstandes und der Dramatik der Veränderungen in der Biosphäre muss die Verfassungsordnung diesen »blinden Fleck« der Rechtsordnung dringend tilgen.
Die ethischen Prämissen der Verfassungen europäisch‐nordamerikanischer Prägung in Gestalt des demokratischen Verfassungs‐Humanismus bedürfen keiner weiteren Rechtfertigung, man hat sich schlicht auf sie geeinigt.
Eine ethische Grundthese im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Mensch und Natur kann nicht auf eine vergleichbare geistesgeschichtliche Entwicklung zurückblicken wie die Menschenwürde oder die Prinzipien der Freiheit und Gleichheit. Deshalb sollte die Frage nicht offenbleiben, wie man ethisch begründen könnte, dass man ein Zusammenleben von Mensch und Natur zur ethischen Grundlage der Rechtsordnung erklärt.26
Eine Begründung mit allumfassendem Geltungsanspruch zu formulieren, wäre anmaßend. Sie ließe die vielfältigen kulturellen, religiösen und geistesgeschichtlichen Wurzeln außer Betracht, aus denen sich ethische Prinzipien herleiten. Ein Anspruch auf eine universale Begründung eines neuen Selbstverständnisses des Menschen wäre dem Vorwurf ausgesetzt, einem bestimmten historischen und kulturellen Hintergrund zu entstammen. Denn ethische Vorstellungen sind zeit‐ und kulturgeprägt, wie nicht nur ein Blick in die Gegenwart, sondern auch in die Vergangenheit zeigt.
Wenn ich im Folgenden den Versuch wage zu begründen, weshalb es ethisch geboten ist, eine Rechtsgemeinschaft von Mensch und Natur zu begründen, und welchen Inhalt eine diese Rechtsgemeinschaft tragende ethische These haben sollte, tue ich dies als Vertreter einer europäischen Denktradition. Außereuropäische Denkweisen und Vorstellungen sollen damit aber nicht als minderwertig oder vormodern abgewertet werden.
Wenn man an die europäische Ideengeschichte anknüpft, kommt man an der im ersten Kapitel erwähnten Schöpfungsgeschichte des Alten Testamentes nicht vorbei. Der amerikanische Historiker Lynn White hat als eine der wirkungsmächtigsten geistesgeschichtlichen Ursachen des westlich‐neuzeitlichen Naturverständnisses die Auslegung der biblischen Genesis als »Herrschaftsauftrag über die Erde« beschrieben.27 Das im hebräischen Urtext verwendete Wort kabas wurde und wird mit »herrschen« übersetzt, das Wort rada mit »untertan machen«. In dieser Interpretation drückt sich ein auf Bemächtigung, schrankenlose Beherrschung und Ausbeutung gerichtetes Verhältnis zur Natur aus.28 Auch wenn sich neuzeitliche Wirtschafts‐ und Gesellschaftsordnungen nicht mehr unmittelbar auf die christliche Religion berufen, ist der so verstandene alttestamentarische Herrschaftsauftrag in das kulturelle Gedächtnis tief eingebrannt und hat die ökonomischen und technischen Strukturen nachhaltig geprägt. Deshalb ist es wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass das gängige Textverständnis keineswegs zwingend, ja bei genauerer Betrachtung sogar fragwürdig ist. Der Theologe Christoph Hardmeier und der Philosoph Konrad Ott stellen die Schöpfungsgeschichte in einen größeren Sinnzusammenhang. Sie übersetzen den hebräischen Begriff kabas als »Dienstbarmachen« und das Wort rada mit »verfügen über«. Sie verstehen kabas nicht als vollständige Beschlagnahme von Land und Meer durch den Menschen, sondern sehen darin den Auftrag an die Menschheit, die Fruchtbarkeit der Erde gemeinsam mit allen anderen Geschöpfen verantwortungsvoll zu nutze.29 Man muss deshalb nicht die Leitbilder der abendländisch‐christlichen Kultur über Bord werfen, wenn man die allumfassende Herrschafts‐ und Verfügungsmacht des Menschen über die Natur infrage stellt.
Allerdings möchte ich in Bezug auf eine ethische Grundlage für ein die Natur einschließendes Verfassungskonzept die biblische Schöpfungsgeschichte nicht als hauptsächlichen oder gar einzigen Ansatzpunkt heranziehen. Dies verbietet sich schon aus Gründen der religiösen Neutralität der staatlichen Ordnung.
Das Weltbild, das den Menschen als allumfassenden Gestalter sieht, der die belebte und unbelebte Natur gleichsam als Werkzeugkasten und Experimentierfeld benutzt, hat die Menschheit in die Naturkrise des Anthropozäns geführt. Anthropologie, Ökologie, Biologie und andere Naturwissenschaften haben in den vergangenen beiden Jahrhunderten unser Wissen über das Leben auf unserem Planeten aber auch immens erweitert und vertieft, in vielerlei Hinsicht auch revolutioniert.
Aus naturwissenschaftlichen Fakten darf man allerdings nicht ohne weitere Begründung die Schlussfolgerung ableiten, es sei nicht vertretbar, die nichtmenschliche Natur in der Rechtsordnung als Sache zu behandeln. Die den Menschen und die übrige Natur verbindenden Eigenschaften als lebendige Systeme führen nicht zwangsläufig zu einer gleichwertigen Stellung in der Rechtsordnung.
Anzunehmen, die Grund‐ und Menschenrechte seien naturgegeben, könnten also aus der wissenschaftsbasierten Beobachtung der Wirklichkeit gleichsam herausgelesen werden, wäre genauso ein Fehlschluss: Aus der Tatsache, dass alle Menschen die gleiche genetische Grundausstattung besitzen, kann nicht deduktiv abgeleitet werden, alle Menschen sollen auch als Rechtspersonen gleich sein (ja überhaupt Rechtspersonen sein). Zwar wird das Postulat der Gleichheit im Recht durch die Erkenntnisse der Naturwissenschaften untermauert: Es gibt keine menschlichen Rassen, Frauen und Männer besitzen grundsätzlich die gleichen Befähigungen. Dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sein sollen, ist indessen ein bewusster Rechtsakt, der nicht »von außen« oder von der Natur vorgegeben ist. Das Sollen resultiert aus einer Wertentscheidung des Menschen.30
Auf die Frage, ob es universell und zeitlos gültige Werte gibt, die in jeder Rechtsordnung anerkannt werden sollten, möchte ich an dieser Stelle nicht eingehen. Philosophen wie Rousseau hatten eine solche universelle Werteordnung wohl im Kopf, als sie von zeitlos gültigen Menschenrechten sprachen, die jedem Menschen »von Natur aus« zukommen (»Naturrecht«).
Nicht zu leugnen ist aber, dass Wertentscheidungen wie die Zuerkennung von Menschenrechten an Grundbedürfnisse anknüpfen, die von Natur aus vorgegeben sind: der Antrieb, (über)leben zu wollen, das Bedürfnis nach Sicherheit und der Wunsch nach Einbindung in eine soziale Gemeinschaft, ein Mindestmaß an Bewegungsfreiheit.
Obwohl man die Beobachtung der Natur und die Ableitung ethischer und rechtlicher Normen gedanklich trennen muss, wäre ein rechtliches Sollen ohne Berücksichtigung des Seins eine leere Hülse.31 Wenn das Bundesverfassungsgericht betont, der Menschenwürde liege die Vorstellung zugrunde, der Mensch sei als geistig‐sittliches Wesen darauf angelegt, sich selbst zu bestimmen und zu entfalten,32 knüpft es an die natürlichen Wesensmerkmale des Menschen an. Grundrechte wie der Schutz der körperlichen Unversehrtheit, das Grundrecht, sich zu Vereinigungen zusammenzuschließen, die Kunstfreiheit oder die Redefreiheit sollen körperliche, psychische und soziale und damit naturgegebene Grundbedürfnisse des Menschen schützen.33 Naturwissenschaftlich gesicherte Gegebenheiten können demnach nicht ignoriert werden.
Welche menschlichen Bedürfnisse als Grundbedürfnisse anerkannt und in welchem Umfang sie rechtlich geschützt werden, kann hingegen nicht aus der Natur abgeleitet werden. Um diese Frage wurde und wird ethisch und politisch gerungen. Ergebnis sind die völkerrechtlich und in der Verfassung verankerten Grund‐ und Menschenrechte.34
In gleicher Weise kann die Überlegung, auf naturwissenschaftliche Erkenntnisse über Lebewesen und Lebensgemeinschaften zurückzugreifen, um eine Rechtsposition ethisch und politisch begründen zu können, auch für die Eigenrechte der Natur nutzbar gemacht werden.
Naturwissenschaftliche Erkenntnisse müssen im Hinblick auf das Selbstverständnis des Menschen und seine Stellung in der Natur demnach rechtsphilosophisch bewertet und ethische Schlussfolgerungen daraus gezogen werden.35
Nutzenbezogene (anthropozentrische) Gründe
Man kann sich mehrere Szenarien ausmalen, wie sich das Verhältnis zwischen der Menschheit und der Natur über kurz oder lang entwickeln könnte. Die für den Menschen ungünstigste Variante wäre ein Katastrophenszenario, in dem der Raubbau an der Natur der Menschheit über kurz oder lang die Lebensgrundlagen entzieht oder sich die Menschheit mit den von ihr entwickelten Waffen selbst zugrunde richtet. Manche Zeitgenossen vertreten den Standpunkt, man könne den Untergang der Menschheit ohnehin nicht verhindern, der Raubbau am Klimasystem und an der Biosphäre sei schon zu weit fortgeschritten, die Menschen seien nicht in der Lage, sich zu besinnen und das Ruder herumzureißen. Einen ähnlich fatalistischen Blick auf die Zukunft pflegte bereits Friedrich Nietzsche, als er im Jahr 1873 zu Beginn seiner Abhandlung Ueber Lüge und Wahrheit im aussermoralischen Sinn konstatierte, es habe Ewigkeiten gegeben, in denen es Menschen nicht gab, und es würde sich nichts begeben, wenn es mit ihm wieder vorbei wäre.36 Aus rein naturwissenschaftlicher Sicht hatte er damit recht: Das Leben auf der Erde existierte, lange bevor der Mensch auftrat, und es würde vermutlich noch lange ohne ihn existieren.