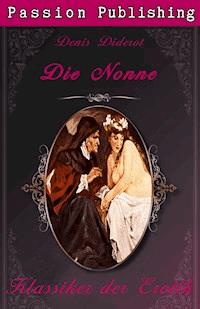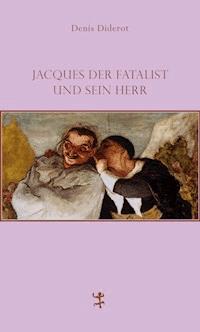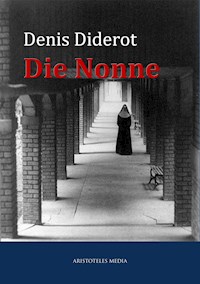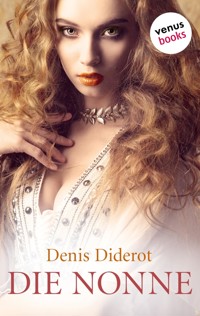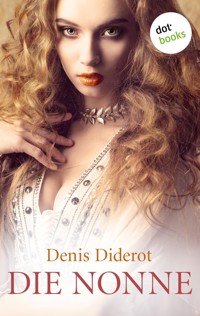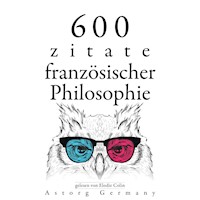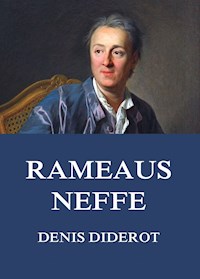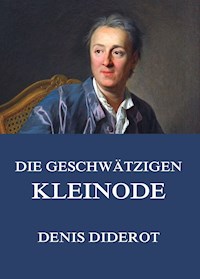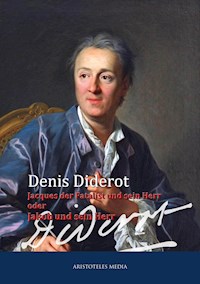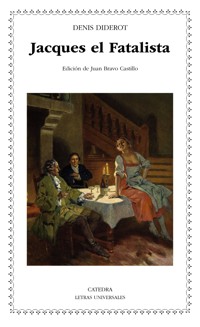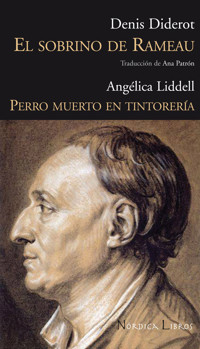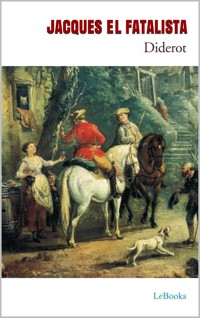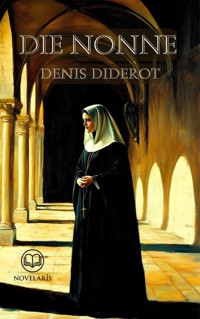
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SK Digital Classics
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gegen ihren Willen wird eine junge Frau in ein Kloster verbannt, wo sie ein Leben der Entbehrung führen muss. Was als göttliche Hingabe dargestellt wird, entpuppt sich als schmerzhafte Reise in die Abgründe von Machtmissbrauch. Suzanne Simonin, jung und voller Lebensenergie, findet sich hinter undurchdringlichen Klostermauern wieder. Ihr Wille wird gebrochen, ihre Freiheit verwehrt – bis sie den Mut fasst, sich zu widersetzen. Denis Diderot beleuchtet die strengen Lebensbedingungen in einem Kloster des 18. Jahrhunderts. Mit scharfsinnigem Blick zeichnet er das Schicksal einer Frau, die gegen die Zwänge des Klosterlebens ankämpft. In klarer Sprache schafft Diderot ein eindringliches Bild der damaligen Gesellschaft. "Die Nonne" bietet nicht nur Einblicke in das historische Frankreich, sondern erzählt eine universelle Geschichte über Freiheit und die Suche nach dem eigenen Platz in der Welt. Ein fesselndes Werk, das tiefere Fragen über Menschlichkeit und Gerechtigkeit aufwirft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Denis Diderot
Die Nonne
1. Auflage
ISBN: 978-3-68931-032-5
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nachschrift
Nachwort des Übersetzers
Kapitel 1
Mein Vater war Advokat, er hatte meine Mutter in ziemlich vorgerücktem Alter geheiratet, und sie hatte ihm drei Töchter beschert. Er hatte mehr Vermögen, als nötig war, um sie gut zu versorgen; doch zu diesem Zweck hatte er seine Zärtlichkeit allen Dreien in gleicher Weise zuteil werden lassen müssen; und ich kann ihm leider dieses Lob nicht angedeihen lassen. Zweifellos übertraf ich meine Schwestern durch die Vorzüge des Geistes und der Gestalt; ich war ihnen an Charakter und Talent überlegen; doch es machte mir den Eindruck, als wenn sich meine Eltern darüber betrübten. Wenn jemand zufällig zu meiner Mutter sagte, sie habe reizende Kinder, so durfte mir das niemals gelten. Ich bin zuweilen für diese Ungerechtigkeit gerächt worden, doch die Lobsprüche, die man mir zuteil werden ließ, kamen mir, wenn wir allein waren, so teuer zu stehen, dass ich Gleichgültigkeit und selbst Schimpfworte vorgezogen hätte; je mehr mich die fremden Besucher verhätschelten, eine desto schlimmere Laune trug man gegen mich zur Schau, sobald sie fortgegangen waren. O, wie oft habe ich darüber geweint, dass ich nicht hässlich, dumm, albern, hochmütig, mit einem Wort, mit all’ den Fehlern zur Welt gekommen bin, die meinen Schwestern die Liebe ihrer Eltern verschafften. Ich habe mich gefragt, wie wohl ein Vater und eine Mutter, die sonst durchaus ehrenhaft, gerecht und fromm waren, sich so eigentümlich benehmen konnten. Einige Bemerkungen, die meinem Vater im Zorn entschlüpft sind – denn er war sehr heftig – einige Umstände, die mir zu verschiedenen Zeiten aufgefallen sind, Äußerungen von Nachbarn, von Dienstboten, haben mich einen Grund vermuten lassen, der eine kleine Entschuldigung für sie bieten würde. Vielleicht hegte mein Vater einige Zweifel in Betreff meiner Geburt, vielleicht erinnerte ich meine Mutter an einen Fehltritt, den sie begangen, und an die Undankbarkeit eines Mannes, dem sie zu sehr zu Willen gewesen, was weiß ich? –
Da wir kurz hintereinander zur Welt gekommen waren, so wuchsen wir auch alle drei zusammen auf. Es stellten sich Bewerber ein; meine älteste Schwester erhielt den Antrag eines reizenden jungen Mannes; doch bald bemerkte ich, dass er mich auszeichnete, und ich ahnte, dass sie bald nur der Vorwand, für seine häufigen Besuche sein würde. Ich sah es voraus, dass mir dieses Benehmen Kummer bereiten würde, und setzte meine Mutter davon in Kenntnis. Das ist vielleicht das einzige Mal in meinem Leben gewesen, dass ich etwas ihr Wohlgefälliges getan habe, und wie wurde ich dafür belohnt? Vier Tage später oder wenigstens doch kurze Zeit darauf, sagte man mir, man hätte für mich einen Platz in einem Kloster besorgt, und schon am nächsten Tage wurde ich dorthin überführt. Ich fühlte mich im Hause so unbehaglich, dass mich dieses Ereignis nicht besonders betrübte, und so fuhr ich nach Sainte-Marie – das war mein erstes Kloster – in heiterster Stimmung. Inzwischen vergaß mich der Liebhaber meiner Schwester, als er mich nicht mehr sah, und wurde ihr Gatte. Er heißt K …, ist Notar und lebt in Corbeil, wo er eine höchst unglückliche Ehe führt. Meine zweite Schwester wurde mit einem Herrn Bauchon, einem Seidenwarenhändler in der Straße Quincampoix in Paris verheiratet und lebt mit ihm ziemlich gut. Als meine beiden Schwestern versorgt waren, glaubte ich, man würde auch an mich denken, und ich würde das Kloster bald verlassen. Ich zählte damals 16 1/2 Jahr. Man hatte meinen Schwestern eine bedeutende Mitgift gegeben; ich erhoffte ein dem ihren ähnliches Schicksal, und mein Kopf war von allerlei verführerischen Plänen voll, als man mich eines Tages in das Sprechzimmer rief. Ich erblickte den Pater Seraphin, den Beichtvater meiner Mutter; er war auch der Meinige gewesen, und daher hatte er auch keine Schwierigkeit, mir den Grund seines Besuches zu erklären; es handelte sich darum, mich zu veranlassen, den Schleier zu nehmen. Ich protestierte heftig gegen diesen seltsamen Vorschlag und erklärte ihm frei heraus, ich fühle keinen Beruf für den geistlichen Stand.
„Um so schlimmer“, sagte er zu mir, „denn Ihre Eltern haben sich Ihrer Schwestern wegen vollständig ruiniert, und ich sehe nicht ein, was sie in der beschränkten Lage, in der sie sich befinden, für Sie tun könnten. Denken Sie darüber nach, mein Fräulein; entweder müssen Sie für immer in dieses Haus eintreten, oder sich in ein anderes Provinzkloster begeben, wo man Sie gegen eine mäßige Pension aufnehmen wird, und das Sie erst nach dem Tode Ihrer Eltern verlassen werden, was noch lange dauern kann!“
Ich beklagte mich bitter und vergoss wahre Ströme von Tränen. Die Oberin war bereits in Kenntnis gesetzt und erwartete mich, als ich das Sprechzimmer verließ. Ich war in einer unbeschreiblichen Aufregung.
„Was ist Ihnen denn, mein liebes Kind?“, sagte sie zu mir. „Wie sehen Sie denn aus? Haben Sie Ihren Herrn Vater oder Ihre Frau Mutter verloren?“
Ich wollte schon antworten: „Das wolle Gott!“, doch ich begnügte mich mit den Worten: „Leider habe ich weder Vater noch Mutter; ich bin eine Unglückliche, die man hasst und lebendig begraben will.“
Sie ließ den Sturm vorübergehen und wartete auf den Augenblick der Ruhe. Ich erklärte ihr nun deutlicher, was man mir eben mitgeteilt. Sie schien Mitleid mit mir zu haben und beklagte mich; dann ermutigte sie mich, nicht einen Stand zu ergreifen, für den ich keine Neigung fühlte; außerdem versprach sie mir, für mich zu bitten, Vorstellungen zu machen, und sich für mich zu verwenden. Sie schrieb in der Tat, wusste aber ganz genau die Antwort, die man ihr erteilen würde, und teilte mir dieselbe mit; erst nach längerer Zeit lernte ich an ihrer Aufrichtigkeit zweifeln. Inzwischen kam der Termin, an dem ich meinen Entschluss kundgeben sollte, heran, und sie setzte mich mit guteinstudierter Traurigkeit davon in Kenntnis. Zuerst sprach sie keine Silbe, dann ließ sie einige mitleidige Worte fallen, aus denen ich das Übrige begriff. Wieder fand eine Szene der Verzweiflung statt, und ich glaube, sie weinte wirklich, während sie sagte:
„Nun, mein Kind, Sie werden uns also verlassen? Teures Kind, wir werden uns nicht mehr wiedersehen!“
Dann führte sie noch andere Reden, die ich nicht hörte. Ich war auf einen Stuhl gesunken, schwieg oder schluchzte. Bald blieb ich unbeweglich, bald erhob ich mich, bald lehnte ich mich gegen die Wand, bald hauchte ich meinen Schmerz an ihrem Busen aus.
Nach einer Weile sprach sie Folgendes: „Hören Sie, sagen Sie aber nicht, dass ich Ihnen den Rat gegeben habe; ich zähle auf Ihre unverletzliche Verschwiegenheit; denn ich möchte um keinen Preis der Welt, dass man mir daraus einen Vorwurf machen könne. Was verlangt man von Ihnen? – Dass Sie den Schleier nehmen? Nun wohl, warum nehmen Sie ihn nicht? Wozu verpflichtet denn das? Zu nichts, höchstens, dass Sie noch zwei Jahre bei uns bleiben. In zwei Jahren kann vielerlei geschehen.“
Mit diesen heimtückischen Reden verband sie so viele Liebkosungen, so viele Freundschaftsversicherungen, so viele süße Falschheiten, dass ich mich überreden ließ. Sie schrieb also an meinen Vater, der Brief war vortrefflich: Mein Schmerz und mein Widerstreben waren darin durchaus nicht verhehlt; doch schließlich teilte man meine Einwilligung mit. Mit welcher Eile wurde nun alles vorbereitet, der Tag wurde festgesetzt, meine Kleider angefertigt, und der Tag der Zeremonie war herangerückt, ohne dass ich heute den geringsten Zwischenraum zwischen diesen Dingen entdecken kann.
Ein Doktor der Sorbonne, der Abbé Blain, hielt die Ermahnungsrede, und der Bischof von Aleppo kleidete mich ein. Obwohl die Nonnen eifrig bemüht waren, mich zu stützen, so fühlte ich doch wohl zwanzigmal, wie die Knie unter mir zusammenbrachen, und es fehlte nicht viel, so wäre ich auf den Stufen des Altars niedergesunken. Ich hörte nichts, ich sah nichts, ich war wie verblödet; man führte mich, und ich ging; man fragte mich und antwortete für mich. Indessen nahm diese grausame Zeremonie ein Ende; alle zogen sich zurück, und ich blieb inmitten der Herde, der man mich eben zugesellt hatte. Meine Gefährtinnen umstanden mich; sie umarmten mich und sagten: „Aber seht doch, Schwestern, wie schön sie ist; wie dieser schwarze Schleier die Weiße ihres Teints hebt, wie dieses Band ihr steht, wie es ihr Gesicht umrahmt, wie dieses Kleid ihre Taille und ihre Arme hervortreten lässt.“
Ich hörte sie kaum an, ich war verzweifelt; dennoch musste ich zugeben, dass ich, als ich allein in meiner Zelle war, mich ihrer Schmeicheleien erinnerte. Ich konnte nicht umhin, mich in einem kleinen Spiegel prüfend zu betrachten, und ich glaubte, ihre Worte waren nicht so ganz unangebracht.
Als wir des Abends vom Gebet kamen, trat die Oberin in meine Zelle und sagte, nachdem sie mich eine Weile betrachtet:
„Ich weiß wirklich nicht, warum Sie einen so großen Widerwillen vor diesem Kleid hegen; es steht Ihnen wunderbar, und Sie sind reizend. Schwester Susanne ist eine schöne Nonne; Sie wird man aber noch mehr lieben. Nun lassen Sie einmal sehen; gehen Sie; Sie halten sich nicht gerade genug; Sie dürfen nicht so gebückt gehen …“
Sie richtete mir den Kopf, die Füße, die Hände; dann setzte sie sich und sagte zu mir:
„Es ist gut; jetzt wollen wir aber ein wenig ernsthaft reden. Zwei Jahre wären nun gewonnen; Ihre Eltern können ihren Entschluss ändern. Sie selbst würden vielleicht hierbleiben wollen, wenn jene Sie fortnehmen möchten, das wäre durchaus nicht unmöglich …“
„Madame; glauben Sie das nicht …“
„Sie sind lange unter uns gewesen, doch Sie kennen unser Leben noch nicht; es hat zweifellos seine Leiden, aber es hat auch seine Freuden.“
Man kann sich denken, was sie sonst noch von der Welt und von dem Kloster hinzufügen konnte; das steht überall geschrieben, und zwar überall in derselben Weise, denn Gott sei Dank hat man mich das ganze Zeug lesen lassen, das die Mönche über ihren Stand geschrieben haben, den sie recht wohl kennen und verabscheuen.
Die Einzelheiten eines Noviziats will ich nicht berühren; wenn man es mit der ganzen Strenge beobachtete, so würde man es nicht aushalten; so aber ist es die schönste Zeit des Klosterlebens. Eine Novizenmutter ist immer die nachsichtigste Schwester, die man finden kann; ihr ganzes Streben ist stets darauf gerichtet, einem alle Dornen des Standes zu verbergen, es ist gleichsam ein Kursus der feinsten und ausgeklügelsten Verführung. Unsere Novizenmutter schloss sich ganz besonders an mich an, und ich glaube nicht, dass eine junge unerfahrene Seele dieser verhängnisvollen Kunst zu widerstehen vermag. Hatte ich zweimal hintereinander geniest, so wurde ich von der Messe, vom Gebet, von der Arbeit entbunden; ich ging frühzeitig schlafen und stand spät auf. Die Klosterregel existierte nicht für mich.
Indessen kam die Zeit heran, die ich manchmal durch meine Wünsche zu beschleunigen versuchte. Nun wurde ich träumerisch und fühlte, wie mein Widerwille aufs Neue erwachte, und sogar stärker und stärker wurde. Ich bekannte das der Oberin oder der Novizenmutter. Diese Frauen rächen sich bitter für die Langeweile, die wir ihnen bereiten, denn man darf nicht glauben, dass die heuchlerische Rolle, die sie spielen und die Dummheiten, die sie uns erzählen müssen, ihnen Spaß machen. Das wird ihnen schließlich sehr zuwider; doch sie entschließen sich dazu, und zwar für tausend Taler, die ihrem Hause zufallen. Das ist der wichtige Gegenstand, für den sie ihr Leben lang lügen, und unschuldigen jungen Seelen, vierzig bis fünfzig Jahre lang oder gar ewig ein unglückliches Leben bereiten; denn sicherlich sind von hundert Nonnen, die vor dem fünfzigsten Jahre sterben, gerade fünfundsiebzig verdammt, ganz abgesehen von denen, die vorher wahnsinnig, blödsinnig oder rasend werden.
Eines Tages geschah es, dass eine der Letzteren aus der Zelle, in der man sie gefangen hielt, entwich. Ich sah sie, und niemals war mir etwas Schrecklicheres zu Gesicht gekommen. Mit wirren Haaren und fast unbekleidet, schleppte sie eiserne Ketten nach sich; die Augen irrten wild umher, sie raufte sich die Haare, schlug sich mit den Fäusten auf die Brust und lief heulend herum; dann suchte sie sich unter den schrecklichsten Verwünschungen aus dem Fenster zu stürzen. Das Entsetzen packte mich, ich zitterte an allen Gliedern, und da ich mein Schicksal in dem der Unglücklichen erkannte, so beschloss ich in meinem Herzen, lieber tausendmal zu sterben, als mich einer solchen Gefahr auszusetzen. Man ahnte, welche Wirkung dieses Ereignis auf meinen Geist ausüben könnte und glaubte, dem zuvorkommen zu müssen. Man erzählte mir von dieser Nonne lächerliche, widerspruchsvolle Lügen; sie wäre bereits geistesgestört gewesen, als man sie aufgenommen hätte; sie hätte in einer kritischen Zeit einen Schreck erlitten, wäre Visionen unterworfen und glaubte, mit den Engeln in Verkehr zu stehen. Sie hätte schändliche Bücher gelesen, die ihr den Geist zerrüttet, und sehe jetzt nur noch Dämonen, die Hölle und Flammenschlünde vor sich. Das alles machte auf mich nicht den geringsten Eindruck, denn jeden Augenblick kam mir die wahnsinnige Nonne in den Sinn, und ich schwor mir von Neuem zu, keinerlei Gelübde abzulegen.
Dennoch war der Augenblick gekommen, in dem es sich darum handelte, zu zeigen, ob ich mir selbst Wort zu halten verstand. Eines Morgens nach der Messe trat die Oberin in mein Zimmer; sie hielt einen Brief in der Hand, und ihr Gesicht drückte Niedergeschlagenheit und Traurigkeit aus. Die Arme sanken ihr hernieder, und ihre Hand schien nicht die Kraft zu haben, den Brief zu halten. Ängstlich sah sie mich an, Tränen standen in ihren Augen, sie schwieg, und ich tat dasselbe. Endlich fragte sie mich, wie ich mich befände, die Messe hätte heute recht lang gedauert, ich hätte ein wenig gehustet und schiene unpässlich zu sein.
„Nein, teure Mutter“, antwortete ich darauf.
Sie hielt noch immer den Brief in der Hand; dann legte sie ihn auf die Knie, und ihre Hand verdeckte ihn zum Teil; endlich, nachdem sie noch mehrere Fragen über meinen Vater und meine Mutter an mich gerichtet, sagte sie zu mir:
„Hier ist ein Brief.“
Bei diesen Worten fühlte ich, wie mir das Herz klopfte, und ich fügte mit zitternden Lippen hinzu:
„Ist er von meiner Mutter?“
„Sie haben es erraten; da, lesen Sie!“
Ich fasste mich ein wenig, las den Brief, und zwar zuerst mit ziemlicher Festigkeit, doch je weiter ich kam, desto lauter regten sich verschiedene Leidenschaften in mir, wie Zorn, Schreck, Entrüstung, Ärger. Stellenweise konnte ich das Papier kaum halten, oder ich hielt es, als hätte ich es zerreißen mögen, aber ich drückte es heftig, als fühlte ich mich versucht, es zu zerknittern und weit von mir zu werfen.
„Nun, mein Kind, was wollen wir darauf antworten?“
„Aber, Madame, Sie wissen es doch!“
„Nein, ich weiß nichts. Die Zeiten sind schlimm, Ihre Familie hat Verluste erlitten, die Vermögensverhältnisse Ihrer Schwestern sind zerrüttet; sie haben beide viele Kinder, man hat sich erschöpft, als man sie verheiratete und ruiniert sich, sie zu unterstützen. Es ist unmöglich, Ihnen eine sichere Lebensstellung zu bereiten; Sie haben das Ordenskleid angelegt; man hat sich damit in Unkosten gestürzt; durch diesen Schritt haben Sie Hoffnungen erweckt, und das Gerücht der bevorstehenden Ablegung Ihres Gelübdes hat sich in der Gesellschaft verbreitet. Rechnen Sie übrigens stets auf meinen Beistand. Ich habe niemals jemanden zum Eintritt in den Orden verlockt; das ist ein Stand, zu dem Gott uns beruft, und es ist sehr gefährlich, die menschliche Stimme mit der seinen zu vermischen. Ich will nicht versuchen, zu Ihrem Herzen zu sprechen, wenn die Gnade es Ihnen nicht sagt; bis heute habe ich mir noch nicht das Unglück eines andern vorzuwerfen, und soll ich damit bei Ihnen, mein Kind, die Sie mir so teuer sind, den Anfang machen? Ich habe nicht vergessen, dass Sie die ersten Schritte nur auf mein Zureden getan haben, und werde nicht dulden, dass man Missbrauch mit Ihnen treibe, um Sie gegen Ihren Willen zu etwas zu verpflichten. Verständigen wir uns also; Sie haben keine Neigung für den geistlichen Stand?“
„Nein, Madame!“
„Sie werden Ihren Eltern nicht gehorchen?“
„Nein, Madame!“
„Was wollen Sie dann werden?“
„Alles, nur nicht Nonne; ich will und werde es nicht!“
„Nun gut. Sie sollen es ja auch nicht werden. Doch einigen wir uns wegen einer Antwort an Ihre Mutter.“
Wir einigten uns über einige Gedanken. Sie schrieb einen Brief, der mir recht gut schien. Indessen sandte man mir den Beichtvater des Hauses; man schickte mir auch den Doktor, der mir bei meiner Einkleidung gepredigt hatte; ich sah den Bischof von Aleppo und musste mit frommen Frauen, die sich in meine Angelegenheiten mischten, ohne dass ich sie kannte, Lanzen brechen; es fanden beständige Konferenzen mit Mönchen und Priestern statt; mein Vater kam; meine Schwestern schrieben mir; zuletzt erschien meine Mutter, doch ich widerstand allen. Indessen wurde der Tag meiner Einkleidung bestimmt, man ließ nichts unversucht, meine Einwilligung zu erlangen; doch als man sah, dass es unnütz war, fasste man den Entschluss, ohne meine Zustimmung zum Ziele zu gelangen.
Kapitel 2
Von diesem Augenblick an war ich in meine Zelle eingeschlossen; man gebot mir Schweigen, ich wurde von aller Welt getrennt, mir selbst überlassen, und ich sah klar, dass man entschlossen war, ohne meine Einwilligung über mich zu verfügen. Ich wollte mich zu nichts verpflichten; das war mein fester Wille, und alle wahren und falschen Schrecken, in die man mich unaufhörlich stürzte, erschütterten mich nicht. Ich bekam niemand mehr zu sehen, weder die Oberin, noch die Novizenmutter, noch meine Gefährtinnen. Deshalb ließ ich die Erstere benachrichtigen und tat, als beuge ich mich dem Willen meiner Eltern; doch mein Plan war, dieser Verfolgung ein Ende zu machen und öffentlich gegen die Gewalttat, die man mit mir im Sinne hatte, zu protestieren. Ich sagte also, man könne über mein Schicksal bestimmen, und darüber verfügen, wie man wolle. Jetzt herrschte Freude im ganzen Hause, und mit den Zärtlichkeiten kehrten auch die Schmeicheleien und die Verführungskünste wieder. Gott hatte zu meinem Herzen gesprochen, niemand war für den Zustand der Vollkommenheit besser geschaffen, als ich. Es war unmöglich, dass es hätte anders sein können; man hatte das stets erwartet. Man erfüllte seine Pflichten nicht mit solchem Eifer und solcher Ausdauer, wenn man sich nicht dazu wahrhaft berufen fühlt. Die Novizenmutter hatte nie bei einem ihrer Zöglinge eine besser zutage tretende Berufung bemerkt; sie war über die Laune, die ich gehabt, ganz überrascht gewesen, hatte aber stets zu unserer Oberin gesagt, man müsse nur zu warten wissen, es würde vorübergehen; die besten Nonnen hätten solche Momente gehabt, das wären Einflüsterungen des bösen Geistes, der seine Bemühungen verdoppelte, wenn er sieht, dass ihm seine Beute verloren geht; ich war im Begriff, ihm zu entwischen, und es würde von nun an für mich nur noch Rosen geben; die Pflichten des religiösen Lebens würden mir um so erträglicher erscheinen, als ich sie mir stark übertrieben vorgestellt hatte, und diese plötzliche Erschwerung des Joches wäre eine Gnade des Himmels, der sich dieses Mittels bedient, um es zu erleichtern.
Ich benahm mich sehr vorsichtig und glaubte, für mich bürgen zu können. Ich sah meinen Vater; er sprach in kühlem Tone mit mir; ich sah meine Mutter, sie umarmte mich, ich erhielt Glückwunschschreiben von meinen Schwestern und vielen andern. Ich erfuhr, dass ein Herr Sornin, Vikar von Saint-Roch, die Predigt halten und dass Herr Thierrn, Kanzler der Universität, mein Gelübde entgegennehmen würde. Alles ging gut, bis zum Vorabend des großen Tages, bis auf den Punkt, dass ich erfahren hatte, die Zeremonie würde heimlich stattfinden, es würden derselben sehr wenig Leute beiwohnen, und die Kirchentür würde nur den Verwandten geöffnet werden. Deshalb ließ ich durch die Pförtnerin alle Personen aus der Nachbarschaft, alle meine Freunde und Freundinnen einladen; auch bekam ich die Erlaubnis, einigen meiner Bekannten zu schreiben. Alle diese Leute, die man nicht erwartet hatte, erschienen; man musste sie eintreten lassen, und die Versammlung war ungefähr so groß, wie ich sie zu meinem Plan brauchte.
Man hatte schon am vorigen Abend alles vorbereitet, die Glocken wurden geläutet, um aller Welt zu verkünden, dass ein armes Mädchen unglücklich gemacht werden sollte.
Mir schlug das Herz heftig. Man schmückte mich, denn an diesem Tage wird sorgfältig Toilette gemacht, und wenn ich mir jetzt alle diese Zeremonien wieder vorstelle, so glaube ich, die Sache hat etwas Rührendes und Feierliches für ein unschuldiges junges Mädchen, das ihre Neigung nicht anderswohin zieht. Man führte mich in die Kirche; die Heilige Messe wurde zelebriert, der gute Vikar, der eine Entsagung bei mir voraussetzte, die ich nicht besaß, hielt eine Rede, in der auch nicht ein Wort enthalten war, das nicht mit meinen Gefühlen im Widerspruch gestanden hätte. Endlich rückte der schreckliche Augenblick heran; als ich in den Raum treten sollte, wo ich das Gelübde aussprechen musste, fühlte ich, wie mir die Beine den Dienst versagten; zwei meiner Gefährtinnen nahmen mich unter den Arm; mein Kopf sank auf die Schulter der einen, und ich schleppte mich mühsam weiter. Ich weiß nicht, was in der Seele der Anwesenden vorging, doch sie sahen ein junges sterbendes Opfer, das man zum Altar trug, und von allen Seiten hörte ich Seufzer und Schluchzen; nur von meinem Vater und meiner Mutter hörte ich nichts.
Alle waren aufgestanden, mehrere junge Mädchen waren auf Stühle gestiegen und hielten sich an den Gitterstäben fest. Es trat eine tiefe Pause ein, dann sagte der Priester, der bei meiner Einkleidung den Vorsitz führte:
„Marie Susanne Simonin, geloben Sie Gott Keuschheit, Armut und Gehorsam?“ Mit fester Stimme erwiderte ich ihm:
„Nein, mein Herr, nein.“
Er hielt inne und sagte:
„Mein Kind, fassen Sie sich, und hören Sie mich an!“
„Monseigneur“, versetzte ich, „Sie fragen mich, ob ich Gott Keuschheit, Armut und Gehorsam gelobe, ich habe Sie angehört und sage Ihnen: Nein!“
Damit wandte ich mich zu den Anwesenden, unter denen sich ein ziemlich lautes Gemurmel erhoben hatte; ich machte ein Zeichen, dass ich sprechen wollte, das Gemurmel hörte auf, und ich sagte:
„Ich nehme Sie zum Zeugen, meine Herren, und vor allem Sie, mein Vater und meine Mutter …“
Bei diesen Worten ließ eine der Schwestern den Vorhang fallen, und ich sah ein, dass es unnütz war, fortzufahren. Die Nonnen umringten mich und überhäuften mich mit Vorwürfen, die ich anhörte, ohne ein Wort zu erwidern. Man führte mich in meine Zelle und schloss mich dort ein.
Hier begann ich allein, meinen Betrachtungen überlassen, meine Seele zu beruhigen; ich dachte über meinen Schritt nach und bereute ihn durchaus nicht. Ich sah, dass ich nach dem Aufsehen, das ich erregt, unmöglich länger hier bleiben konnte und dass man vielleicht nicht wieder wagen würde, mich in ein Kloster zu bringen. Was man mit mir anfangen würde, wusste ich nicht, doch es gab für mich nichts Schlimmeres, als wider meinen Willen Nonne zu werden. Ich blieb ziemlich lange, ohne dass auch das geringste Geräusch zu meinen Ohren drang. Die Schwestern, die mir das Essen brachten, stellten es auf die Erde und gingen stillschweigend davon. Nach einem Monat brachte man mir weltliche Kleider, ich zog die Haustracht aus, die Oberin erschien, sagte nur, ich solle ihr folgen und ging voran. Ich ging mit ihr bis zur Klosterpforte. Dort stieg ich in einen Wagen, in dem meine Mutter allein saß und auf mich wartete. Ich nahm auf dem Vordersitz Platz, und der Wagen setzte sich in Bewegung. Wir blieben eine Zeitlang einander gegenübersitzen, ohne ein Wort zu sprechen; ich hielt die Augen gesenkt und wagte nicht, sie anzusehen. Ich weiß nicht, was in meiner Seele vorging, doch plötzlich warf ich mich ihr zu Füßen und legte meinen Kopf auf ihre Knie; sprechen konnte ich nicht, sondern schluchzte nur und weinte. Sie stieß mich heftig zurück; ich erhob mich nicht, sondern ergriff eine ihrer Hände und rief, während ich sie mit meinen Tränen benetzte und küsste:
„Sie sind noch immer meine Mutter, und ich bin doch Ihr Kind.“
Sie antwortete, indem sie mich noch härter zurückstieß und ihre Hände aus den meinen riss:
„Stehe auf, Unglückliche; erhebe dich!“
Ich gehorchte ihr, setzte mich wieder und zog meinen Schleier über das Gesicht. In dem Ton ihrer Stimme lag so viel Autorität und Festigkeit, dass ich glaubte, mich ihren Augen entziehen zu müssen. Meine Tränen rannen an meinen Armen herunter, und ich war damit vollständig bedeckt, ohne dass ich es bemerkt hatte. Wir kamen nach Hause, wo sie mich sogleich in ein kleines Zimmer brachte, das sie für mich hergerichtet hatte.
Damit betrat ich mein neues Gefängnis, in dem ich sechs Monate zubrachte, und wo ich alle Tage vergeblich um die Gnade flehte, sie zu sprechen, meinen Vater wieder zu sehen oder ihnen wenigstens schreiben zu dürfen. Man brachte mir zu essen und bediente mich; eine Magd begleitete mich an den Festtagen zur Messe und schloss mich dann wieder ein. Ich las, ich arbeitete, ich weinte, und manchmal sang ich auch, und so flossen meine Tage dahin. Ein geheimes Gefühl hielt mich aufrecht, das Gefühl, dass ich frei war und dass mein Schicksal, so hart es auch war, sich ändern konnte. Doch es war bestimmt, ich sollte Nonne werden, und ich ward es. Diese unglaubliche Unmenschlichkeit und Hartnäckigkeit vonseiten meiner Eltern bestärkten mich vollends in der Annahme, die ich hinsichtlich meiner Geburt hegte; wenigstens habe ich nie einen anderen Grund finden können, sie zu entschuldigen. Doch was bis dahin nur eine Vermutung war, sollte sich bald in Gewissheit verwandeln.
Während ich zu Hause eingesperrt war, machte ich nur wenige äußerliche Religionsübungen; doch schickte man mich an den Vorabenden der großen Feste zur Beichte. Ich habe bereits gesagt, dass ich denselben Beichtvater wie meine Mutter hatte; ich sprach mit ihm und setzte ihm die ganze Härte des Benehmens auseinander, mit der man seit drei Jahren gegen mich verfuhr.
Er wusste das. Besonders beklagte ich mich über meine Mutter mit Bitterkeit und Groll. Dieser Priester war spät in den geistlichen Stand eingetreten. Er war menschlich gesinnt, hörte mich ruhig an und sagte zu mir:
„Mein Kind, beklagen Sie Ihre Mutter, beklagen Sie sie noch mehr, als Sie sie tadeln, Ihre Seele ist gut, seien Sie überzeugt, dass sie gegen ihren Willen so handelt.“
„Gegen ihren Willen, mein Herr, was kann sie denn dazu zwingen? Hat sie mich nicht in die Welt gesetzt? Und welcher Unterschied besteht denn zwischen mir und meinen Schwestern?“
„Ein großer Unterschied.“
„Ein großer? Ich verstehe Ihre Worte nicht!“
Ich wollte eben einen Vergleich zwischen mir und meinen Schwestern anstellen, als er mich unterbrach und sagte: