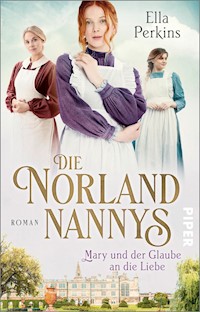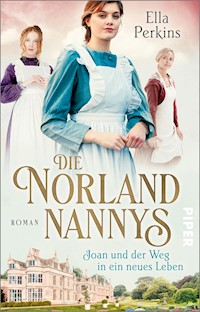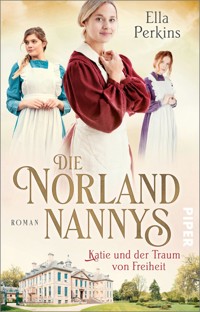
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Aufbruch in eine glänzende Zukunft Deauville 1911. Joan, Mary und Katie treffen sich zu einer kleinen Sommerfrische. Endlich kann Katie sich bei ihren Freundinnen ausweinen. Die intrigante Mutter ihrer Arbeitgeberin und Vertrauten Lady Helena macht ihr das Leben zur Hölle. Als Katie auf ihr Betreiben zu einer simplen Kinderfrau degradiert und sogar eine neue Norland Nanny eingestellt wird, weiß Katie, dass ihre Zeit bei Lady Helena vorüber ist. Sie hat eine Freundin verloren. Noch ahnt sie nicht, dass bald eine neue Herausforderung auf sie wartet: In Berlin will man ihr einen Spross des Kaiserhauses anvertrauen. Historischer Hintergrund: Tauchen Sie mit dieser hinreißenden Roman-Trilogie ein in die Welt der englischen Nannys! Die Norland Nannys und ihre Ausbildungsstätte, das Norland College, gibt es wirklich. Liebevolle, moderne und kindgerechte Pädagogik stand dort von Anfang an im Mittelpunkt – und so ist es noch heute. Emily Ward, eine Pionierin der Kindererziehung in England, gründete das inzwischen legendäre Institut vor ca. 130 Jahren. Dessen Nannys nehmen Englands Upperclass-Kinder inklusive Prinz George und Prinzessin Charlotte unter ihre Fittiche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Die Norland Nannys – Katie und der Traum von Freiheit« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Redaktion: Hanna Bauer
Covergestaltung und -motiv: Johannes Wiebel | punchdesign unter Verwendung von Motiven von shutterstock.com, Rekha Arcangel/arcangel.com und Colin Thomas/bookcoversphotolibrary.com
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Epilog
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Prolog
Paris, Dezember 1891
»Lass deine Schwester in Ruhe, ma chérie.«
»Ich habe nichts gemacht!«, protestierte Katie. Sie stemmte die Hände in die Hüften und blickte an ihrer Mutter vorbei zu ihrer jüngeren Schwester Angélique. Die Achtjährige streckte ihr hinter dem Rücken der Mutter die Zunge raus.
»Sei still. Du bist zwölf und solltest es nun wirklich besser wissen. Sieh dir an, was ihr wieder angerichtet habt.« Anklagend wies Katies Mutter auf die Wolle, die Angéliques Hündchen aus dem Handarbeitskorb gezerrt hatte. Der kleine Terrier bettete sein weißes Wuschelköpfchen auf ein Knäuel rosa Wolle, aus der Angélique ein Paar Handschuhe stricken wollte. Treuherzig blickte er zwischen Katie und ihrer Mutter hin und her.
»Kannst du nicht besser aufpassen?«, fuhr ihre Mutter sie an. »Herrgott, Katherine Fox! Ich kann euch wirklich keine fünf Minuten allein lassen. Und wer räumt das jetzt wieder auf?«
»Aber Maman …«
»Ich will keine Entschuldigungen hören!«
Katie senkte den Kopf. »Ich kümmere mich darum«, flüsterte sie.
»Das will ich auch hoffen. Komm, mein Schatz«, fuhr ihre Mutter an Angelique gewandt fort. »Wir wollen mal nachsehen, ob wir noch ein paar Macarons im Salon für dich auftreiben können. Möchtest du eine heiße Schokolade? Dein Papa kommt bestimmt auch bald heim.«
Ein letzter strenger Blick zu Katie, dann war sie mit dem Hund allein in ihrem Zimmer. »Gib schon her, Napoleon«, knurrte Katie den kleinen Terrier an. Der knurrte zurück und verbiss sich weiter in das kleine flauschige Knäuel. Katie war zum Weinen zumute. Aber sie straffte die Schultern und nahm dem Hund doch noch die Wolle ab. Die war nun eingespeichelt und gar nicht mehr flauschig. Sie bezweifelte, dass Angelique daraus noch Handschuhe stricken würde.
Nachdem Katie das Knäuel wieder aufgewickelt und alles in den Korb geräumt hatte, platzierte sie diesen vorsichtshalber auf der Kommode, damit Napoleon nicht noch einmal in Versuchung geführt wurde. Es störte Katie, dass Angelique am liebsten in ihrem Zimmer spielte. Vermutlich, weil sie danach nicht selbst aufräumen musste. Und Katie hatte in Angeliques Augen natürlich auch die schöneren Spielsachen und die hübscheren Puppen. Sie ging pfleglicher mit ihnen um und nähte auch Kleidchen für sie. Aber als sie nun ihre Biskuitpuppen auf der Kommode zurechtrückte, bemerkte sie, dass bei einem Kleid schon wieder die Spitze am unteren Saum ausgerissen war. Sie holte ihr Nähkörbchen und machte sich daran, die Spitze wieder anzunähen.
Wieso konnte ihr Angelique nicht einfach Bescheid sagen, wenn beim Spielen etwas kaputtging?
Langsam wurde es draußen dunkel. In der großen Wohnung, die Katies Familie bewohnte, war es erstaunlich still; Katie hörte lediglich eines der Hausmädchen vor ihrem Zimmer leise klappern, vermutlich wischte sie Staub.
Ihre Familie, das waren ihre Mutter Samantha, ihre Halbschwester Angelique und ihr Stiefvater Hervé. Über Katies leiblichen Vater verlor ihre Mutter nie ein Wort, und in Katies Erinnerung hatte es nur diese kleine Familie gegeben, nur diese Pariser Wohnung. Ein einziges Mal hatte sich Katies Mutter zu einer Bemerkung über Katies Vater hinreißen lassen. Erst damals hatte Katie erfahren, dass nicht Hervé ihr Papa war. Als sie sich traute, bei ihm Trost zu suchen, hatte er ihr etwas mehr erzählt. Ja, er war nicht ihr leiblicher Vater. Nein, für ihn machte das keinen Unterschied, er liebte Angelique und Katie gleichermaßen.
Nur für ihre Mutter bestand ein Unterschied.
Ihre Mutter und ihre Schwester hatten sie nicht zu heißer Schokolade und Macarons hinzugebeten, und Katie wusste, wenn sie jetzt zu den beiden ging, würde sie das Gefühl haben, fehl am Platz zu sein.
Napoleon hatte dicht an sie gekuschelt auf dem kleinen Sofa ein Nickerchen gehalten. Nun sprang er herunter, gähnte und streckte sich, ehe er die angelehnte Zimmertür aufstieß und verschwand. Seine Pfoten tippelten über den Teppich. Katie ließ das Kleidchen sinken und lauschte. Im Treppenhaus waren schwere Schritte zu hören.
Ihr Stiefvater kam nach Hause. Der Schlüssel drehte sich im Türschloss, dann ging die Tür auf, und der Hund kläffte wild seine Freude heraus, weil das Herrchen endlich zurück war. »Angelique, Katherine! Ich bin zu Hause!«
Katie sprang auf und warf einen kurzen Blick in den Spiegel über ihrem Frisiertisch. Die blonden Haare trug sie zu einem fast schon erwachsenen Knoten frisiert, das hellblau und weiß gestreifte Kleid war aber noch nicht so lang, wie sie es gern tragen würde. »Du bist noch ein Kind!«, war stets das Argument ihrer Mutter, wenn Katie sich beklagte. Dabei war Katie seit dem Sommer in die Höhe geschossen und nun größer als ihre Mutter. Sie schenkte sich im Spiegel ein Lächeln, biss auf ihre Lippen und wischte eine unsichtbare Fluse vom Augenlid. Ihr gefiel, wie ihre blauen Augen strahlten.
Beschwingt verließ sie ihr Zimmer. »Papa!«, rief sie.
»Katie, mein Liebling!« Ihr Vater schloss sie in die Arme. Direkt hinter Katie kam Angelique aus dem Salon, mit rutschenden Söckchen und einer schiefen Samtschleife im Haar. Auf dem Samtkleid prangte ein Kakaofleck, und im Mundwinkel war ein Rest Macaron-Creme sichtbar.
»Papa, hast du mir was mitgebracht?«, rief ihre kleine Schwester sofort.
Hervé Dumont lachte. »Ich kann euch doch nicht jeden Tag etwas mitbringen! Allerdings habe ich für eure Maman eine Kleinigkeit dabei.« Er zauberte hinter seinem breiten Rücken ein kleines Sträußchen Teerosen hervor, das er mit einer tiefen Verbeugung Katies Mutter überreichte.
»Ach, Hervé«, sagte sie mit einem müden Lächeln. »Was hast du diesmal angestellt?«
Mit einem Schlag war die gute Laune dahin. Hervés Lächeln verschwand, und Angelique, die um ihren Vater herumtanzte, hielt in der Bewegung inne. Katie machte einen Schritt nach hinten; sie spürte, wie sich der Ärger zusammenbraute. Ihre Mutter war in dem dunkelgrauen Kleid mit dem goldenen Flechtgürtel wie eine Gewitterwolke, aus der Blitze zuckten.
»Ich habe nichts angestellt, ma chérie«, stotterte Hervé. »Wie kommst du darauf?«
»Schenkst mir Blumen!« Anklagend zeigte ihre Mutter auf die wunderschönen, rosafarbenen Teerosen in ihren Händen. »Was soll ich damit, sollen die mich etwa darüber hinwegtrösten, dass du das Interesse an mir verloren hast? Dass du immer häufiger in deiner Praxis hockst, statt deine Zeit mit der Familie zu verbringen? Meinst du, damit könntest du mich täuschen?«
»Aber meine liebe Samantha …« Hilflos streckte Katies Stiefvater die Hände nach ihr aus.
Katies Mutter warf ihm die Teerosen vor die Füße und trampelte darauf herum. »Spar dir deine Worte!«, fauchte sie. Als sie herumfuhr, bemerkte sie Katie und Angelique, die wie erstarrt hinter ihr standen. »Und ihr, verschwindet! Geht mir aus den Augen, na los!«, rief sie mit von tränenerstickter Stimme. »Ich will euch nicht mehr sehen!«
Weil keiner sich rührte, lief Samantha Dumont an ihren Töchtern vorbei und verschwand im Salon. Die drei zuckten zusammen, als die Tür hinter ihr zuknallte.
»Kommt her, meine Töchter.«
Angelique entzog sich seiner Umarmung. »Ich geh lieber zu Maman«, sagte sie leise und schlich mit gesenktem Kopf, die Arme um ihren schmalen Oberkörper geschlungen, den Flur hinunter.
Katie blieb verlegen vor ihrem Stiefvater stehen. Sie wäre ihrer Schwester gern gefolgt, wusste aber, dass ihre Mutter das nicht wünschte. Es war ja nicht das erste Mal, dass sie einen Streit ihrer Eltern so unmittelbar mitbekam. Doch etwas war anders als sonst. Dass die Laune ihrer Mutter aus dem Nichts umschlug, kannte sie. Aber dass sie ihrem Mann ein Geschenk vor die Füße warf, hatte sie noch nie erlebt.
Hervé Dumont seufzte. Er bückte sich nach dem Teerosenstrauß. »So geht es nicht weiter«, murmelte er.
Das war auch neu. Ihr Stiefvater, der bisher jeden Wutanfall ihrer Mutter klaglos hingenommen hatte. Der sich immer wieder um Versöhnung, Ausgleich und Dialog bemühte. Er wirkte müde. Resigniert.
»Aber was können wir tun?«, fragte Katie leise.
Er legte ihr eine Hand auf die Schulter. Blickte ihr tief in die Augen. »Katherine Fox«, sagte er leise. Sie trug immer noch den Namen ihres leiblichen Vaters. Manchmal dachte sie, dass es das war, was ihre Mutter in ständigen Zorn versetzte. Dass Katie sie an ihr früheres Leben erinnerte.
»Du bist ein wunderbares, kluges und einfühlsames Mädchen. Und ich bin sicher, du wirst …« Er hüstelte. »Du wirst gut auf dich aufpassen, ja? Geh deinen eigenen Weg, Katherine. Versprichst du mir das?«
»Papa«, sagte sie mit dünner Stimme.
»Ja, Katherine.«
»Du klingst so traurig.«
Er lächelte. »Ich bin es auch, kleine Füchsin. Ich fürchte …« Er schüttelte den Kopf, als müsste er sich selbst daran hindern, zu viel zu sagen. »Nein. Deine Mutter ist eine wunderbare Frau. Ich fürchte nur, ich bin nicht der richtige Mann für sie.«
~
Eine Woche später kam es abends, als die Eltern wohl dachten, dass Katie und Angelique schon schliefen, erneut zu einem hässlichen, lauten Streit. Porzellan flog, Stimmen kreischten und brüllten. Angelique schlich zu Katie, und die Mädchen kuschelten sich nebeneinander in das Bett.
»Dann geh doch!«, hörten sie ihre Mutter rufen. »Verschwinde, wenn dir das Leben mit mir so unerträglich ist! Na los! Lass uns im Stich! Wir kommen auch ohne dich aus!«
»Warum ist Maman so böse auf Papa?«, flüsterte Angelique in der Dunkelheit.
Katie drückte sie an sich. »Ich weiß es nicht.« Sie spürte die Veränderung, die unweigerlich ins Haus stand. Und was zunächst eine Ahnung war, sollte sich am nächsten Morgen bestätigen, denn ihre Mutter saß allein am Frühstückstisch, als die Mädchen pünktlich um acht Uhr dort erschienen. In wenigen Tagen war Weihnachten, vor den hohen Fenstern wirbelte der erste Schneesturm des Jahres. Angelique blieb stehen. »Wo ist Papa?«, fragte sie.
Dann sah es auch Katie. Am Tisch waren nur drei Plätze eingedeckt, nicht wie sonst vier. Die Zeitung, sonst immer druckfrisch neben dem Teller ihres Vaters platziert, fehlte ebenso.
»Monsieur Dumont wohnt hier nicht mehr. Und hör auf, ihn Papa zu nennen. Du hast keinen Vater mehr. Hast nie einen gehabt.«
Katie spürte, wie Angelique neben ihr zitterte. Sie legte den Arm um ihre kleine Schwester. Die war allzu oft nervig und machte ihre Sachen kaputt. Aber was ihre Mutter gerade tat, hatte sie nicht verdient. Angelique und Katie liebten ihren Vater, weil er auch sie voller Liebe behandelte. Weil er mit ihnen redete und sie nicht anschrie. Seine ruhige, entspannte Art war wie ein Ausgleich zu den Launen ihrer Mutter. Katie mochte sich gar nicht ausmalen, was sein Verschwinden bedeutete. Nicht nur für die Launen ihrer Mutter, sondern für sie alle.
»Ach, mein Liebling!« Zu Katies Überraschung schob ihre Mutter sie beiseite und schloss ihre jüngere Schwester in die Arme. »Ich weiß, es muss für dich schrecklich sein, dein lieber, guter Papa ist nicht mehr da.« Über Angeliques Kopf hinweg warf sie Katie einen giftigen Blick zu.
Katie verstand nicht, warum ihre Mutter sie so anfunkelte. Sie war noch jung und hatte immerhin so viel begriffen, dass ihre Mutter einen Unterschied machte zwischen ihr und ihrer Halbschwester. Aber Katie vermisste ihn auch …
Es sollte noch viele Jahre dauern, bis sie eine Ahnung bekam, welchen Grund es dafür gab. Warum ihre Mutter ihrer älteren Tochter die Schuld am Scheitern ihre Ehe mit Hervé Dumont gab.
Das junge Mädchen Katie aber lernte vor allem eines: dass es sich nicht lohnte, ihr Herz an andere Menschen zu hängen, denn früher oder später stand sie wieder allein da.
Keine zwei Monate später zog ihre Familie zurück nach England. Während Angelique bei ihrer Mutter blieb, kam Katie in ein Mädcheninternat, bis sie mit sechzehn in ein Pensionat wechselte. Die Ferien verbrachte sie bei ihrer Großmutter. Ihre Mutter interessierte sich nicht mehr für sie, es sei denn, sie brauchte etwas von ihrer Tochter. Über Monsieur Dumont wurde nie wieder ein Wort verloren. Katie jedoch vergaß ihren Stiefvater nie.
Kapitel 1
Deauville, Juli 1911
»Diese Hitze! Sollte es direkt am Meer nicht kühler sein? Puh!« Mit einem kleinen Fächer verschaffte Katies Freundin Joan sich Abkühlung.
»Man sollte meinen, dass wir uns irgendwann daran gewöhnen, dass es in Deauville im Hochsommer auch warme Tage gibt«, kommentierte Mary, die auf Katies anderer Seite in einem der Liegestühle saß.
»Macht mir nur nicht Deauville madig!« Katie verstand bei der Auswahl des alljährlichen Feriendomizils keinen Spaß. Mit ihren Freundinnen Joan Hodges und Mary MacArthur traf sie sich, wann immer es Marys und ihr Zeitplan als Nannys erlaubte, einmal im Jahr in dem wunderschönen Ort in der Normandie.
Joans Fächer bewegte sich hektischer. Aber es nützte nichts – als Engländerin war sie die französische Sommerhitze einfach nicht gewohnt. Katie musste lachen. Ihr machte das Wetter nichts aus. Sie saßen mit Blick auf den Strand unweit der vielen bunten Sonnenschirme, die dieses Jahr zum ersten Mal unterhalb der neuen Strandpromenade aufgestellt worden waren. Jede der drei jungen Frauen trug einen wagenradgroßen Strohhut, damit ihre Gesichter sich in der Sonne nicht bräunten oder gar rot wurden, weil sie sich die Haut verbrannten.
Mary tupfte sich dezent mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn. »Wenigstens regnet es nicht. Wisst ihr noch, letztes Jahr? Den ganzen Aufenthalt hat es uns verhagelt.«
»Schrecklich.« Joan schüttelte es. Sie richtete sich auf. »Edward, lauf nicht zu weit!« Ihr siebenjähriger Sohn rannte mit einem Eimer und einem Kescher Richtung Wasser. Er hob die Hand und winkte ihr zu. Ein wehmütiges Lächeln umspielte Joans Lippen.
»Was denn?«, fragte Katie.
Joans Lächeln schwand. »Ach, ich dachte nur … Er sieht Reginald mit jedem Tag ähnlicher.«
»Ach, Liebes.« Mitfühlend beugte Katie sich zu ihrer Freundin herüber. Sie berührte Joans Arm. »Er wäre stolz auf euch.«
Joan lachte verlegen. Sie war es nicht gewohnt, über ihre Gefühle zu reden, das wusste Katie. Daher wechselte sie rasch das Thema. »Im Übrigen bin ich auch dafür, dass die Kinder mal aufhören zu wachsen. Wohin soll das noch führen? Marina ist nun vier, und wenn Großfürstin Jelena und Prinz Nikolaos nicht bald noch mal Nachwuchs bekommen, werde ich bald arbeitslos!«
»Arbeitslos, du? Niemals!« Mary lachte. »Du bist doch eine der Besten, die unser Norland Institute jemals hervorgebracht hat! Wenn du zu Mrs Ward gehst, wird sie sofort wissen, wo du gebraucht wirst.«
»Aber will ich da auch hin?« Katie runzelte die Stirn. Mary hatte vielleicht recht. Das Norland Institute, das sich der Ausbildung der besten Nannys der Welt verschrieben hatte, bestand nun seit knapp zwanzig Jahren. Katie hatte dort 1902 ihren Abschluss gemacht. Anschließend war sie nach einer einjährigen Episode bei einer italienischen Adelsfamilie ununterbrochen bei dem griechischen Prinzenpaar und kümmerte sich seit der Geburt von Olga, der ältesten Prinzessin, um den Nachwuchs. Die Jüngste, Marina, war inzwischen vier Jahre alt.
»Wer würde sich dem englischen Königshaus verweigern? Oder dem preußischen Kaiserhof?«
»Mach ihr nur keinen Druck«, murmelte Mary. »Zur Not kommst du zu uns. Prinzessin Alice ist kreuzunglücklich, dass sie wieder keinen Sohn bekommen hat.«
»Hat sie dich deshalb überraschend ziehen lassen?«, erkundigte Katie sich. Ursprünglich hatte Mary ihren Aufenthalt in Deauville schweren Herzens abgesagt, da ihre Arbeitgeberin das dritte Kind erwartete. Doch dann hatte sie Anfang Juli geschrieben, sie könne doch kommen.
Mary zuckte mit den Schultern. »Sie sagt das nicht so offen. Aber du hast schon gemerkt, wie sich ein Schatten auf alle legte, als die kleine Cecilia geboren war.«
»Armes Ding«, murmelte Katie mitfühlend.
»Dafür vergöttert Prinz Andreas seine jüngste Tochter.« Mary lächelte versonnen. »Ich habe ihn nie so oft in der Kinderstube gesehen wie in den ersten Lebenswochen der kleinen Cecilia. Sie ist aber auch wunderhübsch und ihrem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten.«
»Das ist immer gut«, murmelte Katie gedankenverloren.
»Was habt ihr nach unserem Urlaub vor?«, fragte Mary, ohne auf Katies Bemerkung einzugehen. Sie hatte von der Sonne winzige Sommersprossen auf der Nase und den Wangenknochen bekommen, die ihre schottische Herkunft betonten. Das hellgrüne Leinenkleid unterstrich das Grün ihrer Augen, und ihre roten Haare, die vor ein paar Jahren noch heller gewesen waren, wurden langsam dunkler. Sie ist hübsch, dachte Katie bewundernd. Nichts erinnerte mehr an das langbeinige, sechzehnjährige Mädchen, das so lange vor den Toren des Norland Institutes herumgelungert hatte, bis es dort als Dienstmädchen arbeiten durfte. Ihr späterer Aufstieg zu einer Norlanderin war ein beschwerlicher Weg gewesen, da Mary aus armen Verhältnissen stammte. Vieles, das für Katie und Joan dank ihrer Herkunft selbstverständlich war, hatte sie sich hart erarbeiten müssen. Doch Mary hatte sich ihren Platz im Leben erobert.
»Wir reisen im Anschluss an Deauville der lieben Verwandtschaft entgegen. Nach Rom.« Joan rekelte sich in ihrem Stuhl. »Schwer vorstellbar, dass ich Lady Rachel drei Jahre lang nicht gesehen habe. Wir werden dort noch ein paar Wochen bleiben, bevor es zurück nach England geht.«
Mary platzte fast vor Stolz. »Ich treffe die Prinzenfamilie in Berlin«, verkündete sie. »Dort wird die kleine Cecilia der Verwandtschaft am kaiserlichen Hof vorgestellt. Anschließend geht es nach London. Sie wird dort ihren Paten kennenlernen.« Marys Blick flackerte. »Den König von England. Ich bin ihm noch nie begegnet …«
»Oh, er ist kein so übler Kerl. Du brauchst nicht aufgeregt zu sein«, witzelte Katie. »Der russische Zar Nikolaus ist da schon ein unangenehmerer Zeitgenosse.«
Mary riss die Augen auf. »Wie sprichst du denn über den König?«, flüsterte sie.
»Du kennst doch unsere Katie. Immer ein bisschen vorlaut«, murmelte Joan.
Katie konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Manche Dinge änderten sich eben nie, dachte sie. Dass Mary immer noch voller Ehrfurcht zum Hochadel aufblickte. Dass Joan mäßigend eingriff. Und sie, nun ja. Sie hatte in den Jahren bei Großfürstin Jelena und Prinz Nikolaos von Griechenland, dem Bruder von Prinz Andreas, wohl ein bisschen den Respekt verlernt.
Es sei denn … Ach nein. Sie wollte sich nicht die gute Laune davon verderben lassen, dass sie schon in wenigen Wochen wieder in Sankt Petersburg unter dem gestrengen Blick von Großfürstin Maria Pawlowna, der Mutter ihrer Dienstherrin, stehen würde. Der Gedanke behagte ihr überhaupt nicht. Die Großfürstin war zugleich die Tante des Zaren, und das ließ sie jeden spüren, der in ihren Augen nicht gleichgestellt war. Vermutlich war es gut, dass Katie sich mit ihr herumärgern musste. Jemand wie Mary würde dabei ziemlich sicher unglücklich werden, weil nichts, was sie tat, den Ansprüchen der Großfürstin genügte.
»Aber was machst du nach Rom?«, wollte sie von Joan wissen. Sie bemerkte den finsteren Blick ihrer Freundin. Falsches Thema, dachte sie.
»Was soll ich schon machen? Ich kümmere mich um die Stiftung und mein Kind. Das war’s.«
»Du könntest immer noch …«
»Sag’s nicht.« Joan machte eine unwirsche Handbewegung. Katie biss sich auf die Lippen. Ihre Freundin wollte nicht über das Norland Institute reden. Oder darüber, welche fantastischen Möglichkeiten sich ihr dort boten. Sie war immerhin vor über fünfzehn Jahren als Studentin dort gewesen, hatte ihren Abschluss gemacht. Im Anschluss war sie mehrere Jahre die Nanny der Kinder von Earl und Countess Dudley gewesen, bevor sie sich in den Bruder von Earl William, Reginald, verliebte, und die beiden gegen die Widerstände aller – vor allem die von Lady Rachel Dudley – heirateten. Kurz nach Edwards Geburt starb Reginald jedoch überraschend an den Komplikationen einer Blinddarmentzündung. Seitdem war sie allein. Eine Zeit lang hatte Joan bei der Familie ihres Schwagers in Dublin gelebt, doch seit einigen Jahren war ihr Lebensmittelpunkt wieder London, wo sie die Norland-Alumni-Stiftung leitete, die Katie und sie ins Leben gerufen hatten. Ein Leben als Nanny war für Joan nicht mehr vorstellbar. Doch sie war immer noch dem Norland Institute verbunden, das wusste Katie.
»Wie alt ist Mrs Ward inzwischen? Sie muss doch mindestens sechzig sein.«
Joan verdrehte die Augen. »Wirklich, Katie. Lass gut sein. Mrs Ward weiß, was sie will. Aber ich weiß auch, was gut für mich ist.«
Katie kniff die Lippen zusammen. Mary hatte den Austausch der beiden verfolgt. »Gibt es etwas, das ihr mir erzählen wollt?«, erkundigte sie sich.
»Es ist nichts«, sagte Joan hastig, doch Katie ließ nicht locker.
»Nun ja, Mrs Emily Ward, Gründerin und seit knapp zwanzig Jahren Leiterin des Norland Institutes, wird sich schon Gedanken machen, wer ihre Nachfolge antritt. Und wenn du mich fragst …«
»Dich fragt aber niemand.« Joan klang nun eindeutig verschnupft, und bei anderen Themen hätte Katie es auch auf sich beruhen lassen. Aber das Norland Institute lag auch ihr am Herzen.
»Du musst doch zugeben, dass sie dich protegiert«, meinte sie.
»Aber wenn ich mir nun mal nicht vorstellen kann, in diese großen Fußstapfen zu treten?«
»Würdest du denn gerne?«, fragte Mary leise.
Joan wollte gerade noch etwas sagen, doch sie verstummte. Sie sah Mary mit ihren großen, braunen Augen an. Blinzelte. Dann blickte sie über den Strand. In der Ferne lief ihr kleiner Sohn herum und versuchte, Krebse mit seinem Kescher zu fangen. Katie beobachtete ihre Freundin aufmerksam. Sie konnte sehen, wie sehr Joan mit sich rang.
»Es ist nicht so einfach«, sagte Joan leise.
Dabei beließen sie es.
Katie drang nicht weiter in ihre Freundin. Sie wusste ja selbst, dass vieles nicht so einfach war, wie es auf den ersten Blick schien. Joan hatte einen Preis dafür bezahlt, dass sie einst ihren Gefühlen nachgegeben und einen Mann geheiratet hatte, der weit über ihr stand. Nach dem kurzen gemeinsamen Glück hatte sie nicht in den Beruf zurückkehren können, den sie vorher so sehr geliebt hatte – wie denn auch mit einem Säugling? Später hatte sie nicht gewollt und sich bewusst dagegen entschieden, weil sie für Edward da sein wollte. Ihre Arbeit für die Norland-Alumni-Stiftung hielt zumindest die Verbindung zum Norland Institute. Aber dass sie sich mehr nicht zutraute – das war verständlich. Schon einmal hatte sie nach den Sternen gegriffen und alles verloren.
Der Tag am Strand hatte Katie gutgetan. Doch sie hatte ihren Freundinnen nicht die ganze Wahrheit gesagt, weshalb sie sich in diesem Sommer besonders auf Deauville gefreut und darauf bestanden hatte, dass sie hierherreisten.
Dieser Umstand bedrückte sie, als sie am frühen Abend in die Pension zurückkehrte, die in einer Seitenstraße lag, ein Stück weit entfernt von der Strandpromenade und den wunderschönen Villen mit ihrer luxuriösen Ausstattung. In der Pension teilte sie sich ein Bad auf dem Flur mit den anderen Gästen. Das mochte für viele Seebadgäste der pure Luxus sein, aber Katie war ein anderes Leben gewohnt. Als Norland Nanny bewohnte sie kleine Apartments in den prächtigsten Palästen.
Na, für eine Woche mochte es schon gehen. Sie hatte in ihrem Zimmer eine Waschschüssel und einen Krug mit frischem Wasser stehen. Nach dem Tag am Strand entkleidete sie sich bis auf die Unterwäsche und wusch sich über der Schüssel. Das kühle Nass tat ihr gut.
An der Rezeption hatte ein Brief auf sie gewartet. In einem frischen, leichten Leinenkleid setzte Katie sich auf den gepolsterten Fenstersitz ihres Zimmers und öffnete den Umschlag. Jelena schrieb, und allein die Vorfreude auf ein paar Zeilen von ihrer Arbeitgeberin zauberte Katie ein Lächeln auf die Lippen.
Liebste Foxie,
Du fehlst uns so sehr hier in Tatoi! Täglich fragen die Kinder nach Dir, und Du wirst Dir denken können, wie sehr Du mir fehlst. Olga und Elizabeth schlafen unruhiger, und die kleine Marina – ach, mein armes kleines Elefantenkind. Manchmal bin ich genauso verzweifelt wie sie und weine mit ihr. Vorgestern kam der Arzt mal wieder, und, nun ja, er hat uns nicht viel Hoffnung gemacht, dass sich das verwächst … Es tut mir so leid, dass ich keine bessere Nachricht habe. Wenn sie keine Schmerzen hat, ist sie das glücklichste Kind von den dreien, so fröhlich und in sich ruhend. Bewundernswert.
Natürlich lasse ich ihrem Fuß jeden Morgen und jeden Abend die Behandlung angedeihen, die Du mir gezeigt hast. Das lasse ich auf keinen Fall eines der anderen Kindermädchen machen! Aber Marina hat Schmerzen, wenn ich ihren Fuß massiere, ich glaube, ich mache es falsch. Zu kräftig oder zu zaghaft? Sie kann es mir leider nicht selbst sagen.
Wann kommst Du zurück, liebste Foxie? Ich weiß, keine hat den Urlaub so sehr verdient wie Du, aber wir brauchen Dich so sehr und, ja, wir vermissen Dich alle ganz schrecklich.
So ging es weiter. Großfürstin Jelena berichtete vom Alltag in dem kleinen Palast Tatoi, in den sich die griechische Königsfamilie jedes Jahr im Sommer zurückzog. Katie hatte das wohlige Gefühl, von einer Freundin, mit der sie Tür an Tür wohnte, ein paar Anekdoten aus dem gemeinsamen Heimatdorf geschickt zu bekommen.
Sie ist deine Arbeitgeberin, ermahnte sie sich. Trotzdem seufzte sie wohlig, als sie den Brief zurück in den Umschlag steckte.
Die jüngste Tochter von Großfürstin Jelena und Prinz Nikolaos war mit einem verformten Fuß zur Welt gekommen – eine Katastrophe für die Eltern. Vor allem Jelena machte sich schreckliche Vorwürfe; sie fürchtete wohl, dass die Behinderung das Leben ihrer Tochter negativ beeinflussen könnte. Katie hatte sie immer ermutigt, die von den Ärzten empfohlenen Behandlungen als Chance zu begreifen, damit Marina ein möglichst unbeschwertes Leben führen konnte. Doch aus Jelenas Zeilen sprach ihre Verunsicherung.
Katie beschloss, in ihrer Antwort gezielt darauf einzugehen, wie wichtig die Massagen waren.
Für den morgigen Tag ging sie noch einmal ihre Garderobe durch. Sie hatte eine Verabredung, die ihr sehr viel bedeutete; sie hoffte, dass alles gut ging.
Dass sie nicht nur wegen der Gesellschaft ihrer Freundinnen nach Deauville gekommen war, wollte sie vorerst für sich behalten. Sie wusste nicht, wie das morgige Treffen ablaufen würde. Und ein wenig fürchtete sie sich davor.
Hoffentlich verstehen wir uns gut.
Sie atmete tief durch. Ganz bestimmt würden sie sich gut verstehen. Früher hatten sie auch eine Basis gefunden …
~
Trotzdem schlug ihr das Herz bis zum Hals, als sie sich am nächsten Morgen auf den Weg zum Grandhotel machte. Sie hatten sich für zehn Uhr in der Lobby verabredet. Katie nickte dem Pagen zu, der ihr die Tür aufhielt. Er neigte den Kopf. In ihrem roten Kleid aus Baumwollmusselin sah sie sehr schick aus; besonders gefiel ihr der mit silbernen Stickereien verzierte Gürtel, der ihre Taille betonte. Sie trug einen Strohhut mit passendem rotem Schleifenband, das hinter ihr herwehte.
In der Lobby des Hotels – viele plüschige Sessel, niedrige Tische, eine gediegene, ruhige Atmosphäre – blickte sie sich um. Ob sie ihn auf Anhieb erkannte? Es war so lange her …
»Katherine, ma chérie!«
Sie drehte sich um. Ein kleiner, untersetzter Mann in den Sechzigern kam auf sie zu. In der Rechten hielt er einen Spazierstock. Katie fiel auf, dass er humpelte. Der Bart war länger und ergraut, der Haaransatz war in den letzten zwanzig Jahren zurückgewichen und die Haare ebenfalls grau. Seine lebhaften blauen Augen hingegen funkelten so fröhlich wie einst.
»Papa!« Jegliche Zurückhaltung war vergessen. Katie eilte ihm entgegen, und obwohl sie vorher nicht gewusst hatte, wie sie sich beim Wiedersehen nach so langer Zeit verhalten sollte, schien es jetzt ganz einfach. Sie umarmten sich sanft und küssten einander auf die Wangen. Sie roch sein Rasierwasser – ein vertrauter Duft – und spürte, wie er leicht zitterte.
»Meine Liebe«, murmelte er. »Es ist so lange her.«
Sie hätte am liebsten geweint. »Es tut mir so leid«, flüsterte sie.
»Nein, nein! Entschuldige dich für nichts.«
»Ich hätte dich eher suchen sollen.«
»Ah.« Er ließ sie los und bückte sich nach dem Spazierstock, den er bei der Begrüßung fallen gelassen hatte. »Gräm dich nicht deswegen. Du warst damals ja noch ein Kind.«
Sie schwieg verlegen.
Hervé Dumont seufzte. »Ah, wenn ich dich ansehe, wird mir erst bewusst, wie viele Jahre vergangen sind«, stellte er fest. »Ich freue mich so sehr, dich noch einmal zu sehen. Geht es dir gut?«
»Ja, danke. Und dir?«
Er machte eine wegwerfende Handbewegung. »Lass uns lieber über Erfreuliches reden. Darf ich dich zu einem opulenten Frühstück einladen? Ich möchte alles über dich und dein Leben erfahren.«
Katie hakte sich bei ihm unter. »Nur, wenn du mir auch erzählst, wie es dir ergangen ist, Hervé«, sagte sie.
Er tätschelte ihre Hand. »Ich erzähle dir alles, aber du wirst enttäuscht sein, fürchte ich. Mein Leben ist nicht annähernd so glamourös wie deines.«
Es war so leicht. Katie wunderte sich, doch sie lief neben ihrem Stiefvater in den Speisesaal, als hätten sie sich vor zwanzig Minuten das letzte Mal gesehen und nicht vor zwanzig Jahren. Sie war so froh und erfüllt von der Möglichkeit, ihn endlich wiederzutreffen. Er schlug vor, sie könnten sich auf die Terrasse setzen, wo sie mit Blick auf die Promenade und dahinter das Meer ihr Frühstück einnehmen konnten. Ein Kellner war sogleich zur Stelle, er rückte Katies Stuhl hervor, nahm ihre Bestellungen auf und zog sich diskret zurück.
»Gut siehst du aus«, sagte er. »Eine erwachsene Frau.« Er schüttelte den Kopf, als müsste er darüber staunen. Katie hob stumm die Augenbrauen. »Ich dachte nur gerade … so viele Jahre, in denen ich es nicht gewagt habe, mich über den Willen deiner Mutter hinwegzusetzen. Sie hat mir untersagt, mit dir oder Angelique Kontakt aufzunehmen. Und nun sitzen wir hier, weil mein Bruder gestorben ist.«
Sie verdankten es tatsächlich Hervés Bruder, dass sie wieder Kontakt hatten. In seinem Testament hatte er Angelique und ebenso Katie eine kleine Summe vermacht, und der Anwalt von François Dumont hatte daraufhin Katie ausfindig gemacht. Sie hatte gezögert, ehe sie ihn fragte, ob er ihr die Kontaktdaten ihres Stiefvaters geben könne. Die Antwort aber kam prompt – direkt von Hervé, der sich freute, von ihr zu hören.
»Und nun erzähl mir von dir.«
Und das tat sie. Ohne auf die Jugendjahre einzugehen, die sie rückblickend nach Hervés Verschwinden als trübe und deprimierend empfand, begann sie ihre Schilderung bei der Ausbildungszeit am Norland Institute. Sie übersprang auch die Zeit bei den Ruspolis, in der sie an ihrem Beruf gezweifelt hatte, und hielt sich an die ereignisreichen Jahre am griechischen Hof. Sie berichtete von Reisen, vom Glanz der Herrscherhäuser und von den alltäglichen Begebenheiten in der Kinderstube. Derweil genossen sie ihr Frühstück und die frische Brise, die vom Meer heraufwehte.
»Ein ereignisreiches Leben«, stellte Hervé Dumont fest. Er lehnte sich zurück, klopfte die Westentaschen nach einem Streichholzbriefchen ab. »Du hast viel erreicht. Bist viel unterwegs …«
»Ach …« Aber insgeheim erfüllten seine Worte sie mit Stolz. »Es ist ein gutes Leben, und ich mag es.«
»Was hält deine Mutter davon, wenn du so viel unterwegs bist?«
Katie fegte ein paar Croissantkrümel zusammen und ließ sie auf ihren Teller rieseln. »Wir haben selten Kontakt. Und bisher hatte ich nicht den Eindruck, dass sie sich sonderlich für mich interessiert.«
»Sie scheint sich nicht geändert zu haben. Und Angelique? Von ihr habe ich leider nichts gehört. Sie hat nur das Geld genommen.« Er berührte seine Kaffeetasse, klimperte mit dem Silberlöffel. »Geht es ihr gut?«
Katie zuckte mit den Schultern. Ihre jüngere Schwester … Wie sollte sie es ausdrücken? »Sie lebt noch bei Mutter. Ich weiß nicht, ob sie glücklich ist.«
»Die beiden …«
Katie wusste, was er sagen wollte, und fiel ihm ins Wort. »Sie waren immer eine Einheit, und du und ich, wir konnten nicht dazwischenkommen. Aber das ging von Maman aus, nicht von Angelique.«
»Du hast recht. Wollen wir ein wenig am Strand spazieren gehen? Leider muss ich morgen schon zurück nach Paris. Bis dahin möchte ich noch möglichst viel Zeit mit dir verbringen.«
»Gerne. Aber nur, wenn du mir von deinem Leben erzählst.« Ihr war nicht entgangen, dass er ihr vor allem Fragen gestellt hatte, damit sie nicht ihrerseits nach seinem Werdegang fragte.
»Einverstanden.« Er neigte den Kopf.
Sie machten sich auf den Weg. Katie hakte sich wieder bei ihm unter und passte ihre Schritte den seinen an. »Was ist mit deinem Bein passiert?«
»Ach, das. Eine Entzündung am Fuß. Vor ein paar Jahren. Hat mich fast das Leben gekostet, aber wie durch ein Wunder und dank der beherzten Amputation eines Kollegen habe ich überlebt.« Er blieb stehen und zog das Hosenbein ein Stück nach oben. Darunter erkannte sie eine Art Holzbein. »Damit komme ich ganz gut voran. Aber große Alpenwanderungen sollte ich wohl nicht mehr machen.«
»Das tut mir leid. Wann ist es passiert?«
»Ach, muss es nicht. Dinge passieren, wir verlieren Menschen aus dem Blick …«
»Und manchmal finden wir sie auch wieder.«
»Ja, so.«
Sie lächelten einander an. Katie drückte seinen Arm. »Ich möchte dich nicht noch mal verlieren, hörst du? Egal, was kommt. Auch wenn Maman dagegen ist, dass wir Kontakt halten.«
»Ich möchte mich auf keinen Fall zwischen dich und deine Mutter drängen«, sagte er leise.
»Das tust du nicht.« Katie atmete tief durch. »Maman hat damals ihre Entscheidung getroffen, und ebenso darf ich heute entscheiden, dass ich dich gern sehen möchte.«
»Hast du ihr von unserem Treffen erzählt?«
Katie schüttelte den Kopf. Ihren Vater auch nur zu erwähnen, hätte vermutlich zu einer üblen Schimpftirade geführt, wenngleich nur in Form eines Briefs, da sie ihre Mutter selten besuchte. Selbst dem wollte sie sich lieber nicht aussetzen.
»Wie lange bleibst du in Deauville?«
»Nur bis Samstag. Danach reise ich nach London. Dort habe ich noch etwas zu erledigen«, fügte sie erklärend hinzu.
»Und anschließend zurück nach Griechenland?«
Sie nickte. Wusste schon, was er als Nächstes sagen würde.
»Ist es denn sicher in Griechenland für dich? Als Bedienstete dieser Königsfamilie? Man liest so einiges in den Zeitungen.«
»Sicherer als außerhalb des Palastes«, sagte sie leise.
Die politische Lage in Griechenland hatte sich in den vergangenen Jahren immer wieder verschärft. Der Vater von Prinz Nikolaos, König Georg I., hatte zu Beginn seiner Regentschaft vor über vierzig Jahren einige Fehler gemacht; immer wieder hatte er sich in die Regierungsgeschäfte eingemischt, was ihm aber verfassungsgemäß gar nicht zustand. In den Jahrzehnten danach hatte Griechenland manche innenpolitische Krise gesehen. Und auch wenn sich die Situation aktuell etwas entspannt hatte, spürte wohl jeder in Europa die schwelende Unruhe. Eingezwängt zwischen dem Osmanischen Reich und dem Balkan versuchte der Ministerpräsident von Griechenland, Eleftherios Venizelos, durch massive Aufrüstung sein Land auf einen Krieg vorzubereiten, der unausweichlich schien.
Das allerdings waren Dinge, von denen Katie in ihrem Alltag wenig mitbekam. Die häusliche Sphäre im Königshaus der Hellenen war strikt getrennt von den militärisch oder politisch geprägten Bereichen, in denen sich Nikolaos bei seinen Aufenthalten in Athen mit seinem Vater, dem König, und Kronprinz Konstantin beriet. Politik war nichts für Frauen, darin war man sich in der Familie einig. Also, die Männer waren sich einig.
Dabei wusste Katie, dass auch Großfürstin Jelena sehr durchdachte Auffassungen über das Wohlergehen ihres Lands hatte; im Gespräch versuchte sie oft, Katie darzulegen, warum Griechenland stark sein musste. Wo die Gefahren drohten. Weshalb es wichtig war, dass Kreta Teil der Nation wurde und der Dodekanes nicht aufgegeben wurde, obwohl Italien Anspruch auf die Inselgruppe in der östlichen Ägäis erhob und das Osmanische Reich immer wieder seine Fühler ausstreckte.
»Prinz Nikolaos hat das Wohl seiner Familie im Blick«, fuhr sie fort. »Wenn die Situation in Athen für uns zu gefährlich wird, werden wir bestimmt das Land verlassen. Die Kinder werden die Ersten sein, die sie in Sicherheit bringen.«
»Und dich mit ihnen.« Dennoch wirkte ihr Stiefvater nachdenklich. »Die Welt ist schwer verständlich geworden«, murmelte er. »Die große Politik ist so verworren … Wenn es auf dem Balkan zum Krieg kommt, wird das Schockwellen aussenden, die ganz Europa erfassen könnten … oder die Welt.«
Katie schauderte. Die Worte ihres Stiefvaters klangen so unheilvoll …
»Na, dann hoffen wir einfach, dass es nicht so weit kommt«, sagte sie betont munter. Zumindest für diesen Moment des Wiedersehens wollte sie die Welt da draußen ausschließen.
Kapitel 2
Irgendwann gewöhne ich mich eventuell auch an den Luxus, dachte Mary amüsiert. Aber bis dahin werde ich jedes Mal aufs Neue staunen, was möglich ist.
Sie hatte sich für den Urlaub dieses Jahr ein Hotelzimmer mit Bad en suite gegönnt. Das kostete zwar einen Teil ihrer Ersparnisse, aber sie merkte selbst, dass dieser Luxus ihr etwas bedeutete. Und dass sie ihn genoss.
Sie saß auf einem Hocker neben der Badewanne, in die das fast dampfend heiße Wasser rauschte. Die roten Locken hatte sie gelöst und entwirrte sie mit einem grobzinkigen Ebenholzkamm. Draußen wurde es bereits Nacht. Sie hatte den Tag mit Joan und deren Sohn am Strand verbracht. Stundenlang waren sie auf und ab spaziert, hatten Muscheln und Taschenkrebse in einem Eimer gesammelt. Sie hatte ihre Röcke gerafft und war mit Edward bis zur Wasserlinie gelaufen, wo sie winzige Quallen mit der Schaufel auflasen und die nackten Zehen in den Sand gruben. Sie hatte den Tag so sehr genossen – Edwards unermüdliche Neugier, sein sonniges Wesen. Sie mochte den kleinen Jungen, auch wenn er sie an zwei andere kleine Jungen erinnerte, die sie seit Jahren schon nicht mehr gesehen hatte …
Oscar müsste in Edwards Alter sein, dachte Mary. Damit wäre er so alt wie Thomas damals, als ich zu der Familie kam … Nein, etwas älter. Ob die beiden sich noch an mich erinnern?
Sie seufzte und drehte das Wasser ab. Sobald ihr Verstand zur Ruhe kam, wurden diese Erinnerungen wach. Sie konnte nichts dagegen tun. Auch fünf Jahre nach ihrem Weggang aus Bethersden erschien ihr das halbe Jahr, das sie als Nanny für Oscar und Thomas Mixon verantwortlich gewesen war, wie eine Ewigkeit. Länger jedenfalls als die fünf Jahre, die sie seither ohne Unterbrechung im Dienst von Prinzessin Alice und Prinz Andreas von Griechenland verbracht hatte. Woran mochte das liegen, dass ihr manches von damals noch so deutlich vor Augen stand, während die Athener Jahre an ihr vorbeiflogen, ohne merkliche Spuren zu hinterlassen?
Sie ließ die Baderobe von ihren Schultern gleiten und stieg in die Wanne. Heiß umschmiegte das Badewasser erst ihre Waden, dann Oberschenkel, Hintern, Bauch und schließlich ihre Brüste und Schultern. Sie ließ die Arme unter Wasser gleiten und spürte das heiße Kribbeln, das sich an ihrem Körper ausbreitete und aus allen Ecken bis in ihren Scheitel brandete. Sie wusste, schon in wenigen Minuten würde ihre Haut vom heißen Wasser krebsrot sein, und bis dahin würde jede Bewegung von der Hitze schmerzen. Aber sie genoss diese Hitze. Sie versuchte, ihre Gedanken auf etwas anderes zu richten als ihre Zeit in Bethersden.
Aber das gelang ihr nicht.
Vielleicht lag es daran, dass es niemanden gab, mit dem sie darüber reden konnte, was damals in Bethersden und wenige Monate später in London passiert war. Was das mit ihr gemacht hatte.
Sie hatte sich in ihren Dienstherrn verliebt – und er sich in sie. Doch Oliver Mixon, frisch verwitwet und noch zu tief in seiner Trauer vergraben, hatte nicht den Mut gehabt, sich zu seinen Gefühlen und der Nanny seiner Kinder zu bekennen. Mary ihrerseits hatte sich ihrer Aufgabe verpflichtet gefühlt; und das war die Versorgung der beiden Söhne. Oscar und Thomas waren nach dem Tod ihrer Mutter verloren gewesen, doch mit der Ankunft von Cora, der Cousine der verstorbenen Mrs Mixon, mit der ihr Arbeitgeber sich schließlich verlobte, schien sich alles zum Guten zu wenden – zumindest hatte Mary sich das eingeredet. Sie hatte wohl gesehen, dass Cora mit den Kindern nicht viel anzufangen wusste. Für Mary aber war kein Platz mehr im Haushalt, und sie reichte ihre Kündigung ein. Alles daran war ihr schwergefallen, denn schon der Weg, um Nanny zu werden, war für sie steiniger gewesen als für Joan oder Katie. Ihre Freundinnen hatten dank der finanziellen Situation ihrer Familien aus dem Vollen schöpfen können. Das Schulgeld für das Norland Institute war einfach da, während Mary jeden Penny umdrehen musste und es letztlich einem Förderprogramm des Norland Institutes und der Norland-Alumni-Stiftung, die Joan Hodges damals gründete, zu verdanken hatte, dass sie ihre Ausbildung beenden konnte. Sie fühlte sich dem Norland Institute und Joan verpflichtet, daran hatte sich in den vergangenen fünf Jahren nichts geändert.
Aber ihre Gefühle für Oliver waren immer noch dieselben wie an jenem verregneten Maiabend vor fünf Jahren, als er sie aufgesucht hatte. Damals war sie erst seit Kurzem die Nanny für die kleine Margarita, und an jenem Abend wurde die zweite Tochter von Prinzessin Alice geboren. Mary erinnerte sich, wie Oliver vor ihr stand. Wie er wissen wollte, ob er das Richtige tat, wenn er die Cousine seiner toten Frau heiratete.
Sie hätte so gern etwas anderes geantwortet, aber ihr Pflichtbewusstsein ließ nur eine Antwort zu.
Ich freue mich für euch.
Sie hatte es wirklich versucht, sich für ihn zu freuen. Doch in den Jahren seither hatten die letzten Sätze, die sie mit Oliver wechselte, sich in ihr Gedächtnis gegraben, und tief in ihr gab es immer noch den Wunsch, dass sie damals etwas anderes geantwortet hätte.
Ohne dass sie es merkte, rannen Tränen über ihre Wangen. Dieser Schmerz, diese Sehnsucht …
Griechenland half. Das Leben dort unterschied sich in so vielen Belangen von dem in England. Aber nun war sie für ein paar Tage in Deauville, und sie hatte Joan und Katie noch nichts davon gesagt, doch auch sie plante im Anschluss eine Reise nach London. Zu ihrer Familie. Drei Jahre war sie nicht dort gewesen. Es war höchste Zeit.
Ihre Schwester Theresa war inzwischen alt genug, sich um ihre Zukunft Gedanken zu machen. Finn war zu einem allseits bewunderten Kaufmann aufgestiegen, vier Läden besaß er nun. Auch die jüngeren Geschwister besuchten dank Marys Unterstützung weiterhin die Schule, und ihre Mutter, die sich gelegentlich hinsetzte und Mary einen Brief schrieb, war nicht mehr ständig in Sorge, woher sie die nächste Mahlzeit nehmen sollte oder wie sie am Ende des Monats die Miete aufbringen konnte.
Das alles war auch Marys Verdienst. Das wusste sie. So vieles hatte sie im Leben erreicht, das sie nie für möglich gehalten hatte.
Dennoch – da war eine Leere in ihr. Und sie wusste, diese würde wohl nie gefüllt werden.
Mit einem Seufzen sank Mary tiefer in das heiße Wasser. Ihre Hände glitten über ihren Bauch, tauchten tief unter, streichelten ihre Hüften … Sie wusste, wie verboten es war, sich selbst zu berühren, doch wie konnte etwas verboten sein, das sich so gut anfühlte? Sie schloss die Augen, ließ kleine Wellen über ihre Brüste schwappen und gestattete sich, mit einer Hand zwischen ihre Beine zu wandern …
Mit der Lust kam die Erinnerung an ihn noch lebhafter zurück. Oliver. Die schönsten gemeinsamen Stunden hatten sie in seinem Arbeitszimmer in Bethersden verbracht, manchmal mit einem Glas Wein, doch immer mit einem gewissen Abstand zwischen sich, beide in den Sofaecken, damit es nicht zu flüchtigen, versehentlichen Berührungen kam … Und doch hatte damals die Luft zwischen ihnen geknistert. Mehr als einmal hatte sie sich den Mut gewünscht, die unsichtbare Grenze zu überschreiten. Ihn zu küssen. Ihm nahe zu sein.
Sie stellte sich vor, was er mit ihr gemacht hätte, wenn sie es ihm erlaubt hätte … Damals, als alles möglich schien …
Kapitel 3
Rom, Juli 1911
Gut möglich, dass Joans Schwägerin nach der langen Heimreise aus Australien schlicht zu erschöpft war, um freundliche Worte für sie zu finden.
Schweren Herzens hatte Joan sich vor wenigen Tagen in Deauville von ihren Freundinnen verabschiedet.
Doch als Joan und Lady Rachel sich auf der Hotelterrasse in Rom nach drei Jahren wiedersahen, runzelte Joans Schwägerin die Stirn und maß sie mit Blicken von Kopf bis Fuß, als sei Joans leicht geschnürtes Leinenkleid eine modische Zumutung. Joan empfand eher die Hitze als Zumutung, und sie war froh, mit Lady Rachel im Schatten eines ausladenden Sonnenschirms Platz nehmen zu können. Diener eilten herbei und servierten das Frühstück.
»Wie geht es dir?«, erkundigte Joan sich freundlich.
»Wie soll es mir schon gehen?« Lady Rachel verdrehte die Augen. »Kaum sind wir wieder in Europa, gibt es nur Ärger.«
»Wer macht denn Ärger?«
Joan ahnte die Antwort. Sie war eine Bürgerliche, nur durch Zufall und dank Reginalds Liebe und Durchsetzungsvermögen war sie Teil der Familie geworden. Manche nahmen ihr das auch jetzt, nach über neun Jahren, noch übel. Es musste sich wohl um sie selbst handeln, die für Ärger sorgte.
Lady Rachels nächste Worte gaben ihr recht. »Lady Georgina hat mir berichtet, du hättest die meisten Einladungen ausgeschlagen, die sie dir in den vergangenen Jahren zukommen ließ. Das verstehe ich nicht, meine Liebe.« Sie runzelte die Stirn. »Was ist da los?«
Joan wusste für einen Moment nicht, was sie darauf antworten sollte, denn Lady Rachel sprach Probleme sonst eher indirekt an. Es musste ihr schon sehr auf der Seele brennen, wenn sie so deutliche Worte wählte. Hatte ihre Schwiegermutter Lady Georgina ihr Druck gemacht?
Und waren es nicht einst Lady Rachel und Lord William gewesen, die nach der Hochzeit Wert darauf gelegt hatten, dass Joan mit ihrer bürgerlichen Herkunft – ihr Onkel war Kaufmann, Herrgott noch mal! – lieber nicht zu oft in Erscheinung trat? Immerhin war Lord Dudley mit dem König befreundet, und Lady Georgina war einst bei Königin Alexandra ein und aus gegangen.
Aber nun war Joans Zurückhaltung nicht mehr richtig?
»Was genau stört dich daran?«, erkundigte Joan sich sanft. »Bisher hatte ich nicht den Eindruck, die Familie lege viel Wert auf meine Anwesenheit. Im Gegenteil, oftmals erfolgten Einladungen eher aus Pflichtgefühl, weniger von der Hoffnung getragen, ich könnte tatsächlich eine Teilnahme an einer Soiree in Erwägung ziehen.«
Sie sah ihrer Schwägerin an, dass diese sich einen bissigen Kommentar verkneifen musste. »Nun, mich stört, dass du nicht mal versuchst, Teil der Familie zu sein. Wenigstens für Edward könntest du dir etwas mehr Mühe geben. Wir alle hätten gern mehr von ihm. Er ist alles, was uns von Reginald geblieben ist, verstehst du?«
Joan musste an sich halten, darauf nicht scharf zu antworten. Es geschah ja nicht zum ersten Mal, dass sie den Erwartungen der Dudleys nicht entsprach. Deshalb war sie inzwischen auch souveräner, wenn es darum ging, für sich einzustehen. Sie beugte sich vor und winkte einem Diener, der im Schatten einer Pergola wartete. Als er herankam, bestellte sie bei ihm einen Espresso. Den würde sie später bereuen, denn dieses neumodische kleine Kaffeegetränk, das so ähnlich wie ein Mokka schmeckte, war besonders stark.
Erst dann wandte sie sich wieder ihrer Schwägerin zu. Lady Rachel Dudley war inzwischen zweiundvierzig Jahre alt. Sie achtete sehr auf ihr Äußeres, aber selbst an ihr waren die sieben Schwangerschaften und die vielen Reisejahre nicht spurlos vorbeigegangen. Sie sieht müde aus, dachte Joan überrascht.
»Ich verstehe deinen Unmut«, sagte sie leise. »Eure Zeit in Australien war ja auch von einigen … Skandalen überschattet.«
Lady Rachel kniff die Lippen zusammen. »Das war nichts«, behauptete sie. »Nur ein paar Politiker von der Labourpartei, die Anstoß daran nahmen, dass wir repräsentative Funktionen ausüben und dafür entsprechend residieren müssen.«
Joan hatte nicht nur darüber gelesen, sondern mehr als einmal mit ihrem Onkel George darüber diskutiert; in ihm schlummerte schon immer ein kleiner Sozialist. Er konnte zwar durchaus die Hilfsprojekte von Lady Rachel anerkennen, die sowohl in Irland als auch in Australien viel für die medizinische Versorgung der einfachen Leute getan hatten. Doch das war für ihn Augenwischerei – damit wollten die Adeligen nur ihr schlechtes Gewissen beruhigen, von dem sie ja behaupteten, sie hätten es gar nicht.
Joan versuchte, das Thema zu wechseln, doch Lady Rachel geriet nun erst richtig in Fahrt. »Du weißt ja nicht, wie das ist«, erklärte sie. Ihre Stimme gewann an Schärfe, und den Diener, der mit Joans Espresso kam, verscheuchte sie mit wilder Handbewegung wie eine bissige Fliege. »Ständig unter Beobachtung. Jede Ausgabe mussten wir rechtfertigen. Wozu wir zwei Residenzen brauchen. Weshalb wir den Kontinent auf einer Jacht umrundet haben. Sind die nicht auf die Idee gekommen, dass uns viel daran gelegen war, Australien kennenzulernen? Warum macht man so etwas, Joan? Wir dienen dem Volk, Lord William unternimmt wirklich alles, damit jeder gerechten Lohn für seine Arbeit erhält. Und meine wohltätige Arbeit? Die wird einfach hingenommen, als wäre ich dazu verpflichtet, mich so hervorzutun. Weißt du, wie anstrengend das war? Wir hatten von Anfang an keine Chance. Der Premierminister von Australien, dieser Fisher«, sie spuckte den Namen förmlich aus, »der hat uns vom ersten Tag an wie Pack behandelt. Unsere Anwesenheit hat ihn so sehr gestört, dass William lieber um seine Abberufung gebeten hat.«
Joan hatte das anders gelesen. Aber was wusste sie schon. An diesem wunderschönen Sommertag in Rom wollte sie nicht länger mit Lady Rachel streiten. Außerdem hatte sie inzwischen gelernt, dass es ihr nichts brachte, mit ihrer Schwägerin zu diskutieren. Sie hatten eben unterschiedliche Auffassungen. Lady Rachel versuchte gelegentlich, Reginald für sich zu vereinnahmen, aber dann wurde Joan recht energisch. Sie wusste, dass ihr verstorbener Mann ihr zugestimmt hätte – in allen Belangen.
»Wenn unsere Schwiegermutter jemanden brauchte, der sie bei der Repräsentation unterstützt, hätte sie Lady Amelia fragen können«, bemerkte Joan.
Lady Rachel spitzte die Lippen. »Wir beide wissen, wie ungeeignet unsere liebe Schwägerin Amelia für derlei ist.«
Natürlich. Amelia war ein Freigeist, sie ließ sich erst recht nicht sagen, was sie im Dienst der Familie zu tun hatte.
»Dann solltest du wissen, dass ich noch viel weniger geeignet bin. Lady Amelia ist immerhin eine Schwester deines Mannes.«
»Aber ihre Ansichten!«
»Liberal, na und? Die triffst du bei mir auch an.«
»Ja, aber bei dir rechnet man damit. Es ist fast ein wenig erfrischend, wenn eine Bürgerliche sich auf diese Art hervortut. Man sollte meinen, dass du in der Gesellschaft weißt, wann du den Mund halten solltest. Lady Amelia weiß das nicht.«
»Ach, ihr wollt also ein stummes Anhängsel, das Lady Georgina überallhin begleitet?« Joan schüttelte den Kopf. Fast war ihr nach Lachen zumute. »Wirklich, Rachel. Du solltest mich inzwischen besser kennen.«
»Ach ja.« Sie schüttelte den Kopf und schmunzelte. »Entschuldige, ich habe das wohl wirklich verdrängt.«
»Und Lady Georgina kennt meine Adresse. Wenn ihr etwas daran missfällt, wie ich mich verhalte, kann sie mir das jederzeit persönlich sagen.«
»Sie tut es schon wieder, hm?« Lady Rachel wirkte nachdenklich.
»Uns gegeneinander ausspielen? Aber ja. Hat sie immer schon getan.«
Joan grollte weder Lady Rachel noch ihrer Schwiegermutter, mit der sie den Kontakt tatsächlich möglichst gering hielt. Die Dowager Countess glaubte immer noch, dass sie der Mittelpunkt der Welt sei. Ginge es nach ihr, müsste Joan ihr regelmäßig Bericht erstatten. Über die schulischen Leistungen ihres Enkels, über Joans Befinden und darüber, ob sie irgendwelchen »Unfug« plante, wobei Unfug in den Augen der Dowager Countess alles umfasste, was sich nicht schickte. Und das war deutlich mehr als das, was sie für angemessen hielt. Doch auch ohne Joans regelmäßige Rapporte war sie vermutlich bestens über ihr Privatleben unterrichtet.
»Und wie ist es dir in den vergangenen drei Jahren ergangen?«, erkundigte sich Lady Rachel. »Ich meine vor allem … dein Privatleben.«
»Da gibt es nicht viel zu berichten«, behauptete Joan. »Unverändert langweilig.«
»Wir dürfen also nicht bald mit einer Vermählung von dir und diesem Mr Bond rechnen?«
Joan spürte, wie sie rot wurde. »Er ist wieder unterwegs in der Arktis«, erwiderte sie spröde, als müsste das als Antwort genügen. Sie wechselte rasch das Thema.
Peter Bond war nun wirklich kein Thema, das sie mit Lady Rachel erörtern wollte.
Sie hatte ihn vor einigen Jahren im Park gegenüber des Norland Institute kennengelernt, wo er die Eichhörnchen mit Maronen fütterte. Sie kamen ins Gespräch, und obwohl sie sich sympathisch waren, fanden sie nicht zueinander. Joan hatte sich ans Alleinsein gewöhnt, und Peter pflegte die Sommer auf Arktisexpeditionen im Auftrag der Royal Geographic Society zu verbringen. Sie waren schließlich übereingekommen, es sei das Beste, sich nicht aneinander zu binden.
Schon davor hatte Joan sämtliche Kuppelversuche von Schwägerin Rachel im Keim erstickt. Es war schön gewesen, drei Jahre lang nicht mit Lady Rachels Erwartungen konfrontiert zu werden.
»Es wird also nichts mit dir und diesem Polarforscher?«
»Wer weiß das schon? Ich habe andere Prioritäten.«
Lady Rachel spitzte den Mund. »Deine Stiftung.«
»Ja, meine Stiftung und mein Kind.«
»Darum dachte ich, eine Ehe wäre gut für dich. Gut auch für Edward.«
Joan lächelte die Argumente weg. Sie wollte sich nicht länger anhören, dass ihr Wert nur darüber definiert wurde, dass sie einen Mann heiratete, der ihrer Verwandtschaft gefiel. Peter Bond wäre da auch nur halbwegs annehmbar gewesen, aber offensichtlich war Lady Rachel inzwischen so verzweifelt, Joan noch einmal unter die Haube zu bringen, dass sie bei der Wahl des Kandidaten bereit war, Abstriche zu machen.
»Wir kommen gut zurecht.« Joan wechselte lieber das Thema. »Wie geht es den Kindern? Gladys hat sich kürzlich verlobt?«, erkundigte sie sich.
»Sie bereitet sich auf die Hochzeit vor. Dürfen wir mit dir rechnen?«
»Selbstverständlich. Und William? Was plant er für die Zukunft?« Als ältester Sohn war sein Weg vorgezeichnet; eines Tages würde er in die Fußstapfen seines Vaters treten.
»Nun, er möchte zu den Husaren, und ich denke, das wird ihm auch gelingen.« Rachel wirkte gelangweilt, als wären Gespräche über ihre Kinder das Letzte, was sie interessierte.
»Das klingt erfreulich.«
»In der Tat.«
Joan schwieg. Hatte sie etwas Falsches gesagt? Doch Rachel atmete tief durch, sie schien zu frösteln, und sagte dann leise: »Darauf war ich nicht vorbereitet.«
»Worauf genau?«
»Mein Leben hatte nur diesen einen Sinn. Ich war für die Kinder zuständig. Nun, da sie mich nicht mehr brauchen, ist da eine … Leere.«
»Die jüngeren sind ja noch bei dir …«
»Ja«, unterbrach Rachel sie ungehalten. »Aber Gladys und William. Es ist nicht dasselbe ohne sie.«
Joan verstand.
Wie würde es ihr wohl ergehen, wenn Edward in gut zehn Jahren alt genug war, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen? Würde sie dann auch diesen Umstand beklagen, oder es eher als Befreiung empfinden, weil sie danach wieder mehr ihre eigenen Ziele verfolgen konnte? Sie wusste es nicht. Edward war ihr Leben. Zugleich ermöglichte ihr die Stiftungsarbeit ein Auskommen und eine Perspektive. Sie war gern Mutter, aber sie war eben nicht nur Mutter.
»Und deine wohltätige Arbeit?«
»Ja, die ist mir immerhin ein Trost.« Rachel gab sich einen Ruck und schüttelte die Nachdenklichkeit ab. »Was hältst du davon, wenn wir in der kommenden Saison in London einen Wohltätigkeitsball für deine Stiftung abhalten? Das würde sicher so viel Geld einbringen, dass du noch mehr junge Frauen ans Norland Institute bringen könntest.«