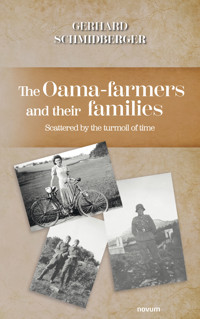26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der zweite Band von Gerhard Schmidbergers biografischem Generationenroman beginnt in der Zeit des Nationalsozialismus und macht in der Gegenwart noch lange nicht Halt. Gezeichnet von Verrat, Krieg und Tod überleben Teile der Familie und führen die Tradition auf mehreren Kontinenten weiter, teils ohne voneinander zu wissen. Diese Erfahrungen der Familie sind von unschätzbarem Wert, um den weiteren Gefahren zu begegnen, die den jüngsten Generationen in einem zukünftigen Europa drohen könnten …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 728
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2024 novum publishing
ISBN Printausgabe:978-3-99130-360-2
ISBN e-book: 978-3-99130-361-9
Lektorat:Falk-Michael Elbers
Umschlagfotos: Gerhard Schmidberger; Okawarung | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
Innenabbildungen:Gerhard Schmidberger
www.novumverlag.com
I. STAMMBÄUME
Stammbaum (Weixelgartner)
Rosa BuchnerGeorg Weixelgartner– 6 Kinder:
3 Söhne Weixelgartnerim I. Weltkrieg gefallenGeorg Weixelgartner(Pfarrer in Gerzen – Ahnenforschung)Josef WeixelgartnerMaria – 2 Kinder:Georg im II. Weltkrieg gefallenJosefOlga – 2 Kinder: (Josef ist Kriegskamerad von Georg Junior)AntonBozenaHelgaGerhard- 2 Kinder:StefanKatharinaAnton WeixelgartnerKatharina – 1 Kind:MathiasMartha – 2 Kind:GeorgChristaOlgaFelix – 2 Kinder: (Olga und Felix kaufen den Oama-Hof von Georg)JohannaAndreasStammbaum (Schmidberger)
Anton Schmidberger, Ur-Ur-Großvater(Hof in Velden abgebrannt) – 1 Kind:
Andreas Senior Schmidberger,Ur-GroßvaterMaria (Hof in Babing gekauft) – 4 Kinder:Berta (Hoferbin)BabetteAndreas Junior (eineiiger Zwilling)Katharina – 3 Kinder:Klaus (verstorben im Konzentrationslager)LukasMaria – 2 Kinder: Lukas und Maria (Leben in Norwegen und Kanada)JohannaReinhard – 2 Kinder:Klaus (bei Verkehrsunfall verstorben)FelixOlga (kaufen Olgas Bruder Georg den Oama Hof ab) – 2 Kinder: Johanna und AndreasGeorg Senior (eineiiger Zwilling)Barbara – 5 Kinder:(Georg Senior hat zwei uneheliche Kinder mit Magdalena)AndiBettyHerrmannHansGeorg Junior verlobt mit Elisabeth Karl – 2 Kinder:SieglindeGerhardHelga Weixelgartner – 2 Kinder:StefanKatharinaGeorg JuniorIrina – 1 KindPeter (Irkutsk)Georg Junior war Kriegskamerad von Josef Weixelgartner. Andreas Junior und Georg Senior waren verfeindete eineiige Zwillinge. Georg Junior lebte überwiegend in Irkutsk und Ostberlin.
II. DIE ZWILLINGSBRÜDER – GEORG UND ANDREAS SCHMIDBERGER
Geschichte von Lukas Schmidberger,dem Onkel von Felix, Bruder von Johanna und Klaus, Sohn von Andreas Junior, Cousin von Georg Junior, Ehemann von Maria
1. Andreas Schmidberger
2. Schafkopffreunde
3. Die Verhaftung
4. Mutters Tod
5. Der Krieg
6. Sylvia
7. Der Funker
8. Wolfsrudel
9. Der Feind
10. Die Havarie
11. Die Rettung
12. Die Überfahrt
13. Das Holzfällercamp
14. Bernhard
15. Lagerleben
16. Die Kämpfe
17. Erneute Kartenrunde
18. Der Chefarzt
19. Calgary
20. Kanadische Staatsbürgerschaft
21. Aufstieg zum Chefarzt
22. Lukas
23. Sylvia
24. Die Reise nach Norwegen
25. Bergen
26. Maria
27. Zurück in Kanada
28. Kirchliche Hochzeit
29. Die neue Heimat
30. Der Streit
31. Das Konsulat
32. Die Verhandlung
33. Versöhnung mit Johanna
34. Hauptverhandlung
35. Urlaub in Kanada
36. Bernhards Tod
1. ANDREAS SCHMIDBERGER
Eigentlich wollte ich in meiner Kindheit und frühen Jugend Missionar in Afrika werden und dort als solcher arbeiten, auch wenn dies immer ein Dorn im Auge meines Vaters gewesen ist. Meine Mutter, Katharina Schmidberger, sagte dazu gar nichts, da sie dies nur für eine blödsinnige Spinnerei eines Kindes hielt. Wie ich darauf gekommen bin, weiß ich selbst nicht mehr so genau. Ich bin zwar katholisch erzogen worden und habe lange Zeit zu den Georgspfadfindern gehört. Doch denke ich, dass es weniger die Religion war, die ich dort verbreiten wollte, als mehr der Traum von Afrika, der mich auf solche Gedanken kommen ließ.
Als unser Vater dann plötzlich schwer krank wurde, habe ich medizinische Bücher gelesen, um zu verstehen, warum es ihm so schlecht ging. Wenige Tage vor seinem Tod war er zum letzten Mal, vollkommen kachektisch infolge seines Pankreaskarzinoms, das sich in seinem gesamten Bauch ausgebreitet hatte, bei uns zu Hause. Unser Vater war dürr und eingefallen, sein Bauch hingegen massiv aufgeschwollen durch den vielen Aszites, der sich darin entwickelt hatte.
Als er so zum letzten Mal auf unserer Terrasse in der Sonne vor unserem Haus auf der Liege lag, die wir für ihn aufgeschlagen hatten, habe ich ihm verkündet, nicht mehr Missionar, sondern Chirurg werden zu wollen. Dies war wohl die letzte Freude, die er in seinem Leben erhalten hat.
Allen seinen Freunden, die gekommen waren, um sich von ihm zu verabschieden, berichtete er voller Stolz von meinem neuen Berufsziel.
Für mich war dies ein Versprechen, das ich mich einzulösen verpflichtet fühlte.
Vielleich sollte ich an dieser Stelle noch erwähnen, dass ich zwei Geschwister hatte: eine zwei Jahre ältere Schwester namens Johanna und einen drei Jahre jüngeren Bruder mit Namen Klaus. Ich selbst heiße Lukas.
Unser Vater, Andreas Schmidberger, soll angeblich in Passau aufgewachsen sein, wo er von seiner Pflegemutter, Elisabeth, allein großgezogen wurde. Einen Vater hatte er offensichtlich nie gekannt. Auf unsere Frage, was mit seinen richtigen Eltern, also unseren eigentlichen Großeltern, passiert sei, erhielten wir nur zur Antwort, dass sie bereits verstorben seien. Mehr war nicht aus unserem Vater herauszubekommen. Anscheinend gab es da ein Geheimnis, über das unser Vater nicht sprechen wollte.
Da er in der Volksschule sehr gute Noten schrieb, durfte er ins Gymnasium überwechseln, was damals für Kinder armer Eltern äußerst ungewöhnlich war. Um eine Lehrerbildungsanstalt besuchen zu können, zog er nach dem Abitur nach Landshut, wo er unsere Mutter Katharina kennen lernte. So wurde es uns jedenfalls berichtet. Da Elisabeth früh verstorben zu sein scheint, sind wir Kinder unserer Großmutter nie begegnet. Unser kleines Haus am Stadtrand von Landshut hat unsere Mutter Katharina von ihren Eltern geerbt, die wir zwar gekannt haben, die aber beide schon verstorben sind.
2. DIE SCHAFKOPFFREUNDE
Es waren seither viele Jahre vergangen. Mein Medizinstudium hatte ich vor kurzem abgeschlossen. Johanna ist Lehrerin geworden. Klaus studierte Theologie. Er hatte meinen ursprünglichen Lebenstraum übernommen, in Afrika zu missionieren und als Priester zu arbeiten. Unsere Schwester war immer unsere Chefin. Sie gab den Ton an. Klaus und ich hatten nur eine Chance, uns gegen sie durchzusetzen, wenn wir uns zusammentaten. So kam es, dass Klaus und ich immer zusammenhielten und uns unglaublich gut verstanden und liebten.
Klaus und ich hatten eine Schafkopfrunde. Unsere beiden Partner beim Kartenspiel hießen Reinhard Hinterseher und Bernhard Habersetzer. Diese beiden Herren kannten wir bereits seit unserer frühen Kindheit. Wir sind zusammen aufgewachsen, waren zusammen bei den Georgspfadfindern, haben Zeltlager und Georgsläufe mitgemacht. Gemeinsam haben wir in unserer Pfarrei St. Martin in Landshut ministriert und an Ministrantenausflügen mit unserem Pfarrer teilgenommen, die bis zum Bodensee gingen. Zur Korbinianswallfahrt sind wir mehrmals nachts von München nach Freising gewandert, haben im Domgymnasium auf Lagern übernachtet und uns am nächsten Vormittag an Diskussionen mit unserem Bischof beteiligt.
So lange Freundschaften festigen Bindungen untereinander, die normalerweise ein ganzes Leben lang halten.
Reinhard war mittelgroß und hatte ein recht gutaussehendes Gesicht. Er war eher der intellektuelle Typ, wohingegen Bernhard recht groß und breitschultrig war und eher einem zupackenden, handwerklichen Typ entsprach.
Zum letzten Mal trafen wir uns zum Spielen im Sommer 1939. Überall hatten die Leute Angst vor einem möglichen Krieg, der in der Luft lag.
Ich hatte seit dem Frühjahr mein Studium abgeschlossen und arbeitete als Assistenzarzt auf der Chirurgie im städtischen Krankenhaus von Landshut. Reinhard war Jurist und Bernhard Krankenpfleger geworden. Klaus befand sich am Ende seines Theologiestudiums. Er war Pazifist und hasste Krieg.
Unser Vater hatte im I. Weltkrieg kämpfen müssen. Seine Erzählungen darüber waren schrecklich.
Er berichtete uns oft, wie sie vor Verdun im Schützengraben lagen und um jeden Meter Landgewinn hart kämpften, wie die Granaten neben ihnen einschlugen und seine Kameraden zerfetzten, wie ihm der kalte Schweiß ausbrach und er, vor Angst gelähmt, sich nicht mehr bewegen konnte. Er hatte eine Hölle durchlebt, die er Zeit seines Lebens nicht mehr vergessen konnte.
An eine Begebenheit, die er uns erzählte, habe ich oft denken müssen. Sie saßen zu dritt im Schützengraben. Es nieselte und war kalt und klamm. Sie froren. Ihr vorgesetzter Offizier versuchte aus Neugierde zu erkunden, was auf der anderen Seite vor sich ging, indem er immer kurz seinen Kopf aus dem Graben reckte und hinübersah. Unser Vater riet ihm, seinen Kopf unten zu lassen, damit er nicht getroffen würde. Als Offizier glaubte er, sich nicht nach den Ratschlägen seiner Leute richten zu müssen. Die Kugel traf ihn unterhalb des Helms in die Stirn. Er war sofort tot. In dem schlammigen, feuchten Morast benutzten seine Untergebenen seinen Leichnam als Stuhl, um bequemer sitzen zu können.
Solche Geschichten hören sich schrecklich an und waren doch Realität in solchen Kriegen.
Ein anderes Mal hat meinem Vater eine Flasche Wein das Leben gerettet, die er als Geburtstagsgeschenk von seinen Kameraden erhalten hatte. Als der Befehl zum Rückzug gegeben wurde, sprangen er und seine Kameraden aus dem Schützengraben, um zurückzulaufen, bis Vater einfiel, dass er seinen Wein im Graben vergessen hatte. Er sprang nochmals in den Graben zurück, als im gleichen Moment eine Granate dort einschlug, wo er gerade noch gestanden hatte, und seine Kameraden zerfetzte. Der Wein hat ihm das Leben gerettet.
In einer weiteren Geschichte berichtete Vater uns, wie ein Freund von ihm versehentlich zum Kriegshelden deklariert wurde. Sie lagen erneut im Schützengraben, den Franzosen gegenüber. Diese waren dabei, die Oberhand zu gewinnen, weshalb bei den Deutschen der Befehl zum Rückzug gegeben wurde. Die Soldaten sprangen aus ihren Schützengräben und rannten nach hinten los, weg vom Feind. Als die Franzosen dies bemerkten, kamen sie ebenfalls aus ihren Schützengräben heraus, um nachzurücken. Vaters Freund hatte den Befehl zum Rückzug überhört, weshalb er im Graben blieb, und mit seinem Maschinengewehr weiter schoss. Auf diese Weise traf er mehrere französische Soldaten, die aus dem Graben herausgekommen waren, um nachzurücken, und keinen Schutz mehr hatten. Als die Franzosen bemerkten, dass sie in eine Falle gelaufen waren, zogen sie sich wieder in ihre Gräben zurück. Sobald die Deutschen dies wahrgenommen hatten, kamen auch sie zurück und nahmen ihre alten Stellungen wieder ein. Vaters Freund war auf diese Weise ungewollt zum Kriegshelden aufgestiegen. Wie er es psychisch verkraftet hat, so viele Franzosen erschossen zu haben, kann ich nicht sagen.
Als wir so zum Kartenspielen zusammensaßen und über einen möglichen Krieg zu reden begannen, sagte ich zu den anderen, dass ich mich, falls es zum Krieg käme, zur Marine melden würde, um dem Kampf Mann gegen Mann entgehen zu können.
Unser Haus war klein. Es bestand aus einer Küche mit Holzofen, auf dem Wasser zum Waschen und Kochen warmgemacht wurde, einem mäßig großen Wohnzimmer mit Couch und zwei Stühlen und einem Tischlein, sowie einem Radio, über das wir in späterer Zeit die Propagandanachrichten der Nazis empfingen, als die Angst vor einem erneuten Krieg immer größer wurde.
Eine Toilette mit Toilettenschüssel ohne Waschbecken schloss sich einem kleinen Hausgang an, von dem neben dem Wohnzimmer auch noch das Elternschlafzimmer abging. Eine Außentreppe führte zum ersten Stock hinauf, wo wir Kinder jeweils ein Zimmer für uns bewohnen konnten. Die Zimmer waren durch einen Gang verbunden.
Zur Toilette und zum Waschen mussten wir allerdings ins Parterre hinabsteigen, wobei der Stuhlgang nach draußen in eine Versitz Grube lief und das Waschen in der Küche stattfand, da man nur hier Wasser mit unserem Holzofen erwärmen konnte, das wir vom Brunnen im Garten holen mussten. Die Heizung des ganzen Hauses lief über diesen Holzofen, was besonders im ersten Stock im Winter wenig Wärme brachte, so dass wir zu dieser Jahreszeit in unserer Kindheit recht häufig froren.
Der Garten war hingegen ziemlich groß, so dass wir unser Obst und Gemüse fast gänzlich selbst anbauen konnten, was mein Vater genau genommen furchtbar hasste. Ich werde nie vergessen, wie ich als Kind meinen Vater fluchen hörte, wenn er dabei war, unser Gemüsebeet zu bearbeiten.
Wir hatten aber auch zahlreiche schöne Blumen im Garten. Am meisten begeisterte mich ein Schmetterlingsstrauch mit seinen vielen blauen Blüten, auf denen sich ungezählte Schmetterlinge tummelten. Ich musste oft daran denken, wie ich zeitweise lange davorgestanden bin, um diese herrlichen Tiere zu beobachten.
Es war ein lauer Sommerabend, als die Sonne bereits untergegangen war, dennoch aber eine gewisse Schwüle in meinem Zimmer im ersten Stock unseres Hauses herrschte, in dem wir auf meinem Bett – das wir zu einer Couch umgeklappt hatten, die sich so in die Mansarde einschmiegte, dass man gerade noch darauf sitzen konnte – und zwei Stühlen um eine Art Campingtisch herumsaßen. Klaus und ich hatten uns auf der Couch niedergelassen und die beiden anderen mussten mit den einfachen Stühlen vorliebnehmen.
Mit Ausnahme einiger bunter, selbst gemalter Aquarellbilder, die auf der weiß gekachelten Wand von einer heilen Welt sprachen, die gerade dabei war, zusammenzubrechen, war mein Zimmer vollkommen einfach und schmucklos eingerichtet. Am besten gefiel mir noch der braune Holzboden.
Von dem kleinen Fenster mit weißem Rahmen, das man nach Süden hin hätte öffnen können, das wir aber wegen der Mücken geschlossen lassen mussten, die in diesem Sommer eine besondere Plage darstellten, drang nur noch wenig Licht herein, so dass die schwache Deckenlampe als einzige Lichtquelle diente, die das Zimmer aber nur matt erhellte. Auf der anderen Seite führte eine einfache Holztüre zum Gang hinaus, der unsere drei kleinen Zimmer miteinander verband.
Trotz der Schweißperlen auf unseren Gesichtern, die wir von Zeit zu Zeit abwischten, versuchten wir uns auf das Kartenspiel zu konzentrieren. Vor allem Klaus mit seinem fein geschnittenen, fast mädchenhaft schönen Antlitz wirkte angespannt, beinahe verzweifelt. Mit seiner schwarzen Hose und seinem weißen Hemd versuchte er sich bereits ein priesterliches Aussehen zu geben, wohingegen wir drei anderen ziemlich leger gekleidet waren mit einfacher Hose und bunten Hemden. Meines war überwiegend rot gesprenkelt, während bei dem von Reinhard die Blautöne überwogen. Das Hemd von Bernhard war einfarbig grau.
Die Luft war zum Schneiden in dem kleinen Zimmer, da Reinhard, als einziger Raucher unter uns, sich eine seiner selbstgedrehten Zigaretten nach der anderen ansteckte, so dass sich die Kippen im Aschenbecher vor ihm nur so stapelten.
Vom Wohnzimmer, in dem Johanna und unsere Mutter saßen, drang sanft plätschernde Musik aus dem Radio zu uns herauf, die mich beinahe zum Träumen brachte, vor allem als das Lied von Lilly Marlen gebracht wurde, das ich am meisten liebte.
Wenn mich Reinhard mit seinen hübschen, blauen Augen anblickte, verzog manchmal ein nervöses Zucken seinen rechten Mundwinkel, so dass ich glaubte, die Zigarette in seinem Mund hin und her wackeln zu sehen.
Ob der Alkohol daran schuld war, von dem wir bereits etwas zu viel genossen hatten, oder ihre Verluste beim Kartenspiel oder überhaupt die angespannte Situation, die im Sommer 1939 überall zu spüren war, als so viele Menschen vor einem erneuten Krieg Angst hatten, dass Klaus und Bernhard sich so in einen Streit hineinsteigerten, kann ich nicht sagen. Einem Beobachter von außen wäre die ganze Situation in unserem halbdunklen Zimmer, in dem wir Mühe hatten, unsere Karten überhaupt zu sehen, sicherlich gespenstisch erschienen. Reinhard sah ihnen mit großen Augen zu, ohne etwas zu sagen, wobei er offensichtlich so vom Streit dieser beiden, deren Köpfe mittlerweile vor Ärger rot anliefen, fasziniert war, dass er sogar vergaß, seine Zigarette anzuzünden, die bereits in seinem Mund steckte.
Klaus wetterte furchtbar gegen diese schrecklichen Nationalsozialisten, die eine solch enorme Kriegsgefahr heraufbeschwören würden. Bernhard, als großer Bewunderer der Nazis, hielt dagegen und meinte, sie hätten Deutschland nach verlorenem I. Weltkrieg, der ihnen diesen schrecklichen Versailler Friedensvertrag eingebracht hatte, und Reparationszahlungen, nach Weltwirtschaftskrise und Inflation wieder hochgebracht.
Ich hatte viele Solos gespielt und war dabei, zu gewinnen. Bei mir stapelten sich die Geldstücke der anderen, die sie an mich abliefern mussten, da ich eine tolle Gewinnserie hatte. Bei Reinhard hielten sich Gewinn und Verlust die Balance, Klaus und Bernhard mussten bezahlen. Vielleicht lag es auch am Bier, von dem sie in ihrem Frust mittlerweile etwas zu viel getrunken hatten, dass ihre Diskussion über den Krieg, die Nazis und die Verhältnisse in Deutschland so eskalierte. Während Reinhard und ich uns zurückhielten, begannen sich Bernhard und Klaus irgendwann anzubrüllen. Klaus schimpfte über die Nazis; Bernhard verteidigte sie. Dies ging so weit, dass sie sich fast die Köpfe eingeschlagen hätten, wäre ich nicht eingeschritten und hätte schlussendlich gesagt: „Liebe Leute, für heute reicht es. Wir beenden unser Spiel. Ihr geht nach Hause.“ Damit waren Reinhard und Bernhard gemeint, da das Spiel bei uns zu Hause stattfand. „Klaus und ich legen uns schlafen.“ Die beiden Streithähne waren so aufeinander eingeschossen, dass Reinhard und ich Mühe hatten, sie zu trennen. Letztendlich verabschiedeten sie sich und verschwanden. Klaus konnte ich hinterher kaum beruhigen, so sehr hatte er sich in den Streit mit Bernhard verbissen.
So unschön, wie dieser Abend endete, so fröhlich hatte er ursprünglich begonnen. Unsere Mutter und Johanna hatten für unsere Gäste eine gute Flasche Rotwein entkorkt, die sie am Vortag eigens für dieses Ereignis im Geschäft gekauft hatten, zusammen mit einem Korkenzieher, da ein solcher bisher in unserem Haushalt nicht vorhanden war, damit wir, wie Mutter es vorschlug, auf einen gelungenen Abend und eine friedliche Zukunft anstoßen könnten.
Im Radio erklangen sanfte, melodische Lieder, die zu einer entspannten, beruhigenden Atmosphäre beitrugen, wodurch sich angenehme Gespräche zwischen den einzelnen Leuten entwickelten, wobei mir besonders Johanna und Reinhard auffielen, wie sie sich ausgesprochen angeregt unterhielten. Sie schienen sich sehr gut zu verstehen, was meine Meinung bestärkte, wonach Johanna schon seit längerer Zeit heimlich in Reinhard verliebt war. Dass er ihr zumindest sehr gut gefiel, war für mich nicht zu übersehen.
Zu diesem Zeitpunkt sprachen sogar Klaus und Bernhard noch recht freundlich miteinander.
Viel Zeit blieb nicht für solche Gespräche, da wir schließlich zur Sache, sprich zum Kartenspiel, schreiten mussten, wofür wir uns eine Etage höher zu begeben hatten.
3. DIE VERHAFTUNG
Am nächsten Morgen war Klaus ziemlich verkatert. Er klagte über Kopfschmerzen und Übelkeit. Johanna brachte ihm etwas zu trinken. Unsere Mutter hatte Mitleid mit ihm und fragte, was gestern alles geschehen wäre, dass er immer noch so aufgewühlt sei.
Mutter und Johanna richteten Frühstück her. Beim Essen berichtete ich über den gestrigen Streit.
Mutter mahnte zur Vorsicht. Über die Nazis zu schimpfen könnte heutzutage gefährlich sein. Die Wände hätten Ohren, meinte sie. Ich sagte, dass man unter Freunden zwar streiten könne, dass man aber nicht denunziert würde. Kaum hatte ich dies ausgesprochen, als es auch schon an der Türe klopfte. Johanna öffnete neugierig unsere Eingangstüre und fragte sich, wer denn zu so früher Stunde uns beim Frühstücken stören würde. Draußen standen zwei uniformierte, ziemlich unsympathisch aussehende Herren, die nach Klaus Schmidberger fragten. Als Klaus erstaunt aufstand und sagte, dass er dies sei, erklärte der ältere der beiden Herren, dass sie einen Haftbefehl gegen Klaus Schmidberger hätten wegen Beleidigung unseres Staates. Wir waren entsetzt. Mutter begann zu weinen. Ich umarmte Klaus und drückte ihn fest an mich. Sollte Bernhard ihn wirklich denunziert haben? Ich konnte es kaum glauben. Ich hatte ihn bisher zwar für etwas fanatisch, im Grunde genommen aber für harmlos und gutmütig gehalten. Dass er fähig sein könnte, seinen Freund den Nazis auszuliefern, hätte ich mir nie vorstellen können. Johanna stellte sich vor Klaus und schrie die Herren von der Gestapo an: „Lasst unseren Bruder in Ruhe. Er hatte doch nur zu viel Bier getrunken.“ Der jüngere der beiden, der bei mir einen besonders fanatischen Eindruck hinterließ, schob Johanna unsanft zur Seite und legte Klaus Handschellen an. Wie einen Schwerverbrecher führten sie ihn ab. Ich lief Klaus nach, bis er in dem Kastenwagen verschwand, in dem bereits mehrere Soldaten warteten. Gleich darauf fuhren sie ab. Mutter und Johanna heulten. Ich war verzweifelt und versuchte die beiden zu trösten, indem ich sagte, dass er vielleicht bald wieder freikommen würde, dass sie erkennen würden, dass der Streit von gestern Abend nur durch den Alkohol zustande gekommen sei. Einem künftigen Priester würde man nichts antun, fügte ich noch hinzu, obwohl ich bereits zu ahnen begann, dass wir Klaus nie wiedersehen sollten.
Zu erwähnen bleibt noch, dass der jüngere der beiden Gestapomänner, der Klaus die Handschellen anlegte, ein durch massive Akne wie pockennarbig verunstaltetes Gesicht hatte, dem kalte, böse blickende Augen einen fast gruseligen Ausdruck verliehen, so dass ich richtig entsetzt war, als ich ihn erblickte. Der andere Herr hingegen, der sich mehr im Hintergrund hielt und den jüngeren agieren ließ, hatte einen völlig normalen, ernst und entschlossen wirkenden Gesichtsausdruck, von dem ich den Eindruck bekam, dass ihm die Situation fast etwas unangenehm und peinlich war.
Von meinen tollen Freunden Reinhard und Bernhard habe ich nichts mehr gehört. Ich wollte sie nie wieder sehen. Vor allem Bernhard, den Denunzianten, hasste ich aus tiefstem Herzen.
Ich habe Zeit meines Lebens nach meinem Bruder gesucht. Viel später habe ich erfahren, dass man ihn nach Dachau ins Konzentrationslager gebracht hat. Von dort soll er in ein anderes Konzentrationslager überführt worden sein, wo sich seine Spur verlor. Wahrscheinlich ist er entweder verhungert oder irgendwo erschossen worden.
4. MUTTERS TOD
Ziemlich verzweifelt arbeitete ich weiter auf meiner Station im Krankenhaus. Johanna unterrichtete ihre Schüler. Unsere Mutter konnte die Verhaftung von Klaus nicht überwinden. Wir fanden sie eines Tages tot in ihrem Bett liegen. Sie hatte eine Unzahl an Schlaftabletten genommen, war eingeschlafen und ist nie wieder aufgewacht.
Die Beerdigung unserer Mutter fiel sehr traurig aus. Die Priester verweigerten ihr ein kirchliches Begräbnis, da Selbstmord eine Todsünde sei. Nur Gott habe das Recht, über Leben und Tod zu entscheiden. Von Mutters Freundinnen und Weggefährten waren auch nur sehr wenige gekommen, unsere Mutter auf ihrem letzten Weg zu begleiten, da alle fürchteten, mit einem Vaterlandsverräter wie Klaus in Verbindung gebracht zu werden.
Wie Johanna bei der Beerdigung unserer Mutter vor der leeren Grabhöhle stand, in die die Träger den Sarg hinabgleiten ließen, sah sie in ihrem schwarzen Trauerkleid, mit dem eleganten Hut auf dem Kopf, mit ihrem edel geschnittenen Gesicht, dessen rehbraune Augen unglaublich anziehend wirkten, und ihren brünetten Haaren, die ihr bis zur Schulter in sanften Wellen herabhingen, unglaublich schön aus. Ich war richtig stolz auf meine Schwester, die mir damals besser als alle anderen Frauen gefiel, die ich bis dahin gekannt hatte.
Da sich kein Priester zuständig gefühlt hatte, für unsere Mutter eine Trauerrede zu halten, stellte ich mich vor das Grab, als sich der Sarg bereits drinnen befand, und begann laut zu beten, wobei Johanna und die wenigen Trauergäste, die sich eingefunden hatten, unserer Mutter ihr letztes Geleit zu geben, in das Gebet einstimmten.
Anschließend hielt Johanna eine kurze Ansprache über das Leben und Leiden unserer Mutter und sprach vor allem den Wunsch aus, dass unser Bruder Klaus doch wieder heil zu uns zurückkehren möchte.
In unserem Haus in Landshut wohnten jetzt nur noch Johanna und ich. Wir frühstückten gemeinsam und gingen dann unsere eigenen Wege. Meist trafen wir uns abends wieder und richteten zusammen unser Abendessen her. Besorgungen und Einkäufe verrichtete in der Hauptsache Johanna, da sie mehr Zeit als ich hatte. Wir sprachen viel darüber, was wohl mit Klaus passiert sein könnte. Die Leute tuschelten hinter vorgehaltener Hand, dass er möglicherweise ins Konzentrationslager nach Dachau gekommen sein könnte, wobei niemand so genau wusste, was dies eigentlich zu bedeuten hätte. Es musste jedenfalls etwas Schlimmes sein, so viel war klar.
Zeitweise fürchteten wir, dass er nach Ausschwitz gekommen sein dürfte, wobei mir erst später klar wurde, dass dorthin fast nur Juden gebracht wurden.
Dass er nicht in Dachau umkam, sondern in ein anderes Konzentrationslager verfrachtet worden war, in dem er wahrscheinlich erschossen wurde, haben wir erst nach dem Krieg erfahren, als ich mich in Dachau nach ihm erkundigte. Es konnte mir aber niemand mehr Auskunft geben, wohin sie ihn letztendlich verschleppt hatten.
5. DER KRIEG
Es waren wieder einige Monate vergangen, als der Krieg ausbrach. Der Angriff auf Polen war bereits voll im Gange, als ich meinen Einberufungsbefehl bekam. Ich stellte mich im zugehörigen Amt vor und erklärte, zur Marine gehen zu wollen, da ich dort als Arzt dringend gebraucht würde. Offensichtlich scheint man bei der Marine wirklich Ärzte benötigt zu haben, da man mit meinem Vorschlag sofort einverstanden war.
Von Johanna, die ihre Arbeit als Lehrerin fortsetzen musste, verabschiedete ich mich. Sie brachte mich noch zum Bahnhof in Landshut. Ich solle wieder zurückkommen, meinte sie zum Abschied. Sie wolle schließlich nicht auch noch ihren zweiten Bruder verlieren. Wir umarmten uns.
Dass sehr viel mehr Jahre bis zu unserem Wiedersehen vergehen würden, als wir es uns damals vorgestellt hatten, konnten wir zu dieser Zeit nicht ahnen.
Die Bahnfahrt nach Kiel dauerte zwölf Stunden. Dort wurde ich in einer Kaserne untergebracht. Gleich am nächsten Tag begann die Grundausbildung, die bei mir recht milde ausfiel, da den Ausbildern bewusst war, dass ich infolge meines Abiturs und des abgeschlossenen Medizinstudiums hinterher gleich zum Stabsarzt, also zum Leutnant und bald Oberleutnant, aufsteigen und damit ihnen vorgesetzt sein würde.
Mein erster Kriegseinsatz fand auf einem kleineren Zerstörer statt. Wir kreuzten im Nordatlantik und versuchten die Versorgungsschiffe zwischen Amerika und Russland abzufangen. Einmal trafen wir jedoch auf einen größeren englischen Zerstörer, der uns torpedierte. Unser Schiff wurde beschädigt. Wir flohen und versuchten die Küste Norwegens bei Hammerfest zu erreichen, wohin uns das englische Schiff nicht zu verfolgen wagte. Unser Schiff kam auf ein Trockendock und ich in eine Kaserne, in der ich mich allerdings fast nur zum Schlafen aufhielt.
Untertags war ich in einem Lazarett beschäftigt. Als rechte Hand des Chefchirurgen war ich bei vielen Operationen dabei und durfte einige unter seiner Leitung sogar selbst durchführen.
Lukas Schmidberger, Ehemann von Maria, Onkel von Felix, Bruder von Johanna, Cousin von Georg Junior
6. SYLVIA
In der Nähe des Krankenhauses hatte ich ein recht nettes Lokal entdeckt, in das man sogar als Deutscher gehen konnte, ohne dass man von den Norwegern angepöbelt worden wäre, wie es in vielen anderen Lokalen häufig vorkam. Als ich eintrat, waren noch ziemlich viele Tische frei. Gleich in der Nähe des Eingangs saß eine sehr sympathisch aussehende junge Dame, die ich kurz entschlossen fragte, ob ich mich an ihren Tisch setzen dürfte. Sie blickte etwas überrascht auf, sah mich an und sagte in gebrochenem Deutsch „Bitte schön, setzen Sie sich“, was ich dann auch tat. Als der Kellner kam, bestellte ich ein Glas Mineralwasser und eine Kleinigkeit zum Essen: „Sie haben gar nichts gegessen. Darf ich Sie zu etwas einladen?“, fragte ich sie. Sie blickte erneut auf und sah mich mit ihren großen, blauen Augen an. „Vielen Dank. Ich habe wirklich Hunger“, antwortete sie mir daraufhin und bestellte sich einen Rinderbraten mit Kartoffeln, Salat und Sauce. „Woher haben Sie so gut Deutsch gelernt?“, fragte ich sie weiter. „Meine Mutter war Deutsche. Mein Vater hat sie in Deutschland kennen gelernt, sich in sie verliebt und sie mit nach Norwegen gebracht. Sie hat mir und meinem Bruder ihre Muttersprache beigebracht“, antwortete sie mir. Ich fragte sie daraufhin, was mit ihrer Mutter geschehen sei, wenn sie in der Vergangenheit von ihr spricht. Dass sie leider bereits verstorben sei, bekam ich zur Antwort.
Wie ich meine Gesprächspartnerin so ansah, erkannte ich, dass sie eine wunderschöne Frau war. Ihre blonden, leicht gewellten Haare trug sie schulterlang. Gekleidet war sie einfach, aber sehr adrett. Die einzigen Frauen in meinem Leben waren bisher meine Mutter und meine Schwester. Zu dieser Dame fühlte ich mich von vornherein hingezogen, wie ich es bisher noch bei keiner anderen Frau verspürt hatte. Sie wirkte unglaublich sympathisch, freundlich und natürlich. Ich bekam den Eindruck, sie freute sich, mit mir Deutsch reden zu können. Ihr Name sei Sylvia, erklärte sie mir. Sie arbeite als Krankenschwester im städtischen Krankenhaus, fuhr sie fort zu berichten. Ich stellte mich als Lukas vor und erklärte, im Lazarett als Assistenzarzt auf der Chirurgie beschäftigt zu sein. Wir unterhielten uns einen ganzen Abend lang gut, bis sie plötzlich aufstand, auf ihre Armbanduhr blickte und sagte: „Es ist spät geworden. Ich muss heim“ „Darf ich du zu dir sagen und dich wiedersehen?“, fragte ich sie. Sie schaute mich an, nickte, lächelte, so dass ich ihre schönen, ebenmäßigen, weißen Zähne zu sehen bekam, und meinte: „Ich komme wieder hierher. Du musst nur da sein.“ Während sie dies sagte, zog sie ihren grauen Mantel an, setzte ihre selbst gestrickte, bunte Mütze auf und verschwand durch die Eingangstüre.
Ich rief den Kellner, um die Rechnung zu begleichen, und machte mich ebenfalls auf den Weg zu meiner Kaserne. Als Offizier musste ich nicht in den einfachen Mannschaftsräumen schlafen, sondern hatte ein eigenes Zimmer.
Ich konnte lange nicht einschlafen, da ich an diese sympathische, liebenswerte Frau denken musste, zu der ich mich so hingezogen fühlte, wie bisher noch zu keiner anderen Frau in meinem Leben.
Falls es wirklich so etwas wie Liebe auf den ersten Blick gibt, dann dürfte dies an diesem Abend mit mir passiert sein. Ich musste jedenfalls laufend an sie denken, weshalb ich die halbe Nacht keinen Schlaf fand.
Den Großteil des nächsten Tages verbrachte ich im Operationssaal. Ich hatte mit Schussverletzungen und Beinbrüchen verwundete Soldaten zu versorgen. In der Notaufnahme herrschte zum Teil große Hektik, da es an Medikamenten und Infusionen mangelte, die wir dringend benötigten. Als ich am späteren Nachmittag aus dem Lazarett herauskam, war ich ziemlich erschöpft.
Abends suchte ich dieses nette, kleine Lokal wieder auf, um dort zu essen. Es gab Fleischgerichte mit viel Salat und Gemüse. Dazu trank ich ein Glas Bier. Das Essen war gut. Sylvia war leider nicht gekommen. Ich kam jeden Tag zum Abendessen in dieses Lokal, nur leider ohne Sylvia zu sehen.
Es sollte eine Woche vergehen. Ich hatte gerade mit meinem Essen angefangen, als sie hereinkam.
Sie sah mich, lächelte, zog ihren Mantel aus, fragte „Darf ich?“ und setzte sich mir gegenüber, nachdem ich genickt hatte. „Lukas! Es ist schön, dich zu sehen“, begann sie und lächelte mich mit ihren schönen, roten Lippen an. Mit ihren tollen, blauen Augen strahlte sie mich dabei so intensiv an, dass ich mich richtig verunsichert fühlte. Jedenfalls kam sie mir fast noch schöner vor, als ich sie in Erinnerung hatte. Sie bestellte sich ein Glas Weißwein und einen Salat mit Putenstücken darin. Als sie aufgegessen hatte, fragte sie mich, ob ich Lust auf einen kleinen Spaziergang hätte.
Ich stimmte natürlich zu. Wir beglichen unsere Rechnungen, zogen unsere Mäntel an, setzten unsere Mützen auf und gingen in die Kälte hinaus. Es war Winter. In Hammerfest war es zu dieser Jahreszeit fast immer dunkel und bitterkalt. Trotz meiner dicken Handschuhe fror ich an den Händen. Sylvia schien es ebenso zu ergehen. Nach einer kleinen Runde blieb sie vor einer Haustüre stehen und sagte: „Hier wohne ich. Kommst du mit herein?“ Ich war natürlich froh, aus der Kälte herauszukommen. Wir betraten den Hausgang und stiegen zwei Stockwerke nach oben, bis sie vor ihrer Wohnungstüre stehen blieb. Als wir eintraten, war es herrlich warm. Sylvia hatte ihren Kachelofen eingeheizt, von dem eine wohlige Wärme ausging, so dass meine steif gefrorenen Hände und Glieder wieder auftauten. Unsere Mäntel hängten wir an einer Garderobe auf.
Die Wohnung war klein. Sie maß höchstens 30 Quadratmeter. Es gab eine Küche, ein Wohnschlafzimmer, sowie ein Bad mit Dusche und Toilette. Sylvia führte mich ins Wohnzimmer und bedeutete mir, mich auf die Couch zu setzen. „Willst du Tee?“, fragte sie mich und ging in die Küche, einen aufzubrühen, nachdem ich genickt hatte. Wir tranken Tee und unterhielten uns. Ich erzählte ihr von meinem Bruder Klaus, den die Gestapo verhaftet hatte, von dem ich seither keine Nachricht mehr bekommen habe, und von meiner Mutter, die sich daraufhin ihr Leben genommen hat. Als einzige Verwandte ist mir nur noch meine Schwester verblieben.
Irgendwann blickte mir Sylvia tief in die Augen und küsste mich. Ich küsste sie zurück. Langsam begann sie sich auszuziehen. Ich sah ihre straffen Brüste, ihre schlanke Figur, ihre Taille, ihre langen, muskulösen Beine und fühlte mich wie benommen, als sie auch mich auszuziehen begann.
Als wir uns nackt gegenüberstanden, schmiegten wir uns eng aneinander und küssten uns erneut. Sylvia stülpte mir ein Kondom über den Penis, woraufhin wir gemeinsam Verkehr hatten.
Für mich war es das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit einer Frau geschlafen habe. Ich glaube aber, dass dies auch für Sylvia zutraf. Hinterher drückten wir uns eng aneinander. Ich fühlte mich unglaublich glücklich und zufrieden. Sylvia, hatte ich den Eindruck, schien ähnlich zu empfinden. Plötzlich erzählte sie mir von ihrer Familie, die in Bergen lebte, woher auch sie stammte. Ihre Mutter sei bereits verstorben, fuhr sie fort zu berichten. Mit ihrem Vater und Bruder hätte sie Streit gehabt, weshalb sie nach Hammerfest gekommen sei. Sie wollte einfach weg von ihnen und sei deshalb soweit nach Norden gezogen. Worüber dieser Streit ging, der offensichtlich so ernst war, dass sie ihre Familie verlassen hat, hat sie mir nicht erzählt.
Wenn sie es mir nicht von sich aus sagte, wollte ich auch nicht weiter in sie dringen. Wir wechselten das Thema und unterhielten uns über belanglosere Sachen.
Als ich auf meine Armbanduhr blickte, war es bereits nach Mitternacht, weshalb ich dringend zu meiner Kaserne zurückkehren musste.
Seither trafen wir uns fast täglich. Sylvia lud mich meistens zu sich in ihre Wohnung ein, wo wir zusammen kochten und uns häufig liebten. Manchmal gingen wir auch vor dem Kochen gemeinsam einkaufen, um uns auszusuchen, was wir zum Abendessen haben wollten. Zeitweise trafen wir uns in dem netten, kleinen Lokal, in dem wir uns kennen gelernt hatten, um dort zu speisen, wobei wir uns fast immer angeregt unterhielten. Ich genoss dieses Zusammensein mit Sylvia und fühlte mich richtig glücklich, wenn sie in meiner Nähe war, wobei ich das Gefühl hatte, dass sie ebenso empfand. Wahrscheinlich erlebt man eine solche Seelenverwandtschaft mit einem anderen Menschen nur einmal im Leben, wobei ich in meiner Kindheit Ähnliches im Beisammensein mit meinem Bruder Klaus verspürt hatte. Vielleicht muss man im Vorfeld schwere Schicksalsschläge durchgemacht haben, wie bei mir den Verlust von Klaus und den Selbstmord meiner Mutter oder bei Sylvia den Tod ihrer Mutter und den Streit mit Vater und Bruder, um eine solch intensive Zuneigung zu einem anderen Menschen entwickeln zu können.
Wenn wir Zeit hatten, unternahmen wir große Spaziergänge trotz der Kälte und Dunkelheit.
Einmal sagte sie zu mir: „Lass uns der Sonne entgegengehen.“ Ich war etwas verwundert, folgte ihr aber auf eine Anhöhe hinauf, wo schon mehrere Menschen sich versammelt hatten, um auf die Sonne zu warten. Plötzlich wurde es hell. Die Landschaft, die eben noch völlig im Dunklen gelegen hatte, erstrahlte mit einem Mal im grellen Sonnenlicht. Die Leute jubelten. Die Polarnacht war vorüber. Der lange Polartag hatte begonnen. Ein halbes Jahr lang würde die Sonne jetzt kaum noch untergehen, bis es dann wieder ein halbes Jahr Nacht werden wird. Sylvia und ich umarmten und küssten uns. Wir fühlten uns unendlich glücklich.
In der Ferne tauchten Berge auf, von denen ich bisher keine Ahnung hatte. Die Umgebung erschien in einem unwirklich klaren Licht, wie man es nur im hohen Norden oder anderswo im Hochgebirge erleben kann. Die Landschaft um uns herum wirkte wie verzaubert.
Leider dauerte dieses Glück nur noch wenige Tage, bis mir mitgeteilt wurde, dass ich zu einem U-Boot-Einsatz im Nordatlantik abkommandiert würde. Der Abschied fiel uns beiden unendlich schwer. Es ging mir wie damals, als die Gestapo Klaus abführte. Meinen Bruder habe ich nie wiedergesehen, obwohl ich mein ganzes Leben versucht habe, etwas über sein Schicksal zu erfahren. Sylvia versprach ich, wiederzukommen und sie zu heiraten.
7. DER FUNKER
In der Kaserne in Hammerfest lernte ich einmal einen Funker kennen, der sich mir als Johannes vorstellte. Mit diesem Herrn habe ich mich etwas angefreundet. Zusammen haben wir Sport getrieben, sind gelaufen oder haben Gymnastik und Fitnesstraining unternommen. Hinterher haben wir uns dann öfter zusammengesetzt, ein Bier getrunken und uns unterhalten.
Dabei erzählte er mir, dass er den U-Boot-Kapitänen Positionen von amerikanischen Versorgungsschiffen für die Russen bekannt gebe, die er von Flugzeugen oder anderen Schiffen empfangen hat.
Zur Verschlüsselung benutzte Johannes die streng geheime Verschlüsselungsmaschine mit Namen Enigma, mittels derer die meisten Botschaften so entstellt wurden, dass die Engländer lange Zeit benötigten, bis sie diesen schwierigen Code knacken konnten.
Leider erwies sich unsere beginnende Freundschaft als sehr kurz, da ich bald auf das U-Boot abkommandiert wurde, auf dem einige unliebsame Überraschungen auf mich warteten.
Wie es in diesem schrecklichen Krieg häufig der Fall war, habe ich von Johannes’ traurigem weiteren Schicksal erst nach vielen Jahrzehnten erfahren.
Man lernt sich kennen, versteht sich gut, freundet sich an, wird dann aber woanders hin versetzt und sieht sich nie wieder. In späterer Zeit habe ich oft an Johannes denken müssen und mich gefragt, ob er diesen furchtbaren Krieg heil überstanden hat oder irgendwo auf dem Schlachtfeld umgekommen ist.
Wenn ich mein weiteres Leben überwiegend in Deutschland verbracht hätte, wäre ich sicherlich einmal nach Nürnberg, in seine Heimatstadt, gefahren und hätte mich nach ihm erkundigt. Nachdem mein Leben aber völlig anders verlief, fand ich keine Gelegenheit dazu.
Wahrscheinlich hat er von mir geglaubt, dass es mich gar nicht mehr gibt, weil ich im Nordatlantik ertrunken bin.
Als ich dann durch Zufall von meinem seltsamen Cousin Georg, von dessen Existenz ich lange Zeit keine Ahnung hatte, da er einen Großteil seines Lebens in Russland verbracht hatte, weil er eine Russin geheiratet hat, mit dem Johannes gemeinsam im Gefangenenlager in Uljanowsk an der Wolga war, Jahrzehnte später doch noch erfahren habe, welch grausames Schicksal ihn ereilt hatte, hat mich dies sehr traurig gestimmt.
8. WOLFSRUDEL
Etwas erstaunt war ich schon, als mir mitgeteilt wurde, dass ich zu einem U-Boot-Einsatz eines V-II-C-Typs, einem sogenannten Wolfsrudel, eingeteilt wurde, da mir bekannt war, dass in solchen Schiffen normalerweise keine Ärzte zur Betreuung der ungefähr 40 bis 50 Mann starken Besatzung mitfuhren, sondern höchstens Krankenpfleger oder Sanitäter.
Normalerweise bestand die Führungsriege eines solchen Schiffes aus einem Kapitänleutnant, einem Oberleutnant, zwei Wachleutnants und einigen Maaten im Range von Feldwebeln.
Dass ich als Arzt und Major einem solchen Schiff zugeteilt werden sollte, erschien mir etwas seltsam. Dennoch habe ich nicht weiter darüber nachgedacht, da meine Gedanken mehr mit dem Abschied von Sylvia beschäftigt waren, der mir selbstverständlich sehr schwerfiel, als mit meinem Einsatz auf diesem Schiff.
In unserer letzten gemeinsamen Nacht bin ich nicht in meine Kaserne zurückgekehrt, sondern habe bei Sylvia übernachtet. Wir haben uns fest umarmt, mehrmals gemeinsam Verkehr gehabt und sind die gesamte Nacht eng beieinander gelegen. Zum Abschied habe ich ihr hoch und heilig versprochen, wiederzukommen und sie zu heiraten. Sie versprach mir im Gegenzug, auf mich zu warten: „Und sollte es viele Jahre dauern; ich werde da sein, wenn du wiederkommst“, sagte sie zum Abschied zu mir, als hätte sie schon geahnt, was alles an Schwierigkeiten auf uns zukommen würde.
Erst als ich beim Einchecken vom führenden Offizier begrüßt wurde, dämmerte mir langsam, in welche Falle ich geraten war.
Offensichtlich hatte dieser Herr so viel Einfluss in der Partei, dass er mich gegen alle Regel zusätzlich hatte anfordern können.
Im Normalfall gab es in einem U-Boot dieser Art eine Zentrale, eine Messe, eine Kombüse sowie eine Funkluke, durch die mit dem Sehrohr die Umgebung bis zum Horizont abgesucht werden konnte, neben den Mannschaftsräumen, wobei der Proviant für die Matrosen meistens unter deren Betten verstaut war.
Die Umgebung wurde zusätzlich mit sogenannten Sonaren, also mit Ultraschall, abgesucht, da Radar erst nach dem Krieg zum Einsatz kam.
Eine kleine, eigene Kajüte stand eigentlich nur dem leitenden Offizier zu. Da ich aber den Rang eines Majors bekleidete, hatte ich ebenfalls das Anrecht auf eine solche Unterkunft. Auch wenn der leitende Offizier dies nicht wahrhaben wollte, bestand ich auf diesem Vorrecht.
Bewaffnet war unser Schiff mit zwölf Torpedos, wie mir gleich nach meiner Ankunft voller Stolz mitgeteilt wurde.
Was mir bis dahin nicht bekannt war, was ich aber leidvoll erfahren musste, war, dass in solchen Schiffen keine Rettungsboote vorhanden waren. Nur dem Kapitänleutnant war es erlaubt, ein rettendes Schlauchboot in seiner Kajüte zu verstauen. Für die übrige Mannschaft waren nur Schwimmwesten vorgesehen.
Feuerwaffen durften in Schiffen dieser Art ebenfalls nicht mitgebracht werden, da sicherlich die Gefahr bestand, dass einige Matrosen während der wochenlangen Fahrt auf See, zusammengepfercht auf engstem Raum, durchdrehen und anfangen könnten, auf ihre Kameraden zu schießen.
Nur dem Kapitänleutnant, als oberstem Dienstherrn, der Befehlshaber und, falls nötig, zugleich auch Richter war, während sie sich auf See befanden, war es gestattet, eine Pistole zu tragen.
Leider muss ich gestehen, dass ich von all dem bei meiner Ankunft auf dem Schiff wenig wusste, was sich jedoch als recht verhängnisvoll herausstellen sollte. Was ich zu diesem Zeitpunkt auch nicht ahnen konnte, war, dass ich bald mehr über das Schicksal meines Bruders erfahren sollte.
9. DER FEIND
Mein Zimmer in der Kaserne musste ich räumen und meine Sachen zusammenpacken. Um 13 Uhr hatte ich ins Boot einzuchecken. Sylvia begleitete mich noch ein Stück. Zum Abschied umarmten und küssten wir uns.
Als Erstes wurde ich vom Kapitän begrüßt, wobei ich den Schreck meines Lebens erhielt, als ich vor Reinhard Hinterseher, meinem früheren Freund und Schafkopfpartner, stand, der die Kapitänsstreifen trug.
„Holla, wen haben wir denn da?“, waren seine zynischen Worte bei der Begrüßung, als er mich ziemlich abfällig ansah, indem er mich von oben bis unten musterte. „Möchtest du wissen, was mit deinem Bruder geschehen ist, nachdem ich noch in der gleichen Nacht die Gestapo auf diesen Intriganten gehetzt habe?“, fuhr er fort, mich zu schikanieren und zu quälen. „In Dachau hat er schwer arbeiten müssen, bis man ihn weiter nach Osten brachte, wo er zur Exekution vorgesehen ist“ waren seine weiteren Worte der Begrüßung. Da ich mittlerweile selbst zum Major aufgestiegen war, brauchte ich keine Angst vor diesem Mann zu haben, der mir gleich bei der Begrüßung so viel Hass entgegenbrachte.
Neben ihm stand Bernhard Habersetzer, mein anderer Freund und Kartenpartner. Sie waren beide meinem Vorschlag gefolgt und zur Marine gegangen.
Wie ich erst später von Bernhard erfuhr, hatte mich Reinhard eigens zu seiner Mannschaft angefordert, um mich zu schikanieren. Vielleicht war es auch sein schlechtes Gewissen, das ihn trieb. Überraschend für mich war nur, dass anscheinend nicht Bernhard der Denunziant war, der Klaus hingehängt hatte, sondern Reinhard, dem ich dies nie zugetraut hätte. Anscheinend konnte dieser meine Gedanken erraten. „Du hast wohl geglaubt, Bernhard hätte den Vaterlandsverräter hingehängt? Der ist viel zu schwach dazu. Dazu muss ein Mann wie ich her“, sagte er, wobei er einen verächtlichen Seitenblick auf Bernhard warf.
Ich begrüßte meinen Vorgesetzten vorschriftsmäßig mit „Heil Hitler“ und verlangte, meine Kajüte beziehen zu dürfen, um meine Sachen dort abzulegen, ohne auf seine Beleidigungen einzugehen.
Es waren vielleicht zehn Minuten vergangen, die ich in meiner Kajüte war, als es an meiner Tür klopfte. Als ich öffnete, sah ich Bernhard davorstehen „Darf ich reinkommen?“, fragte er mich. „Bitte“, antwortete ich und ließ ihn eintreten. Bernhard wirkte ziemlich niedergeschlagen „Zuerst möchte ich mich für den Empfang entschuldigen, den dir Reinhard bereitet hat“, sagte er und fuhr dann fort: „Ich weiß, du hast geglaubt, ich hätte deinen Bruder hingehängt. Ich würde so etwas nie tun, glaube mir. Ich bin enttäuscht von Reinhard, von dem Krieg, von den Nazis und den furchtbaren Zuständen, die zurzeit herrschen. Vor allem aber habe ich den Streit mit Klaus damals bereut, da ich Reinhard damit die Gelegenheit gegeben habe, ihn hinzuhängen. Dadurch hat er die Gelegenheit bekommen, schneller aufzusteigen. Ansonsten hätte er es sicherlich nicht zum Kapitän gebracht. Leute wie Reinhard, die auf diese infame Weise ihre Treue zum Regime beweisen, werden von der Partei durch Beförderung belohnt. Dass Reinhard zu der Zeit, als wir unseren letzten Kartenabend hatten, bereits Mitglied der NSDAP war und im Begriff stand, in der Partei aufzusteigen, war mir damals auch nicht bekannt. Mein Streit mit Klaus kam ihm daher gerade recht, seine Parteitreue zu beweisen, was ihm das Kapitänspatent bei der Marine einbrachte. Einen abtrünnigen Freund aus Vaterlandsliebe zu denunzieren, war der beste Beweis seiner Loyalität, den er nur irgendwie erbringen konnte. Reinhard hat auch mich dazu getrieben, mit ihm zur Marine zu gehen, wie du es vorgeschlagen hast. Ich dürfte dir dies alles gar nicht erzählen, da ich sonst selbst fürchten müsste, in ein Konzentrationslager eingeliefert zu werden. Ich war damals verblendet, habe das aber längst bereut. Dies wollte ich dir nur sagen, damit du mich nicht verurteilst.“ Ich reichte ihm die Hand und bedeutete ihm, sich zu setzen. Er wirkte ziemlich deprimiert. Ich bot ihm ein Glas Wasser an. Mehr war leider in meiner Kajüte nicht vorhanden. Er müsse schleunigst wieder gehen, da sonst Reinhard Verdacht schöpfen könnte. Dieser würde sich auf dem Schiff wie ein schrecklicher Despot aufführen. Er hätte mich zu seiner Mannschaft angefordert, um mich schikanieren zu können, fügte Bernhard noch beim Gehen hinzu. Er solle mir noch meine Behandlungsräume zeigen. Ich solle ihn begleiten. Als Schiffsarzt war ich für die ärztliche Behandlung der Verwundeten und Kranken zuständig. Mein Arbeitsraum war klein, beinhaltete aber die wichtigsten Utensilien wie Verbandszeug und einige chirurgische Instrumente sowie Infusionen und Spritzen, die ich zur Versorgung meiner Patienten benötigte. Bernhard war mir als Krankenpfleger zugeteilt.
Das Abendessen fand in der Kombüse des Schiffes statt. Ich saß mit den Offizieren, Reinhard als Kapitän, dem Steuermann und zwei weiteren Leutnants an einem Tisch. Bernhard saß bei den Feldwebeln, den sogenannten Maten. Der Kapitän war gut gelaunt. Er prostete uns zu, wobei er mich mit einem abschätzigen Blick musterte. Ich ließ mir nichts anmerken, sondern prostete zurück und lobte das Kantinenessen.
„Um sechs Uhr ist Morgenappel, dann Frühstück. Um sieben Uhr laufen wir aus“ waren Reinhards Worte zum Abschied. Dann stand er auf und ging.
Wir anderen standen ebenfalls auf, verabschiedeten uns und begaben uns zu unseren Schlafplätzen.
Bernhard war nicht mehr zu sehen. Er hatte sich offensichtlich bereits eher zurückgezogen und hingelegt.
Nach dem Morgenappel gab es Frühstück. Dann musste jeder auf seinen Posten zum Auslaufen in Richtung Nordatlantik. Lange Zeit blieben wir an der Wasseroberfläche, bis dann der Befehl zum Tauchen gegeben wurde. Ein amerikanisches Versorgungsschiff war auf dem Sonar aufgetaucht, dem wir uns rasch näherten, um es zu torpedieren. Schwer getroffen verschwand es vom Sonar. Mit den militärischen Ereignissen hatte ich wenig zu tun, da meine Aufgabe darin bestand, mich um Kranke zu kümmern.
Reinhard schaute mich beim Essen nur verächtlich an, ließ mich ansonsten links liegen, was mir ganz recht war. Bernhard hingegen war mir eine große Unterstützung bei meiner Arbeit.
Wir waren jetzt bereits mehrere Wochen auf See. Unsere Vorräte gingen langsam zu Ende, weshalb wir zurück zu unserer Basis nach Hammerfest mussten.
10. DIE HAVARIE
Ich freute mich bereits, Sylvia wiedersehen zu können, als wir plötzlich von einem englischen Jagdflugzeug angegriffen wurden. Dieser Flieger war unvermittelt aus dem wolkenverhangenen Himmel über uns aufgetaucht und hatte begonnen, uns senkrecht von oben zu beschießen. Mit unserer Bordkanone beschossen wir ihn von unten, wobei er plötzlich schwer getroffen zu sein schien. Über uns explodierte das Flugzeug und stürzte direkt auf unser Schiff, das auseinanderzubrechen drohte. Der Aufprall war schrecklich. Einige unserer Leute wurden von den herabfallenden Trümmern erschlagen: „Rettungsboot herrichten. Alle Mann Schwimmwesten anziehen. Das U-Boot sinkt“, brüllte Reinhard seine Befehle. Da es nur ein einziges Schlauchboot gab, das Reinhard für sich, Bernhard und zwei seiner Offiziere beanspruchte, entwickelte sich ein enormes Durcheinander, da alle auf dieses Schlauchboot wollten. Die Leute liefen in ihrer Panik kreuz und quer herum, ohne etwas Vernünftiges zusammenzubringen.
Meine beiden Freunde hatten ihr Schlauchboot aufgeblasen und ins Wasser gelassen, in das sie einstiegen. Zwei andere folgten ihnen. Ich legte meine Schwimmweste an und wollte ihnen ebenfalls ins Boot nachkommen, wurde aber von Reinhard mit dem Fuß zurück ins Wasser gestoßen: „Du blöder Hund bleibst draußen“, schrie er mich an, als ich im eisigen Wasser des Nordatlantik landete. Bevor die Wellen über mir zusammenschlugen und die furchtbare Kälte in mich eindrang, sah ich noch, wie Reinhard mit seiner Pistole auf einen Matrosen schoss, der ebenfalls auf das Rettungsboot zu gelangen versuchte.
Was ich erst viel später erfuhr, war, dass dieser Mann noch im Sterben mit letzter Kraft Reinhard die Pistole entriss und seinerseits auf ihn feuerte, bevor er mit der Waffe in der Hand im Atlantik versank.
Reinhard war offensichtlich am Oberschenkel getroffen worden und blutete stark, wobei Bernhard ihn zu verbinden versuchte, was nur wenig Erfolg zeigte.
Von all dem hatte ich allerdings nichts mehr mitbekommen. Glücklicherweise hatte ich rechtzeitig meine Schwimmweste angezogen. In meiner Verzweiflung versuchte ich zu schwimmen, was bei der Kälte und dem starken Wellengang fast nicht möglich war. Zufällig schwamm ein hölzernes Möbelstück an mir vorbei, an das ich mich zu klammern versuchte. Ich zog mich hinauf, um aus dem kalten Wasser herauszukommen, was mir nur unwesentlich gelang.
Wie lange ich so auf dem Wasser trieb, weiß ich nicht mehr, da ich infolge der Kälte bald das Bewusstsein verlieren sollte. Unglücklicherweise hatte es auch noch zu regnen begonnen, was mir meinen Zustand noch unangenehmer machte. Die anderen waren schon weit weg. Mit meinem Leben hatte ich bereits abgeschlossen und betete zu Gott um Vergebung meiner Sünden. Meine letzten Gedanken, bevor ich ohnmächtig wurde, galten Sylvia. Nach Klaus habe ich nun zum zweiten Mal eine geliebte Person für immer verloren, ging es mir noch durch den Kopf, als meine Sinne bereits zu schwinden begannen. Johanna werde ich auch nicht mehr sehen, blitzte es noch in meinem Kopf auf, bevor der Faden riss.
11. DIE RETTUNG
Was dann geschah, weiß ich nur aus Erzählungen, da ich in eine tiefe Ohnmacht gefallen war.
Mich fror furchtbar. Ich hatte Fieber und Schüttelfrost. Von meiner Umgebung nahm ich wenig wahr, da ich mich in einem ziemlich deliranten Zustand befand. In meinen Fantasien sah ich Wellen, die über mir zusammenschlugen, die mich erdrückten und erstickten. Ich glaubte, sterben zu müssen. In meiner Verzweiflung schlug ich um mich, um Angreifer abzuwehren. Ich bekam furchtbare Angst und schreckliche Alpträume, die mich quälten.
Von Zeit zu Zeit tauchte eine entsetzliche Fratze vor meinem inneren Auge auf, die irgendwie Reinhard glich, den ich hasste. Wie lange dieser Zustand anhielt, weiß ich auch nicht mehr. In meinem Arm war eine Infusion angelegt, über die mir Schmerz- und Beruhigungsmittel gespritzt wurden, ohne die ich wahrscheinlich völlig durchgedreht wäre. So nach und nach wurde ich klarer im Kopf und verstand langsam, dass ich in einem Bett lag, in einem Zimmer mit zehn weiteren Krankenbetten. Ich befand mich in einem Krankenhaus in London, in englischer Gefangenschaft. Ein englisches Schiff, das zufällig vorbeikam, hätte mich halb tot aus dem Meer gezogen und nach London gebracht, wurde mir berichtet.
Man pflegte mich wieder gesund. Die Schwestern und Pfleger um mich herum wirkten distanziert, verhielten sich aber einem deutschen Kriegsgefangenen gegenüber nicht unfreundlich oder gar feindlich. Nachdem mein Arzt, ein freundlicher, älterer Herr, meine Genesung festgestellt hatte, wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen. Anfangs fühlte ich mich noch schwach. Ich benötigte einige Tage, um wieder auf die Beine zu kommen. Man gab mir diese Zeit. Als es dann endlich so weit war, dass ich mich wieder recht gut fühlte, wurde ich erneut auf ein Schiff gebracht, das aber nicht für den Kriegseinsatz bestimmt war, sondern nach Kanada aufbrach, das damals noch englische Kolonie war.
Auf der Ladefläche eines Lasters wurden ich und einige weitere deutsche Kriegsgefangene zur Themse gebracht. Dort wurden wir auf ein kleineres Boot verladen, das die Themse hinunter bis zur Anlegestelle der großen Schiffe fuhr, wo wir dann auf ein großes Passagierschiff verfrachtet wurden. Ein Highlight in meinem bisherigen Leben war sicherlich diese Fahrt auf der Themse, bei der wir an den meisten der berühmten Sehenswürdigkeiten Londons vorbeikamen. Ich sah die Westminster Abbey, die Houses of Parlament, die Tower Bridge, den Tower und vieles mehr, was mich in helle Begeisterung versetzte. London ist schon eine tolle Stadt, ging es mir damals durch den Kopf.
12. DIE ÜBERFAHRT
Auf dem Passagierschiff wurden wir in Arbeitsgruppen eingeteilt. Ich musste als Kellner viele vornehme Engländer bedienen, was mir eigentlich recht viel Spaß bereitete. Beim Be- und Entladen von Fracht und Gepäck der Mannschaft und der Passagiere mussten wir mit anpacken. Insgesamt ging es uns während der Überfahrt, die fast zwei Wochen dauerte, eigentlich nicht schlecht, wenn auch das Zimmer, in dem wir anfangs zu fünft zusammengepfercht waren, schon unangenehm eng war, zumal einer dieser fünf Kameraden sich als ein äußerst unsympathischer Typ herausstellte, dessen pockennarbiges, hässliches Gesicht mit den kalten, grauen Augen in mir schreckliche Erinnerungen wachrief. Dieser Mann war der jüngere der beiden Herren von der Gestapo, die damals meinen Bruder abgeholt haben. In mir stieg ein furchtbarer Hass hoch. Manchmal glaubt man kaum, was es für Zufälle gibt. Ich fragte ihn, wo er seinen Kollegen von der Gestapo gelassen hätte. Er schaute mich verdutzt an und wurde kreidebleich im Gesicht. „Was bist du denn für ein räudiger Hund?“, schnauzte er mich an. „Ich meine deinen Kollegen, mit dem du meinen Bruder in Landshut abgeführt hast“, antwortete ich ihm ebenfalls ziemlich unwirsch. „Lass mich in Ruhe, du Arschloch“, sagte er noch und fügte hinzu, dass sein Kamerad den Heldentod in Russland gefunden hätte. Es war mir bewusst, dass ich mir einen Feind geschaffen hatte, vor dem ich mich in Zukunft in Acht nehmen musste. Andererseits könnte ich ihm große Schwierigkeiten bereiten, wenn ich ihn als Angehörigen der Gestapo denunzieren würde. Dies war ihm sicherlich bewusst.
Als deutscher Kriegsgefangener musste ich während der Überfahrt kräftig zupacken, wenn ich keine größeren Strafen riskieren wollte. Nachdem ich ihnen erklärt hatte, ein Arzt zu sein, behandelten sie mich freundlicher. Vor allem bekam ich ein anderes Zimmer, das ich mir nur mit einem weiteren Gefangenen teilen musste. Froh war ich vor allem, endlich von dem Gestapomann wegzukommen. Man brachte mir verletzte und kranke Matrosen und auch Kriegsgefangene zur Behandlung, wobei mir mein Zimmernachbar, ein Krankenpfleger, tatkräftig zur Hand ging.
Zum ersten Mal legten wir im Hafen von Halifax an. Neuer Proviant wurde geladen. Die Wachen wurden ausgewechselt. Wir Kriegsgefangene mussten beim Ausladen der Fracht helfen, hatten dann aber gleich wieder zurück aufs Schiff zu gehen. Es gab viele zum Teil sehr schwere Säcke zu schleppen. Abends waren wir alle ziemlich fertig. In Halifax bekamen wir zum ersten Mal wieder eine richtige Mahlzeit zum Essen. Während der Überfahrt gab es für uns nur gekochte Kartoffeln, Weißbrot und saure Äpfel zum Verzehr. Nachdem die Ladung gelöscht und neue Fracht an Bord genommen war, legte unser Schiff wieder ab. Es ging den Sankt-Lorenz-Strom entlang bis Montreal, wo wir ein weiteres Mal an Land gingen, um die Ladung auszutauschen, dann weiter bis Toronto, wo sich die gleiche Prozedur erneut wiederholte.
Zeitweise wurden wir mit Bussen übers Land transportiert. Dann ging es auf Schiffen wieder weiter bis zum westlichen Ende des Lake Superior. Von dort wurden wir auf Lastwägen weiter nach Westen gebracht. Auf den Schiffen mussten wir hart arbeiten. Auf den Lastern war es für uns bequemer. Ich genoss es, die abwechslungsreiche Landschaft Kanadas zu beobachten.
Nach einer weiteren Woche hatten wir unser Ziel, ein Holzfällercamp mitten in den Bergwäldern des späteren Banff-Nationalparks im Bundesland Alberta, erreicht.
13. DAS HOLZFÄLLERCAMP
Wir befanden uns in einem riesigen Lager, das von einem Palisadenzaun umgeben war und mitten in einem großen Waldgebiet lag. Um uns herum konnten wir Berge bewundern, die nach oben großteils von mächtigen Gletschern bedeckt wurden und deren schroffe, felsige Spitzen senkrecht in den Himmel zu ragen schienen. Sehr häufig fingen sich Wolken an diesen Giganten, so dass wir leider öfter im Regen arbeiten mussten. Unser Tal wurde von einem schmalen Fluss durchzogen, der sich nach vielen Windungen in einen See ergoss, dessen Ufer zum Teil von Schilf bedeckt war.
An einer Stelle wies dieser See sogar einen kleinen Sandstrand auf, zu dem wir, wenn immer es möglich war, im Sommer bei schönem Wetter zum Baden gingen.
Es gab viele Holzbaracken, wobei sich jeweils vier Gefangene eine solche Hütte teilten. Man brachte mich in eine Hütte, gab mir Decken und Arbeitskleidung und wies mir ein Lager zu. Für den nächsten Tag wurden wir in Arbeitsgruppen eingeteilt. Nach der anstrengenden Reise waren wir alle ziemlich erschöpft. Es gab einen großen Gemeinschaftsraum, in dem sich alle zum Essen versammelten. Die Wärter saßen etwas abgetrennt von den Gefangenen, bekamen aber, soweit ich es beurteilen konnte, das gleiche Essen wie wir. Uns wurden Teller und Besteck zugeteilt, das wir natürlich selbst abspülen mussten. Zum Essenfassen stellten wir uns in Reih und Glied an und warteten, bis wir an die Reihe kamen. Meistens gab es Gulasch oder Suppen mit zum Teil undefinierbarem Inhalt. Kartoffel und Weißbrot bekamen wir praktisch immer dazu. Es war ausreichend Essen vorhanden, so dass wir nicht hungern mussten.
Wenn man seine Arbeit richtig versah, waren die Wächter in der Regel freundlich. Es wurde niemand schikaniert. Die Bäume mussten wir mit Handsägen fällen, was oft ausgesprochen anstrengend war. Zum Abtransport der Bäume gab es Traktoren. Meinem Kameraden von der Gestapo begegnete ich mehrmals. Er fauchte mich jedes Mal an, wenn er mich sah. Ich bekam das Gefühl, dass er mich tätlich angreifen würde, sobald er die Gelegenheit dazu bekäme. Solange die Wärter auf mich aufpassten, war ich einigermaßen in Sicherheit. Ich bin sicherlich muskulös und kräftig; doch glaube ich nicht, dass ich gegen diesen brutal aussehenden Kerl eine reelle Chance im Kampf Mann gegen Mann gehabt hätte.
Sobald sie erfahren hatten, dass ich Arzt war, wurde ich vom Baumfällen abgezogen und zum Lazarettdienst eingeteilt. Ärzte wurden dringend benötigt, da es bei dieser harten und auch gefährlichen Arbeit schwere Verletzungen gab. Meine chirurgischen Erfahrungen, die ich bisher sammeln konnte, kamen mir in diesem Camp sehr zugute.
14. BERNHARD
Es gab auch eine Krankenstation, die von Pflegern geleitet wurde. Eine große Überraschung erlebte ich, als ich unter den Pflegern Bernhard erkannte. Als er mich bemerkte, erschrak er heftig. Anscheinend plagte ihn ein schlechtes Gewissen, da er mir gegen Reinhard beim Rettungsboot nicht beigestanden hatte.
„Hallo, Lukas“, begrüßte er mich. „Es ist schön, dich wiederzusehen“, fuhr er fort. „Wir dachten alle, du wärst tot, nachdem dich Reinhard vom Boot gestoßen hatte. Ich habe es leider nicht verhindern können, was mir furchtbar leidgetan hat“, entschuldigte er sich. „Ich habe mich an einem hölzernen Schrank festgeklammert, bis man mich bewusstlos auffischte“, antwortete ich ihm. Bernhard war sicherlich nicht schuld daran, dass Reinhard mich ins Wasser gestoßen hat. Er hätte es nicht verhindern können: „Wo ist Reinhard?“, fragte ich ihn. „Ich habe keine Ahnung“, gab Bernhard mir zur Antwort. „Er ist offensichtlich in London geblieben und nicht wie wir nach Kanada gebracht worden“, meinte Bernhard. „Seine Spur hat sich jedenfalls in England verloren. Vielleicht ist er auch gestorben, da er sich im Schlauchboot eine ziemlich schwere Schussverletzung zugezogen hat, weshalb er in London im Krankenhaus behandelt werden musste. Reinhard hat mit seiner Pistole auf einen Matrosen geschossen, der auch auf das Rettungsboot springen wollte. Dieser hat Reinhard, bevor er sterbend in den Fluten des Atlantiks versank, die Pistole entrissen und seinerseits auf Reinhard geschossen, dessen Oberschenkel durch den Schuss schwer verletzt wurde“, berichtete mir Bernhard.
Bis sie von einem englischen Schiff, das zufällig vorbeikam, aufgegriffen wurden, hatte Reinhard bereits ziemlich viel Blut verloren. Offensichtlich sind die beiden vom gleichen Schiff mitgenommen worden, das auch mich rettete.
Im Laufe der Zeit freundeten wir uns wieder richtig an. Mein Feind war Reinhard, nicht Bernhard. Der war harmlos, so viel ist mir längst klar geworden.
Nachdem es Sommer war, gingen wir häufig zum nahegelegenen See zum Baden. Dieser war überraschend warm. Meistens zogen wir uns nackt aus und sprangen in das glasklare Wasser. Wir plantschten und freuten uns wie kleine Kinder, wenn wir im See schwimmen konnten.
Bernhard jedoch konnte, wie ich leider feststellen musste, gar nicht schwimmen. Er plantschte nur am Ufer herum. So nackt, wie er jetzt war, fiel mir zum ersten Mal seine große, muskulöse Figur auf, die ich bisher kaum beachtet hatte. Trotz seines etwas rundlichen Gesichtes, das mit vielen Bartstoppeln übersät war, und seiner doch recht schütteren, hellblonden Haare war er eigentlich eine recht gutaussehende Erscheinung. Ich versuchte ihm das Schwimmen beizubringen, was sich als gar nicht so einfach herausstellte, da er viel zu viel Angst vor dem Wasser hatte.
Die Landschaft um uns herum war wunderschön. Es gab viele Bäume und Hügel, aber auch grüne Wiesen, durch die unser mäandernder Fluss zog, der in den See mündete.
Wir waren zwar Gefangene, genossen aber dennoch das Leben in dieser traumhaft schönen Wildnis, die sich im Frühjahr, wenn die Bäume und die Wiesenblumen blühten, in ein buntes, in allen hellen Farben leuchtendes Blütenmeer verwandelte, während im Herbst, wenn die Blätter sich verfärbten, besonders dunklere Braun- und Rottöne vorherrschten.
Da Bernhard und ich zum Sanitätsdienst eingeteilt waren, hatten wir keine so schwere Arbeit zu verrichten wie die Holzfäller und diejenigen, die die Stämme bearbeiten und über den Fluss abtransportieren mussten. Der Fluss mündete in einen größeren, über den viele Stämme nach Calgary geschafft wurden.
15. LAGERLEBEN