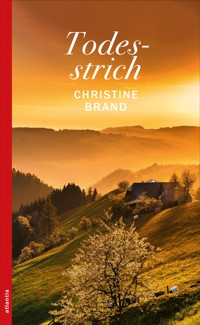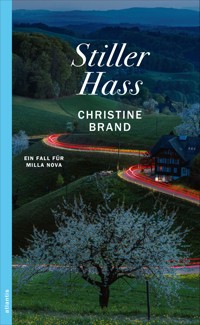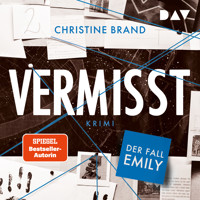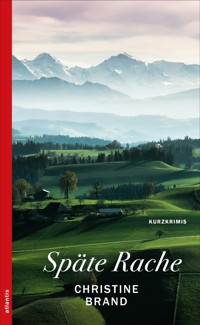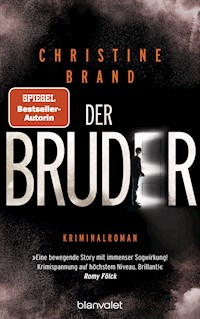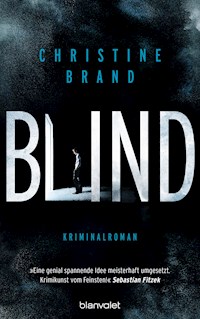9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Milla Nova ermittelt
- Sprache: Deutsch
»Raffiniert und äußerst rasant: Dieser Krimi bietet coole Hochspannung mit einem unvergesslichen Ermittlerteam!« Bernhard Aichner
Der blinde Nathaniel und sein kleiner Patensohn Silas geben ein merkwürdiges Paar ab – doch seit dem Tag, an dem Nathaniel Silas' Mutter das Leben rettete, sind sie unzertrennlich. Jeden Monat besuchen sie gemeinsam die Komastation des Berner Spitals, doch heute stimmt etwas nicht. Eine fremde Frau liegt in dem Bett, in dem vier Jahre lang Silas' Mutter lag. Der Oberarzt behauptet, sie sei gestorben. Doch es gibt kein Grab, keinen Totenschein, keine Antworten auf Nathaniels Fragen. Als seine gute Freundin, die Journalistin Milla Nova, herausfindet, dass in der Schweiz mehrere Komapatienten verschollen sind, wittert sie einen Skandal. Dann tauchen Leichen am Ufer der Aare auf, die alles in einem anderen Licht erscheinen lassen. Nathaniel wird klar: Die verschwundene Patientin lebt – doch sie schwebt in tödlicher Gefahr ...
Die unabhängig voneinander lesbaren Krimis um Milla Nova und Sandro Bandini bei Blanvalet:
1. Blind
2. Die Patientin
3. Der Bruder
4. Der Unbekannte
5. Der Feind
Lesen Sie auch »Wahre Verbrechen»: Christine Brand schreibt über ihre dramatischsten Fälle als Gerichtsreporterin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Buch
Der blinde Nathaniel und sein kleiner Patensohn Silas geben ein merkwürdiges Paar ab – doch seit dem Tag, an dem Nathaniel Silas’ Mutter das Leben rettete, sind sie unzertrennlich. Jeden Monat besuchen sie gemeinsam die Komastation des Berner Spitals, doch heute stimmt etwas nicht. Eine fremde Frau liegt in dem Bett, in dem vier Jahre lang Silas’ Mutter lag. Der Oberarzt behauptet, sie sei gestorben. Doch es gibt kein Grab, keinen Totenschein, keine Antworten auf Nathaniels Fragen. Als seine gute Freundin, die Journalistin Milla Nova, herausfindet, dass in der Schweiz mehrere Komapatienten verschollen sind, wittert sie einen Skandal. Dann tauchen Leichen am Ufer der Aare auf, die alles in einem anderen Licht erscheinen lassen. Nathaniel wird klar: Die verschwundene Patientin lebt – doch sie schwebt in tödlicher Gefahr …
Die Autorin
Christine Brand, geboren und aufgewachsen im Schweizer Emmental, arbeitete als Redakteurin bei der »Neuen Zürcher Zeitung«, als Reporterin beim Schweizer Fernsehen und als Gerichtsreporterin. Im Gerichtssaal und durch Recherchen und Reportagen über die Polizeiarbeit erhielt sie Einblick in die Welt der Justiz und der Kriminologie. Sie schrieb bereits Romane und Kurzgeschichten bei Schweizer Verlagen. »Blind« war ihr erster Roman bei Blanvalet, mit »Die Patientin« erscheint der zweite Teil um das Schweizer Ermittlerduo Milla Nova und Sandro Bandini. Christine Brand lebt in Zürich, reist aber die meiste Zeit des Jahres um die Welt.
CHRISTINE BRAND
DIEPATIENTIN
KRIMINALROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung März 2020 bei Blanvalet Verlag, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Copyright © 2020 by Blanvalet, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Umschlaggestaltung: www.buerosued.de Umschlagabbildung: Stephen Caroll / Trevillion Images / Getty Images / Ryan Mc Vay JB Herstellung: sam Satz und E-Book: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-24254-1V001 www.blanvalet.de
Prolog
»Herein!«
Zögernd legt er die Hand auf die Klinke. Er riecht seine eigene Angst. Sie stinkt. Dann gibt er sich einen Ruck und öffnet die Tür. Das Zimmer liegt im Dunkeln. Vor dem raumhohen Fenster zeichnet sich eine Gestalt ab. Sie ist nicht mehr als ein Schatten im Gegenlicht, wie der Zauberer von Oz in einem Scherenschnitt. Oder die böse Hexe. Eine Silhouette ohne Gesicht.
»Nun treten Sie schon ein, berichten Sie! Wie ist die Operation verlaufen?«
»Negativ.«
»Was soll das heißen?«
»Die Patientin ist tot.«
»Sie ist tot?«
»Es sind die gleichen Komplikationen aufgetreten wie beim letzten Mal.« Er steht noch immer in der Tür, kann sich nicht überwinden, näher zu treten. Sein Körper verweigert jegliche Nähe zur Gestalt.
»Verdammt! Sie müssen das in den Griff kriegen!«
Unweigerlich weicht er noch weiter zurück. »Ich bin nahe dran.« Er blickt zu Boden.
»Das genügt nicht.«
»Ich arbeite daran.«
»Sie haben nicht mehr viel Zeit.«
Einen Moment lang schweigen sie sich an. Die Stille unterstreicht jedes Geräusch. Er hört seine Armbanduhr ticken. Draußen zetert ein Spatz.
»Ist noch was?« Die Gestalt stellt die Frage, als spucke sie Gift.
Er sucht nach Worten und findet sie nicht. Unbeholfen streicht er die feuchten Hände an seiner Hose trocken. Ein Knall lässt ihn zusammenfahren. »Was war das?«
»Ein Vogel. Die Scheibe. Sie sind zu dumm für diese Welt. War noch was?«
»Patientin F…«
»Was ist mit ihr?«, wird er unterbrochen.
»Sie ist aufgewacht.«
Die Gestalt erstarrt. »Aufgewacht? Von selbst?«
Er nickt stumm.
»Bevor wir mit ihr angefangen haben?«
»Ja. Einfach so aufgewacht.«
»Sorgen Sie dafür, dass sie verschwindet.«
»Wie …«
»Mir ist egal, wie. Machen Sie einfach. Seien Sie mal kreativ!«
»Aber sie erinnert sich nicht. Sie ist keine Gefahr.«
»Das macht keinen Unterschied. Erledigen Sie Ihren Job. Sofort.«
Die Gestalt wendet sich von ihm ab. Blickt hinaus auf die Berge, die sich vom dunkelblauen Himmel abheben. Wie Zähne, die auf dem Horizont festsitzen. Die untergehende Sonne färbt sie rosagelb.
Er dreht sich um und verlässt wortlos den Raum. Schließt die Tür hinter sich. Lehnt sich im Flur an die Wand. Fährt sich mit der Handfläche über die schweißnasse Stirn und fragt sich, was ihn getrieben hat, sich auf das Projekt hier einzulassen. Warum er sich hat ködern lassen von dem vielen Geld, der Hoffnung auf Ruhm. Und wie er je wieder aus dieser Sache rauskommt. Seine Visionen sind tot. Nichts ist so, wie er es sich vorgestellt hatte. Schlimmer hätte es nicht kommen können. Er legt den Kopf in den Nacken, blickt an die Decke. In ihm nichts als Verzweiflung.
In der Ecke über ihm filmt lautlos eine Überwachungskamera. Sie überträgt das Bild eines Mannes, der sich im Flur an die Wand lehnt, sich mit der Hand über das Gesicht fährt, die Decke anstarrt. Der nicht ahnt, dass hinter der Tür jemand auf den Bildschirm blickt, ihn beobachtet, zum Handy greift. Und einen tödlichen Befehl ausspricht.
1
»Schläft Mama noch?«
»Ja, Mama schläft.«
»Wann wacht sie endlich auf?«
»Das weiß ich nicht.«
»Warum schläft sie so lange?«
»Weil sie sehr, sehr müde war.«
»Und warum müssen wir sie dann besuchen, wenn sie sowieso schläft?«
Nathaniel lässt die kleine Hand kurz los, wuschelt durch Silas’ Locken und drückt ihn während des Gehens an sich, sodass sie beide beinahe ins Stolpern geraten. »Sie schläft nicht richtig. Nicht so wie du und ich schlafen. Sie ist bloß nicht ganz wach. Aber sie spürt, dass wir da sind. Wenn wir mit ihr reden, kann sie unsere Stimmen hören. Dann weiß sie, dass sie nicht allein ist.«
»Aber ich will, dass sie aufwacht! Mama ist langweilig, wenn sie immer nur schläft.«
Nathaniel verspürt einen Stich im Herzen. Nie hätte er gedacht, dass er ein Kind derart lieben könnte. Sein Stock stößt mit einem hellen Klang an eine Kante. Metall, die Tür, sie müssen nach rechts, dann weiter: eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht. Nach acht Schritten stoppt Nathaniel, er tastet nach dem kleinen Plättchen neben der Tür, findet es und fährt mit den Fingern über die Zahlen. Zimmer zweihundertdreizehn. Sie sind da. Nathaniel drückt auf die Klinke.
Das ungleiche Paar ist längst ein eingespieltes Team. Silas führt den blinden Nathaniel ins Zimmer und legt dessen Hand auf die Metallstange am Bettende, die sich immer kalt anfühlt. Er holt die zwei Stühle, die unter dem Fenster stehen, und schiebt sie mit einigem Getöse neben das Bett. Dann weist der Kleine den Großen an, wo er sich hinsetzen kann, er macht das ganz vorsichtig, als wäre er der Erwachsene und nicht gerade erst vier Jahre alt. Sobald sie dasitzen neben der schlafenden Frau, der kleine Junge und der blinde Mann, die sich irgendwie ähnlich sehen, ohne dass es einem der beiden bewusst ist, schweigen sie erst einen Moment. Der Augenblick verlangt nach Stille. Die Worte fordern Zeit, bis sie sich finden lassen.
Die Frau liegt reglos vor ihnen. Wie tot und doch nicht tot. Carole Stein ist das Opfer eines Gewaltdeliktes, und darum ist Silas das auch, ein Opfer, darum hat ihn seine Mutter noch nie gesehen, ihn nie in die Arme nehmen, ihn nie trösten, nie mit ihm schimpfen, ihm nie übers Haar streichen können. Sie wäre fast gestorben, als sie ihn mit letzter Kraft ins Leben gepresst hat. Seither liegt sie im Wachkoma. Vier Jahre schon.
Nathaniel tastet nach ihrem Arm, greift nach ihrer Hand. Legt sie in seine. Er hofft jedes Mal, eine Reaktion zu spüren. Doch da ist nichts.
»Nathaniel, das ist nicht meine Mama.« Silas flüstert, als fürchtete er, jemanden aufzuwecken.
»Doch, sie ist deine Mama. Du hast jetzt einfach zwei Mamas. Das hatte ich auch, als ich etwas älter war als du.«
Stimmt nicht, rügt Nathaniel sich selbst. Doch er erzählt Silas nicht, dass seine eigene Mutter schon tot war, als er eine Adoptivmutter bekommen hat, eine ganze Adoptivfamilie, alles inklusive. SeinefalscheFamilie, wie er sie nennt, wenn niemand es hört. Sie ist ihm fremd geblieben. Auch, weil sie ihn stets daran erinnert, dass er seine richtige Familie verloren hat, genau in dem Moment, als auch das Licht aus seinem Leben verschwand. Das alles wird er seinem Patenjungen vielleicht irgendwann einmal erzählen, wenn er älter ist. Das hat Zeit.
»Aber die Frau hier ist nicht meine Mama.« Silas klingt trotzig jetzt.
Nathaniel zögert, die richtigen Sätze fallen ihm nicht ein. Vielleicht weil es die Worte nicht gibt, die dem Kind erklären könnten, warum die Welt so ungerecht ist und manche Menschen Böses tun. Zum Beispiel einem Kind die Mutter zu nehmen.
»Ihre Haare sind ganz komisch.«
»Ihre Haare sind komisch?«
»Ja, komisch.«
»Wie sehen ihre Haare denn aus?«
»Sie sind so rund und grau.«
»Hm.« Unsicher legt Nathaniel die Hand auf das Bett zurück. »Du meinst, das ist eine andere Frau, die hier liegt?«
»Das ist nicht Mama.«
Ob er sich im Zimmer geirrt hat? Aber er hat doch die Nummer ertastet. Zweihundertdreizehn. Unschlüssig bleibt Nathaniel sitzen. »Silas, hängt über dem Bett eine Klingel oder baumelt da sonst was herunter?«
»Nö.«
Weil eine Komapatientin keine Klingel braucht. Nathaniel überlegt, ob er jemanden anrufen soll. Doch wer könnte ihm schon helfen? Er muss jemanden vom Pflegepersonal finden.
»Wir müssen eine Pflegerin finden«, sagt er zu Silas und hört, wie der Junge noch im selben Moment aufsteht.
Gemeinsam gehen sie zurück in den Flur. Die kleine Hand liegt in der großen.
»Hallo, ist hier jemand?«, ruft Nathaniel.
»Kann ich Ihnen helfen?«
Die Stimme ist nah, die Frau muss fast neben ihm gestanden haben. Sie klingt freundlich, auch wenn Nathaniel in ihrer Stimme Müdigkeit hört. Er glaubt, dass sie kleiner ist als er. Und jünger.
»Wir wollen Carole Stein besuchen. Aber der Junge sagt, es liege eine andere Frau in ihrem Bett.«
Es dauert einen Moment zu lange, bis eine Antwort folgt. Nathaniel kennt das. Er spürt förmlich, wie ihr Blick nach unten auf seinen Blindenstock schweift, dann hinüber zu dem Kind. Beinahe kann er die dazugehörenden Gedanken hören.
»Carole Stein?«, fragt die junge Frau schließlich zurück. »Nein, die liegt nicht hier, das ist das Zimmer von Frau Rothen. Lassen Sie mich kurz nachsehen. Ich bin gleich wieder da.«
Schritte entfernen sich.
»Wo ist Mama?« Silas zappelt an Nathaniels Arm herum.
»Ich weiß es nicht, aber die Frau wird es uns gleich sagen.«
Dasgleichzieht sich in die Länge, und nicht nur Silas, auch Nathaniel wird ungeduldig. Es kann nicht sein, dass sie Carole verlegt haben. Sie liegt seit Jahren in Zimmer zweihundertdreizehn. Es ist ihr Zimmer. Die können es ihr nicht einfach wegnehmen. Außer … Der Gedanke kommt mit einem heftigen Schmerz, der ihm den Atem nimmt.
Bitte lass sie nicht gestorben sein. Bitte lass sie nicht gestorben sein, bitte nicht.
Der Satz in seinem Kopf hört sich an wie ein Gebet, dabei glaubt er an gar keinen Gott.
Oder sie ist aufgewacht!
»Autsch!«, jammert Silas. Nathaniel hat seine Hand zu fest gedrückt.
Die Schritte kehren zurück.
»Es tut mir leid.«
Nathaniel will es nicht hören. Am liebsten würde er sich die Ohren zuhalten, doch stattdessen greift er unbeholfen nach dem Kopf des Kindes, als könnte er die Wahrheit von Silas fernhalten, wenn er zumindest ihm die Ohren zuhält.
»Wir haben keine Carole Stein auf unserer Abteilung.«
Nathaniel spürt, dass die Frau ihn anschaut, und er fragt sich, was sie in seinem Gesicht liest. Er weiß, dass er – anders als die meisten Blinden – über eine Mimik verfügt. Weil er elf Jahre lang ein Sehender war. Sie wird ihm ansehen, dass der Tod in seinen Gedanken ist und ihn aufwühlt.
»Das kann nicht sein. Sie war immer hier«, widerspricht Nathaniel.
»Wo ist Mama?«, fragt Silas schon wieder.
»Wann haben Sie sie denn zuletzt besucht?« Auch die Frau klingt auf einmal unsicher.
»Vor einem Monat. Montag vor einem Monat.«
»Ich arbeite erst seit drei Wochen hier«, sagt die Frau, als ob dies alles erklären würde.
»Können Sie noch einmal nachschauen?«
»Es tut mir leid, ich habe es bereits geprüft: Hier liegt keine Patientin mit dem Namen Stein. Sind Sie sicher, dass Sie im richtigen Spital sind?«
»Natürlich bin ich sicher, dass ich im richtigen Spital bin. Und im richtigen Zimmer war. Ich komme seit vier Jahren jeden Monat hierher. Was ist mit Carole passiert?«
Bitte lass sie nicht gestorben sein.
»Womöglich wurde sie in ein anderes Spital verlegt.« Ihre Antwort klingt eher wie eine Frage.
Oder sie ist gestorben, denkt Nathaniel erneut. Wäre doch das Kind nicht hier, dann könnte er frei sprechen. »Könnte sie für immer weggegangen sein?«, fragt er vorsichtig.
»Warum ist Mama für immer weggegangen?«
»Das ist sie nicht, sie haben sie wahrscheinlich nur an einen anderen Ort gebracht«, erklärt die Frau Silas.
»Wahrscheinlich? Und warum wurden wir nicht informiert?« Nathaniel möchte erleichtert sein, aber er ist es nicht. Weil sich alles falsch anfühlt. Die Frau schweigt. Vielleicht zuckt sie mit den Schultern. Nathaniel kann es nicht fassen, Wut kocht in ihm hoch, Wut und Verzweiflung. Doch er schluckt beides runter, ebenso die Worte, die er der Frau ins Gesicht schleudern will. Das Kind, sagt er sich, denk an das Kind. Er räuspert sich. »Ich will mit jemandem reden, der hier verantwortlich ist. Aber nicht jetzt, ich komme wieder, ich muss zuerst den Kleinen nach Hause bringen.«
»Ich will aber Mama sehen!«
Nathaniel hört Silas an, dass er gleich zu weinen beginnt. Am liebsten würde er es ihm gleichtun.
2
Der Kastenwagen, auf dessen Türen das Signet des Schweizer Fernsehens klebt, gerät in der Kurve ins Schlingern und fängt sich gleich wieder.
Milla Nova blickt erschrocken von ihren Unterlagen hoch. »Mir ist bereits kotzübel, fahr etwas vorsichtiger«, bittet sie Ivan Ivanovic, der eigentlich gar nicht Ivan heißt, den aber alle Ivan nennen.
Vor ihnen schlängelt sich die Straße wie ein schmales Band die Hügel hoch, die unter einer weißen Decke begraben liegen. Der Schnee fällt eher in Fetzen als in Flocken und verwandelt den Himmel in eine trübgraue Maße. Im Wageninnern ist nichts als das regelmäßige Schaben und Quietschen des Scheibenwischers und das Gebläse der Heizung zu hören. Trotzdem beschlagen die Scheiben. Hin und wieder rüttelt eine Windböe am Wagen. Milla und Ivan passieren die zur Hälfte zugeschneite Ortstafel von Rüeggisberg; ein kleines Dorf hoch über Bern, in dem die Wege Namen tragen wie Lisibühl, Hübeli oder Hüslistätt. Es sieht aus, als wären die letzten Bewohner vor dem Wintereinbruch geflohen. Das Jahr ist erst ein paar Tage alt, und schon macht die Welt auf Untergangsstimmung.
»Bist du sicher, dass wir hier richtig sind?«
»Ich glaube schon.«
Eine Antwort, die Ivan keineswegs beruhigt. Es wäre nicht das erste Mal, dass sie sich verfahren, weil Milla ihm eine völlig falsche Adresse angegeben hat. Er kennt ihren Hang zum Chaos. Schon seit über zehn Jahren sind sie regelmäßig zusammen im Einsatz. Milla als Reporterin, Ivan als ihr Kameramann. Sie haben einiges gemeinsam durchgestanden; eine Beinahe-Verhaftung im Bundeshaus zum Beispiel, Tränengas- und Gummischrotattacken, weil sie sich zwischen die Fronten begeben hatten, oder eine Hetzjagd von Neonazis, denen sie nur knapp entkommen sind. Ist Ivan mit Milla unterwegs, ist fast immer mit Schwierigkeiten zu rechnen. Nicht selten, weil sie meist alles andere als vorbildlich auf den Dreh vorbereitet ist. Oft aber auch, weil sie stets die wildesten Geschichten aufdeckt. Und die spannendsten, also die, die so ungern ans Tageslicht wollen. Mit Milla wird es wenigstens nie langweilig.
Sie lassen das menschenleere Dorf hinter sich und tauchen erneut ein ins weißgraue Nichts.
»Was drehen wir hier am Ende der Welt?«, fragt Ivan.
»Wir haben einen Termin beim Messias der magischen Pilze.«
Er wirft einen Blick zu Milla hinüber, um sich zu vergewissern, ob sie ihn veräppelt. Tut sie nicht; das verrät das Grinsen in ihrem Gesicht. Und das Strahlen in ihren grünen Augen, die von einer viel zu großen Strickmütze beinahe verschluckt werden. Unter dieser lugen links und rechts ein paar vorwitzige dunkle Locken hervor. An einer zwirbelt sie mit ihrem Finger herum.
»Klingt gut.« Ivan schnalzt mit der Zunge.
»Er will sich vor laufender Kamera mit Psilo-Pilzchen berauschen.«
»Klingt noch besser!« Ivan lacht. »Echt jetzt?«
»Indianerehrenwort!«
»Na, wie wir das wohl filmen wollen! Du stellst mich immer wieder vor neue Herausforder…«
»Dort vorne, dort muss es sein!«, unterbricht ihn Milla. Sie zeigt auf die Umrisse eines Gebäudes, das einsam an der Straße steht und sich zunächst nur schwach, dann immer deutlicher hinter dem Schleier aus Schneeflocken abzeichnet. Von Weitem sieht es aus wie ein altes Landschulhaus, wie sie heute überall leer stehen, weil die Familien mit ihren Kindern in die Stadt gezogen sind. Vorsichtig bremst Ivan und biegt auf den Parkplatz ein.Hotel Blauwaldist in ein Holzschild geschnitzt, das unter dem Vordach hängt. Daneben baumeln zwei Blumentöpfe im Wind, mit einem toten Etwas darin, das wohl einst Geranien gewesen sind. Das Haus wirkt verlassen.
»Bist du sicher, dass wir hier richtig sind?«
»Du wiederholst dich«, sagt Milla. »Wir sind hier goldrichtig.«
Exakt in jenem Moment, als sie die Autotüren öffnen, tritt Maximilian Stingeder aus dem Haus, das einst ein Hotel war, dann vorübergehend zur Pilgerstätte für Pilzfreunde wurde und schließlich als Kursort für Tantra-Begeisterte einen neuen Höhenpunkt erlebte. Und das jetzt ein leerstehendes Gebäude ist, das auf eine neue Nutzung wartet, die wohl niemals kommen wird. Stingeder breitet seine Arme aus, als wolle er Milla und Ivan gleichzeitig an seine Brust drücken. Dabei hat er beide noch nie zuvor gesehen. Milla streckt ihre Hand weit von sich, um einer Umarmung zu entgehen und den überschwänglichen Pilz-Messias zu einem weniger verfänglichen Händeschütteln zu bewegen. Während er nach ihrer Hand greift, drückt er mit dem anderen Arm Ivan an sich, der sich unbeholfen zu befreien versucht.
Stingeder ist etwa einen Kopf kleiner als Ivan und hat so gar nichts Messianisches an sich. Im Gegenteil, er wirkt seltsam farblos; ein Mensch, der selbst dann übersehen wird, wenn er direkt vor einem steht. Die Augen abwaschwassergrau und zu nah beieinander liegend, das gelblich blonde Haar stramm nach hinten gekämmt und platt an den Kopf geklatscht, und eine Nase, die Milla an ein Tier erinnert. Ein Maulwurf.
»Wie schön, dass Sie da sind!«, sagt Stingeder in unverwechselbarem Wiener Schmäh. »Seid gesegnet im Namen der magischen Pilze!«
Milla sieht, dass sich Ivan ein Lachen verkneift, und sie fragt sich, wie sie es anstellen soll, dass dieser Kerl am Bildschirm nicht völlig durchgeknallt rüberkommt – obwohl er in Wirklichkeit völlig durchgeknallt ist.
Zwar hat Milla bereits am Telefon mit Maximilian Stingeder besprochen, was sie filmen möchten, trotzdem geht sie den Ablauf noch einmal mit ihm durch. Zuerst soll er sie durch das leerstehende Hotel führen, in dem er bis vor zwei Jahren nicht nur einen lukrativen Anbau psilocybinhaltiger Pilze betrieben hat, sondern auch zu ganz besonderen Partys lud; zu sogenannten Pilzkreisen, bei denen Stingeder und seine Jünger kollektiv berauscht in andere Sphären abhoben und euphorisch auf die Erleuchtung warteten.
Diese Zeiten sind vorbei. Heute ist Stingeder nicht mehr als ein Eindringling, ein Ruhestörer, der das Haus aus seinem Winterschlaf reißt. Doch das Gebaren eines Chefs, oder eher: eines Messias, wie er es nennen würde, hat er deswegen keineswegs abgelegt. Stolz schreitet er voran, durch dunkle Flure, in denen die Teppiche zerschlissen und die Tapeten gelblich-klebrig sind. Ivan folgt ihm mit der Kamera auf der Schulter, und Milla hält sich dicht an dessen Seite, jederzeit bereit, eine Frage einzuwerfen. Doch das ist überhaupt nicht nötig, denn Stingeder redet ohne Unterlass. Am Ende eines Flurs öffnet er eine gläserne Flügeltür und weist in den Speisesaal, der an eine charakterlose Schulaula erinnert.
»Hier haben wir die magischen Pilze zubereitet und zu uns genommen.« Stingeder legt zum ersten Mal eine Atempause ein, als wolle er den Satz wirken lassen. »Wir saßen in der Runde und haben ihre Wirkung begrüßt. Es handelte sich dabei um einen gemeinschaftlichen, spirituellen Akt.«
Schnitt, denkt Milla. Ihre Zweifel sind verflogen. Stingeder könnte es nicht besser machen. Zwar geht ihr sein theatralisches Getue schon jetzt auf die Nerven, aber er weiß sich vor der Kamera zu bewegen, und die Art, wie er spricht, hat durchaus etwas Einnehmendes. Milla lässt sich den Keller zeigen, die Regale, auf denen einst seine psilocybinhaltigen Pilze gediehen, die er unter dem NamenSakramente für spirituelle Zeremonienan seine Jünger verteilt hat – gegen »Spenden«, wie er es nennt.
»Und hier«, Stingeder zieht keck mit zwei Fingerspitzen ein durchsichtiges Plastiksäckchen aus seiner Westentasche, »hier haben wir das Corpus Delicti.«
Schnitt.
Zwischen dieser und der nächsten Szene wird im Film keine Sekunde liegen, in Wirklichkeit aber ist es eine Stunde. So lange brauchen Milla, Ivan und der Messias, um zu ihm nach Hause zu fahren. Während in den Vorgärten seiner Nachbarn die Zipfelmützen spießbürgerlicher Gartenzwerge aus dem Schnee ragen, stehen links und rechts von seiner Eingangstür übergroße, phallusähnliche Holzpilze. Jeder trägt einen spitzkegeligen Schneehut. Als hätte ihnen ein Außerirdischer auf den Kopf geschissen, geht es Milla durch den Kopf, ein Gedanke, der sie irritiert. Vielleicht hat sie der Messias bereits mit seinen wirren Ideen infiziert.
Als Ivan seine Scheinwerfer ins Haus gebracht und installiert hat, demonstriert Maximilian Stingeder vor laufender Kamera, wie aus einem unscheinbaren Pilz aus dem Wald ein bewusstseinserweiternder Zaubertrank wird. Er schüttet die Pilze in eine Schale, zerkleinert sie in einem Mörser und beschreibt exakt, was er wie und warum macht. Dann gibt er das Pulver in ein zur Hälfte gefülltes Wasserglas und rührt vorsichtig um.
»Ich bin so weit. Lassen Sie uns ins Wohnzimmer gehen.«
Draußen hat sich in der Zwischenzeit das Schwarz der Nacht auf die Hügel gebettet, drinnen hat Ivan das Zimmer in ein dunkelrotes Licht getaucht. Maximilian Stingeder setzt sich auf das Sofa, atmet ruhig ein und aus und ein und aus und nimmt einen großzügigen Schluck.
Danach passiert eine Weile lang gar nichts, weil sich die Wirkung der »heiligen Kraft«, wie Stingeder sagt, erst mal entfalten muss. Doch plötzlich beginnt er sich langsam und kaum merkbar hin und her zu wiegen.
»Das Nehmen von magischen Pilzen führt zu einer Verbindung mit dem Welt-Allwissen und zur Integration in die große Natur.« Stingeder hört sich auf einmal anders an, seine Stimme hat sich in einen Singsang verwandelt. »Mir persönlich brachten sie Heilung und Erkenntnis.«
Ein leises Summen lässt seine Lippen vibrieren. Milla wirft einen Blick auf Ivan, doch der reagiert nicht; er ist hochkonzentriert. Seine Mimik aber verrät, dass er fasziniert ist von dem, was sich da gerade vor seiner Kamera abspielt.
»Ihr Körper fängt an, durchsichtig zu werden, es ist nicht mehr ganz klar, wo er beginnt, wo er aufhört, die Seele ist nicht mehr so gefangen und kann sich freier bewegen.«
Milla ertappt sich bei dem Gedanken, dass sie sich nicht wundern würde, wenn der Mann vor ihr plötzlich zu schweben begänne. Im selben Augenblick pfeift jemand die Titelmelodie des ActionfilmsKill Bill.
»Milla!«, ruft Ivan entsetzt.
»Mist.« Milla sucht in ihrer Jackentasche nach dem Handy, das sie nicht ausgeschaltet hat, obwohl Ivan es ihr schon gefühlte Hunderttausend Mal gesagt hat. Während sie den Anruf wegklickt, blickt sie flüchtig auf das Display. Der Name Nathaniel leuchtet auf.
Nathaniel.
Sie hat seit Monaten nichts von ihm gehört, aber jetzt hat sie keine Zeit. Bevor sie ihr Smartphone stumm schaltet, kommt eine WhatsApp-Nachricht rein.
Ich brauche deine Hilfe, schreibt Nathaniel.Dringend.
Das letzte Mal, als sie Nathaniel geholfen hat, mussten die Ärzte dreiundzwanzig Schrotkugeln aus ihrem Bein herausoperieren. Milla schließt kurz die Augen. Dann schaltet sie das Handy ganz aus.
3
Das Licht der Straßenlaterne zeichnet ein Abbild des Fensters an die Zimmerdecke. Nichts regt sich in der Dachwohnung in der Altstadt von Bern, nur der Sekundenzeiger des Weckers auf dem Nachttisch dreht störrisch seine Runden. Da zerschneidet ein Klingeln die trügerische Ruhe der Nacht. Es läutet einmal. Zweimal.
Sandro Bandini wälzt sich in seinem Bett auf die andere Seite.
Dreimal.
Er träumt von einer Verfolgungsjagd. Er sitzt im Streifenwagen am Steuer, eine Sirene heult, und obwohl er das Pedal durchdrückt, will die Distanz zum Wagen vor ihm einfach nicht kleiner werden.
Viermal.
Sandro hat keine Ahnung, wen er verfolgt und warum, er weiß einzig mit absoluter Sicherheit, dass er diese Person dort vorne im Auto erwischen muss.
Fünfmal.
Die Sirene wird schriller, sitzt plötzlich nicht mehr in seinem Ohr, sondern mittendrin in seinem Kopf. Keuchend schreckt Sandro hoch. Der Traum ist weg. Die Sirene ist noch da.
Sechsmal.
Es ist keine Sirene, es ist das Telefon.
Sandro will aufstehen, wobei er sich in der Decke verheddert. Er tastet im Dunkeln nach dem Handy, das einsam vor sich hin leuchtet.
»Bandini.«
»Ich dachte schon, ich kriege dich gar nicht mehr wach.« Seine Kollegin Florence Chatelat hört sich deprimierend munter an. »Ich musste es eine Million Mal klingeln lassen!«
Hätte Milla hier geschlafen, sie hätte mich beim ersten Klingelton geweckt, denkt Sandro und versucht, die letzten Traumfetzen abzuschütteln.
»Was ist los?« Seine Stimme hört sich an, als hätte er am Abend zuvor drei Zigarren auf Lunge geraucht. Dabei raucht er gar nicht.
»Wir haben eine Leiche.«
Mist,denkt er, fragt aber nur: »Wo?«
»Unten an der Aare. Beim oberen Eingang des Marzili-Bades. Du kannst es nicht verfehlen. Bis gleich.«
Zack. Die Leitung ist tot. Sandro blickt auf das Display seines Handys. Die Zeit zeigt 4 Uhr 37 an. Die Temperatur liegt bei minus sieben Grad.
Doppelmist.
Er begibt sich ins Badezimmer und spritzt sich kaltes Wasser ins Gesicht. Als er in den Spiegel blickt, erschrickt er ob der blassen Gestalt, die ihn nur entfernt an sich selbst erinnert. Er sieht ebenfalls aus wie ein Toter. Kurzentschlossen hält er den Kopf unter den Wasserhahn.
Als Sandro wenig später auf seinem Fahrrad bei der Dampfzentrale steifgefroren um die Ecke biegt, sieht er die Scheinwerfer schon von Weitem. Sie verleihen der Szenerie etwas Surreales; als wäre in diesem Moment nur auf einem einzigen Flecken Erde Tag – ein bisschen Tag, der sich rund um einen Toten bettet und umschlossen ist von undurchdringbarer Nacht. Die angestrahlten Bäume sehen aus wie die Geister alter Seelen, ihre Schatten greifen wie Klauen nach Sandro. Es ist einer jener Momente, in denen er sich fragt, warum er das hier eigentlich macht; diesen Job, der ihn nach draußen treibt, wenn jeder vernünftige Mensch in seinem Bett liegt und sich die Decke über den Kopf zieht. Er ist nicht dafür gemacht, um mitten in der Nacht aus dem Bett geholt zu werden. Und Minustemperaturen nimmt er persönlich. In seinen Adern fließt sizilianisches Blut, er braucht Wärme und Sonne und Tageslicht. Er könnte seine Eltern dafür schütteln, dass sie in dieses lebensfeindliche, vom Winter gebeutelte Land gezogen sind. Nicht sein Klima! Zu kalt! Verdammt noch mal. Und warum müssen die Toten immer mitten in der Nacht gefunden werden? Scheißjob, denkt Bandini, als er sein Rad an die Mauer lehnt. Automatisch greift er zum Schlüssel, hält inne. Hier und jetzt wird wohl kaum jemand das Fahrrad klauen. Er vergräbt seine Hände tief in den Hosentaschen und stapft durch den Schnee seinem nächsten Fall entgegen.
»Wir haben ihn schon heruntergeholt«, sagt Florence zur Begrüßung. Sie blickt ihren Chef kritisch an und schiebt nach: »Du siehst ja schrecklich aus.«
»Erhängt?«
»Dort drüben. Wahrscheinlich Suizid.«
Und dafür habt ihr mich aus dem Bett geholt, denkt Sandro verärgert. »Hier draußen, mitten in der Nacht?« Er blickt am Baum hoch. Ein dicker Ast. Kein Risiko, dass er unter dem Gewicht eines Menschen bricht. Darunter liegt ein abgesägter, umgekippter Baumstrunk im Matsch. »Wer bringt sich bei solchen Temperaturen freiwillig draußen um?«
»Wir wissen noch nicht, wer er ist.«
Sandro hat die Frage rhetorisch gemeint, aber gut. Schaut er sich den Toten halt mal an.
Die Kollegen haben kein Zelt aufgestellt; um diese Zeit sind selbst die Gaffer noch im Bett, die sich sonst wie Schmeißfliegen auf jeden Tatort stürzen und einer Waffe gleich ihr Smartphone zücken, darauf hoffend, mit ihrem blutigen Bild bei einer Zeitung unter der beschönigenden KategorieLeserreportereine Paparazzi-Prämie abzukassieren.
Die Spurensicherung hat ihre Arbeit bereits beendet. Schwierige Umstände, denkt Sandro. Direkt am Flussufer liegt kein Schnee, dafür ist alles nass und schlammig. Er muss aufpassen, dass er nicht ausrutscht. Als Sandro unter die Bäume tritt, sieht er den schmalen Rücken seiner Kollegin Irena Jundt, die sich gerade über die Leiche beugt. Das schwarze lange Haar hat die Rechtsmedizinerin unter einer Schutzhaube zusammengeknotet. Trotzdem würde er ihren Rücken unter Hundert anderen wiedererkennen. Sandro ist mal in sie verliebt gewesen. Ist lange her. Doch manchmal bedauert er noch immer, dass sich die Gefühle nur einseitig entwickelt haben. Über einen Kuss sind sie nie hinausgekommen, aber da waren sie beide betrunken. Jetzt sind sie gute Freunde. Vielleicht, denkt er, ist das mehr wert. Freundschaften halten meist länger als Liebschaften. Sandro räuspert sich.
»Sandro.«
Irena blickt zu ihm auf. Sie scheint keinen Schlaf zu brauchen, sieht immer erholt aus. Und immer schön. Sogar jetzt. Ihre Blässe hat ihr bei einigen Kollegen den Spitznamen Morticia eingetragen, weil sie mit ihrem schwarzen glatten Haar und dem durchschimmernden Teint an die Mutter der Adams-Family erinnert, dieser morbiden Truppe aus der gleichnamigen TV-Serie. Und wohl auch, weil sie deren Faszination für die Toten teilt. All das verleiht ihr etwas unnahbar Geheimnisvolles. Selbst wer Irena kennt, ist sich nie sicher, ob er sie wirklich kennt.
»Kannst du schon etwas sagen?«
Sandro weiß, dass Irena die Frage hasst, wenn er sie bereits am Tatort stellt. Wie erwartet schüttelt sie den Kopf.
»Könnte ein Suizid sein. Vielleicht aber auch nicht.«
»Fünfzig zu fünfzig?«
Auch das hasst sie. Ein flüchtiges Lächeln streift ihre Lippen. Sie erkennt, dass Sandro sie neckt.
»Du bist einfach kein Morgenmensch«, gibt sie zurück.
»Morgen? Es ist mitten in der Nacht! Wer hat ihn denn gefunden?«
»Eine Jennifer Keller«, sagt Florence Chatelat, die zu ihnen getreten ist. »Sie sitzt im Einsatzwagen und wärmt sich auf. Sie war auf dem Weg zur Arbeit. Frühschicht. Du siehst, auch andere Menschen arbeiten um diese Uhrzeit.«
Die Frau, die auf dem Rücksitz des geheizten Einsatzwagens sitzt, zittert am ganzen Körper. Sie ist nicht mehr richtig jung, aber auch noch nicht alt, Sandro schätzt sie auf Ende dreißig. Er sieht sich nach einer Decke um.
»Ist Ihnen kalt?«, fragt er und kommt sich augenblicklich dümmlich vor.
»Nein. Nein. Ich bin nur … ich meine … ich. Das ist meine erste Leiche.«
Sandro wirft Florence einen Blick zu. Sie nickt. Sie wird einen Arzt rufen, die Frau steht unter Schock.
»Kann ich Ihnen trotzdem ein paar Fragen stellen?«
Die Antwort ist ein tiefes Schniefen.
»Gehen Sie immer diesen Weg zur Arbeit?«
Ein Nicken.
»Immer um diese Uhrzeit?«
»Nur wenn ich Frühschicht habe.«
»Warum haben Sie den Mann überhaupt gesehen? Es war doch total dunkel.«
»Der Mond. Der Schatten des Toten fiel genau auf meinen Weg. Die Füße. Ohne Boden. Er bewegte sich im Wind.«
Ihre letzten Worte werden von einem heftigen Schluchzen verschluckt. Sandro wartet kurz, bis sie sich wieder zu fassen scheint.
»Ist Ihnen sonst noch etwas aufgefallen? Ist Ihnen vorher oder nachher jemand begegnet?«
Die Frau schüttelt den Kopf. »Ich habe sofort die Polizei angerufen.«
»Das haben Sie gut gemacht.« Sandro findet, dass er sich wie ein Grundschullehrer anhört.
»Vielleicht …«
Er wartet, lässt ihr Zeit. Aber da kommt nichts mehr.
»Was wollten Sie sagen?«
»Ich weiß nicht. Vielleicht war da ein Geräusch. Es hörte sich an, als versuche jemand, kein Geräusch zu machen.«
4
»Keine neuen Nachrichten«, sagt die Frauenstimme in Nathaniels Handy, nachdem er zum fünften Mal innerhalb von zehn Minuten danach gefragt hat. Einmal mehr wundert er sich, dass es immer Frauenstimmen sind: In seiner Uhr, in seinem Navigationsgerät, in seinem Computer – alles Frauenstimmen. Als müssten uns die Frauen die Welt erklären. Gleichzeitig wird ihm bewusst, dass auch er gerade auf die Antwort einer Frau wartet. Weil er ihre Hilfe braucht, mal wieder.
Milla hat gestern Abend nicht zurückgerufen. Ihm ist klar, dass sie kaum begeistert sein konnte, als sie seine Nachricht las. Das letzte Mal, als er sie um Hilfe gebeten hat, sind sie beide nur mit viel Glück heil aus der ganzen Sache wieder rausgekommen.
Aber wir haben ein Leben gerettet.
Nathaniel beißt sich auf die Lippen.ZweiLeben gerettet, korrigiert er sich. Auch wenn Carole Stein nicht mehr aus dem Koma erwacht und jetzt vielleicht tot ist.Zwei Leben.
»Bitte, Milla, ruf jetzt endlich zurück«, sagt Nathaniel laut. Als Antwort erhält er ein Klopfen; Alishas Schwanz, der auf den Boden schlägt. Ein kurzes Wedeln, als müsste seine Blindenhündin ihm versichern, dass sie noch da ist.
Nathaniel realisiert, dass er sich über Milla ärgert, obwohl sie nichts für seine Wut kann, für seine Angst, dafür, dass er die Verzweiflung nur noch mit Mühe von sich fernhalten kann. Wieder greift Nathaniel zum Handy, er überlegt, ob er Milla nochmals anrufen soll, und diktiert ihr stattdessen eine Sprachnachricht. »Carole Stein ist verschwunden.« Er zögert. »Die Frau im Koma«, fügt er an, obwohl er sicher ist, dass Milla niemals vergessen wird, wer Carole Stein ist. Auch wenn sie, anders als er, seines Wissens Carole nie im Spital besucht hat. »Womöglich ist sie tot! Bitte ruf mich an!« Pause. »Senden.«
Alisha ist aufgestanden und streift unruhig durch die Wohnung, ihre Krallen klacksen auf dem Laminatboden. Sie ist nervös, weil er nervös ist, und das macht ihn nur noch nervöser.
»Kannst du dich nicht mal hinlegen, Alisha?«
Zur Antwort kriegt er ein Hecheln. Dann bettet die langhaarige Schäferhündin ihren Kopf auf sein Bein und fordert mit einem halblauten Japser ein Kraulen ein. Gedankenverloren streichelt er sie hinter dem rechten Ohr. Sie legt grummelnd den Kopf schief, sie will mehr. Doch Nathaniel ignoriert sie, greift erneut zum Handy und fragt das Hilfsprogramm nach der Nummer der Klinik für Komapatienten am Inselspital Bern. Die Frauenstimme liest ihm staccatoartig die Zahlen vor und fragt, ob sie die Nummer wählen soll. Nathaniel sagt laut und deutlich: »Ja.«
Dreimal erklingt der Summton, dann geht jemand ran, oder eher etwas: Ein Computer – mit einer Frauenstimme.
»Guten Tag, Sie sind mit der Klinik für Komapatienten des Inselspitals Bern verbunden. Für Deutsch, wählen Sie bitte die Taste Eins. Pour le français, composez le numéro deux. Per l’italiano, componi il numero tre.«
Nathaniel ärgert sich schon wieder. Solche Ansagen sind nicht für Blinde gemacht. Er braucht eine Weile, bis er den richtigen Befehl eingeben und die deutsche Sprache auswählen kann.
»Guten Tag, Sie sind mit der Klinik für Komapatienten des Inselspitals Bern verbunden. Drücken Sie die Taste Eins, wenn Sie ein Gespräch mit einem Patienten wünschen. Drücken Sie die Taste Zwei, wenn Sie einen Termin für ein Beratungsgespräch verabreden wollen, drücken Sie die Taste Drei, wenn Sie mit einer anderen Abteilung verbunden werden wollen.«
Nathaniel wartet auf eine weitere Option. Doch es kommt keine. Hat der Computer ihn tatsächlich gerade gefragt, ob er mit einem Patienten der Komaklinikredenwolle? Er klickt den Anruf weg. Es bringt nichts.
»Alisha, wir gehen raus!«
Die Hündin springt auf, als hätte sie seit Stunden auf diese vier Worte gewartet. Sie steht längst an der Tür, als auch Nathaniel endlich so weit ist und nach dem Hundegeschirr greift, das neben der Garderobe an seinem Platz hängt. Manchmal denkt Nathaniel, seine Mutter würde in Ohnmacht fallen, wenn Sie ihn heute sehen könnte: Ein richtiger Ordnungsfanatiker ist er geworden, er, der als Kind immer alles überall herumliegen ließ und nur zum Aufräumen bewegt werden konnte, wenn sie ihm damit drohte, dass das Abendessen ausfiel. Allerdings ist er ein Pedant wider Willen: Wenn er nur einmal sein Handy an eine andere Stelle legt als üblich oder ein Kleidungsstück irgendwo in der Wohnung liegen lässt, hat solch eine Nachlässigkeit mitunter eine stundenlange Suche zur Folge. Unordentlichkeit und Blindheit vertragen sich schlecht.
Noch bevor Nathaniel ein Wort sagt, schlüpft Alisha mit dem Kopf in ihr Geschirr. Er bindet es fest und öffnet die Tür. Alisha drängt nach draußen, Nathaniel hastet hinter ihr die Treppe hinunter. Er ist sich bewusst, dass sie beide ein ungewöhnliches Bild abgeben. Selbst wenn sie nicht in Eile sind, legt seine Schäferhündin ein Tempo an den Tag, das ihn beinahe in den Laufschritt zwingt. Sie zerrt an ihrem Geschirr, und er hetzt ihr mit leichter Rücklage hinterher. Alisha ist nicht das, was man einen vorbildlichen Blindenhund nennt. Oft ist sie ungeduldig, auch ihr Orientierungssinn könnte besser sein. Und einmal hat sie ihn, unachtsam, vor ein anfahrendes Auto gezerrt, eine Aktion, die den Einsatz eines Veterinärs und eines Notarztes erforderte. Trotzdem kann Nathaniel sich nicht vorstellen, Alisha wegzugeben und gegen einen anderen Hund einzutauschen. Unmöglich. Sie mag zwar nicht die beste Blindenhündin sein, aber sie hat dafür andere Qualitäten. Obwohl Milla das ein bisschen anders sieht, ist Nathaniel noch heute überzeugt, dass Alisha ihnen beiden das Leben gerettet hat. Damals, als Carole in ihren tiefen Schlaf fiel.
Nathaniel braucht sein Navigationsgerät nicht, den Weg zur Klinik kennt er gut genug. Er will sich nicht länger mit Telefoncomputerstimmen herumschlagen und hofft, mit jemandem von der Direktion sprechen zu können. Es ist schließlich sein Recht zu erfahren, was mit Carole passiert ist.
Zwanzig Minuten später steigt Alisha mit Nathaniel vor dem Berner Inselspital aus dem Bus. Die Kälte verschlägt ihm den Atem. Obwohl er seine wärmste Jacke und die Mütze angezogen hat, dringt der eisige Wind durch jede Faser zu ihm durch, kriecht durch die Ärmelöffnungen herein und die Hosenbeine hoch. Grauenhaft.
»Avanti«, treibt er Alisha an, obwohl es nicht nötig wäre, sie trabt schon fast.
Sie finden den Weg zum Eingang der Klinik problemlos, zu oft sind sie ihn in den letzten vier Jahren gegangen. Weil es Nathaniel wichtig war, dass Silas seine Mutter nicht vergisst. Seine leibliche Mutter. Weil er die Hoffnung nie aufgegeben hat, dass Carole eines Tages aufwachen wird. Und vielleicht auch wegen seines schlechten Gewissens. Seine und Caroles Geschichte sind unauflöslich miteinander verwoben. Wenn er nur etwas schneller und etwas geschickter gewesen wäre …
Wenn seine Augen noch etwas taugen würden.
Womöglich würde sie jetzt lachend mit ihrem Kind auf einem Spielplatz auf der Schaukel sitzen. Nathaniel kann sich sein Versagen nicht verzeihen. Sein zweites, großes Versagen. Die Schuld wird sein lebenslanger Begleiter sein.
Vor dem Eingang angekommen, setzt sich Alisha hin, weil sie normalerweise draußen wartet, während er mit Silas Carole besucht.
»Avanti«, sagt Nathaniel erneut. Heute soll sie mit reinkommen. Vielleicht braucht er sie drinnen. Die Hündin führt ihn zum Empfangsschalter und zeigt ihm an, dass er anhalten muss.
Die Frau, die ihn dort begrüßt, ist zwar freundlicher als der Telefoncomputer, aber nicht viel auskunftsfreudiger.
»Sind Sie mit Frau Stein verwandt?«, will sie als Erstes wissen, nachdem sich Nathaniel vorgestellt und ihr die Geschichte von der fremden Frau in Caroles Bett erzählt hat. Es klingt wie die Eröffnungsfrage eines Quiz – nur die richtige Antwort qualifiziert einen für weitere Quizrunden.
Nathaniels »Nein« ist zweifelsfrei die falsche.
»Dann kann ich Ihnen leider keine Auskunft geben.«
»Hören Sie …« Nathaniel lehnt sich so weit nach vorne, dass seine Stirn plötzlich kaltes Glas berührt. Erschrocken zuckt er zurück. »Ich komme Carole Stein seit vier Jahren einmal im Monat besuchen. Ich bin der Patenonkel ihres Sohnes, ihrem einzigen Verwandten. Er ist vier! Und er hat ein Recht zu erfahren, was mit seiner Mutter passiert ist. Also geben Sie mir als seinem Vertreter bitte Auskunft.« Nathaniel wünschte, er würde sich entschieden und wütend anhören. Stattdessen klingt seine Stimme genau so, wie er sich fühlt: verzweifelt.
»Es tut mir leid, als Patenonkel sind Sie nicht der rechtliche Vertreter des Kindes, oder?«
Nein, ist er nicht. Aber Nathaniel findet, es ist nicht der richtige Moment, um auf solchen Kleinigkeiten herumzureiten.
»Ich bitte Sie!«
»Es tut mir leid.«
»Dann will ich jetzt sofort mit dem Chef hier sprechen.«
»Wie stellen Sie sich das vor? Ich kann Ihnen nicht einfach so einen Termin beim Direktor geben.«
»Natürlich können Sie das! Oder wollen Sie mich jetzt wirklich wieder nach Hause schicken, wo ich extra den ganzen Weg auf mich genommen habe?«
Es ist ein letzter Versuch. Wenn gar nichts mehr geht, setzt Nathaniel auf den Mitleidsbonus. Manchmal muss man mit den wenigen Waffen kämpfen, die einem zur Verfügung stehen. Auch wenn es bloß ein Blindenstock ist. Die Frau zögert. Nathaniel spürt, dass sie ihn mustert. Er stellt sich vor, wie sie in seine Augen schaut, von denen eines stumpf ins Leere blickt und das andere fast ganz geschlossen ist.
»Warten Sie einen Moment.«
Geht doch, denkt Nathaniel. Er fährt zusammen, als ihn Sekunden später jemand am Ellenbogen fasst.
»Bitte setzen Sie sich so lange«, sagt die Stimme von vorhin, nur dass sie jetzt viel klarer und heller klingt als gerade eben, als die Frau noch hinter Glas gesessen hat. Sie führt ihn vorsichtig zu einer Stuhlreihe, Nathaniel ertastet dahinter eine Wand. Er setzt sich, Alisha legt sich zeitgleich vor ihm auf den Boden, als würde sie automatisch von der Rolle des Blindenhundes in jene des Wachhundes schlüpfen.
Nathaniel lauscht auf die Geräusche. Er hört Schritte, die an ihm vorbeieilen, flache Sohlen, Gummi auf Linoleum. Eine Schiebetüre, die sich immer wieder öffnet, kaum hat sie sich geschlossen, und die stets von Neuem einen Hauch winterkalte Luft von draußen hereindringen lässt. Das Warten dehnt die Zeit. Die Stimme in Nathaniels Uhr sagt ihm, dass er erst seit sieben Minuten hier sitzt. Es fühlt sich an wie eine halbe Stunde. Da setzt sich jemand neben ihn.
»Es tut mir leid.«
Es ist die Frau von vorhin. Den Satz kennt er schon.
»Ich habe nachgesehen, aber ich kann Ihnen nicht sagen, wo Carole Stein ist. In ihrer Akte steht einzig, dass sie am 22. Dezember entlassen wurde.«
»Was heißt das? Ist sie aufgewacht? Oder gestorben?« Nathaniel versteht nicht.
»Nein, gestorben ist sie nicht. Dann wäre der Exitus in ihrer Akte vermerkt.«
»Dann ist sie also aufgewacht?«
Die Frau zögert einen Moment zu lange.
»Sagen Sie schon! Was bedeutet das alles?«
Nathaniel spürt eine Hand auf seinem Unterarm. Die Frau will ihn beruhigen, aber er will nicht ruhig sein.
»Es bedeutet nicht, dass sie aufgewacht ist. Denn auch das wäre vermerkt. Wahrscheinlich ist sie in ein anderes Spital verlegt worden, oder in ein Pflegeheim.«
»In welches? Und warum?«
»Es tut mir leid, das weiß ich nicht. Das sollte zwar bei einer Entlassung eingetragen sein, aber wahrscheinlich wurde es vergessen.«
»Vergessen? Jemand muss das doch wissen!«
»Herr Brenner. Brenner, das ist Ihr Name, richtig?«
Nathaniel reagiert nicht.
»Gehen Sie nach Hause, beruhigen Sie sich, es ist nichts passiert. Ich werde versuchen herauszufinden, in welches Spital oder in welche Institution Carole Stein verlegt worden ist, und dann werde ich Ihnen Bescheid geben. Geben Sie mir Ihre Telefonnummer, ich melde mich, sobald ich mehr weiß.«
»Danke«, sagt Nathaniel, obwohl er nicht dankbar ist, obwohl er zum zweiten Mal das Spital verlassen muss, ohne zu wissen, was mit Carole geschehen ist. Aber: Sie lebt. Sie ist nicht gestorben, das hat die Frau gesagt.
»Sie lebt also.« Nathaniel will sichergehen, wenigstens das. Sie darf nicht gestorben sein.
»Sonst wäre ihr Exitus eingetragen«, wiederholt die Frau.
Exitus. Was für ein seltsames Wort, um den Tod eines Menschen zu umschreiben, denkt Nathaniel. Er diktiert der Frau seine Handynummer, und dann ist sie weg und er sitzt da, allein, er sollte gehen jetzt, doch seine Beine sind zu schwer, die Müdigkeit überschwemmt ihn wie eine Ohnmacht, er möchte sich nur noch hinlegen und schlafen. Da stupst Alisha ihn an. Ihre nasse Schnauze in seiner Hand. Er krault sie hinter dem Ohr.
»Schon gut. Schon gut. Lass uns nach Hause gehen. Avanti.«
Das Klingeln des Telefons reißt Nathaniel aus einem Traum. Er hatte sich hingelegt, kaum war er zu Hause angekommen, und muss sofort eingeschlafen sein. »Inselspital«, wiederholt eine monotone Frauenstimme zwischen den Klingeltönen. Hastig tastet Nathaniel nach dem Handy und geht ran.
»Hier ist Clavadetscher von der Komaklinik. Es tut mir leid.«
Er kennt die Stimme und er kann diesen Satz nicht mehr hören.
»Es muss ein Systemfehler gewesen sein. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ich wollte Ihnen keine falsche Auskunft geben.«
Nathaniel schließt die Augen. Er will es nicht wissen.
»Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Carole Stein verstorben ist.«
5
Der Schnee bringt den öffentlichen Verkehr der Stadt Zürich zwar nicht zum Erliegen, aber aus dem Takt. Milla fragt sich, warum das Problem nicht in den Griff zu kriegen ist. Es ist jedes Jahr dasselbe: Kaum fallen ein paar Zentimeter Schnee, bleiben Busse stecken, und die Trams kapitulieren vor den kleinsten Steigungen. Darum ist Milla spät dran. Es ist genau halb zehn, die Redaktionssitzung beginnt in diesem Moment, und sie sitzt noch immer in der Elfer-Tram, die gerade beim Sternen Oerlikon um die Kurve rumpelt. Dass sie nicht rechtzeitig da sein wird, bekümmert Milla allerdings wenig; sie wird kaum die Einzige sein, die sich heute Morgen an einer Haltestelle beinahe den Hintern abgefroren hat, weil sie ewig auf die nächste Tram hat warten müssen. Dass sie anschließend einen Sitzplatz erobern konnte, grenzt an ein Wunder. Sie lehnt ihre Stirn an die Scheibe, die jedes Mal beschlägt, wenn Milla ausatmet. Mit dem behandschuhten Zeigefinger malt sie ein Herzchen rein, das mit dem nächsten Atemzug wieder verblasst.
An der HaltestelleFernsehstudiospuckt die blaue Straßenbahn ein Rudel von TV-Mitarbeitern aus. Wie ein Herdentier trottet Milla dem Strom dick eingepackter Menschen hinterher, die in ihrer winterlichen Verkleidung kaum zu erkennen sind. Wie aufgeplusterte Pinguine, denkt Milla, oder eine Horde Michelin-Männchen auf dem Weg zum Eingang des Studios. Willkommen beim Schweizer Fernsehen, dem multimedialen Großbetrieb, der im Sekundentakt Neuigkeiten produziert – selbst dann, wenn die Welt draußen schockgefriert.
Mit dem Badge passiert Milla die Sicherheitsschleuse, mit dem Lift fährt sie hoch in den elften Stock zur Redaktion der SendungWochenthemen. Als sie durch den langen Flur Richtung Sitzungszimmer eilt, lässt ein wohlbekannter Ruf sie auf halbem Weg innehalten.
»Milla!«
Sie macht kehrt und streckt den Kopf ins Büro ihres Chefs Wolfgang Schnell. »Die Sitzung hat noch gar nicht begonnen?«, fragt sie überrascht.
»Auch dir einen wunderschönen guten Morgen«, antwortet Wolfgang mit einem Lachen. »Außer mir ist hier noch keine Seele aufgetaucht. Du bist tatsächlich die Erste, die sich erfolgreich durch das bisschen Schnee gekämpft hat.«
»Die Goldmedaille kannst du mir gerne in der Sitzung überreichen …«
»Silber! Silber! Ich selbst bin schon seit Stunden hier.«
Milla ist nicht überrascht. Es erstaunt sie eher, dass Wolfgang zwischen Feierabend und Arbeitsbeginn überhaupt noch nach Hause geht. Er scheint hier nicht nur zu arbeiten, sondern in der Redaktion auch zu leben. Manchmal fragt sie sich, ob er tatsächlich so gerne schuftet, oder ob sein enormer Arbeitseinsatz in Tat und Wahrheit nichts anderes ist als eine Flucht vor Frau und Kindern. Fünf sind es wohl mittlerweile, wenn Milla sich richtig erinnert.
»Wir fangen an, wenn alle da sind.« Wolfgang wirft einen Blick auf die Uhr, als könnte er so das Geschehen beschleunigen.
»In Ordnung.«
Milla durchquert den Flur und nimmt die nächste Tür auf der gegenüberliegenden Seite. Rechts liegen die Einzelbüros des Chefs, der Produzenten und des Moderators, links das Großraumbüro der Indianer, wie sie sich nennen: Die Reporter, die hinausgeschickt werden. Milla ist gerne ein Indianer. Nicht eine Squaw, die sich um das Tipi kümmert. Sondern eine Kämpferin mit Kriegsbemalung, die sich auf einem gescheckten Hengst an der Spitze des Feldes in die Schlacht stürzt, am liebsten mit Gebrüll.
Sie schält sich aus ihren drei Jacken, hängt sie über die Stuhllehne, schmeißt die Tasche unter den Tisch und schnäuzt sich die Nase, die bei solchem Wetter dauerläuft. Als sie ihren Computer hochfahren will, fällt ihr Blick auf den gelben Post-it-Zettel, den sie gestern an den Bildschirm geklebt hat.Nathaniel anrufen, steht darauf. Sie greift zum Hörer, doch gerade als sie seine Nummer wählen will, rauscht ein Gewirr aus Stimmen durch den Flur. Die anderen Indianer trudeln ein. Wahrscheinlich haben sie alle in derselben Straßenbahn gesessen.
»Sitzung!«, ruft Wolfgang mit dröhnender Stimme. Zweifelsohne ist er gerne der Stammeshäuptling.
Milla legt den Hörer wieder auf und klebt den Zettel erneut an den Bildschirm. Nathaniel muss warten.
Als Milla das Sitzungszimmer betritt, sind die drei begehrten Plätze auf dem roten Sofa bereits besetzt. Also nimmt sie neben Wolfgang an dem runden Tisch Platz. Es ist Dienstag, zwei Tage vor der Sendung, der Countdown läuft. Nach der Sitzung muss der Ablauf der nächsten Ausgabe derWochenthemenstehen. Je näher der Sendetermin rückt, desto geschäftiger wird der Betrieb in der Redaktion und desto größer die Hektik.
»Milla, deine Geschichte können wir bringen?« Wolfgang nickt ihr zu, und obwohl er den Satz als Frage formuliert hat, erkennt sie den wahren Inhalt des Gesagten:Milla, mach mal voran, wir werden deine Geschichte am Donnerstag bringen.
»Können wir. Ich bin heut Mittag noch auf einem Dreh, dann kann ich in den Schnitt.«
»Sagst du nochmals kurz, worum es geht?«
Milla erzählt ihrem Team von dem skurrilen Justizfall um den selbsternannten Messias der magischen Pilze, der fast zwei Jahre lang wegen Handel mit Magic Mushrooms ohne Urteil in Untersuchungshaft gesessen hat. »Die haben ihn behandelt, als sei er Pablo Escobar persönlich, vermuteten den ganz großen Drogenfall, dabei verteilte er bloß ein paar Pilzchen.« Sie berichtet, wie sie Maximilian Stingeder beim Einnehmen seines Zauberelixiers gefilmt haben. »Und ab heute Mittag drehen wir am World Psychedelic Forum in Basel, wo natürlich alle einhellig der Meinung sind, dass Pilze keine Drogen sind, sondern ein Geschenk der Natur.«
»Und warum macht er das?«, fragt Marco, der Skeptiker in der Runde. »Ich meine, er ist ein Krimineller, er saß im Knast, warum exponiert er sich und isst erst noch Pilze vor laufender Kamera?«
»Er hat sie getrunken, die Pilze, aufgelöst und getrunken«, korrigiert ihn Milla. »Überdies muss sich erst noch zeigen, wie kriminell er tatsächlich ist – das Urteil steht immer noch aus. Er macht mit, weil er glaubt, dass er nichts Unrechtes getan hat, denn seiner Meinung nach ist ein Pilz ein Pilz und keine Droge.«
»Gut jetzt.« Das ist Wolfgangs Machtwort.Gut jetztbedeutet: Ende der Diskussion, nächster Punkt. »Das klingt nach einer prima Geschichte. Wir bringen das am Donnerstag.«
Es dauert eine Weile, bis sich das Team auf die weiteren Themen geeinigt hat. Sie streiten darüber, ob sie schon wieder einen Beitrag über das World Economic Forum in Davos realisieren müssen – der erwartungsgemäß eher trocken ausfallen würde – oder ob sie sich auf die Protestaktionen konzentrieren wollen; ein Garant für krasse Actionbilder. Als die Diskussion doch noch ein Ende findet und sich die Hälfte des Teams umgehend um die Plätze am Tischkicker streitet, der neben dem Sofa im Sitzungszimmer steht, begibt sich Milla zurück an ihren Arbeitsplatz.
Nathaniel anrufen.Sie entfernt das Post-it. Als sie zu ihrem Handy greift, sieht sie, dass er sich schon wieder gemeldet hat. Er scheint in ernsthaften Schwierigkeiten zu stecken.
Sie hört die Sprachnachricht ab: »Carole Stein ist verschwunden.« Was zum Teufel?, fragt sich Milla. Die Zeit scheint innezuhalten, rückwärtszulaufen und sie an einen längst vergangenen Punkt zurückzuschleudern. Auf einen Schlag ist alles wieder da. Carole Stein. Verschwunden. »Die Frau im Koma. Womöglich ist sie tot.«
Milla verzieht sich auf die Damentoilette, wie sie es immer tut, wenn sie ungestört telefonieren will. Sie schließt sich in eine Kabine ein, klappt den Klodeckel herunter und setzt sich hin. Dann wählt sie Nathaniels Nummer.
»Milla!«, ruft er ihr ins Ohr. »Es ist etwas Schreckliches passiert. Carole ist tot!«
6
Der Nebel draußen malt die hohen Fenster grau aus. Drinnen tunken Neonröhren den Obduktionssaal in ein kaltgrelles Licht. Aus der Lautsprecherbox klingt Mozarts Requiem; imLacrimosabeweinen die Stimmen des Chors den unbekannten Toten, der da liegt auf dem metallenen Tisch, ohne Kleider, ohne Namen, mit nichts als einem Strick um den Hals, der ihm den letzten Atem nahm.
Es ist schon fast halb elf, aber es ist einer jener Tage, an denen es nie richtig Tag zu werden scheint. Weil sich der Nebel nicht verziehen mag. Trotzdem ist Irena Jundt hellwach. Während die anderen Beteiligten vom Tatort – falls es denn der Tatort eines Verbrechens ist – direkt nach Hause fuhren, um sich doch noch etwas Schlaf zu holen, ist sie gleich im Rechtsmedizinischen Institut geblieben. Sie hätte sowieso nicht wieder einschlafen können.
Vorsichtig macht sie sich daran, das Seil vom Hals des Mannes zu lösen, von dem sie nicht weiß, wer er ist und warum er zu früh gestorben ist. »Hast du dir das selbst angetan?«, murmelt Irena leise. »Oder war das jemand anderes?« Sie knüpft rechts und links von der Stelle, an der sie das Seil zerschneiden will, einen Bindfaden an den Strang, damit der Knoten und die Schlingenführung des Galgens erhalten bleiben. Dann durchtrennt sie das Seil, das nun nur noch mit dem Bindfaden zusammengehalten wird. Die Schlinge ist dadurch genügend erweitert, um sie der Leiche über den Kopf zu streifen. Sie legt den Strick unter das Mikroskop, studiert die Ausrichtung der Fasern, sucht nach Abriebspuren und erkennt Teilchen der Baumrinde, die sich darin verfangen haben.
Auch wenn es sich bei Erhängungsfällen fast ausnahmslos um Suizide handelt, muss immer bis zum Beweis des Gegenteils mit einem latenten Tötungsdelikt gerechnet werden.
Irena Jundt hört in ihrem Kopf die Stimme ihres ehemaligen Professors Doktor Dinkelmann, der sie in die Rechtsmedizin eingeführt hat. Er war es, der sie überhaupt erst dazu gebracht hat, eine Fachrichtung zu wählen, die bei anderen im besten Fall Kopfschütteln und im schlimmsten Fall Ekel auslöst, und die für sie selbst zur Leidenschaft geworden ist. Zum Lebensinhalt.
Gerade weil die Fälle so selten sind, können sie durch allzu schematisches Vorgehen bei den Ermittlungen leicht übersehen werden.
Manchmal kommt es ihr vor, als säße ihr ehemaliger Lehrer wie ein kleines Heinzelmännchen auf ihrer Schulter, um sie bei der Arbeit zu beobachten – und hin und wieder einen lobenden oder belehrenden Kommentar beizusteuern. Doch in diesem Fall könnte er es bleiben lassen. Denn mittlerweile hat sie die Erfahrung gelehrt, wie recht er damals hatte. Es ist noch nicht lange her, da ist sie selbst bei einem Erhängten zu lange von einem Suizid ausgegangen. Eine Fehleinschätzung. Sie hatte ihre Zweifel nicht ernst genug genommen. Im Nachhinein hatte sich die vermeintliche Selbsttötung als nahezu perfekter Mord entpuppt. Begangen von jemandem, den Irena zu aller Letzt vermutet hätte. Der Fall hatte sie aus persönlichen Gründen an ihre Grenzen gebracht. So sehr, dass sie sich damals zum ersten Mal überlegt hatte, ihren Beruf aufzugeben. Heute ist sie froh, dass sie es nicht getan hat.
Jeder Ermordete ist für sie ein Rätsel, der Bewahrer eines letzten Geheimnisses, das sie entschlüsseln will – um denjenigen zu überführen, der diesem Menschen das Wertvollste genommen hat. Irena Jundt ist die Fürsprecherin der Toten. Sie gibt ihnen ihre Stimme, weil sie selbst keine Worte mehr haben.
Sie wendet sich wieder der Leiche zu. »Wer bist du?«, fragt sie leise. »Und was hattest du mitten in der Nacht an der Aare zu suchen?«
Irena schätzt den Toten auf etwa vierzig. Er ist leicht untersetzt, aber nicht übergewichtig. Gesunder, wenn auch nicht sportlicher Körperbau. Ein Mann, der ein langes Leben hätte führen können.Hätte. Im Protokoll notiert sie sich die Ausprägung der Leichenstarre, die Wegdrückbarkeit der Totenflecken und die aktuelle Körpertemperatur – um sie mit der Temperatur zu vergleichen, die der Körper aufwies, als er gefunden worden ist. Irena wendet sich dem Kopf zu, zieht erst das rechte, dann das linke Lid hoch und leuchtet mit einer Taschenlampe in die Augen. Keine punktförmigen Blutungen auf der Bindehaut. Von den Augenwinkeln über die Wangen: eingetrocknete, weißliche Streifen, Abrinnspuren. Er hat Tränen abgesondert, als er starb. Kein Weinen, sondern ein Nebeneffekt des Krampfstadiums. Von einem Mundwinkel über das Kinn findet sich eine Speichelspur. Das Gesicht des Mannes ist auffällig blass, ohne Blutstauung. Beim typischen Erhängen werden sowohl der Blutzufluss zum Kopf als auch der Blutabfluss sofort unterbrochen, darum bilden sich keine Stauungserscheinungen. Ganz anders sähe es aus, wenn die Schlinge um seinen Hals langsam zugezogen worden wäre. Irena untersucht die Strangulationswunde, eine braune, tief eingeschnürte Schürfung, die das Seil am Hals hinterlassen hat. Sie verläuft von vorn über beide Seiten des Halses und steigt hinter den Ohren zum Nacken hin an. All das deutet auf einen Suizid hin. Doch Irena will sich nicht täuschen lassen, nicht ein zweites Mal. Sie misst die Größe des Mannes, dann überträgt sie alle Spuren, die sie an seinem Körper findet, auf die schematische Abbildung eines Menschen auf Papier. Schürfwunden, Pigmentflecken, alte Operationsnarben. Unterhalb beider Ellenbogen stellt sie leichte Hautrötungen fest, feine Striemen, als hätte ein hochgeschobener, zu enger Ärmel einen Abdruck hinterlassen. Irena greift zur Kamera und fotografiert die Stellen. Anschließend entfernt sie den Fingernagelschmutz, sichert ihn fürs Labor, untersucht die Handflächen und die Innenseiten der Finger und sichert mittels eines Klebebandes allfällige Faserspuren. Nichts deutet darauf hin, dass der Mann mit jemandem gekämpft hat. Also doch ein weiterer Erhängungs-Suizid, einer von vielen? Die Öffnung der Leiche wird mehr Klarheit bringen. Hoffentlich, denkt Irena, als sie das Skalpell am Brustbein ansetzt.
7
Nathaniels Worte prasseln auf Milla nieder wie ein Regenschauer, endlose Sätze ohne Anfang, ohne Ende. Eine falsche Frau in Caroles Bett, graues Haar statt dunkelblondes, ahnungslose Pflegerin, keine klare Auskunft, Carole erst entlassen und nun plötzlich tot – das sind die Fetzen, die bei ihr hängen bleiben.
»Warum ist sie gestorben?«, fragt Milla, als Nathaniel kurz Atem holt.
»Das weiß ich eben nicht, ich weiß auch nicht, was mit ihr danach passiert ist, nichts weiß ich! Entweder wollen die mir nichts sagen, oder sie können mir nichts sagen.«
Milla beobachtet durch das Fenster ein Flugzeug, das gerade gestartet ist und in den Himmel sticht.
»Nathaniel, es tut mir leid, dass Carole gestorben ist, und ich verstehe, dass dir das nahegeht. Aber es ist wohl das Beste für sie. Das war ja kein Leben mehr.«
Das Flugzeug zieht einen großen Bogen und dreht Richtung Süden ab. Milla hört Nathaniel am anderen Ende der Leitung ächzen.
»Darum geht es doch gar nicht! Also, es geht schon darum, dass sie gestorben ist, aber das allein ist es nicht. Es ist die Art und Weise, wie es geschehen ist. Ein heimliches Sterben! Dass die niemanden informiert haben! Und mir nun nicht einmal sagen können, wo sie Carole hingebracht haben. Das ist doch nicht normal!«
»Ich bin sicher, es gibt keinen Grund, sich aufzuregen. Es ist bestimmt in Erfahrung zu bringen, wo Carole begraben liegt. Wir leben schließlich in der Schweiz. Ihr Bestattungsort kann nichtnichtregistriert sein. Hier wissen die Behörden ja sogar, welche Kuh in welchem Stall steht.« Noch während Milla den Satz zu Ende spricht, realisiert sie, dass der Vergleich pietätlos ist. »Ich meine: Wir finden heraus, was mit Carole passiert ist. Der Ort, wo sie beerdigt wurde, wird ja kaum ein Staatsgeheimnis sein.«
»Genau so führen sie sich in der Klinik aber auf.« Nathaniel klingt trotzig und niedergeschlagen zugleich. »Und warum hat mir die Frau im Spital zunächst versichert, Carole sei am Leben und bloß verlegt worden? Um kurz darauf zu erklären, dass sie nun plötzlich doch tot sei?«
»Das Inselspital ist eine Fabrik, dort liegen Tausende von Patienten. Da ist es durchaus möglich, dass sich jemand mal irrt.«
»Sie sprach von einem Fehler im System. Aber ich glaube ihr nicht.«
Jetzt ist Milla diejenige, die hörbar aufstöhnt. »Du siehst Gespenster, wo es keine gibt.«
Plötzlich schweigt Nathaniel. Vielleicht tut er das wirklich. Etwas größer machen als es ist. Sich in etwas hineinsteigern. Vielleicht. Wenn da bloß dieses Gefühl nicht wäre, das ihn einnimmt und das er nicht benennen kann.
Es gibt Ängste, die tragen keine Namen. Als er ein Kind war, damals, als die Welt noch voller Licht und voller Farben war, hatte er böse Träume gehabt. Albträume, aber andere als heute. Es ging darin noch nicht um das Verbrechen, das ihm seine Familie und sein Augenlicht genommen hat. Auch handelten seine kindlichen Albträume nicht von kinderfressenden Monstern oder axtschwingenden Räubern, die hinter ihm her waren. Sie bestanden einzig aus gestaltlosen Emotionen, die über ihn herfielen und ihn erdrücken wollten. Nur Gefühle, keine Bilder.
Und genau so fühlt sich das hier an: eine namenlose, aber fast greifbare Furcht füllt ihn aus, weil etwas ganz und gar nicht stimmt. Doch wie soll er das Milla erklären, wenn er diese Art von Gefühl nicht einmal für sich selbst in Worte fassen kann?
»Könntest nicht du mal nachfragen? Vielleicht sagen sie dir mehr als mir.«Als einem Blinden, fügt Nathaniel in Gedanken an.
Milla möchte Nein sagen. Sie hat genug anderes zu tun. Ihr Kopf ist auch so schon viel zu voll. Doch sie kann Nathaniel die Bitte nicht abschlagen. Nicht Nathaniel, nicht nach allem, was geschehen ist.
»Okay, mach ich, sobald ich eine freie Minute habe.«