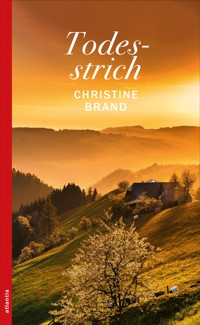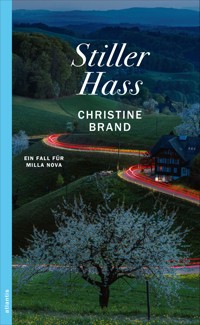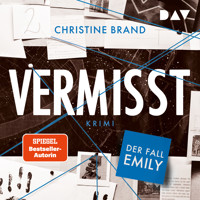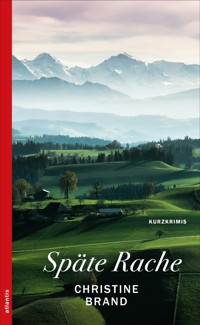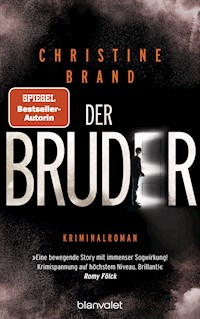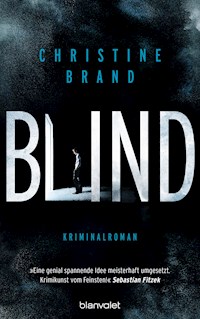Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Kampa VerlagHörbuch-Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: True Crime
- Sprache: Deutsch
Ausgerechnet an Weihnachten, um genau 3:31 Uhr, geht bei der Polizei ein Notruf ein: am Apparat ein verzweifelter Vater, der den Tod seiner beiden Kinder meldet. Was ist passiert? Mitten in der Nacht wird Bernhard Scherrer von seiner Frau geweckt: Sie hat Angst, irgendetwas stimmt nicht. Scherrer steht auf. Ein Fenster steht weit offen. Jemand muss in ihre Wohnung eingebrochen sein. Sofort sieht er nach den beiden Kindern und findet sie reglos in ihren Betten: Sophie und Noah, acht und sechs Jahre alt, sind tot. Noch in derselben Nacht wird Bernhard Scherrer in Untersuchungshaft genommen. Anklage: Mord. Von einem Moment auf den anderen wird sein Leben ein Albtraum, der kein Ende nehmen will. Anhand der Befragungen des Verdächtigen durch die Kommissarin, den Aussagen des Polizisten, der in der Nacht als Erster vor Ort war, und von Beamten der Spurensicherung, der Rechtsmedizinerin, des forensischen Psychiaters, Nachbarn und Bekannten der Scherrers zeichnet Christine Brand das Leben der Familie und eine unbegreifliche Tat nach.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Christine Brand
Bis er gesteht
Kampa
Der Notruf
25. Dezember, exakt 3:31 Uhr
»Polizeinotruf, kann ich Ihnen helfen?«
»Hier ist Bernhard Scherrer. Ahornweg 8. Bei uns sind beide Kinder umgebracht worden.«
»Was sagen Sie da?«
»Bei uns wurde eingebrochen. Sie sind beide umgebracht worden.«
»Fassen Sie nichts an. Was ist mit Ihren Kindern?«
»Sie sind beide umgebracht worden.«
»Das kann ja gar nicht sein!«
»Sie sind tot. Beide tot!«
»Wir schicken sofort jemanden los. Gehen Sie zu Ihren Kindern.«
»Sie sind beide tot!«
»Sind Sie sicher?«
»Sie sind schon kalt, die Lippen sind ganz blau. Sie sind schon lange tot. Das Fenster ist aufgebrochen worden. Das gibt es ja nicht, jetzt sind die Kinder tot!«
»Nehmen Sie ein Kind, umschließen Sie mit Ihrem Mund Nase und Mund des Kindes. Ist Ihre Frau auch da? Sie soll das beim anderen Kind tun. Legen Sie seinen Kopf in den Nacken.«
»Da läuft Blut aus Sophies Mund! Sie sind tot! Es tut mir leid, sie sind tot, wir waren zu Hause und schliefen, und ein Fenster wurde aufgebrochen, das Geld ist geraubt. Es ist der absolute Notfall. Die Kinder sind beide tot.«
»Wir sind gleich bei Ihnen. Ist die Haustür unten abgeschlossen?«
»Ich gehe sie öffnen … Ich bin nun im Treppenhaus, aber Moment, etwas ist hier seltsam.«
»Was ist dort?«
»Nein, es ist nichts. Wir hatten die Rollläden alle unten, jetzt ist der Rollladen oben, ich habe ihn dummerweise schon angefasst, wir hatten das Fenster schräg gestellt.«
»Sorgen Sie dafür, dass unten die Tür offen ist.«
»Meine Frau sitzt im Treppenhaus. Wir sind etwa um Viertel vor elf ins Bett. Soll ich bei den Nachbarn läuten? Es ist so still im Haus.«
»Sobald Sie die Tür aufgeschlossen haben, gehen Sie zurück zu Ihren Kindern.«
»Vera, komm, komm zu mir. Sie kann nicht, sie hat keine Kraft. Sie müssen wissen, uns ist schon mal ein Kind gestorben, vor neun Jahren.«
»Können Sie zurück ins Zimmer der Kinder?«
»Ich traue mich nicht. Da kommt jemand. Hallo? Hallo!«
»Sind Sie noch am Apparat? Hallo? Wer ist dran?«
»Hallo, Philipp Bühler am Apparat, Polizei. Ich bin gerade eingetroffen und übernehme jetzt, die Sanität fährt auch gerade vor. Ich gehe schauen, ob die Kinder noch atmen, bleiben Sie dran … Scheiße. Der Bub ist blau angelaufen, auch die Lippen sind blau. Er hat bereits Flecken. Uff, ich muss doch was machen können! Das Mädchen noch nicht, keine Flecken. Ich versuche, es zu beatmen. Die Sanität kommt. Ende.«
Philipp Bühler
Wachtmeister bei der Kantonspolizei
Ausgerechnet an Weihnachten. Zwei tote Kinder. Ich habe in meiner Karriere einiges gesehen, bin schon viel zu lange dabei. Aber das hier … Es wird schwierig sein, die Bilder wieder aus dem Kopf zu kriegen.
Ich hatte Bereitschaftsdienst, als der Notruf reinkam. Zufällig wohne ich in der gleichen Gemeinde, darum war ich als Erster vor Ort. Ein Dorf am See, das seinen ländlichen Charakter trotz der vielen Neubauten bewahren konnte. Hier würde man ein solches Verbrechen nicht vermuten. Aber das Böse geschieht überall. Das mit der Idylle, das können Sie vergessen.
Ich traf um 3:47 Uhr im Ahornweg 8 ein: Ein Mehrfamilienhaus, es liegt in einem kleinen Weiler etwas außerhalb des Dorfes, südöstlich des Zentrums. Die Tür unten stand offen, ich stieg die Treppe hinauf und traf zunächst auf Vera Scherrer, die auf den Stufen saß. Sie weinte nicht, wirkte aber abwesend und verstört. Als ich sie ansprach, reagierte sie nicht. Da hörte ich in der Wohnung im ersten Stock jemanden »Hallo« rufen, ich ging hinein und begegnete im Flur Bernhard Scherrer. Der Vater.
Er hatte Tränen in den Augen, versuchte aber, sich zusammenzureißen. Er wirkte sehr erleichtert, als er mich sah, als könnte ich ungeschehen machen, was gerade passiert war. Scherrer streckte mir hilflos sein Telefon entgegen, fasste mich am Arm und führte mich ins Zimmer des Buben.
Ich trat über die Schwelle. Es war ein schrecklicher Anblick.
Der Junge lag in einem hellblauen Pyjama regungslos auf dem Bett, sein Gesicht war bereits blau angelaufen. Tote Kinder … das ist auch nach all den Jahren kaum zu ertragen. Daran gewöhnt man sich nie.
Ich versuchte, den Puls an der Halsschlagader zu ertasten, und hielt meinen Finger unter seine Nase. Aber es war klar, dass es zu spät war. Der Junge war schon eine Weile tot.
»Sophie«, sagte der Vater, der in der Tür stehen geblieben war. »Er hat auch Sophie getötet.« Ich erhob mich und folgte ihm ins Zimmer nebenan. Dort fand ich eine ähnliche Situation vor. Das Mädchen trug einen rosaroten Pyjama. Das Gesicht zur Seite gedreht. Wie auch sein Bruder war es sehr ordentlich angezogen, wie zwei Puppen, kein Zipfel war verrutscht, das fiel mir sofort auf. Das Mädchen hatte noch keine blauen Flecken, und sein Körper war noch weicher als jener seines Bruders. Also versuchte ich sofort, es zu beatmen. Doch ich konnte nichts mehr machen, keine Chance, auch das Mädchen war bereits gestorben. Das Gefühl, zu spät zu kommen, kann einen fertigmachen.
Plötzlich war Vera Scherrer hinter mir, sie stand in der Tür zum Kinderzimmer und sank weinend in sich zusammen, sie glitt am Türrahmen zu Boden, als wäre sie aller Kraft beraubt worden. Sie schluchzte laut und klagte, ich habe ihre Worte zuerst nicht verstanden, dann aber sagte sie, sie hätten vor neun Jahren schon mal ein Kind verloren. Ihr Mann kniete neben sie und nahm sie in die Arme, sie wirkten beide aufgelöst und weinten. So viel Leid und Schmerz.
Ich erinnere mich, wie Bernhard Scherrer fragte: »Wer macht nur so etwas, unschuldige Kinder umbringen?«
Was sagt man einem Vater, der gerade seine beiden Kinder verloren hat? Dafür gibt es keine Worte. In dem Moment, als sich ein schweres Schweigen im Zimmer ausbreitete, weil sich die richtigen Sätze nicht finden ließen, waren im Treppenhaus Schritte zu hören. Die Sanitäter vertrieben die Stille und stürmten in die Wohnung, um das Unmögliche zu versuchen und die Kinder zurück ins Leben zu holen.
Ich hielt die Eltern auf Abstand, während die Sanitäter ihre Arbeit taten. Als sich Bernhard Scherrer etwas gefasst hatte, zeigte er mir das Fenster, durch das der oder die Einbrecher eingestiegen sein sollen – ich sah ziemlich schnell, dass es nicht aufgebrochen worden war. Es gab weder Beschädigungen am Rahmen noch am Fenster, es muss schon offen gestanden haben. Draußen betrug der Abstand zwischen dem Fenster und dem Boden etwa vier Meter. Unter dem Fenster lag eine Wiese, sie war mit Tau bedeckt, von oben waren keine Spuren zu erkennen.
Als ich mich im Wohnzimmer umsah, fiel mein erster Blick auf den Christbaum und auf die Geschenke, die darunterlagen. Buntes Papier, goldene Schleifen. Auf aufgeklebten Sternen standen ihre Namen geschrieben: Sophie und Noah. Ihre Geschenke würden nie ausgepackt werden.
Nach dem Rettungsdienst traf meine Kollegin ein, kurz darauf die Kollegen von der Spurensicherung. Plötzlich stand auch eine Nachbarin in der Tür, die geweckt worden war – wir mussten die Wohnung absperren, damit keine Spuren zerstört wurden. Wir brachten die Eltern hinaus, und die Maschinerie der Ermittlungen setzte sich in Gang. Die Wohnung, die nur mehr ein Tatort war, verwandelte sich in ein eigentliches Laboratorium. Wenn es hier Spuren zu finden gab, würden wir sie finden. Sowohl die Mutter als auch den Vater haben wir schließlich in die Zentrale gebracht, wo sie zu den Ereignissen der Nacht befragt wurden, getrennt voneinander, das ist normal in solchen Fällen, wir brauchen die exakten Erinnerungen beider Beteiligter, ohne dass der eine den anderen beeinflusst. Es geht darum, dass wir den Hergang möglichst genau rekonstruieren können. Damit wir den Täter finden. Diese Bestie, die die beiden Kinder umgebracht hat, darf nicht davonkommen. Die müssen wir kriegen.
1. Befragung
Anwesende: Belinda Schwarz, polizeiliche Sachbearbeiterin, und Bernhard Scherrer, Auskunftsperson
»Fürs Protokoll: Es ist der 25. Dezember, 5:30 Uhr in der Früh. Mein Name ist Schwarz, Belinda Schwarz, polizeiliche Sachbearbeiterin Mordkommission. Herr Scherrer, ich muss Ihnen einige Fragen stellen. Wie geht es Ihnen, können wir reden?«
»Ja, es geht schon, fragen Sie. Bitte.«
»Ich befrage Sie in diesem Verfahren als Auskunftsperson. Als Auskunftsperson sind Sie nicht zur Aussage verpflichtet. Haben Sie das verstanden?«
»Ja. Warum sagen Sie das? Fragen Sie einfach.«
»Im Weiteren weise ich Sie darauf hin, dass Sie das Recht haben, sich einen Anwalt zu nehmen, und dass Sie sich strafbar machen, wenn Sie falsche Anschuldigungen aussprechen, die Rechtspflege irreführen oder jemanden begünstigen. Haben Sie das ebenfalls verstanden?«
»Ja. Ich brauche keinen Anwalt.«
»Ihr Name ist Scherrer, Bernhard Scherrer?«
»Das ist richtig.«
»Sie wohnen gemeinsam mit Ihrer Frau Vera im Ahornweg 8, mit Ihren Kindern Sophie und Noah?«
»Ja. Aber die Kinder … die sind tot.«
»Es tut mir leid, was passiert ist, und ich verstehe, dass es schwierig ist für Sie und dass Sie aufgewühlt und müde sind. Ich muss Ihnen trotzdem einige Fragen stellen, jetzt, wo die Erinnerung noch frisch ist.«
»In Ordnung. Ich schaffe das schon.«
»Wie lange wohnen Sie bereits im Ahornweg?«
»Ich weiß nicht. Ist das wichtig? Etwa vier oder fünf Jahre, die Kinder waren noch klein, als wir hergezogen sind.«
»Sophie ist acht, und Noah sechs?«
»Ja, acht und sechs.«
»Wie lange sind Sie schon mit Ihrer Frau zusammen?«
»Seit über zehn Jahren. Wir haben uns beim Skifahren kennengelernt, da war sie zwanzig, ich war fünfundzwanzig. Kurz darauf sind wir zusammengezogen, es war von Anfang an klar. Wir wussten auch vom ersten Moment an, dass wir Kinder haben würden. Und jetzt sind sie tot. Ich kann es nicht begreifen. Sie sind tot. Alle tot!«
»Möchten Sie ein Taschentuch?«
»Danke. Es waren so liebe Kinder, wissen Sie.«
»Geht es?«
»Es muss.«
»Die Kinder besuchten die Schule und den Kindergarten?«
»Ja, aber es sind Ferien. Weihnachtsferien.«
»Waren die Kinder in den letzten Tagen anders als sonst?«
»Wir waren alle etwas gestresst wegen der Weihnachtsgeschenke, aber Sophie und Noah haben sich darauf gefreut. Wir haben ihnen eine Spielekonsole und ein Malbuch gekauft, das sollte eine Überraschung sein.«
»Haben die Kinder in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches erzählt?«
»Nein. Ich meine … ich weiß es nicht. Da müssen Sie Vera fragen, sie war immer um die beiden herum. Aber nein, ich glaube nicht, sie hätte mir erzählt, wenn etwas gewesen wäre.«
»Waren die Kinder kürzlich alleine unterwegs und könnten sie von jemandem angesprochen worden sein?«
»Nein, sie sind niemals alleine unterwegs. Vera begleitet sie stets auf dem Schulweg. Und in den Ferien sind sie nur bei uns. Das hätten wir doch gemerkt.«
»Können Sie mir Ihre Kinder beschreiben? Waren es wilde Kinder, waren sie schüchtern, wie reagierten sie auf fremde Menschen?«
»Wir haben zwei genügsame Kinder, ab vier Jahren waren sie beide sehr pflegeleicht, hilfsbereit, freundlich. Ich kann es einfach nicht verstehen. Es ist nicht möglich, dass jemand den beiden etwas angetan hat. Das ist absolut unverständlich. Sie sind zwei Goldschätze, sehr selbstständig.«
»Können Sie Noah und Sophie noch etwas näher beschreiben? Was waren ihre Eigenschaften?«
»Noah ist eher liebesbedürftig und er kann etwas nachtragend sein, er ist sehr ordentlich. Sophie ist das pure Gegenteil: Sie kann auch mal laut schimpfen. Es sind aber beides sehr liebe Kinder. Ich meine … es waren sehr liebe Kinder. Es ist einfach zu schrecklich. Ich kann nicht glauben, dass es wahr ist. Dass sie tot sind. Das kann nicht sein.«
»Wie reagierten sie auf fremde Menschen?«
»Ich glaube normal. Sie sind nicht oft wildfremden Menschen begegnet. Am Anfang waren sie selten draußen, Vera hat sich stets Sorgen um sie gemacht. Sie ist eine sehr fürsorgliche Mutter.«
»Wie meinen Sie das, dass die Kinder nur selten draußen waren?«
»Als sie klein waren. Es kann ja so viel passieren. Darum ließen wir sie nicht alleine draußen spielen, sie sollten erst etwas älter werden. Aber das hat sich dann natürlich geändert.«
»Gab es in den letzten Tagen Streit? Mit den Kindern oder in der Familie, mit Ihrer Frau?«
»Wir haben Kekse gebacken, da ist Noah eine Schüssel runtergefallen. Vera reagierte gereizt und meinte, das sei das letzte Mal, dass sie Weihnachtskekse backen würden. Sie mochte Weihnachten nicht besonders, das bedeutete für sie immer zu viel Stress. Doch das mit der Schüssel war nur eine Kleinigkeit. Sonst war da nichts. Es war alles wie immer.«
»Wie würden Sie Ihre Ehe beschreiben?«
»Wir führen eine gute Ehe. Vera weiß alles von mir, und ich weiß alles von ihr. Sie hilft mir auch im Geschäft, mit der Buchhaltung, wobei, eigentlich ist sie die Geschäftsführerin, und ich bin der Arbeiter. Sie hält mir den Rücken frei. Sie will immer, dass es allen in der Familie gut geht.«
»Sie führen eine Zimmerei?«
»Richtig.«
»Läuft es gut?«
»Mal besser, mal schlechter, aber ich kann nicht klagen.«
»Sie hatten keine finanziellen Schwierigkeiten?«
»Nein, ich bin schuldenfrei.«
»Würden Sie sich als glückliche Familie bezeichnen?«
»Natürlich. Warum stellen Sie solche Fragen? Denken Sie etwa, wir hätten unseren Kindern etwas angetan? Bin ich deswegen hier? Ich liebe meine Kinder! Wer tut nur so was? Wer bringt zwei unschuldige Kinder um?«
»Das versuchen wir herauszufinden. Ich möchte, dass Sie mir vom gestrigen Tag erzählen, dem 24. Dezember. Wie haben Sie und Ihre Familie den Tag verbracht?«
»Die Kinder waren früh wach und schlüpften zu uns ins Bett. Das sind die schönsten Momente, wenn wir alle unter eine Decke kriechen. Nach dem Frühstück putzte Vera die Wohnung, dann fuhren wir zum Supermarkt, um die Einkäufe für die Festtage zu erledigen. Und um meine Eltern zu treffen. Wir gingen mit ihnen in einem Bistro gegenüber dem Einkaufszentrum Kaffee trinken. Da gibt es eine Spielecke, die Kinder haben sich selbst beschäftigt.«
»Waren sie alleine dort, sind sie in der Spielecke jemandem begegnet, die Kinder?«
»Ich glaube nicht. Es ist mir nichts aufgefallen. Das hätten wir bestimmt gesehen.«
»Und danach?«
»Danach fuhren wir nach Hause. Nein, Moment, vorher haben wir am Kiosk noch einen Lottoschein gekauft. Wir spielen jede Woche Lotto, man kann nie wissen, nicht wahr? Und auf dem Weg zum Auto sah Vera einen Ring im Schaufenster eines Schmuckgeschäfts. Ich gab ihr hundert Franken, damit sie ihn kaufen konnte. Erst dann fuhren wir über einen Umweg nach Hause. Von dort aus ging ich mit den Kindern spazieren. Wir waren sicher eine Stunde unterwegs. Ich erinnere mich, dass überall Raureif lag. Es war ein kalter, grauer Tag.«
»Und Ihre Frau?«
»Sie kochte währenddessen das Abendessen. Ich weiß nicht mehr, was es gab. Seltsam, dass mir das jetzt nicht einfällt. Das war ja erst gerade, vor ein paar Stunden. Es fühlt sich an, als wäre es weit weg, in einem anderen Leben. Nach dem Essen sahen wir noch etwas fern, einen Weihnachtsfilm, etwa um Viertel vor neun brachten wir die Kinder ins Bett. Vera und ich legten uns um Viertel vor elf schlafen. Sie klagte über Kopfschmerzen, sie leidet manchmal an Migräne. Ich wollte ihr eine Kopfschmerztablette holen, aber sie lehnte ab, sie stand selbst auf und nahm eine ein. Dann muss ich eingeschlafen sein.«
»Warum sind Sie aufgewacht?«
»Vera hat mich geweckt, es war mitten in der Nacht. Ich glaube, etwa drei Uhr, vielleicht etwas später. Ich schreckte aus dem Tiefschlaf hoch. Sie sagte, etwas sei nicht in Ordnung. Die Tür des Schlafzimmers war nahezu geschlossen. Das kam auch mir seltsam vor. Sie müssen wissen, die steht sonst immer ganz offen, ich blockiere sie jeweils mit einem Pantoffel, damit sie nicht zufällt und wir die Kinder hören können, falls etwas ist. Jetzt aber war sie nur halb offen, etwa in einem 45-Grad-Winkel, und draußen sah ich ein Licht schimmern. Vera fragte mich, ob ich auf dem Klo gewesen sei, wegen der Tür, oder ob Noah auf dem Klo war. Ich war alarmiert. Die Tür stand sonst immer offen, sie war nie zu. Mir war sofort klar, dass hier etwas nicht stimmte. Vorsichtig stand ich auf, ich ging leise in den Flur hinaus, dann zu Noah ins Zimmer.«
»Haben Sie bei Noah im Zimmer das Licht angemacht, oder brannte es schon?«
»Das weiß ich nicht mehr. Da war ein Licht, als ich aufgestanden bin. Aber ich kann nicht sagen, ob es das Licht in Noahs Zimmer war. In dem Moment stürzte vieles gleichzeitig auf mich ein, ich konnte nicht mehr klar denken. In solchen Momenten funktioniert man nur noch. Da war nichts als Angst und Überforderung. Es war ganz schrecklich.«
»Hier, nehmen Sie ein frisches Taschentuch. Ich weiß, dass es schwierig ist für Sie, aber Sie müssen mir ganz genau erzählen, was Sie im Kinderzimmer gesehen haben.«
»Was ich dort sah, war furchtbar. Noah hatte ein Kissen auf dem Gesicht. Ich nahm es weg. Er fühlte sich eiskalt an, und es lief ihm eine Flüssigkeit aus dem Mund. Er hatte auch Flecken im Gesicht. Ich habe seinen Puls gesucht, am Handgelenk, am Hals, aber ich habe ihn nicht gefunden. Ich erinnere mich, dass ich einen kalten Windzug wahrnahm, im Zimmer war es frostig. Ich schloss das Fenster und ging hinüber ins Zimmer von Sophie. Ich tat das wie ferngesteuert, ich habe nicht nachgedacht. Sophie war ebenfalls kalt und lag genau gleich da wie Noah. Ich habe auch bei Sophie das Kissen weggenommen. Ich weiß noch, dass ich ihren Namen gerufen habe, das weiß ich noch ganz genau, als würde ich mich selbst immer wieder hören – ›Sophie! Sophie!‹ –, und ich versuchte auch bei ihr, einen Puls zu ertasten, aber ich schaffte es nicht. Da war keiner, ich spürte nichts. Sie war tot! Dann alarmierte ich die Polizei. Ich musste zuerst die Nummer heraussuchen, ich wusste sie nicht mehr. Es war eine extreme Angst da. Es war die totale Überforderung. Ich wusste auch nicht, ob sich noch jemand im Haus befand, es sah aus, als wäre jemand in die Wohnung eingebrochen. Er muss durch das Fenster eingestiegen sein, es stand offen, obwohl wir es nur schräg gestellt hatten, und der Rollladen war oben, ich bin sicher, dass der Rollladen am Abend unten war, wir schließen die Rollläden jeden Abend. Und dann die Kinder, tot in ihren Betten. Sie waren so klein. Es war ein furchtbarer Anblick, es war ganz schrecklich und ganz extrem. Der absolute Notfall.«
»Wo war Ihre Frau in dem Moment?«
»Ich weiß nicht, was meine Frau gemacht hat, als ich erst zu Noah ins Zimmer und dann zu Sophie ging. Ich glaube, unsere Wege haben sich irgendwann gekreuzt, sie war präsent, aber ich weiß nicht, was sie in der Zwischenzeit gemacht hat.«
»Sie riefen also die Polizei. Was passierte danach?«
»Der Mann am Telefon redete mit mir, er sagte, ich solle zu den Kindern gehen und sie beatmen. Doch die Kinder waren eiskalt. Ich war völlig überfordert. Ich ging dann runter, um die Eingangstür für die Sanitäter zu öffnen. Als ich zurückging, saß Vera im Treppenhaus auf einer Stufe, sie saß dort und weinte. Ich sagte ihr, wir müssten die Kinder beatmen. Sie meinte, sie könne das nicht. Der Einbruch von früher kam wieder hoch, bei uns beiden. Es war eine ähnliche Situation wie damals, als schon mal bei uns eingebrochen worden war, noch in der alten Wohnung. Wir hatten solche Angst – und gleichzeitig wirkte alles unwirklich. Der Mann am Telefon sagte, ich solle zurück zu den Kindern gehen, er wies mich an, was ich tun musste. Aber ich konnte sie nicht beatmen, ich habe mich nicht getraut, es kam eine Flüssigkeit aus ihrem Mund.«
»War die Wohnungstür abgeschlossen in der Nacht?«
»Die Wohnungstür war zweimal abgeschlossen, sie ist immer zweimal abgeschlossen.«
»Sind Sie sicher?«
»Ich bin ganz sicher, dass sie zweimal abgeschlossen war. Abends bin ich mit Sophie noch mal runter in den Keller, um etwas zu holen, und als wir zurückkamen, hat sie vergessen abzuschließen, darum habe ich es gemacht. Ich bin ganz sicher.«
»Haben Sie den Schlüssel stecken lassen?«
»Ja.«
»Und als Sie in der Nacht aufschlossen, um unten die Haustür für die Sanitäter öffnen zu gehen, haben Sie da den Schlüssel wieder zweimal umgedreht?«
»Ich erinnere mich nicht, wer die Wohnungstür geöffnet hat. Und ob sie einmal oder zweimal abgeschlossen war. Oder überhaupt nicht abgeschlossen. Vielleicht habe ich sie geöffnet. Oder Vera? Ich weiß es nicht.«
»Herr Scherrer, bitte denken Sie nach. Das ist ganz wichtig. Versetzen Sie sich zurück in die Situation. Es ist Nacht. Sie gehen ins Treppenhaus, um unten die Haustür aufzuschließen. Sie verlassen dafür Ihre Wohnung, öffnen die Tür: Haben Sie den Schlüssel im Schloss umgedreht?«
»Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich erinnere mich nicht!«
»Versuchen Sie’s.«
»Es geht nicht. In meiner Erinnerung stehe ich schon im Treppenhaus.«
»In Ordnung. Sie sagten, das Fenster in Noahs Zimmer hätte offen gestanden.«
»Und das Fenster im Wohnzimmer. Wir hatten die Rollläden unten – aber nun waren sie oben. Nach dem ersten Einbruch in unserer alten Wohnung haben wir uns nicht mehr sicher gefühlt. Darum haben wir in der neuen Wohnung Beschläge an der Balkontür angebracht. Aber das Fenster beim Esszimmertisch stand weit offen. Ich bin ganz sicher, dass am Abend der Rollladen unten und das Fenster nur schräg gestellt war.«
»Was nahmen Sie sonst noch wahr in der Wohnung?«
»Es war extrem kalt. Ich hatte Angst, dass noch jemand da war. Zuerst habe ich ins Büro geschaut, dort habe ich nichts festgestellt, dort steht ein blaugraues Sofa. Ich dachte, es sei alles in Ordnung. Erst als ich später mit dem Polizisten erneut ins Zimmer ging, hab ich bemerkt, dass da Kleidung auf dem Boden lag und die Tasche auf dem Sofa ausgeleert war. Ich schaute nach meinem Portemonnaie. Darin befanden sich einhundertfünfzig Franken, aber das Geld war weg. Ich habe auch etwas Geld für kleine Ausgaben gespart, 5000 Franken, die lagen in der kleinen Kommode in der untersten Schublade. Die 5000 Franken waren noch da, als ich nachschaute, die haben sie nicht gefunden. Ich fragte mich, wie die reingekommen sind. Wir wohnen im ersten Stock, sie müssen eine Leiter dabeigehabt haben. Dann bat mich eine Polizistin, mit ihr mitzugehen, und eine Ärztin hat mich untersucht. Ist eigentlich meine Frau auch hier?«
»Ja, sie ist auch hier.«
»Wie geht es ihr?«
»Wir müssen ihr ebenfalls einige Fragen stellen.«
»Warum dürfen wir nicht zusammen sein?«
»Es ist wichtig, dass wir Sie getrennt befragen können, damit sich die Erinnerungen nicht vermischen.«
»Sagen Sie mir: Wer hat das unseren Kindern angetan? Es waren doch zwei kleine, unschuldige Kinder! Wie kann so etwas nur passieren?«
»Möchten Sie eine Pause machen?«
»Gerne. Ich bin sehr müde.«
»Ich lasse Ihnen Kaffee bringen. Und etwas zu essen.«
»Ich kann nicht nach Hause fahren?«
»Das geht leider nicht, ich habe noch weitere Fragen. Wir machen eine halbe Stunde Pause.«
Veronika Weber
Nachbarin
Der Lärm im Treppenhaus hat mich geweckt. Es war nicht wirklich Lärm, ich hörte Schritte, viele Schritte, viel zu viele Schritte mitten in der Nacht, und dann ein Weinen, weit weg. Ich war auf einen Schlag hellwach und wusste, dass etwas passiert sein musste. Aber wer denkt schon an so was? Es muss kurz nach drei gewesen sein, aber das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ich habe nicht auf die Uhr geschaut.
Im ersten Augenblick habe ich an einen Ehestreit gedacht. Ich war unsicher, ob ich wirklich aufstehen und nachschauen sollte. Aber streiten tut man in der Wohnung, nicht im Treppenhaus, nicht mitten in der Nacht. Und es waren zu viele Schritte, zu viele Menschen. Ich verwünschte meinen Mann dafür, dass er ausgerechnet in dieser Woche auf Montage im Ausland unterwegs war, dass ich nicht ihn losschicken konnte, um mal nachzusehen. Also habe ich den Morgenrock übergezogen und vorsichtig die Tür geöffnet.
Vera saß vor ihrer Wohnung auf den Stufen. Sie war sehr blass, ihr Gesicht wirkte versteinert. Sie muss es gewesen sein, die ich weinen gehört hatte. Jetzt aber blickte sie mich nur müde an und sagte, bei ihnen sei eingebrochen worden. Und die Kinder seien tot.
Im ersten Moment habe ich nicht verstanden, was sie sagte. Ich meine, ich habe es schon gehört – aber eben nicht verstanden, nicht begriffen, die Worte haben sich geweigert, in meinem Kopf anzukommen. »Einbruch«, das konnte ich aufnehmen – »tote Kinder«, das ging nicht, das war zu groß und zu schlimm, um es zu verstehen. Ich habe es bis jetzt noch nicht wirklich realisiert, dass sie tot sind, die Kinder. Umgebracht! Man bringt keine Kinder um. Das geht doch nicht.
Ich fragte Vera, ob sie den Einbrecher gesehen und ob er etwas gestohlen habe, es fiel mir nichts anderes ein, auch wenn sich die Frage im Nachhinein schrecklich und voll daneben anhört, aber ich habe mich am Wort »Einbruch« festgeklammert, weil ein Einbruch allein nicht so schlimm ist.
Da wiederholte sie, er habe die Kinder getötet.
Ich konnte das nicht fassen. Und dann sagte sie noch: »Geh rein und schau nach, wenn du mir nicht glaubst.« Also bin ich an ihr vorbei in die Wohnung gegangen.
Es mag seltsam klingen, aber ich war zuvor noch nie in ihrer Wohnung, obwohl wir direkt Tür an Tür leben. Wir sind nicht diese Art von Nachbarn, die gleichzeitig dicke Freunde sind. Wir haben uns immer gegrüßt und im Treppenhaus einen Schwatz gehalten, doch das war es dann auch schon. Es wäre mir seltsam vorgekommen, die Scherrers einzuladen oder von ihnen eingeladen zu werden. Aber das geht in Ordnung. Es ist nicht so, dass wir uns nicht verstehen. Wir sind einfach gute Nachbarn, nicht Freunde.
In der Wohnung standen Bernhard und ein fremder Mann. In der ersten Sekunde habe ich mich erschrocken, weil ich unsinnigerweise dachte, dass der andere der Einbrecher sein könnte. Aber im nächsten Augenblick war klar, dass er ein Polizist war – aufgrund der Art und Weise, wie er mit Bernhard sprach.
Und dann sah ich Sophie. Im Kinderzimmer.
Die Kleine lag auf dem Boden, und die Sanitäter versuchten, sie zu reanimieren. Ich habe mich abgewendet, und der Polizist hat mich dann auch gleich wieder aus der Wohnung geführt und mich gebeten, bei Vera zu warten. Bei ihr stand nun eine Polizistin, eine große Frau, die ihr Fragen stellte.
Erst nachdem ich Sophie dort liegen gesehen hatte, habe ich realisiert, was Vera mir gesagt hatte. Dass es wahr war. Dass etwas ganz Schlimmes geschehen war. Es kamen dann noch mehr Menschen. Es fühlte sich alles surreal an, als wäre ich im richtigen Leben eingeschlafen und in einem Horrorfilm aufgewacht. Oder als ob ich immer noch in einem üblen Traum feststecken würde. Wenn ich heute an die Nacht zurückdenke, kommt es mir vor, als blickte ich auf die Erinnerung eines anderen Menschen. Als handle es sich um eine Erzählung eines Bekannten, nicht um ein Ereignis, das ich selbst erlebt habe. Ich kann das Geschehen nicht mit mir in Verbindung bringen. Ist das nicht eigenartig?
Eine Polizistin hat mich dann später befragt. Sie wollte, dass ich die Familie Scherrer beschreibe. Aber was sollte ich schon sagen? Die Scherrers sind eine Familie wie viele andere auch. Sie hatten reizende Kinder, vor allem Noah, ihn mochte ich sehr. Sophie war etwas wilder. Man hat die Kinder nicht oft draußen gesehen, und für meinen Geschmack waren die beiden beinahe zu gut erzogen. Ich weiß, das mag etwas seltsam klingen, aber Sie wissen bestimmt, wie ich es meine. Sie waren auf eine fast unnatürliche Weise artig, wie kleine Erwachsene, nicht wie Kinder. Es herrschte Drill und Ordnung in der Familie, das war mein Eindruck. Es wurde getan, was die Mutter sagte, da gab es keinen Widerspruch. Die Kinder mussten immer und überall aufpassen, sie durften ja nicht schmutzig werden, da war Vera sehr penibel. Und wenn sie doch mal schmutzig waren, mussten sie selbst die Wäsche waschen, dabei waren sie ja wirklich noch so klein. Es ist eine schreckliche Vorstellung, dass sie nun tot sind.
Was soll ich sonst noch sagen? Meine Kinder haben nicht so gerne mit den Kindern der Scherrers gespielt. Wahrscheinlich, weil die beiden vieles nicht tun durften, was andere Kinder machen. Wir haben Noah und Sophie jeweils trotzdem zu den Kindergeburtstagen eingeladen, aber sie durften nie kommen. Womöglich klinge ich jetzt zu negativ. Es war eine Familie, wie es viele gibt, sie lebten einfach ein bisschen zurückgezogen, sie konzentrierten sich auf sich selbst, aber das ist ihr gutes Recht. Sie schienen mit sich zufrieden zu sein.
Es ist grauenhaft, dass ausgerechnet ihnen so etwas widerfahren muss. Die armen Kinder. So etwas kann man nicht begreifen. Es kommt mir vor, als wäre das Böse in unser Haus eingedrungen, und ich befürchte, dass es so schnell nicht wieder verschwindet. Das macht mir Angst. Vielleicht war es nichts als Zufall, dass der Einbrecher bei den Scherrers und nicht bei uns eingestiegen ist. Dass er ihre, nicht unsere Kinder getötet hat. Vielleicht hatten wir einfach nur Glück, dass es nicht uns getroffen hat – und womöglich werden wir beim nächsten Mal weniger Glück haben. Ich sorge mich um unsere Jungs, um unsere Sicherheit. Ich werde für ein paar Tage mit den Kleinen zu meiner Schwester ziehen, ich kann nicht hierbleiben und so tun, als wäre nichts geschehen. Man kann nie wissen; vielleicht kehrt der Einbrecher zurück und schlägt erneut zu.
Als ich wieder in unserer Wohnung war, ging ich als Erstes ins Kinderzimmer. Die Knaben schliefen tief und ruhig. Sie können sich nicht vorstellen, wie erleichtert und wie dankbar ich war. Doch in der nächsten Sekunde überflutete mich die Angst wie eine Welle, die Angst, dass auch ich meine Kinder verlieren, dass auch uns das Glück abhandenkommen könnte. Dass es beim nächsten Mal nicht den Nachbarn, sondern uns selbst treffen wird. Ich muss lernen, mit dieser Angst umzugehen.
Fortsetzung 1. Befragung
Anwesende: Belinda Schwarz, polizeiliche Sachbearbeiterin, und Bernhard Scherrer, Auskunftsperson
»Herr Scherrer, wie geht es Ihnen, können wir fortfah- ren?«