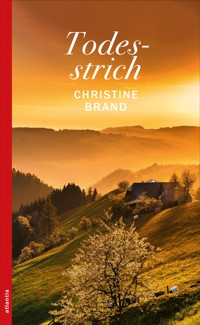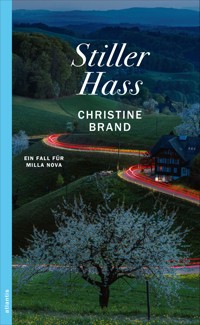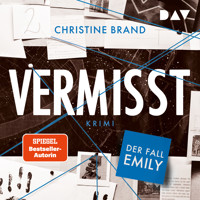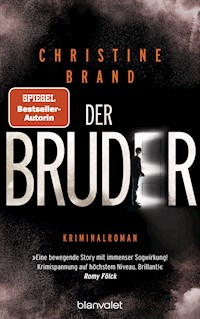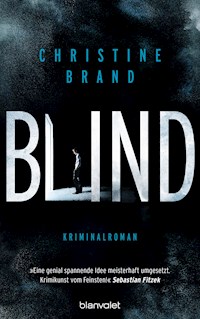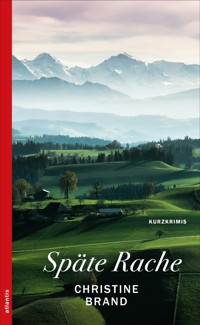
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Drei Freundinnen gehen einmal im Monat zusammen wandern, seit Jahren, sommers wie winters – doch eines Tages kommt eine von ihnen nicht lebend zurück ins Tal. Ein Journalist sorgt für Aufruhr in der Redaktion, als er erschossen am Schreibtisch seines Chefs sitzt. Ein Mann wurde für tot erklärt, wie man ihm am Telefon sagt;einer Frau bietet sich auf einem Klassentreffen nach Jahren die perfekte Gelegenheit zur Rache. Einer hat die falsche Frau geheiratet, der andere die Falsche verurteilt. Ob im Ameisenhaufen, im Beichtstuhl oder im Tank einer Absinthbrennerei – Leichen finden sich in nahezu allen Erzählungen dieses Bands. Bestsellerautorin Christine Brand erzählt von Opfern, die sterben, obwohl es gar nicht sie hätte treffen sollen, von Richtern, die an der Gerechtigkeit verzweifeln, Dorfpolizisten, Taschendieben, Rechtsmedizinern und angehenden Pfarrern. Einige der hier versammelten dreizehn Kurzkrimis beruhen auf wahren Begebenheiten, andere verdanken wir allein Christine Brands Phantasie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christine Brand
Späte Rache
Kurzkrimis
Atlantis
Tod am Napf
Ich bin am 17. August gestorben. Obwohl ich gar nicht hätte sterben sollen. Wir hätten es beide rückgängig gemacht, wäre es möglich gewesen. Doch das war es nicht. Ich weiß, das klingt nach einer komplizierten Geschichte. Ist es auch. Und eine traurige, zumindest aus meiner Sicht. Aber lassen Sie mich von vorne beginnen.
»Alles eingepackt? Proviant, Regenschutz? Wanderschuhe, und zwar die richtigen?«
Agnes konnte es nicht lassen. Jedes Mal ließ sie einen Spruch fallen. Ich konnte es nicht mehr hören. Nur weil ich damals, als wir über die Sieben Hengste wandern wollten, die falschen Schuhe mitgenommen hatte. Nicht die meinen, sondern seine. Als es noch einen »Ihn« in meinem Leben gab. Etwa drei Nummern zu groß waren sie gewesen. Eine Stolperpartie war das geworden, damals, vor ungefähr elf Jahren. Agnes hatte es nicht vergessen, sie vergaß nie etwas.
An diesem Tag, der der letzte meines Lebens werden sollte, stand der Napf auf dem Programm. Ein Tag, zum Sterben schön. Jemand hatte in großzügigen Schwüngen Wolkenfransen an den Himmel gemalt, um dem eintönigen Blau die Langeweile auszutreiben. Felder und Hügel lagen wie ein welliger Teppich vor den verschneiten Bergen, die sich Zähnen gleich auf den Horizont gesetzt hatten. Als wären sie ein Gebiss, der Himmel der Rachen – und die Wolken der Atem.
Agnes und ich standen oben an der Treppe, warteten auf Brigitte. Paul, der uns von Burgdorf nach Trubschachen chauffieren sollte, war nicht ausgestiegen. Seinem Gesicht nach zu urteilen war es eher ein Müssen als ein Wollen. Unbeteiligt schaute er zu uns herüber, trommelte mit beiden Zeigefingern einen stummen Rhythmus aufs Lenkrad. Er würde nicht mitwandern. Er wanderte nie mit. Undenkbar.
Von jenem Paul mit wilden Locken, Schlaghosen und Wollstrickpulli, der Agnes einst im Berner Gaskessel Samstag für Samstag tanzend umworben und dank einer unerschütterlichen Ausdauer letztlich auch erobert hatte, war nicht viel übrig geblieben. Siebzehn waren sie gewesen, damals, siebenundvierzig waren sie heute. Sie wirkte fünf Jahre älter – er fünf Jahre jünger. Banker war er geworden, einer von der Teppichetage. Man sah es ihm an. Kopfform, Haarwuchs wie auch seine Art sich zu bewegen und zu geben, schienen sich seiner beruflichen Tätigkeit angepasst zu haben. Aufrechter Gang. Die Haare kurz-, die Locken weggeschnitten. Ein auswechselbares Durchschnittsgesicht.
Wandern war für Paul »Weiberzeugs«, für Agnes war es Frauensache. Wandertag war Frauentag, einmal im Monat, im Sommer wie im Winter, seit Jahren schon. Stets wir drei: Agnes, Brigitte und ich, die wir bereits in der Schule gemeinsam unterwegs gewesen waren. Die Unzertrennlichen, wie Agnes manchmal sagte. Sie, die immer recht hatte, lag damit falsch. Doch wer sollte das an diesem lauen Sommermorgen ahnen?
Brigittes Zug war eingefahren. Von Herzogenbuchsee nach Burgdorf, dreizehn Minuten Fahrt, weit hatte auch sie es nicht gebracht. Nur knapp über die Talgrenze hinaus. Für einen Moment verwandelten die Pendler die Unterführung in einen Menschenteich. Brigittes Kopf stach aus den vielen Häuptern hervor, die sich durch den Betontunnel schoben – ihr langes, glattes pechfarbenes Haar, die herausfordernd hellen Augen. Selbst in ihren Wanderklamotten strahlte sie eine Eleganz aus, die mir völlig abging. Und Agnes sowieso. Brigitte war schon immer die Schönste gewesen von uns dreien. Das hatte sich nicht geändert. Im Gegenteil: Die Jahre hatten für sie gearbeitet – und gegen uns.
»Da bist du ja! Blendend siehst du aus …«
»Hallo ihr beiden. Was für ein Tag! Das hast du wieder mal bestens organisiert, Agnes.«
»Wie schön, dich zu sehen!«
»Wunderbar, dass es geklappt hat.«
»Ja, ein ganz besonderer Tag soll es werden. Ihr werdet ihn nie vergessen!«
Eine Drohung?, frage ich mich im Nachhinein. Eine Drohung, die niemand als Drohung verstand?
Während der Fahrt durchs Emmental, den Bergen entgegen, Eiger, Mönch und Jungfrau zum Greifen nah und doch nicht näher kommend, schwieg einer, und drei redeten. Nichts Besonderes also. Alles wie immer. Paul war da und doch nicht da. Erst Stunden später, als alles plötzlich anders war, fiel mir ein, was mir nicht aufgefallen war: diese Blicke während der Fahrt. Er schaute hin und wieder in den Rückspiegel, als wollte er sich vergewissern, dass wir noch immer hinter ihm saßen. Agnes auf dem Beifahrersitz blickte zwei-, dreimal zu ihm hinüber. Doch warum hätte ich mir dabei etwas denken sollen? Ich, die Ahnungslose. Die Ahnungsloseste von allen.
In Trubschachen angekommen, stiegen wir aus. Drei Küsschen, zwei links, eines rechts, drückte Paul mir und Brigitte auf die Wangen. Seiner Frau eines auf den Mund. Keine Herzlichkeit. Das hingegen hatte ich registriert. Wie die Gewohnheit die Herzlichkeit verdrängt, hatte ich gedacht. Dann fuhr er weg, der Paul.
Tock, tock, tock. Das Klopfen der Stockspitzen auf den Steinen gab uns den Rhythmus vor und mir ein vertrautes Gefühl. Agnes bestimmte Route und Tempo. Schon in der Schule hatte sie stets das Kommando übernommen, keine hatte es ihr streitig gemacht. Es war uns gerade recht gewesen. Agnes, die Anführerin, damals wie heute. Sie war immer perfekt vorbereitet, hatte die passende Wanderkarte zur Hand, den Weg, den wir zu gehen hatten, mit rotem Filzstift eingezeichnet. Es gab schon viele rote Striche in ihrer Kartensammlung, zahllose gewanderte Kilometer. Wahrscheinlich hatten wir längst die Welt umrundet.
»Wahrscheinlich haben wir schon die ganze Welt umrundet.«
Ich setzte dem Schweigen ein Ende.
»Haben wir nicht. Ich hab sie gezählt, unsere Wanderkilometer. Wir haben drei Komma sieben Mal die Schweiz durchquert.«
Brigitte und ich tauschten einen Blick. Wir waren nicht überrascht. Agnes, die Buchführerin. Über alles und jedes.
Sonderbar eigentlich, wie ausgeprägt meine Erinnerungen sind. Jedes Detail tief in mein Bewusstsein eingraviert. Als hätte ich den Tag mit einem HD-Rekorder aufgezeichnet und mir den Film schon fünfmal in Zeitlupe angesehen. Dabei hatte ich zeit meines Lebens nie ein gutes Gedächtnis. Aber vielleicht ist das so mit unseren letzten Tagen. Dass man sie nie vergisst.
Am Anfang des Schlussaktes meines persönlichen Dramas stand ein Fehltritt. Als hätte das Abrutschen meines Fußes über einen Stein mit dem darauffolgenden Umknicken des Knöchels dem Geschehen einen Stoß versetzt, um es in eine fatale Richtung zu lenken.
»Autsch, verflucht!«
Ich stolperte zwei, drei Schritte weiter, setzte mich auf einen Baumstrunk am Wegrand und zog den Schuh aus, um meinen Fuß zu untersuchen. Agnes verdrehte genervt die Augen.
»Aufpassen solltest du!«
In ihrer Stimme versteckte sich Hektik. Unvorhergesehene Ereignisse fanden in ihrem Programm keinen Platz.
»Hast du dir wehgetan?«
Brigitte begutachtete meinen Knöchel. Der machte sich gerade daran, sich bläulich zu verfärben und einen Kontrastpunkt zur heruntergeschobenen roten Socke zu setzen.
»Wird nicht allzu schlimm sein.«
Ich stand auf und belastete meinen linken Fuß, so vorsichtig, als drohe er abzuknicken wie ein angesägtes Stuhlbein, zuckte zusammen, versuchte es erneut. Der Knöchel hielt, was er nicht versprach.
»Der Schmerz wird sicher rasch nachlassen.« Der Versuch eines Lächelns missglückte, ich verzog mein Gesicht.
»Hoffentlich. Du kannst uns jetzt nicht die Wanderung verderben!« Agnes strich sich mit einer nervösen Geste eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Sie sah nicht gut aus, das fiel mir jetzt erst auf. Zu bleich. Ich erinnere mich, dass ich mich fragte, ob sie wohl schlecht geschlafen hatte. Sie war nicht immer so.
Der kleine Zwischenfall, der an einem Tag wie jedem anderen nicht mehr als ein kleiner Zwischenfall gewesen wäre, vermochte unsere zufriedene Stimmung wegzufegen. Vielleicht lag es am Tonfall in Agnes’ Stimme, an ihrer Wortwahl. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nahm ein unangenehmes Gefühl den Tag gefangen, der so gut begonnen hatte. Wie programmiert passte sich das Wetter umgehend unserer Laune an. Auf einmal blies uns der Wind ins Gesicht. Regenvolle Wolkensäcke hatten die Zirren weggeschoben und sich träge über den Hügeln an den Himmel gesetzt, darauf lauernd, sich zielgenau über uns zu entleeren.
Tock, tock, tock. Unbeirrt stapften wir weiter. Doch die zuvor angenehme Stille war einem bedrückten Schweigen gewichen. Keine von uns dreien mochte es brechen. Keine Bemerkungen. Keine Erzählung. Kein Wort. Etwas Unausgesprochenes hatte sich zwischen uns gedrängt und blieb verschwiegen, weil es nichts Gutes bringen würde. Was war bloß los mit uns, wir wollten es zusammen doch gut haben? Was stimmte nicht mit Agnes? Ich versuchte, meine Gedanken in eine andere Richtung zu treiben. Darin war ich immer gut gewesen, im Mich-Wegdenken. Ja nicht zu viel grübeln.
Natürlich. Jetzt, im Nachhinein, sind sie plötzlich da, all die Fragen, die ich mir nie gestellt hatte. Die Frage, ob ich diese beiden Frauen, die ich so lange zu kennen glaubte, wirklich kannte. Agnes – mit ihrem scheinbar makellosen Leben. Eine Villa mit Pool, ein angesehener Job, ein erfolgreicher Mann an ihrer Seite. Und Brigitte, die es weder im Beruf noch mit Männern jemals gut getroffen hatte und die ihre Zufriedenheit erst im Alleinsein fand. So zumindest schien es mir, die ich ihre Leben nur von außen sah. Das waren die Bilder, die sie mir hingemalt hatten und mit denen ich mich zufriedengab. Jetzt aber frage ich mich, ob die Freundschaft, von der ich meinte, sie hätte all die Jahre überdauert, wirklich Freundschaft geblieben war. Oder ob wir sie aus Gründen der Bequemlichkeit nur vorgaben. Weil die vergangene Zeit zerfloss, wenn wir uns zu unseren Wanderungen trafen. Als hätte jemand jeweils das Rad der Geschichte zurückgedreht und uns an einem längst vergangenen Punkt abgesetzt, an dem wir es ganz gemütlich und das Leben noch so einfach fanden. Dabei hatten wir wohl übersehen, wie sehr sich jede von uns verändert hatte. Dass die Bande zwischen uns nur noch Schatten der Erinnerungen waren und nicht mehr wirklich existierten. Ich weiß nicht, warum ich es nicht schon früher erkannt habe. Verstehe nicht, dass ich nicht eher begriffen habe. Aber danach ist man immer schlauer als zuvor. Wäre dem nicht so, sähe das Danach vielfach anders aus. In meinem Fall hätte es dann noch ein Danach gegeben.
Tock, tock, tock. Schon malten fette Tropfen dunkle Flecken auf die Steine. Der Regen verwandelte die Blätter in Trommeln und den Wald in ein Orchester. Hin und wieder rumorte der Himmel wie ein riesiger Rumpelbauch. Der Pfad wurde steiler. Und schmaler.
»Es könnte glitschig werden.« Brigitte hatte angehalten, um ihren Regenschutz hervorzuklauben, der sich irgendwo ganz unten in ihrem Rucksack versteckte.
»Wird schon gehen!«
Agnes, die Unerschütterliche. Sie wirkte noch immer mürrisch, unfreundlich ihr Ton. Doch es war ein ungeeigneter Moment, um darüber nachzudenken. Ich war zu sehr auf mich selbst konzentriert.
»Das ist kein guter Weg für mich.« Ich hörte, was die Angst mit meiner Stimme anstellte, und ärgerte mich darüber. Erbärmlich klang sie, und fremd.
Links vom Pfad verlief der Wald steil hinauf, rechts davon noch steiler hinab. Ein Grenzfall für eine wie mich. Agnes wusste um meine Höhenangst. Bisher hatte sie bei ihrer Routenwahl stets Rücksicht darauf genommen. Doch heute schien alles ungut zu laufen.
»Stell dich nicht so an!«, sagte Agnes barsch.
Ich schwieg. Blickte angestrengt nach links an den Hang. Bloß nicht rechts hinunter in den Abgrund schauen. Agnes schritt voran. Ich folgte in der Mitte. Brigitte hinterher. Ich schlich mehr, als dass ich ging. Am liebsten wäre ich gekrochen. Ich versuchte mir einzubilden, auf einer breiten Straße zu gehen. Doch es nützte nichts. Schon wurde mir schwindlig. Die Unsicherheit verdrängte meine Standfestigkeit, die Knie veränderten ihre Konsistenz. Meine Augen gehorchten mir nicht mehr und schweiften immer wieder nach rechts, blickten in die Tiefe, die mich hinabziehen, aufsaugen, verschlingen wollte.
Die Regentropfen waren jetzt Bindfäden. Das Laub am Boden und die Erde vermengten sich zu Schmierseife.
Agnes marschierte.
Brigitte fluchte.
Und ich fiel.
So sehr ich mich auch bemühe, ich kann nicht erklären, warum ich stürzte. Ich habe so sehr darüber nachgedacht, dass mein Kopf zu zerspringen drohte, doch ich erfasste kein klares Bild. Offenbar hat jemand die letzten Sekunden vor dem Fall von meiner Festplatte gelöscht. Ob ich gestolpert bin? Wegen meines instabilen Knöchels? Oder über einen Wanderstock? Über meinen eigenen, Brigittes oder über den von Agnes? War ich ihretwegen gestolpert? War das ihre Absicht gewesen? Vielleicht bin ich auch einfach so gefallen, weil mir die Furcht vor der Höhe den Gleichgewichtssinn geraubt hatte. Ich weiß es nicht.
Aber ich erinnere mich, wie ich fiel. Ich beobachtete, wie sich der Boden in unbegreiflicher Langsamkeit meinem Gesicht näherte. Die Zeit hatte sich entschlossen, träger voranzuschreiten. Noch im Fallen wägte ich ab, ob es sich empfehlen würde, mich abzudrehen. Ich schien in der Schwerelosigkeit hängen zu bleiben, wartete auf den Aufprall, der sich verzögerte, und dann doch kam. Mein Körper verursachte ein eigenartiges Geräusch, als er auf dem Boden aufschlug. Wie ein Walross, das nach Luft schnappt. Der Schlag ließ in mir Knochen ächzen, von deren Existenz ich zuvor nichts gewusst hatte. Ich fühlte mich wie ein hingeworfener Lappen. In meinem Kopf rotteten sich die wüstesten Worte zu Schimpftiraden zusammen. Doch nur ein alleinstehendes »Verflucht!« schaffte es über meine Lippen.
»Typisch!« Agnes stand vor mir und blickte auf mich herab. »Niemand sonst ist so ungeschickt wie du!«
Sie machte keine Anstalten, mir zu helfen. Verwundert blickte ich von unten zu ihr hinauf, vage hoffend, dass sie nur scherzte, auch wenn sie nicht danach klang. In ihren Augen sah ich nichts als Kälte. Sie kam mir vor wie eine fremde, feindselige Frau. Ich verstand es nicht.
Es war Brigitte, die mir die Hand reichte, um mir aufzuhelfen, und die für mich Partei ergriff. »Agnes, was ist bloß heute in dich gefahren?«
»Frag doch sie. Sie soll es dir erklären!«
Brigitte blickte mich an. Ich zuckte mit den Schultern und wusste keinen Text. Das Drehbuch, das Agnes mir vorhalten wollte, war mir unbekannt.
»Was soll sie mir sagen?« Brigitte wurde langsam grantig.
»Warum es mir beschissen geht! Soll sie dir doch erklären, was mit mir los ist!«
Warum es ihr beschissen ging? Weshalb sollte ich wissen, warum es Agnes beschissen ging? Mir ging es doch gerade ziemlich dreckig! Ich stand hier, nass bis auf die Haut, die Kleidung verschmutzt, das Gesicht dreckverschmiert, der Knöchel schmerzhaft angeschwollen. Das Gefühl, ich sei im falschen Stück gelandet, steigerte sich zur Überzeugung. Alles verkehrt in dieser Welt.
»Ich habe keine Ahnung, warum es dir schlecht gehen sollte«, sagte ich und staunte, wie sachlich ich mich anhörte.
»Du! Wie scheinheilig du tust! Du weißt es haargenau. Du allein bist an allem schuld!« Agnes spuckte die Worte aus wie Gift. Sie zeigte mit dem Finger auf mich, als wollte sie mich damit erstechen.
»Ich weiß nicht, wovon du sprichst!« Auch ich wurde jetzt laut. Ein Donner grollte, der Regen fiel noch heftiger.
Und plötzlich waren da Tränen. Agnes weinte. Agnes! Es war das erste Mal, dass ich meine Freundin weinen sah. In den neununddreißig Jahren, in denen wir uns kannten. Erst jetzt, wo ich nicht mehr sicher wusste, ob sie wirklich eine Freundin war. Ich fühlte mich unbeholfen, überfordert auch. Brigitte legte den Arm um Agnes’ Schulter.
»Lass uns darüber reden.«
Agnes stieß sie beiseite, drehte sich weg.
»Lass uns darüber reden!« Noch einmal Brigitte, eindringlicher jetzt.
»Nicht hier.«
»Wo dann?«
»Lass uns weitergehen!«
»Ich möchte verstehen!«
»Später.«
Die beiden schienen mich nicht mehr wahrzunehmen. Ich war in die Rolle der Beobachtenden geschlüpft, obwohl ich gleichzeitig im Mittelpunkt stand – ohne zu wissen, warum.
»Wir gehen rauf. Oben gibt es ein Berghaus.«
Agnes hatte sich gefasst. Schon gab sie wieder die Richtung vor.
Wir müssen ein sonderbares Bild abgegeben haben, wir drei Frauen, die wir da aufgewühlt hintereinander durch den Regen den Berg hinaufstapften. Mein ganzer Körper tat mir weh. Die Nässe und der Schmutz machten meine Kleidung schwer. Es fühlte sich an, als hätte sich eine Hand auf meinen Rücken gelegt, die versuchte, mich niederzudrücken. Zum Glück dauerte es keine halbe Stunde, bis wir oben waren, auf dem Gipfel, der so sanft gerundet ist, dass der Begriff Gipfel gar nicht passt. Zuoberst auf dem Napf, der seinen Besuchern an einem klaren Tag eine Weite bietet, die das Leben groß macht und den Menschen klein. Doch an diesem vermaledeiten Tag strahlte der Napf nur Bedrückung aus. Nichts Gutes. Die Landschaft war mit einem undurchdringbaren Grau übermalt. Die nassen Wolken hingen tief in den Gräben, als wollten sie die Welt ersticken. Sie machten mir das Atmen mühsam.
Das Berghaus war geöffnet. Wenigstens das. Die Wärme, die uns empfing, täuschte Geborgenheit vor. Erst jetzt spürte ich, wie die Kälte meinen Körper in Besitz genommen hatte, und ich fürchtete, sie lasse ihn nie wieder los. Kaum eingetreten, steuerte ich direkt die Toilette an. Am Waschbecken musste ich das Wasser eine Weile laufen lassen, bis es wärmer wurde. Ich benetzte ein paar Papierhandtücher und wusch mir den Schmutz aus dem Gesicht. Blickte mir im Spiegel in die Augen, sah die Müdigkeit. »Was ist nur passiert?«, fragte ich flüsternd mein Spiegelbild. »Was wird hier gespielt?« Keine Antwort. Nur Schweigen. Ich musste mich überwinden, den engen Raum wieder zu verlassen. Er hatte mir ein Gefühl von Sicherheit gegeben.
Wäre ich doch einfach dringeblieben!
Der Tee stand schon da, dampfte aus den Tassen. Wir waren die einzigen Gäste. Ich setzte mich zu Agnes und Brigitte an den Tisch. Wir schauten uns an. Das Schweigen wurde schwer.
»Nun.« Brigitte ließ dieses eine Wort, das weder Frage noch Satzanfang war, allein im Raum stehen.
Agnes räusperte sich. Ihre Stimme klang rauer als sonst. »Paul betrügt mich.«
Der Satz war zu gewaltig, ein Brocken, auf den eine Pause folgte. Als müsste er erst heruntergewürgt werden.
»Paul? Unmöglich!« Brigitte klang ehrlich überrascht.
»Das kann nicht sein! Bist du sicher?«, fragte ich. Damit hatte ich zuallerletzt gerechnet. Ich versuchte, meine Hand auf jene von Agnes zu legen. Sie schreckte zurück, als hätte sie sich verbrannt.
»Ja, ich bin sicher.«
»Wie kannst du dir denn sicher sein?«, wollte Brigitte wissen. Sie hörte nicht auf, mit dem Teelöffel in ihrer Tasse zu rühren.
»Ich habe ihn erwischt.«
Der Löffel fiel scheppernd auf den Holztisch.
»Was heißt, du hast ihn erwischt?«
»Das heißt, ich habe ihn erwischt.«
»Dann weißt du, wer sie ist?«
»Ja, ich weiß ganz genau, wer sie ist. Ich kenne sie sogar gut.«
Agnes sah mich direkt an und wirkte völlig gefasst. Doch ihre Stimme war zu Eis gefroren. Ich hielt die Tasse mit beiden Händen umschlossen und nahm einen Schluck, damit ich ihrem Blick nicht standhalten musste. Sogar der Tee schmeckte eigenartig an diesem Tag. Bitter.
»Das tut mir leid.« Das tat es mir wirklich. Ich konnte mir vorstellen, dass ihre Welt erschüttert war.
»Dir tut es leid? Ausgerechnet dir will es leidtun?« Agnes schrie mir ins Gesicht. Unwillkürlich rutschte ich von ihr weg.
»Natürlich tut es mir leid!« Blut schoss mir in den Kopf. Am liebsten wäre ich aufgestanden und gegangen. Sie ging zu weit. Doch ich hielt meine Wut zurück, versuchte mich selbst zu beschwichtigen. Das hier war nicht die Agnes, die ich kannte, sondern eine tief verletzte Agnes, die neben sich stand.
»Verlässt du ihn?«, wollte Brigitte wissen.
Mich hätte mehr interessiert, wer Pauls Geliebte war, doch ich wagte nicht zu fragen. Ich fühlte mich plötzlich elend. Mein Kopf war auf einmal fiebrig, als würde er glühen. Ein Schmerz pochte von innen an meine Stirn.
Agnes beantwortete Brigittes Frage nicht. Stattdessen begann sie, in ihrem Rucksack zu wühlen. Sie stellte ein Necessaire auf den Tisch.
»Es ist Zeit«, sagte sie und blickte mir in die Augen. »Es ist Zeit, endlich ehrlich zu sein.«
Etwas an ihrem Gesicht irritierte mich. Die Proportionen schienen sich verschoben zu haben.
»Du sagst also nichts?«, legte Agnes nach.
»Ich weiß nicht, was du von mir erwartest.« Mir wurde übel. Ich nahm einen weiteren Schluck des bitteren Tees.
Agnes öffnete den Reißverschluss des Necessaires und zog einen Ohranhänger heraus, der mir vage bekannt vorkam. Das Stück war nicht nach meinem Geschmack, völlig überdimensioniert, es bestand aus einem schwarzen Drahtgeflecht und bunten Perlen. Der Anhänger verschwamm vor meinen Augen.
»Den hier habe ich unter unserem Bett gefunden.« Agnes hielt ihn in die Luft wie einen Pokal, den sie gerade errungen hatte.
Mir war schwindlig. Der Boden setzte sich in Bewegung. Auch mit meinen Augen schien etwas nicht zu stimmen.
»Ich habe dir genau diesen Ohrring vor acht Jahren aus Burkina Faso mitgebracht. Erinnerst du dich?« Agnes wedelte mit dem Anhänger vor meinem Gesicht herum.
Doch das war nicht meiner. Plötzlich begriff ich. Agnes meinte, ich sei die Frau, die ihr den Paul genommen hatte. Ich! Den Paul! Am liebsten hätte ich laut losgelacht. Aber es ging nicht. In meinem Hals wurde es eng. Jemand schien mir die Kehle zuzudrücken. Doch da war niemand. Ich rang nach Atem. Mein ganzer Körper fühlte sich eigenartig an. Die Haut wurde taub. Ich verlor jegliches Gefühl.
»Ich werde dir das nie verzeihen.« Agnes wartete meine Antwort nicht ab. »Damit kommst du nicht davon!«
In diesem Augenblick war mir alles klar. Fragen Sie mich nicht, warum ich es auf einmal wusste. Ich wusste es einfach. Und im gleichen Moment realisierte ich, dass dies mein Ende war. Agnes hatte mich vergiftet. Der Tee! Sie hatte mir etwas in den Tee getan. Natürlich! Ich war nicht mal überrascht. Irgendwie passte es zu Agnes. Sogar das.
Ich wollte ihr sagen, dass sie sich irrte. Doch die Leitungen zwischen meinem Gehirn und dem Körper waren gekappt. Er gehorchte mir nicht mehr. Ich wollte schreien: »Ich war es nicht!« Ich wollte flehen: »Helft mir!« Doch nichts geschah. Ich fühlte mich hilflos und leer.
»Ich muss dir etwas sagen.« Brigitte hörte sich nicht mehr an wie Brigitte. Sie sah auch nicht mehr aus wie Brigitte. Ihr Gesicht hatte die Konturen verloren, war nur noch ein fleischfarbener Fleck. »Nicht ihr – mir hast du diesen Anhänger geschenkt.« Brigittes Stimme kam von sehr weit weg. »Sie ist es nicht. Ich bin’s. Ich hab was mit Paul.«
Die Welt stand einen Herzschlag lang still.
»Du?«
Meine letzte Erinnerung ist das Entsetzen in Agnes’ Gesicht. Ich spürte nicht mehr, wie meine Stirn mit einem dumpfen Ton auf der Tischplatte aufschlug. Ich war schon weg.
So bin ich also gestorben. Obwohl gar nicht ich hätte sterben sollen. Wäre es möglich gewesen, hätten wir es rückgängig gemacht. Doch das war es nicht.
Chefsache
Die Plätze der anderen sind leer. Alle schon weg. Sitzen zu Hause vor vollen Tellern, klagen über die Arbeit und lassen sich erzählen, was die Kinder den ganzen Tag über getrieben haben. Oder sie verstecken sich hinter dem allabendlichen Schweigen, das sich in ihrem Haus eingenistet hat, weil alles längst gesagt worden ist.
Die Leere im Großraumbüro, in dem es tagsüber zugeht wie in einem Ameisenhaufen, beruhigt mich. Das Surren meines Computers unterstreicht die Stille. Da und dort wirft eine vergessene Lampe ihren unnützen Schein auf einen Schreibtisch. Die Nacht draußen färbt die Fenster schwarz, und ich fühle mich geborgen wie in einem Kokon.
Die Redaktion ist mein Zuhause. Nirgendwo sonst habe ich so viele Stunden verbracht, so viele Sätze formuliert, Millionen von Buchstaben sortiert. Bin ich alleine hier, schreibe ich am besten. Klack-klack-klack, meine Finger tanzen wie von selbst über die Tasten.
Der letzte Abschnitt meines letzten Artikels vor meiner Zwangsversetzung. Vor meiner entwürdigenden Degradierung. Die letzten Sätze meines Porträts über einen jungen Mann, der sich an einen Baum gefesselt hat und dort seit Tagen einen sinnlosen Protest aussitzt. Er will verhindern, dass Dutzende Bäume gefällt werden, die einer neuen Straße weichen müssen. Das wird ihm nicht gelingen. Er hat keine Chance, das hab ich ihm gesagt.
»Auch wenn ich nicht gewinnen kann«, hat er geantwortet, »so weiß ich wenigstens, dass ich versucht habe, zu gewinnen.«
Fast ein Kind noch, aber er hat mich berührt. Wo doch sonst der Schreibblock in meinen Händen als Schutzwall dient, damit mir die Themen und die Menschen nicht zu nahe kommen, über die ich berichte. Der Mut des jungen Mannes hat meine Zweifel vertrieben und mich darin bestärkt, es endlich zu tun. Egal, was passiert.
Und auch wenn ich nicht gewinnen sollte – so weiß ich wenigstens, dass ich versucht habe, zu gewinnen.
Heute ist der schrecklichste Tag meines Lebens. Wäre ich bloß nicht aufgestanden. Bin ich aber. Leider. Dabei hat sich abgezeichnet, dass dies kein guter Tag werden wird. Aber so etwas? Wer denkt schon an so etwas! So etwas gibt’s ja gar nicht.
Hätte ich nur auf die Zeichen gehört. Es begann mit den grässlichen Kopfschmerzen kurz nach dem Aufwachen. Doch wer bleibt schon wegen Kopfschmerzen im Bett? Ich hab gleich mal ein Aspirin eingeworfen, krank sein geht ja nicht. Dann kochte die Milch über. Ich verbrannte mir die Finger, als ich den Topf von der Herdplatte stieß. Wenig später, als ich schon draußen vor der Haustür stand, fiel mir ein, dass ich die Unterlagen für die Konferenz der Chefredakteure oben liegen gelassen hatte, also wieder hoch in den vierten Stock.
Konnte ja keiner ahnen, dass die Konferenz nie stattfinden würde.
Und schließlich der Unfall. Ein Lastwagen, quer gestellt und umgekippt mitten im Morgenverkehr auf dem Bellevue-Platz. Da gabs kein Durchkommen mehr. Alles und jeder schien sich gegen mich verschworen zu haben – oder eben gerade nicht: Alles und jeder schien mich aufhalten zu wollen, damit ich nie in der Redaktion ankomme. Um mich vor diesem Schock zu bewahren. Ich aber dachte bloß, das ist wieder mal so ein Tag, an dem alles schiefläuft. Dabei wurde es der schrecklichste Tag meines Lebens.
Ich kam dann nämlich doch noch an. Um Viertel nach sieben war ich im Büro, eine Viertelstunde zu spät. Das passiert mir sonst nie. Ist mir all die Jahre nicht passiert. Siebzehn Jahre und fünf Chefredakteure lang war ich jeden Morgen pünktlich um sieben in der Redaktion. Eine Stunde, bevor der Chef eintrifft.
Trotz der Verspätung war ich die Erste im Haus. Dachte ich zumindest. Ich hab natürlich nicht angeklopft, als ich das Büro des Chefredakteurs betrat, ich ging davon aus, es sei leer. Die Tür war nicht abgeschlossen, das ist mir aufgefallen, aber es kommt hin und wieder vor, dass der Chef nach mir das Haus verlässt und vergisst abzuschließen. Ich stoße also die Tür auf – ich hatte es eilig, es galt, die verlorene Zeit wieder reinzuholen – und trete ins Büro, und dann sitzt er da. Ehrenwort – ich habe mir im ersten Moment überhaupt nichts dabei gedacht, hab aus dem Augenwinkel heraus gesehen, da sitzt jemand, und wer sollte das anderes sein als der Chefredakteur Kunz, auch wenn das ungewöhnlich ist, so früh am Morgen, aber vielleicht ist ja wieder was passiert, erneut eine schreckliche Amoktat oder gar ein Terrorakt, der frühes Handeln erfordert, damit das Thema in der Zeitung entsprechend breitgetreten werden kann, was weiß ich – auf jeden Fall nehm ich wahr, dass der Kunz da sitzt, und ich rufe fröhlich, denn das ist nun mal meine Art: »Guten Morgen, Herr Chefredakteur, Sie sind aber früh unterwegs, hoffentlich ist nichts Schlimmes passiert!«
Es ist aber etwas Schlimmes passiert. Nur kann mir das der Kunz nicht sagen. Er schweigt. Keine Antwort. Also dreh ich mich um und schau genauer hin. Da seh ich, dass er eingeschlafen ist, den Kopf neben sein Laptop gebettet. Der Arme, denke ich, darum ist er schon hier, weil er gar nicht nach Hause gegangen ist. Erst dann registriere ich die Lache auf dem Schreibtisch. Zuerst denke ich an verschütteten Kaffee. Oder vielleicht denke ich das auch nicht. Denn ich weiß, verschütteter Kaffee sieht ganz anders aus, aber ich will, dass es verschütteter Kaffee und nichts anderes ist.
Ist es aber. Es ist Blut. Viel Blut. Überall auf dem Tisch. Und in seinem Haar. Verklebte schwarz-graue Strähnen.
Das ist der Moment, in dem ich losschreie.
Kennen Sie das? Ist Ihnen das auch schon mal passiert? Dass ein Schrei Ihrer Kehle entweicht, der sich anhört, als stamme er nicht von Ihnen selbst? Und dass der Schrei kein Ende nehmen will, weil dann, wenn der Schrei endet, das Schreckliche, das man nicht wahrhaben will, Wirklichkeit wird? Genau so habe ich geschrien. Aber irgendwann kam nichts mehr. Also verließ ich das Zimmer. Schloss die Tür hinter mir, begab mich an meinen Arbeitsplatz, setzte mich hin. Und hier sitze ich noch immer.
Ich will den Computer hochfahren, mit der Arbeit beginnen, das tun, was ich immer tue, so tun, als ob nichts wäre, um mich selbst zu überzeugen, dass nichts passiert ist, dass ich mir das alles nur eingebildet habe, ein übler Traum, mehr nicht. Gleichzeitig weiß ich, dass ich die Polizei anrufen sollte, das ist es, was ich jetzt tun muss. Doch mein Arm, der zum Telefonhörer greift, wiegt eine Tonne. Drei Ziffern nur, eins eins sieben. Mein Körper fühlt sich an wie festgenagelt. Ich fühle mich unfähig, die Tasten zu drücken, und schaffe es dann doch.
»Das ist der schrecklichste Tag meines Lebens«, sage ich zu der Person am anderen Ende der Leitung.
Mord an einem Journalisten: gar nicht gut. Tatort Redaktion: ganz schlecht. Um 7:27 Uhr kam die Meldung rein, noch bevor ich mir Kaffee holen konnte: auch nicht gerade stimmungsfördernd. Der Chefredakteur der Großen Zeitung