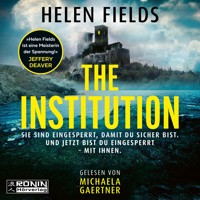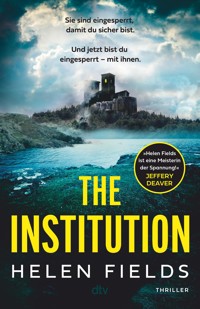9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Luc Callanach und Ava Turner
- Sprache: Deutsch
Geduldig pirscht er sich an die Opfer an, erschleicht ihr Vertrauen. Nur um dann ihren qualvollen Tod zu orchestrieren und sich an der Trauer der Hinterbliebenen zu weiden.
Die Leiche einer jungen Frau wird an der Flanke vom Arthur’s Seat, Edinburghs Hausberg, gefunden. Schnell stellt sich ihr Tod als Giftmord heraus. Dann stirbt die Leiterin einer Wohltätigkeitsorganisation - auch sie wurde vergiftet. War derselbe Täter am Werk? DI Callanach und DCI Turner begeben sich auf die Jagd. Eine Jagd, die keinen Fehltritt duldet und eine schwere Entscheidung fordert: Sind sie bereit, für die Ergreifung des Mörders die eigenen Regeln zu brechen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KAPITEL 36
KAPITEL 37
KAPITEL 38
KAPITEL 39
KAPITEL 40
KAPITEL 41
KAPITEL 42
KAPITEL 43
KAPITEL 44
KAPITEL 45
KAPITEL 46
KAPITEL 47
KAPITEL 48
KAPITEL 49
KAPITEL 50
KAPITEL 51
KAPITEL 52
KAPITEL 53
KAPITEL 54
KAPITEL 55
KAPITEL 56
KAPITEL 57
KAPITEL 58
KAPITEL 59
KAPITEL 60
KAPITEL 61
KAPITEL 62
KAPITEL 63
KAPITEL 64
KAPITEL 65
KAPITEL 66
DANKSAGUNG
Über die Autorin
Helen Fields studierte Jura an der Universität von East Anglia in Norwich, lernte an der Inns of Court School of Law in London und arbeitete anschließend dreizehn Jahre als Anwältin. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes widmete sie sich neuen Aufgaben und leitet heute mit ihrem Ehemann eine Filmproduktionsfirma. Sie arbeitet als Produzentin und Autorin für Drehbücher und Romane. Die perfekte Gefährtin ist ihr Debütroman. Fields lebt mit ihrem Ehemann und drei Kindern in Hampshire.
HELEN FIELDS
DIE PERFEKTE STRAFE
Thriller
Aus dem Englischen von Frauke Meier
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Für die Originalausgabe:Copyright © 2018 by Helen FieldsTitel der englischen Originalausgabe: »Perfect Death«Originalverlag: Avon, A division of HarperCollinsPublishers, London
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Alexander Groß, MünchenTitelillustration: © Protasov AN/shutterstockUmschlaggestaltung: Massimo Peter-BilleE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-7799-6
www.luebbe.dewww.lesejury.de
Für SollieEin einziges Lächeln kann die Welt verändern.Vergiss nie, mein lieber Junge – du kannst alles erreichen. Es gibt keine Grenzen. Gar keine.Du raubst mir den Atem.
KAPITEL 1
Lilys Leben war so gut wie vorbei, sie wusste es nur noch nicht. Er liebkoste das Foto von ihr, das in den letzten Monaten griffbereit an seinem Bett gelegen hatte. Es zeigte sie, wie sie vorgebeugt am Rand eines Teiches stand und lachend Enten mit Brot fütterte, ohne auch nur zu ahnen, welche kümmerliche Zukunft sie erwartete.
Vor dem Abend blieb noch viel zu tun, doch ein paar Augenblicke mit seiner Schatztruhe konnte er sich noch gestatten. Er zog die untere Schublade aus seinem Nachttisch, schob die Hände in den dunklen Hohlraum und griff nach dem hölzernen Behältnis. Er hatte es im Werkunterricht in der Schule angefertigt, einer der wenigen Erfolge in einem überwiegend vergeudeten Abschnitt seines Lebens – andererseits war er häufig umgezogen, und Lernen war ihm nie leichtgefallen.
Kaum hatte er den Deckel geöffnet, betrachtete er atemlos die Überbleibsel des Daseins in dem Kästchen. Eine Brosche mit Einlegearbeiten aus Halbedelstein in der Form eines Erikazweigs. Er erinnerte sich an die zermürbende Gartenarbeit, die er dafür hatte verrichten müssen, stundenlang, ohne sich auch nur eine Pause zu gönnen, um dem Regen zu entgehen, aber am Ende hatte es sich ausgezahlt. Dann war da der kleine silberne Brieföffner, so viel geliebt und genutzt, dass das verschnörkelte Muster auf dem Griff nahezu fortgewetzt war. Eine Glücksmünze, so zumindest hatte die Eigentümerin behauptet, die stets in einer Tasche oder einem Portemonnaie verwahrt worden war. Was nur bewies, dass es so etwas wie Glück nicht gab. Und schließlich ein Zahn. Genauer, eine Zahnkrone, abgebrochen in jenem quälenden Drama, in dem nichts mehr nach Plan verlaufen war. Ihm gefielen die Ebenmäßigkeit der Oberfläche und die bedeutende Rolle, die sie in einem Leben gespielt hatte, dem er ein Ende bereitet hatte. Wohin verschwand die einem Körper innewohnende Energie, wenn das Sterben abgeschlossen war? Wieder dachte er an seine Schulzeit zurück. Da war etwas mit Energie, die ihre Form änderte, aber nie zu existieren aufhörte. Seine Kenntnisse reichten nicht, um die Prüfung in Naturwissenschaften zu bestehen, aber er freute sich über diese kleine Perle des Wissens und überlegte, ob es wohl möglich war, die Energie eines sterbenden Menschen einfach einzuatmen.
Er räumte eine Stelle inmitten der Gegenstände in seinem Kästchen frei und stellte sich eine neue Beute an diesem Platz vor. Um das Vertrauen ihrer Eigentümerin zu erringen, hatte er mehr Zeit benötigt als bei den anderen. Lily blieb gern für sich, erfreute sich am Familienleben und arbeitete hart. Dennoch würde er bald ein Andenken an sie haben, dessen Anblick er gemeinsam mit den anderen, für die er so schwer gearbeitet hatte, genießen konnte.
Er kontrollierte das kleine Fläschchen Cannabisöl, das herzustellen ihn wochenlang beschäftigt hatte. Stets nur kleine Mengen zu kaufen, um nicht durch den Erwerb einer größeren Menge Misstrauen zu wecken, war zeitraubend gewesen, doch die Mühe hatte sich gelohnt. Die anschließende Verarbeitung hatte sich größtenteils recht einfach gestaltet. Zu Problemen war es nur gekommen, wenn er es an sich selbst getestet und am Ende so tief geschlafen hatte, dass er die Arbeit am nächsten Tag versäumt hatte. Nicht gut. Er hatte Kosten. Solch ein Vorhaben wollte sorgsam finanziert sein, und Jobs, die bar bezahlt wurden, waren knapp.
Während er das Kästchen wieder in das Schubladenfach schob, ging er im Kopf noch einmal die Einzelheiten durch. Der Wagen war bereit. Alle Lichter funktionierten – schließlich hatte es keinen Sinn, wegen so etwas Albernem wie einer kaputten Birne die Aufmerksamkeit der Polizei zu erregen. Alles war mit Handschuhen angefasst worden. Seine gesamte Ausrüstung. Da war nicht ein Teil, das er mit bloßen Händen berührt hätte. Er hatte genug Fernsehsendungen über echte Kriminalfälle gesehen, um zu wissen, dass Fingerabdrücke heutzutage nicht mehr das größte Problem waren. Hautzellen konnten genug DNA liefern, um ihn in Verdacht zu bringen, und er wollte nicht geschnappt werden. Es gab noch so viel zu tun. So viele andere Menschen, die seiner Aufmerksamkeit bedurften.
Alles fertig, und er konnte sich sogar noch ein kleines Nickerchen leisten. Besser, er war ausgeruht, angesichts all dessen, was er vor sich hatte. Dabei ging es nicht nur um die physischen Aspekte. Morden war Schwerstarbeit. Wer glaubte, ein Mensch stürbe einfach so in den paar Sekunden, die ein Fernsehkrimi dafür einräumte, war ein Idiot. Viel öfter trat der Tod in Erscheinung wie ein langsamer Striptease. Natürlich gab es Möglichkeiten, es schnell zu erledigen – ein Schuss, eine Explosion, ein schweres Kopftrauma –, aber manuell dauerte es zwangsläufig länger. Ersticken und Ertränken waren wahrlich zeitaufwendige Aktivitäten und bargen das Risiko, dass man sich am Ende selbst verletzte. Kratzer, Tritte in die Leistengegend, Knochenbrüche. Das hatte er oft genug erlebt.
Er legte sich auf das Bett und schloss die Augen. Die Vorfreude war ein wichtiger Teil des Ganzen. Sich übereilt auf das Ende zu stürzen wäre, als würde man das letzte Kapitel eines Buches zuerst lesen. Dabei war es gerade die Vorbereitung, die Mühe, die man den Charakteren widmete, was das Ergebnis so aufregend machte. In der Vergangenheit war es ihm schwergefallen, das ideale Opfer zu finden, und nun waren gleich drei auf einmal aufgetaucht. Er lachte. Es war ein schmerzlich erstickender Laut, der in der Luft zu explodieren schien wie ein Feuerwerkskörper. Ein grausamer Laut, aber er war kein grausamer Mann. Nicht ohne Not. Nur dann, wenn Grausamkeit absolut unverzichtbar war.
KAPITEL 2
»Hey, Süße, wie wäre es, wenn ich dir noch einen Drink bestelle?« Joe lächelte Lily an, als die von der Toilette des Pubs zurückkehrte. Seitwärts quetschte sie sich zwischen zwei Gästen auf der Suche nach freitagabendlichem Vergessen hindurch, ohne denjenigen zu bemerken, der ihr derweil auf das Hinterteil starrte. Verständlicherweise, wie Joe dachte. Ihr Körper verdiente es, angestarrt zu werden, und er würde wegen so einer Kleinigkeit keinen Streit anfangen.
»Ich bin dran, Joe. Du musst nicht immer zahlen«, sagte sie, als sie sich neben ihm auf den Sitz fallen ließ. Sie kauerten sich auf dem begrenzten Raum zusammen und sprachen mit lauter Stimme gegen den zunehmenden Lärm der Zecher, der Musik und der über den Holzboden schlurfenden Füße an.
»Sparst du nicht für die Universität?«, fragte er und schnappte sich ihre leeren Gläser.
»Du weißt, dass ich das tue«, entgegnete sie, »aber das bedeutet nicht …«
»Und reißt du dir den Arsch auf, um die beste Ärztin aller Zeiten zu werden?« Joe beugte sich zu ihr herab, um sie zu küssen. Die Mädchenhorde, die mit ihnen am Tisch saß, verdrehte die Augen und erging sich in tadelnden Lauten, erkennbar eifersüchtig unter der Maske des Abscheus.
»Du bist verrückt.« Lily erwiderte den Kuss.
»Also tue ich der Welt einen Gefallen, indem ich Miss Lily Eustis dabei helfe, in Zukunft Leben zu retten, ohne mit zusätzlichen Schulden in Höhe von« – abwägend starrte er zur Decke empor – »acht Pfund sechsundvierzig auf ihren Abschluss hinzuarbeiten.«
»Ich gebe auf.« Lachend küsste Lily ihn erneut und barg dann errötend ihr Gesicht an seinem Hals.
»Okay, du hast mich erwischt. Ich habe ein Faible für Frauen in weißen Kitteln, die Stethoskope tragen. Das ist meine Art, meinen eigenen bizarren Fetisch zu befriedigen«, sagte Joe, und Lily schlug ihm spielerisch auf den Arm, als er davonging. Weder hörte er, dass die Frau, die ihn anstarrte, leise pfiff, noch merkte er, dass das Mädchen, das neben ihnen saß, Lily mit Blicken zerfleischte. Sie waren ein Paar, das nur Augen füreinander hatte.
Zum Tresen zu kommen war, als wollte er einen Berg erklimmen. Getränke ergossen sich über Rücken, wenn sich Leute mit zu vollen Händen entfernten. Positionen wurden behauptet, Stimmen erhoben, wann immer ein Gast fälschlicherweise vor einem anderen bedient wurde. Musikwünsche wurden gebrüllt, Klagen erhoben, weil jemand sich in einer der gerade mal zwei Kabinen in der Damentoilette eingeschlossen hatte. Ein Fass war leer. Doch Joe stand geduldig da und hatte stets ein Lächeln parat, um sich gegenüber Zehentretern und Ellbogenrammern nachsichtig zu zeigen. Er hatte Lily, und sie war alles, was er sich erträumt hatte.
In seinem Wagen wartete alles, was sie für den perfekten romantischen Abend brauchten. Holz, Zündhilfen, Streichhölzer, eine Flasche Schnaps zum Aufwärmen, ein Schlafsack. Sogar das Wetter war ihnen wohlgesinnt. Es würde zwar kalt werden, aber nicht regnen. Er hatte sich sogar die Mühe gemacht, ihr Ausflugsziel ein paar Tage zuvor auszukundschaften. Edinburgh würde sich majestätisch unter ihnen ausbreiten, und die Lichter der Stadt würden aussehen wie ein Spiegelbild der Sterne am Himmel, sofern keine Wolken aufzogen. Endlich würde er Lily ganz für sich allein haben und dazu genug Zeit, um ihr zu zeigen, was sie ihm wirklich bedeutete.
Es war zu kalt, als dass irgendjemand nackt draußen sein sollte. Das war Mark McVeighs erster – und irrwitzigster – Gedanke. Die Szenerie, die die Drohne an seinen Monitor übertrug, entsprach nicht so ganz dem, was er zu sehen erwartet hatte. Winterlicher Frost auf kahlen Felsen, ja. Eine am Boden liegende Frau, ein Bein angezogen, das andere ausgestreckt, einen Arm hinter dem Kopf, den anderen flach auf der Erde, nein. Der Wind fegte durch ihr langes, rotes Haar und wehte es ihr wie einen Schleier über die Augen. Zu ihren Füßen war die Asche eines Feuers zu sehen, und neben ihr lag eine Streichholzschachtel. Er steuerte die Drohne näher heran, versuchte sich einzureden, er könnte vielleicht sehen, wie sich ihr Brustkorb hob und senkte. Erfolglos. Mark dirigierte die Drohne zu ihrem Gesicht, hoffte, man würde ihn nicht irgendeiner Art der Perversion beschuldigen, und betete zu den unterschiedlichsten Göttern, dass sein Bauchgefühl ihn täuschen möge. Jetzt falschzuliegen wäre wirklich gut. Der kleine Kopter befand sich jenseits eines Grats und damit außerhalb seines Blickfelds. Vorsichtig ließ er ihn tiefer gehen, darauf bedacht, ihn nicht direkt über der Frau herabsinken zu lassen, um zu verhindern, dass sie, sollte sie erwachen und sich aufsetzen, mit dem Fluggerät kollidierte. Doch auch eine nähere Betrachtung brachte keine Erleichterung. Die Drohne war mit einem anständigen Objektiv ausgestattet, und sein Bildschirm füllte sich mit Schattierungen von Blau, die nichts mit dem Frost oder dem erfrorenen Heidekraut zu tun hatten. Das Blau war auf ihren Lippen, ihren offenen Augen, ihren Adern und der von Sauerstoffmangel gezeichneten Haut.
Obgleich er wusste, dass es nutzlos war, rannte Mark los, mühte sich ab; die Vorstellung, einfach zu der toten Frau zu schlendern, roch förmlich nach mangelndem Respekt. Auf Händen und Knien krabbelte er auf den Grat hinauf. Der einfachere, aber längere Weg um den Gipfel herum kam nicht infrage. Er blutete, als er sie endlich mit eigenen Augen sehen konnte, unter ihm eine Szenerie, von der die guten Bürger von Edinburgh in der Ferne nichts ahnten, über ihnen Arthur’s Seat. Ohne auf seine aufgeschürften Knie und die wunden Hände zu achten, schoss Mark den Geröllhang hinab und rief unterwegs nach der Fremden.
Wenige Meter entfernt war seine Drohne gestrandet, ein surrendes Durcheinander aus Plastik und Metall. Er hatte nicht einmal gemerkt, dass er die Fernbedienung weggeworfen hatte. Das Telefon in seiner Tasche spielte Katz und Maus mit seinen Fingern. Dann hatte er die Frau erreicht, kniete sich neben ihr auf den Boden und presste die Finger an ihren Hals, wohl wissend, dass ein Mensch, dessen Haut solch eine Farbe angenommen hatte, unmöglich einen Puls haben konnte. Obwohl er wusste, dass das Leben ihrem Körper entfleucht war, riss er sich den Wintermantel vom Leib, um ihre Blöße zu bedecken. Dann erst rief er die Polizei und beschrieb, so gut er nur konnte, ihre Position in der bergigen Landschaft, die majestätisch über Schottlands Hauptstadt wachte.
Von Nahem erkannte Mark, dass sie jünger war, als er angenommen hatte. Die nächtliche Kälte hatte ihr die rosige Farbe geraubt, die ihre Jugend hätte verraten können. Wie er, so dachte er, war sie in der unsicheren Kluft des Übergangs vom Teenager zur Erwachsenen. Ein winziger Diamant an der Seite ihrer Nase reflektierte die ersten Strahlen der winterlichen Morgensonne und fing sich in den blonden Strähnen in ihrem kupferroten Haar. Instinktiv wollte er ihr das Haar aus dem Gesicht streichen, konnte sich aber gerade noch zurückhalten. Dann hätte er ihre Augen deutlicher erkennen können, und das widerstrebte ihm. Mark stand auf und hielt über den Grat des Hügels Ausschau nach herannahenden Fahrzeugen, doch er hatte keine freie Sicht auf irgendeine Straße. Im Sommer – und ohne Leiche – wäre das hier ein intimes und geschütztes Idyll gewesen. Ein flatternder roter Fleck inmitten des Scheuerkrauts erregte seine Aufmerksamkeit.
»Ich bin in einer Minute zurück«, sagte er. Es kam ihm unhöflich vor, nichts zu sagen, auch wenn er es mit einer Toten zu tun hatte. Ohne seinen Mantel fing die Kälte an, ihm zuzusetzen. Er zwang sich zu joggen, um sich warmzuhalten. Dabei fragte er sich, wie lange die Polizei wohl brauchen würde, um diesen schwer zugänglichen Ort zu erreichen. Sein eigener Wagen parkte eine Meile entfernt am Fuß des Berges. Die steilen Hänge und die felsigen Fahrwege waren für alles andere als Allradfahrzeuge kaum zu bewältigen.
Der rote Fleck entpuppte sich als Hemdbluse, eine warme Hemdbluse, gefertigt aus schwerer Baumwolle, perfekt für eine Nacht am Feuer oder ein paar Drinks im Pub. Er hob das Teil auf und sah sich zu dem Mädchen um, schätzte grob ab, ob es ihm passen würde, und kam zu einem positiven Ergebnis. Einige Minuten Fußweg hangabwärts fand er einen Büstenhalter, der am vorstehenden Grat eines Felsens baumelte, leuchtend weiß mit einem Verschluss aus Metall, der sich unter seinen Fingern eiskalt anfühlte.
Mark hörte den Helikopter, ehe er ihn sah. Das Flap-flap der Rotorblätter hallte von den Felsen wider und versetzte die Tierwelt in Angst und Schrecken. Die Polizeimaschine kreiste, bestimmte die genaue Lage des Leichenfundorts und informierte die Einheiten, deren blaue Lichter erstmals in der Tiefe sichtbar wurden. Mark trug die Kleidung, die er gefunden hatte, den steilen Hang empor zu dem Mädchen.
Ein Gesicht tauchte über der Bergkuppe auf, gefolgt von zwei weiteren. Der Besitzer des ersten ging direkt auf Mark zu und streckte die Hand aus.
»Guten Morgen«, sagte er mit einem schwachen, aber unverkennbaren französischen Akzent. »Ich bin Detective Inspector Luc Callanach. Ich nehme an, Sie sind derjenige, der das hier gemeldet hat?« Mark nickte. »Entfernen wir uns ein Stück vom Fundort. Wie geht es Ihnen?«
»Weiß nicht so recht«, antwortete Mark. »Besser als diesem Mädchen, schätze ich.«
Besser als dem Mädchen ging es ihm allerdings, dachte Callanach. Im Stillen hoffte er, ihr Tod ginge auf einen Unfall zurück. Zugleich fragte er sich, wie viel Zeit er wohl damit zubringen würde, ihr Gesicht auf Fotos auf der Anschlagtafel im Lagezimmer anzustarren. Ob wohl je irgendein Mensch des Morgens erwachte und ahnte, dass er zu einem baldigen Tod bestimmt war?, überlegte er. Schauten die Leute einmal mehr in den Spiegel, ehe sie hastig ihr Zuhause verließen, um zur Arbeit oder zur Schule zu eilen, weil ihr Gefühl ihnen sagte, dass sich etwas im Universum verändert hatte? In einem Anfall vorübergehenden Zorns hasste er die Kälte in Schottland, die Feuchtigkeit und das ewige Grau. Das Mädchen war in Eiseskälte umgekommen, hatte zusehen können, wie sein letzter Atemzug wie ein Rauchfähnchen in die Luft aufstieg. Das war keine Art zu sterben. Es war ein bitteres, einsames Ende. Er konnte nur hoffen, dass sie nicht geahnt hatte, was auf sie zukam.
KAPITEL 3
Auch fünf Monate nach ihrer Beförderung litt Detective Chief Inspector Ava Turner immer noch an einem chronischen Hochstapler-Syndrom. Es lag nicht daran, dass sie nun so viele Leute unter sich hatte, oder an den Besprechungen, bei denen ihre Anwesenheit erwartet wurde, nicht einmal an ihrem neuen Büro. Der Grund war schlicht, dass sie das Gefühl hatte, nicht länger im Lagezimmer herumhängen zu können, um Kaffee zu trinken, die Ereignisse des Tages zu sezieren und, wenn die Umstände es erlaubten, ein wenig mit den Kollegen zu lachen. Was ihr noch weniger zusagte, war der Druck, der damit einherging, die öffentliche Sicherheit gegen das auf magische Weise schrumpfende Budget der Police Scotland auszubalancieren. Es fühlte sich an, als wäre das Wort »nein« neuerdings zu ihrer Standardantwort avanciert. Konnten sie sich einen weiteren Experten für einen bestimmten Fall leisten? Nein. Könnte das Major Investigation Team ein paar weitere Uniformierte zur Unterstützung der Ermittlungsarbeit bekommen? Nein. Könnten sie eine neue Software zur Auswertung von Filmmaterial aus Überwachungskameras testen? Wie zum Teufel mochte wohl die Antwort darauf lauten? Nicht, dass Ava es bedauert hätte, die Beförderung angenommen zu haben. Das Problem war eher, dass sich ihre Träume davon, Gutes zu tun und Verbrechen aufzuklären, mit jedem Schritt, der sie die Leiter weiter hinauftrug, in etwas zu verwandeln schienen, das einem tropfenden Wasserhahn ähnelte, nur dass anstelle von Wasser Enttäuschung herausrieselte.
Während sich ihr Berufsleben zunehmend unter den Augen der Öffentlichkeit abspielte, hatte ihr Privatleben eine geradezu trostlose Wendung genommen. Die Frauen und Männer des MIT empfanden die Distanz zwischen sich und ihrem Detective Chief Inspector als zu groß, um Ava zu ihren gelegentlichen Ausflügen in den Pub einzuladen, und sie selbst hätte sich verpflichtet gefühlt, sich zu entschuldigen, sollte doch eine Einladung ausgesprochen werden. Gleichrangige Kollegen waren zu sehr mit ihren Kindern oder Ehepartnern beschäftigt, um neue Kontakte zu knüpfen oder auszugehen, doch für Ava, mit Mitte dreißig die Jüngste unter ihnen und noch immer ledig, gab es keine derartige Zerstreuung. Ihre beste Freundin steckte in einer neuen Beziehung, schärfer als eine Carolina-Reaper-Chili, und würde erst wieder verfügbar sein, wenn ihr und ihrer neuesten Freundin irgendwann in den Sinn käme, dass sich die Welt außerhalb ihrer Schlafzimmertür immer noch weiterdrehte. Der Preis, den sie für den Erfolg zu zahlen hatte, bestand, wie es schien, aus endlos langen und einsamen Abenden. Ava starrte ihr Bürotelefon an, klug genug, sich gar nicht erst zu wünschen, es würde klingeln, denn sie wusste nur zu gut, dass die Erfüllung ihres Bedürfnisses nach Beschäftigung nur zulasten anderer gehen konnte.
Detective Sergeant Lively, ein Endfünfziger ohne das geringste Verständnis für das Konzept der Political Correctness, tauchte ohne zu klopfen in ihrem Büro auf. Ava überlegte, ob sie ihn daran erinnern sollte, dass man es als gutes Benehmen einstufen würde, wenn er seine Absicht einzutreten im Vorfeld durch ein Pochen ankündigte, war aber viel zu erfreut über die Gesellschaft, um irgendeinen Tadel auszusprechen.
»Haben Sie DI Callanach gefunden?«, fragte Ava.
»Habe ich. Zuerst haben wir die Toiletten überprüft. Normalerweise ist er nie weit von einem Spiegel entfernt. Aber dieses Mal war er überraschenderweise unterwegs, um sich echter Ermittlungsarbeit zu widmen, Ma’am.«
»Danke, DS Lively. Wenn Sie mit Ihren Sticheleien fertig sind, könnten Sie mir erzählen, mit welchem Fall Ihr Vorgesetzter befasst ist.«
Lively grinste. Er und Callanach hatten von Anfang an nicht die beste Beziehung gehabt, begnügten sich aber inzwischen damit, einander ganz zwanglos aus dem Weg zu gehen und nebenbei die eine oder andere Kränkung auszusprechen. »In den Hügeln oben bei Arthur’s Seat wurde eine Leiche gefunden. Eine Untersuchung wird zwar stattfinden müssen, aber ersten Berichten zufolge handelt es sich nicht um ein Verbrechen. Die Pathologin war bereits vor Ort und konnte keine offensichtlichen Verletzungen oder Anzeichen von Gewaltanwendung erkennen. Die Leiche wurde zur Autopsie abtransportiert. Nur die Identifizierung steht noch aus. Wie es momentan aussieht, wird das, wenn wir den Namen des Opfers ermittelt und die Familie informiert haben, ein ganz einfacher Fall werden. Nichts, worüber Sie sich den Kopf zerbrechen müssten, da bin ich sicher.«
»Mag sein. Würden Sie DI Callanach trotzdem bitten, mich zu unterrichten, sobald er zurück ist? Ich möchte auf dem Laufenden bleiben.« Ava musterte den Becher in DS Livelys Hand. »Es besteht wohl keine Chance, dass der für mich ist?«, fragte sie lächelnd.
Lively trank einen tiefen Schluck. »Sorry, Ma’am, ich hätte Ihnen ja einen gemacht, wüsste ich nicht, dass so etwas derzeit nicht gern gesehen ist. Sie wollen doch bestimmt niemanden auf den Gedanken bringen, Sie würden erwarten, dass das Fußvolk Sie mit Kaffee versorgt. Rächt sich schnell bei der modernen Polizeipraxis.« Damit ging er hinaus.
Ava lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück und verwünschte das Adrenalin, das ihr Körper bei der Erwähnung einer neuen Untersuchung produziert hatte. Dass Angehörige der Polizei sich langweilten, statt froh zu sein, wenn sie nichts zu tun hatten, stellte dem Apparat ein kümmerliches Zeugnis aus, und doch war es so. So tragisch es war, dass eine arme Seele auf Arthur’s Seat ihr Leben ausgehaucht hatte, und so dankbar Ava war, dass es keinen Hinweis auf ein Verbrechen gab, brauchte sie doch ein bisschen mehr zu tun als nur, sich vom jährlichen MIT-Dinner abzumelden.
Irgendein Spaßvogel hatte dafür gesorgt, dass es in diesem Jahr in einem französischen Restaurant stattfand – eine sarkastische Hommage an DI Callanach, nahm sie an. Sein halb französischer, halb schottischer Stammbaum machte ihn heute noch genauso sehr zur Zielscheibe alberner Witze wie vor einem Jahr, als er von Interpol zur Police Scotland gewechselt hatte. Aber sogar sein Akzent war kaum von Bedeutung in Anbetracht der Sticheleien, die er über sich hatte ergehen lassen müssen, als seine Truppe von seiner Vorgeschichte als Model erfahren hatte. Callanach hatte genau die Art von Gesicht, die nicht anzustarren äußerst schwer war, weshalb er sich beständig im Fokus weiblicher Betrachtung wiederfand. Seine dunklen Augen, die langen Wimpern, das kräftige Kinn und die olivfarbene Haut waren einfach nicht geeignet, um in der Menge unterzugehen, eine Tatsache, die Ava stets als amüsant empfand, wenn sie gemeinsam ausgingen. Oder ausgegangen waren, korrigierte sie sich in Gedanken. Seit ihrer Beförderung ergingen sie sich in einem peinlichen Spielchen, das darin bestand, einander immer wieder zu versichern, sie würden bald mal etwas zusammen unternehmen, ohne jedoch das Was oder Wann näher zu bestimmen.
Sie hatte gerade eine Hand auf das Telefon gelegt, um Callanach anzurufen und sich auf den neuesten Stand bringen zu lassen, als es unter ihren Fingern klingelte. Sie riss es ans Ohr. »Turner«, meldete sie sich.
»Meine Güte, könnten Sie bitte auf eine etwas gemäßigtere Art ans Telefon gehen? Es wäre mir lieb, wenn Leute, die beim Major Investigation Team anrufen, nicht annehmen müssten, Sie würden mitten in einer Krise stecken, noch ehe sie auch nur ihren Namen nennen können. Wir stecken doch nicht in einer Krise, oder?«, fragte Superintendent Overbeck.
»Nein, Ma’am«, entgegnete Ava. »Tut mir leid. Ich wollte nur gerade …«
»Schon gut, schon gut. Ich habe eine engere Auswahl unter den Bewerbern für die offene Stelle des Detective Inspectors getroffen. Ich dachte, Sie sollten Gelegenheit bekommen, sie durchzusehen, ehe wir mit den Vorstellungsgesprächen beginnen, also maile ich Ihnen die Liste heute Nachmittag. Es wäre hilfreich, wenn Sie mir Ihre Überlegungen morgen im Laufe des Tages mitteilen würden. Soweit ich weiß, sind Sie heute zu einem Umtrunk bei den City Fellows eingeladen, nehmen aber nicht teil. Wie kommt das?«
»Oh, das ist heute Abend? Ich habe einen Termin beim Physiotherapeuten. Ich wollte mir deswegen nicht freinehmen, also habe ich ihn auf den Abend gelegt. Wenn ich absage, muss ich wieder einen Monat warten«, sagte Ava, erleichtert, dass Superintendent Overbeck sie nur telefonisch ausfragte, nicht von Angesicht zu Angesicht. Trotz all der Jahre, in denen sie andere Leute bei Verhören überzeugend hatte lügen sehen, war es Ava immer noch nicht gelungen, diese spezielle Fertigkeit selbst zu perfektionieren.
»Verdammt richtig, Sie sollten sich auch nicht freinehmen, um sich eine schnelle Massage zu gönnen. Jetzt dürfte es zu spät sein, noch etwas zu ändern, aber ich erwarte, dass Sie in Zukunft daran denken, wie dieses Spiel läuft. Verpassen Sie nicht noch eine Einladung. Und halten Sie die Überstunden im nächsten Monat wieder auf einem niedrigen Niveau. Wir liegen zur Abwechslung innerhalb des Budgets, was bedeutet, dass der Ausschuss mir mal nicht die Hölle heißmacht, und dabei würde ich es gern belassen«, schoss Overbeck verbal aus dem Hinterhalt.
»Ja, Ma’am«, sagte Ava, aber die Leitung war bereits tot. Sie schickte Dr. Ailsa Lambert, Edinburghs Chefpathologin, eine Mail mit der Bitte um aktuelle Informationen über die Leiche von Arthur’s Seat, ehe sie sich ihrem heimlichen Vergnügen widmete und nachschaute, was gerade im Kino lief. Sie hatte eine Vorliebe für die Wiederaufführung alter Klassiker, die gelegentlich in den Nachtvorstellungen gezeigt wurden, aber derzeit war sie bereit, sich mit jedem Stumpfsinn zu begnügen. Und einer großen Portion Popcorn. Aber das Glück war auf ihrer Seite. Um 23.00 Uhr stand Sergio Leones Spiel mir das Lied vom Tod auf dem Programm. Ava hatte ein Date mit Charles Bronson, eine klare Verbesserung gegenüber einem weiteren Abend allein zu Hause und beinahe ein Lotteriegewinn verglichen mit der Cocktailparty der City Fellows. Die war so lästig wie langweilig, eine Veranstaltung, auf der sie damit rechnen musste, von achtzigjährigen Männern »Liebchen« genannt zu werden; Männern, die es für ihr gutes Recht hielten, einen aufzufordern, ihnen einen neuen Drink zu besorgen, wenn man nur einem anderen Geschlecht angehörte, und die über ihr Handicap beim Golf zu schwadronieren wünschten, während die Person anderen Geschlechts mit beeindruckter Miene stumm ihren Ausführungen zu lauschen hatte. Detective Superintendent Overbeck mochte in diesen beförderungsrelevanten Spielchen ja bewandert sein, sie selbst jedoch war nicht nur weniger tolerant, sie hatte auch nicht so viel Ehrgeiz.
Wieder wurde die Tür geöffnet, und DS Lively kehrte zurück.
»Verschonen Sie mich, ja?« Ava seufzte. »Falls Sie gekommen sind, um mich wegen des Kaffees zu verspotten, empfehle ich …« Da fiel ihr sein Gesichtsausdruck auf. Die gewöhnlich mürrische Grimasse, die stets zum Ausdruck brachte, dass er sich ungerecht behandelt fühlte, war erschlafft, dafür war sein Hals angespannt, und seine Gurgel war heftig in Bewegung, doch es kam kein Laut über seine Lippen. DS Lively tat, wie ihr nun bewusst wurde, sein verdammt Bestes, um die Tränen zurückzuhalten. »Raus damit«, sagte sie.
»Es geht um DCI Begbie«, sagte Lively. »Es tut mir leid.«
Ava erhob sich. Jetzt wusste sie, was die Mimik ihres Detective Sergeants zu bedeuten hatte, dennoch musste sie ihn die Worte sagen hören. »Hören Sie auf, sich zu entschuldigen, Lively, und spucken Sie es einfach aus.«
»Ma’am, ich weiß nicht genau, was passiert ist. Sein Wagen wurde gefunden. Zu spät, um noch irgendetwas zu unternehmen. Der Chief ist tot.«
Ava spürte einen stechenden Schmerz in ihrer Brust. Ihr blieb die Luft weg – sie war am Boden zerstört, eine Empfindung, die bemerkenswerte physische Auswirkungen zeitigte. Ihr ehemaliger Vorgesetzter und langjähriger Freund war nicht mehr da.
KAPITEL 4
Der Wind fegte von der Seite herbei, draußen am Gipsy Brae Recreation Ground im Norden der Stadt. Er trug Stimmen und Notizblöcke weg, peitschte durch Haare und ließ die Landschaft öde erscheinen. Die Straße war vor der Zufahrt zum Park abgesperrt worden. Ava saß in ihrem geparkten Fahrzeug und zögerte den Gang zu der Stelle hinaus, an der Begbies Wagen im Scheinwerferlicht stand. Der ehemalige Detective Chief Inspector George Begbie, der erst kürzlich in den Ruhestand gegangen war, war ein Bilderbuchpolizist gewesen. Manchmal griesgrämig, aber vor allem langmütig, geradeheraus und unermüdlich in seinem Einsatz im Namen der Opfer. In all den Jahren, in denen Ava für ihn gearbeitet hatte, hatte sie nie erlebt, dass er das, worauf es wirklich ankam, aus den Augen verloren hätte. Bei jedem Fall gab es jemanden, der verletzt worden war oder etwas verloren hatte. Der Chief hatte mit all seinem beachtlichen Einfluss für diese Menschen gekämpft, ohne sich um die hohen Tiere zu scheren, die ihm deswegen auf den Leib rücken wollten, ohne der Presse besondere Beachtung zu schenken oder sich um Politiker zu kümmern. Er war blitzgescheit gewesen, und er hatte nie von irgendeinem Officer erwartet, dass dieser mehr Stunden arbeitete, als er selbst leistete.
Es war Begbie, der Ava vor der Frauenfeindlichkeit geschützt hatte, die sie ihre Karriere als Detective hätte kosten können. Er hatte ihr einen Posten im Major Investigation Team gegeben und sie vor anderen, aussichtsreicheren Kandidaten befördert, sie aber auch vor gar nicht langer Zeit wegen eines Regelverstoßes für eine Weile suspendiert. Sie wusste, das zu tun war schmerzlich für ihn gewesen, denn aus Kollegen waren während langer Nächte an Tatorten und früh morgendlicher Einsätze bei personeller Unterbesetzung gute, verlässliche Freunde geworden. Sogar, als sie noch Junior Officer gewesen war, hatte er sie bei Besprechungen einbezogen, weil er ihr Potenzial erkannt hatte. Der Rest der Truppe hatte ihn gemocht, ja, bewundert, aber Ava war ihm so zugetan wie einem Lieblingsonkel. Einem, der sie dann und wann angebrüllt und gezwungen hatte, ohne Schlaf drei Tage durchzuarbeiten, der aber dennoch der Hauptgrund dafür war, dass sie sich für eine Karriere im Polizeidienst entschieden hatte. Sie wollte einfach nicht glauben, dass er nicht mehr da war.
Ava schloss ihren Wagen ab und ging los. Unterwegs überlegte sie, warum George Begbie, der ein Faible für beheizte Pubs und behagliche Sessel hatte, ausgerechnet diesen unwirtlichen Ort für seinen Abschied von der Welt gewählt hatte. Es schien ein furchtbar trostloses Ende für solch eine herausragende Persönlichkeit zu sein, gerade in diesem Park zu sterben, von dem der Blick hinausging auf die Nordsee, zur Linken Cramond Island, zur Rechten Granton Harbour, und sich nichts außer dem weiten, grauen Himmel in dem kalten Wasser spiegelte.
Am oberen Ende der schmalen Straße zum Meer, die als Zufahrtsweg für Wohnwagen und Wartungsfahrzeuge diente – und für Begbies alten Land Rover –, hielt sie inne. Er hatte das Auto abseits der Fußwege mit Blick auf die See abgestellt. Niemand würde sich ohne Weiteres einem einsamen Mann in einem Wagen nähern, umso weniger einem von so furchterregend großer Gestalt. Ava legte einen weißen Kittel, Schuhüberzüge und Handschuhe an, auch wenn das nun nicht mehr viel nützte. Vorbehaltlich der Autopsie war sein Tod bereits als Selbstmord eingestuft worden. Ein Schlauch war aus dem Wagenfenster gezogen worden. Sogar jetzt, da er harmlos im Gras lag, wirkte er heimtückisch auf sie. Ein Zelt war aufgebaut worden, um den Schauplatz abzuriegeln – vor allem, um neugierige Blicke abzuwehren, weniger zum Schutz der Beweise –, und die Silhouetten der Tatortermittler huschten geschäftig umher.
Während sie, die Hände in den Taschen vergraben, den sanften, grasbewachsenen Hang hinunterging, fiel ihr auf, dass es nun, da der Tag dunkler wurde, nicht mehr lange dauern würde, bis sie ein Scheinwerfergerüst aufbauen mussten, um den Schauplatz auszuleuchten. Ein junger Sergeant in makelloser Uniform, in dessen Gesicht sich tiefe Besorgnis spiegelte, kam auf sie zu.
»Kann ich bitte Ihren Ausweis sehen?«, fragte er.
Zu ermattet, um ihm zu erklären, wer sie war, reichte Ava ihm den Ausweis.
»Major Investigation Team?«, fragte der Officer. »Hätte nicht gedacht, dass das Ihr Territorium ist.«
»Sergeant, wenn Sie damit fertig sind, einem Detective Chief Inspector zu erklären, wo er sein und was er tun sollte, könnten Sie vielleicht diese Person, die da drüben ihren Hund ausführt, von der Wiese scheuchen. Und mich sprechen Sie mit Ma’am oder DCI an. An die Arbeit.«
»Ja, Ma’am«, sagte er, zog sich den Kragen seiner Jacke um den Hals und stemmte sich dem Wind entgegen.
Ava atmete tief durch. Sie verabscheute rüdes Verhalten, ganz besonders, wenn es auf Überlegenheit beruhte. Wenn Begbie sie in all den Jahren, in denen er ihr Vorgesetzter gewesen war, eines gelehrt hatte, dann dass mit dem Rang auch die Verantwortung wuchs, freundlich aufzutreten und zuzuhören. Also nahm sie sich vor, sich zu zügeln.
»Wo ist Dr. Lambert?«, erkundigte sie sich bei einer vorübergehenden Tatortermittlerin.
»Hat irgendwo anders zu tun«, entgegnete der weibliche Officer und trat um Ava herum, um sich ein frisches Paar Kunststoffhandschuhe aus einer Schachtel zu holen. Ava packte die Frau am Arm.
»Sie ist beschäftigt? Der Verstorbene ist ein ehemaliger Detective Chief Inspector. Er hat zwanzig Jahre lang Tatorte wie diesen untersucht, und jetzt hat er keine Priorität? Ich will wissen, was hier passiert ist. Auf keinen Fall hat George Begbie Selbstmord begangen.«
Die Ermittlerin befreite sich zähneknirschend aus Avas Griff und trat einen Schritt zurück. »Ein Minibus mit acht Kindern an Bord ist vor einer halben Stunde auf Glatteis geraten und von der Straße abgekommen. Zwei der Kinder sind tot. Das hat Dr. Lambert zur Priorität erklärt. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden.«
»Davon hatte ich noch nichts gehört«, erklärte Ava dem Rücken der Tatortspezialistin. »Tut mir leid.«
»DCI Turner?«, rief eine Stimme hinter ihr. Während die Frau sich entfernte, kam ein Mann mit ausgestreckter Hand auf sie zu. »Ich bin Chief Inspector Dimitri. Ich hatte nie das Vergnügen, mit George Begbie zu arbeiten, aber soweit ich weiß, hat er bei seinen Leuten großen Respekt genossen. Wie wäre es, wenn wir die Forensiker ihrer Arbeit überlassen? Ich komme mir in deren Gegenwart immer ziemlich überflüssig vor. Wenn Sie wollen, können wir in meinem Wagen warten.«
»Das wird nicht nötig sein, aber ich weiß Ihr Angebot zu schätzen«, erwiderte Ava. »Allerdings würde ich die Leiche gern vor Ort sehen. Wenn ich recht verstehe, ist das Ihr Fall.«
»Ich wurde damit beauftragt, mich um die Sache zu kümmern, auch wenn es nicht so aussieht, als gäbe es hier viel zu ermitteln.« Er unterbrach sich und schaute sich zu Begbies Wagen um. »Ich habe auch schon Kollegen verloren, und das ist schmerzhaft. Der Trick ist, keinen Kreuzzug daraus zu machen. Wenn man sich zu sehr den Kopf darüber zerbricht, führt man sich nur selbst in die Irre. Ich will Sie nicht vertreiben, aber das Beste, was Sie jetzt tun können, ist, uns die Sache zu überlassen. Sie können sich sicher sein, dass ich ihn mir ansehe, und wenn Sie irgendwelche Informationen haben wollen, müssen Sie nur fragen.«
Ava musterte den Chief Inspector, von dem sie zwar schon gehört hatte, dem sie aber noch nie begegnet war. Er hatte mit so leiser Stimme gesprochen, dass sie sich dabei ertappt hatte, den Kopf vorzurecken, um ihn zu verstehen. Aus der Nähe fielen ihr seine Augen auf. Sie waren von einem so fahlen Blau, es war schwer, den Blick von ihnen zu lösen. Sein Haar war weiß, was jedoch keine Folge des Alters war. Sie schätzte ihn auf Mitte fünfzig, auch wenn sein Gesicht anscheinend aus einem organischen Material gemeißelt worden war, das nicht alterte. Ehe sie etwas zu seinem Vorschlag sagen konnte, tauchte in der Nähe des Wagens eine Trage mit einem Leichensack auf, die zu einem wartenden Van gebracht wurde, der sie in die städtische Leichenhalle transportieren sollte. Ganz gleich, welche Mutmaßungen vor Ort angestellt worden waren, es würde trotzdem eine Autopsie geben.
»Ich begleite Sie zu Ihrem Wagen«, sagte Chief Inspector Dimitri.
»Nicht nötig.« Ava schüttelte den Kopf. »Sofern Sie nichts dagegen haben, würde ich George Begbies Frau gern persönlich unterrichten. Ich wüsste es trotzdem zu schätzen, wenn Ihre Officers später ihre Aussage aufnehmen. Aber heute Abend … ich kenne sie, und er würde wollen, dass sie es von einer Freundin erfährt.«
»Verständlich«, sagte Dimitri. »Die Fakten, die wenigen, die wir haben, beinhalten ein Paar, das den Küstenweg entlanggegangen ist und dabei Motorengeräusche wahrgenommen hat. Sie wollten eine Abkürzung zur Straße nehmen und sind erst vorbeigegangen; dann ist ihnen der Schlauch aufgefallen, der am Auspuff befestigt war. Sie haben eine Tür aufgerissen – anscheinend war die hintere Tür auf der Beifahrerseite unverschlossen –, aber da war es schon zu spät. Sie haben einen Krankenwagen und die Polizei gerufen. Die zuerst eingetroffenen Rettungskräfte haben das Nummernschild überprüfen lassen, so konnten wir ihn identifizieren. Ich wage es kaum zu sagen, aber das alles wirkt auf eine tragische Art normal. Auf dem Beifahrersitz liegt eine leere Flasche Whisky, das Radio war eingeschaltet. Keine Kampfspuren, keine eingeschlagenen Fenster oder aufgebrochenen Türen.«
»Danke für Ihr Entgegenkommen«, murmelte Ava. »Meine Leute werden am Boden zerstört sein. Sie informieren mich über Ihre Schlussfolgerungen?«
»Natürlich. Er ist in guten Händen, das verspreche ich«, beteuerte Dimitri.
Ava nickte, schob die Hände tief in ihre Taschen und stapfte davon. Ehe sie in ihren Wagen stieg, hielt sie einen Moment inne und betrachtete die donnernden Wogen der See, eine Macht, so zerstörerisch und brutal wie die Neuigkeit, die sie George Begbies Frau zu überbringen hatte.
Das Haus der Begbies lag östlich der Stadt in Portobello an der Ecke St. Mark’s Place und Argyle Crescent. Das im traditionellen Stil erbaute Haus, dessen einst braune Mauersteine sich durch Alterung und Niederschläge zunehmend schwarz verfärbt hatten, hob sich durch einen Erkerturm auf einer Seite von den Gebäuden in der Nachbarschaft ab. Ava erinnerte sich, wie der Chief gescherzt hatte, sein Haus sei wirklich seine Burg, und es sah auch in der Tat aus wie ein miniaturisierter Nachbau einer solchen. Er und seine Frau hatten das Haus geliebt. Sie waren vor zehn Jahren hergezogen, und soweit Ava wusste, hatten sie beabsichtigt, auch in Zukunft hier zu bleiben. Eine Zukunft, die abrupt zum Stillstand gekommen war. Wärme und gute Stimmung hatten das Haus ausgezeichnet, wann immer Ava die Begbies in der Vergangenheit aufgesucht hatte. Dieser Besuch würde all dem ein Ende bereiten. Nichts würde hier je wieder so sein wie zuvor, wenn Ava ihre furchtbare Nachricht erst abgeliefert hatte. Nicht für sie und ganz sicher nicht für Glynis Begbie. Eine Weile blieb sie im Wagen sitzen und lauschte, während Mark Knopfler von Schakalen und Raben sang, rechnete beinahe damit, Begbies Frau-Schrägstrich-Witwe würde zur Tür herauskommen, würde von einem sechsten Sinn hinaus auf die Straße und direkt zu Ava geführt werden. Doch sie tauchte nicht auf. Ava schaltete das Radio aus, vergewisserte sich, dass ihre Kleidung ordentlich saß, und ging über den Gartenweg die paar Schritte hinauf zum Haus.
»Ava! Wie schön, Sie zu sehen, meine Liebe. George hat mich nicht vorgewarnt, sonst hätte ich gebacken. Also wirklich, dieser Mann, ständig ist er so zerstreut …«
»Glynis«, fiel Ava ihr ins Wort. Dann schwieg sie für eine Sekunde, wartete auf den Fernsehmoment, wie Ava dieses Phänomen nannte, bei dem die bloße Präsenz eines Polizisten, der unerwartet auf der Schwelle erschien, Omen genug war, um Erkenntnis und Kummer hervorzubringen. Er trat nicht ein.
»Kommen Sie rein, schnell. Hier draußen werden Sie noch erfrieren. Vermutlich liegt es nur an meinem Alter, aber ich friere neuerdings ständig. Geben Sie mir Ihren Mantel. Ich rufe George auf seinem Handy an und hole ihn her. Er würde sich in den Hintern beißen, würde er Ihren Besuch verpassen.«
»Glynis«, sagte Ava erneut. »Wir sollten uns setzen.« Und da war es. Dieses vage Zaudern in ihrem Lächeln, das Blinzeln, ehe sie zu einer Antwort ansetzte.
»Natürlich. Gehen wir ins Wohnzimmer. Verzeihen Sie die Unordnung. Ich war gerade dabei, ein paar Karten zu schreiben. Sicher, dass Sie keine Tasse mit irgendetwas Heißem möchten?«
Ava setzte sich auf das Sofa und wartete, bis Glynis in einem Lehnsessel Platz genommen hatte.
»Es tut mir leid, dass ich Ihnen das sagen muss, aber George wurde tot in seinem Wagen aufgefunden. Erste Indizien deuten auf Suizid hin.«
Glynis’ Kiefermuskulatur erschlaffte, und ihre Brauen rückten näher zusammen. Kurz schüttelte sie den Kopf. Diesen Moment der Abwehr, der Weigerung, die Nachricht von einem Todesfall hinzunehmen, hatte Ava schon zu oft erlebt. Sie wartete darauf, dass Glynis etwas sagte. Das Erste, was die Leute in so einem Fall äußerten, war immer eine Frage. Wo? Wann? Wie? Und bei einem Selbstmord zumeist: Warum?
»Etwas war nicht in Ordnung«, sagte Glynis jedoch mit schwacher, zitternder Stimme.
Ava starrte sie an. »Wieder sein Herz? Hatte der Arzt schlechte Neuigkeiten für ihn?«
Glynis schüttelte den Kopf. »Nicht, soweit George es mir erzählt hat. Meines Wissens hatte er sich recht gut erholt. Aber während der letzten paar Wochen war er, ich weiß nicht, missmutig. Das hat gar nicht zu ihm gepasst.«
»Verzeihen Sie, dass ich frage, aber hatten Sie den Verdacht, er könnte eine Gefahr für sich selbst darstellen? Hat er etwas in der Art gesagt?«, erkundigte sich Ava.
»Nein. Nein, dann hätte ich mit jemandem darüber gesprochen. Wo ist er jetzt?«
»Auf dem Weg in die … sie bringen ihn zu Ailsa Lambert. Sie wird gut auf ihn aufpassen«, versprach Ava.
»Dafür ist es jetzt zu spät, nicht wahr? Sein Abendessen ist im Ofen. Jede Menge Grünzeug. Nichts, was viel Fett oder Zucker enthält. Er hat die Diät gehasst, die er seit dem Herzanfall einhalten musste, trotzdem hat er seinen Teller immer klaglos leer gegessen. Früher gab es bei uns jeden Freitag Sahnetorte, wissen Sie. Die hatten wir schon seit sechs Monaten nicht mehr. Ich glaube, die hat er am meisten vermisst.«
»Glynis, wie wäre es, wenn ich jemanden für Sie anrufe? Sie sollten Ihre Familie um sich haben.«
»Wenn es Ihnen nichts ausmacht, möchte ich erst George sehen. Es wird eine Autopsie geben, wenn ich nicht irre?«
»Ja«, flüsterte Ava.
»Wie hat er es getan?« Glynis presste die Lippen so fest zusammen, dass sie eine bebende Linie in ihr Gesicht zeichneten.
»Auspuffgase«, sagte Ava. Glynis versuchte, von ihrem Sessel aufzustehen, taumelte und sank wieder zurück. »Ich hole Ihnen ein Glas Wasser. Versuchen Sie nicht, aufzustehen.« Sie ging in die Küche. Gerade, als sie auf der Suche nach einem Glas angefangen hatte, Schränke zu öffnen, hörte sie hinter sich schlurfende Schritte.
»Hat er gelitten? Ich will die Wahrheit hören, Ava. Ich war fünfunddreißig Jahre mit einem Polizisten verheiratet. Mich anzulügen hat keinen Sinn.«
Ava ließ das kalte Wasser laufen, um sicherzustellen, dass das, was sie einschenkte, frisch war, während sie überlegte, was sie antworten sollte. George Begbies Frau war nicht dumm, und die Details der Fälle, die das MIT bearbeitete, waren ihr sicher nicht entgangen. Das war das Kreuz, das die Ehe mit einem Polizisten mit sich brachte.
»Kopfschmerzen, Übelkeit. Er muss sich schwach gefühlt haben. Vermutlich hat er auch ein Gefühl von Panik erlebt, falls er noch bei Bewusstsein war, als sein Körper den Sauerstoffentzug registriert hat. Er könnte auch Brustschmerzen gehabt haben, besonders in Anbetracht seiner Vorgeschichte. Am Ende vielleicht Krampfanfälle«, erklärte Ava. »Es tut mir so leid. Ich wünschte …«
»Bitte nicht«, unterbrach Glynis. »Ich hätte jetzt gern das Wasser.«
Ava reichte ihr das Glas, lehnte sich an den Küchenschrank und massierte sich die Schläfen.
»Sie sagten, etwas wäre nicht in Ordnung gewesen. Können Sie das genauer ausführen?«, fragte Ava.
»Da gab es ein paar Anrufe, spät am Abend. Einige auf seinem Handy und mindestens einer auf dem Festnetzanschluss. Er hat mir nie gesagt, wer dran war. Hat Witze gerissen, um mich davon abzulenken. Einmal, als wir einkaufen waren, hat jemand ein Paket vor unserer Haustür hinterlassen. Keine Beschriftung. Ich habe ihm gesagt, er soll die Polizei rufen. Er wusste, dass er immer noch gefährdet war angesichts der Anzahl der Leute, die er hinter Gitter gebracht hat. Er hat das Paket mit in seinen Schuppen genommen und mir erzählt, es wären nur irgendwelche wertlosen Gratisproben drin gewesen. Aber ich habe immer gewusst, wann er lügt.«
»Und Sie denken, was immer es war, könnte ihm einen ausreichenden Grund geliefert haben, um …« Ava brach ab.
»George hat Selbstmorde gehasst. Er hat gesagt, das wäre das Grausamste, was man einem anderen Menschen antun kann. Wenn Sie recht haben und er das getan hat, dann habe ich keine Ahnung, wer der Mann war, mit dem ich mehr als die Hälfte meines Lebens verbracht habe. Ich möchte jetzt bitte zu ihm.«
Eine halbe Stunde später trafen sie an der Edinburgh City Mortuary ein. Dr. Ailsa Lambert empfing sie bereits an der Tür und nahm Glynis in die Arme. Ailsa kämpfte selbst mit den Tränen, als sie sie in den Autopsiesaal führte. Auf einem der stählernen Tische lag ein mit einem Laken abgedeckter Leichnam.
»Es tut mir leid, dass ich Ihnen keine geeignetere Umgebung als diesen Saal anbieten kann. Alle anderen Räume sind derzeit belegt. Sind Sie sicher, dass Sie bereit dafür sind, Glynis? Ich kann ihn selbst offiziell identifizieren. Das muss nicht die letzte Erinnerung sein, die Sie an George behalten werden«, sagte Ailsa.
»Ich muss das tun«, erwiderte Glynis, zerdrückte ein Taschentuch in ihrer Hand und starrte den verhüllten Leib des Mannes an, den sie jahrzehntelang geliebt hatte.
Ailsa zog das Laken zurück, sodass der Kopf und die nackten Schultern zum Vorschein kamen. Glynis holte hörbar Luft, und Ava legte ihr den Arm um die Schultern. Am liebsten hätte sie weggeschaut, aber für solch ein Duckmäusertum gab es keinen Spielraum, solange Glynis so tapfer sein musste. Dennoch war es schauderhaft hinzusehen. Der Tod war nie so endgültig wie dann, wenn man ihm direkt ins Gesicht blicken musste. Ava hasste es, das Kinn des Chiefs so erschlafft zu sehen, die Art, wie seine Wangen zu seinen Ohren gesackt waren, als hätte sein Körper keine Lust mehr, so zu tun, als wäre er menschlich. Das Leben hatte ihn buchstäblich verlassen.
»Warum ist er so rot?«, fragte Glynis.
»Kohlenmonoxid kann nach dem Tod diese Auswirkung haben«, erklärte Ailsa. »Können Sie bestätigen, dass dies George ist?«
»Er ist es«, sagte Glynis. »O Gott, er ist es wirklich.« Damit machte sie kehrt und ging zur Tür hinaus in den Korridor. Ava ließ sie ziehen.
»Hatten Sie schon Gelegenheit, einen Blick auf ihn zu werfen, Ailsa? Können Sie mir schon irgendwelche Informationen liefern?«, fragte sie.
»Ich hatte nur ein paar Minuten. Heute ist viel los.« Ailsa deckte Begbies Gesicht wieder mit dem Laken zu.
»Hab ich gehört«, sagte Ava. »Tut mir leid. Es muss derzeit eine Menge Familien geben, die Sie brauchen.«
»Die gibt es, aber George war ein Freund. Ich habe schon mit ihm zusammengearbeitet, als Sie noch zur Schule gegangen sind. Nie hätte ich gedacht, dass ich einmal gebeten werde, eine Autopsie an ihm durchzuführen. Aber er weist die klassischen Symptome eines Selbstmords durch die Inhalation von Kohlenmonoxid auf. Diese kirschrote Hautfarbe? Bedeutet, dass er das Gas eingeatmet hat. Wenn Sie also hoffen, ich würde Ihnen sagen, jemand hätte ihn ermordet und dann in den Wagen gelegt, muss ich Sie enttäuschen. Er hat keine erkennbaren Wunden. Er war im Wagen nicht gefesselt, und er hat sich nicht zur Wehr gesetzt.«
»Nichts?«, fragte Ava. »Wirklich gar nichts, Ailsa? Sie kannten ihn besser als ich, und ich weiß, der Chief hätte niemals diesen Ausweg gewählt.«
»So etwas kann man nie wissen. Menschen zerbrechen, Ava. Sie bekommen schlechte Nachrichten, erleiden einen Verlust, hören auf zu arbeiten und empfinden ihr Leben plötzlich als leer. Sie schauen eines Tages in den Spiegel und stellen fest, dass sie alt geworden sind, und das jagt ihnen höllische Angst ein.«
»Es ist feige«, sagte Ava. »So etwas war unter seiner Würde.«
»Suizid ist die menschlichste und einsamste Tat, die man sich vorstellen kann. Es steht Ihnen nicht zu, über ihn zu urteilen.«
Stille trat ein. Ava streckte die Hand nach dem großen Mann unter dem Laken aus, zog sie wieder weg und drehte sich zur Wand um.
»Ich weiß, tut mir leid. Ich habe es nicht so gemeint, Ailsa. Ich habe nur das Gefühl, ich hätte ihn irgendwie im Stich gelassen. Ich hätte ihn nach seinem Herzanfall öfter besuchen müssen. Ich hätte mich vergewissern sollen, ob er zurechtkam. Aber ich habe einfach weitergemacht wie eh und je und hatte immer zu viel zu tun.«
»Bei einem Selbstmord neigen die Hinterbliebenen dazu, das Ganze auf sich zu beziehen – darauf, was sie unterlassen oder vergessen haben. Aber dabei geht es nicht um Sie, Ava. Es geht auch nicht um Glynis oder um ihre Kinder oder um irgendjemand anderen. Es geht allein um die Lage, in der George sich befunden hat. Um ehrlich zu sein, erwarte ich nicht, bei der Autopsie etwas Neues herauszufinden, trotzdem werde ich mich mit seinem Arzt in Verbindung setzen und mich nach Diagnosen jüngerer Zeit erkundigen. Sein Körper weist keinerlei Auffälligkeiten auf, abgesehen von dem hier.« Ailsa ging um den Tisch herum, um das Laken auf der linken Seite von George Begbies Leiche anzuheben. »Hier, auf der Innenseite des Handgelenks – man kann es wegen der Rötung kaum erkennen, aber es sieht aus wie Buchstaben, wenn auch etwas plump ausgeführte. Ein großes K neben einem kleinen c. Ich glaube, sie wurden in die Haut gekratzt.«
»Sagt mir gar nichts«, bekundete Ava. »K c. Ich sehe mir das an, aber jetzt sollte ich besser erst einmal Glynis nach Hause bringen. Sie hat gleichmütiger reagiert, als ich es erwartet habe, andererseits steht sie natürlich unter Schock. Außerdem war sie die Ehefrau eines wirklich altgedienten Polizisten. Vermutlich hat sie jahrelang unterschwellig damit gerechnet, dass jemand an ihre Tür klopft, um ihr von seinem Tod zu berichten. Es wird eine Weile dauern, bis das richtig angekommen ist. Und sie wird den Rest der Familie informieren müssen. Sagen Sie mir bitte Bescheid, wenn der Autopsiebericht vorliegt.«
»Natürlich. Sie sollten auch nach Hause gehen und sich ein bisschen ausruhen. Wenn Tage wie dieser uns irgendetwas lehren, dann, dass man nie weiß, was die Zukunft bringt. Jeder Augenblick zählt.«
KAPITEL 5
»Ich w…will mich freiwillig melden«, sagte der Mann, dessen Adamsapfel sich weitgehend unabhängig vom Rest seines Körpers zu bewegen schien.
»Sie wissen aber, dass es keine Bezahlung gibt, oder? Momentan haben wir keine richtigen Stellen offen«, informierte ihn eine Frau, ausstaffiert mit Klamotten, wie man sie normalerweise nur auf den die Augen beleidigenden Laufstegen der London Fashion Week zu sehen bekam.
»Das w…weiß ich. Ich bin nicht w…wegen des Geldes hier. Ich möchte nur w…wirklich helfen. Das, was Sie hier machen, ist eine gute Sache«, entgegnete er.
»Dann haben Sie andere Möglichkeiten, Ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, und müssen nicht des Geldes wegen arbeiten, ja?«, fragte die Frau. Dabei musterte sie ihn auf eine Weise, die Zweifel signalisierte, vom Scheitel bis zur Sohle.
»Ich arbeite noch w…woanders«, murmelte er. »Ich dachte nur, ich könnte ein paar Stunden in der W…woche einen Beitrag leisten. Und w…wenn ich nur Kaffee mache oder so.«
Noch während er sprach, zog sie seufzend ein Blatt Papier aus einer Schublade, drückte auf das Ende eines Kugelschreibers und wartete darauf, dass er seinen Satz beendete.
»Ich kann Ihren Namen notieren, aber ich weiß nicht, ob wir etwas für Sie haben.«
»Schon gut, Sian, ich übernehme das. Danke«, ging eine andere Frau dazwischen und legte dem Modedesaster mit einem sanften Lächeln behutsam eine Hand auf die Schulter. »Warum gehen wir nicht in mein Büro? Ich bin Cordelia Muir. Und Sie sind?«
»Jeremy«, sagte er und spürte, wie eine Last von ihm abfiel, als er ihr folgte. Sie musste zwischen vierzig und fünfzig sein. Dank ihres Knochenbaus, ihrer schlanken Gestalt und sorgfältiger Hautpflege war ihr Alter schwer einzuschätzen. Die Medien nannten diverse Zahlen, die man allesamt mit Vorsicht genießen sollte, aber sie waren sich alle darüber einig, wie viel Gutes ihre Wohltätigkeitsorganisation in einer Vielzahl afrikanischer Länder bewirkte. Crystal war eine Initiative für sauberes Trinkwasser, die es sich zum Ziel gesetzt hatte, Gemeinden im Brunnenbau auszubilden und anschließend dabei zu unterstützen, ihrerseits ihre Nachbardörfer anzuleiten. So bauten sie nach und nach ein Netzwerk auf, das für eine sichere, umweltverträgliche Wassergewinnung sorgen und sich ausbreiten sollte wie ein lebenspendendes Spinnennetz, das dazu diente, das Leben der Menschen zu verändern und ihre Zukunft zu sichern.
»Also, Jeremy, ich muss sagen, es ist sehr selbstlos, dass Sie sich als freiwilliger Helfer zur Verfügung stellen wollen. Sian kümmert sich um die alltäglichen Verwaltungsarbeiten und hat ein recht starres Weltbild, aber sie meint es nicht böse. Ich hoffe, sie hat Sie nicht verprellt, aber es war richtig von ihr, Sie darauf hinzuweisen, dass wir Sie nicht bezahlen können. Wir haben nur begrenzte Mittel, und ich achte darauf, dass ein möglichst großer Anteil der Spenden sein vorgesehenes Ziel erreicht. Für teure Büroräume und endlos viele Mitarbeiter bin ich nicht zu haben.«
»Darum bin ich hier«, sagte Jeremy und starrte in seinen Schoß. »Ich habe von Ihnen gelesen. Des…w…w…wegen möchte ich helfen. Sie scheinen …« Er blinzelte einige Male und nagte an seiner Unterlippe. »Sie scheinen ein guter Mensch zu sein.«
»Das ist sehr nett von Ihnen«, sagte sie. »Und wenn Sie es ernst meinen und wirklich helfen wollen, würde ich mich freuen, Sie hier zu haben. Können Sie mir ein bisschen über sich erzählen? Wie alt sind Sie?«
Jeremy errötete, holte tief Luft und bereitete sich mental darauf vor, ihr in die Augen zu sehen. »Fünfundzwanzig«, sagte er. »Und ich helfe Leuten gern.« Er sprach nun langsam, bedächtig, wog jedes Wort genau ab. »Ich w…war ein Pflegekind. Nette Leute. Ich w…würde gern etwas zurückgeben. Manchmal mache ich Gartenarbeiten, aber die sind nicht so gefragt im W…winter.«
»Nachvollziehbar«, antwortete Cordelia leise. »Ich verstehe, was Sie meinen, wenn Sie sagen, Sie wollen etwas zurückgeben. Ich habe viel Glück im Leben gehabt. Meine Eltern waren beide Kenianer, aber sie stammten aus wohlhabenden Familien. Sie haben mich hergebracht, als ich gerade vier war, zu einer Zeit, als die Rassenintegration noch lange nicht vollzogen war. Mein Vater hat im Finanzwesen gearbeitet. Ich wurde auf eine gute Schule geschickt, durfte Ferien im Ausland machen und konnte studieren, ohne Schulden machen zu müssen. Nach meinem Abschluss bin ich in einem Konzern gelandet und habe haufenweise Geld für Leute erwirtschaftet, die nicht mehr gebraucht haben, als sie längst hatten. Das hatte ich wohl irgendwann einfach satt. Ich wollte meinem Leben mehr Sinn geben, und hier bin ich. Dazu beizutragen, das Leben der Menschen in Afrika zu verbessern, fühlt sich an, als hätte sich für mich der Kreis geschlossen. Was für mich mehr als alles andere zählt, ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die eine positive Einstellung mitbringen und den Wunsch haben, Gutes zu tun. Wie wäre es, wenn Sie nächste Woche vorbeikommen, ein paar Stunden mit uns verbringen, dann können Sie unsere Arbeit kennenlernen und sehen, wie Sie da hineinpassen, und wenn es Ihnen gefällt, können wir mehr daraus machen? Bis dahin sollten Sie einen Personalbogen mit ein paar Detailfragen und Angaben zu Referenzen ausfüllen, falls Sie welche haben.«
»Habe ich«, sagte Jeremy verhalten lächelnd.
»Wie wäre es, wenn ich Ihnen einen Kaffee mache, ehe Sie gehen, damit Sie gleich wissen, wie schlecht ich darin bin? Alle hier werden begeistert sein, wenn jemand anders als ich die Verantwortung für die Kanne übernimmt.«
Sie reichte Jeremy ein Formular, in dem wesentliche Daten abgefragt wurden – Adresse, Sozialversicherungsnummer, Telefon, nächster Verwandter im Falle eines Notfalls –, und einen Stift und verschwand dann nach draußen, um mit Tassen und Teelöffeln in der Spüle zu klappern. Rasch füllte er das Formular aus, ehe er sich in Cordelia Muirs Büro umschaute. Ein Familienfoto hatte einen Ehrenplatz auf ihrem Schreibtisch. Es zeigte sie und ihre Kinder, ein älteres Mädchen und einen Jungen. Angesichts dessen, wie sich Cordelia verändert hatte, musste es schon vor einer ganzen Weile aufgenommen worden sein. Außerdem hatte Jeremy bei seinen Nachforschungen festgestellt, dass ihre Tochter ausgezogen war und zur Universität ging, während ihr Sohn noch die Oberstufe in Edinburgh besuchte. Während er durch die Glasscheibe zusah, wie sie die Kühlschranktür öffnete, um einen Milchkarton hineinzustellen, fragte er sich, ob es ihr wohl etwas ausmachen würde, wenn er das Foto zur Hand nähme.
»Sie haben sehr hübsche Kinder«, bemerkte Jeremy, als sie mit zwei Bechern in der Hand wieder hereinkam.
»Danke«, antwortete sie und stellte die dampfende Flüssigkeit vor ihm ab. Dass er ihr kostbares Bild in der Hand hatte, schien sie nicht zu stören. »Mein Mann ist vor ein paar Jahren verstorben. Er war schon todkrank, als wir dieses Foto gemacht haben. Meine Tochter ist besser damit zurechtgekommen als mein Sohn. Randall ist erst siebzehn. Ich glaube, Jungs brauchen einen Mann, der sie beim Erwachsenwerden unterstützt.« Sie lächelte.
»Mein Vater ist gestorben, als ich zwei w…war«, sagte Jeremy und stellte das Foto zurück auf den Tisch. »Er und meine Mutter hatten einen Unfall mit einem Reisebus. Meine Pflegeeltern haben sich w…wirklich Mühe gegeben, aber die Teenagerzeit war hart. Ich w…war damals nicht sehr umgänglich.«
»Ich bin sicher, Sie waren nicht schlimmer als andere Jungs in dem Alter, und für Sie muss es schwerer gewesen sein als für die meisten. Ihre Eltern wären heute stolz auf Sie.« Wieder lächelte sie. »Sie haben das Formular schon ausgefüllt? Wunderbar. Wie wäre es, wenn Sie Montagmorgen herkämen? Ich beginne mit einem neuen Projekt und könnte ein bisschen Hilfe dabei brauchen. Nichts besonders Glanzvolles, fürchte ich, aber ich würde mich freuen, wenn Sie dabei wären.«
Jeremy strahlte und nahm mit zitternden Händen einen Schluck von seinem Kaffee.
»Das w…wäre toll«, sagte er. »Vielen Dank, Mrs Muir.«
»Cordelia. Hier reden wir uns mit Vornamen an«, entgegnete sie. »Mir ist, als hätte das Schicksal Sie zu uns geschickt, Jeremy. Ich glaube fest an das Schicksal. Willkommen im Team.«
Auf dem Revier wartete DI Callanach bereits in Ava Turners Büro. Als sie eintrat, erhob er sich.
»Luc«, sagte sie. »Was gibt es Neues über die Leiche bei Arthur’s Seat?«
»Nicht viel, Ma’am«, antwortete Callanach und setzte sich wieder, nachdem sie ihm mit einem Wink bedeutet hatte, er möge wieder Platz nehmen.
»Könntest du bitte aufhören, mich Ma’am zu nennen? Ich meine, ja, in Gegenwart anderer Leute schon, aber nicht, wenn wir unter uns sind. Du weißt, dass mir das unangenehm ist.«
»Mir ist es unangenehm, es nicht zu tun«, erwiderte er. »Ich habe das mit dem Chief gehört und wollte sehen, wie es dir geht, schauen, ob ich irgendwie helfen kann.«
»Du willst dich mit mir bis zum Umfallen besaufen, dafür sorgen, dass ich sicher nach Hause komme, mein Haar halten, während ich mich übergebe, und dann die ganze Nacht an meinem Bett sitzen, um sicherzustellen, dass ich nicht ersticke?« Ava legte den Kopf auf den Schreibtisch. »Gott, tut mir leid. Keine Ahnung, wo das herkam. Wissen alle Bescheid?«
»Sergeant Lively weiß es«, entgegnete Luc. »Also hätte es ebenso gut im Rundfunk gesendet werden können. Und, ja, will ich, wenn es das ist, was du brauchst.« Ava sah ihn verdattert an. »Dein Haar halten und sicherstellen, dass du nicht erstickst.«
»Ich bin sicher, du weißt Besseres mit deinem Abend anzufangen«, sagte Ava, obwohl sie annahm, dass das vermutlich nicht der Fall war. Callanach hatte das Aussehen eines Models, was in der Öffentlichkeit regelmäßig dafür sorgte, dass sich die Leute nach ihm umblickten, aber seit ihn während seiner Zeit bei Interpol eine Kollegin fälschlich der Vergewaltigung beschuldigt hatte, führte er im Privaten ein sehr zurückgezogenes Leben. »Ich muss sowieso arbeiten. Erzähl mir von dem Mädchen bei Arthur’s Seat.«
»Ihr Name ist Lily Eustis, neunzehn. Hat zwischen Schule und Universität ein Jahr Pause eingelegt, um Geld für die Studiengebühren anzusparen. Nächsten September hätte sie ihr Medizinstudium an der St. Andrews aufnehmen sollen. Ihre Familie wurde benachrichtigt. Mum, Dad, eine Schwester. Ich war vor Ort, aber es sieht nicht so aus, als wäre dies eine Angelegenheit für das Major Investigation Team. Ersten Untersuchungsergebnissen zufolge ist sie an Unterkühlung gestorben.«
»Wie ist sie überhaupt da raufgekommen?«, wollte Ava wissen.