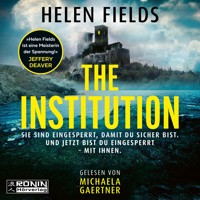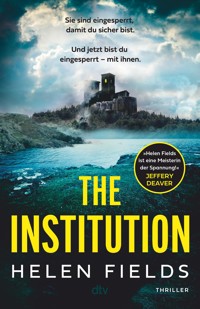9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Luc Callanach und Ava Turner
- Sprache: Deutsch
Am Stadtrand von Edinburgh wird die Leiche von Zoey Cole gefunden. Sie wurde entführt, festgehalten und dann ermordet. Bei der Obduktion wird klar, dass der Täter ihr zwei Hautstücke entfernt hat. DI Luc Callanach und seine Chefin DCI Ava Turner nehmen die Ermittlungen auf, doch der Täter hat kaum Spuren hinterlassen. Dann verschwindet eine weitere Frau, und ihr Baby wird zurückgelassen in einer Seitenstraße gefunden. Im Kinderwagen liegt eine Puppe — genäht aus der Haut von Zoey Cole ...
"Schonungslos rasant und teuflisch clever" Chris Brookmyre
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 659
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungKapitel einsKapitel zweiKapitel dreiKapitel vierKapitel fünfKapitel sechsKapitel siebenKapitel achtKapitel neunKapitel zehnKapitel elfKapitel zwölfKapitel dreizehnKapitel vierzehnKapitel fünfzehnKapitel sechzehnKapitel siebzehnKapitel achtzehnKapitel neunzehnKapitel zwanzigKapitel einundzwanzigKapitel zweiundzwanzigKapitel dreiundzwanzigKapitel vierundzwanzigKapitel fünfundzwanzigKapitel sechsundzwanzigKapitel siebenundzwanzigKapitel achtundzwanzigKapitel neunundzwanzigKapitel dreißigKapitel einunddreißigKapitel zweiunddreißigKapitel dreiunddreißigKapitel vierunddreißigKapitel fünfunddreißigKapitel sechsunddreißigKapitel siebenunddreißigKapitel achtunddreißigKapitel neununddreißigKapitel vierzigKapitel einundvierzigKapitel zweiundvierzigKapitel dreiundvierzigKapitel vierundvierzigKapitel fünfundvierzigKapitel sechsundvierzigKapitel siebenundvierzigKapitel achtundvierzigKapitel neunundvierzigKapitel fünfzigDanksagungÜber dieses Buch
Am Stadtrand von Edinburgh wird die Leiche von Zoey Cole gefunden. Sie wurde entführt, festgehalten und dann ermordet. Bei der Obduktion wird klar, dass der Täter ihr zwei Hautstücke entfernt hat. DI Luc Callanach und seine Chefin DCI Ava Turner nehmen die Ermittlungen auf, doch der Täter hat kaum Spuren hinterlassen. Dann verschwindet eine weitere Frau, und ihr Baby wird zurückgelassen in einer Seitenstraße gefunden. Im Kinderwagen liegt eine Puppe – genäht aus der Haut von Zoey Cole …
Über die Autorin
Helen Fields studierte Jura an der Universität von East Anglia in Norwich, lernte an der Inns of Court School of Law in London und arbeitete anschließend dreizehn Jahre als Anwältin. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes widmete sie sich neuen Aufgaben und leitet heute mit ihrem Ehemann eine Filmproduktionsfirma. Sie arbeitet als Produzentin und Autorin für Drehbücher und Romane. Die perfekte Gefährtin war ihr Debütroman. Fields lebt mit ihrem Ehemann und drei Kindern in Hampshire.
HELEN FIELDS
DIE PERFEKTE SÜNDE
Thriller
Aus dem Englischen von Frauke Meier
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2018 by Helen Fields
Titel der englischen Originalausgabe: »Perfect Silence«
Originalverlag: Avon, A division of HarperCollinsPublishers, London
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Alexander Groß, München
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille
Unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock: Flik47 | Alex James Bramwell | kakteen | Laboko | leoks | Thomas Dekiere | Chansom Pantip | Gino Santa Maria | photolinc | jps
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-9442-9
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Für Gabriel
Wenn ich dich ansehe, dann sehe ich den Mann, der du werden wirst.
Dieser Mann ist liebenswürdig und loyal, stark und sanft zugleich, standhaft und charakterfest.
Er ist ein Anführer.
Du kannst dir nicht vorstellen, wie stolz ich auf dich bin.
Kapitel eins
Zoey
Haut schliff über Stein. Schotter bohrte sich in rohes Fleisch. Doch Zoey kroch weiter.
Der Tod war ein Ghul in der Finsternis, der mit scharrenden Schritten hinter ihr herschlich. Bald würden seine eisigen Finger auf ihrer Schulter landen. Dann würde sie verharren. Doch sie würde erst aufgeben, wenn kein Tropfen Blut mehr in ihrem Körper wäre. Sie war dankbar für die pechrabenschwarze Dunkelheit dieser Herbstnacht, die es ihr ersparte, die groteske Masse zu sehen, die von ihrem eigenen Körper übrig war. Nun ließ sogar die wenige Kraft, die in ihren Oberarmen verblieben war, nach. Auf den Ellbogen schleppte sie sich vorwärts, und noch immer pulsierte Hoffnung durch ihre Adern, wo einst Blut geflossen war.
Böses Mädchen, dachte sie. Der Mann hatte ihr versprochen, sie dürfe weiterleben, wenn sie nur gestand. »Böses Mädchen«, flüsterte Zoey am Boden liegend. Sie wollte so unbedingt weiterleben.
Schmerz überwältigte sie. Gedemütigt von dem niederschmetternden Ausmaß der Qualen ließ sie ihr Gesicht auf die Erde am Straßenrand sinken. Bis zu diesem Tag hatte sie sich für eine Art Schmerzexpertin gehalten. Da hatte es gebrochene Knochen gegeben, ein geplatztes Trommelfell, eine kaputte Nase, aber nichts von alldem hatte ihr auch nur eine Ahnung davon vermitteln können, welche Leiden ein menschlicher Körper erdulden konnte, ehe der Tod ihn erlöste.
Mühsam hob sie den Kopf von dem harten Boden und zwang ihr unwilliges Knie, noch ein paar Zentimeter weiterzurutschen. Jemand würde kommen, dachte sie. Bald würde irgendjemand kommen. Aber das dachte sie schon seit Tagen. Wo waren all diese Leinwandhelden, die gerade noch rechtzeitig zu Hilfe eilten, wenn man sie wirklich mal brauchte?
An einem Sonntagnachmittag war sie aus ihrem gewöhnlichen Leben gerissen und in diesen Albtraum gestürzt worden, der nun schon eine Woche anhielt. Die Zeit selbst hatte sich verwandelt wie in einem Zerrspiegel; grotesk aufgebläht war sie unendlich langsam verstrichen, während Zoey traurig darauf wartete, dass ihre Gefangenschaft endete, nur um zu zersplittern und sich in nichts aufzulösen, als das Ende schließlich in Sicht war – ihr Ende.
Tagelang hatte Zoey in schwachem Licht auf einem kalten, harten Tisch gelegen. Der grausame Witz dabei war, dass sie gefüttert und mit Wasser versorgt worden war und ihr kaum etwas zugestoßen war, bis das Ende kam. Als wäre das nicht krank genug, hatte sie sich auch noch gestattet zu glauben, sie könnte überleben. Jahrelang hatte sie Horrorfilme konsumiert, sich etwas darauf eingebildet, im Voraus zu erkennen, welche Figur sterben und welche überleben würde, und doch war sie nun selbst in diese uralte Falle getappt. Sie hatte sich gestattet zu glauben, was ihr gesagt wurde, nur um die nächste Sekunde zu überstehen, die nächste Minute, die nächste Stunde, ohne dass das Entsetzen sie im Innersten zerfraß.
Zoey betrachtete Furcht jetzt aus einer neuen Perspektive. Da gab es vieles, was sie den anderen Frauen im Zentrum zum Schutz vor häuslicher Gewalt nun hätte beibringen können. Nicht, dass sie je Gelegenheit dazu haben würde. Schmerz raste von ihrer Wirbelsäule in ihren Bauch, als wäre sie von einem Speer durchbohrt worden. Der Schrei, den sie ausstieß, hörte sich weniger menschlich als animalisch an, als er vom Asphalt widerhallte und sein Echo die Landstraße hinabjagte. Niemand kam. Mit dieser Erkenntnis ging eine neue Klarheit einher. Man hatte sie nicht mitten in der Nacht am Straßenrand abgeladen, um ihr eine Überlebenschance einzuräumen. Nein, dies war ihre finale Strafe. Ihre große Demütigung.
Die Entscheidung fiel nicht schwer.
Zoey legte ihr Gesicht auf das Kissen aus Straßenbelag und ließ ein Bein nach dem anderen herabrutschen, bis sie ganz flach ausgestreckt war. Mit letzter Kraft drehte sie sich auf die Seite, rollte weiter auf die Straße, und dann vervollständigte die Schwerkraft die Bewegung, bis sie weiter entfernt von den Bäumen am Straßenrand auf dem Rücken lag. Es tat nicht weh. Die gute Neuigkeit – und die schlechte, wie sie vermutete – war, dass all der Schmerz verschwunden war. Das Gefühl, ihr Körper wäre entzweigerissen worden, hatte sich in der kühlen Oktoberluft aufgelöst. Wenn sonst nichts blieb, dann konnte sie wenigstens ein letztes Mal zum Mond emporschauen. Totale Finsternis. Also befand sie sich außerhalb der Stadtgrenzen. Kein Licht dämpfte das Funkeln der Sterne. Der Himmel über Schottland war mit nichts anderem auf Erden vergleichbar. Zoey mochte nicht viel gereist sein, aber sie hatte die blendende Schönheit ihrer Heimat stets zu schätzen gewusst, war der Architektur und der Landschaft, die so unendlich viel Folklore und so viele Lieder hervorgebracht hatten, nie müde geworden.
In dieser Nacht waren die Sterne für sie herausgekommen. Vielleicht sah sie sie doppelt oder dreifach wegen der Tränen in ihren Augen, vielleicht funkelten sie umso mehr durch die salzige Flüssigkeit, aber dies war ein Nachthimmel zum Sterben. Sie war kein böses Mädchen, dachte sie. Und es hatte keinen Sinn, noch länger so zu tun.
»Ich bin gut«, formten ihre Lippen, auch wenn ihnen kein Laut entfloh. Wäre noch genug Blut in ihren Muskeln gewesen, um die Bewegung zu stützen, dann hätte sie sogar gelächelt.
Glücklichere Zeiten. Es hatte welche gegeben. In jenen frühen Tagen, in denen ihre Mutter ihren Vater abgöttisch geliebt hatte, lange bevor ihr Bruder sein Zuhause verlassen hatte. Da war ein Tag, an dem ihr Vater behauptet hatte, der halbjährliche Zahnarztbesuch sei fällig, nur um die Familie stattdessen in eine Auffangstelle für Hunde zu bringen. Den ganzen Nachmittag hatten sie Hunde gestreichelt und vor Freude gekräht, bis sie schließlich, vergessen im letzten Zwinger, einen verwahrlosten kleinen Terrier entdeckten. Sie nannten ihn Warrior – Krieger –, was eigentlich scherzhaft gemeint war, doch er hatte ihnen von diesem Tag an eine erbitterte, wilde Treue erwiesen. Tag für Tag hatte Zoey sich gefragt, ob sie es irgendwann leid wäre, mit ihm rauszugehen, ihn zu füttern und zu pflegen, so, wie ihre Freunde die Bedürfnisse der Tiere, die sie geschenkt bekommen hatten, leid geworden waren. Doch so kam es nicht. Seit sie fünf war und ihn bekommen hatte, war Warrior an ihrer Seite geblieben, bis sie zwölf war. Er hatte auf ihrem Bett geschlafen und ihren Kummer besänftigt, als das große Mädchen von gegenüber sie einen Monat lang ständig schikanierte, bis ihr Vater einmal in Ruhe mit den Eltern des Mädchens gesprochen hatte. Warrior hatte sich von ihr herumtragen lassen wie eine Puppe, wenn sie traurig war. Von Montag bis Freitag hatte er um halb vier auf der Fußmatte gesessen und darauf gewartet, dass Zoey aus der Schule zurückkam. Sie hatte immer bestaunt, dass Hunde Zeit erkennen konnten. Und Warrior hatte ihr seine pelzige Schnauze ins Gesicht gepresst, als sie geweint hatte, nachdem der Wagen ihres Vaters von einem Fahrzeug gerammt worden war, dessen Fahrer mehr Alkohol im Blut hatte, als es irgendjemandem zustand. Es hatte keine Besuche am Krankenbett gegeben, keinen langen Abschied, nur einen Polizisten auf der Türschwelle, der mit ernster Miene leise zu ihnen gesprochen hatte. Ihre Mutter hatte sich völlig in ihrem Kummer aufgelöst.
Achtzehn stille Monate später war ihr Stiefvater aufgetaucht. Ein Jahr darauf hatte ihr Bruder seinen sechzehnten Geburtstag gefeiert, indem er sich mit der Erlaubnis ihrer Mutter beim Militär verpflichtet hatte. Zoey hatte sie dafür gehasst. Sie fragte sich, ob sie ihr mit ihrem letzten Atemzug würde vergeben können. Doch Vergebung erforderte Mühe und Konzentration, musste von Hoffnung genährt werden. Und davon war dort, wo sie lag, nichts mehr übrig. Mit der Flucht ihres Bruders war ihre Falle zugeschnappt. Von da an hatte es keine Barriere mehr zwischen Zoey und dem neuen Ehemann ihrer Mutter gegeben.
Die Fäuste, die ihren Bruder traktiert hatten, bis er hatte gehen können, wandten sich nun gegen sie. Ihre Mutter, kaum noch mehr als eine Scherbe zerbrochenen Porzellans, sagte und tat nichts. Vielleicht war es ihr egal. Vielleicht war sie auch einfach dankbar, dass die Schläge nicht sie trafen. Die Geografie der Blutergüsse war begrenzt. Zoeys Gesicht blieb bis zu den Sommerferien unberührt, dann aber, wenn die Furcht vor neugierigen Lehrern nachließ, herrschte pure Anarchie. Zoey hatte in Warriors warmes Fell geweint und bei Nacht in ihrem Zimmer an seinem dürren, aber tröstlichen Körper gezittert. Bis ihr Stiefvater befand, dass die Liebe, die Zoey für diesen Hund empfand, zu viel Freude in ihr Leben brachte. Er erklärte sich selbst für allergisch und das Hundefutter für zu teuer, trotz des großen Hauses und seines guten Einkommens. Mit dem einen oder anderen schlecht vorgetäuschten Niesen verkündete er, der Hund müsse verschwinden.
Dieser Tag hatte sich in Zoeys Gedächtnis geätzt wie die Szene aus dem Zauberer von Oz, nur dass Toto nicht aus dem Griff ihres Stiefvaters entkam und zu ihr zurückkehrte. Warrior wurde ihr aus den Armen genommen, während sie sich auf ihrem Bett an ihn schmiegte und beteuerte, sie würde sterben, wenn sie ihn ihr wegnahmen.
»Hör mit dem Theater auf«, hatte ihre Mutter gesagt. Diese fünf Wörter waren das Todesurteil für was immer noch an Mutter-Tochter-Bindung wie ein zarter Schmetterling durch den Sommer von Zoeys Kindheit geflattert war. Ihr Stiefvater hatte ihr erklärt, Warrior müsse in die Auffangstation zurück, und eine liebevolle Familie, in der er besser aufgehoben wäre, würde ihn zu sich holen. In dieser Nacht setzte Zoey sich hin und rechnete nach, wie viele Tage es noch bis zu ihrem eigenen sechzehnten Geburtstag dauern würde, dem Tag, an dem sie fliehen konnte, wie ihr Bruder es getan hatte. Siebenhundertzwei. Jeden einzelnen hatte sie in einem Notizbuch festgehalten, bereit, ihn mit einem roten Stift durchzustreichen, sobald sie ihn überstanden hatte.
Was für ein vergeudetes Leben das gewesen war, dachte sie. Und die schreckliche Wahrheit in diesem Moment war, könnte sie nur einen winzigen Prozentsatz dieser von Schlägen geprägten, Hass erzeugenden Tage noch einmal erleben, so würde sie sich dem mit tiefer Dankbarkeit im Herzen hingeben.
Mit siebzehn hatte sie mit einer Collegefreundin zusammengewohnt, bis deren Mutter ihren Job verlor und Zoey nicht mehr durchfüttern oder auch nur unterbringen konnte. Sie hatte sich vergeblich bemüht, zu studieren und ihre Prüfungen zu bestehen, doch das ständige Hin und Her von einem Sofa zum anderen war zu anstrengend gewesen. Am Ende hatte sie ihrer Mutter noch eine letzte Chance eingeräumt. Versprechen wurden geleistet. Und ebenso schnell gebrochen. Und wieder waren die Fäuste geflogen.
Mit achtzehn war Zoey klug genug, um zu wissen, wann die Zeit zur Schadensbegrenzung gekommen war. Sie ging hinaus auf die Straße und brüllte ihre Meinung über ihren Stiefvater in die Welt hinein, öffentlich genug, dass er es nicht wagen würde, sich an ihr zu rächen. Dann marschierte sie mit ihrer Plastiktüte mit Klamotten zu einer Zuflucht, von der sie gehört hatte. Ausgestattet mit den blauen Flecken, die ihre Eintrittskarte für den sicheren Hafen darstellten, richtete sie sich dort ein und stellte sich in die endlose Schlange der Anwärter auf eine Sozialwohnung. Ihre Narben wurden untersucht, und man bot ihr an, die Angelegenheit strafrechtlich zu verfolgen. Doch Zoey konnte ihrer Mutter gegenüber nicht so grausam sein, den Mann, der für das Dach über ihrem Kopf sorgte, ins Gefängnis zu bringen. Auch wenn er es tausendmal verdient hatte.
Der Himmel schien näher zu kommen, während sie den Mond anstarrte. Eine Windböe tanzte durch das Geäst der Bäume über ihr und streute eine Schicht goldener Blätter über ihren Körper. Eine vielbeinige Kreatur kroch über ihren Hals, aber das war Zoey egal. Zurückzuschrecken hatte keinen Sinn mehr. Bald würde sie so oder so Insektenfutter sein. Die Straße war lang und gerade, ohne die Zierde ordnender weißer Streifen, also musste sie draußen im ländlichen Raum sein. Der nächste Wagen würde vielleicht erst am kommenden Morgen vorbeifahren. Dem armen Fahrer steht eine schreckliche Entdeckung bevor, dachte Zoey. Man stelle sich vor, den Montagmorgen mit solch einer Ungeheuerlichkeit zu beginnen. Immer vorausgesetzt, er überfuhr sie nicht einfach.
Die letzten sieben Tage ihres Lebens hatten mit einem Fehler begonnen. Wie oft wurden Kinder gewarnt, nicht zu nahe an ein Auto heranzutreten, wenn sie nach dem Weg gefragt wurden? Sie war abgelenkt gewesen, hatte darüber nachgedacht, was sie zum Abendessen machen könnte, während sie unterwegs zum örtlichen Supermarkt in Sighthill war. Der Wagen, der hinter ihr hergefahren war, war Zoey nicht aufgefallen, wenngleich sie jetzt wusste, dass er ihr gefolgt sein musste. Kein sechster Sinn hatte sie gewarnt, als sie den Parkplatz zwischen den Mietshäusern überquerte, und ihr war gar nicht in den Sinn gekommen, dass der Mann, der sich nach dem Weg zum Zoo erkundigt hatte, ein Messer im Ärmel haben könnte, bereit, ihr damit seitlich in den Hals zu stechen. Einsteigen oder auf dem Parkplatz verbluten, das waren ihre einzigen Möglichkeiten. Im Nachhinein wünschte sie, sie hätte sich für Letzteres entschieden. Zu guter Letzt wäre es sowieso auf das Gleiche hinausgelaufen.
Auf dem Beifahrersitz, das Messer auf ihr Herz gerichtet, hatte er ihr befohlen, sich Handschellen anzulegen. Ihre Hände hatten so heftig gezittert, dass sie es erst beim vierten Versuch schaffte, sie zu schließen. Vergewaltige mich einfach, hatte sie gedacht. Was immer in dir wütet, lass es einfach raus. Benutz mich, und dann lass mich gehen. Aber lass mich leben. Bitte, lass mich leben. Ich habe so viele Tage mit roter Farbe durchgestrichen. Es wäre nicht fair, wenn ich jetzt sterben müsste. Der Mann war weit aus der Stadt hinausgefahren, hatte die Straßen, die sie kannte, hinter sich gelassen, während sie auf der Rückbank lag. An Mut hatte es nicht gemangelt. Sie hatte ihren Fuß unter den Türgriff geschoben und versucht, sie zu öffnen, nur um festzustellen, dass die Kindersicherung aktiviert worden war. Die dunkel getönten Scheiben im hinteren Bereich des Wagens hatten ihr jede Chance geraubt, Hilfe herbeizuwinken. Und der Versuch, dem Mann mit ihren gefesselten Händen auf den Kopf zu schlagen, hatte ihr weiter nichts als ein verächtliches Lachen und einen Ellbogen im Auge eingebracht.
»Bitte, töten Sie mich nicht«, hatte sie gesagt, als er endlich in eine von Unkraut überwucherte Einfahrt einbog.
»Das werde ich nicht«, antwortete er. »Aber du warst ein böses Mädchen.«
»Was?«, fragte sie mit vor Furcht trockenem Mund und dem beschämenden Wissen, dass ihre Blase ihren Inhalt hatte laufen lassen, während der Rest von ihr festsaß.
»Du musst es sagen«, klärte der Mann sie in aller Seelenruhe auf. »Du warst ein böses Mädchen, nicht wahr?«
»Sie müssen die falsche Person erwischt haben«, erwiderte Zoey. »Ich weiß nicht, für wen Sie mich halten, aber ich bin nicht böse. Ich habe nie jemandem wehgetan. Wenn Sie mich gehen lassen, dann schwöre ich, ich werde kein Wort sagen. Ich werde Sie nicht in Schwierigkeiten bringen.«
»Aber du bist ein böses Mädchen«, entgegnete der Mann. »Du bist respektlos. Du bist kalt. Du denkst nur an dich selbst. Sag es.«
»Bin ich nicht«, schrie Zoey und wich auf der Rückbank vor ihm zurück. »Ich bin nicht böse. Sie kennen mich gar nicht.«
Daraufhin stieg der Mann aus und öffnete die hintere Tür. Er war groß. Seine dicht zusammenstehenden Augen waren von einem so dunklen Braun, dass Zoey Pupille und Iris nicht auseinanderhalten konnte. Und er stank. Als er sich über sie beugte und eine Handvoll ihrer Haare packte, um sie rauszuzerren, nahm sie einen Hauch Fäulnisgeruch wahr.
»Ich tue alles, was Sie wollen. Sie können … Sie können Sex mit mir machen. Ich werde mich nicht wehren. Wenn Sie wollen, dass ich ein böses Mädchen bin, dann kann ich das sein, okay? Ich kann alles sein, was Sie wollen«, flüsterte sie und wandte das Gesicht ab, als sie schließlich vor ihm stand.
»Siehst du? Wie viele Sekunden hast du gebraucht, um mir genau zu zeigen, wer du bist? Sag es mir«, forderte er sie auf.
»Ich bin ein böses Mädchen«, sagte Zoey fügsam, als er erneut ihr Haar packte und sie die Auffahrt hinauf zu einer Baumgruppe am Ende des Gartens führte. Die Ungezwungenheit, mit der er sie zur Schau stellte, signalisierte das Ende aller Hoffnung. Wenn er so sicher war, dass sie nicht gesehen würden, dann konnte niemand in der Nähe sein.
»Sie zu berühren verstößt gegen die Regeln«, murmelte er unterwegs. »Nicht berühren. Überhaupt nicht.«
Sie hatte den Kopf gehoben, um über die Büsche hinwegzublicken, die den Garten begrenzten. Kein einziges Gebäude in Sichtweite, abgesehen von dem, das zu betreten sie ausersehen worden war. Niemand da, der ihre Schreie hätte hören können.
Über ihr in den Bäumen rief eine Eule. Zoey hatte Eulen immer geliebt. Gleich darauf hörte sie ein Schnüffeln jenseits ihres Blickfelds. Das ist Warrior, dachte sie. Warrior kommt, um sich zu mir zu setzen, und bald bin ich wieder mit Daddy zusammen. Dann gibt es nichts mehr, wovor ich Angst haben muss. Die Reflexion der Sterne in ihren Augen erlosch. Der Edinburgher Herbst versprach lang und kalt zu werden.
Kapitel zwei
Detective Inspector Luc Callanach brachte seinen Wagen am Rand der Torduff Road zum Stehen. Zwei neugierige Pferde hinter einem Weidetor beobachteten untätig, wie blinkende blaue Lichter den morgendlichen Frieden störten. Callanach zog sich ein Hoodie über sein T-Shirt und sah zur Uhr. Fünf Uhr dreißig am Morgen. Die Tatortermittler waren gerade dabei, Scheinwerfer rund um den Ort des Geschehens aufzustellen, um Ersatz für das fehlende Tageslicht zu schaffen. Die schwachen Oktobersonnenstrahlen würden frühestens um halb sieben diesen Boden berühren. DCI Ava Turner stellte ihren Wagen hinter seinem ab und stieg in Sportklamotten aus, die an diesem Morgen bereits ein Work-out hatten überstehen müssen.
»Schläfst du eigentlich nie?«, fragte er, als sie neben ihm in Schritt fiel.
»Ist das eine französische Sitte, anstelle eines Grußes eine Frage zu stellen? Weil wir hier in Schottland nämlich gewöhnlich erst Hallo sagen. Du bist doch eigentlich inzwischen lange genug hier, um das zu wissen. Was wissen wir über das Opfer?«, fragte sie und rieb wie wild die Hände aneinander.
»Ich habe es noch nicht zu sehen bekommen«, sagte er, zog seine Handschuhe aus und gab sie Ava. »Zieh die an, hier draußen ist es eiskalt. Der Weg die Straße hinauf ist ziemlich lang. Eine lange, schmale Trasse, die südwärts zum Stausee führt, also hat die Truppe einen Abschnitt von einer ganzen Meile abgeriegelt. Die Spurensicherung hat schon angefangen. Soweit ich informiert bin, handelt es sich um ein einzelnes Opfer, eine junge Erwachsene.«
Ava zeigte einem Uniformierten ihren Dienstausweis, als sie sich unter dem gelben Absperrband hinwegduckten. »Unsere gewohnte Pathologin Ailsa Lambert ist derzeit im Urlaub. Wer sieht sich die Leiche an?«, fragte sie.
»Ich«, rief ein Mann hinter ihnen. »Jonty Spurr. Schön, Sie endlich mal persönlich kennenzulernen, DCI Turner.« Lächelnd streckte er die Hand aus. »Luc. Ist eine Weile her. Ich würde ja sagen, ich freue mich, Sie wiederzusehen, aber nicht unter diesen Umständen.«
»Jonty«, grüßte Luc. »Was machen Sie in Edinburgh?«
»Vertretung für Ailsa, während sie sich um ihre Schwester kümmert. Soweit ich weiß, hatte sie einen Schlaganfall. Ich habe einen guten Stellvertreter in Aberdeen, aber Sie sind knapp an Personal, also wurde ich vorübergehend hierher versetzt. Sollen wir gehen und die junge Dame besuchen, die hier auf Sie wartet?« Er reichte ihnen Overalls, Überschuhe und Handschuhe. Während sie sich anzogen, baute das Forensik-Team unter den Bäumen, ein paar Meter vor ihnen, einen Wetterschutz auf, und das Geräusch eines Generators scheuchte die Vögel in dem nahen Wald auf. »Tut mir leid, hier draußen klingt das unfassbar laut«, sagte Jonty. »Die Leiche ist mit Laub und Wassertropfen bedeckt, darum das Zelt. Sie werden Abstand halten müssen. Das Blut verteilt sich über einen ziemlich großen Bereich, und wir wollen keine Spuren verwischen. Hat jemand von Ihnen schon gefrühstückt?«
»Nur Kaffee«, antwortete Ava. »Warum?«
»Bisher haben heute Morgen schon zwei meiner Leute ihren Mageninhalt wieder von sich gegeben. Noch mehr Ablenkung können wir wirklich nicht brauchen«, informierte sie Jonty.
»Wir machen das beide schon lange genug, wir können uns beherrschen«, versicherte Ava. »Aber danke für die Warnung.«
Langsam trotteten sie den aus weißen Matten gebildeten Pfad hinauf und traten unter das Zeltdach, darauf bedacht, nicht seitlich über den Rand zu treten und die wie auch immer gearteten Beweise in Mitleidenschaft zu ziehen, die dort liegen mochten. Dr. Spurr ging voraus und kauerte sich neben einen kleinen Hügel, der mit Plane abgedeckt worden war. Zögernd, beinahe als ginge es um ein schlafendes Baby, hob er sie an.
Callanach wandte den Blick ab. Ava schlug eine Hand vor den Mund. Es gab Morde, und es gab Blutbäder. Was immer dieser jungen Frau dort am Boden zugestoßen war, fiel eindeutig in die zweite Kategorie.
»Luc, ruf auf dem Revier an. Frag nach, ob in den letzten achtundvierzig Stunden eine junge Frau vermisst gemeldet wurde. Sag ihnen nur, zwischen sechzehn und zwanzig, langes braunes Haar, rotbraunes Kleid. Keine weiteren Details«, wies Ava Callanach an.
»Falsch«, kommentierte Jonty.
»Was?«, fragte Callanach.
»Das ist kein rotbraunes Kleid«, erwiderte Jonty. Er schob eine mit einem Handschuh geschützte Hand unter die linke Schulter der jungen Frau, um sie ein paar Zentimeter vom Boden hochzuheben und ihnen ein kleines Stück ihrer Kleidung hinter dem Schulterblatt zu zeigen. Die strahlend weiße Baumwolle leuchtete im Scheinwerferlicht auf.
Ava atmete hörbar ein. »Das ist ein weißes Kleid?«, murmelte sie. »Wie zum Teufel hat sie …?«
Jonty beantwortete die Frage, indem er den Saum des Kleides über Oberschenkel und Abdomen schob. Ein großes Stück Haut war aus ihrer Bauchregion herausgeschnitten worden. Das rohe Fleisch kräuselte sich überall dort, wo es zu trocknen begonnen hatte. Blut verkrustete ihren ganzen Unterleib, zog sich über die Beine und die nackten Füße.
»Das ist noch nicht alles«, warnte Jonty. »An ihrem Rücken wurde ein ebenso großes Stück Haut entfernt. Ihre Unterwäsche war fort, als wir sie gefunden haben. Ich habe den Tatort unverändert belassen, damit Sie sich selbst ein Bild machen können.« Er erhob sich und deckte das Mädchen wieder ab, ehe er die Straße weiter hinaufdeutete, weg von ihren Fahrzeugen. »Sie ist einige Meter die Straße entlanggekrochen. Da sind Hautfetzen auf dem Asphalt. Wir nehmen an, sie stammen von ihren Händen und Knien. Die Blutung hat noch zugenommen, als sie sich die Straße hinuntergeschleppt hat. Wir haben zwei große Wundverbände gefunden, die von ihrem Körper abgefallen sein müssen, beide vollgesogen mit Blut. Wer auch immer sie hier abgelegt hat, hat sie zunächst medizinisch behandelt und dann an einem Ort zum Sterben zurückgelassen, an dem sie mit beinahe vollkommener Sicherheit erst gefunden werden würde, wenn es zu spät ist.«
Schweigend standen sie da und ließen die Szene für einige Augenblicke auf sich wirken. In der Ferne wurde ein Traktor gestartet. Wind fegte geräuschvoll über den ausgedehnten Stausee im Süden. Dies war eine außerordentlich schöne Gegend, nur ein paar Meilen südlich der als Edinburgh City Bypass bekannten Umgehungsstraße, und nun war sie die Heimat eines Geistes.
»Sie hat auf dem Rücken gelegen«, sagte Ava. »Glauben Sie, sie ist zusammengebrochen und herumgerollt?«
»Nein, wäre sie einfach zusammengebrochen, wäre ihr Gesicht nach oben gewandt. Und es gibt nicht genug Gefälle, damit die Schwerkraft sie hätte umdrehen können. Ich nehme an, sie hat aufgehört zu kriechen und beschlossen, sich auszuruhen. Oder die Hoffnung aufgegeben. Durch den Blutverlust und den Schock muss sie zu dem Zeitpunkt deliriös gewesen sein. Kann ich den Leichnam jetzt bewegen? Ich möchte nicht, dass er sich noch weiter zersetzen kann, ehe ich mit der Obduktion beginne«, sagte Jonty.
»Lassen Sie mich noch einen Blick auf sie werfen«, entgegnete Ava. »Mit dem Frühstück hatten Sie recht, Jonty. Jedes Mal, wenn ich denke, meine Jahre bei der Polizei hätten mich abgehärtet, begegnet mir etwas Neues.«
»Frieden und Gerechtigkeit, mehr können wir ihnen in diesem Stadium nicht bieten. Ich habe einige Dokumente abzuzeichnen. Sie können sie sich ansehen, aber bringen Sie nichts durcheinander, und bleiben Sie auf den Matten, ja?«, bat Jonty.
Ava trat zu dem Mädchen, ging neben ihm in die Knie und zog die Plane wieder weg, um Gesicht und Arme freizulegen. »Ihr rechter Arm liegt beinahe im Halbkreis auf dem Boden. Als hätte sie etwas festgehalten«, bemerkte Callanach.
»Vielleicht ist er einfach so gefallen«, sagte Ava, ging zum anderen Ende der Leiche und hob einen Fuß an. »Unter dem getrockneten Blut kann ich keine Verletzungen erkennen. Keine offensichtlichen Prellungen. Ich glaube nicht, dass sie eine weite Strecke zurückgelegt hat. Sie muss ganz in der Nähe abgesetzt worden sein.«
»Letzte Nacht hat es nicht geregnet, und es hätte keinen Grund gegeben, rechts ranzufahren, wenn keine anderen Fahrzeuge in der Nähe waren. Reifenspuren werden wir nicht finden«, stellte Callanach fest.
»Da stimme ich dir zu. Wir wissen auch nicht, in welche Richtung der Wagen unterwegs war, also wird die Auswertung der Überwachungsaufnahmen an den nächsten Kreuzungen eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen werden. Aber es gibt ein paar Häuser an der Straße«, sagte Ava. »Schick Uniformierte los, sie sollen von Tür zu Tür gehen und nach Fahrzeugen fragen, die letzte Nacht gesehen oder gehört wurden. Und sie sollen sich erkundigen, ob die Landeigentümer etwas dagegen haben, wenn wir uns auf ihrem Besitz umsehen. Bei jedem, der Nein sagt, wird eine Hintergrundüberprüfung vorgenommen.«
Jonty Spurr gesellte sich wieder zu ihnen und streifte die Handschuhe ab, als ein Fotograf hereinkam, um Tatortfotos zu machen, ehe der Leichnam für den Abtransport in die Leichenhalle vorbereitet wurde.
»Dr. Spurr, besteht irgendeine Möglichkeit, dass da eine Operation fehlgeschlagen ist? Die Baumwollverbände, die Einschnitte. Und dann wurde der Leichnam so öffentlich abgelegt. Wer immer das getan hat, wollte, dass sie gefunden wird«, sagte Ava.
»Dass sie bei dem Blutverlust nicht mehr zu retten war, muss offensichtlich gewesen sein. Es gibt keinen medizinischen Grund für das, was hier passiert ist. Die Wundverbände sind vielleicht einfach nur angelegt worden, um sie noch ein bisschen länger am Leben zu halten«, entgegnete Jonty.
»Sie wollen also sagen, die Behandlung der Wunden war tatsächlich eine Methode, um ihr Leiden zu verlängern?«, hakte Callanach nach.
»Mein Aufgabenbereich ist wissenschaftlicher Natur, nicht spekulativer. Es ist ein Wunder, dass sie überhaupt so lange überlebt hat. Sie muss sehr zäh und tapfer gewesen sein. Auch wenn es nur ein paar Meter waren … dass sie unter diesen Umständen noch weitergekrochen ist, ist bemerkenswert«, sagte Jonty.
»Wie lange ist sie schon tot, was meinen Sie?«, erkundigte sich Ava.
»Drei bis vier Stunden. Wie es scheint, wurde sie von einem Landarbeiter gefunden, der unterwegs war, um weiter unten an der Straße ein paar Rinder rauszulassen. Ich habe ihn mit dem ersten Beamten reden sehen, der am Tatort eingetroffen ist. In Anbetracht der Tatsache, dass er selbst wegen eines Schocks behandelt werden muss, nehme ich an, dass er nichts mit der Sache zu tun hat. Von der pathologischen Komponente abgesehen, man muss schon ziemlich abgebrüht sein, um so an einem Mädchen herumzuschnippeln und es dann umzudrehen und das Gleiche auch noch auf der anderen Seite zu machen. Das ist etwas anderes, als im Zorn zuzustechen. Selbst professionelle Mediziner brauchen viel Zeit, ehe sie bereit sind, solche umfassenden Schnitte vorzunehmen.«
»Also ein Psychopath«, konstatierte Ava. »Oder jemand, der vollkommen unempfindlich für extreme Gewalt und Blutvergießen ist.«
»Jemand, den Sie nicht unterschätzen sollten, würde ich sagen«, bekräftigte Jonty. »Wir bringen sie jetzt weg. Ich werde die postmortale Untersuchung heute machen, aber es wird einige Zeit dauern. Kommen Sie gleich morgen früh in die Leichenhalle, dann können Sie sich ein paar Antworten abholen.«
Sie verabschiedeten sich, und Luc und Ava sahen zu, wie der Leichnam in einen Leichensack gepackt und auf eine Trage gelegt wurde. Dort, wo die junge Frau gestorben war, war der Boden in der Mitte scharlachrot und an den Rändern schwarz. Nun, da die Leiche fort war, trat die Spur deutlicher zutage.
»Sie ist wirklich nicht besonders weit gekommen«, konstatierte Callanach. »Ich schätze, der Täter hat, als er sie hier zurückgelassen hat, gewusst, dass sie nicht mehr lange überleben würde. Und ich glaube außerdem, dass er nach Südwesten in Richtung Stausee gefahren ist.«
»Warum?«, wollte Ava wissen.
»Weil sie in Richtung Edinburgh gekrochen ist. Sie wäre bestimmt nicht in die Richtung gekrabbelt, in die der Täter gefahren ist. Man bewegt sich weg von seinem Angreifer, und zwar so schnell wie möglich. Das Bauchgefühl treibt einen dazu, die entgegengesetzte Richtung einzuschlagen.«
»Meinst du, es war jemand, den sie kannte?«, fragte Ava.
»Ich bin nicht sicher, was gefährlicher wäre, jemand, der imstande ist, das einer völlig Fremden anzutun, oder jemand, der fähig ist, einem Menschen, den er kennt, in die Augen zu sehen und ihn derart zu verstümmeln. Das ist, als wäre sie von einem Tier angefallen worden. So viel fehlende Haut ist mir noch nie begegnet«, sagte er. »Lass uns ein Stück die Straße runtergehen und nachsehen, ob da noch irgendetwas ist, was bisher übersehen wurde.«
Stumm gingen sie etwa hundert Meter weit. Sie kannten die Schritte des jeweils anderen, und das Grün vermittelte ihnen etwas Ruhe. »Ich hasse diesen Job«, bekundete Ava.
»Nein, tust du nicht«, erwiderte Callanach. »Du hasst nur die Gründe dafür, dass er notwendig ist. Du musst dir immer wieder bewusst machen, dass die anständigen Menschen gegenüber solchen kranken Mistkerlen wie diesem hier millionenfach in der Überzahl sind. Wenn es uns nicht gäbe, wie viele Leichen würden dann verstümmelt am Straßenrand landen?«
»Denkst du nie darüber nach, wieder nach Lyon zurückzukehren? Ich weiß, was dir da passiert ist, war schlimm, aber inzwischen ist eine ganze Weile vergangen. Du könntest dich wieder Interpol anschließen, dein guter Ruf ist wiederhergestellt. Du kannst mir nicht erzählen, dass du daran noch nie gedacht hast«, sagte Ava, drehte sich um und starrte die Straße hinauf zu den Scheinwerfern und der Parade weiß gekleideter Personen, die methodisch hin- und hergingen.
»Wenn man der Vergewaltigung beschuldigt wird, kann man seinen guten Ruf nicht wiederherstellen«, widersprach Luc. »Das ist, als wollte man Tinte aus einem weißen T-Shirt entfernen. Ich habe mich jetzt hier eingerichtet. Ich werde nicht so weit gehen zu behaupten, ich würde mich in Schottland heimisch fühlen, aber ich bin zufrieden. Wenn wir jetzt noch sämtliche Fast-Food-Läden von Edinburgh gegen Feinkostgeschäfte austauschen könnten, wäre es noch besser.«
»Unsere Essgewohnheiten wirst du uns nie verzeihen, was?«
»Wenn du von mir erwartest, dass ich solche Abscheulichkeiten wie Haggis, Porridge und das, was ihr, wie ich glaube, Mince and Tatties nennt, akzeptiere, dann, nein.« Callanachs französischer Akzent brachte jeden der Begriffe in einer Weise zur Geltung, als hätte er von exotischen Seuchen gesprochen.
Ava lächelte. »Dieser Weg ist jenseits der beiden Stauseen eher ein Pfad als eine Straße, aber steinig. Wenn ich mir einmal weichen Boden wünsche, hat es seit Wochen praktisch nicht geregnet. Du hast recht. Keine frischen Reifenspuren. Aber in dem Fahrzeug muss ihr Blut zu finden sein. Wir müssen den, der das getan hat, nur schnell genug ermitteln, damit ihm keine Zeit bleibt, die Beweise zu vernichten.«
»Weshalb er das auch gerade jetzt tun wird«, konterte Callanach. »Lass uns zurück zum Revier fahren. Ich unterrichte die Truppe, während du die nötigen Ressourcen bereitstellst.« Sein Telefon klingelte, als sie sich zum Gehen wandten. »Ja, richtig. Nehmen Sie Kontakt zu den nächsten Verwandten auf. Bitten Sie zuerst um ein Foto. Wir können es uns nicht leisten, dass die falsche Person die Leiche sieht, weil wir sie nicht korrekt identifiziert haben. Danke.« Er legte auf. »Letzten Sonntag wurde eine junge Frau vermisst gemeldet, deren Beschreibung passt. DC Tripp versucht gerade, ein aktuelles Foto zu beschaffen.«
»Davon habe ich gar nichts gehört. Gibt es irgendeinen Grund, warum dieser Vermisstenfall nicht die Runde gemacht hat?«, fragte Ava.
»Sie hat in einer Zuflucht für Opfer von häuslicher Gewalt gelebt. Die Frauen da kommen und gehen. Ich schätze, manchmal wird ihnen der Mangel an Privatsphäre einfach zu viel, oder sie kehren in ihr altes Leben zurück, und viele wollen nicht gefunden werden. Die Polizei hat in dem Frauenhaus eine Aussage aufgenommen, aber es gab keinerlei Hinweise auf ein Verbrechen, darum haben sie darüber hinaus nicht viel getan.«
»Hast du einen Namen?«
»Zoey Cole. Achtzehn Jahre alt. Weiß, braunes Haar, haselnussbraune Augen. Klingt ganz nach unserem Mädchen.«
»Das tut es«, stimmte Ava zu und ging etwas schneller. »Die Frage ist, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass sie in diesem Frauenhaus gelandet ist? Vielleicht hat, wer immer ihr genug Angst gemacht hat, dass sie sich dorthin geflüchtet hat, herausgefunden, wo sie ist, und beschlossen, ihr einen Besuch abzustatten.«
»Es würde mich überraschen, wenn das hier auf häusliche Gewalt zurückgeht. Das wäre die extremste Entwicklung derartiger Übergriffe, die mir je begegnet ist«, sagte Callanach.
»Menschen können plötzlich explodieren und eine bis dahin völlig verborgene Seite ihres Charakters offenbaren. Du hattest nur ein Date mit Astrid, und sieh dir an, wie das ausgegangen ist. Sie war ausreichend auf dich fixiert, dass sie dich der Vergewaltigung beschuldigt und sich selbst ernsthaft verletzt hat, um ihrer Geschichte mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen. Kannst du dir vorstellen, wie viel schlimmer ihre geistesgestörte Besessenheit von dir gewesen wäre, wenn ihr sechs Monate zusammen gewesen wärt oder vielleicht auch zwei Jahre? Menschen kennen keine Grenzen, wenn sie nur kaputt genug sind. Die Probleme, die nicht an der Oberfläche erkennbar sind, sind die gefährlichsten.«
Kapitel drei
Das Lagezimmer des Major Investigation Teams war leer. Detective Constable Christie Salter stand in der Tür, eine Kaffeetasse in der einen, einen Karton mit Donuts in der anderen Hand. Nur ein weiterer Schritt würde sie zurück in eine Welt führen, die sie Monate zuvor verlassen hatte, nachdem ein Einsatz im Zusammenhang mit einer Geiselnahme furchtbar schiefgegangen und sie mit einer Scherbe aus einem zerbrochenen Keramikgefäß in den Unterleib gestochen worden war. Salter hatte ihr Baby verloren. Und für eine Weile auch ihren Verstand, wenn sie wirklich ehrlich war. Sie war nicht ganz aus freien Stücken an den Arbeitsplatz zurückgekehrt. Aber hätte sie nur noch eine weitere Minute daheim zugebracht, die Tapete angestarrt und durch die Kanäle gezappt, dann hätte der Schaden, den ihre geistige Gesundheit genommen hatte, auf der Skala von »temporär« auf »irreparabel« springen können.
»Ich hoffe, die sind alle für mich. Ich teile meine Transfette nicht mit dem Rest dieser gierigen Mistkerle, wenn sie wieder zurück sind«, bemerkte DS Lively hinter ihr.
Salter lächelte in den leeren Raum hinein und bemühte sich dann um eine neutrale Mimik, ehe sie sich umdrehte.
»Sarge, Sie sind doch sowieso schon so ein fettiger Kerl. Ich bin sicher, da würden selbst zwanzig puddinggefüllte Küchlein mit Schokoladenglasur keine erkennbare Wirkung mehr hinterlassen. Tun Sie sich keinen Zwang an.« Sie hielt ihm den Karton hin.
»Schön zu hören, dass Ihre Zunge während Ihres Urlaubs nicht stumpf geworden ist. Aber Sie erinnern sich hoffentlich, dass Sie mir, als Ihrem Sergeant, immer noch jeden Morgen Kaffee kochen und die Stiefel polieren müssen«, konterte Lively, schnappte sich eine Wochenration Kalorien und nahm einen Bissen.
»Nach allem, was ich gehört habe, hat Max Tripp die Prüfung zum Sergeant abgelegt und wartet gerade auf die Ergebnisse. Ich schätze, bald ist er derjenige, dem ich Kaffee kochen werde. Aber ich bin überzeugt, Sie haben immer noch genug Ihrer üblichen Idioten, die gern den Handlanger für Sie spielen.« Salter grinste. »Da wir gerade davon sprechen: Wo sind die alle?«
»Wurden zu einem Leichenfund an der Torduff Road gerufen. Wird noch ein paar Stunden dauern, bis sie wieder hier sind. Ich schätze, sie fangen gerade mit Tür-zu-Tür-Befragungen an. DCI Turner und das Unterwäschemodel, das ich Sir nennen darf, sind beide dort«, berichtete Lively und wischte sich den Mund mit dem Handrücken ab.
»Sie und DI Callanach sind also immer noch heiß verliebt, ja? Und ich hatte angenommen, Sie wären inzwischen über die Schwärmerei hinweg. Vielleicht sollte ich da rausfahren. Wenn die eine neue Mordermittlung lostreten, werden sie jedes Händepaar brauchen, das sie kriegen können.«
»Ich glaube, die werden eher hier Unterstützung benötigen. Sie wissen doch, wie das ist. Das Telefon klingelt ununterbrochen, weil irgendwelche Leute Hinweise liefern oder Fragen stellen wollen. Es wird nicht lange dauern, dann bricht bei uns das Chaos aus, und die haben da draußen vorerst genug Officers«, wandte Lively ein.
»Das ist doch albern. Wir haben hier jede Menge Leute, die ans Telefon gehen können. Ich hole mir einen Wagen aus dem Fuhrpark. Der Verkehr ist heute Morgen nicht so schlimm. Ich werde nur …«
»Christie«, fiel Lively ihr ins Wort. »Das ist eine wirklich üble Geschichte. Eine junge Frau mit einem verstümmelten Bauch. Ich glaube wirklich nicht …«
»Halt«, unterbrach Salter. »Sie werden mich Salter nennen, so, wie Sie es immer getan haben. Und wir reden nicht über das, was passiert ist. Wenn ich das hätte tun wollen, dann wäre ich zu Hause geblieben, wo meine Familie zweimal am Tag reinschneit, um nach mir zu sehen. Das hier ist Arbeit, und die brauche ich. Auf Bevormundung kann ich verzichten. Also spielen Sie nicht den Beschützer, und versuchen Sie nicht, mich in Watte zu packen. Dafür ist es zu spät.«
Das Telefon klingelte, was Lively die Antwort ersparte. Er holte sich einen Stift und fing an, Einzelheiten auf einem Notizblock festzuhalten, während er zugleich allerlei Bestätigungen murmelte.
»Geben Sie uns zehn Minuten«, sagte er, ehe er den Hörer auflegte. »Dann schnappen Sie sich mal Ihren Mantel, Salter. Wir fahren in die Stadt.«
Crichton’s Close bot Fußgängern einen Zugang zur Royal Mile und war dank der hohen Mauern zu beiden Seiten, die den Wind abhielten und ein wenig Schutz vor Regen boten, ein beliebter Schlafplatz für Obdachlose. Da die Gasse nicht für den Verkehr freigegeben war, hatte sie zudem den Vorteil, dass keine Polizeifahrzeuge des Weges kommen konnten. Nur Betrunkene und unkundige Touristen kamen nach Mitternacht hier durch. Alle anderen mieden die Gasse, es sei denn, sie waren auf Ärger aus. Lively und Salter fuhren mit dem Wagen die Gentle’s Entry hinauf, parkten ihn in der Bakehouse Close und gingen zu Fuß um die Ecke, hinter der Uniformierte und Sanitäter ihr Bestes gaben, um einen Mann zu überzeugen, sich medizinisch versorgen zu lassen.
»Wer ist er?«, fragte Lively einen Officer, als sie näher kamen.
»Er heißt Mikey Parsons. Bekannter Drogenkonsument und schon lange obdachlos. Wir bekommen ihn auf Streife ziemlich regelmäßig zu sehen, aber wir hatten nie Probleme mit ihm, von öffentlichem Pinkeln abgesehen, und auch dann zieht er anschließend weiter, ohne unangenehm zu werden.«
»Wie geht es Ihnen, Mr Parsons?«, fragte Salter und trat zu ihm.
Der Mann wirbelte herum, wollte sich ihr entgegenstellen, verfehlte aber die Neunzig-Grad-Position und starrte stattdessen das Poster eines Konzerts an, das an der gegenüberliegenden Wand hing. Das Weiße in seinen Augen leuchtete wütend rot, und er schwankte auffällig, blieb jedoch auf den Beinen. Ein Sanitäter ging mit Feuchttüchern in der Hand einen weiteren Schritt auf ihn zu und zielte auf Mikeys linke Wange. Als er das getrocknete Blut abwischte, traten die drei Schnittwunden deutlicher zutage.
»Das ist ja einfach toll«, murmelte Lively. »Wir haben einen geistesgestörten Zorro-Imitator in der Stadt.«
Die obere Linie des Z zog sich von der Nasenwurzel zum äußeren Ende des Wangenknochens, von dort führte eine Diagonale hinunter zum Mundwinkel, und der letzte Strich reichte bis zu seinem Ohrläppchen.
»Nur gut, dass er ihm nicht in den Hals geschnitten hat«, bemerkte der Sanitäter. »Mr Parsons, haben Sie irgendwelche Schmerzen?«, fragte er laut.
Parsons stöhnte. Trotz der Kälte war sein Gesicht verschwitzt, und er schien sich seiner Verletzungen nicht bewusst zu sein.
»Was hat er genommen, was meinen Sie?«, fragte Salter.
»Ich würde auf Spice tippen«, antwortete der Sanitäter und klebte alle paar Millimeter ein Klammerpflaster über die Schnittwunden, um die Ränder zusammenzuhalten. »Wir erleben da gerade eine Epidemie. Die Notaufnahme ist bis an die Kapazitätsgrenze ausgelastet, und normale Bürger erschrecken sich zu Tode, wenn sie irgendwelche Leute wie Zombies mitten auf der Straße stehen sehen. Diese Droge löst Halluzinationen und Psychosen aus. Eine so umfassende Bewusstseinstrübung kommt häufig vor. Das kann dazu führen, dass sie zu keiner normalen Kommunikation mehr imstande sind. Wenn Mr Parsons noch da drin ist, dann ist es durchaus möglich, dass er große Schmerzen hat. Es gibt nur keine sichere Möglichkeit, das festzustellen.«
»Wer hat Sie alarmiert?«, fragte Lively.
»Ein Geschäftsinhaber ist heute Morgen hier vorbeigekommen, hat das Blut gesehen und uns angerufen. Uns ist erst klar geworden, was passiert ist, als wir endlich einen genaueren Blick auf sein Gesicht werfen konnten. Als wir hier angekommen sind, hat er versucht, seinen Kopf in einem Mülleimer zu verstecken.«
»Tja, ein Unfall war das nicht«, konstatierte Salter. »Was meinen Sie, Sarge? Zoff mit seinem Dealer, unbezahlte Schulden oder eine Schlägerei, die ausgeufert ist?«
Als die Sanitäter zusammenpackten, holte Lively sein Telefon hervor und machte ein paar Nahaufnahmen von der Wunde. Zur Sicherheit schoss er auch noch einige Fotos von der Umgebung.
»Keine Schlägerei«, erwiderte Lively. »Das sieht mehr nach einer Art Kennzeichnung aus. Die Linien sind alle sauber auf einer Seite des Gesichts und ziemlich gerade. Das war geplant. Irgendwelches Blut auf dem Boden in der Umgebung?«, rief er einem der uniformierten Officers zu.
»Da drüben, bei dem Haufen Mülltüten«, ertönte die Antwort. »Wir glauben, das ist Mikeys Zeug.«
Salter und Lively gingen zu dem Stapel stinkender Klamotten und Pappkartons, die Mikey Parsons Zuhause darstellten. Ein Pfeil aus verspritztem Blut zierte die Außenwand eines Ladens etwa einen Meter über dem Boden. Lively vervollständigte seine Fotosammlung mit den zugehörigen Aufnahmen.
»Wenn er dort auf der Pappe gesessen hat, dann wären die Blutspritzer auf einer Höhe mit seiner Wange«, stellte Lively fest. »Und da es ihm schwergefallen sein dürfte, sich einen Joint zu drehen, während ihm die halbe Gesichtshaut runterhängt, wette ich, dass er bereits mächtig stoned war, bevor er angegriffen wurde.«
»Sie denken, jemand ist zu ihm gegangen, während er weggetreten war, und hat beschlossen, ihm das Gesicht aufzuschneiden?«, hakte Salter nach. »Kann das ein anderer Spice-Konsument gewesen sein? Wenn die Droge Psychosen auslöst, ist es doch möglich, dass jemand, der drauf war, Mikey gesehen, aber etwas völlig anderes wahrgenommen hat.«
»Ich hege den ernsten Verdacht, dass wir das nie herausfinden werden«, sagte Lively. »Mr Parsons scheint weder kooperieren noch ins Krankenhaus gehen zu wollen, und er wird bestimmt keine schlüssige Aussage darüber machen können. Haben Sie alles getan, was Sie können?«, fragte er die Sanitäter.
»Alles, was wir hier draußen tun können. Idealerweise würden wir ihn ins Krankenhaus bringen, um die Wunde zu reinigen, Antibiotika zu verabreichen und ihn ordentlich zu nähen, aber er will nicht in den Krankenwagen steigen, und wir werden nicht versuchen, ihn zu fixieren.«
»Na gut. Salter, ich hoffe, Sie tragen nicht Ihre beste Kutte, denn Sie und ich werden Mr Parsons gleich auf den Rücksitz des Streifenwagens verfrachten. Können wir uns ein paar Handschuhe ausleihen?«
»Nur zu«, antwortete der Sanitäter und reichte beiden einen Ball aus zusammengeknülltem, gummiartigem Material. »Viel Glück.«
Sie streiften sich die Handschuhe über. Parsons verharrte an Ort und Stelle und starrte in die Ferne. Sein Mund öffnete und schloss sich immer wieder, als versuchte er erfolglos, etwas zu sagen. Salter stellte sich auf einer Seite neben ihm auf, Lively übernahm die andere, und sie dirigierten ihn gemeinsam langsam zu ihrem Wagen. Es dauerte eine Weile, bis sie seinen Körper in die passende Position gefaltet hatten, um ihn auf die Rückbank zu verfrachten, aber schließlich war er drin.
Salter schloss die Tür und seufzte. »Das ist beinahe, als hätten Sie das extra für meinen ersten Morgen geplant, um es mir gleich wieder zu verleiden«, murrte sie.
»Haben Sie wirklich nur acht Monate gebraucht, um zu vergessen, wie glamourös und amüsant unser Job ist?«, konterte Lively. »Ich fahre. Sie passen auf unseren Gast auf.«
Über den Spiegel sah Salter nach Mikey Parsons. Sein Kopf kippte mit den Bewegungen des Wagens auf und nieder wie der eines Wackeldackels, und die weißen Klemmpflaster auf den dunkelroten Wunden erinnerten an eine schaurige Halloweenmaske. Plötzlich blickte er auf, und seine Pupillen zogen sich zusammen, als er Salter in die Augen sah.
»Hey, Mikey«, sagte sie. »Wissen Sie, wo Sie sind?«
Er atmete lang und pfeifend aus. Der säuerliche Geruch aus seinem Mund waberte durch den Wagen. Mikey fing an, mit seinem Gurt zu kämpfen, und warf sich dabei so schwungvoll nach vorn, dass er sich den Kopf an der Trennscheibe hinter Livelys Sitz anschlug, nur um gleich im Anschluss mit dem Hinterkopf an seine Kopfstütze zu knallen. Vor und zurück ging es immer wieder, und jedes Mal prallte sein Kopf härter auf.
»Halten Sie an«, sagte Salter. »Wir müssen etwas tun, ehe er sich selbst außer Gefecht setzt.«
»Nein, wir bringen ihn aufs Revier. Wenn er bis dahin bewusstlos ist, rufen wir einen Krankenwagen. Aber ich fasse ihn nicht an, solange er so ist, und Sie auch nicht. Wir haben keine Ahnung, zu was er fähig ist, solange er das Zeug im Körper hat. Letzten Monat erst ist ein Officer im Zuge einer Festnahme gebissen worden.«
»Wie viel wissen Sie über dieses Spice?«, fragte Salter.
»Sie verhökern es als Cannabisalternative, nur ist es vollständig synthetisch. Soll wirken wie Cannabinoide, aber nach allem, was ich gesehen habe, wirkt es eher wie LSD oder auch Heroin. Jede Sorte wird mit anderen Bestandteilen hergestellt, also wissen die Konsumenten im Grunde gar nicht, was sie da rauchen.«
»Wo kriegen die das her?«, erkundigte sie sich, bemüht, nicht auf das Rumsen auf dem Rücksitz zu achten.
»Überall. Es ist ziemlich billig herzustellen. Die verpacken das Zeug, damit es professionell aussieht, und es ist weniger riskant als der Versuch, Heroin oder Kokain zu importieren. Dieses Zeug bekommen wir noch ein Jahrzehnt nicht von der Straße. Es sei denn, Anti-Zorro jagt ihnen eine solche Scheißangst ein, dass sie seinetwegen aufhören.«
»Kommen Sie, Sarge, wer immer das getan hat, nennen Sie ihn nicht Anti-Zorro. Wenn die Presse Wind davon bekommt, geht das überall rum.«
Mikey drehte den Kopf vor einem letzten monumentalen Zusammenstoß mit der Kopfstütze zur Seite, worauf sich sämtliche Klemmpflaster lösten. Blut rann über seine Wange wie Tränen aus einem Horrorfilm, und Salter sah Lively mit hochgezogenen Brauen an.
»Wer immer derzeit für den Fuhrpark zuständig ist, wird uns nicht besonders mögen«, kommentierte sie.
Sie brachten ihn ohne größere Probleme ins Gebäude, bis der Diensthabende ihnen in die Quere kam. »Sie erwarten doch wohl nicht von mir, dass ich den abfertige, oder? Der gehört direkt ins Krankenhaus, und das wissen Sie genau.«
»Er hat medizinische Versorgung verweigert, aber er ist betrunken und handlungsunfähig, und er braucht ein paar Stunden in der Zelle. Wir müssen versuchen, ihm eine Aussage zu entlocken, wenn er seinen Rausch ausgeschlafen hat«, sagte Lively.
»Stillen Sie die Blutung«, erwiderte der Diensthabende. »Machen Sie ihn sauber. Wenn ich mit dem Ergebnis zufrieden bin, buchte ich ihn ein. Schön, Sie wiederzuhaben, Salter«, fügte er hinzu.
Lively nickte ihr zu. »Sie gehen rauf und erstatten dem Boss Bericht. Jemand müsste ja inzwischen wieder da sein. Informieren Sie das Team über unseren Einsatz. Ich komme nach, sobald dieses Drama geregelt ist. Und trinken Sie eine Tasse Tee. Für ihren ersten Morgen zurück im Dienst reicht das jetzt.«
»Wie recht Sie doch haben, Sir«, sagte Salter und ging zur Treppe.
»Na klar, jetzt widersprechen Sie mir nicht. Natürlich soll ich die ganze Drecksarbeit machen«, murmelte Lively.
»Sturheit und Dummheit sind zwei verschiedene Sachen, Sarge.« Salter grinste und verschwand.
Kaum hatte sie den Korridor im Obergeschoss betreten, schien die Luft wie elektrifiziert von dem Gebrummel aus dem Lagezimmer. Ava Turner tauchte am anderen Ende des Gangs auf, blieb stehen, und ein Lächeln breitete sich über ihre Züge aus, als Salter sich näherte.
»Detective Constable Salter, schön, dass das MIT Sie wiederhat«, begrüßte Ava sie.
»Schön, wieder hier zu sein, Ma’am«, sagte Salter. »Es hat einen Mord gegeben, wenn ich richtig informiert bin?«
»Sieht ganz so aus«, bestätigte Ava. »Ich werde Ihnen keine speziellen Aufgaben vorenthalten. Sie wurden für einsatzfähig befunden, und das soll mir reichen. Sprechen Sie mich einfach an, wenn Sie irgendwas brauchen, ja?«
»Gern«, stimmte Salter zu. »Und Glückwunsch zur Beförderung, Ma’am, auch wenn ich damit ein paar Monate zu spät dran bin.«
»Ich weiß nicht, ob Glückwunsch der passende Begriff ist. An den meisten Tagen kommt es mir eher wie eine Strafe vor. Wo sind Sie und DS Lively heute Morgen gewesen?«
»Jemand hat einem obdachlosen Drogensüchtigen den Buchstaben Z ins Gesicht geschnitten. Er wurde heute Morgen blutüberströmt aufgefunden. Keine Zeugen, keine Hinweise. Das Opfer stand unter Drogen – so sehr, dass er immer noch nicht mitkriegt, was mit ihm passiert ist. Lively ist unten, um ihn als betrunken und handlungsunfähig in eine Zelle zu schaffen, in der Hoffnung, dass wir in ein paar Stunden eine Aussage aus ihm herauslocken können.«
»Spice?«, fragte Ava.
»So lautet Livelys Theorie. Die Sanitäter schienen ihm zuzustimmen«, antwortete Salter.
»Die Stadt ist voll davon«, sagte Ava. »Geben Sie dem Drogendezernat Bescheid. Falls da eine neue Sorte gehandelt wird, durch die die Konsumenten gewalttätig werden, sollten die sich schnell darum kümmern.«
»Salter«, rief Callanach, als er das Lagezimmer verließ, sich zu ihnen gesellte und sie umarmte, woraufhin Salter rot anlief.
»Sir«, sagte sie. »Schön, Sie wiederzusehen, aber ich sollte mich an die Arbeit machen. Ich muss meine Notizen abtippen, und DS Lively geht in die Luft, wenn kein Kaffee bereitsteht, sobald er von den Arrestzellen zurück ist.« Damit huschte sie in die kleine Küche.
»Wow«, machte Ava und drehte sich zu Callanach um. »Alles in Ordnung? So emotional habe ich dich nicht erlebt seit … eigentlich immer.«
»Witzig. Sollte sie so schnell schon wieder arbeiten? Nach allem, was sie durchgemacht hat? Immerhin hat sie ihr Baby verloren.«
»Lass ihr Zeit«, sagte Ava. »Ich nehme an, sie reibt ein bisschen Salz in die Wunden, um herauszufinden, wie sehr es noch schmerzt. Behalt sie im Auge. Und sag mir Bescheid, falls du den Eindruck hast, es gäbe ein Problem. Salter ist ein guter Detective. Wir brauchen Beamte wie sie.«
DC Max Tripp steckte den Kopf aus dem Lagezimmer und rief sie herbei. »Ma’am, wir haben ein paar Hintergrundinformationen über Zoey Cole und ihren Stiefvater Christopher Myers. Das wollen Sie bestimmt sofort erfahren«, sagte er.
Kapitel vier
Mit einem Laken bedeckt lag Zoey Cole auf einer Rollbahre. Ava und Callanach standen schweigend daneben und warteten darauf, dass sich Jonty Spurr zu ihnen gesellte. Eine Mitarbeiterin aus dem Zentrum zum Schutz vor häuslicher Gewalt hatte ihnen ein aktuelles Foto zur Verfügung gestellt und war am Vorabend hergekommen, um die Leiche zu identifizieren.
»Guten Morgen, Sie zwei«, sagte Jonty beim Eintreten und streifte sich Handschuhe über. »Behördlichen Daten zufolge ist Zoey achtzehn Jahre alt, und ich pflichte dem bei. Außerdem habe ich mit der Mitarbeiterin des Schutzhauses gesprochen, die gestern hier war.« Jonty blätterte in seinen Notizen. »Da haben wir es ja, eine Miss Sandra Tilly. Sie hat erklärt, dass Zoey über Schmerzen in den Händen geklagt hat, die von schlecht verheilten Frakturen in den Fingern herrührten. Ich habe drei alte Brüche gefunden. Ich nehme an, sie stammen von zwei verschiedenen Zeitpunkten. Dann waren da noch vier verheilte Rippenfrakturen, und ihre Nase war vermutlich auch gebrochen, aber das ist nie so leicht feststellbar.«
»Ergibt Sinn«, konstatierte Ava. »Zoey hat in dem Schutzzentrum gelebt, seit sie zu Hause ausgezogen ist. Sie hat behauptet, ihr Stiefvater wäre ihr gegenüber einige Jahre lang gewalttätig gewesen. Die Mutter hat es gewusst, aber nichts getan, um die Situation zu verbessern.«
»Und es hat nie eine polizeiliche Untersuchung gegeben?«, fragte Jonty.
»Nein. Zoey wollte nie Anzeige erstatten, weil ihre Mutter immer noch bei ihm gelebt hat«, erklärte Ava.
»Das MIT hat bisher noch nicht mit dem Stiefvater oder der Mutter gesprochen«, fügte Callanach hinzu. »Uniformierte sind gestern dort gewesen und haben sie über Zoeys Tod informiert. Das war, bevor wir die ganze Geschichte kannten. Wir wollten erst hören, welche Fakten Sie uns liefern können, ehe wir den Stiefvater offiziell befragen.«
»Damit sollten Sie vielleicht noch warten. Ich habe gestern Abend selbst ein paar Erkundigungen eingezogen, aber bisher ohne Ergebnis. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, womit wir es zu tun haben.«
Jonty schlug das Laken zurück und legte Zoeys nackten Körper frei. Die Haut, die an ihrem Abdomen abgezogen worden war und ihre Form verloren hatte, war nun wieder aufgelegt und so positioniert worden, dass ein Umriss erkennbar wurde.
»Was zum Henker …?«, sagte Ava und trat näher, um direkt von oben einen Blick auf den Unterleib der Toten zu werfen.
»Exakt meine Worte, als ich die Haut glatt gestrichen habe«, bemerkte Jonty.
Getrocknetes Blut rund um den Einschnitt verlieh der kleinen Figur, die aus Zoeys Haut herausgeschnitten worden war, einen besonders gruseligen Rahmen. Aus dem Bereich zwischen den Rippen war ein kopfförmiges Stück Haut herausgetrennt worden. Winzige Arme spannten sich über ihre Seiten, und die Beine reichten hinab bis zum Oberschenkelansatz.
»War sie schwanger?«, fragte Callanach. »Soll das vielleicht ein Baby darstellen?«
»Das war das Erste, was ich überprüft habe, als ich die Form erkannt habe, aber sie war zum Todeszeitpunkt nicht schwanger, und sie hat auch nie ein Kind bekommen. Das schließt aber nicht die Möglichkeit aus, dass sie irgendwann schwanger war und sich für einen Abbruch entschieden hat.«
»In dem Fall müssten wir wohl nach einem Freund suchen. Nach jemandem, der ihr die Entscheidung verübelt hat«, erklärte Ava. »Sie sagten, Sie hätten bereits Erkundigungen angestellt, Jonty. Wonach haben Sie gesucht?«
»Nach ähnlichen Fällen. Ich freue mich, Ihnen sagen zu können, dass ich über einen Zeitraum von fünfundzwanzig Jahren nichts gefunden habe, das derart ungeheuerlich gewesen wäre. Helfen Sie mir, Zoey umzudrehen, Luc?« Callanach trat vor und unterstützte ihn. »Hier haben wir exakt die gleiche Form, herausgeschnitten aus der Haut am Rücken. Das dürfte erheblich schwieriger gewesen sein, weil die Haut dort straffer anliegt und es weniger weiches Gewebe darunter gibt.«
»Sagen Sie mir, dass sie nicht bei Bewusstsein war, als man ihr das angetan hat«, bat Ava.
»In diesem Punkt gibt es gute und schlechte Neuigkeiten«, entgegnete Jonty und zeigte auf ein paar Stellen im Verlauf der Einschnitte. »Ich glaube, sie war bei Bewusstsein, auch wenn sie, sofern sie sehen konnte, was passierte, einen Schock erlitten haben dürfte, durch den sie ziemlich schnell ohnmächtig wurde. An diesen beiden Stellen können Sie sehen, dass die Umrisse auf Zoeys Körper gemalt worden sind, ehe die Schnitte geführt wurden. Die Tinte ist gerade noch zu erkennen.«
»Womit wurde der Schnitt gemacht?«, erkundigte sich Callanach.
»Ein Skalpell, medizinische Qualität. Da kommt man leicht dran. Wir haben einige Tests an der Haut rund um die Einschnitte durchgeführt und eine beträchtliche Menge einer Betäubungssalbe gefunden. Ich glaube, ihr Mörder hat Zoeys Abdomen und Rücken mehrere Tage lang damit eingerieben, ehe er ihr das angetan hat.«
»Und sie kann nicht vorher getötet worden sein?«, hakte Ava nach.
»Das war offensichtlich nicht das, was der Täter wollte«, erwiderte Jonty. »Es gibt auch vier Injektionswunden. Ich habe Gewebeproben ins Labor geschickt, und die Bestätigung wird ein paar Tage auf sich warten lassen, aber angesichts der Nähe zu den Einschnitten …« Er deutete auf winzige Einstiche in der Nähe der beiden Schultern und der Beine der ausgeschnittenen Form. »Ich würde sagen, der Chirurg – und diesen Begriff benutze ich nur im allerweitesten Sinne – hat Zoey ein Lokalanästhetikum verabreicht, ehe er angefangen hat zu schneiden. Die Wundmale gleichen sich auf beiden Seiten.«
»Wozu die Mühe?«, fragte Callanach. »Und ehe Sie es sagen, Jonty, ich weiß, die Schlussfolgerungen fallen in unser Aufgabengebiet, nicht in Ihres. Aber wenn er sie foltern wollte, dann hätte es doch keinen Sinn gehabt, den Schmerz zu lindern.«
»Medizinisch betrachtet, ist die Antwort einfach. Hätte Zoey die Einschnitte vollständig spüren können, dann hätte sie sich auf eine Art bewegt, die es unmöglich gemacht hätte, einen sauberen Schnitt zu führen. Außerdem hätte der Schock sie umgebracht, nehme ich an. Ihr Herz hätte dem nicht standgehalten. Ihre Atmung hätte gelitten. Diese geringfügige Betäubung hat es ihr gestattet, die Operation zu überleben, und sie hat es leichter gemacht, die Babyfigur auszuschneiden.«
»Und dann hat der Mörder ihre Wunden verbunden und sie irgendwohin gefahren, um sie an einem öffentlichen Ort zum Sterben zurückzulassen?«, fragte Callanach.
»An der Stelle sind Sie gefragt«, sagte Jonty. »Die Schnitte wurden ihr, nicht lange bevor man sie am Straßenrand abgelegt hatte, zugefügt. Die Verbände hätten den Blutfluss nicht lange aufhalten können, und der Verlust einer solchen Menge Haut hätte sie früher oder später sowieso umgebracht, ob sich die Wunden infiziert hätten oder nicht.«
»Wo kann der Mörder das Lokalanästhetikum herhaben?«, wollte Ava wissen.
»Über einen Kontakt zum ärztlichen Berufsstand. Einen Diebstahl aus einem Krankenhaus oder einer allgemeinmedizinischen Praxis. Vielleicht auch über das Internet. Es gibt Seiten, die auf den Vertrieb medizinischer Produkte spezialisiert sind. Da werden keine Fragen gestellt, und ein Verkauf dieser Ware würde auch nicht als besonders riskant eingestuft werden. Das zurückzuverfolgen dürfte so gut wie unmöglich sein, was mich zu dem Kittel bringt, den sie getragen hat, als sie gefunden wurde.«
»Das war kein Kleid?«, warf Ava ein.
»Nein. Es war zunächst nicht leicht zu erkennen wegen des vielen Bluts, aber der Kittel ist hinten offen und wird in regelmäßigen Abständen an drei Stellen mit Bändern geschlossen, was einen leichten Zugriff auf Abdomen und Rücken ermöglicht hat. Genau das, was er benötigte. Kein Markenzeichen oder Etikett, und das Material ist ein ziemlich gewöhnliches, billiges Baumwollmischgewebe, wie man es oft bei Bekleidungsstücken findet, die aus China importiert werden.«
»Wie stehen die Chancen, die Herkunft festzustellen?«, fragte Luc.
»Mehrere tausend zu eins, schätze ich«, antwortete Jonty.
Ava seufzte. »Sie sagten, Chirurg im weitesten Sinne. Also hat er medizinische Kenntnisse? Was halten Sie von seinen chirurgischen Fähigkeiten?«, erkundigte sie sich.
»Das war kein stümperhaftes Gemetzel, aber der Täter hatte auch keine medizinische Ausbildung. Er hat keine gute Arbeit geleistet, als er die Haut abgehoben hat – alle Schichten, Epidermis, Dermis und das subkutane Fettgewebe. An einer Stelle ist sie einen Zentimeter dick, am Ende der Arme und Beine nur drei Millimeter. Wenn Sie genau hinsehen, können Sie erkennen, dass er mit der Klinge herumgehackt hat, um den Hautabschnitt herauszulösen«, erklärte Jonty und zeigte auf eine entsprechende Stelle.
»Ich verlasse mich auf Ihre Ausführungen«, sagte Ava. »Was ist mit der Fixierung? Ich kann nichts Offensichtliches entdecken.«