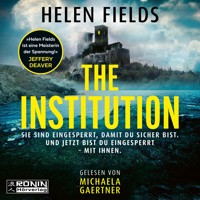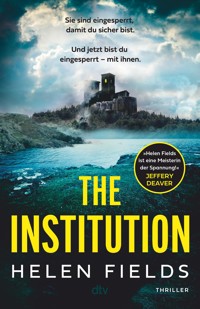
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eingesperrt mit den gefährlichsten Männern der Welt In der geschlossenen Station eines Hochsicherheitsgefängnisses für psychsich kranke Verbrecher erschüttert ein Schrei die Nacht. Am nächsten Morgen wird die Leiche einer Krankenschwester gefunden und ihre Tochter wurde entführt. Die Uhr tickt, denn das kleine Mädchen kann ohne medizinische Versorgung nur wenige Tage überleben. Die forensische Profilerin Dr. Connie Woolwine ist bekannt für ihre Fähigkeit, sich in die Psyche der Mörder hineinversetzen zu können. Jetzt muss sie sich undercover unter die gefährlichsten Männer der Welt mischen und ihr einzigartiges Gespür einsetzen, um das Mädchen zu finden – bevor es zu spät ist ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 584
Veröffentlichungsjahr: 2023
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Willkommen in der Institution, dem gefährlichsten Ort der Welt.
Dr. Connie Woolwine ist eine knallharte Profilerin, die bei den schwierigsten Ermittlungen eingesetzt wird. Doch ein Fall in der Parry Institution, einem Hochsicherheitsgefängnis für psychisch kranke Verbrecher, bringt sie an ihre Grenzen. Fern jeder Zivilisation und umschlossen von dicken Mauern beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. In dunklen Winkeln und auf einsamen Fluren macht sie sich auf die Suche nach der Wahrheit. Sie ist auf sich allein gestellt. Die düsteren Mauern der Institution scheinen das Böse zu beherbergen …
Helen Fields
The Institution
Thriller
Deutsch von Christine Blum
Für Grace, Martha und Esther
Mit Dank dafür, dass ich mir eure Mum
von Zeit zu Zeit ausleihen darf
Kapitel 1
Montag
Mit den Toten konnte man sich oft viel besser unterhalten als mit den Lebenden. Jedenfalls nach Connies Erfahrung. Sie sagten, was Sache war, ohne Ausflüchte oder Übertreibungen, und verlangten erstaunlich wenig dafür. Gerechtigkeit vielleicht, oder Schutz für andere, bei denen zu befürchten stand, dass sie das gleiche Schicksal erleiden würden. Diese spezielle Leiche jedoch würde mehr von ihr fordern.
Dr. Connie Woolwine nahm die Hand der Toten in die behandschuhte eigene. Im Leben hätten sie befreundet sein können, verbunden durch ein gemeinsames Interesse an Medizin und den Wunsch, den Verlorenen zu helfen. Im Tod war der gemeinsame Nenner das Kind, mit dem die eine von ihnen schwanger gewesen war und das die andere nun finden sollte.
»Wer hat sie dir weggenommen, Tara?«, fragte Connie. »Wie konnte jemand nur so grausam sein?« Sie strich der Toten übers Haar, fasziniert von der seidigen Fülle, in der noch hie und da eine Haarklammer von dem Knoten steckte, der sich im Kampf gelöst hatte. »Darf ich mir ansehen, was man dir angetan hat? Ich bin ganz vorsichtig. Das verspreche ich dir.«
Sie wartete einen Augenblick, dann schlug sie den oberen Teil des Tuchs zurück, mit dem die Leiche von Schwester Tara Cameron bedeckt war. Sie fühlte sich an ein Spiel aus Kindertagen erinnert. Jedes Kind bekam ein Blatt Papier und einen Stift. Zuerst zeichneten alle ein Paar Füße, falteten das Blatt, gaben es weiter. Dann kamen die Beine, wieder wurde gefaltet und weitergegeben und so weiter. Zum Schluss wurde die ganze urkomische Person aufgedeckt, sodass die Runde aus dem Lachen nicht mehr herauskam. Ganz anders der Anblick, der sich ihr jetzt bot. Das Abbild eines Mordes, dessen Pinselstriche – die Verletzungen – ihr die Geschichte erzählten.
Taras Gesicht war relativ unversehrt, wenn man von den zerlaufenen Mascaraspuren absah, die sich als traurige Bahnen von ihren Augen nach außen über die Schläfen zogen. Die junge Frau war auf dem Rücken liegend gestorben und dabei die meiste Zeit bei Bewusstsein gewesen. Hatte um ihr verlorenes Kind und um sich selbst geweint. Mit ihrem medizinischen Wissen musste ihr klar gewesen sein, dass sie das, was mit ihr geschah, unmöglich überleben konnte.
Fast unsichtbar und für das ungeübte Auge einer schwachen Lippenstiftspur täuschend ähnlich war die Hautreizung in der Verlängerung beider Mundwinkel.
»Hat er das als Erstes getan? Dich geknebelt?«, fragte Connie und fuhr mit dem Fingernagel über die minimalen Abschürfungen, die der Knebel hinterlassen hatte. »Ja, bestimmt, sonst hättest du um Hilfe gerufen.«
In Taras linkem Ohrläppchen saß noch ein winziger dunkler Stecker. Connie ließ den Daumen darübergleiten, fragte sich, wer ihr diese Ohrringe wohl geschenkt hatte und wann. Ihr Handschuh rieb die obere Schicht ab, und plötzlich war es ein Diamant, der mit etwas Blut befleckt gewesen war. Das rechte Ohrloch war leer, und dafür mochte es verschiedene Erklärungen geben, aber Connie konnte fast vor sich sehen, wie der Knebel grob weggezerrt wurde, sich hinter dem Stecker verhakte und ihn aus dem Flügelverschluss löste.
Weiter zu Hals und Schultern. Seitlich an Taras Hals waren deutlich die blutigen Abdrücke zweier Fingerkuppen zu sehen, ein Abbild des Augenblicks, als der Angreifer ihr den Puls gefühlt hatte. Connie wusste schon, dass in dem Blut keine Fingerabdrücke zu finden sein würden. Wer diese Gräueltat auch begangen hatte, er hatte Handschuhe getragen. Nichts war dem Zufall überlassen worden. Nur durch einen winzigen, unvorhersehbaren Umstand hatte Taras Leiche überhaupt in ihrem ursprünglichen Zustand geborgen werden können.
Ihre unversehrten, makellosen Schultern sagten eine Menge über Taras Leben aus. Mit ihren dreißig Jahren hatte sie eine gesunde, straffe und reine Haut besessen. Schmale weiße Linien von den Schultern zur Brust verrieten einen Bikini, den sie in sonnigen Gefilden getragen hatte. Sie war gern draußen gewesen, hatte es genossen, Wärme auf der Haut zu spüren. Es hatte etwas Optimistisches, in Urlaub zu fahren. Die Zeit zu verbringen im Glauben, man hätte noch genug davon, dass man sie einfach genießen, für ein Weilchen alles vergessen und sich amüsieren konnte. Connie fragte sich, was Tara mit diesem Urlaub angefangen hätte, wenn sie gewusst hätte, was auf sie zukam. Ihn mit ihrer Familie verbracht? Ihre Angelegenheiten geordnet? All ihren Lieben Briefe geschrieben, um sie in der dunklen Zeit, die kommen würde, zu trösten?
Sie schlug das Laken weiter um. Unversehrte Brüste, schon prall von der ersten Milch. Darauf Blutspritzer, zu schwärzlichen Flocken getrocknet, weshalb die Haut sich rau anfühlte. Ihre Oberarme trugen die Spuren grausamer Hände, die so fest zugepackt hatten, dass blaue Flecken entstanden waren, das geisterhafte Nachbild des Menschen, der sie schnell und gnadenlos gefesselt hatte. Die Daumenabdrücke innen, die der Finger außen. Tara hatte ihm also ins Gesicht gesehen, aus nächster Nähe, so nahe, wie Connie ihr jetzt war. Hatte den Mann erkennen können, der im Begriff war, sie zu töten.
Höchstwahrscheinlich würde auf der Leiche irgendein Hinweis auf ihn zu finden sein. DNA-Spuren aus Hautzellen, einem Schweißtropfen, einem Speicheltröpfchen, das er während der Tat ausgestoßen hatte. Dank des technologischen Fortschritts war jede Leiche inzwischen eine forensische Schatzkarte, die nur darauf wartete, entziffert zu werden, jede Berührung, jeder Kuss, jeder Hieb und Kratzer war darauf verzeichnet. Eine ausgelassene chemische Party.
Aber derartige Entdeckungen brauchten eine gewisse Zeit, und die hatten sie nicht. Connie warf einen Blick auf die Uhr, die an der weißgekachelten Wand vor sich hintickte, und zwang sich, zügig weiterzumachen. Die Zeit lief. Nächster Abschnitt. Unterarme, Brustkorb, Magen, Bauchraum. Sie wappnete sich. Je weiter nach unten sie kam, desto blutiger und makabrer wurde der Anblick. Lose, schlaffe Haut warf Falten um den plötzlich nicht mehr vorhandenen Babybauch. Aber das war nicht aufgrund von Schlägen passiert. Es gab keine Anzeichen für stumpfe Gewalt. Dies war etwas noch viel Schlimmeres.
Ganz unten an Taras Bauch war ein Schnitt, etwa achtzehn Zentimeter lang und nur so tief, dass er die Haut bis zur obersten Muskelschicht durchtrennte. Am Rand entlang zeigten winzige Wunden in regelmäßigen Abständen an, wo Klammern gesetzt worden waren, um die Haut zu spreizen und den Zugang zu den tieferen Schichten zu erleichtern. In diesen befanden sich versetzt weitere Schnitte bis in die Gebärmutter hinein. Und damit war schon fast alles gesagt. Nicht alles, aber fast.
Jemand hatte sich gewaltsam einen Weg in Taras Körper hinein gebahnt und ihr Baby herausgeholt. Der Bauch, der sechsunddreißig Wochen lang als ideales Nest und Transportsystem gedient hatte, während das Kind sich für den Eintritt in die Außenwelt bereitmachte, war geschändet und ausgeraubt worden. Keineswegs professionell, aber durchaus passabel. Da hatte jemand seine Hausaufgaben gemacht. Hätte man die Leistung benoten müssen, wäre vielleicht eine Zwei als Fleißnote und als Gesamtbewertung eine Drei plus herausgekommen – und für einen gewaltsamen Kaiserschnitt reichte das absolut aus.
Der Fachbegriff war Fötusraub, und es war so ziemlich das schlimmste Verbrechen, das zumindest Connie sich vorstellen konnte. Und das wollte etwas heißen, wenn man bedachte, wie hoch die Latte aufgrund ihrer Berufserfahrung lag. Mord war es außerdem, aber das war nicht das Primärziel des Täters gewesen.
Die Leiche war im Grunde nur Kollateralschaden.
Man hatte nicht einmal versucht, Taras Wunden zu schließen. Sie war verblutet, während man das Kind versorgt und aus dem Gebäude gebracht hatte. Vollständig gefesselt und geknebelt hatte sie nur zu bewusst mitbekommen, wie ihr das Kostbarste genommen wurde.
Behutsam legte Connie die Hand über die Wunde, wünschte sich, sie könnte die Zeit zurückdrehen. Musste den Drang unterdrücken, die Ränder zusammenzupressen und den klaffenden Schnitt zu schließen – als könnte das das Baby in den Bauch der Mutter zurückbringen.
Taras Hände waren geschwollen. Die Operation, sofern man so pervers war, es so zu bezeichnen, hatte eine Weile gedauert. Connie tastete Zentimeter für Zentimeter Taras linke Hand ab, befühlte sanft die Knochen. Endgültig würde man es erst durch eine richtige Obduktion mit Röntgenaufnahmen wissen, aber sie meinte unter den Blutergüssen gebrochene Knochen zu spüren. Für diese Lesart sprachen auch Taras abgebrochene, blutige und schwarz unterlaufene Fingernägel.
»Du hast dich so gewehrt«, sagte sie sanft. »Ich hoffe, du weißt, dass du für dein Kind alles gegeben hast, was nur möglich war. Aber manche Kämpfe kann man nicht gewinnen. Dein Gegner war zu gut vorbereitet.« Sie tätschelte der Leiche die Hand, wie ihre Großmutter früher ihre getätschelt hatte, wenn sie Trost brauchte. Wenn man Glück hatte, lernte man früh zu lieben und bewahrte sich diese Fähigkeit ein Leben lang – oder sie blieb einem für immer versagt. Connie fragte sich, was Taras Baby in diesen ersten schweren Stunden seines Lebens sah und lernte. Wahrscheinlich nichts Gutes.
Weiter abwärts boten sich ihr kaum neue Informationen. Um Taras Fußknöchel waren wieder blaue Flecke; also waren auch sie gefesselt gewesen. Da Connie so schnell nach dem Fund gerufen worden war, war die Leiche noch nicht so entfärbt, wie es in den Tagen nach dem Tod zunehmend der Fall sein würde. Dass Obduktionen möglichst zeitnah erfolgen sollten, war eine heillose Untertreibung.
Die Tür des Leichenschauraums quietschte, klemmte, jemand hieb dagegen, und sie öffnete sich widerstrebend. Sie war jahrelang kaum benutzt worden, und offensichtlich wäre es dem Gebäude lieber gewesen, wenn der Raum geschlossen geblieben wäre.
»Dr. Woolwine, ich bin Kenneth Le Fay. Wir hatten uns gefragt, wie weit Sie schon sind …?«
»Fast fertig«, gab Connie zurück.
»Aha … wie lange dauert es wohl noch? Die Angehörigen warten nämlich bei mir im Büro. Ich weiß nicht, ob Sie darüber informiert wurden, aber die Kinderärztin schätzt die Überlebenschance für das Baby auf höchstens eine Woche, nach dieser traumatischen Trennung von der Mutter, und es ist jetzt schon über einen Tag her.«
»Mit ungefähr dem Zeitrahmen habe ich gerechnet. Danach wird die Spur sowieso kalt sein.«
»Die Leiche muss von hier weggebracht werden. Diskret, aber bald. Die Vorkehrungen sind schon getroffen.« Mr. Le Fays Stimme klang rau und kehlig, Connie fühlte sich an ein Insekt erinnert, das die Hinterbeine aneinanderreibt. Sein Blick blieb an ihrer Hand haften, mit der sie die der Leiche hielt, und er konnte seine angewiderte Überraschung nicht verhehlen.
»Meine Methoden mögen ungewöhnlich wirken«, sagte Connie. »Aber beim Profiling geht es darum, Verbindungen herzustellen, sowohl zwischen den verschiedenen Parametern des Falls als auch zwischen mir und allen Beteiligten. Alles davon hilft mir, der Lösung näherzukommen.«
»Man sagte mir schon, dass Sie etwas …« Er schien kein passendes Wort zu finden.
»Lassen Sie sich davon nicht irritieren, Direktor. Ich komme sofort.«
Er zerrte die Tür noch etwas weiter auf und machte eine auffordernde Geste.
Connie rührte sich nicht vom Fleck. »Ich wäre gern noch einen Moment allein hier.«
Er seufzte, verschwand aber ohne weiteren Einwand. Connie nahm es ihm nicht übel. Kenneth Le Fay leitete eine stark ausgelastete psychiatrische Spezialklinik für Hochsicherheitspatienten. Dieser Todesfall war für ihn nicht der erste im Amt und würde nicht der letzte sein, aber es war bestimmt derjenige, der ihm am meisten schlaflose Nächte bereiten würde.
»Ich muss gehen«, sagte Connie zu Tara und breitete das Laken Falz für Falz wieder über deren kalte Haut. »Ich werde alles tun, was ich kann. Versprechen kann ich nichts – das geht einfach nicht –, aber ich fange gleich an und gebe alles, so viel kann ich definitiv sagen. Falls es dir etwas hilft, ich glaube, im Moment ist dein Baby noch am Leben. Es tut mir so verdammt leid für dich.«
Noch einmal strich sie Tara übers Haar und beugte sich tiefer über sie, in Versuchung, sie auf die glatte Stirn zu küssen und ihr »Schlaf gut« zu wünschen. Doch die Tatsache, dass sie dabei unweigerlich ihre DNA hinterlassen würde, hielt sie davon ab. »Wenn alles vorbei ist, komme ich wieder zu dir. Gib die Hoffnung nicht auf.«
Der Hubschrauber, der Connie hier abgeliefert hatte, hatte zuvor eine Reihe gewundener Täler durchflogen, an Flussläufen entlang, wo er nur Hirsche und Schneeziegen aufstörte. Sie hatte kaum etwas davon wahrgenommen, ganz darauf konzentriert, ihre Vorabinformationen durchzugehen und sich Notizen zu machen. Während sie von leichten Turbulenzen geschüttelt wurden, hatte sie bereits zu analysieren begonnen, wie ein menschlicher Geist ticken musste, der zu einer solchen Gräueltat fähig war. Der Pilot hatte seit dem Start nichts gesagt, außer ihr die üblichen Sicherheitsanweisungen zu geben, und Connie war froh gewesen, sich in ihre Überlegungen vertiefen zu können, bis er sie schließlich angetippt und nach vorn gezeigt hatte, gerade als sie im Steigflug die obere Kante eines hohen Staudamms erreicht hatten.
»Himmel, das ist …« Ihr hatte das richtige Wort gefehlt. Beklemmend, monumental, beeindruckend, entsetzlich. Seltsam erhaben. Für manche Leute vielleicht sogar schön.
Unter ihnen befand sich nichts als eine weite Wasserfläche, die die unzähligen Grautöne des Himmels widerspiegelte. In der Ferne hüllten Wolken die Berge in geheimnisvolle Schleier. Doch zwischen See und Bergen stand ein schreiender Affront gegen die Natur, der in gewisser Hinsicht doch perfekt in die unbarmherzige Landschaft passte. Ein Bauwerk mit drei eckigen Türmen – dem höchsten in der Mitte – ließ die Umgebung geradezu klein erscheinen.
»Da sind Sie sprachlos, was? Ist jeder, der es zum ersten Mal sieht. Ich bin froh, dass ich hier immer nur Leute absetze oder abhole und dann schnell wieder weg kann. Mich gruselt, wenn ich das Ding nur sehe.«
Seinen Anfang hatte das Gebäude als Festung genommen, hatte Connie gelesen: drei Wehrtürme, die das Tal überblickten, verbunden durch niedrigere Gebäudeteile. Eine gewaltige, weitläufige Masse, als wäre der Granitboden ungleichmäßig aufgebrochen und hätte sie ausgespien in dem Versuch, die Berge im Hintergrund nachzuahmen.
Vor etwa hundert Jahren war die Charles Horatio Parry Institution for the Rehabilitation of the Criminally Insane in die Festung eingezogen, die Charles-Horatio-Parry-Anstalt zur Heilung und Pflege geisteskranker Straftäter. Der lächerliche Titel war bald zu »Parry Institution« verkürzt worden, ein Begriff, der schnell weltweit mit Psychopathen und Serienmördern verbunden wurde und dem Bemühen, hinter den berüchtigten Mauern den Wahnsinn zu zähmen und aus Löwen Lämmer zu machen. Bedlam, Topeka, Broadmoor, Rampton – und die Parry Institution. Namen, die man nur flüsternd aussprach und die auf der ganzen Welt Anlass zu Spekulationen boten.
Dem Komplex vorgelagert war eine stachelbewehrte Mauer zum Schutz vor Gefahren von außen wie von innen. Hinter den Türmen schlängelte sich eine schmale Straße die gefährlich steile Bergflanke entlang, außer dem Luftweg der einzige Verkehrsweg für Mitarbeiter, Waren, Dienstleister und Neupatienten. Für Entlassungen hingegen wurde sie weniger genutzt. Es hieß, es gäbe so gut wie keine. Die Patientinnen und Patienten der Parry Institution waren nicht von der Sorte, die über kurz oder lang wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden konnte. Hier war man lebenslänglich untergebracht, wie lange das auch sein mochte.
Als sie auf dem Weg zu dem markierten Landeplatz das Gelände überflogen hatten, hatte Connie den Personalparkplatz vor dem Gebäude, den Ladebereich für Lieferfahrzeuge neben Turm 1 und die Müllverbrennungsanlage neben Turm 3 zur Kenntnis genommen; es gab also insgesamt vier Möglichkeiten, wie ein Mensch die Einrichtung verlassen konnte, lebend oder tot. Das einzige sichtbare Wachhäuschen befand sich an der Lieferzufahrt, das hieß, den Mitarbeitern der Anstalt wurde ein gewisses Vertrauen entgegengebracht.
Die drei grauen Steingiganten der Türme waren hoch genug, um selbst den verzweifeltsten Patienten jede Lust zu fliehen zu nehmen. Natürlich waren die Fenster zusätzlich vergittert, und schon der Blick nach draußen reichte wohl aus, um die meisten Leute von einem unbefugten Ausflug abzuhalten. Nach vorn winkte Ertrinken, nach hinten gefährliche Stürze und die Macht der Naturgewalten. Und in der kalten Jahreszeit in jeder Richtung Erfrieren, bevor man auf ein Fahrzeug stieß, das einen mitnahm. Angesichts des überschaubaren Verkehrs würde der oder die Flüchtige, sobald unweigerlich der Alarm losging, aber auch dann leicht zu finden sein. Außer, es war Hilfe von innen im Spiel. Wie es bei dem Mord an Tara zweifellos der Fall gewesen war.
Ein Mitglied des Personals musste bestochen oder erpresst worden sein, Türen unverschlossen zu lassen und das Baby aus dem Komplex zu schmuggeln. Und zwar jemand, der genug Vertrauen genoss, um über Schlüssel und Türcodes auf den Stationen zu verfügen, aber einem Menschenleben so wenig Wert beimaß, dass er auch die grausamsten Taten als Mittel zum Zweck betrachtete.
Auf dieser Welt war nichts undenkbar.
Es hatte eine Zeit gegeben, da hatte Connie sich das nicht vorstellen können, hatte aufrichtig geglaubt, es gäbe eine Obergrenze dessen, was Menschen einander anzutun fähig sind. Doch das war in der fernen Vergangenheit gewesen, bevor sie angefangen hatte, für Polizeibehörden weltweit als Profilerin zu arbeiten. Vor ihrem Abschluss in Psychologie und der Weiterbildung zur forensischen Psychologin. Damals, als auch sie in einer Einrichtung einsaß – hübscher (und teurer) als diese hier, aber vom Prinzip her genau wie die, in der sie nun stand. Was sie besser wusste als jeder andere, war, dass Gut und Böse in jedem Menschen schlummerten, wie eine Art Energiepotenzial, das nur den richtigen Katalysator brauchte, um sich explosionsartig zu entladen. Dass niemand zur Gänze vertrauenswürdig war. Dass es zur Essenz des Menschseins gehörte, die finstersten Triebe und Gelüste unter der Fassade der Normalität und Routine zu verbergen. Manche beherrschten das sehr gut, andere nicht.
Dank dieser besonderen Einsicht in die menschliche Natur war Dr. Connie Woolwine hier. Hatte die schwere Entscheidung getroffen, diesen Auftrag anzunehmen, statt zu ihrer Mutter zu fahren, während ihr Vater zur Angiografie ins Krankenhaus musste. Hatte ein Treffen mit dem einzigen Mann abgesagt, der sich, soweit sie zurückdenken konnte, je für sie interessiert hatte (ihre Mutter meinte, sie »stieße die Menschen zurück«). Hatte alle Urlaubsüberlegungen aufgeschoben. Bora Bora, Australien und Marrakesch würden im nächsten Jahr auch noch da sein. Ihre Arbeit war ihr Lebensinhalt. Vielleicht, flüsterte eine Stimme in den dunkelsten Tiefen ihres Gehirns, ist das sogar buchstäblich das Einzige, wofür du lebst.
Und in diesem Moment waren Connies Arbeit, ihre Fachkenntnis und ihre natürliche Gabe, in Menschen zu lesen, absolut essenziell. Weil zwischen ihr und dem Ziel, Taras Baby zu finden, eine Station voller verurteilter Serienmörder und Psychopathen lag.
Kapitel 2
Montag
Ohne sich die Mühe zu machen, anzuklopfen, betrat Connie das Büro ganz hinten im Verwaltungstrakt. Die Sicherheitsleute hatten nur einen Blick auf das Schild geworfen, das von dem Band um ihr Handgelenk baumelte, und sie nicht weiter aufgehalten. Den Sekretariatsangestellten hatte man Grund gegeben, nicht an ihren Schreibtischen zu sein.
Vier Personen standen auf, als sie in das große Zimmer mit dem Panoramafenster trat, das auf den Fuß der Berghänge hinausging. Kenneth Le Fay kam hinter seinem wuchtigen Schreibtisch hervor, um sie auf dem großen Teppich zu begrüßen, der sich verzweifelt – und vergebens – bemühte, dem Raum eine freundlichere Atmosphäre zu verleihen.
»Dr. Woolwine«, sagte er. »Setzen Sie sich zu uns.«
Sie streckte ihm die Hand entgegen und bemerkte seinen Gesichtsausdruck. Dass er daran dachte, wie sie die Hand der toten jungen Frau gehalten hatte. Abrupt drehte er sich zur Seite und steckte seine Hand stattdessen in die Tasche.
»Der Tod ist nur selten ansteckend«, murmelte sie und ging an ihm vorbei.
Der jüngste der drei Unbekannten trat vor. Er war fast so bleich wie die Frau, von der sie gerade kam. »Können Sie uns helfen? Haben Sie irgendeine Idee, wer das war oder wie man ihn finden kann?«
»Das ist Johannes Cameron, Taras Mann«, stellte Kenneth Le Fay ihn vor. »Und Taras Eltern, Keira und Francis Lyle.«
»Ich tue alles, was ich kann, aber sicher ist nichts. Das Zeitfenster, um das Baby heil zu finden, ist kurz«, sagte Connie.
»Nur eine Woche«, bestätigte Francis Lyle, »und auch nur, wenn bei der … Sache nicht noch etwas vorgefallen ist, was unsere Enkelin noch mehr geschädigt hat.«
»Aurora«, warf Johannes ein. »Den Namen hat Tara ausgesucht. Ich möchte, dass wir sie so nennen.«
Francis Lyle nickte. »Aurora, ja. Ich habe gleich mit einer Kinderärztin gesprochen, als wir es erfuhren. Sie sagte, ihrer Erfahrung nach sind andere Leute als die Eltern – außer kindermedizinischem Fachpersonal – meist nicht gut dafür ausgerüstet, ein Baby zu versorgen. Und da Aurora auch noch zu früh … unserer Tochter genommen …«
»Ich weiß«, sagte Connie. »Wir sollten davon ausgehen, dass wir ab heute höchstens fünf Tage haben. Darf ich die Lösegeldforderung sehen?«
Francis Lyle nahm ein Blatt Papier von Le Fays Schreibtisch und reichte es ihr. »Es wurde an meinen Steuerberater geschickt, mit dem wir auch persönlich befreundet sind.«
Connie las die ausgedruckte Mail vor. »Beschaffen Sie fünf Millionen Crater Coins und überweisen Sie sie in Batches an die unten genannte E-Wallet. Nach Erhalt informieren wir Sie, wo das Baby ist. – Kryptowährung. Clever. Fast nicht rückverfolgbar. Haben Sie vor zu zahlen?«
»Die Polizei rät davon ab. Sie sagt, die Chance, dass die entführte Person zurückkommt, wird durch eine Zahlung auch nicht höher«, sagte Le Fay.
»Wir zahlen«, entgegnete Francis Lyle in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete.
»Wird die Polizei die Überweisung überwachen? Sie muss ja der Spur des Geldes, oder der Crypto Coins, folgen.«
»Die Polizei wird sich mit meinem Steuerberater zusammentun, der sich um den Kauf und die Abwicklung kümmert. Eine digitale Wallet haben wir schon eingerichtet und die geforderten Mittel dort deponiert. Seien Sie versichert, dass wir jeden Geldtransfer pünktlich erledigen werden. Wir werden den Kidnappern keinen Anlass bieten, dem Kind etwas zu tun.«
»In Ordnung«, sagte Connie. »Ich verstehe Ihre Entscheidung. Aber diese Sache ist besonders heikel. Haben Sie – verzeihen Sie, wenn ich das so plump sage – irgendwelche Beweise bekommen, dass das Kind lebt?«
»Im Anhang war ein Video. Wir haben ein Standbild davon gemacht. Hier.« Francis Lyle reichte ihr ein zweites Blatt.
Das Baby hatte die Augen fest geschlossen. Es war in ein schlichtes weißes Handtuch gewickelt, nur das winzige Gesichtchen und die Arme schauten heraus. Es hätte jedes beliebige Kind überall auf der Welt sein können, abgesehen von der Tatsache, dass in einer Ecke ein Teil eines Gesichts zu sehen war, das unverkennbar Tara Cameron gehörte.
»Man versucht, die Mail zurückzuverfolgen?«, erkundigte sich Connie.
»Uns wurde gesagt, sie ging durch einen Onion-Router«, sagte Johannes. »Über so viele Server auf der ganzen Welt, dass sie unmöglich rückzuverfolgen ist.«
»Konnten Sie die Entführer informieren, dass Sie die Mail bekommen haben und gewillt sind, zu zahlen?«
»Ja. Und wir haben gefordert, dass sie uns täglich ein neues Video schicken, dem ganz klar das aktuelle Datum zu entnehmen ist.«
»Gut. Bitte leiten Sie mir die Videos weiter. Ich muss alle Informationen bekommen, die auch die Polizei hat. Kann sein, dass mir aufgrund dessen, was ich hier mitbekomme, irgendein Detail auffällt, das die Beamten nicht als relevant erkannt haben.« Sie gab Francis die Blätter zurück.
»Ich will sie sehen«, schrie Keira Lyle plötzlich. Alle Blicke wandten sich ihr zu. »Ich will meine Tochter sehen. Jetzt, hier. Ich will nicht warten. Sie braucht mich.«
Francis Lyle seufzte und streckte die Hand nach seiner Frau aus. Sie wich einen Schritt zurück. »Liebes, wir haben doch alle dem Ablauf zugestimmt. Wir können Tara sehen, sobald sie von hier weggebracht worden ist.«
»Aber sie durfte sie sehen!« Mit zitterndem Finger zeigte Taras Mutter auf Connie. »Sie wurde hier eingeflogen und durfte sofort zu meiner Tochter. Das ist doch alles Wahnsinn. Warum kann die Polizei nicht einfach kommen und alle in dieser verdammten Anstalt verhaften, bis wir herausgefunden haben, wer sie umgebracht hat?«
»Das Wichtigste ist doch jetzt, das Baby zurückzubekommen«, sagte Francis. »Die Polizei meint, wenn sie zu schnell vorgeht, könnten die Leute, die Aurora haben, Panik bekommen und sie töten oder einfach irgendwo aussetzen, sodass sie stirbt.«
»Von unseren Patienten wird keiner irgendwohin gehen«, fügte Kenneth Le Fay hinzu. »Und jedes Mitglied des Personals, das diese Woche die Anstalt ungeplant verlässt, würde damit im Prinzip zugeben, dass es in der Sache mit drinsteckt. Was wir brauchen, sind Informationen von innen, aus der Station. Und die können wir von Dr. Woolwine bekommen.«
»Aber sie ist tot. Meine Kleine ist tot. Mein Baby. Warum versteht mich niemand von euch?«
Connie trat zwischen die beiden Männer, die so verstört waren, so überwältigt von dem Druck, das vermisste Baby zu finden, dass sie unfähig waren, ihre Frau beziehungsweise Schwiegermutter zu trösten. Sie ergriff fest Keira Lyles Hände, drang in deren unsichtbare persönliche Sphäre vor, zog ihre Aufmerksamkeit auf sich. »Tara wünscht sich, dass wir ihr Kind finden«, sagte sie. »Sie müssen ihr helfen, indem Sie noch ein kleines Weilchen stark bleiben, damit wir Aurora helfen können.«
Keira Lyle begann zu schluchzen.
»Dass ich zu ihr durfte, hatte zwei Gründe. Erstens muss ich, wenn ich die Menschen finden will, die Ihrer Kleinen das Leben genommen haben, mit eigenen Augen sehen, womit ich es zu tun habe. Es wäre mir nicht recht, wenn Sie sie jetzt zu sehen bekämen, und so eng, wie Taras Beziehung zu Ihnen war – das merke ich deutlich –, würde sie auch nicht wollen, dass Sie sie so sehen.«
Keira senkte den Kopf; schwere Tränen fielen auf ihrer beider Hände. »Ich kann das nicht. Bitte. Bitte finden Sie einen anderen Weg. Ich muss meine Kleine im Arm halten.«
»Ich weiß«, sagte Connie. »Aber der zweite Grund, warum ich bei Tara war, bestand darin, herauszufinden, was sie sich jetzt von uns wünscht.«
»Hören Sie auf, bitte. Ich will das alles nicht hören.«
Connie drückte sanft die Hände der Frau. »Ihre Tochter hat sich gegen denjenigen gewehrt, der ihr das angetan hat. Mit aller Kraft, auch nachdem ihr schon klar war, dass sie ihr eigenes Leben nicht würde retten können. Sie hat alles gegeben, um Ihre Enkelin zu retten. Eine andere wäre vielleicht vor Angst oder Schmerz gelähmt gewesen. Hätte sich vom Grauen dessen, was mit ihr passierte, überwältigen lassen. Tara nicht. Ich glaube, sie war etwas Besonderes. Und nach meiner Erfahrung haben besondere Frauen meist auch besondere Mütter. Können Sie ihr helfen, jetzt, wo sie es am meisten braucht, Mrs. Lyle? Noch einmal tief Atem holen, die Zähne zusammenbeißen, Tara ihren Wunsch erfüllen? Nämlich alles zu tun, um Aurora in Sicherheit zu bringen?«
Die Schluchzer verstummten. Keira Lyle zitterte noch immer am ganzen Leib, aber sie zwang sich, den Kopf zu heben. »Es tut so weh«, sagte sie. »Das überlebe ich nicht.«
»Mit Ihrer Enkelin im Arm können Sie es vielleicht eher überleben«, sagte Connie. »Ich habe Tara versprochen, dass wir alles versuchen, um das zu erreichen.«
»Haben Sie … haben Sie mit ihr gesprochen?« Zum ersten Mal erwiderte sie Connies Händedruck.
»Ja. Ich habe ihre Hand gehalten, genau wie jetzt Ihre. Ich habe ihr übers Haar gestrichen, so wie Sie es sicher tausendmal gemacht haben. Ich habe ihr gesagt, dass ich nicht ruhen werde, bis ich die Menschen gefunden habe, die ihr dieses Leid zugefügt haben.« Keiras Lippen entrang sich noch ein Schluchzer. »Können Sie mir erzählen, wie sie war? Alles, was Ihnen einfällt. Es wird mir helfen. Setzen wir uns doch.« Noch immer Keiras Hände haltend, um den Kontakt nicht abreißen zu lassen, führte sie sie zu einem kleinen Sofa am Kamin und setzte sich neben sie.
»Ich war so dagegen, dass sie hier arbeitet«, begann Keira. »Mir war der Gedanke zuwider, sie hier an diesem Ort bei diesen Leuten zu wissen. Das Schlimmste ist, ich glaube, ich wartete fast darauf, dass etwas passierte. Ich … ich wollte recht behalten. Damit sie zu mir kommt und mir sagt, sie würde kündigen.«
»Natürlich«, sagte Connie. »Welche Mutter will denn, dass ihre Tochter mit so gefährlichen, kranken Menschen umgeht? Sie wollten sie beschützen.«
»Aber es kommt mir vor, als hätte ich vielleicht –« Abrupt brach sie ab, ihr Mund ein stummes Rund des Entsetzens.
»Nein. Sie haben das nicht herbeigeführt«, sagte Connie. »Sie haben nicht ein Tor in eine Welt geöffnet, wo das passieren kann. So etwas gibt es nicht. Ihr Gehirn will Ihnen vorgaukeln, Sie wären schuld. Fast alle Eltern, die ein Kind verlieren, entwickeln unbegründete Schuldkomplexe. Später kann ich Ihnen helfen, das zu überwinden, aber jetzt müssen Sie mir einfach glauben, wenn ich Ihnen sage, dass Sie diese inneren Dämonen unter Kontrolle bekommen müssen, die versuchen, Ihre Trauer gegen Sie zu wenden. Ich würde gern hören, was Taras herausragende Eigenschaften waren. Was sie für ein Mensch war.«
»Sie war überzeugt, sie könnte hier etwas Gutes bewirken«, sagte Johannes vom Fenster her, wo er mit dem Rücken zu ihnen allen stand. »Deshalb wollte sie nicht weg. Du warst nicht die Einzige, die wollte, dass sie kündigte, Keira. Ich bat sie, mir zu versprechen, dass sie nach der Babypause nicht zurückkehren würde.«
»Sie hätte auch Medizin studieren können«, sagte Keira. »Sie war intelligent, sie war auf den besten Schulen, sie war immer fleißig und hatte gute Noten. Ich sagte ihr, als Krankenschwester würde sie ihr Talent vergeuden, aber sie wollte es so. Einfach nur für Menschen sorgen. Sie sagte, sie hätte im Leben so viele Vorteile und Privilegien genossen, die einzige Möglichkeit, das auszugleichen, bestünde darin, zu den bedürftigsten, ausgestoßensten, hoffnungslosesten Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft zu gehen und zu versuchen, dort etwas zu bewirken.«
»Und abgesehen von der Arbeit? Womit beschäftigte sie sich gern?«
»Basteln. Handarbeiten«, sagte Johannes leise. »Ich hielt das immer für Zeitverschwendung, aber im Grunde war es ihre Methode, von dem runterzukommen, was sie hier erlebte. Bei unserer Hochzeit machte sie alle Gastgeschenke selber, alles ganz persönliche Sachen für sämtliche Eingeladenen.«
»Das klingt wunderschön«, sagte Connie. »Und hatte sie enge Freunde außer ihrer Familie? Ging sie gern unter Leute?«
»Bis sie schwanger wurde, ja. Aber seither war sie nur noch mit dem Nestbau beschäftigt. Von dem Tag an, als wir erfuhren, dass wir Eltern wurden, hat sie nur noch das Kinderzimmer eingerichtet und auf ihre Gesundheit geachtet. Hat mit Schwangerschaftsyoga angefangen. Sie kam auch öfter nach Hause. Vorher legte sie sich die Schichten so, dass sie meist etwa drei Tage die Woche komplett hier blieb. Das war durchaus sinnvoll, so abgelegen, wie die Klinik ist, und ich war ja beruflich auch viel unterwegs.«
Im Raum entstand eine unbehagliche Stille.
»Ich hätte sie besser beschützen sollen«, sagte Johannes. So leise er sprach, die Worte schrien den Selbsthass geradezu heraus.
»Vor ihrem Beruf? Vor ihrem Recht, frei zu wählen, was sie im Leben wollte? Davor wollte Ihre Frau nicht beschützt werden«, erwiderte Connie.
Kenneth Le Fays Festnetztelefon gab ein leises Summen von sich. Er trat an den Tisch und nahm den Anruf an, legte aber gleich wieder auf und drückte ein paar Tasten auf seinem Laptop. Auf dem Bildschirm erschien eine Aufnahme von einem Wäschereiwagen, der gerade in drei Zügen wendete, um rückwärts in eine offen stehende Garage des Gebäudes einzuparken.
»Die Polizei ist da«, sagte er. »Und jemand von der Gerichtsmedizin. Sie werden den Transport von Taras Leichnam koordinieren. Sie haben einen Plan des Gebäudes, und in der Garage ist ein Schlüsselbund für sie deponiert. Der Transporter kommt von unserer üblichen Wäscherei, sodass möglichst wenige Leute hier etwas mitbekommen.«
»Gut«, sagte Connie. »Die Beteiligten an dem Verbrechen rechnen natürlich damit, dass es Ermittlungen oder irgendeine Art Intervention geben wird, und mich werden sie unweigerlich verdächtig finden, aber ich sollte in der Lage sein, hier drin wenigstens einige Personen auszuschließen, die definitiv unbeteiligt sind, während die Polizei die Ermittlungen draußen vorantreibt.«
»Wie gehen Sie … verzeihen Sie, wenn ich das so sage, laut Polizei sind Sie die Beste auf Ihrem Gebiet … aber es klingt ein bisschen vage. Wie können Sie ein so genaues psychologisches Täterprofil erstellen, dass Sie sagen können, wer schuldig oder unschuldig ist?«, fragte Francis Lyle.
Connie kannte diese Frage. Sie hatte ihre Berechtigung. Psychologie und ihre praktischen Anwendungen wurden in dieser technologisierten, konsumorientierten Welt oft als Hokuspokus betrachtet, und selbst sie hatte das meiste, was sie über ihr Metier wusste, unter ungewöhnlichen Umständen außerhalb der Seminarräume gelernt.
»Die Erstellung eines psychologischen Profils ist insofern eine Wissenschaft, als sie gute Kenntnisse über das menschliche Verhalten, Soziologie und die Funktionsweise des Gehirns voraussetzt, außerdem in Psychiatrie und Kriminologie. Mir ist klar, dass es von außen ein bisschen wie ein Ratespiel erscheinen kann. Aber ich versichere Ihnen, das ist es nicht. Wir suchen nach Mustern und Anomalien. Die meisten Menschen geben genau dann etwas von sich preis, wenn sie am stärksten etwas zu verbergen versuchen. Sicher, üblicherweise gehört es zu meiner Arbeit, auch den Tatort und alle verfügbaren Kommunikationsmittel auszuwerten und zu sehen, ob Parallelen zu früheren Verbrechen bestehen, zum Beispiel in der Wahl des Tatorts, des Opfers, der Methoden und so weiter. Insofern ist das hier eine sehr ungewöhnliche Situation. Aber vergessen Sie nicht, dass ich es hier mit einem sehr engen Kreis von Verdächtigen zu tun habe. Auf Station H, wo der Mord geschehen sein muss, gibt es fünf Patienten. Hinzu kommen acht Beschäftigte mit Zugang zu den Schlüsseln, die alle hier vor Ort wohnen.«
»Aber Sie werden verdeckt ermitteln. Sie können ja die Leute nicht einfach befragen und ihre Anworten bewerten«, sagte Francis Lyle.
»Nicht offen, da haben Sie recht. Aber ich ziehe auch Informationen aus informellen Gesprächen, normalen Unterhaltungen, wenn die Menschen nicht auf der Hut sind. Sie besitzen doch mehrere erfolgreiche Unternehmen, Mr. Lyle. Ich bin mir sicher, Sie wären nicht dort hingekommen, wo Sie heute stehen, wenn Sie andere Menschen nicht anhand ihrer Mimik und Körpersprache einschätzen könnten und wüssten, wie man zwischen den Zeilen liest.«
Francis Lyle bedachte das kurz und nickte dann.
»Ich werde in ständiger Verbindung zu Ihnen allen und der Polizei bleiben«, fügte Le Fay hinzu. »Sie bekommen auch Dr. Woolwines Handynummer, damit Sie ihr alles, was Ihnen wichtig erscheint, weitergeben können. Aber bitte beschränken Sie den Kontakt auf diesen Zweck. Ich werde Sie, so regelmäßig ich es einrichten kann, ausführlich informieren und bin vierundzwanzig Stunden am Tag für Sie erreichbar.«
Connie sah auf die Uhr, bemerkte, dass es schon fast zwölf Uhr mittags war, und stand auf. »Ich sollte anfangen.«
»Geben Sie mir Ihr Wort, dass Sie die Leute finden, die das waren«, sagte Keira Lyle. »Wenn wir das wirklich so machen sollen, wenn wir unser ganzes Vertrauen in Sie setzen, muss ich sicher sein, dass unserer Tochter Gerechtigkeit widerfahren wird.«
»Das kann ich nicht versprechen, Mrs. Lyle. Da müsste ich lügen. Ich kann nur sagen, dass dies Ihre beste Chance ist, Ihre Enkelin lebend zurückzubekommen. Mit Sicherheit.«
Connie ließ die vier in Le Fays Büro zurück, jeder für sich allein, wie auf verschiedenen Inseln gestrandet, zu weit entfernt, um zueinander zu schwimmen. So war das bei unerwarteter Trauer. Sie verletzte die Opfer so, dass sie von niemandem berührt werden wollten.
»Dr. Woolwine!« Es war Johannes Cameron.
Schon in der Tür, drehte sich Connie noch einmal um.
»Tara liebte Musik. Johnny Cash, Neil Diamond, Tom Petty, Bruce Springsteen. Sie hat immer vor sich hingesungen, oft ganz unbewusst.« Ihm versagte die Stimme, er zuckte matt mit den Schultern. »Helfen Sie uns, meine Tochter wiederzubekommen. Ich will nicht, dass sie in den Armen eines Fremden stirbt.«
Kapitel 3
Montag
Als sie sich an der Rezeption offiziell anmeldete und ihr Gepäck ablieferte, sprang ein Jugendlicher auf sie zu, nahm ihre Hand und schüttelte sie kräftig. »Willkommen in der Parry Institution«, sagte er übers ganze Gesicht strahlend. »Ich bin Boy, Fremdenführer vom Dienst. Was kann ich für Sie tun?«
Trotz der schrecklichen Umstände konnte Connie nicht anders, als das Lächeln des Jungen zu erwidern. »Vielen Dank. Ich bin gerade eingestellt worden und arbeite in Turm 2, auf Station H. Wie komme ich dorthin?«
»Ich kann Sie hinbringen. Dazu bin ich da. Also, unter anderem. Ich hab hier so einige Aufgaben. Kommen Sie, hier lang.«
Sie folgte ihm. »Boy?«, fragte sie, während sie einen langen fensterlosen Flur entlanggingen. »Heißt du wirklich so?«
»Meine Eltern konnten sich auf keinen Namen einigen und stritten dermaßen darüber, dass mein Vater meinte, sie sollten mich einfach Boy nennen, und meine Mutter war so wütend, dass sie zum Standesamt ging und das eintragen ließ, nur um ihn zu ärgern.« Er grinste. »Ich find’s nicht schlimm. Man gewöhnt sich an alles. Darf ich fragen, warum Sie keine Uniform anhaben? Hier tragen alle eine.«
»Ich bin keine Pflegerin oder Ärztin, sondern Psychotherapeutin, das fällt aus diesem Schema raus. Arbeitest du gern hier?«
»Meine Mutter hat auch schon hier gearbeitet, und als ich sechzehn wurde, hat sie mir diesen Job besorgt. Ich find’s okay. Jeder Tag ist anders. Manchmal führe ich Leute herum. Oder ich helfe den Hausmeistern oder Handwerkern. Am liebsten hab ich die Arbeit im Kreativbereich.«
Sie erreichten einen Aufzug, der sichtlich für ein Rollbett mit Begleitern bemessen war. Boy drückte auf den Knopf für den zweiten Stock.
»Der Kreativbereich?«, erkundigte sich Connie. »Was wird dort gemacht?«
»Direktor Le Fay sagt, Kunst ist gut für die Seele. Es gibt hier Musik- und Tanzunterricht, Mal- und Töpferkurse und Kreatives Schreiben. Den Patienten macht’s Spaß. Ist auch die einzige Gelegenheit, wo sie mal länger von ihrer Station wegkommen, außer bei Terminen mit ihren Anwälten oder wenn sie ihren monatlichen Besuch bekommen.« Er senkte die Stimme, obwohl sie allein im Aufzug waren. »Die meisten bekommen nicht mal so oft Besuch. Die Anstalt ist abgelegen.«
Connie lächelte. »Das hab ich bemerkt. Darf ich fragen, wie alt du bist?«
»Siebzehn. Angeblich hört man erst mit neunzehn auf zu wachsen, also hab ich noch zwei Jahre, um meine endgültige Größe zu erreichen. Ich würde gern richtig groß werden. Wie groß waren Sie, als Sie neunzehn wurden?«
»Ich war …« Connie verstummte. Die Erinnerung an ihren neunzehnten Geburtstag war nicht glücklich. Sie hatte lange daran gearbeitet, sie ad acta zu legen. »Da habe ich mich nicht gemessen. Ich denke, ich war schon so groß wie jetzt, also eins siebzig. Damals war ich auch an einem ähnlichen Ort wie dem hier. Wir haben also etwas gemeinsam. Arbeitet deine Mutter immer noch hier?«
»Nein, nein, sie ist ziemlich schnell gegangen, nachdem ich angefangen habe. Aber sie hat mir gesagt, ich soll bleiben. Unbefristete Jobs sind schwer zu finden. Und ich kann hier wohnen und essen, und meine Wäsche kriege ich auch gewaschen. So konnte meine Mum mein Zimmer zu Hause vermieten, deshalb muss sie nicht mehr so viel arbeiten, was ja gut ist.«
Connie betrachtete Boys lächelndes, offenes Gesicht, die Sommersprossen, die in einer sonnigeren Gegend viel stärker hervorgetreten wären, die Unschuld, die mit der Zeit immer mehr schwinden und zu Zynismus werden würde, wenn ihm klar werden würde, wie übel seine Mutter ihm mitgespielt hatte.
»Hast du Freunde hier, Boy? Leute, mit denen du gern zusammen bist?«
»Ach, ich mag eigentlich alle. Also, die meisten jedenfalls. Alle kann man nicht mögen, aber ich schaue halt, dass ich denen aus dem Weg gehe, die …« Er brach ab und legte den Kopf schief. »Es gibt solche und solche – sagt meine Mutter immer.«
Sie verließen den Aufzug, und der Junge zeigte auf eine Tür. »Ab hier müssen wir laufen. Das ist die Treppe zu Turm 2. Wussten Sie, dass manche Teile des Gebäudes schon fast zweihundert Jahre alt sind? Ich finde das toll. Manchmal berühre ich die Mauern und stelle mir vor, wie das vor vielen Jahren schon andere gemacht haben und wie es gebaut wurde, Stein für Stein, und was hier schon alles passiert ist.«
»Weißt du, wie viele Patienten hier insgesamt wohnen?«
»Bis zu zweihundertvierzig«, sagte er stolz. »Darüber weiß ich alles. In Turm 1 können bis zu hundert untergebracht werden – da sind die Frauen- und Seniorenstationen. In Turm 3 auch hundert, das sind alles Männer, die nicht ganz so schweren Fälle. In Turm 2 sind die Hochrisikopatienten. Da sind nur sechsunddreißig untergebracht, obwohl da am meisten Platz ist.«
»Wie viele Stationen hat Turm 2 denn?«
»Sechs. Und weil die Patienten absolut nicht rausdürfen, auch nicht zu den Kursen und nicht mal zum Sport, brauchen sie größere Zimmer und eigene Gemeinschaftsbereiche. Und mehr Personal ist da auch.«
»Beeindruckend«, sagte Connie. »Du weißt ja wirklich alles über die Einrichtung. Und was ist mit dir? Wo bist du zu Hause?«
»Hm …« Er richtete den Blick nach oben in das geräumige Treppenhaus, als wollte er sich etwas Bestimmtes ins Gedächtnis rufen. »Weiß nicht so recht. Nach Hause kann ich nicht mehr so einfach gehen, jetzt, wo mein Zimmer vermietet ist, und außerdem wohnt da der neue Freund von meiner Mutter, also ist es nicht so günstig. Sagen Sie, mögen Sie Schoko-Brownies? Montags gibt es die in der Kantine immer ganz frisch, und wenn man möchte, wärmen sie sie einem sogar auf. Wenn Sie heute viel zu tun haben, tu ich Ihnen ein paar beiseite. Wenn man spät zum Essen kommt, sind oft keine mehr da.«
Es erleichterte Connie zutiefst, dass das Gebäude trotz seines düsteren Zwecks etwas Unschuldiges barg. »Das wäre super. Wie viele Stockwerke sind es denn bis zur Station H?«
»Bis zum Himmel.« Boy zwinkerte ihr überdeutlich zu. Connie fühlte sich an eine Figur aus einem Film der Vierzigerjahre erinnert, die dem naiven Publikum bedeutete, dass gleich etwas Albernes angestellt werden würde.
Sie spielte mit. »Bis zum Himmel?«
»Ja, Station H für Himmel.«
Er sprang ihr voraus, Etage um Etage, bis zu einer verschlossenen Tür, wo er den Summer drückte. Ein paar Sekunden später klickte das Schloss. Er trat zurück.
»Du kommst nicht mit rein?«, fragte Connie.
»Ich darf nicht. Für hier braucht man eine Sondergenehmigung. Ich hoffe, Sie bleiben hier, war schön, mit Ihnen zu reden.«
»Mit dir auch.« Connie musste den Drang unterdrücken, die Hand auszustrecken und ihm übers verwuschelte Haar zu streichen. »Ich versuche, dich nachher zu finden, wegen der Brownies.«
Sie trat ein. Hinter ihr fiel die Tür wieder ins Schloss. Aus einem Zimmer gleich daneben kam gähnend und sich die Augen reibend eine Pflegerin.
»Sie werden schon im Personalraum erwartet«, sagte sie. Ihr dunkles Haar war verfrüht von grauen Strähnen durchzogen, und der Schmutz an ihren Schuhen ließ erkennen, dass sie den Kampf des Putzens aufgegeben hatte. »Ich bin Dawn Lightfoot, eine der Schwestern hier auf Station. Kommen Sie, bald ist Medikamentenausgabe.«
Connie folgte ihr. So alt die Anlage war und so martialisch sie von außen wirkte, hier drinnen sah es aus wie in jedem modernen Krankenhaus, nur mit zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen. Alle Türen bestanden aus Stahl und hatten zwei Schließsysteme, ein manuelles und ein elektronisches. Die Sichtfenster darin enthielten dicke Drahtgitter, sodass niemand die Hand hindurchstrecken konnte, selbst wenn das Glas zerschlagen wurde. Hoch in den Ecken lauerten Kameras.
»Wenn Direktor Le Fay gegangen ist, kriegen Sie eine Sicherheitseinweisung. Wir sollten ihn nicht aufhalten. Fragen Sie nur das Nötigste. Wir haben viel zu tun, und eine aus dem Team fehlt.«
»Verstanden«, sagt Connie.
Schwester Lightfooot brachte sie in einen Aufenthaltsraum. Eine Wand war von weißen Kunststoffstühlen gesäumt, an der nächsten war ein Fernseher und ihm gegenüber standen zwei lange Sofas. An der vierten Wand hing eine große Wandtafel, vor der Kenneth Le Fay gerade mit einem hochgewachsenen, schlanken asiatischstämmigen Mann in dem tadellosesten Anzug sprach, den Connie je gesehen hatte.
»Ah, dann können wir ja anfangen. Bitte setzen Sie sich«, sagte Le Fay. »Vielen Dank, dass Sie sich alle hierherbemüht haben, obwohl einige von Ihnen keinen Dienst haben. Es gibt ein paar dringende Dinge zu besprechen.« Sein Ton wirkte selbstsicher, aber seine Hände ballten sich zu Fäusten, die Finger zuckten. Connie beschwor ihn innerlich, sich zu entspannen. »Wie Sie wissen, hätte Schwester Cameron eigentlich erst Ende dieser Woche in Mutterschutz gehen sollen. Aber heute Nacht ging es ihr nicht gut. Sieht aus, als wäre es der Blutdruck gewesen. Sie ist jetzt in einer gynäkologischen Spezialklinik und wird dort überwacht. Sie soll sich fürs Erste auf keinen Fall belasten oder aufregen, bis man weiß, wie es dem Kind geht. Ich würde Sie bitten, ihr die nötige Ruhe zu gönnen. Sobald das Kind da ist, wird sie uns alle bestimmt kontaktieren.«
Connie zwang sich, den Blick auf Le Fay gerichtet zu halten, sosehr es sie auch drängte, die Übrigen im Raum unauffällig zu mustern. Glaubwürdig Betroffenheit zu simulieren war schwierig, und sie hätte sich gern schon einmal einen Überblick verschafft, indem sie in den Mienen las, aber damit wäre sie aus der Rolle gefallen. Hinzu kam, dass sie sich sicher war, dass auch sie beobachtet wurde. Jetzt den Blick wandern zu lassen hätte bedeutet, sich sofort zu verraten.
»Wie geht es ihr? Sie ist so kurz vor dem Termin, sie hätte niemals so lange arbeiten sollen. Das habe ich ihr auch gesagt«, sagte Schwester Lightfoot.
Le Fay ließ sich nichts anmerken. Connie war beeindruckt. »Taras Mann hat mir versichert, dass sie sich momentan wieder gut fühlt und das Baby nicht in Gefahr ist. Also keine Panik. Ich fürchte nur, ich muss Sie bitten, Taras Schichten unter sich aufzuteilen, bis wir Ersatz haben.«
»Kriegen wir dafür Überstundenzuschläge?«, fragte ein Mann. Er war so breit, dass er den Stuhl neben sich auch noch halb ausfüllte, und so groß, dass Connie schätzte, im Stehen würde sie ihm nur zur Brust reichen. Seine Nase sah aus wie die eines Boxers oder Kampfsportlers. Wahrscheinlich war er eine Kombination aus Wachmann und Krankenwärter.
»Da finden wir sicher eine Regelung, Tom«, gab Le Fay zurück, ohne sich die Mühe zu machen, seine Irritation zu verbergen.
Connie war nicht überrascht über die Kaltschnäuzigkeit. Nach ihrer Erfahrung arbeiteten in der geschlossenen Psychiatrie zwei Arten von Menschen – diejenigen, die sich dazu berufen fühlten, weil sie glaubten, damit etwas Gutes zu tun, und diejenigen, denen es ums Geld ging. Dazwischen gab es nichts.
»Nun zu dem Grund, aus dem ich heute hier bin«, fuhr Le Fay fort. »Sie werden bemerkt haben, dass unter uns ein neues Gesicht ist. Bitte heißen Sie Dr. Connie, wie sie angesprochen werden möchte, herzlich willkommen.« Es gelang ihm ganz gut, so zu tun, als wären sie einander völlig fremd. Die Gleichgültigkeit des Publikums war sehr hilfreich. Seine Begrüßung löste keinerlei Reaktion aus.
Er nannte Connie der Reihe nach die Namen der Anwesenden, ohne ihr oder ihnen Gelegenheit zu geben, etwas zu sagen, und fuhr an alle gewandt fort: »Was ich Ihnen jetzt sage, geht über unsere übliche Schweigepflicht hinaus in den Bereich der nationalen Sicherheit. Dr. Connie wurde vom Militär als Spezialtherapeutin für einen Patienten bestellt, der heute ankommen wird. Sie wird etwa einen Monat lang hier sein, während der Eingewöhnungsphase. Ich erwarte, dass Sie sie in jeder Hinsicht unterstützen, ihr Zugang zu allem gewähren, was sie braucht, und ihren Anweisungen Folge leisten. Und jetzt übergebe ich an Dr. Ong, der Ihnen das klinische Bild des Neuzugangs schildern wird.«
Unterdrücktes Stöhnen und leises Murmeln. Ein paar der Anwesenden sahen auf die Uhr. Kenneth Le Fay trat beiseite, und Dr. Ong nahm mit der Akte in der Hand eine gebieterischere Haltung ein. Connie blieb reglos und stumm. Ihre selbstgesetzte Aufgabe an jedem ersten Tag in einem neuen Einsatz war es, zu beobachten und möglichst viel in Erfahrung zu bringen, dabei aber selbst im Hintergrund zu bleiben.
»Vielen Dank, Direktor Le Fay. Zunächst einmal: Sie alle werden feststellen, dass der Neuzugang, Patient B, anders als unsere üblichen Gäste keinen medienwirksamen Prozess hinter sich hat. Tatsächlich werden Sie, sofern das Militär alles ordentlich gemacht hat, noch nie von ihm gehört haben. Das liegt daran, dass sowohl die Verhandlung als auch die psychiatrische Begutachtung militärintern stattfanden.«
»Müssen wir ihn etwa Patient B nennen?«, fragte Schwester Lightfoot.
»Nur bis Dr. Connie ihr Eingliederungsgutachten erstellt hat. Sollte er langfristig bei uns zu Gast bleiben, werden wir mehr Informationen über ihn erhalten, auch seinen vollen Namen. So ist die Vorgabe der Militärbehörden, damit nicht unter Umständen zweimal sensible Informationen preisgegeben werden«, erklärte Ong.
»Warum ist er nicht in einem Militärgefängnis?«, fragte Tom.
»Weil keines der Militärgefängnisse optimal für psychisch kranke Straftäter eingerichtet ist, und auch, weil es sein kann, dass seine Psychose durch seine Auslandseinsätze hervorgerufen wurde. Daher hielt man es für sinnvoll, ihn aus der militärischen Umgebung zu entfernen, um zu sehen, ob eine Verbesserung seines Zustands erreicht werden kann.«
»Was hat er denn angestellt?«, fragte eine Schwester.
»Er hat während seiner Einsätze zwölf Menschen gefoltert, verstümmelt und ermordet. Es handelte sich um legal zur Befragung festgehaltene Personen. Die ersten Fälle hielt man noch für fahrlässigen Totschlag, aber dann begann man zu ermitteln und fand ein Muster. Daraufhin berief man eine Kommission ein, und schließlich kam es zum Prozess.«
»Gut, aber was genau hat er seinen Opfern angetan?«, beharrte die Schwester. »Sensible Informationen hin oder her, das zu erfahren sind wir berechtigt, das wissen Sie, Dr. Ong. Wir müssen uns ja um die Gefangenen kümmern –«
»Das heißt Patienten oder Gäste, Schwester Madani«, unterbrach Dr. Ong sie.
Die Schwester seufzte. »Ja, natürlich.« Kurzes Kopfschütteln. »Aber wenn ich mit Patient B in einem Zimmer bin, muss ich wissen, worauf ich achten muss.«
Dr. Ong blätterte in der Akte. Sie enthielt nur das absolute Minimum an Informationen. Connie hatte sie selbst durchgesehen und wusste, dass die Antwort auf Madanis Frage in den hastig zusammengestellten Seiten nicht enthalten war.
»Vielleicht könnten Sie, Dr. Connie …?«, wandte Dr. Ong sich an sie.
Connie blieb sitzen. Es wäre nicht gut gewesen, aufzustehen und sich damit als eine Art Autoritätsperson darzustellen. »Ich kann Ihnen auch nur begrenzt Auskunft geben. Was ich weiß, ist, dass Patient B über eine umfassende Kampfausbildung verfügt – logischerweise. Er hat seine Opfer sowohl physisch wie psychisch misshandelt. Bei einigen Morden waren chemische Substanzen im Spiel, teils wurden sie gewaltsam eingeflößt, teils wurden äußerliche Verätzungen herbeigeführt. Außerdem Schlafentzug und Waterboarding, wobei Patient B nicht Wasser, sondern Essig verwendete. Es wurden auch Körperteile gequetscht oder abgetrennt. Das sollte Ihnen schon einmal ein grobes Bild verschaffen. Ich bin deshalb hier, weil vermutet wird, dass es noch weitere Opfer gab, und man sich wünschen würde, dass Patient B anfängt, sich zu öffnen. Er hat seit seiner Verhaftung kaum etwas gesagt. Meine therapeutische Aufgabe ist, ihm zu helfen, sich hier einzuleben, und ihn hoffentlich psychisch voranzubringen. Dazu werde ich auch mit Ihnen zusammenarbeiten, um sicherzugehen, dass er die richtige Betreuung erhält, und ich muss alle hier begutachten, die mit ihm in Kontakt treten werden – Sie ebenso wie die anderen Patienten. Es ist wichtig, dass er menschlichen Umgang hat, Isolation kommt nicht in Frage, aber er darf nicht getriggert werden.«
»Okay, ’n typischer Fall für die Irrenanstalt halt«, sagte Tom.
»So wird hier nicht gesprochen«, sagte Dr. Ong schnell mit einem besorgten Blick auf Direktor Le Fay. »Ich werde für die medikamentöse und klinische Behandlung zuständig sein. Dabei stehen wir unter Beobachtung seitens des Militärs, das darauf setzt, dass Patient B mit der Zeit Fortschritte macht. Ich hoffe, Sie alle werden mithelfen, zu zeigen, dass die Parry Institution nicht nur Bewahranstalt, sondern eine funktionierende psychiatrische Klinik ist.«
»Gut gesagt«, nahm Le Fay das Wort an sich. »Ich verabschiede mich jetzt, ich weiß ja, dass Sie viel zu tun haben. Wie immer – wenn Sie irgendwelche Sorgen oder Bedenken haben, sprechen Sie mich direkt an. Meine Tür steht Ihnen jederzeit offen.«
Niemand reagierte. Le Fay steckte die Hände in die Taschen und verließ den Raum. Dr. Ong hob warnend die Hand und wartete, bis zu hören war, wie die Tür zum Treppenhaus sich öffnete und schloss, dann senkte er die Hand. »Ich möchte darum bitten, den Direktor nicht um Gehaltsfragen anzugehen. Die Arbeit hier sollte uns allen eine Herzenssache sein. Ich bitte Sie, diese positive Einstellung stets im Blick zu haben. Immer mit einem Lächeln vollen Einsatz bringen. Ja?«
Vages Gemurmel.
»Gut«, sagte Ong. »Schwester Lightfoot, ich gebe Dr. Connie heute in Ihre Obhut. Machen Sie sie mit unseren Abläufen vertraut und stellen Sie sie unseren anderen Gästen vor. Wenn sie hier länger bleibt, sollten sie ihr Gesicht kennen. Ich danke Ihnen allen.« Und er verließ zügig den Raum.
Ein paar Sekunden lang rührte sich niemand.
»Zusätzliche Nachtdienste übernehme ich aber keine«, ließ sich der massige Mann vernehmen. Tom Lord scheute sich sichtlich nicht, seine Interessen zu vertreten. »Wenn dieser Patient B kommt, sind wir erstens voll belegt, zweitens werden die anderen wieder anfangen rumzuzicken. Wir sollten einfach ihre Medikation verdoppeln und aufhören, uns einzureden, wir könnten die Arschlöcher noch mal ändern.«
»Hör auf zu jammern. Als hättest du im Dienst so viel zu tun«, sagte Schwester Madani. »Die Extradienste betreffen vor allem uns von der Pflege.«
»Ach, echt?«, mischte sich der andere Krankenwärter ein, der bisher still in der Ecke gesessen und mit einem Zahnstocher seine Fingernägel gereinigt hatte. »Du findest, ihr macht die schwere Arbeit hier? Pillen verabreichen, Blutdruck messen und ab und zu ’ne Spritze setzen, damit ist es getan, ja? Aber wenn einer von den Perversen euch auch nur anniest, müssen Tom und ich ran und sie bändigen. Habt ihr schon mal ’nen Kopfstoß gekriegt oder wurdet angepisst?«
»Das reicht, Mr. Aldrich.« Dr. Roth, eine Frau mit dunkler, nach vorn in die makellose Stirn gekämmter Pixie-Frisur, stand auf. Sie war höchstens einen Meter sechzig groß, wirkte aber befehlsgewohnt. Kühl, an der Grenze zur Gleichgültigkeit der Diskussion gegenüber. »Sie haben Dienst, also gehen Sie an die Arbeit. Schwester Lightfoot, geben Sie Dr. Connie …«, sie zog den Namen in die Länge, fast – aber nur fast – herablassend, »den Überblick über unsere Abläufe. Alle anderen: Die Insassen warten.«
Connie blieb sitzen, bis die anderen den Raum verlassen hatten.
Auf dem Weg den Flur entlang sagte Schwester Lightfoot: »Dr. Roth ist das Gegenteil von Dr. Ong – kommen Sie ihr bloß nicht mit ›Gästen‹ oder ›Patienten‹. Sie macht sehr deutlich, dass der Hauptzweck dieser Station darin besteht, die Welt vor den Menschen hier drin zu beschützen – nicht darin, sie zu behandeln und so hinzukriegen, dass sie wieder rauskönnen.«
»Danke für die Warnung«, sagte Connie. »Noch was Wichtiges, was Dr. Roth betrifft?«
»Widersprechen Sie ihr nie. Das hasst sie wie die Pest. Und glauben Sie mir, Sie sollten ihr nicht auf die Füße treten. Ich würde lieber mit einem Patienten aneinandergeraten als mit ihr, wenn sie in Rage ist. Die kann einen total fertigmachen.«
Kapitel 4
Montag
»Das ist die Medikamentenkammer.« Schwester Lightfoot wies auf eine Tür. »Sie ist immer abgeschlossen. Jede Entnahme muss dokumentiert werden, und es müssen immer zwei medizinisch ausgebildete Personen anwesend sein. Weil Sie für die Medikation keine Befugnis haben, werden Sie keinen Zugang haben. – Da hinten sind die Waschräume, Duschen, Toiletten, Umkleideräume und Schließfächer. Da ist auch Reservekleidung, falls jemand Ihnen zum Beispiel, na ja, eine gelbe Dusche verpasst oder sich den Finger in den Hals steckt und auf Sie zielt. Passiert hier täglich, also nehmen Sie’s nicht persönlich.«
»Werde ich nicht«, sagte Connie.
Sie gingen weiter. »Das hier ist die Wäschekammer für Bettzeug, die Sachen der Patienten, Handtücher. Und Personalkleidung, wenn wir uns zwischendrin umziehen müssen.«
»Wie kommt die schmutzige Wäsche zur Wäscherei?«
»Durch einen Wäscheschacht runter ins Erdgeschoss, dann über ein Fließband in den Transporter der externen Wäscherei. Ist das für Sie von Bedeutung?«
»Nun ja, Patient B hat eine umfassende militärische Ausbildung. Zu meinem Gutachten gehört es auch, mögliche Fluchtrouten auszuschließen.«
Schwester Lightfoot nickte gleichgültig. »Woher kommen Sie eigentlich?«
»Massachusetts. Martha’s Vineyard. Bin aber schon lange dort weg. Wie lange arbeiten Sie denn schon hier?«
»In der Parry Institution oder auf Station H?«
»Beides.«
Schwester Lightfoot schloss die Tür mit der Aufschrift »Security« auf und signalisierte Connie, einzutreten. »Fünf Jahre hier in der Anstalt, hier oben erst zwei Jahre. Gerade fange ich an, mich nach einer Beförderung umzusehen.«
»Stationsintern?«
»Wo was frei ist. Hier oben zu arbeiten lohnt nur der Kohle wegen. In den anderen Türmen verdient man nicht so viel, aber in einer höheren Gehaltsklasse würde ich dasselbe verdienen und dabei nicht total verückt werden.«
Connie nickte, während sie eintraten, und starrte dann mit einem Rundumblick die Fixierungshilfen und Quasi-Schusswaffen an den Wänden an. »Wie oft wird das Zeug benutzt?«
»Das hängt absolut von den einzelnen Teammitgliedern ab. Manche kriegen es besser hin als andere, eine Situation durch Reden zu entspannen. Wenn Tom oder Jake ohne Mitsprache von Pflegern oder Ärzten Maßnahmen treffen müssen, ist die erste Wahl meistens Zwangsjacke und Beruhigungsraum. Wenn ein Patient so richtig austickt, kriegt man ihn allerdings kaum in die Jacke, deshalb müssen wir ihn manchmal auf Abstand sedieren.«
Connie betrachtete die vier gepolsterten Jacken, die an einer Wand hingen, mit so langen Ärmeln, dass der Patient am Kratzen und Schlagen gehindert wurde, und Riemen, um den Oberkörper einzuschnüren und zu verhindern, dass er sich selbst verletzte. Die Waffen waren im Grunde Betäubungsgewehre, wie sie normalerweise eher in Großtierpraxen als in Kliniken für Menschen zu finden waren, aber im Notfall, wenn ein Patient es geschafft hatte, sich irgendwie zu bewaffnen, und es riskant war, sich ihm zu nähern, erfüllten sie ihren Zweck. Außerdem hingen da Stichschutzwesten und Helme für den Fall, dass Patienten randalierten.
»Der Zugang zur eigentlichen Station ist doppelt gesichert, erst müssen Sie Ihren Ausweis vorhalten und dann einen fünfstelligen Code eingeben. Merken Sie ihn sich.« Sie schob Connie eine kleine Karte aus festem Karton zu. »Jeden Montagmorgen ändert er sich. Er verhindert, dass die Patienten flüchten können, indem sie jemandem vom Team den Sicherheitsausweis entwenden.«
»Können die Türen von hier aus ferngesteuert werden?«, fragte Connie.
»Natürlich. Und es gibt Sonderfälle, bei denen spezielle Maßnahmen greifen. Bei einem Brand beispielsweise schalten alle Schließmechanismen auf manuell um und können mit traditionellen Schlüsseln ohne Elektronik bedient werden.«
»Das heißt, es gibt für jede Tür auch einen Schlüssel?«
»Ja. Die Generalschlüssel hängen auf der Rückseite dieser Tür, und auf Station hat jeder von uns einen dabei, falls der Strom ausfällt und die Notstromgeneratoren nicht sofort anspringen. Wenn es zu Randalen kommt, schließen sich sofort alle Türen, und das System –«
Ein durchdringendes tiefes Piepen ertönte von einem Wandmelder, der gleichzeitig zu blinken anfing. Schwester Lightfoot nahm die Maus des Computers und klickte. Der Bildschirm erwachte zum Leben, aber die vier verschiedenen Ansichten von Fluren darauf wirkten ruhig. »Shit. Bleiben Sie hier«, sagte sie. »Tom braucht Unterstützung.«
Sie öffnete eine Schublade, nahm eine Spritze heraus und eilte zur Tür hinaus. Connie trat in den Türrahmen und sah zu, wie sie ihren Ausweis vor einen Sensor an der Wand neben der inneren Stationstür hielt und eine Zahl in das Ziffernfeld eingab. Das Schloss klickte auf, und Schwester Lightfoot verschwand nach drinnen.
Auf dem Bildschirm im Wachraum war zu sehen, wie sie den ersten Flur entlangging und links abbog, woraufhin sie in einem anderen Bildschirmviertel auftauchte. Kurz verschwand sie wieder, diesmal in einem Zimmer, und Connie starrte auf leere Flure, bis aus demselben Zimmer Tom Lord rückwärts herausstolperte und mit dem Rücken an die Wand prallte. Es gelang ihm gerade so, aufrecht zu bleiben, während schon eine zweite Gestalt aus dem Zimmer geschossen kam und den Flur entlang davonsprintete. Jetzt kam auch Schwester Lightfoot wieder heraus und ging zu Tom, um nach ihm zu sehen. Gemeinsam folgten sie dann dem Patienten, aber ohne Eile.
Connie setzte sich auf den zerschlissenen Stuhl vor dem Bildschirm und beugte sich vor, um das Geschehen weiter zu beobachten. Tom Lord war zwar ein Hüne, aber anscheinend nicht so unbezwingbar, wie der äußere Anschein es nahelegte, oder vielleicht hatte er auch den Kampfeswillen verloren. Das gab es in Hochsicherheitseinrichtungen immer mal, Connie hatte es selbst schon beobachten können. Und es war gefährlich, nicht zuletzt deshalb, weil das der Punkt war, wo jemand nachlässig wurde.
So gut Dr. Ong offenbar darin war, ein gewisses Maß an Respekt und Freundlichkeit seinen sogenannten Gästen gegenüber aufrechtzuerhalten, ihm schien zu entgehen, dass es in seinem Team Anzeichen für Burn-out gab.
Auf dem Bildschirm rannte der Flüchtige die Flure entlang und rüttelte wild an diversen Türen. Connie lehnte sich unbesorgt zurück. Wer es auch war, er grinste dabei, und mochte er auch noch so heftig an den Türklinken rütteln, sein Gesichtsausdruck war der eines unartigen Kindes, dem vollkommen klar ist, dass es mit seinen Eskapaden nicht weit kommen wird, das aber aus Lust und Laune weitermacht, solange es eben geht.
Sein Vergnügen war direkt proportional zu Schwester Lightfoots und Tom Lords Genervtheit. Schweigend trotteten sie ihm nach – die Kameras an sich hatten keine Tonspur, aber es war zu sehen, dass sie nicht redeten, und Tom sah zutiefst gelangweilt aus.
Der dumpfe Aufprall gegen die Stationstür war im selben Moment zu hören, als Connie durch die Kamera sah, wie der Flüchtige sich dagegenwarf. Des guten Blicks wegen blieb sie sitzen und konnte nun auch durch den Computerlautsprecher die dazugehörigen Stimmen hören. Offenbar gab es an der Kamera direkt innen an der Stationstür ein Mikrofon.
»Kommen Sie schon, Benny. Sie machen es nur schlimmer«, sagte Schwester Lightfoot. Zugleich trat Tom langsam vor, mit vorgehaltenen Händen, bereit zum Handgemenge.
»Sie sind gemein«, gab Benny zurück. »Und wenn ich es so will, müssen Sie mich Mr. Rubio nennen. Wir sollen respektvoll behandelt werden, sagt Dr. Ong.«
Toms Miene wurde noch höhnischer.