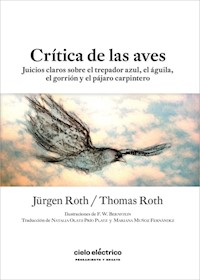Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Monsenstein und Vannerdat
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Die Poesie des Biers ist kein nüchternes Buch. Es ist trunken vor Liebe zu Hopfen und Malz, das Werk eines Mannes, der ohne Bier nicht sein will […]. Jürgen Roth ist […] vollkommen vertrauenswürdig, wovon jede Seite dieses Buches zeugt, in dem Dutzende Feuilletons und Vignetten, dadaistische Dialoge und symptomatische Szenen aus dem Leben eines Biertrinkers versammelt sind. Sie spielen in Lieblingskneipen, Ausflugslokalen und Trinkhallen, sie tragen sich bei Besuchen fränkischer Bierdörfer zu, bei Spritztouren in das deutsch-holländische Grenzbierland und mißglückten Weinproben, die mit ein paar Flaschen Flens beschlossen werden. Meist kommt das Bier konkret als Getränk und selten nur abstrakt als Gedankengegenstand vor, etwa wenn der Verlust der deutschen Bierkultur und der Siegeszug gepanschter, bierhaltiger Kaltgetränke beklagt wird. Da kennt Roth keinen Spaß, den er sonst immer versteht […]. Daß Bier ein heiterer Saft ist, merkt man schnell, lacht pausenlos, brüllt bei der Parodie auf Prominentenautobiographien und stutzt nur ab und zu bei einigen Episoden, deren Sinn sich erst offenbart, wenn sehr viel Bier getrunken und man selbst in jenem Zustand ist, in dem man zu letzten Wahrheiten wie dieser eines Tresenphilosophen eifrig nickt: ›Bier macht nämlich nicht betrunken. Betrunken sind die, die nicht trinken.‹" Frankfurter Allgemeine Zeitung
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 787
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roth
Die Poesie des Biers
Jürgen Roth
Die Poesie des Biers
Mit Gastbeiträgen von Matthias Egersdörfer,
Marco Gottwalts, Christian Jöricke,
Friederike Reents, Michael Rudolf, Jörg Schneider
und Dieter Steinmann
Jürgen Roth, geboren 1968, lebt als Schriftsteller in Frankfurt am Main. Jüngst sind von ihm im Verlag Antje Kunstmann drei Hörspiel-CDs erschienen (Stoibers Vermächtnis, Der Untergang des Bayernlandes und Mit Verlaub, Herr Präsident …, die ersten beiden zusammen mit Hans Well von der Biermösl Blosn) sowie bei Zweitausendeins der Band Schrumpft die Bundesrepublik! (zusammen mit Michael Rudolf und F. W. Bernstein). Im Oktober Verlag liegen von ihm diverse Titel vor, darunter Anschwellendes Geschwätz, Fußball! (Buch und CD), Das perfekte Wirtshaus und, als Herausgeber, die Live-Lese-CD Der saubere Herr Rudolf.
2., korrigierte, überarbeitete und stark erweiterte Auflage
© 2010 Oktober Verlag, Münster
Der Oktober Verlag ist eine Unternehmung
des Verlagshauses Monsenstein und Vannerdat OHG, Münster
www.oktoberverlag.de
Alle Rechte vorbehalten
Satz: Claudia Rüthschilling
Umschlag: Tom van Endert unter Verwendung
eines Photos von Jürgen Roth
Alle anderen Bildnachweise am Ende des Buches
Herstellung: Monsenstein und Vannerdat
ISBN: 978-3-938568-91-0
eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net
Ich hab’ nach vier Runden schon gemerkt, daß ich
so blau bin, da hab’ ich gemerkt: Oh, oh, das wird schwer!
Claudia Pechstein
Kann man einem Menschen trauen, der keinen
Alkohol trinkt? Ich habe da meine Bedenken.
Gerhard Polt
[…] dieses eine Bier hatte auf ihn gewartet, und
er hatte es noch nicht ganz ausgetrunken.
Malcolm Lowry: Unter dem Vulkan
Was soll man denn die Leute in den Geschichten immer trinken
lassen – nimmt man Whisky, muß man einen Revolver einbauen,
und bei Sekt wird die Beschreibung der Kleider der Weiber gleich viel
zu langwierig. Bei Bier schreibt man Bier, und damit hat es sich.
Franz Dobler: Bierherz
So sind zum Beispiel Bier, Wein und Denken
Reize, aber nur vom erstern ließe sich leben.
Jean Paul
Pilsner Bier ist das eigentlich einzige Alkoholgetränk,
das absolut für viele Leidende eine Medizin, ein Diätetikum, eine
Rekonvaleszenz, eine Erlösung, ein Heil erster Ordnung bedeutet!
Peter Altenberg
Bier ist unter den Getränken das nützlichste, unter den Arzneien
die schmackhafteste, unter den Nahrungsmitteln das angenehmste.
Plutarch
Da der Komfort das oberste Prinzip ist, so versteht es sich
von selbst, daß man Bier haben kann, wenn man einen
Menschen anzapft und ein Gefäß unter die Öffnung hält.
Karl Kraus: Varieté
Andere gehen am Vormittag in ein Wirtshaus und
trinken drei oder vier Gläser Bier, ich setze
mich hier herein und betrachte den Tintoretto.
Thomas Bernhard: Alte Meister
Trinkst du persönlich auch noch was?
Wirtin in der Frankfurter Gastwirtschaft Lokalteil
Bier hilft!
Jörg Fauser
Cerevisiam bibunt homines.
Es war alles Bier.
Heino
Man trank, um getrunken zu haben.
Jörg Fauser
Inhalt
Vorbemerkung zur zweiten Auflage
Vorbemerkung
Grußwort
Michl Rudolf, alter Seebär!
Ein Abend in Aufseß
Neulich am Tresen
Die einzig wahre Flaschenpost
Ein Flecken
Arbeiterfrühling
Der Russe
Vom Russ’
Aus der Welt der Wahrheit
Der Staub der Seele und das Grün des Gemüts
Kino
Kneipenkomik
Die Gasthaushölle und die goldene Gerste
Das Verschwinden des dicken Luftraums
Bier im Schuh
Trotz Zahlkraft der Heimat so fern
Alles fahren lassen
Beim Bistrobier belauscht
Beckett guckt Beckenbauer
Daseinsbewältigung 2008
Das heilige Viereck
Kleine psychosoziale Biertypologie
Bohlens Bier (im Kontext)
Die Blaue Bierblume oder: Ein hehrer Halunke und harter Herold
Wrba contra Rehse
Der Poet des Bieres oder: Ode an Helmut Stier
Kafka in Pirmasens
Dorst und Dorf
Eins für die Chefin
Von Dieter Steinmann
Das Zelt der Zerberusse
Vom Briten lernen
Von Dieter Steinmann
Aufklärung à la Albion
Leberwurstbauch
Auf Hemdknopfhöhe
Blonde Bräute in spe
Der oder das Radler – akzeptabel?
Oberneuses
Bock around the clock
Mosers Mühen
Oberharnsbach
Karnevalskirche
Paradigmenwechsel in Jesbach
Das lohnende Los
Bald Barbarei in Borgentreich?
Trauer um Spuckesepp
Der Bischoff-Bischof
Alle Irren
Richtig trinken
Mehrere Männer und zwei Frauen
Über den Biersatz
Erwähnenswerte Ereignisse
Sieh an, ein Anagramm!
Neue Überlegungen übers und beim Bier
Was A sagt, muß auch B sagen oder: Sich verabreden
Schnitzel, quo vadis?
Total wahre Anekdote über und zu Ror Wolf
Von der mangelhaften Lautlosigkeit im Schnitzelgebirge
Stadt, Land, Fluß
Ursprüngliche Bierakkumulation oder: Bloß eine Jugendsünde?
Unser liebes Bätzibaby
Biermanieren
Witz aus der Flasche
Auf, zum Teufel!
A Hardy’s Night
Fuller Frühling
Irrtum
Bierpoesie
Die zehn besten Biere vom Niederrhein
Die zehn besten Biere aus Franken
Die zehn besten Biere aus Sachsen-Anhalt
Das modernische Dingsda
Erneute Ereignisse und erwähnenswerte Erwägungen
Kneipenkomik II
Pappkameraden
Singendes Sitzfleisch
Der Herumführer
Trier an der Nordsee
Im Dienste der vielfachen Völkerverständigung
Jetzt mal ein paar Worte zu Gießen
Teufelswerk im Kloster Machern
Obere Wiese, untere Wiese
Die Rühreifrage
Spafallera
Wie wir Weltmeister wurden
Aussicht auf nichts
P13
Wolkensuche
Zugglück
Achtung, aufgeschichtetes Holz!
Kettenrauchen contra Katarrh
Auf der Jagd nach einer Dose
Lustprinzip im Modus der konjunktivischen Vorvergangenheit
Bierdeckelarithmetik
Mein terroristischstes Erlebnis
Gemischte Völker- und Tierkunde (nach Robert Gernhardt)
Australien doch nicht!
Wer ist Kafka?
Trinkorte, Nicht-Orte, Gegenorte
Tratschort Trinkhalle
Skatskandal
Die Marmelade am Hering
Da lacht die Leber
Dosenbierkrise
Schöner reisen nach Afrika
Von der Kunst des Negerphotographierens
Dreierlei Maßarbeit oder: Ein Tresentriptychon
Sprachlos
Die Fünf-Promille-Hürde
Die Biervision
Die besten Elf*
Breakfastbierbrezeling
Rechenkünstler
Es tritt auf: das Arschloch
Godesberger Farben
Monsters Of Miltenberg
Sommerausklang
Winzer und Würstl
Weinberater Gonzales
Gegen das Klavierspielen
Zehn bemerkenswerte, vielleicht sogar gesellschaftsrelevante Bierlieder
Der Abschaffelverein
Die Sonne im Sonnenhof
Rauschende Spiele
Welcome Asia Bistro
Pizza-Connection
Zwei oder drei, du mußt dich entscheiden
Jürgen Roth kauft sich eine Hose und geht zu einer Lesung – Ein Drama in drei Akten und mit glücklichem Ausgang
Bierwart Jubb
Magnetbier oder Bountybier
Kaufen, kaufen!
Medizin
Abstürze, Katerkunde
Schwund und Schund
Die guten Eindrücke von Lahnstein
Livealbum oder: Ein Remixroman in mehreren, nämlich ganzen drei Kapiteln
Anhang: Marken und mehr
Nachweise
Bildnachweise
Vorbemerkung zur zweiten Auflage
Jeden Autor freut es, wenn ein Buch von ihm vergriffen ist. Es wurde gekauft, womöglich sogar gelesen und weiterempfohlen. Also einfach geschwind eine Neuauflage drucken?
Nein. Bei Lesungen hat man gemerkt, daß dieser und jener Text an der einen oder anderen Stelle nicht richtig fließt, daß man hier ein wenig kürzen, dort hingegen eine Kleinigkeit einfügen müßte, daß sich ein Druckfehler, eine Wiederholung oder ein falsches Wort eingeschlichen hat. Die Suche nach dem »mot juste« (Flaubert), auf die man sich dann begibt, kann außerordentlich mühsam sein, denn sie verleitet einen dazu, die alten Sachen, die man Arno Schmidt zufolge fünfundzwanzig Jahre nicht mehr anschauen sollte, einer genauen Überprüfung zu unterziehen.
Das ist keine angenehme Arbeit. Ich habe alle Texte so penibel wie möglich durchgesehen, und das hat sich hingezogen. Deshalb erscheint die Neuauflage mit einem Jahr Verspätung. Zudem konnte ich es nicht lassen, noch etwelche Glossen, Reportagen, Geschichten, Aufsätze und Minidramen zu schreiben, und der Anhang ist auf das Fünffache des ursprünglichen Umfangs angeschwollen. Es werden dort jetzt 844 Biermarken inspiziert und bewertet. Ob es sie alle noch gibt, vermochte ich beim besten Willen nicht zu recherchieren. Wo das nicht der Fall ist, verweise ich auf das konservatorisch-eschatologische Moment von Literatur.
Im Verbund mit dem im Frühjahr 2009 erschienenen Band Das perfekte Wirtshaus liegen meine Texte zum Thema Bier nun gesammelt in Buchform vor. Dann kann es ja weitergehen.
Vorbemerkung
Vielfältig sind nicht nur die Lobgesänge, die die besten Dichter auf das Bier angestimmt haben, auf das älteste Getränk der Kulturgeschichte, die sinn- wie würdevollste Erfindung des Menschen. Eindrucksvoll vielfältig ist die Alltagspoesie selbst, die der Zungenlöser und Geselligkeitsförderer Bier anregt.
Die Poesie des Biers wendet sich einigen bemerkenswerten Aspekten und einigen abgelegenen Winkeln des unermeßlich weiten Bierkosmos zu, unternimmt Exkursionen in fränkische Bockbierparadiese und in Bierprovinzen, erzählt von Tresengesprächen und von konfusen Bierdiskursen – verpflichtet im wesentlichen den Gattungen und Genres Prosa, Polemik und Panegyrik. Zuweilen mogelt sich das Bier auch bloß vom Rande herein, was nicht bedeutet, daß es dann eine weniger wichtige Rolle spielt.
Im Anhang werden einige spezielle und nicht so spezielle Erzeugnisse der weltweit tätigen Brauwirtschaft begutachtet; mit 241 neu verkosteten Marken ist er als Ergänzung zu den Bänden Bier! Das Lexikon und Bier! Das neue Lexikon gedacht.
Der freundliche Hinweis auf Michael Rudolfs Opus 2000 Biere – Der endgültige Atlas für die ganze Bierwelt sei hier auch gestattet.
Grußwort
Bis zum April 1999 dachte ich, Herrn Rudolf ganz passabel zu kennen; diesen distinguiert auftretenden, edle Lederjacken schätzenden, stets leidlich gescheitelten, kotelettenfreien Herrn, der während seiner Jahre als Sudingenieur c/o Greizer Vereinsbrauerei ein reines Gespür für Hopfen, Malz und die Solistenkunst Ritchie Blackmores entwickelt zu haben schien; der bei gelegentlichen Luftspeedgitarrenwettkämpfen gar nicht mal »schlecht« aussah und dem Moment des musikalischen Glücks meist wohltönende Lautreihen zu schenken verstand; der, und wann findet man so was schon in unsren verlotterten Zeiten, ein Freund war. Bis zum April 1999 –
– da wir gemeinsam die Fränkische Schweiz bereisten und keine drei Tage später getrennte Wege gingen. Gehen mußten.
Ich könnte Sachen erzählen. Wenn hier zum Beispiel einer den Arsch offen hat, dann der feine Herr Rudolf. Der saubere Herr Rudolf, der sich vertraulich gerne »Brüsteforscher Rudolf« nennt, peppt jenen Trank, den er »testifizieren« möchte, mit Zigaretten auf, »um der schalen fränkokanadischen Hopfenkaltschale wenigstens etwas Power« zu »verleihen«. Ernste Verkostung gehorcht gewiß anderen Regeln. Der honorige Herr Rudolf, die Schnapsdrossel und temporäre Whiskyleiche, pflegt jede halbe Stunde zu fordern: »Laß uns noch einen Liter Bierschnaps wegputzen, du fährst ja« – die häßlichste der bekannten Formen des Bierdopings.
Der superbe Herr Rudolf gestand mir am Schanktisch des Aufsesser Brauhauses, bevorzugt bei geschlossener Flasche und »per Anblick« zu verkosten. Es ist der anständige Limofan Rudolf, der im Grunde nur nach Weibern ächzt und einen Dreck um die Weiterentwicklung der Bierliteratur sich kümmert. Die Notizen und Notate des Rauchbierrauchers Rudolf erfüllen samt und sonders den Tatbestand des Betrugs und wollen, erklärt er gegen zwölfe steinvoll johlend, »eh bloß dem verfickten Kunstgedanken Genüge leisten«.
Der edle Herr Rudolf, der ab einse »Mein Freund, der Frauenarsch« intoniert, ist ein akkurater Lump und nur zum Schein ein manierliches Mitglied der Menschengesellschaft. Mein Vertrauen hat er verwirkt. »Ich fress’ jetzt ein Schnitzel«, waren die letzten Worte, die er an mich richtete, bevor er ein Warsteiner köpfte, sein Rad bestieg und in den blitzend roten Horizont entschwand, um »dieses Scheißbuch runterzusemmeln«.
Immerhin: Drei Wörter hier sind wahr. Mehr als auf den folgenden Seiten.
Michl Rudolf, alter Seebär!
So hatten wir zwar nicht gewettet; aber Du hast es so gewollt: im Greizer Wald, wo Du vor vierzig Jahren zusammen mit Deinen Großeltern sämtliche bekannten Pilz- und Reharten der nordöstlichen Hemisphäre in einem Akt spontaner Willkür komplett um- und neubenannt hast, kurz nach dem Rechten zu sehen und dann die Lebensnot- und -mutreißleine zu ziehen.
Michl, alter, guter Stiefel: Jetzt trinkst Du uns im Deutschen Brauer-Bund-Himmel die siedend schönen Bierkessel auf eigene Rechnung leer und weg, und bei solch sauberer Feinarbeit wollen wir Dich auch nicht stören, auch wenn wir’s zu gerne täten. Aber, good old Lump, hinauf zu Dir brüllen und jammern dürfen und müssen wir doch: Keep on rockin’ and drinkin’ in a Binding-free world!
Deine Schwermutmatrosen von stets Deiner
Titanic
Ein Abend in Aufseß
Ich weiß nicht, ob ich richtigliege – vielleicht weiß man ohnehin praktisch nichts von jenen Dingen, die relevant sind –, aber eine autobiographische Miniatur aus Michael Rudolfs seit Mitte der neunziger Jahre in dichter Abfolge erschienenen Büchern lese ich heute als eine Art Programmschrift, die mir die Augen öffnet für sein schriftstellerisches und sein Lebenscredo, die er beide nie explizit formuliert hat.
»Topographie des Taumels« aus Der Pilsener Urknall (Leipzig 2004) ist die Hommage an den Bürgerhof überschrieben, an eine seiner zwei Stammkneipen während der Schulzeit in der DDR. »Die Schwerkraft wirkte höchstens symbolisch, damit die Leute auf den Stühlen blieben. Nicht daß es in dieser Topographie des Taumels einen einzigen Augenblick stille gewesen wäre. Immer gab es was zu erzählen und am meisten von denen, die ohnehin ihren ganzen Tag hier verbrachten. Selten waren die Gespräche ergebnisorientiert. Trotzdem funktionierte die vor der oralen Hysterie draußen hermetisch behütete – Achtung: Kalauer! – Oral history. Wohl weil deren Protagonisten stilsicher auch an den richtigen Stellen weinen konnten.«
Zwischen den »Distinktionsverlierern« und sozial Geächteten war ein Glück beheimatet, »da lebten sie auf, lebten sie vorübergehende Gleichberechtigung. Und fühlten sich als Subjekt.« Man sollte diese Sätze ganz und gar ernst nehmen. Michael Rudolf spricht hier ohne satirische Camouflage: »die Welt – und was für eine – in einer Nußschale.« – »Im Bürgerhof operierte die Kommandoebene eines Lebensverschönerungsvereines […]. Im Bürgerhof kam ich mir vor wie in einem Paralleluniversum: unendlich nah an der albernen Sinnestäuschung, die von der Menschheit als Leben hingenommen wird, und doch un(an)greifbar und Welten davon entfernt.«
Nicht greifbar und mitten im Leben – jedoch in einem Leben, das mit dem gewöhnlichen, realistisch abschilderbaren ›Leben‹ nichts gemein hat, mit dem Leben der Honoratioren und Dicketuer und »Kaufleute und Lokalpolitiker«, gegen deren herrschende Gegenwart eine Idee des Lebens steht, von deren Finalität Michael Rudolf im Rückblick auf den Abriß des Bürgerhofes etwas preisgibt, und zwar in einer kaum verschlüsselten absurden Figur: »Dem Wirt half dieser bittere Gegenschlag des Daseins wenigstens, den Kampf gegen seinen Selbsterhaltungstrieb zu gewinnen.«
Ich hatte das große Glück, Michael Rudolf 1994 kennenzulernen. Wir hatten bis dahin ein paarmal miteinander korrespondiert und telephoniert, und nun kauerten wir in der Frankfurter Messekoje seines Verlages Weisser Stein, mit dem er – unter beträchtlichem finanziellen Verlust – Autoren wie Gerhard Henschel, Susanne Fischer, Fritz Tietz und Eugen Egner die Tür zur großen Verlagswelt aufstieß.
Wir tranken irgendeinen hessischen Bierrotz und schienen uns zu verstehen. Zwei Jahre später kampierten wir dann in meiner Wohnung und schrieben Bier! Das Lexikon. Michael, der in der Titanic (4/1994) mit einer Parodie auf die Verkostungsliteratur die Blaupause für das schließlich juristisch von allerlei Seiten schwer bombardierte Buch geliefert hatte, war schon damals gesundheitlich angeschlagen – er machte vor allem die höllischen acht Jahre als Brauingenieur und Schichtleiter in der Greizer Schloßbrauerei für seine oftmals marode Verfassung verantwortlich –; aber in den zwei Wochen, in denen wir wie bekloppt zwischen Batterien von Bierflaschen aus aller Welt herumstaksten und nebenher unseren Unsinn in die Tasten klopften, war er nicht selten fast entfesselt ausgelassen. »Mit dir ist gut arbeiten«, sagte er plötzlich eines Abends strahlend, und ich muß gestehen, daß nahezu alles, was von dem Buch bleibt, von Michael stammt – natürlich auch mein Lieblingseintrag: »Beck’s Spitzen-Pilsener – 4,7% Brauerei Beck & Co. Bremen. Eigenartig: schmeckt immer so, wie man sich gerade fühlt, also meistens schlecht.«
Annäherungsweise begriffen habe ich erst Jahre danach, als er schlagartig keinen Schluck mehr vertrug und die peinigenden Schmerzen und multiplen depressiven Beschwerden den manischen Arbeiter zur wiederholten Krankschreibung zwangen, daß in dieser beiläufigen Biernotiz sein ganzes Lebensgefühl ausgedrückt war. Er schrieb trotzdem hartnäckig weiter und ließ ein bewunderungswürdiges Buch auf das nächste folgen: seinen wahrlich »wunderbaren Pilzführer« Hexenei und Krötenstuhl, den Roman Morgenbillich – die ostdeutsche Antwort auf den legendären Arnold Hau von Bernstein, Gernhardt und Waechter –, den in der Öffentlichkeit völlig untergegangenen, grandios albernen Kolportagepolitporno Chefarzt Dr. Fischer im Wechselbad der Gefühle oder die kleine monographische Liebeserklärung an die Artrockband Yes, Round About Jutesack. Michael war ein Genie.
Ich würde gerne von vielem erzählen; es ist hier kein Platz. Nie ist Platz. Ich würde gerne von unseren Forschungsreisen ins Böhmische erzählen, auf denen uns das montypythoneske Metal-Trio Primus erquickte, bis wir vor Vergnügen fast ins Auto kotzten, oder von unseren in jedem Frühjahr anberaumten Biertouren, deren erste in einer komatösen Pkw-Fahrt kulminierte, bei der uns der Allmächtige beigestanden haben dürfte und die wir mit einem Rockkassettenkonzert in meinem Wagen krönten, das die Bewohner des von Michael mehrfach porträtierten Dörfleins Aufseß nie vergessen werden.
Dieser duale Radau- und Klamaukkreis erweiterte sich auf Betreiben Michaels, der den normierten Gesellschaftsmenschen als Pest empfand und die freundschaftliche Geselligkeit über alles schätzte. Bald war ein stabiles Vergnügungsteam gebildet, das standhaft dem »Qualitätspilsener« (Michael) zusprach und es sich ein paar Tage pro Jahr sackrisch gutgehen ließ, inklusive der Kultivierung extraterrestrischer Katerphänomene.
Ich würde gerne erzählen von einem Abend in Aufseß, an dem wir uns ungeplant und stundenlang ausnahmslos in den allerdümmsten Phrasen unterhielten und dabei lachten, wie vielleicht noch nie gelacht worden war. Oder erzählen würde ich gerne von einem wahnsinnigen Verkostungsnachmittag bei Tucher-Bräu in Fürth, an dem uns der damalige Boß Franz Inselkammer nicht nur sein gesamtes Monstersortiment vortrank, sondern der Welt auch die Sentenz »Biertrinken ist erlebbare Realität« schenkte, die Michael in der Folge wie eine Art Zauberwort immer wieder aufgriff.
»Erlebbare Realität«: Das ist ein Schlüssel für Michaels Werk, im spöttischen und im emphatischen Sinn. An der Realität zu verzweifeln, zugleich verzweifelt zu versuchen, sie zu gewinnen, für sich und gegen die Wirklichkeitsmodellierungen derer, die einem immerzu nachstellen, indem sie einem über ihre Agenturen einhämmern, was man als ›Welt‹ zu akzeptieren habe – von diesen bisweilen grausamen Zwiespalterfahrungen erzählen Michaels melodiöse, grantige, bübisch übermütige, sorgsam krumme Geschichten und Satiren, und diesen Riß zwischen gelungener Welterfahrung, die Michael am Schreibtisch, unter Freunden, in der Familie, in der Rockmusik und in der idyllischen Natur ab und an machen konnte, sowie den unauslotbaren, tiefen Daseinszumutungen hat er, der von seinen Qualen hie und da in Andeutungen sprach, nicht mehr ausgehalten, als er am 2. Februar dieses Jahres um die Mittagszeit das Haus verließ, nur mit einem Rucksack, in dem ein Strick lag.
»Auch nicht angezweifelt werden darf die Dignität einer funkelnd hellgrünen Zitronenfalterraupe beim Schlürfen der Bierpfützen unseres Tisches. Diese Kreatur hatten wir schon in Heckenhof angetroffen, wo sie ihrer Daseinsform weitere Glücksmomente zufügte.« Das steht im letzten Kapitel des Pilsener Urknalls, in der Eloge »No Sleep ’til Nankendorf«. Zugefügte Glücksmomente – ich bin mir sicher, Michael hat dieses Oxymoron, das durch eine kleine Verschiebung, eine winzige Abweichung vom konventionellen Sprachgebrauch (Glücksmomente, die sich fügen o. ä.) entsteht, bewußt gewählt.
Ich habe diese unscheinbare, kunstvoll verhüllte Formulierung erst in diesen Tagen als das wahrgenommen, was sie ist: als bedeutendes Beispiel oder Moment der Poetologie, auf der Michaels Texte aufruhen und die seinen Arbeiten jenen ganz und gar eigentümlichen, barocken, enigmatischen und zugleich luftigen Sound verleiht, jenes spielerische Flair, in dem sich das Dunkle, Bedrohliche, schwer Sagbare in der Posse, im witzigen Kniff, in der Wortverdrehung, im artistischen Jux, in der Pointe vermummt. Wovon man nicht sprechen kann, damit treibe man Schabernack.
Seltener griff Michael zu den Mitteln der uneingeschränkt und notgedrungen brachialen Polemik – zuletzt in seinem Streifzug durch die sprachlichen und allgemeingeistigen Verwüstungen, die der nicht endende Kapitalismus anrichtet (Atmo. Bingo. Credo – Das ABC der Kultdeutschen, Berlin 2007), früher in kulturkritischen Interventionen, die der Band Trost und Unrat (Mainz 2001) versammelt. Das Cover ziert ein Bild von Ernst Kahl, auf dem ein Mann mittleren Alters am Galgen baumelt und von einem Kind als Schaukel benutzt wird, und die »Abrechnungen« und »Grobheiten« berichten von »mottentief im Haarkleid der Mutter Erde verborgen liegen[den] ostdeutsche[n] Kleinstädte[n]«, sie verhöhnen die Religion, das Fernsehen und die Zeitschrift Rolling Stone, für die Michael im WM-Sommer 2006 eine anbetungswürdige Abrechnung mit dem Fußball schrieb, sowie »diese überflüssige Drecksblase« der Musikjournalisten überhaupt, und sie vernichten den Deutschen als Gattungswesen und das von ihm verunstaltete Land, für welche Michael das Arno Schmidtsche Verdikt von der »Faß=Zieh=Nation« verwandte. Dem Buch vorangestellt hatte er ein Motto von Emile Cioran: »Habe ich die Fresse von einem, der hienieden irgendeine Aufgabe hat?«
Auf der vorletzten Seite des Pilsener Urknalls ist ein Photo zu sehen. Drei schwarzgekleidete Gestalten, von hinten aufgenommen (rechts Michael, in der Mitte Ina, links ich), schlendern einen sacht ansteigenden Feldweg in der Fränkischen Schweiz hinauf; am blitzblanken Horizont lagert eine schöne, buschig ausfransende Hecke; die Bildlegende, die Michael daruntergesetzt hat, lautet: »Die Himmelsrichtung.«
Er hat sich in der Fränkischen Schweiz wohlgefühlt; vielleicht war er in diesen versunkenen Tagen auch stundenweise glücklich. Denn geschrieben hat er über unsere jährlichen Ausflüge ins Reich der Weltruhe: »Wiese, Wald und Weide wechseln wie nicht gescheit. Die Nachmittagssonne sengt auf die Hochalbflächen, die Luft flimmert, die Köpfe dampfen bedrohlich, und Flüssigkeitsaufnahme dürfte jeden Moment essentiell werden. Ein bißchen in den Schatten legen könnte auch nicht schaden – die Luft ankucken, schweigen, Gedanken fassen oder in süßen Albträumen schwelgen.«
Am Montag wurde Michael Rudolfs Leichnam in einem Wald in der Nähe von Greiz von einer Pilzsammlerin gefunden. Michael Rudolf hat sich erhängt. Er wurde fünfundvierzig Jahre alt und hinterläßt seine Frau Ina und seine Tochter Eva.
Neulich am Tresen
Sagt der eine zum andern: »Mensch, ich glaub’, ich trink’ noch eins!«
Sagt der andere: »Mensch, dann mach das doch!«
Die einzig wahre Flaschenpost
»Beim Bockbier schmeckt alles nach Blues«, brummte der 1987 auf der A 94 bei München besoffen verunglückte Frankfurter Dichter Jörg Fauser ein wenig benommen und melancholisch. Ob er den schweren, dunklen, gallig-schnapsigen Weihnachtsdoppelbock meinte oder den leichteren, honiggelben Maibock, den Kleinbrauereien während der Biergartensaison unter schattenspendenden Bäumen frisch vom Faß servieren, ist nicht zu klären. Allein, wenn Fauser auch oft zurückgezogen, jenseits der Tresen und Trinkhallen trank – »ich warte darauf daß es klingelt / und jemand mit mehr Bier / und anderen Gedanken kommt« –, so trank er doch mit einer solchen Beharrlichkeit, wie sie sich heutzutage PR-Manager und Geschäftsführer der großen Brauhäuser als verbreitete Gewohnheit wünschen würden.
Denn der Trend zum Biertrinken ist seit Jahren ein konstant negativer, ein Trend zur Abkehr vom beseelend feinen Hopfengebräu, hin zu aufputschenden, aggressiven respektive vorgeblich sportiven Mixturen und Cocktailpanschereien. Die Absatzquote, meldete der Deutsche Brauer-Bund, fiel jüngst unter die magische Grenze von hundert Millionen Hektolitern. Daran ändert selbst das engagierte Bechern auf dem jährlichen Münchner Oktoberfest nichts. Nahezu sieben Millionen Einheimische und assoziierte australische und sonstige globale Touristen verputzten im Jahr 2000 neben knapp 700.000 Brathendln, über 60.000 Schweinshaxen, 235.000 Paar Schweinswürstln und 94 Ochsen immerhin noch fast 65.000 Hektoliter Wiesn-Festbier – und das bei einem astronomischen Maßpreis von zwölf bis dreizehn Mark. Sie tun, was sie können. Sie »litern obi«, wie’s nur reingeht und wie’s ihnen Gerhard Polts Meistertrinker Adi in der genialen Wiesn-Bühnennummer »Attacke auf Geistesmensch« vorexerziert. Bloß – es nützt nichts. Deutschland kehrt dem Bier den Rücken.
Alarmiert ob des besorgniserregenden Zustandes im Land des Dichtens, des Bieres und des Denkens, greift der Brauer-Bund zu absonderlich gedankenlosen Werbemaßnahmen. Da werden allenthalben sogenannte Biererlebnisse beschworen und zwei offizielle »Bierbotschafter« berufen – Harald Schmidts mehr scherzhaft als rechtschaffen bierverkostender Co-Moderator Manuel Andrack und Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt; letzterer wohl, weil der Einbecker Brauknecht Till Eulenspiegel einst an Stelle des Hopfens des Braumeisters Hund – mit Namen Hopf – der Würze appliziert haben soll.
Innerhalb der vergangenen fünf Jahre sank der Jahresprokopfverbrauch um zehn auf zirka hundertzwanzig Liter. Steuert man jetzt nicht dagegen, dürfte es in sechzig Jahren in Deutschland kein Bier und keine Biertrinker mehr geben. Intelligente Öffentlichkeitsprogramme sind gefragt, eine sofortige Rückbesinnung auf das Bier und seine Verherrlicher tut not, auf die Jünger des Gambrinus, auf die ehrenwerten Bierpoeten und -denker. Und die hat es wahrlich reichlich, zumal im deutschsprachigen Raum, solche, die das Bier in Romanen, Theaterstücken und Gedichten priesen oder gewichtigste Rollen übernehmen ließen, und jene, die es eher empirisch in sich hineinschütteten – zwecks Anfeuerung oder Entspannung oder beider Lebensverschönerungen halber, getreu dem Motto Robert Walsers: »Ein Helles, bitte!«, und zwar dalli.
Thomas Bernhard vermochte noch das Selbstverständlichste zu definieren: »›Ein Bier, bitte‹ heißt, die Welt will ein Bier. Sie trinkt es und wird mit der Zeit wieder durstig.« Bereits Jörg Fauser jedoch konnte das gegenwärtige Übel mit Worten greifen: »Wenn ich sehe, wie dann statt der Halben der Piccolo rausgetan wird […], dann wird mir klar, warum deutsche Büromenschen so zerrüttet sind […]. Dabei wäre, wie so oft im Leben, das Desaster zu vermeiden gewesen, wären wir nur beim Naheliegenden geblieben, beim Bier.«
Fern lag das Naheliegende nicht nur der protestantischen Antibierpropaganda von Luther, der den »Saufteuff« zu exorzieren trachtete, bis zu Kant, der »Trunkenheit« schlicht als »einen widernatürlichen Zustand« schalt. Bier verdammte, in völliger Mißachtung dessen, was Friedrich Schillers Freund J. W. Petersen die »deutsche National-Neigung zum Trunke«, und das heißt zum Bierumtrunke, nannte, der Weimarer Großgrantler Goethe, der eminent ahnungslos dekretierte: »Das Bier macht das Blut dick.« Und in Ekelkoalition mit dem Tabakdampfen malte er den geistesgeschichtlichen Teufel an die Wand, weil er halt selber täglich flaschenweise Wein verdrückte und deshalb wohl glaubte, besser zu dichten als die Bierhumpen: »Wenn es so fortgehen sollte, wie es den Anschein hat, so wird man nach zwei oder drei Menschenaltern schon sehen, was diese Bierbäuche und Schmauchlümmel aus Deutschland gemacht haben. An der Geistlosigkeit, Verkrüppelung und Armseligkeit unserer Literatur wird man es zuerst merken.«
Daß es, europaweit betrachtet, so nicht kam, verdanken wir trotz gewisser Reputationen nicht dem Goethe-Verehrer Alessandro Manzoni, der die Frechheit besaß, in seinem Jahrtausendroman Die Brautleute die Zunft der Kneipiers zu desavouieren (»›Verdammte Wirte!‹ fluchte Renzo im stillen. ›Je mehr Exemplare ich von ihnen kennenlerne, desto schlimmer finde ich sie!‹«); genausowenig konnte sich Goethe-Preisträger Thomas Mann Verdienste ums Bier erwerben. In der ihm eigenen Torheit gab er zum besten: »Im allgemeinen halte ich nicht das geringste von der ›Inspiration‹ durch Alkohol«, und der Sturzlangweiler fügte an: »Ich Geringer trinke täglich zum Abendbrot ein Glas helles Bier und reagiere auf diese anderthalb Quart so stark, daß sie regelmäßig meine Verfassung durchaus verändern.«
Durchaus seine Verfassung veränderte Thomas Manns Hausphilosoph Nietzsche. Zu Studentenzeiten ein Fan der »Biergemüthlichkeit«, suhlte er sich später, so Eckhard Henscheid, in einer »nimmerstill-pathetischen Ablehnung des Biers – als des Symbols von Biedersinn und Philisterei«. Henscheids episches Personal hingegen neigt, uns zur Freude, recht ausgiebig größeren Mengen Bier zu – etwa der herzergreifend abgewrackte, desillusionierte Kommunist aus der wie ein goldgelbes Helles wunderbar und wundersam in sich ruhenden Novelle Maria Schnee: »Sie alle seien heute gebrannte Kinder der Revolution, flüsterte der Dicke leis und mit viel Wehmut. Er sei heute praktisch trocken. Er trinke nur noch sieben oder acht Bier am Tag, sieben, acht frische Weizen. Gar nicht der Rede, gar nicht der Erwähnung wert.«
Uns allen, den Wirtshausweizenwuchtern, den Biergartenhockern und den Pilspassionierten, sollte die innige und humane Beziehung zwischen gutem Bier und guter Literatur eine Erwähnung wert und Mahnung genug sein, den fünfzackigen Stern des Bierbrauers nicht sinken zu lassen auf den Boden von Wein-, Whisky- und Wacholderbeersaftgläsern. E. T. A. Hoffmann drehte u. a. durch Bamberger Bierspezialitäten sein »inneres Fantasie-Rad an« und »trank, um sich zu montieren«. Georg Christoph Lichtenberg vergötterte englisches Bier (»diese Bouteillen aus England [sind] so etwas wie eine poetische Flaschenpost«), der Nachfahre Kurt Tucholsky verleibte seinem Sudelbuch die besinnliche und sauschöne Sentenz ein: »bier beglänzt«, und Jean Paul, der knuddelige Krösus der Biervernichtung, widmete sich in aufreibendsten Briefwechseln pausenlos dem einen, dem Edlen, dem süffigen Solidargetränk, dem sensationell schmackhaften Durstlöscher und Rauscherzeuger: »Bier, Bier, Bier, wie es auch komme!«
Es kam zu selten, und Jean Paul zürnte, da ihm seine Hauswirtin Kienhold englische Bräus kredenzte. Er mahnte Besserung an, »weil der Transport vom Faß in mich schneller geht« als jener des Fasses zu ihm, und schrieb manisch: »Vom Wichtigsten zuerst! Ihr Bier ist schon seit so lange ausgetrunken, daß ich wieder mit ihm zugleich (durch das englische) den Appetit verloren habe. Leere Fässer kommen – ungleich Menschen – schwerer fort als volle; kein Fuhrmann belastet sich mit jenen.« »Fuhrmann Zapf«, o welch Name!, nahm sich des geplagten Bayreuthers (»Bayreuth trotz Bier und Gegend unaushaltbar«) an, und der Dank kannte kein Ende – gleich dem Durst.
Glücklicher noch, wer etliche Jahre später auf dem englischen Eiland einen echten Kumpel an seiner Seite wußte, einen zuverlässigen, solventen Alkoholkompagnon. Marx und Engels, »diese beiden Superchampions der Polemik« (G. Tomasi di Lampedusa) und Superkenner der geistigen Getränke, verband eine dioskurischdionysische Freundschaft. Während der »privilegierte Zecher« Engels, den Marxens Schwiegersohn Paul Lafargue »den unergründlichen Verschlinger von Ale« taufte, auf Reisen Bier testete, haute Marx den zugesandten Wein um und berichtete Engels aber auch: »Außer dem Wein hatte ich täglich (bis zur Stunde) 1½ Quart vom stärksten Londoner Stout zu saufen. Es schien mir ein gutes Thema für eine Novelle.«
Erst Ernest Hemingway dröselte den Faden vom anderen Ende her auf: »Nun tranken die Burschen in meiner Story, und das machte mich durstig«, was H. L. Mencken, der erste amerikanische Nietzsche-Biograph und gefürchtete Kritiker, mit einer Eloge auf das »unique, incomparable, transcendental Bavarian Beer« konterte. In das grausame 20. Jahrhundert, längst jenseits der von Engels verlachten »unerschöpflichen Streit- und Parteifrage über die respectiven Vorzüge des alten Pilsener, des bürgerlichen und des Aktienbieres«, pflanzte Robert Walser ein bezauberndes Idyll, ein Stilleben, das sich der »Seelenruhe« und Geselligkeit verdankte, die das Bier stiftet: »Die Bierburschen haben momentan ein wenig Ruhe, aber nicht lange, denn es wälzt sich wieder von draußen herein und wirft sich durstig an die Quelle. […] Würde und Selbstbewußtsein wirken behaglich, auf mich wenigstens, und deshalb stehe ich so gern in irgendeinem von unseren Aschingerhäusern.«
Durchs Bier genas manch Denker, manch Dichter, am Bier labte sich noch auf dem Todeslager sehnsuchtsvoll Franz Kafka, und beim Sterben ließ er sich eins vortrinken. Beruhigt, hienieden erlöst: »Ich bin ja zum Biertrinken da«, formuliert Herbert Achternbusch die modernste aller Existenzphilosophien und Religionen, und Gottfried Benns funkelndste Verse huldigen weihevoll IHM, dem Bier. Aber: »Was schlimm ist: bei Hitze ein Bier sehen, das man nicht bezahlen kann.«
Was das Schlimmste wäre: bei Hitze das Kleingeld zusammenkramen und ein Bier vor dem inneren Auge sehen, das man nicht kaufen kann. Daher sei, bevor das Undenkbare, das Ende des Biers, eintritt, dem Deutschen Brauer-Bund die Frage gestellt: Was spräche gegen ein den Absatz ankurbelndes, bundesweit gehängtes Plakat mit jenem berühmten Photo, das Bertolt Brecht und Oskar Maria Graf beim beduselt-beherzten Krugstemmen am Kneipentisch zeigt – ergänzt um die Zeile: »Zwei deutsche Dichter – wer ist deutlich dichter?«
Nicht die Kaffeebohne spräche dagegen.
Ein Flecken
Nicht allzuweit nordwestlich von der global geachteten Brau- und Damenhochburg Bamberg, aber doch bereits recht abgeschieden, gebettet zwischen weich geschwungene Wiesenbuckel und säumende Waldstreifen, liegt am Rande der östlichen Haßberge ein ganz und gar einfältiger fränkischer Weiler. Nie käme einem Menschen, einem durchschnittlich welterfahrenen Menschen, in den Sinn, dieser kaum zweihundert Einwohner zählenden Ortschaft, diesem geduckten, aus einigen Höfen, einer kauernden Kirche und zwei Wirtschaften bestehenden Dorf eine Bedeutung beizumessen, irgendeine Bedeutung, wär’s eine für die Region, wär’s eine gar fürs Land oder für die Republik.
Bamberg, des Örtchens hinreichend entfernter großer und beschützender, alle neugiergeilen Fremden anziehender, ja fliegenpapiergleich anlockender Nachbar, tut sich verständlicherweise eher dicke mit den unterschiedlichsten Attraktionen und Traditionen, und deshalb mag unseren Ort oder dessen Bewohner auch bisweilen der Gram übermannen, daß es mit ihm und mit ihnen nicht recht voranmarschieren möcht’ in der Welt der Aufmerksamkeit und Sensationen.
In Bambergs berühmter Gaststube der Brauerei Fäßla, die selbstbewußt ihr vorzügliches Produkt bewirbt: »Fäßla Bier – bekannt, beliebt, bekömmlich«, in dieser schon um die Mittagszeit dramatisch gefüllten ehrwürdigen Lokalität imponieren »für vier« oder »für sechs« – also für »vier Bier« oder durchaus mehr, wie das einheimische Idiom preisgibt – künftige Bräute und edle Weibsbilder den gepiercten Stammtischlern. Sie offerieren Haxn-Bringdienste und servieren den mehrheitlich erbarmungswürdig verquollenen Männern Klopsteller mit Pfiff. Ein Bohei von erheblichen Ausmaßen ist Standard.
Schmachvoll verkümmert derweil schmählich schlummernd unser bescheidener Flecken unter den schwachen Sonnenstrahlen des neckenden Frühlings. Eine Kuh muht, ein Gockel kräht, ein Traktor brummt, das Gewöhnlichste geht hier vonstatten, ob es will oder nicht.
Drei Wandersleut’, ein Museumsdirektor, ein Bürgermeister eines multifunktionalen Mittelzentrums und ein Taugenichts, machten sich dennoch auf den Weg. In Baunach verließen sie, von Bamberg kommend, die Bimmelbahn, und bald öffnete sich ihren Blicken ein schönes, schlichtes Tal. Ein Fluß begleitete sie, und gegen Abend erreichten sie unsren Ort, der als ein Hort des Zauberhaften sich entpuppen sollte.
Appendorf durchzieht eine gefegte, kerzengerade Straße. Der Bürgermeister erspähte als erster an ihrem Ende die Brauerei Fößel-Batz. »Grüß Gott!« empfing der Wirt, ein sportlicher Mittvierziger, das Trio, »hereinspaziert!« ergänzte Yvonne, seine Frau.
Nun »in der Dorfschenke angelangt, wo sie völlig frei in perfekter Einsamkeit Platz finden konnten«, so erzählt es Alessandro Manzoni in seinem Roman Die Brautleute, »ließen sie sich das wenige bringen, was es gab«, etwas Sauerkraut, Bratwurst, graues Brot und ein brezelzart knisterndes Kellerbier, im Familienbetrieb gebraut wie eh und je.
So in sich versunken, waren sie es zufrieden, und der Bürgermeister begann gerade, einen Wurstzipfel zerfleischend, seine »kneipenorientierte Stärken-/ Schwächenanalyse« zu unterbreiten, als der Museumsdirektor gedämpft die Stimme hob: »Schaut mal, das gibt’s doch nicht! Was ist denn da los?«
Wie auf ein geheimes Zeichen traten aus verschiedenen Türen unpassend akkurat gekleidete Männer. Einer trug unter jedem Arm eine Trommel, ein anderer zwei Becken, ein dritter schleppte einen Kofferverstärker und eine feuerrote Gitarre herein. Sie bauten, ohne ein Wort zu wechseln, ihre Gerätschaften im ein wenig tiefer gelegenen Gesellschaftsraum auf, und währenddessen schritten weitere Männer in Westen durch die Eingangstür.
Den Schluß der Prozession bildete ein bäriger, graumelierter, geruhsamer Mann, der sich und seinen Kontrabaß in der Mitte der Tanzfläche postierte und sogleich vorsichtig einige Töne zupfte. An der hinteren, kunststoffverschalten hellbraunen Wand kauerte jetzt der weißbärtige Herr in fichtengrüner Kombi auf einem Stuhl und strich Akkorde, und der Schlagzeuger ditschte mal das Becken an, mal auf die Snare.
Der Bürgermeister schwieg, der Taugenichts schaute benommen, und der Museumsdirektor rieb sich die Augen. Plötzlich zog einer der drei, oder waren es vier, fünf?, Harmonikaspieler sein Schifferklavier auseinander, quetschte es zusammen, ein breiter, fetter Auftaktakkord erklang, und auf der Eins setzte diese aus dem Nichts erschaffene und vom Himmel gesandte Combo ein und erfüllte den Raum mit einem seelenheiteren Getön nur für unsere drei Wanderer.
Da hockten sie, tranken das dunkle Zwickelbier und lauschten betört. Vor ihnen bewegten sich, von unsichtbarer Hand choreographiert, acht, zehn Musikanten, geschmückt mit Zweireihern, manchmal einer bunten Kreppkappe oder Hosenträgern, und drehten Kreise um ihre Weisen, beglückt vom schieren Hier- und Beisammensein. Ihr Publikum, der Taugenichts, der Museumsdirektor und der Bürgermeister, applaudierte erst zaghaft, dann immer impulsiver nach jedem Lied, der Wirt bezapfte entspannt die alten Glaskrüge, Yvonne reichte sie mal diesem, mal jenem Spielmann, und sonst geschah einfach nichts – außer dem beständigen, gutmütigen, bedächtig rhythmisierten, betulich dynamisierten Ineinanderfließen des Bieres und der Musik.
Erst eine, vielleicht zwei Stunden später betraten andere Menschen den Brauereiausschank Fößel-Batz, Ortsansässige und Bekannte aus den umliegenden Dörfern, und längst hatte da den drei Wanderern der Geiger, der einzige Violinist des Appendorfer New Modern Dance & Swing Ensembles, erklärt, daß sich jeden Freitag hier, auf unserem begünstigten Flecken Erde, die Musikanten träfen, in zufälliger Formation, und aufspielten, daß es rassele, ja, er trinke heute Wasser, er müsse den Laden zusammenhalten, die Quetschkommodisten neigten zu vorgerückter Stunde zu recht freien Improvisationen, da sei einer vonnöten, der die Leitmelodie noch im Kopf habe, obschon sie ihn meist ja doch übertrumpften und niederschrubbten, er lachte verschmitzt, machte eine wegwerfende Geste und wandte sich, das Instrument unters Kinn schiebend, kurz dem Tresen zu, ja, daß es halt eine Freude sei und sie den Leuten hier eine Freude bereiteten, sagte der alte, sorgenfreie Mann mit seiner glänzenden Geige zu den drei Gästen, er hob den Bogen, und als er das sagte und eine Gitarrensoloeinlage herüberpritzelte, pflanzten sich ein krebsroter, grinsender, wohlbeleibter Mann im feinsten Tuch und dessen Frau, eine sorgsam herausgeputzte Dame, an den Tisch. An den Tisch, an den dürfe man sich doch hersetzen, fragte der Mann, ein Kerl, der sich rasch als tanzwütige Granate und fideler Gemütskracher erwies, der zunächst mal eine Haxn einfuhr und dann seine heilig-froh als »schönste Frau der Welt« belobigte Gattin zwischen die immer fetziger herumfegenden Musiker schob und über den Tanzboden schleuderte, wo die beiden ein »La Paloma« hinschwoften, daß dem lieben Gott die Sinne geschwunden wären, während am Nebentisch Kotelettenpaul und dessen Anhang lächelten.
Lebensprall tobte das Appendorfer Stüberl Stunde um Stunde doller und draller, die fesch frisierten Hasardeure des Liedguts ließen Strophen und Refrains, Harmonien und Hooklines stilvoll durcheinanderrauschen und -randalieren, als sei es ihnen gegeben, die Musik neu zu erfinden, und mitten in dieser klingenden Welt der Freude für und für erklommen die »Bergvagabunden« den Gipfel der Begeisterung, die nichts sucht außerhalb ihrer selbst. Im Getöse und Gestampfe, im Gesange und Geschwanke stießen sie aufeinander, die Menschen, und priesen, zur Ehr’ ihrer selbst und der Geselligkeit, die roten Rosen, die roten Lippen, den roten Wein, und da unser Museumsdirektor ein zweites Mal des Dorfhallodris bewunderte, im Gesicht greulich vernarbte Spitzenfrau um die Hüften wirbelte, fand auch der Bürgermeister einen Gefallen gehörig daran, bloß noch den Damen zu gefallen.
Was immer im Dämmer des Bewußtseins versank – am folgenden Morgen beteuerte der Bürgermeister, er habe »nicht nur« seine »ausgeprägten logischen Denkstrukturen beieinander«, nein, er werde obendrein dem von ihm regierten und dirigierten Mittelzentrum einen Innovationskreis verordnen, der durch eine ausgetüftelte Stärken-/Schwächenanalyse die Grundlagen der künftigen Stadtpolitik dahingehend neu bestimme, daß im Hinblick auf konkrete Zielvorgaben das Handlungsfeld der Kneipenpolitik in einem permanenten Innovationsprozeß moderierend, koordinierend und kontrollierend dergestalt neu und innovativ gestaltet werde, daß – gemäß dem Motto »Hinschauen und lernen« – »endlich so ein Laden herkommt«.
Der Taugenichts und der Museumsdirektor nickten, recht grundlegend einverstanden.
Arbeiterfrühling
Im Osten wird es später warm. Wien friert Ende März noch immer. »Su koit woas nu nia«, klagt eine ältere Dame am Stephansplatz. In der geheizten Stube der U-Bahnlinie 4 zählen andere Dinge und Werte. Eine Mittzwanzigerin, die von einem politischen Treffen nach Hause fährt, gibt ihrem Begleiter fast dialektfrei und in voller dialektischer Fahrt zu bedenken: »Weißt du, was mir auf die Nerven geht? Dieser undifferenzierte Antimaterialismus!«
Nimmt man die U 1 Richtung Kagran, erreicht man Teile jener monomorphen Peripherien großer Städte, in denen die Straßen selten gekehrt, die Häuser nicht mehr verputzt und die Menschen nicht mehr der Mode teilhaftig werden. Dort herrscht der Funktionalismus des Lebens, und wenn man auch nostalgisch an eine Epoche denkt, in der das Rote Wien mehr versprach als nur noch mehr höhere, bürgerliche, als nur noch feinere und darob nicht sinnvollere Kultur, die stets eine Herrschaftsvernebelungskultur war, so sieht man sich doch enttäuscht, allerdings voraussehbar enttäuscht.
Die Enttäuschung ist der Anfang aller Aufklärung, und so darf man die Sentimentalität fahrenlassen und an einer der silbern verkleideten U-Bahnstationen aus den achtziger Jahren, am Haltepunkt Alte Donau, den Zug verlassen. Verlassen vom Guten, Wahren und Schönen, führt einen die Arbeiterstrandbadstraße zum aus Gründen des Hochwasserschutzes abgetrennten Arm der grün und smaragdblau funkelnden Donau. Rund um das stehende Gewässer stehen ein paar Ausflugslokale für karg Begüterte (Schnitzel um sechs Euro). Grüne Tretbote ruhen am Gestade, der seeähnliche Fluß öffnet sich weit und schmiegt sich lässig um baumverzierte Halbkleininseln.
Unterhalb der Arbeiterstrandbadstraße hat ein kleines Lokal, eher eine Art Imbiß, schon geöffnet. Das Buffet Alte Donau wird von der Familie Schneider betrieben. An den Außenwänden des Verschlags sind Holzschilder angebracht, die zur »Selbstbedienung« auffordern.
Die ersten Tische, Bänke und Stühle sind rausgebracht worden. Vor dem Eingang sitzt Frau Schneider mit den blauen Fingernägeln und raucht Memphis-Zigaretten, die blauen. Herr Schneider in der Jogginghose sitzt neben ihr und raucht Marlboro. Der Sohn setzt sich dazu, raucht nicht und liest das Fachblatt Fisch & Fang. Nebenan gruppieren sich um einen Holzstehtisch drei Frührentner, nippen an ihren Achtele und reden Vollgültiges.
Meisen zirpen, ein Star pfeift, Mäusebussarde gellen. Die Weiden und Birken wiegen sich im kühlen Wind. Herr Schneider rückt unseren Tisch alle halbe Stunde in die wandernde Sonne, stellt einen frischen Aschenbecher ab und sagt: »Bitte sehr.«
Schneiders Hund, ein französischer, ergrauter Vorstellhund, rennt im Schweinsgalopp auf und ab, das Maul auf- und zuschnappend, als lache er sich das Herz aus dem gewärmten Leib. Ein Kind versucht, ein blaues Tretboot mit Rutsche zu entern, während sich ein Ehepaar an einer überdimensionalen Cola-Dose, einem weiteren Stehtisch, zum Wieselburger Bier einfindet und sich zufrieden nicht unterhält. Und raucht.
Das österreichische Fernsehen, der ORF, sendet ein paarmal pro Tag zehn Minuten über den »Krieg gegen Saddam«, in seinen Nachrichten Zeit im Bild. Es gebe nicht mehr zu sagen, sagt der Moderator, einige Bilder von den Alliierten flimmern über den Schirm, dann kommt Ally McBeal. Morgens greift man zum Splitscreen. Rechts streift die Kamera über österreichische Landschaftstraumpanoramen, links, etwas kleiner, glühen grüne Kugeln über dem kommentarlos eingespielten CNN-Bagdadhimmel. Drunter dudelt Kaminmusik.
Der Vorzug der Neutralität und des kleinen Landes: Es ist praktisch fernsehfrei. Keine Endlosschleifen, kein televisionär sich vermehrendes Nichts. Kaum ein Österreicher hat Kabel. Der Österreicher hat ORF 1 und ORF 2.
Zwei Schweizer KFOR-Soldaten in voller Montur tauchen vor dem Buffet Alte Donau auf. Warum, weiß niemand. »I dacht’, der Krieag is’ woanders«, sagt Sohn Schneider und bringt den beiden, die nicht lesen können oder nicht wissen, was Selbstbedienung ist, einen Kaffee und eine aufgespritzte Limo.
Wir bestellen eine Gemüsesuppe und Bier. Vorzüglich. Frau Schneider lacht nicht einmal. Sie ist nur da. Ohne etwas zu wollen.
Ein Krieg findet statt. Anderswo, irgendwo, nirgendwo. Zu »20 Schilling« darf im alten Buffetnebenkabuff Tischtennis gespielt werden.
Der Russe
Zwischen Murmansk und Moskau hat ein Russe einen Schnellzug entführt und »zwei Flaschen Bier als Lösegeld gefordert« (taz, 3. November 1999), wurde jedoch nahe Sankt Petersburg von der Polizei überwältigt und arretiert.
Vom Russ’
Taktische Ikonographie
Es wird erzählt, daß der Russ’ manchmal sehr ergrimmen konnt’. Als er mit seinem Fußvolke und seinen Rössern zum Beispiel einmal ein Wegkreuz, welches den Gottessohn in sterbender Verzehrung zeigte, zu passieren sich anschickte, hielt er bei diesem Anblick an und inne. Augenblicklich überkamen ihn ein Zorn und ein inneres Grollen, nämlich darüber, daß der Franke es wagte, ein Leid so schamlos an der Straße auszustellen – ein Leid, das doch er, der Russ’, dem Franken wollt’ angedeihen lassen.
Unschlüssig und verwirrt verweilte der Russ’ in seiner ganzen herrlichen mannschaftlichen Geschlossenheit vor dem hölzernen Gebilde, während keine acht Morgen weiter der Franke einen Becher hob und in den Wirtssaal rief: »Leut’, habt acht, des hamma für den Russ’ gemacht!«
*
Virtuelle Vendetta
Weil aber der Russ’, der von alters her ein Meister in Ikonographie, Schweineschlachtung und Menschenbehandlung war, jene Niederlage von Drügendorf nicht ungesühnt lassen wollte, marschierte er gleich auf Drosendorf zu. Dort war indes niemand.
*
Die Macht der Gedanken
Ein ehrlicher Franke trieb seine Kühe vom Anger auf die Weide hinaus, sprach seinen Viechern warme Worte zu und legte sich ins Maigras. Die melonengelbe Sonne bleckte und tänzelte über die Wangen des wackeren Franken, der bloß angetan war mit einem Shirt und einer Stoffhos’, und die Gefleckten mampften das dicke Gras, während sich der Franke einem Gedanken hingab, von dem er noch nicht wußte, welcher Art er sei.
So verging eine Zeit. In einem Moment jedoch schreckte der Bauersmann hoch, weil er hinten am Waldesrand, im Gebüschsaum, ein Geräusch glaubte gehört zu haben. »Ein Franke täuscht sich nicht«, dachte er da, und er fügte für sich noch einen Gedanken hinzu: »Das ist der Russ’, auf der Lauer liegt er dort, das ist mir gewiß.«
Also berappelte sich der Franke, erhob sich, zog die Stoffhos’ »auf Äquator«, schritt hinüber zu seinen grasenden Tieren und flüsterte jeder einzelnen Kuh ein Wort ins flauschige, hochgestellte Ohr.
Daraufhin taten die Tiere, wie ihnen geheißen, sammelten sich auf einer Linie und begannen, auf den Waldesrand zuzumarschieren.
Aus dem Buchen- und Tannengeflecht waren sogleich deutlich gewisse undeutliche und erschreckend blecherne Laute wie »Kuczynski, Katastrophia!« und »Kommando kehrtysky!« zu vernehmen, derweil dem wacker’n Franken schon wieder hold liegend daran lag, jenen Gedanken zu denken, an den er schon so lange gedacht hatte, ohne ihn bereits vollends zur Reife gebracht, geschweige denn begonnen zu haben.
*
Fitneßfinte
Dem Russ’ fiel einmal ein, es anders zu probieren. Er machte einen Plan, den er selbst beinahe verstand, und nach diesem Plan verheerte der Russ’ sodann folgende Gemarkungen: Sachsendorf-Süd, Keilstätten, Fürth (komplett), die ebermannsstädtische Schweiz und einen erheblichen Teil von Aufseß. In Aufseß hatte der Russ’ nämlich außerdem ein Wirtshaus ausgemacht, in dem pechschwarzgebrannt wurde, und das packte ihn sehr an der eig’nen Ehr’.
Nun, der Erfolg der Mission war augenscheinlich. Aber nach zwei Tagen stellte sich heraus, daß der Russ’ nur Sachsen, Holsteiner und Albaner hingemeuchelt hatte. Dieselben waren vom Franken zu einem »Extreme Wellness Weekend« eingeladen und überall dort einquartiert worden, wo die Kunde von des Russ’ Vorhaben vorher hingedrungen war.
Der Franke seinerseits aber war längst über den Wellness-Wanderweg nach Kathi-Bräu entflohen, wo er jetzt der Katze ein Prosit entbot und jene zarten Maiden orgelte, von denen der Russ’ abermals bloß schmachtend träumte.
*
Von der Wendigkeit der Gefühle
Einmal verlief sich der Russ’ bei Nürnberg-Langwasser so arg, daß er nach Stunden entbehrungsreichen Marschierens schon aufgeben und die Fehde, verärgert über sich selbst, für beendet erklären wollte. Vorerst.
Gerade hatte er sich also in einem großen Kiefernwald mit seinen erschöpften Mannen auf ein Lager gebettet, um zu rasten und den Friedensvertrag aufzusetzen, da fiel ihm auf, daß er die nämliche Schrift ja gar niemandem würde überbringen können, wo man doch so furchtbar herumgeirrt war und nun in der erbärmlichsten Einöde verdammt schien, immerdar unter sich zu bleiben und nie mehr eines Franken ansichtig zu werden.
Bei dieser trüben Aussicht änderte der Russ’ seine Meinung deshalb sofort und schwor sich, in den nächsten Tagen wenigstens auf Reuth droben und jenseits des Wernsbaches alles kompromißlos kurz und klein zu hauen.
Obschon dort ja schon lange kein Stein mehr auf dem anderen lag, hatte jene Gegend früher nämlich als Übungsgebiet für die »Operation Schnatzkolkaja« herhalten müssen. Aber das war dem Russ’ in seinem Frust nun gleich ganz scheißegal. So war er eben …
*
Ankündigung schlimmer Ereignisse
Von Mund zu Mund ging oft die Geschichte, daß der Russ’ etwas fürwahr Furchterregendes im Schilde führte, das schlimmste Not über die Gauen des Frankenlandes bringen würde und manches Ungemach, etwa trocken Brot, Gift in der Suppe und grüne Fahrradreifen. Was genau, wußte man nicht.
Aus der Welt der Wahrheit
Schlagfertig con Schaschlik
An einem Frankfurter Stehimbiß, an dem Eckhard Henscheid in unregelmäßigen Abständen zu einem Gemeinschaftssnack und zum anschließenden »Elendstrinken« lädt, wurde der Romancier, als er gerade einen Happen Schaschlik zum Mund führte, von einem Redakteur gefragt, ob er gedenke, demnächst wieder »einen großen Roman« zu schreiben.
»Nein«, versetzte Henscheid und kaute weiter.
*
So nicht!
Vor vielen Jahren war der Dichter Henscheid mit einem Freund während einer Anhalterreise zwischen Rastatt und Iffezheim sehr lange hängengeblieben. Also beschloß Henscheid, in die nächstgelegene Ortschaft zu wandern, um durstlöschendes Bier zu holen. Es war um sechzehn Uhr herum, zudem glutheiß.
Der Wirt des ersten erreichbaren Lokals beschied das Ansinnen des jungen Henscheid, zwei kühle Flaschen Bier kaufen zu wollen: »Ein Bier für zwei genügt!«
*
Perfekte Pannenhilfe
»Tatsächlich? Mit der Flasche?« Ja, er bitte ihn darum, mit der Bierflasche auf den Anlasser zu hauen, eigentlich genüge auch ein Klopfen, um den Wagen zu starten. Nur weil der Anlasser hinüber sei, liege diese Bierflasche überhaupt hier im Auto herum.
»Ach so«, sagte Eckhard Henscheid und stieg mit der Bierflasche in der Hand aus, ging um den Wagen herum, öffnete die Motorhaube, beugte sich über den Motorblock und begann, mit der Bierflasche auf den Anlasser einzuschlagen. Der Mann hinterm Steuer drehte den Zündschlüssel um, und schon lief der Motor.
»Das wäre ein Romananfang«, sagte Henscheid, als er wieder auf dem Beifahrersitz Platz genommen hatte. »Eine interessante Szene.«
Die Bierflasche war unversehrt geblieben.
Der Staub der Seele und das Grün des Gemüts
Nach Westen, junger Mann, nach Westen! Dort findest
du Glück, Ruhm und Abenteuer.
Der Mann, der Liberty Valance erschoß
Es ist schwer.
Townes Van Zandt
Das Lagerfeuer lodert, orange und honiggelb züngeln die Flammen. Unterhalb der Terrasse neben dem Hauptgebäude der 71 Ranch im Nordosten von Nevada erstrecken sich im Halbdunkel riesige Weiden, die in die Ausläufer der Ruby Mountains übergehen. Gütig konturieren die »Alpen von Nevada« den Horizont, die Szenerie einhegend und beschützend.
Es riecht nach Bohnen, gegrilltem Huhn, gegarten Kartoffelscheiben. Jay Dalton, eine optisch präzise Inkarnation des Marlboro-Mannes, greift zur Gitarre, legt sie noch mal zur Seite, nimmt einen Schluck Bier und beginnt sie dann zu besingen, die unstillbare Sehnsucht nach dem Westen, nach dem Leben im »Big Empty«, nach der Unabhängigkeit, aber auch nach der Familie, der Geborgenheit, der Sicherheit, die die tradierten Werte gewähren. Oder gewähren sollen.
Der Mythos vom weißen Mann, der sich kraftstrotzend, hartgesotten und selbstbewußt, mit Entschlossenheit, Unerschütterlichkeit und Gottes Segen ein wildes, unermeßlich weites Land untertan gemacht hat, ist melancholisch legiert. Die verflossene Liebe, die ausgespannte Braut, »heartache and tears«, all das kennt das Liedgut der Cowboys nur zu gut, und Jay Daltons schwebender, wellenförmig an- und abschwellender Gesang zeichnet die Welt bisweilen tief anrührend nach dem Melos der Schwermut. Das Leben, »sometimes it makes me mellow« – manchmal macht mich das Leben mürbe.
Nicht, daß Jay Daltons Darbietung an die Auftritte des großen, verlorenen Sohns der Country- und Bluesmusik heranreicht, an Townes Van Zandt, der laut Willie Nelson »Poesie und Musik« wie kein zweiter Songwriter und Folksänger vermählte; an den abgewetzten, ausgemergelten, verstörten Tramp und Troubadour, der das Bild vom gebrochenen Cowboy, der auf der Straße die Freiheit und Reinheit des Lebens sucht und dabei scheitert, verkörperte wie sonst kaum jemand: »Alleinsein ist ein Zustand. Einsamkeit dagegen ist ein Gefühl.« – »Ich habe ein paar Lieder, die sind nicht traurig, nur hoffnungslos.« Aber der Staub, der sich auf die Seele legt und die Hoffnung, die im Gemüt noch grünen mag, endgültig erstickt, den spült auch Jay Dalton – bildlich – mit dem einen oder anderen Bier an der Bar herunter, »just watching the bubbles in my beer«, bloß auf die Bläschen in meinem Bier starrend, und dabei fühlt er sich »as empty as the bubbles in my beer«. Da hilft vielleicht nur noch Jodeln, American Yodeling, und das beherrscht Jay Dalton so virtuos, daß man sich in den Alpen wähnt oder mitten unter Kojoten.
Nun nimmt er einen weiteren Schluck Buckaroo-Bier, das benannt ist nach den in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts in der hiesigen Gegend ansässig gewordenen baskischen Schäfern, den »vaqueros«. »I like beer, it makes me a jolly good fellow«, sagt Dalton, »ich mag Bier, das macht aus mir einen fröhlichen, guten Kerl«, und dann setzt er seinen Ritt durch den Reigen berühmter Cowboylieder, berühmter Weisen amerikanischer Kuhhirten und ihrer Panegyriker und Rhapsoden, fort, von Hank Williams über die Titelmelodie des Jahrhundertwesterns High Noon und »Ring Of Fire« bis zu einer glänzenden Willie-Nelson-Parodie.
Jay Dalton ist witzig, ist komisch, er erzählt Räuberpistolen und Grotesken über eine Stampede, über ein Rodeo in Elko, der nächsten Stadt Richtung Westen, er veralbert mitunter die Grasnarbenfolklore, und er beschließt den Abend, die Bierflasche in den wie auf einem Gemälde von Frederic E. Church oder Albert Bierstadt glühenden Himmel hebend, mit John Denvers Zeile »Sunshine on my shoulders makes me happy«.
Wie sagten die amerikanischen Kollegen während der Anreise von Salt Lake City über den Highway Interstate 80, der auch die legendären Siedler- und Goldsucherrouten California Trail und Oregon Trail touchiert? »Nevada is a drinking state« – Nevada ist ein Staat der Trinker. Yeah.
*
Es fällt einem kein anderes Wort ein als: Weite. Der Himmel, die Weite. Eine Landschaft, die prähistorisch wirkt. Eine Kulturlandschaft jedoch, zum Teil zumindest. The Great Basin, Cowboy Country, das wahre, das unverfälschte. »The unspoiled drama of the West« – so bewirbt man den Nordosten Nevadas, den wilden, rauhen, das »Territorium des Bieres«, wie die amerikanischen Kollegen immer wieder anmerken, zumal jene aus Kalifornien, die beim Anblick einer glimmenden Zigarette gleich dem Vampir im Angesicht der Knoblauchzehen dreinschauen.
Wir kommen aus der faden Mormonenkapitale Salt Lake City. SLC, eine Abbreviatur der Lustfeindlichkeit. Die Stadt am Großen Salzsee, der quecksilbrig unterm tranig-quarkigen Himmel in seiner Pfanne vor sich hin schwappt. SLC, such a lust killing community. In Salt Lake City, der womöglich ernüchterndsten Stadt des Westens, sind Alkohol und Tabak des Teufels.
Graue Berge säumen den Horizont. Milchig-bläulich fläzt das Licht über strohig-blaßbrauner Vegetation. Der Wüstenbeifuß behauptet sich, dazwischen nichts, kein Haus, kein Mensch, kein Pferd. Die Wolken kleben am Himmel, als seien sie dort begraben. Zerfurchte, kahle Hänge hinter olivgrün gesprengselten Ebenen. Zwergsträucher, Krüppelbüsche, stille Prärie, ausgetrocknete Heide. Zementfarbene, endlose Flächen. In der High Desert seien sie auch noch nicht gewesen, gestehen die amerikanischen Kollegen und betonen, abgelegener, unberührter gehe es nicht.
Es tauchen die ersten Salzplacken auf, sie werden größer, dehnen sich aus, und plötzlich sind wir auf den Bonneville Salt Flats. Die Berge in der Ferne ragen kantig, spitz, schwarzbraun und abweisend auf, und davor liegt eine betonharte, wie gewalzte, gleißend weiße, tödliche Ebene, auf der mit Raketenautos Geschwindigkeitsweltrekorde en suite aufgestellt und in die vielerlei Namen von denen, die hier eine Rast einlegten, eingeritzt wurden – mit Bierflaschen, wie uns später ein Cowboy auf der 71 Ranch erklärt.
Die Cowboys der Landstraße, die Trucker, hetzen ihre Riesenkähne brummend und heulend über den schnurgeraden Asphalt. Ob Geschwindigkeit und Zielstrebigkeit der Gütertransporteure das Äquivalent zum Pioniergeist des 19. Jahrhunderts sind? Die motorisierte Unentwegtheit den einstigen Eroberungsdrang beerbt? Zitiert? »24 hours truck wash«, lesen wir an einer Tankstelle, und am Heck eines Lkws steht: »Without Trucks America Stops«.
Und die Kollegin aus Kalifornien sagt: »Sarah Palin hat den Cowboy in sich. ›Bring it on!‹ – ›Mach hin!‹ Das fordert sie.«
*
Wir halten in West Wendover, etwa hundertsiebzig Kilometer vor Elko und einen Fußbreit hinter der Grenze zwischen Utah und Nevada. Dort kann man, von einer Anhöhe aus und der Weite wegen, sehen, wie sich die Erde krümmt, in die Salzwüste hinein. Am Ortseingang grüßt die größte Neoncowboyfigur der Staaten, der »Wendover Will«, auf einem massiven Podest, mit, man glaubt es kaum, Zigarette im Mundwinkel. Lucky Luke, der rechtschaffene Widersacher der rund um Carson City ihr Unwesen treibenden Dalton-Brüder, darf das schon seit Jahren nicht mehr. Er kaut im Comic auf einem Strohhalm herum. Lustlos.
Seit 1931 ist das Glücksspiel in Nevada, dem »Silver State« mit seinen zahlreichen Gold- und anderen Edelerzminen, legal. West Wendover besteht im Grunde einzig aus Hotels mit Spielkasinos, das heißt aus vollklimatisierten Übernachtungsbunkern mit verspiegelt-labyrinthischen, in den grell-giftigsten, abscheulichsten Farbkombinationen gehaltenen Hallen und Foyers, in denen zwischen Roulettetischen, Restaurantbuchten und verchromten Bars Tausende von Spielautomaten jiepen, rattern, pfeifen, singen, klingeln, scheppern, schnarren. Tinnituspatienten sollten diese Orte meiden.
Gleich hinter den Rezeptionen öffnen sich die Höllenreiche, in denen Rentner, Trucker, Hausfrauen, Kettenraucher, Studenten, Geschäftsleute, Handelsreisende ihr materielles Glück suchen. Sie drücken die Knöpfe der in die Tresen eingelassenen Pokermaschinen, die die Pokertische in den verqualmten Saloonhinterzimmern ersetzt haben, und ordern per Fingerzeig schweigend Whisky und Bier. Die Cowboys an den Slot Machines, den Einarmigen Banditen, genießen nicht nur den Vorzug, von all den Restriktionen, Bevormundungen und Schikanen im Alltag verschont zu bleiben und ungestört-entspannt dicke Zigarren dampfen zu können; sie genießen obendrein die in solchen hochdemokratischen Instituten übliche Sonderbehandlung: Solange du vor einer bunten Kiste hockst und Münzen in sie versenkst, gehen Bier und sonstige Getränke in unbegrenzten Mengen aufs Haus.
Hier drinnen, in der überirdischen Katakombe, scheint die Sonne nie. Selbst die Zimmer sind weitenteils verdunkelt. Damit die Spieler das Gefühl für die Zeit verlieren und tagelang an den Geräten kleben, wenden die Kasinobetreiber diverse Tricks an. Die Spielhallen haben keine Fenster, nirgendwo hängt eine Uhr. Für die Teppiche wählt man die allerabstoßendsten Muster, so daß der Blick stets auf die Slot Machines gerichtet bleibt. Die wiederum werden in kurzen Abständen umgestellt, um zu suggerieren, es seien neue angeschafft worden. Eine außergewöhnlich sauerstoffreiche Luft sorgt für immens ausgedehnte Wachphasen.
Draußen stülpt sich eine erbarmungslose trokkene Hitze über eine Topographie, die man mit unbewohnten Planeten assoziiert. Daß auf der anderen Seite der Straße, auf der in den sechziger Jahren geschlossenen Wendover Air Force Base, die Besatzung der Enola Gay ausgebildet wurde, die die erste Atombombe über Hiroshima abwarf, dünkt einem nicht unschlüssig.
*
Siebzig, sechzig Kilometer vor Elko beginnt es zu grünen. Vieh steht in der Landschaft herum, an den Berghängen vereinzelt niedrige Bäume. In Richtung Süden, auf die Ruby Mountains und das Ruby Lake National Wildlife Refuge zu, werden die gelblich leuchtenden Weiden immer saftiger und – wie von der Hand eines Landschaftsmalers des 19. Jahrhunderts dirigiert – gruppieren sich pechschwarze Angus-Rinder unter flockig am blauen Firmament arrangierten Schäfchenwolken.
Die »einzigartige, unermeßliche, wunderbare Landschaft« und »das grenzenlose Licht: die amerikanische Verheißung« (Robert Hughes: Bilder von Amerika, München 1997) – sie, diese Elemente eines unvergleichlichen Seelentableaus, wirken vollendet schön und überwältigend ein paar Meilen weiter im sonnenüberfluteten Lamoille Canyon mit seinen buntgescheckten Bergflanken. Auf der im späten 19. Jahrhundert errichteten, zweitausend Meter hochgelegenen 71 Ranch, gewissermaßen um die Ecke, gut vierzig Kilometer von Elko entfernt, versuchen wir nach einem Cowboyfrühstück mit Rührei, Kartoffeln, gegrillten Tomaten, stocktrockenem Speck, Geselchtem und Pfannkuchen mit Sirup, dem »folklife« auf den Grund zu gehen, die »working cowboy experience« zu machen, also zu erfahren, was es mit dem autarken »buckaroo way of life« auf sich hat, einem Lebensstil, den viele als Berufung verstehen oder verklären, etwa das Ranch & Country Magazine, das das »Leben in Harmonie mit der Natur« preist, »in dem die Erde tagein, tagaus als ein Ort des Friedens und der Sicherheit erscheint«, das »Leben, in dem man wertschätzt, sich frei im offenen Gelände bewegen zu können«, jenseits der Grenzen und Beschränkungen, die einem die Zivilisation auferlegt. Freiheit, heißt das so betrachtet wohl, findet man auf dem Rücken eines Pferdes, alleine durch die unendlichen Gefilde streifend – beziehungsweise im Rahmen einer Beschäftigung, die in einem Handbuch der 71 Ranch wie folgt definiert wird: »Ein Cowboy ist eine Person, die mit Rindern vom Rücken eines Pferdes aus arbeitet.«
»Nie fragen, wie viele Rinder und wieviel Land ein Rancher besitzt«, lautet ein ungeschriebenes Gesetz des Cowboykodexes im »Open Range«. Greg Titus, der »Buckaroo Boss«, der Chef der 71 Ranch, die Teil eines Verbundes von neun Höfen ist, sieht das weniger eng und gibt bereitwillig Auskunft: 2.500 Rinder, zirka 15.000 Hektar – und fünfzig Pferde, die nur die versiertesten Cowboys »mit einer starken Persönlichkeit« zähmen und zureiten könnten.
Anschließend trägt er den kategorischen Cowboy-Imperativ vor, das »Cowboy Up!«: »Mach hin! Hör auf, dich zu beschweren! Leg die Extrameilen zurück! Unternimm die Extraanstrengung!« Daneben gibt es weitere Gebote, beispielsweise diese: »Mach nie eine Kuh verrückt!« – »Wenn du neu bist in der Gegend, halte die Klappe und mach die Augen auf!« – »Schrei nie den Hund eines anderen an!« – »Hetze dein Pferd nie nach Hause zurück in den Stall!« – »Bevor du ißt, füttere dein Pferd!«
»Entdecke den Cowboy in dir!« Das ist die Aufforderung, die an uns ergeht. Gleichwohl, auf einem Gaul durch die Gegend zu zuckeln, das hat wenig gemein mit der Arbeit der »Cattlemen«, die bei jedem Wetter den ganzen Tag das Vieh observieren. Während unsereins »die heilige Ruhe der Natur« (James F. Cooper) genießt, den Blick ins »great wide open«, auf das flirrende Panorama, über gewellte Wiesen, auf die gestaffelten Anhöhen der Ruby Mountains, die gebüschgesäumten Weiher, während unsereins die Linien der Schotterwege und Zäune, die erdigen Farben der Hügel, die ausgedehnten, verdorrenden Grasflächen adoriert und das Säkulare kontemplativ poetisiert, erläutert Greg unter seinem grauen Stetson trocken: »Wir tun hier alles im Hinblick auf das Ende der Kuh. Wir sind Fleischproduzenten.«
»Jeder Cowboy ist ein Doktor und ein Apotheker«, fährt er fort, aber kranke Rinder, die in den Ruby Mountains grasen, müßten erschossen werden. »Pferde sind Teil unserer Produktion und keine niedlichen Haustiere«, meint er dann, um uns auf die Kastration eines Hengstes in der alten Scheune vorzubereiten – »ein trauriger Tag für ihn«. Dem Vorgang möchte man, weiß man hinterher, nicht noch mal beiwohnen und lugt verlegen hinüber zum ehemaligen Schlachthaus, einem spitzgiebeligen, weißen Holzverschlag am Rande einer Koppel.
Die Viehgroßhändler würden traditionell mit rüden Scherzen bedacht, sagt Greg und zupft an seinem gezwirbelten Schnurrbart. Das »cowbusiness« sei hart, die Rindfleischbörse unterliege erheblichen Schwankungen, die Globalisierung dränge die amerikanischen Rancher in die Enge, deshalb verlege man sich verstärkt auf den Tourismus, auf das Konzept »Ferien auf dem Bauernhof«. Da gelte es, die Artenvielfalt zu konservieren, die Natur zu schützen, »alles im Gleichgewicht zu halten, darauf sind wir stolz«. Und er setzt hinzu: »Viehzüchter sind in allererster Linie Landmanager. Kühe sind lediglich Graspakete. Was bleibt, ist das Land.«
Einen feinfühligen, indes keineswegs nostalgisch eingefärbten Vortrag hält der Sprecher einer befreundeten Ranch. Er ist bemüht, das Bild des Cowboys als eines unzivilisierten, unbändigen Raufbolds zu revidieren, die Cowboydichtung als der Nachsicht zugeneigte, zarte Ausdrucksform zu würdigen und die heutigen Herausforderungen der Landschaftspflege, des sorgsamen Umgangs mit der Kreatur zu skizzieren. Das schließt die Frage der Wiederansiedlung der Bisons ein, die im kolonialistischen Besiedlungskampf vernichtet wurden. Warum man einst die Bisons nicht domestiziert hat, legt Greg dar: Ein Büffel würde ein Pferd innerhalb von zehn Sekunden aufspießen und in Stücke reißen.