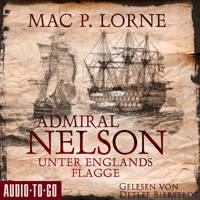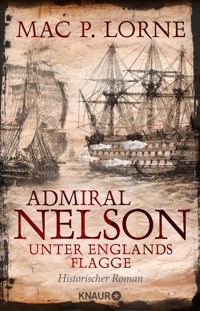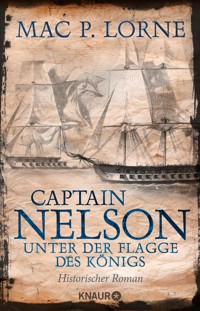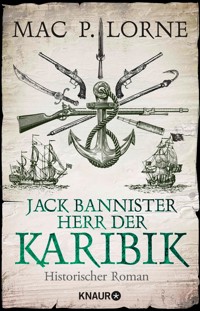9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Robin Hood-Reihe
- Sprache: Deutsch
Wie alles begann! Der fulminante Auftakt der Reihe um den Meister der Diebe. Rasant erzählt und genau recherchiert von Bestseller-Autor Mac P. Lorne. England 1110 - Der junge Gardist Robert Fitzooth wird zum persönlichen Leibwächter der englischen Prinzessin Matilda bestimmt, die den deutschen König Heinrich V. heiraten wird. An ihrer Seite überquert er die Alpen, gelangt bis nach Rom, wird in den Streit zwischen Kaiser und Kurie verwickelt und muss in einem jahrzehntelangen Bürgerkrieg kämpfen. Doch er findet auch die Liebe seines Lebens und sein Enkel wird dereinst einen Namen tragen, den alle Welt kennt - Robin Hood. Mac P. Lorne führt den Leser eindrucksvoll durch das Europa des 12. Jahrhunderts, an die Höfe von Kaisern und Päpsten, in die Hütten der einfachen Menschen und tief hinein in den Sherwood Forest. Dieses eBook erschien bereits 2014 unter demselben Titel bei Offsetdruck & Verlag Dorfmeister, Tittling.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 968
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mac P. Lorne
Die Pranken des Löwen
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Wie alles begann: Die Ahnengeschichte des Robin Hood
England 1110: Im einen Moment wird ihm beinahe die rechte Hand abgeschlagen, im nächsten wird der Gardist Robert Fitzooth zum Leibwächter einer Prinzessin bestimmt. Sein wechselhaftes Schicksal führt den Engländer an der Seite der jungen Matilda, der Braut Heinrichs V., zuerst ins deutsche Kaiserreich, dann weiter, über die Alpen, bis ins ferne Rom und schließlich zurück in die alte Heimat und in einen nicht enden wollenden Krieg.
Er ahnt nicht, dass sein Enkel einst einen Namen tragen wird, den alle Welt kennt: Robin Hood!
Inhaltsübersicht
Widmung
England um 1140
Römisch-Deutsches Reich um 1120
Wappen
Personenregister
Teil I
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Teil II
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Epilog
Historische Anmerkungen des Autors
Zeittafel
Glossar
Bibliografie
Für Martha, Hilde, Johannes und Werner.
Ich denke an euch!
England um 1140
Römisch-Deutsches Reich um 1120
Personenregister
(historische Personen sind mit einem * gekennzeichnet)
Henry I.* – geb. um 1068 in Selby, gest. 01.12.1135 in Lyons-la-Forêt, von 1100 bis 1135 König von England
Matilda* – seine Tochter, geb. 07.02.1102, gest. 10.09.1167 in Rouen
Heinrich V.* – ihr erster Ehemann, geb. um 1081, gest. 23.05.1125 in Utrecht, von 1111 bis 1125 römisch-deutscher Kaiser
Geoffrey von Anjou* – ihr zweiter Ehemann, geb. 1113, gest. 07.09.1157
Henry II.* – ihrer beider Sohn, geb. 05.03.1133, gest. 06.07.1189, ab 1154 König von England
Eleonore von Aquitanien* – seine Ehefrau, geb. ca. 1122 in Poitiers, gest. 01.04.1204 im Kloster Fontevrault
Richard Plantagenet*, später genannt »Löwenherz«, ihrer beider Sohn – geb. 08.09.1157 in Oxford, gest. 06.04.1199 vor Chalus, ab 1172 Herzog von Aquitanien, ab 1189 König von England
Robert Fitzooth der Ältere – geb. um 1092, gest. 1174 in Loxley
Martha Fitzooth, seine Frau – geb. um 1100, gest. 1181 in Loxley
Hugh Fitzooth, ihrer beider Sohn – geb. 1135 in Le Mans, ermordet 1183 in Loxley
Robert Fitzooth der Jüngere, auch Robert von Loxley, später Robin Hood genannt, sein Sohn – geb. 1160 in Loxley, gest. 1247 in Kirklees Priory
Marian Leaford – seine Frau, geb. 1165 in Fenwick, gest. 1243 in der Gascogne
Richard Leaford, ihr Vater – geb. 1132 in Lincoln, gest. 1192 in Fenwick
Little John, Much Millerson, Bruder Tuck, Gilbert Whitehand, Will Scarlett – Gefährten von Robin Hood
Ralf (Robert) de Lacy* – Highsheriff von Nottingham und den königlichen Forsten, geb. 1144 in Pontefract, gest. 1194 in Nottingham
Guy von Gisbourne, sein Gehilfe – geb. 1155, gest. 1189 in Nottingham
Paschalis II.* – von 1099 bis 1118 Papst der katholischen Kirche, ließ sich als Erster bei seiner Inthronisation krönen und untermauerte damit das Primat der Kirche über die weltlichen Herrscher
Adalbert von Saarbrücken* – Kanzler Heinrichs V. und Erzbischof von Mainz, wandelte sich vom Freund des Kaisers zu dessen Feind und ärgstem Widersacher, gest. 23.06.1132
Lothar III.* – Herzog von Sachsen, Nachfolger Heinrichs V. als König und Kaiser, geb. 1075, gest. 03.12.1137
Hildegard von Bingen* – trat als Benediktinerin 1112 in das Kloster Disibodenberg ein, gründete 1147 das Kloster auf dem Rupertsberg nahe Bingen, gilt als bedeutendste Universalgelehrte und Visionärin ihrer Zeit, geb. 1098, gest. 17.09.1179
Jutta von Sponheim* – Magistra der Frauenklause im Kloster auf dem Disibodenberg, geb. 1092, gest. 22.12.1136
Stephan von Blois* – riss nach dem Tod Henrys I. die englische Krone an sich und entfesselte damit einen neunzehnjährigen Bürgerkrieg, die sogenannte Anarchy, geb. 1097, gest. 25.10.1154
Heinrich von Blois* – sein Bruder, Bischof von Winchester, krönte Stephan, wechselte aber während der Anarchy mehrfach die Fronten, gest. 08.08.1171
Robert von Gloucester* – Halbbruder Matildas, neben seiner Schwester Anführer des Widerstandes gegen Stephans Usurpation des Thrones, geb. um 1100, gest. 31.10.1147
John FitzGilbert, genannt der Marshal* – geb. um 1105, gest. 1165, sein Sohn William Marshal wurde später Regent Englands
Robert d’Osney* – Kastellan von Oxford Castle, gest. 1142
William Peverel* – Highsheriff von Nottinghamshire und der königlichen Forste, geb. um 1080, gest. 1155
Robert Foliot* – von 1174 bis 1186 Bischof von Hereford
Teil I
Robert Fitzooth der Ältere
Prolog
London, Februar 1110
Ein eisiger Februarwind pfiff um die Mauern des Towers von London. Selbst die Raben hatten ihr Gefieder aufgeplustert und scheuten sich davor, aufzufliegen. Sie harrten der Dinge, die da kamen, und schickten nur von Zeit zu Zeit ein heiseres Krächzen über den Platz zwischen dem großen normannischen Donjon und der Außenmauer.
Auf der Richtstätte des Tower Hill rückte der Scharfrichter seinen Block zurecht und prüfte die Schneide seiner Axt. Auch wenn heute kein Gefangener vom Leben zum Tode befördert werden sollte, so musste doch alles stimmen, denn der König selbst hatte sich angesagt. Schließlich sollte einem seiner Leibwächter die Hand abgehackt werden, die dieser gegen einen Vorgesetzten erhoben hatte.
Trommelwirbel erklang, als Henry I., seine kleine Tochter Matilda an der Hand, aus dem Tor der großen Halle des White Tower trat und die hölzerne Treppe aus der ersten Etage zum Innenhof hinabschritt. Vor Kurzem waren die Gesandten des deutschen Königs eingetroffen. Die junge Prinzessin war schon vor Jahren Heinrich V. zur Gemahlin versprochen worden, um das Bündnis zwischen dem Anglonormannischen und dem Deutschen Reich zu festigen. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, zu dem sie, obwohl erst achtjährig, ihrem zukünftigen Gatten zugeführt werden sollte. Ihre weitere Erziehung würde der Erzbischof von Trier übernehmen und sie in den Sitten und Gebräuchen des Landes unterrichten, über das sie einmal an der Seite ihres Gemahls als Kaiserin herrschen sollte.
Seitdem ließ Henry seine Tochter nicht mehr von seiner Seite weichen. Er wollte die letzten gemeinsamen Stunden mit ihr verbringen, damit sie sich für immer in sein Gedächtnis einbrannten. Wer wusste schon, ob sie sich jemals im Leben wiedersahen? Außerdem konnte es nicht schaden, wenn sie auch einmal mit den unangenehmen Dingen konfrontiert wurde, denen sich ein Monarch zu stellen hatte. Bestrafungen mitanzusehen machte dem König keine Freude. Lieber beschäftigte er sich mit den schönen Dingen des Lebens, vor allem mit den Wissenschaften. Nicht umsonst hatte man ihm den Beinamen Beauclerc – der Gelehrte – gegeben. Doch was sein musste, musste sein, und wenn er ein Urteil gesprochen hatte, war er auch anwesend, wenn es vollstreckt wurde.
Hinter dem König schritt Hugh de Clare mit zerknirschter Miene einher. Er befehligte die Leibwache Henrys und hatte den jungen Mann, der jetzt verstümmelt werden sollte, vor einiger Zeit selbst ausgesucht und einer intensiven Ausbildung unterzogen. Bisher hatte sich der Bursche nichts zuschulden kommen lassen – und nun das. Sein Sergeant hatte ausgesagt, dass er von ihm angegriffen worden war. Ein unverzeihliches Vergehen, das auch mit dem Tode geahndet werden konnte. Kein Vorgesetzter durfte etwas Derartiges dulden, und so musste hier, auch wenn es de Clare bitter ankam, ein Exempel statuiert werden.
Der König nahm auf einem gepolsterten Stuhl auf der Empore neben der Richtstätte Platz und griff nach Matilda, um sie auf seinen Schoß zu heben. Doch die wehrte sich und gab ihrem Vater zu verstehen, dass sie lieber neben ihm stehen wollte. Mit ihren acht Jahren hatte sie durchaus schon ihren eigenen Kopf. Das rotblonde, lockige Haar quoll unter der Haube hervor, die bei ihr nie richtig sitzen wollte. Es rahmte ein ausgesprochen hübsches Kindergesicht ein, das nur seine Anmut verlor, wenn sich Zornesfalten auf ihrer Stirn bildeten. Und das kam nicht gerade selten vor. Schon jetzt waren ihre Wutausbrüche unter der Dienerschaft gefürchtet, und nicht selten wurde sie trotz ihrer Jugend eher mit einer fauchenden Löwin als mit einem sanften Kätzchen verglichen.
Henry I. gab ein Zeichen, und aus einem der Verliese wurde der Delinquent herangeführt. Zwei kräftige Männer an jeder Seite hatten ihn fest gepackt, und ein weiterer ging voraus und hielt den Strick, mit dem er gebunden war. Trotzdem wehrte sich der Verurteilte nach Kräften und machte es seinen Henkersknechten keineswegs leicht. Allen, die es sahen, war schnell klar: Hier ergab sich einer nicht gottergeben in sein Schicksal.
Der junge Bursche zählte vielleicht gerade einmal achtzehn Jahre und war trotzdem schon ein Hüne. Genau nach solchen Soldaten hielt Hugh de Clare für die Leibwache des Königs ständig Ausschau. Sie mussten bereit sein, den Herrscher mit ihrem Leib bis zum Tode zu verteidigen, kämpfen können wie ein Rudel hungriger Wölfe und dabei die Beobachtungsgabe und Reaktionsschnelligkeit eines Luchses besitzen, um Gefahren und Angriffe rechtzeitig zu erkennen.
Genau so ein Mann war Robert Fitzooth bisher gewesen und hatte zu großen Hoffnungen Anlass gegeben. Und nun sollte ihm die Hand abgehackt, er aus der Wache verjagt und als Krüppel ins Elend gestoßen werden. Die ganze harte und umfangreiche Ausbildung der letzten Jahre wurde damit auf einen Schlag zunichtegemacht.
Was für eine Vergeudung, dachte Hugh de Clare bei sich. Hätte dieser dämliche Sergeant nicht sein Maul halten können? Es gab schließlich andere Möglichkeiten, einen aufmüpfigen Soldaten zu züchtigen. Aber er hatte sich ja wie eine Heulsuse gleich bei erster Gelegenheit beim König beschweren müssen! Irgendwann würde er sich diese Memme einmal vorknöpfen, schwor sich der Hauptmann.
Die drei Büttel hatten Robert Fitzooth die Treppe zur Richtstätte mehr hinaufgeschoben, als dass er sie gegangen wäre. Jetzt zwangen sie ihn mit brutalen Stößen auf die Knie und rissen mit dem Strick seinen Arm nach vorn, sodass die Hand auf dem Hauklotz lag. Immer noch wehrte sich der Delinquent verzweifelt, als eine helle Stimme die bedrückende Stille durchdrang.
»Was geschieht denn da mit Robert?«, erkundigte sich die kleine Prinzessin. »Tut ihm bitte nicht weh. Er hat versprochen, mir einen neuen Löwen zu schnitzen, weil dieser dumme Mann dort mein Spielzeug zerbrochen hat.«
»Wovon sprichst du eigentlich, Kind?« Henry runzelte die Stirn. »Dieser Soldat wird bestimmt nichts mehr schnitzen. Es sei denn, er ist Linkshänder. Und wen meinst du eigentlich mit dem ›dummen Mann‹?«
»Na, den Sergeanten dort, der mir meinen Löwen weggenommen hat.« Matilda zeigte auf einen der Männer nahe dem Schafott. Dann kramte sie in ihrer Gürteltasche und holte mehrere Teile eines hölzernen Löwen hervor. Sie streckte sie ihrem Vater anklagend entgegen, der sie eingehend musterte. Obwohl zerbrochen, konnte man doch erkennen, was für eine kunstvolle Arbeit es war, dem Wappentier nachempfunden, das er selbst auf der Brust trug.
Wenn man die Teile zusammenfügte, schien der Löwe dahinzuschreiten. Die Vorderpranken waren ausgestreckt und sogar die Krallen zu sehen. Die Hinterbeine hatte der Schnitzer unter den Leib gesetzt, sodass das Tier auf ihnen stehen konnte. Selbst der Schwanz war sorgsam gearbeitet und schien über dem Rücken des Löwen die Luft zu peitschen, ganz so wie auf dem Wappenrock des Königs. Allerdings fehlte das Stück mit der Quaste, und auch ansonsten war das Tier unrettbar zerstört.
»Wo hast du den denn her?«, fragte Henry, der die Arbeit fachmännisch begutachtete.
Matilda rollte mit den Augen. Begriff ihr Vater denn heute gar nichts?
»Robert hat ihn geschnitzt, wenn er bei mir Wache hielt. Das habe ich doch schon gesagt. Ist er nicht schön? Fast war er fertig, da kommt dieser Sergeant und nimmt ihn Robert weg. Jetzt ist er kaputt, und ich will einen neuen!«
»Warum hat er ihn dir denn weggenommen? Weil Robert seine Wache vernachlässigt hat?« Henry sprach mit seiner Tochter wie mit einer Erwachsenen. Das hatte er schon immer getan, und es hatte sich so manches anregende Gespräch daraus ergeben.
»Nein, sondern weil wir keine Löwen, sondern Schakale wären, hat der Sergeant gesagt«, entfuhr es der kleinen Prinzessin wutschnaubend. »Bestenfalls reißende Wölfe. Dabei sind doch unsere Wappentiere in der Normandie Leoparden und in England edle Löwen! Oder etwa nicht?«
»Das hat er wirklich gesagt?« Henry konnte es nicht fassen. Wahrscheinlich hatte der Sergeant die Auffassungsgabe des Kindes unterschätzt, sonst hätte er wohl kaum in ihrer Gegenwart solche furchtbaren Beleidigungen ausgesprochen.
»Ja«, Matilda nickte eifrig, sodass ihre Locken auf und ab wippten, »und als Robert ihm den Löwen wieder wegnehmen wollte, hat er ihn nicht hergegeben. Da haben sie miteinander gerungen, und dabei ist er zerbrochen.«
In diesem Moment setzte Trommelwirbel ein. Wenn er verstummte, würde das Henkersbeil herabsausen und den Verurteilten für alle Zeiten verstümmeln. Mit einer herrischen Handbewegung unterbrach Henry den Ablauf des Geschehens.
»Hierher zu mir, Sergeant! Auf der Stelle!«, schallte die Stimme des Königs über den Platz. Der Gerufene eilte, so schnell ihn seine Füße trugen, zu dem Podest und fiel vor seinem Herrscher auf die Knie.
»Ist das wahr? Habt Ihr uns tatsächlich ein Geschlecht von Schakalen geheißen?«, fuhr Henry den vor Angst schlotternden Mann an.
»Nei…, nein, Sire«, stotterte dieser voller Panik. »Das muss Eure Tochter falsch verstanden haben. Niemals würde ich etwas Derartiges wagen!«
»Das glaube ich dir aufs Wort, du Wicht, dass du dich das nicht trauen würdest, wäre ich in der Nähe.« Henry wusste wohl, dass seine Stellung als König von England keinesfalls gesichert war. Erst sein Vater, Wilhelm der Eroberer, von manchen auch Wilhelm der Bastard genannt, war von der Normandie aus über den Kanal gekommen und hatte das Land unterworfen. Und obwohl er sich bemühte, im Gegensatz zu diesem und seinem älteren Bruder Rufus, der vor ihm die Krone getragen hatte, gerecht zu herrschen, war ihm keineswegs jeder im Reich wohlgesinnt. Vor allem, dass seine Frau aus dem alten, angelsächsischen Königsgeschlecht stammte und er Normannen und Engländer gleichbehandelte, nahmen ihm viele übel, die hier im Land auf reiche Beute gehofft hatten.
»Bringt den Gefangenen zu mir«, wies der König die Büttel an, die sich beeilten, dem Befehl Folge zu leisten. Und so kam der Verurteilte schneller von der Richtstätte wieder hinunter als zuvor hinauf und fand sich wenige Augenblicke später zu Füßen des Königs auf den Knien neben seinem Sergeanten wieder.
»Ihr habt also meiner Tochter diesen Löwen geschnitzt? Sagt, wo habt Ihr diese Kunst erlernt?«
»Sire, solange ich zurückdenken kann, sehe ich in jedem Stück Holz etwas, das man daraus gestalten kann. Tiere, Gesichter, Figuren, was auch immer. Es ist eine Gabe, die mir in die Wiege gelegt wurde. Und auf langen, ereignislosen Nachtwachen nehmen die Dinge dann Gestalt an.«
»Er hat mir schon einen ganzen Gutshof mit Pferden, Kühen, Schafen und Schweinen geschnitzt«, bestätigte Matilda wichtig. Doch das interessierte ihren Vater im Moment weniger.
»Ihr seid doch Angelsachse, nicht wahr?«, wandte er sich erneut an den vor ihm Knienden.
»Jawohl, Sire.«
»Und Ihr Normanne?«, fuhr der König den Sergeanten an. »Wie heißt Ihr eigentlich?«
»Reginald de Bourgois, Sire. Und ja, mein Vater hat Euren Vater über den Kanal begleitet.« Weiter kam er nicht. Henry winkte nur ab und wandte sich wieder an den Soldaten.
»Dann erklärt mir doch einmal, wieso ein Angelsachse mein Wappentier schnitzt und es gegen einen Normannen verteidigt?«
Der Sergeant wollte aufbegehren, doch der König verbot ihm mit einer herrischen Geste das Wort.
»Sire, es war ein Geschenk für Eure Tochter. Und die ist wirklich manchmal eine kleine Löwin! Ich habe zwar noch nie einen Schakal gesehen, aber als Kind Wölfe. Und mit denen hat die Prinzessin nun wahrlich gar nichts gemein.«
Das kam so ohne Falsch aus dem jungen Mann heraus, dass Henry geneigt war, es ihm auf der Stelle zu glauben.
»Und wie kommt Ihr dazu, meine Tochter oder gar mich zu beleidigen und unser Wappentier zu zerbrechen?«, fuhr der König den Sergeanten an. »Ich könnte Euch auf der Stelle hängen lassen!«
»Sire, nichts lag mir ferner! Glaubt mir, ich flehe Euch an! Ich wollte den Soldaten nur ermahnen, nicht seine Zeit zu vertrödeln. Schließlich ist es seine Aufgabe, aufmerksam Wache zu halten, und nicht Spielzeug herzustellen. Als ich ihm den Löwen wegnahm, hat er mich angegriffen. Und das habe ich pflichtgemäß zur Meldung gebracht.«
»So, so, pflichtgemäß. Ihr wusstet schon, was dem Mann dann blüht?«
Der Sergeant schluckte betreten und nickte dann. Das hier entwickelte sich auf einmal ganz anders als gedacht. Fast wäre er diesen aufmüpfigen Kerl, der ihm schon lange ein Dorn im Auge war, aber unverständlicherweise die Gunst des Hauptmanns genoss, losgeworden. Und jetzt musste er sich auf einmal vor dem König rechtfertigen und wurde selbst angeklagt.
»Da wir nicht genau herausfinden können, wer die Wahrheit spricht, lassen wir doch am besten Gott entscheiden«, verkündete Henry sein Urteil. »Ihr beide werdet gegeneinander kämpfen. Und da Ihr keine Ritter seid, ohne Waffen. Wer den anderen zuerst am Boden und in einer Lage hat, aus der dieser sich nicht mehr befreien kann, hat gewonnen. Außerdem kann ich so gleich einmal sehen, wie Ihr meine Wachen ausbildet, de Clare.«
Der Hauptmann verbeugte sich leicht und gab dann seine Befehle. Robert Fitzooth wurden die Fesseln abgenommen. Er massierte sofort seine Handgelenke, in die das aufgestaute Blut langsam zurückkehrte. Die Wachen bildeten einen Halbkreis vor dem Podest, in dem der Ringkampf stattfinden sollte. Henry stellte dabei fest, dass die Sympathien der Soldaten offenbar in erster Linie dem Verurteilten galten, was ihn nicht überraschte. Seine Kameraden klopften ihm auf die Schultern und sprachen ihm Mut zu, während der Sergeant allein gelassen wurde und wenig Zuspruch erhielt.
Reginald de Bourgois war ein großer, kräftiger Mann. Robert Fitzooth überragte ihn zwar noch, war allerdings von schlanker, jugendlicher Gestalt. Gegen den kampferprobten Sergeanten, der wie festgewurzelt auf seinen stämmigen Beinen stand, waren seine Chancen sicherlich nicht gut. Die umstehenden Männer schlossen, wie es der Brauch war, sofort Wetten auf den Ausgang des Kampfes ab. Henry hätte sich am liebsten beteiligt, doch das ging natürlich nicht an. Außerdem wusste er nicht, auf wen er setzen sollte. Seine Sympathie galt seit Kurzem dem Soldaten, aber eine echte Chance hatte der wohl gegen den Bullen von Sergeanten nicht. Ganz gleich, selbst wenn der junge Mann den Kampf verlor, wollte Henry ihn begnadigen, das hatte er sich bereits fest vorgenommen. In der Wache konnte er dann natürlich nicht bleiben, doch zumindest blieb ihm die Verstümmelung erspart.
»Und auf wen setzt Ihr, de Clare?«, wandte sich der König flüsternd an seinen Hauptmann.
»Ich wette nicht, Sire. Aber ich glaube, Ihr werdet überrascht sein.«
»Nun, dann bin ich jetzt wirklich gespannt. Komm her, Matilda. Setz dich auf meine Knie. Einen Ringkampf kannst du dir schon einmal ansehen.«
Henry machte es sich in seinem Stuhl bequem, denn er rechnete mit einer längeren Auseinandersetzung. Dann gab er das erwartete Zeichen – und zwei Augenaufschläge später war der Kampf bereits vorbei.
Der Sergeant hatte breitbeinig Aufstellung genommen und erwartete, dass sein Gegner das Gleiche tat. Man würde sich langsam umkreisen, dann versuchen, sich an den Kleidern zu packen, und miteinander ringen, bis einer den anderen zu Boden werfen konnte. Wer letztendlich unterliegen würde, stand für ihn von vornherein fest, obwohl er seinen Kontrahenten keineswegs unterschätzte.
Doch Robert Fitzooth tat seinem Vorgesetzten nicht den Gefallen, nach dessen Regeln zu spielen. Als der König die Hand senkte, sprang er mit einem Satz und abgewinkeltem Oberkörper blitzschnell nach vorn und rammte dem Sergeanten seinen Kopf mit aller Macht in den Unterleib. Gleichzeitig packte er ihn mit beiden Händen an den Hüften, hob ihn empor und schmetterte ihn zu Boden. Dann hechtete er sich auf seinen um Luft ringenden Gegner, umschloss mit seinem linken Arm dessen Kehle und packte gleichzeitig den rechten Arm des unten Liegenden. Er verdrehte ihn so weit nach oben, dass seine linke Hand das rechte Handgelenk des Sergeanten greifen konnte. Der schrie gellend vor Schmerz auf und gleich darauf noch ein zweites Mal, als Robert Fitzooth ihn jetzt mit der frei gewordenen Hand an den Haaren packte und seinen Kopf nach hinten riss.
Der Kampf war vorbei, bevor er überhaupt richtig begonnen hatte. Würde Reginald de Bourgois sich in dieser Lage zur Wehr setzen, war das Geringste, was ihm passieren konnte, eine ausgerenkte Schulter. Vielleicht brach aber auch sein Genick, oder er erstickte in der Umklammerung. Wer konnte das schon sagen?
»Beim heiligen Eduard, de Clare! Wo habt Ihr den Burschen denn aufgetrieben? Das ist ja unglaublich, mit welcher Geschwindigkeit der sich bewegt! Führt er seine Waffen ebenso?«
»Hättet Ihr Schwerter befohlen, Sire, wäre der Sergeant jetzt sicherlich tot. Ich habe den Jungen eines Tages in London entdeckt, da war er noch ein Knabe. Drei viel größere und ältere Kerle hatten versucht, ihm einen Kanten Brot wegzunehmen. Das haben sie bitter bereut. Er ist Waise, seine Eltern sind bei der großen Hungersnot umgekommen. Er selbst wäre wohl entweder einmal als Dieb gehängt oder der Anführer aller Diebe geworden. Ich fand, in Eurer Wache wäre er nützlicher.«
»Da könnt Ihr durchaus recht haben, de Clare. Und ich weiß auch schon, wo er wahrscheinlich am besten aufgehoben ist«, schmunzelte der König in sich hinein.
»Lasst den Mann los, Fitzooth«, befahl er dann. »Es besteht wahrlich kein Zweifel an Gottes Willen.« Und an seine Tochter gewandt fragte er dann mit einem Lächeln in den Augen: »Was meinst du, Matilda, soll dich Robert in deine neue Heimat geleiten? Als dein persönlicher Leibwächter sozusagen?«
Da strahlte die kleine Prinzessin über das ganze Gesicht, und ihre feste, wortlose Umarmung war ihrem Vater Antwort und Dank genug.
Henry erhob sich, jetzt wieder ganz König, und tat seinen Willen kund.
»Euch, de Bourgois, scheint das ruhige Leben hier im Tower träge gemacht zu haben. Ich versetze Euch an die Grenze nach Wales, wo Ihr Euch mit den rauen Kriegern herumschlagen könnt. Und wenn es Euch dort nicht gelingt, Eure Kameraden für Euch zu gewinnen, werdet Ihr sicherlich nicht lange am Leben bleiben.«
Erstauntes Raunen begleitete die Worte des Königs, und Henry hatte den Eindruck, dass manch einer der Soldaten froh war, den ungeliebten Vorgesetzten loszuwerden.
»Eure Unschuld hingegen sehe ich als erwiesen an, Robert Fitzooth. Aber auch Ihr werdet uns verlassen. Ich vertraue Euch etwas äußerst Wertvolles an – das Leben meiner Tochter. Ihr untersteht ab sofort direkt Hugh de Clare, der sie nach Deutschland begleiten wird, und seid zukünftig Matildas persönlicher Leibwächter. Fühlt Ihr Euch dieser Aufgabe gewachsen?«
Robert Fitzooth sank auf das linke Knie und führte die rechte Hand zum Herzen.
»Sire, bei meinem Leben, ich werde Eure Tochter wie meinen Augapfel hüten!«
»Ich verlasse mich auf Euch. Doch geschieht ihr ein Leid, wird Euch nichts auf der Welt vor meinem Zorn retten, dessen seid versichert.«
Das glaubte Robert Fitzooth sofort. Dass er England verlassen musste, bedrückte ihn kaum. Matilda war ihm ans Herz gewachsen. Trotz des großen Rangunterschiedes zwischen ihnen sah er in ihr so etwas wie seine gemeinsam mit den Eltern verstorbene kleine Schwester. Wenn er sagte, er würde sein Leben für sie geben, dann war das durchaus ernst gemeint. Vor wenigen Augenblicken noch hatte Robert geglaubt, künftig als Krüppel sein weiteres Dasein fristen zu müssen. Jetzt bot ihm der König ein wahrlich unglaubliches Abenteuer an. Er würde fremde Länder sehen, sich immer in der Nähe von Matilda aufhalten, und wenn er ihr treu diente, vielleicht sogar eines Tages zum Ritter erhoben werden. Der junge Mann sah seinen weiteren Lebensweg in diesem Moment wie eine mit Rosenblättern bestreute, sonnige und schnurgerade Straße vor sich liegen.
Robert Fitzooth ahnte nicht, wie sehr er sich täuschen sollte.
1. Kapitel
Rom, 1111
Robert Fitzooth fror jämmerlich. Wenn bisher unter seinen Kameraden von Italien die Rede gewesen war, hatte es immer geheißen, dass es dort warm wäre und eher die Hitze den Menschen zu schaffen machte. Auf die eisigen Winde, die von den nahen Bergen herunterwehten, hatte die Soldaten niemand vorbereitet. Jetzt stand er sich hier, ein Stück nördlich von Rom, vor dem Zelt des Königs auf Wache seit Stunden in viel zu leichter Kleidung die Beine in den Bauch und musste alle Willenskräfte aufbieten, damit seine Zähne nicht vor Kälte aufeinanderschlugen.
Was war in diesem einen Jahr nicht alles passiert! Mehr als in seinem ganzen Leben zuvor, wollte es Robert scheinen.
Zuerst hatte er gemeinsam mit fünf Dutzend Rittern und Kriegsknechten unter dem Befehl von Hugh de Clare Matildas Fahrt über den Kanal geschützt. Hier wimmelte es nur so von Seeräubern, und auch dem französischen König, welchem an einem engen Bündnis zwischen Deutschland, der Normandie und England nicht gelegen sein konnte, war nicht zu trauen. Doch wider Erwarten erreichten sie den Hafen von Boulogne-sur-Mer an der flandrischen Küste, ohne angegriffen zu werden. Ein starkes Kontingent deutscher Ritter erwartete sie bereits, um sie auf ihrer Weiterreise nach Lüttich, wo Matilda ihren zukünftigen Gatten treffen sollte, zu geleiten.
Über Heinrich V. waren Robert die schrecklichsten Dinge zu Ohren gekommen. Der König hatte angeblich seinen eigenen Vater gefangen genommen, in den Kerker geworfen und zur Abdankung gezwungen. Umso überraschter war er dann, als er Matildas zukünftigem Gatten selbst gegenüberstand. Der nahm von Robert selbstverständlich keinerlei Notiz, sondern kümmerte sich ausschließlich um seine Braut, tat das aber auf so liebevolle Art und Weise, dass er schnell das Herz des jungen Soldaten gewann.
Heinrich war fast zwanzig Jahre älter als Matilda, was allerdings für niemanden einen Stein des Anstoßes darstellte. Seine hohe, schlanke Gestalt war in kostbare Gewänder gehüllt, ein freundliches Lächeln umspielte seine Lippen, und auf seinem blonden Haar trug er nur einen schmalen Reif als Krone. Eingerahmt von Bischof Burchard von Cambrai und Heinrich von Winchester, ihrem Erzieher, schritt die kleine Prinzessin selbstbewusst auf den deutschen König zu und wurde von ihm, trotz ihres noch kindlichen Alters, mit aller Höflichkeit und Ehrerbietung, wie es einer Dame von hohem Rang zukam, begrüßt. Robert, der in vollen Waffen in der zweiten Reihe hinter den englischen Würdenträgern stand und alles aufmerksam beobachtete, konnte nichts Falsches oder Verschlagenes in den Augen des Saliers entdecken, was ihn sehr beruhigte.
In Utrecht kam es während des Osterfestes zur feierlichen Verlobung zwischen König Heinrich V. und der englischen Prinzessin. Die Heirat sollte erst erfolgen, wenn Matilda alt genug dafür war und ihren Aufgaben als Ehefrau nachkommen konnte.
Allerdings wurde sie bereits im Sommer in einer einzigartigen Zeremonie im Dom zu Mainz zur Königin gekrönt. Robert, immer in ihrer unmittelbaren Nähe, war tief beeindruckt, wie tapfer, unerschrocken und hoheitsvoll sie auftrat. Er selbst hätte sich wahrscheinlich zu Tode gefürchtet, wäre Gleiches von ihm verlangt worden.
Ausschließlich in der Abgeschiedenheit ihrer Kemenate durfte Matilda manchmal noch Kind sein. Doch auch hier nur, wenn keine der zahlreichen Hofdamen und Priester, die sie ständig umgaben, mehr anwesend war. Dann setzte sie sich oft auf Roberts Knie, spielte mit den von ihm geschnitzten Holztieren, am liebsten Löwen, mittlerweile eine ganze Familie, und konnte das achtjährige, kleine Mädchen sein, das sie im Grunde genommen noch war.
Die Bindung zwischen ihr und ihrem Beschützer wurde zum Missfallen vieler hochgestellter Würdenträger immer enger. Einmal hatte man versucht, Robert aus ihrer Nähe zu entfernen, und zu anderen Aufgaben abkommandiert. Allerdings wurde dieser Befehl umgehend rückgängig gemacht, denn niemand hatte mit einem solchen Wutausbruch der jungen Königin gerechnet. In dieser Beziehung verstand Matilda keinen Spaß. Robert war für sie trotz zahlreicher höfischer Begleiter die letzte enge Verbindung zur alten Heimat. Und die ließ sie sich von nichts und niemandem nehmen.
Trotz allem war doch der Tag der Trennung gekommen, und diesmal halfen weder Matildas energische Proteste noch ihre Tränen. Heinrich V. hatte beschlossen, mit einem gewaltigen Heer nach Rom zu ziehen. Ein für alle Mal wollte er direkt mit dem Papst klären, wer das Recht hatte, hohe geistliche Würdenträger in ihre Ämter einzusetzen: der jeweilige weltliche Herrscher oder der Bischof von Rom.
Der Streit über die Investitur tobte seit vielen Jahren. Sein Vater war deshalb gezwungen worden, nach Canossa zu gehen und sich Papst Gregor zu unterwerfen. Später hatte er sich für diese Demütigung bitter gerächt und seinen Widersacher aus dem Amt und der Stadt Rom gejagt. Nicht nur dafür war er dann erneut exkommuniziert worden, und seine sterblichen Überreste durften nicht in geweihter Erde bestattet werden. Sie ruhten seither in einer ungeweihten Seitenkapelle des Doms zu Speyer, und Heinrich hatte sich geschworen, auch diese Schmach mit seinem Zug gegen Rom zu tilgen.
Die meiste Zeit seines Lebens hatte sein Vater mit den Großen des Reiches im Streit gelegen. Auch Heinrich traute den Fürsten und Bischöfen nur bedingt, obwohl die letzten Jahre recht friedlich verlaufen waren. Das konnte sich allerdings schnell ändern, zog er gegen Rom, um den hohen Klerus seiner Macht zu berauben und sich zum Kaiser krönen zu lassen. Wagte im Moment vielleicht auch niemand einen offenen Aufstand, so war er doch nicht vor einem heimtückischen Überfall oder Meuchelmord gefeit. Deshalb hatte er den Plan gefasst, seine deutsche Leibwache gegen die englische seiner Verlobten auszutauschen. Von den Fremden verstanden nur die wenigsten ein paar Brocken der deutschen Sprache und kannten kaum die Verhältnisse im Land. Das machte sie weniger empfänglich für Bestechungen und Einflüsterungen und bot Heinrich somit den größtmöglichen Schutz.
Robert wurde von dem Befehl des Königs ebenso überrascht wie de Clare, nur dass Letzterer sich rasch in das Unvermeidliche fügte. Robert hingegen weigerte sich strikt, Matilda zu verlassen, und wurde in seinem Entschluss von dieser nach Kräften bestärkt. Doch es half alles nichts. Der Hauptmann erklärte seinem Untergebenen, es gäbe für ihn zwei Möglichkeiten, die Alpen zu überqueren – zu Fuß oder zu Fuß und in Ketten. Ihm selbst hatte man ja auch keine Wahl gelassen. Und so verabschiedete sich der junge Soldat von seiner kleinen Prinzessin, die nun eine Königin war, als wäre er der Ritter ihres Herzens. Robert bekam zum Abschied von ihr sogar ein rot-goldenes Band geschenkt, das er an seiner Lanze tragen sollte. Noch eine ganze Weile glaubte er auf dem Marsch nach Süden ihre tränenfeuchte Wange an der seinen zu spüren.
Am nächsten Morgen, jetzt wieder ganz junge Königin, winkte sie von einem Söller des Königspalastes ihrem Verlobten und dem abziehenden Heer hinterher. Für die Zeit von Heinrichs Abwesenheit wurde sie der Obhut des Erzbischofs von Trier übergeben, der ihre weitere Ausbildung übernehmen und sie in der deutschen Sprache unterrichten sollte.
Der Weg über die himmelhohen Berge, Alpen genannt, die das Deutsche Reich von Italien trennten, war das Anstrengendste, das Robert bisher erlebt hatte. Endlos wand sich der Heerwurm durch schmale Täler dahin, um dann in engen Serpentinen zum großen Sankt-Bernhard-Pass aufzusteigen. Wenn dieser Pass wirklich der bequemste Alpenübergang war, legte er keinen gesteigerten Wert darauf, die anderen kennenzulernen.
Die liebliche Landschaft südlich der Alpen und die reichen italienischen Städte beeindruckten Robert sehr. Über Piacenza und Florenz, wo sie das Weihnachtsfest gefeiert hatten, waren sie nach Sutri gelangt. Die Stadt lag nur noch einen reichlichen Tagesmarsch nördlich von Rom und beherrschte in strategisch günstiger Position an der Via Francigena gelegen den Zugang nach Mittelitalien.
Und hier trafen sie das erste Mal auf Abgesandte von Papst Paschalis. Nie hätte sich der junge Soldat noch vor einem Jahr träumen lassen, einmal bei einer solchen Begegnung anwesend zu sein.
Das Eintreffen der Delegation schreckte Robert aus seinen Gedanken und lenkte ihn zumindest für den Moment von der bitteren Kälte ab, die nach seinen Gliedern gegriffen hatte. Da ihm mittlerweile die seiner Muttersprache gar nicht so unähnliche deutsche Sprache geläufig war, verstand er so gut wie jedes Wort, das zur Begrüßung gewechselt wurde.
Der König beeilte sich keineswegs, die Vertreter des Heiligen Vaters zu empfangen. Im Gegenteil, es schien Robert fast so, als ließe er die Ankömmlinge absichtlich auf ihren Reittieren in den rauen, von den Bergen des Apennins herabwehenden Winden warten.
Die Abordnung wurde von einem Kardinalbischof angeführt, der ein prächtig herausgeputztes Maultier ritt. Sein scharlachroter Mantel und der große, runde Hut waren von Schneekristallen bedeckt, die mit den Edelsteinen seiner Ringe, der juwelengeschmückten Kette, an der ein goldenes Kruzifix hing, und der kostbaren Mantelspange um die Wette glitzerten. Noch nie hatte der junge Soldat so viel Schmuck an einem einzigen Mann gesehen. Nicht einmal an den zwei Königen, die er kannte.
Endlich wurde von einem Diener der Türvorhang zurückgeschlagen, und Heinrich, in Kettenhemd und pelzverbrämtem Mantel, trat vor das Zelt.
»Seid willkommen, Kuno von Praeneste«, begrüßte der König den Kardinal und nickte freundlich – oder war es eher spöttisch? – auch dessen Gefolge zu. »Sitzt ab und seid meine Gäste. Wärmt Euch an meinem Feuer, während Ihr mir Eure Botschaft überbringt. «
Hörte Robert da einen leicht sarkastischen Unterton in der Stimme des Königs heraus? Auch wenn er im offiziellen Hofzeremoniell nicht übermäßig bewandert war, wusste er doch, dass man einen Abgesandten des Papstes normalerweise anders empfing. Kein Titel, kein »Eure Eminenz«, sondern nur die Nennung eines Namens stellte gegenüber einem hochrangigen kirchlichen Würdenträger einen beachtlichen Affront dar. Spätestens als Kuno von Praeneste recht mühsam aus dem Sattel glitt und Heinrich seinen Ring zum Kuss hinhielt, was von diesem geflissentlich ignoriert wurde, war jedem der Anwesenden klar, dass der König auf Konfrontation aus war.
Der Kardinal lief so rot an wie die Kleidung, die er trug, und sein Gesicht war von dieser kaum noch zu unterscheiden. Was bildete sich dieser deutsche Jungspund eigentlich ein? Ihm, dem Vertreter des Heiligen Vaters, nicht mit dem gebührenden Respekt entgegenzutreten, ihn wie einen seiner Gefolgsleute, noch dazu einen unbotmäßigen, zu behandeln! Nun, er würde ihn schon in die Schranken weisen. Hatte dieser König vergessen, über welche Macht die heilige Mutter Kirche verfügte? Sein Vater hatte drei Tage lang vor der Burg von Canossa als Büßer und Bittsteller um die Gnade von Papst Gregor und die Lossprechung vom Kirchenbann gefleht! Die Exkommunikation konnte auch diesen König ganz schnell treffen. Ihm das klarzumachen, sah der Kardinal als seine vordringliche Aufgabe an.
Doch Heinrich hatte nicht die Absicht, die Fehler seines Vaters zu wiederholen und sich vor den Vertretern der Kirche zu demütigen. Es war ihm in den Jahren seiner Herrschaft gelungen, die Fürsten seines Reiches hinter sich zu versammeln und auf seine Seite zu ziehen. Seinem Vater war das nie so recht geglückt, und dadurch war er angreifbar gewesen. Jetzt war er, Heinrich V., in Erbfolge von den Großen des Reiches gewählter deutscher König, hier, um gegenüber dem Pontifex Maximus Forderungen zu stellen, die diesem und seiner Kurie mit Sicherheit ganz und gar nicht gefallen würden. War Heinrich IV. damals mit kleinem Gefolge nach Canossa gekommen, um sich zu unterwerfen, so rückte er mit einem Heer an, wie es Italien seit den Zeiten der Cäsaren nicht mehr gesehen hatte. Und diese Macht wollte er nutzen, das hatte er sich am Grabe seines noch immer in ungeweihter Erde ruhenden Vaters geschworen.
»Ich hatte damit gerechnet, dass mich eine Abordnung des Heiligen Vaters spätestens nach meiner Alpenüberquerung begrüßt«, begann Heinrich das Gespräch, nachdem man das Zelt betreten hatte, ohne seinen Gästen einen Platz anzubieten. Er selbst ließ sich, umringt von seinen Grafen, Herzögen und den wenigen zu seinem Gefolge gehörenden Klerikern, auf einem Feldstuhl nieder. Der König wollte gleich von Anfang an klarstellen, wer hier das Sagen hatte.
»Wenn Eure Majestät Boten geschickt und seine Absicht erklärt hätte, wäre das sicher auch geschehen.« So schnell ließ sich Kuno von Praeneste, der einmal Kaplan und Beichtvater von Wilhelm dem Eroberer und später päpstlicher Legat am Hofe des französischen Königs Ludwig VI. gewesen war, nicht einschüchtern.
»Ich habe Papst Paschalis mehrfach eingeladen, mein Gast zu sein und den leidigen Streit um die Investitur der Bischöfe und Äbte beizulegen. Er hätte auf dem Hoftag zu Mainz vor fünf Jahren zu allen Großen des Reiches sprechen können. Doch bis heute hat er es ja vorgezogen, meinen Einladungen nicht Folge zu leisten. So habe ich mich eben auf den beschwerlichen Weg gemacht, um ihm die Anstrengung zu ersparen. Außerdem, wenn ich Euch daran erinnern darf, steht auch meine Kaiserkrönung noch aus. Ich glaube, beides ist dem Heiligen Vater durchaus bewusst. Er kann über mein Kommen also kaum überrascht sein.«
Dem Kardinalbischof wurde der Mund trocken. Diese bodenlose Unverfrorenheit! Was dachte dieser Barbarenkönig eigentlich, wer er war? Die heilige Mutter Kirche hatte noch jeden, der ihr widerstehen wollte, Demut gelehrt. Die ewige Verdammnis würde ihn ereilen, wenn er sich nicht besann und als gehorsamer Sohn erflehte, was er begehrte.
Völlig ausgeschlossen war natürlich, dass man einem weltlichen Herrscher gestattete, die Bischöfe und Äbte nach Gutdünken in seinen Landen einzusetzen, wie es früher – zugegeben – durchaus üblich gewesen war. Aber da vertrat die Kirche seit Papst Gregor VII. einen ganz klaren Standpunkt: Sie, und nur sie, bestimmte darüber, wer Bistümern, Abteien und Klöstern vorstand. Daran würde, so Gott wollte, und daran zweifelte Kuno keinen Augenblick, auch dieser deutsche König nichts ändern. Und auf seine Krönung zum Kaiser konnte er, wenn es nach dem Kardinal ginge, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten. Eher würde ihn der Bannfluch treffen, dafür wollte er schon sorgen. Vorerst musste er sich aber diplomatisch geben, wollte er seine Mission nicht gefährden. Schließlich sollte Kuno im Auftrag des Papstes den König zur Umkehr bewegen, auch wenn er nicht viel Hoffnung hatte, das zu erreichen. Zu herrisch war das Auftreten Heinrichs und zu mächtig sein Heer.
»Die Synoden von Guastalla und Châlons-sur-Marne haben leider keine Einigung gebracht«, erklärte der Kardinal säuerlich. »Es wäre sicherlich anzuraten, noch einmal ein Konzil einzuberufen, um den unseligen Streit endgültig beizulegen. Der Heilige Vater wird kaum etwas dagegen haben, wenn Eure Majestät den Ort bestimmt, solange er diesseits der Alpen liegt.«
Heinrich wischte die Worte mit einer Handbewegung beiseite. Allein die Verhandlungen darüber konnten sich über Monate, wenn nicht Jahre hinziehen. Nein, er war nach Italien gekommen, um endlich Nägel mit Köpfen zu machen. Bis seine Forderungen erfüllt waren, würde er mit seinen Truppen nicht wieder abziehen. Komme, was da wolle.
»Ich bin hier, um das mit ihm persönlich zu besprechen. Richtet dem Heiligen Vater aus, dass ich in zwei Tagen in Rom einziehen werde. Besser, die Tore stehen dann weit offen.«
Das war eine offene und unverhohlene Drohung, die Heinrich da aussprach. Der Ewigen Stadt und dem Papst näherte man sich als Pilger, als bußfertiger Sünder – ein König vielleicht als demütiger Sohn –, aber nicht als Kriegsherr mit einem gewaltigen Heer. Der Kardinal hatte gehofft, dass auch der Deutsche davor zurückschrecken würde, doch das war ganz offensichtlich nicht der Fall. Sollte er ihm vielleicht gleich hier und heute mit dem Bannstrahl der heiligen Mutter Kirche drohen? Lieber nicht. Das konnte der Papst mit der Autorität des Oberhauptes der Christenheit hinter sich weit besser, falls man zu keiner Einigung kam.
Wichtig war jetzt vor allem, ihn von dem Gespräch zu unterrichten, damit der Heilige Vater informiert war, was auf ihn zukam, und Vorkehrungen treffen konnte. Kuno wusste auch schon, was er ihm raten würde. Diese Nachrichten mussten Paschalis so schnell wie möglich erreichen. Deshalb hatte der Kardinal es plötzlich sehr eilig, sich von seinem Gastgeber, der ihm und seinem Gefolge ja nicht einmal einen Stuhl, geschweige denn Speis und Trank angeboten hatte, zu verabschieden.
Vor dem Zelt winkte Kuno von Praeneste einen Untergebenen zu sich und flüsterte ihm etwas in einer Sprache zu, von der er annahm, dass keiner der Deutschen sie verstand. Laut befahl er ihm dann, mit einem schnellen Pferd vorauszureiten und die Kunde von der Ankunft des Königs nach Rom zu bringen, auf dass Heinrich von der Bevölkerung mit Jubel und Freude empfangen würde. Der Kardinal wollte, wie es seinem hohen geistlichen Amt zukam, langsam folgen und Papst Paschalis selbst die frohe Kunde überbringen.
Robert trat von einem Fuß auf den anderen. Nicht vor Kälte, sondern weil er seinem Hauptmann eine wichtige Meldung zu machen hatte, der sich allerdings nirgends sehen ließ. Es war zum Verzweifeln! Von seinem Posten durfte er sich als eingeteilte Wache nicht entfernen, aber was er zu sagen hatte, erschien ihm äußert wichtig. Eine Weile rang er mit sich und wusste nicht so recht, was er tun sollte. Doch dann erschien ihm die Strafe, die ihm für das Verlassen des Postens drohte, weniger schwerwiegend gegenüber dem, was sie alle erwartete, überbrachte er nicht rechtzeitig, was er gehört hatte. Robert rief seinen ebenfalls zum Wachdienst eingeteilten Kameraden zu, dass er den Hauptmann suchen müsse, und bevor ihn jemand zurückhalten konnte, lief er auch schon los.
Nach längerem Suchen fand er Hugh de Clare im Gespräch mit mehreren Edelleuten und Rittern, die den Besuch des päpstlichen Abgesandten und ihr weiteres Vorgehen diskutierten. Robert versuchte, seinem Vorgesetzten Zeichen zu geben, doch es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis dieser von ihm Notiz nahm. Offenbar hatte der Soldat etwas Wichtiges auf dem Herzen und Hugh de Clare immer ein offenes Ohr für die Sorgen seiner Untergebenen.
»Habt Ihr nicht Wache beim Zelt des Königs?«, fragte der Hauptmann ganz verblüfft, als ihm aufging, dass Robert Fitzooth gar nicht hier sein durfte.
»Mylord, ich habe eine wichtige Meldung zu machen, die keinen Aufschub duldet. Vielleicht ist es sogar schon zu spät.«
»Ihr wollt mir jetzt nicht sagen, dass Ihr Euren Posten verlassen habt, oder? Kerl, das kann Euch den Kopf kosten!«
»Hört mich doch nur einen Moment lang an! Die Römer werden die Tore vor uns verschließen und die Stadt in Verteidigungsbereitschaft versetzen. Das soll uns so lange aufhalten, bis die Normannen aus Apulien anrücken. Herzog Roger ist dem Papst lehnspflichtig und zur Waffenhilfe verpflichtet.«
»Woher wisst Ihr das?« Hugh de Clare war nahezu sprachlos.
»Der Kardinal hat es zu einem Boten gesagt. Leise, aber doch so, dass ich es hören konnte. Er dachte wohl, niemand versteht hier diese Sprache.«
»Welche Sprache, Mann! Erklärt Euch deutlicher.«
»Normannisches Französisch. Er scheint nicht bemerkt zu haben, dass die Leibwache des Königs aus Engländern besteht.«
»Robert, wenn das wahr ist, müssen wir auf der Stelle handeln, sonst kommt es zu einer furchtbaren Schlacht. Nehmt Euch ein paar Männer und die schnellsten Pferde und verfolgt den Boten. Bringt ihn her, tot oder lebendig, ganz gleich. Ich gehe zum König. Wahrscheinlich wird er auch dem Kardinal Verfolger hinterherschicken. Doch das ist allein seine Entscheidung. Und jetzt sputet Euch, sonst kann alles verloren sein.«
Der junge Soldat rief schnell fünf seiner Kameraden zusammen, und wenige Augenblicke später jagten sie aus dem Lager. Robert selbst nahm sich das Pferd des Hauptmanns. Schließlich hatte dieser ja gesagt, sie sollten die schnellsten auswählen.
Der Bote, den Kuno von Praeneste vorausgeschickt hatte, sah keinen Grund zu großer Eile. Das Pferd, das er ritt, war sein eigenes, und auf keinen Fall sollte es durch übermäßige Hast Schaden nehmen. Die Straße stammte noch aus der Zeit des Kaisers Augustus und war in entsprechend schlechtem Zustand. Trotzdem machte er keine Pause, denn offen dem Befehl des Kardinals zuwiderhandeln, das wagte er nun doch nicht. In der Ferne sah er bereits die gewaltigen Mauern Roms, als er den Hufschlag galoppierender Pferde hinter sich vernahm. Ein Blick über die Schulter zurück genügte, um ihn zu der Erkenntnis zu bringen, dass er sich wohl besser mehr beeilt hätte. Jetzt gab der Bote seinem Pferd die Sporen, und da er es bisher ja nicht übermäßig angestrengt hatte, flog es wie ein von der Bogensehne schnellender Pfeil dahin.
Von den Verfolgern war nur Roberts Pferd in der Lage, dieses Tempo mitzuhalten. Es gelang ihm sogar, nach und nach den Vorsprung zu verkürzen, aber bedrohlich näherten sich die Mauern der Stadt. Wenn der Bote sie erreichte, war er in Sicherheit. Von allen Seiten her strömten Händler, Bauern und Handwerker mit Karren oder auch nur Kiepen auf dem Rücken auf eines der Stadttore zu und schickten den Reitern, die, ohne Rücksicht zu nehmen, durch ihre Reihen preschten, wüste Flüche hinterher.
Endlich war Robert mit dem Boten gleichauf. Er beugte sich hinüber, um ihn zu packen, da durchfuhr ihn ein brennender Schmerz. Der Vertraute des Kardinals hatte keinesfalls die Absicht, sich widerstandslos gefangen nehmen zu lassen. Er bückte sich unter dem Arm des Angreifers hinweg und stieß mit einem langen Dolch zu.
Dass Robert von links angriff und der Stich in seine Richtung nicht mit voller Wucht geführt werden konnte, rettete ihm das Leben. Die Klinge glitt am Kettenhemd ab, rutschte nach oben und fuhr in seine nur durch das Gambeson geschützte rechte Achselhöhle. Glücklicherweise hatte der Stoß bereits an Kraft verloren und ging knapp an der Schlagader vorbei. Trotzdem spürte der junge Soldat, wie sein warmes Blut an der Seite herabrann. Auf eine lange Auseinandersetzung konnte er es jetzt nicht mehr ankommen lassen. So warf er sich hinüber, riskierte den eigenen Sturz, riss aber dabei den Boten vom Pferd. Gemeinsam ineinander verkrallt, stürzten sie zu Boden. Robert war leicht im Vorteil, da er auf seinem Gegner landete, der zumindest für einen Moment benommen war. Schnell schnitt er die Kordel des Umhangs ab, den der Mann trug, und band ihm damit die Hände auf den Rücken, bevor dieser sich ernsthaft wehren konnte.
Erst als Robert sich aufrichtete, bemerkte er, dass er von aufgebrachten Männern und Frauen umringt war, die in einer ihm unbekannten Sprache von allen Seiten auf ihn einredeten. Viele hatten die Fäuste geballt, hielten Knüppel in den Händen, und auch wenn er die Menschen nicht verstand, war ihre Absicht doch eindeutig. Sie wollten seinen Gefangenen, der immerhin das Wappen eines der angesehensten Kardinäle Roms auf der Brust trug, befreien und keinesfalls dulden, dass er von einem Fremden verschleppt wurde.
Robert wusste sich nicht anders zu helfen, als sein Schwert zu ziehen und es mit einer schnellen Bewegung einmal um sich kreisen zu lassen. Erschrocken zog sich die Menge zurück, aber es war klar, dass er allein nicht gegen die Menge bestehen konnte. Jetzt begann auch noch der Gefangene zu den Umstehenden zu reden, was Robert auf keinen Fall dulden konnte. Wenn er ihnen seine Botschaft übermittelte, konnte sie sehr schnell zum Befehlshaber der Garnison oder gar zu Papst Paschalis selbst gelangen.
Der junge Soldat tat es nicht gern, aber der Befehl seines Hauptmanns war eindeutig. Mit dem Fuß stieß er den Gefangenen zu Boden, sodass dieser mit dem Gesicht im Dreck lag und keinen Ton mehr von sich geben konnte. Als Robert jetzt auch noch sah, wie von dem Wachturm an der nahen Tiberbrücke – der berühmten Ponte Milvio, wie er später erfuhr – ein paar Soldaten angelaufen kamen, setzte er widerstrebend die Schwertspitze in den Nacken des Boten, bereit, ihn zu töten.
Glücklicherweise war das aber nicht nötig, denn in diesem Moment sprengten seine fünf Kameraden auf ihren großen Streitrossen zwischen die Menge, die sich schleunigst zerstreute, und auch die Brückenwachen zogen sich vor der plötzlichen Übermacht der gefährlich aussehenden Reiter zurück.
Es gelang Robert mithilfe seiner Gefährten, den Gefangenen auf sein Pferd zu hieven. Erst dann kümmerte er sich um seine Verletzung und stopfte Stoffstreifen zwischen seine Achselhöhle und das Kettenhemd, um die Blutung zu stillen. Bis zum Lager musste das ausreichen, dort konnte sich ein Feldscher die Wunde ansehen.
Da die Pferde erschöpft waren, schafften sie es nicht, am gleichen Tag noch zurückzukehren. Es gab unterwegs etliche Herbergen, aber Robert setzte durch, dass im Freien genächtigt wurde. Er befürchtete in einer Schenke einen erneuten Versuch, den Gefangenen zu befreien. Obwohl er im Rang nicht über ihnen stand, akzeptierten seine Kameraden seine Entscheidung ohne großes Murren. Sie vertrauten ihm, als wäre er ihr gottgegebener Anführer.
Als sie am nächsten Tag das Lager bei Sutri erreichten, wurden sie bereits von Hugh de Clare erwartet. Robert fiel auf, dass das Maultier des Kardinalbischofs bei den Pferden des Königs stand. Offenbar hatte Heinrich den Vertrauten des Papstes auch nicht weit kommen lassen.
Der Hauptmann, der die Verwundung seines Untergebenen bemerkte, schickte ihn sofort zu seinem eigenen Wundarzt und befahl ihn erst danach zur Berichterstattung in sein Zelt. Der Feldscher vernähte die Wunde mit dem Darm junger Katzen, versicherte Robert noch einmal, dass er großes Glück gehabt hatte, und gab ihm auf, den Arm mehrere Tage ruhig zu halten und gegen den Blutverlust roten Wein zu trinken. Zumindest Letzteres würde Robert nicht weiter schwerfallen.
Im Zelt des Hauptmannes nötigte ihn dieser, Platz zu nehmen, und bot ihm einen Becher der verordneten Medizin an.
»Der König ist Euch überaus dankbar«, meinte er dann, als Robert seinen Bericht beendet hatte. »Er hat sich wieder einmal zu seiner Idee einer normannischen Leibwache beglückwünscht.«
»Ich bin kein Normanne!«, verwahrte sich der junge Soldat entschieden.
»Nein?« Hugh de Clare zeigte sich überrascht, hatte er doch bisher immer angenommen, dass die Eltern von Robert wie seine Familie mit Wilhelm dem Eroberer über den Kanal gekommen waren.
»Aber Ihr tragt einen normannischen Namen«, bohrte er nach.
»Ich heiße Hrodberht, Sohn des Odo. Meine Eltern waren Angelsachsen. Sie sind, wie Ihr wisst, in der großen Hungersnot umgekommen, die Euer Herzog, der sich dann später die englische Königskrone genommen hat, mit seinen Kriegen über das Land brachte. Mönche von Saint Mary in Nottingham fanden mich und bewahrten mich vor dem gleichen Schicksal. Sie kamen aus Frankreich und haben meinen Namen, den sie kaum über die Lippen brachten, in Robert Fitzooth geändert. So würde er in Eurer Sprache heißen, sagte man mir.«
Robert sprach selbstbewusst und völlig offen. Das kannte Hugh de Clare von seinen Soldaten sonst anders. Immer mehr begann er, sich für das Schicksal des jungen Mannes zu interessieren.
»Wie seid Ihr dann nach London gekommen, wo ich Euch getroffen habe?«
»Ich ertrage keine Mauern und geschlossenen Tore um mich herum. Meine Eltern waren Freibauern und ich in meiner Kindheit immer gemeinsam mit ihnen auf den Feldern oder im Wald. Im Kloster bestand das Leben nur aus Beten, Fasten und Lernen. Das habe ich nicht ausgehalten und bin ausgerissen. Hätte man mich aufgegriffen, wäre ich aufgehängt oder bestenfalls Leibeigener geworden. Nur die große Stadt bot mir die Möglichkeit, in ihr unterzutauchen und zu überleben.«
»Und das habt Ihr damals als Kind schon gewusst?«, meinte de Clare nachdenklich.
»Nein, aber der Pförtner von Saint Mary, ein alter Soldat, war mein Freund. Er hat mich auch in einer dunklen Nacht aus dem Kloster gelassen, mir etwas Wegzehrung und diesen Rat gegeben.«
›Aha‹, dachte der Hauptman, ›deshalb hast du dich nicht gesträubt und bist mir widerspruchslos gefolgt, als ich dich aufgelesen habe. Der Alte wird dir vom Soldatenleben vorgeschwärmt haben, denn mit vielen Jahren Abstand gesehen, verliert es seine Schrecken. Nur die angenehmen Erinnerungen bleiben im Gedächtnis, auch wenn es vielleicht nicht viele sind.‹
»Wisst Ihr eigentlich, an welcher geschichtsträchtigen Stelle Ihr den Boten gefangen genommen habt?«, erkundigte sich de Clare schmunzelnd bei seinem Untergebenen, der nur verneinend den Kopf schüttelte.
»Nun, an dieser Brücke siegte erstmals ein Kaiser im Zeichen des Kreuzes über seinen Widersacher. Konstantin, so sagt man, zögerte, die Schlacht gegen seinen Mitkaiser Maxentius zu schlagen. Da erschien ihm am Himmel ein leuchtendes Kreuz, und Jesus selbst soll im Traum zu ihm die Worte gesprochen haben: ›In diesem Zeichen siege.‹ Konstantin ließ das Kreuzzeichen auf die Schilde seiner Soldaten malen und warf sich mit ihnen der Übermacht entgegen. Er feierte einen grandiosen Sieg an der Milvischen Brücke, Maxentius ertrank im Tiber, und das Christentum verdrängte nach und nach die alten römischen Götter und wurde Staatsreligion. Wäre es anders ausgegangen, würde man hier heute vielleicht noch Jupiter, Apollo und Venus anbeten.«
Das waren blasphemische Worte, doch de Clares Vorfahren, die Wikinger, hatten noch vor hundert Jahren an Odin, Thor und weitere Götter sowie ein Leben nach dem Tod in Walhalla geglaubt. Erst als der französische König Karl ihren Anführer Rollo als Ausgleich für die Schonung von Paris mit der Normandie belehnte und zum Herzog erhob, wurden die wilden Nordmänner sesshaft und traten nach und nach zum Christentum über. Doch die alte Religion war in vielen von ihnen noch tief verwurzelt, und nicht jeder von ihnen nahm bis heute ohne Einschränkung den Priestern der heiligen Mutter Kirche ab, was sie ihm erzählten.
»Dieser Kaiser Konstantin soll aus Dank für den Sieg im Zeichen des Kreuzes und dafür, dass ihn angeblich der damalige Papst Silvester vom Aussatz geheilt hat, der Kirche das gesamte Weströmische Reich übereignet haben. Seither begründet sie mit dieser Urkunde, deren Rechtmäßigkeit äußerst zweifelhaft ist, ihren Herrschaftsanspruch auch über Könige und Kaiser. Und Heinrich ist nicht zuletzt hier, um dem Heiligen Vater klarzumachen, dass er sich ihm nicht zu unterwerfen gedenkt.«
Robert hatte aufmerksam zugehört, aber nur einen Teil von dem verstanden, was de Clare ihm zu erklären versuchte. Der Streit zwischen König und Papst interessierte ihn wie die meisten einfachen Menschen nur am Rande. Viel mehr beschäftigte ihn etwas anderes.
»Mylord, gestattet Ihr, dass ich Euch eine Frage stelle?«
»Nur zu.«
»Der Kardinal befahl seinem Boten, dem Papst zu raten, die Normannen zur Unterstützung zu holen. Woher sollen die so schnell kommen? Über das Meer?«
»Nein, Robert. Meine Landsleute haben nicht nur den Norden Frankreichs und England erobert, sondern auch die Byzantiner aus dem Süden Italiens und die Mauren aus Sizilien verdrängt. Herzog Roger Borsa beherrscht Apulien und Kalabrien und ist ein enger Verbündeter des Pontifex Maximus. Kommt er Paschalis zu Hilfe, kann es brenzlig werden. Ihr Engländer wisst, wie wir Normannen kämpfen können.«
Oh ja, darüber wurden viele Lieder gesungen, konnte Robert nur bestätigen. In der Schlacht von Hastings waren seine Vorfahren furchtbar geschlagen worden. Auch spätere Aufstände hatten nie zu einem Erfolg gegen dieses kriegerische Volk geführt. Wilhelm der Eroberer und sein Sohn Rufus hatten die Angelsachsen grausam unterdrückt und einen regelrechten Vernichtungsfeldzug mit Schwert, Feuer und Hunger gegen sie geführt. Doch unter König Henry, Matildas Vater, hatten sich die Verhältnisse deutlich gebessert. Sicherlich war niemandem daran gelegen, den gefürchteten Nordmännern in einer offenen Schlacht gegenüberzutreten, von der niemand vorher sagen konnte, wie sie ausgehen würde.
»Und noch eins, Robert. Der König hat mich beauftragt, Euch diesen Beutel zu übergeben. Er belohnt treue Dienste gern und reichlich. Aber wenn ich Euch einen guten Rat geben darf, versauft nicht das ganze Silber oder verliert es beim Würfelspiel.«
»Nein, Mylord, sicher nicht. Irgendwann einmal, sollte mein Sold je dafür reichen, will ich mir eine Freisass kaufen und als freier Bauer leben. So wie es mein Vater und dessen Vater getan haben.«
Hugh de Clare stand auf und klopfte dem jungen Soldaten auf die Schulter.
»So ist’s recht. Schont Euren Arm, und wenn die Wunde sich entzünden sollte, scheut Euch nicht, noch einmal den Feldscher aufzusuchen. Für die nächsten Tage seid Ihr vom Wachdienst befreit. Aber wenn wir in Rom einziehen, will ich Euch an der Seite des Königs wissen.«
Robert Fitzooth verneigte sich und verließ das Zelt. Sein Hauptmann schaute ihm noch eine Weile nachdenklich hinterher und seufzte dann tief. Seine Frau war bei der Geburt ihres Kindes gestorben, und auch der kleine Kerl, den sie zur Welt gebracht hatte, nach wenigen Tagen verschieden. Er wäre heute in etwa so alt wie der junge Mann, der ihn soeben verlassen hatte.
Der Kardinalbischof war schon kurz hinter dem Lager von Heinrichs Truppen eingeholt und in aller Höflichkeit, aber auch Bestimmtheit nach Sutri zurückgeleitet worden. Jetzt saß er hier fest und arbeitete sehr zu seinem Unwillen mit dem Kaplan des Königs an einem Vertrag, der den Investiturstreit zwischen der Kirche und den weltlichen Herrschern, zumindest in deutschen Landen, beenden sollte. Nie und nimmer würde Paschalis dieses Machwerk, das unter Zwang zustande kam, unterzeichnen, dessen war er sich sicher. Doch dann kam der Heilige Vater auf Einladung Heinrichs und unter Zusicherung freien Geleites selbst von Rom nach Sutri und traf eine noch viel weiter gehende Vereinbarung mit dem König.
Der Streit zwischen Heinrich und Paschalis wogte bereits eine ganze Zeit hin und her, und ihre jeweiligen Berater waren mittlerweile in die Auseinandersetzung gar nicht mehr eingebunden.
»Ihr könnt nicht von mir verlangen, dass mehr als die Hälfte meines Reiches von Männern verwaltet und beherrscht wird, die Euch mehr verpflichtet sind als mir«, brüllte der König und hieb mit der Faust auf den kleinen Tisch, auf dem der mühsam ausgehandelte Vertragsentwurf lag, der soeben wieder zunichtegemacht wurde.
»Ihr maßt Euch an, Bischöfe mit dem Krummstab des Hirten und dem Ring des Fischers einzusetzen«, donnerte Paschalis nicht weniger laut zurück. »Auch Ihr werdet die Oberhoheit der heiligen Mutter Kirche, das Subprimat des Papsttums über das der weltlichen Herrscher anerkennen müssen!«
»Könige und Kaiser sind durch die Erbfolge direkt von Gott eingesetzt. Ihr hingegen werdet von Menschen gewählt und in dieses Amt berufen. Und die entscheiden nicht immer weise. Wer steht da wohl über wem?«
»Ihr könntet ohne den Segen und die Salbung mit dem heiligen Öl gar nicht herrschen, sondern werdet erst dadurch zu einem christlichen König. Mäßigt Euch, sonst ergeht es Euch letztendlich wie Eurem Vater.«
Zwischen die rot angelaufenen Gesichter der beiden Männer passte kaum noch ein Blatt Pergament, so dicht standen sie voreinander.
»Ihr solltet mir lieber nicht drohen! Schon gar nicht mit Exkommunikation und Kirchenbann. Sonst führt Ihr mich in Versuchung, aus Euch einen Märtyrer zu machen. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein König einen Papst absetzt und zur Hölle schickt. Seht Euch doch an, was aus Eurer Kirche geworden ist! Priester, die sich neben ihren Frauen noch ein halbes Dutzend Konkubinen halten, Bischöfe, die ihre Bistümer an ihre Kinder vererben, Klöster, in denen es wie in Sodom und Gomorrha zugeht. Ihr selbst habt Euch bei Eurer Inthronisation sogar krönen lassen! Wollt Ihr vielleicht Papst, König und Kaiser in einer Person sein?«
»Gott hat seine Stellvertreter auf Erden über alle anderen Herrscher gesetzt. Damit Ihr und Euresgleichen das endlich begreifen, habe ich aus der Tiara eine Krone machen lassen. Die Freiheit der Kirche, die libertas ecclesiae, steht über allem. Papst Gregor hat schon Eurem Vater erklärt, dass die heilige Mutter Kirche frei von Einmischung durch Laien sein muss, ihre Bischöfe und Priester selbst in ihre Ämter einsetzt, unter alleiniger Leitung des jeweiligen Heiligen Vaters steht und dieser die höchste Gewalt in der gesamten Christenheit besitzt.«
»Höchste Gewalt, dass ich nicht lache! Und was hat Gregor seine Machtlüsternheit und die Demütigung meines Vaters vor Canossa eingebracht? Er wurde abgesetzt, aus Rom vertrieben und starb einsam im Exil.«
»Aber er sitzt heute zur Rechten Gottes, während Euer Vater noch immer exkommuniziert ist und nicht in geweihter Erde bestattet werden darf! Hört Ihr seine Seele manchmal in Euren Träumen seufzen?«
Um ein Haar hätte Heinrich Paschalis an der Kehle gepackt und erwürgt.
»Um das zu ändern, bin ich unter anderem hier. Bevor Ihr ihn nicht losgesprochen habt, werde ich Rom nicht verlassen.«
»Passt lieber auf, dass es Euch nicht wie ihm ergeht! Warum nur besteht Ihr so vehement darauf, Bischöfe und Priester zu benennen? Kann es Euch nicht gleichgültig sein, wer über ein Bistum oder eine Abtei gebietet?«
»Weil sie auch Reichsterritorien verwalten und in ihren Gebieten über Hoheitsrechte verfügen. Das kann ich nur dulden, wenn sie mir den Treueeid schwören und mit ihren Truppen zu meinen Fahnen eilen, wenn ich ihrer bedarf.«
»Darum geht es Euch also letztendlich, um die Regalien«, meinte Paschalis nachdenklich.
Regalien waren die Rechte, die einem Souverän in seinen Landen zustanden, wie Münz-, Markt- und Zollrecht, die oberste Gerichtsbarkeit, das Recht auf erbloses Gut und vieles mehr.
Der Papst lief mit gesenktem Haupt eine ganze Weile auf und ab und schien in tiefe Gedanken versunken. Plötzlich blieb er stehen, die Hände auf dem Rücken verschränkt, sah Heinrich einen ewig scheinenden Augenblick in die Augen und verkündete dann: »Was haltet Ihr davon, wenn ich Euch alle aus königlicher Verleihung stammenden Hoheitsrechte der Bistümer, Abteien und Klöster zurückgebe?«
Augenblicklich war es totenstill im Zelt. Der König musste sich erst einmal setzen, so überraschend kam für ihn die Wendung der Auseinandersetzung.
»Als Gegenleistung für was?«, brachte er dann fast stammelnd vor Verblüffung heraus.
»Ihr verzichtet gänzlich auf die Investitur und überlasst sie zukünftig ausschließlich der heiligen Mutter Kirche.«
»Verzeiht, Heiliger Vater, aber wovon sollen die Bischöfe dann leben, die Äbte und Priore, die Diakone und Priester?«
Es war nicht der König, der diese wichtige Frage stellte, sondern Kuno von Praeneste. Schon jetzt begann der Kardinalbischof um seine Pfründen und die seiner Amtsbrüder zu bangen. Und der ganze Klerus, das war Heinrich von einem auf den anderen Augenblick klar, würde sich auf seine Seite schlagen.
»Nun, vom Kirchenzehnten, vom Eigenbesitz der Klöster und Abteien, von Almosen«, gab Paschalis die Antwort. »König Heinrich hat ja in manchen Dingen nicht unrecht. Unsere Bischöfe sind eher Grafen und Herzöge als geistliche Hirten ihrer Gemeinden. Statt von der weltlichen Macht geschützt zu werden, müssen sie Gefolgschaftsdienste leisten, Steuern eintreiben, Ländereien verwalten und vieles mehr. Sie konzentrieren sich nicht mehr auf die Verbreitung des Wortes Gottes, sondern mehr und mehr auf die Wahrung ihrer Besitztümer. Kirchliche Ämter werden gekauft, verkauft und vererbt. Es ist einfach unerhört! An das vor fast hundert Jahren beschlossene Zölibat für Priester und Mönche hält sich kaum einer. Der Bischof von Passau wäre beinahe von seinem eigenen Klerus gelyncht worden, als er es durchsetzen wollte, wurde mir erst unlängst berichtet. Nein, hier ergibt sich eine Chance, weltliches und geistliches Leben wieder zu trennen. So wie es schließlich sein sollte! Wenn Ihr, Heinrich, auf die Investitur verzichtet, verzichtet die heilige Mutter Kirche zukünftig auf die Regalien und gibt die bisher gewährten zurück. Könnten wir uns darauf einigen? Was meint Ihr?«