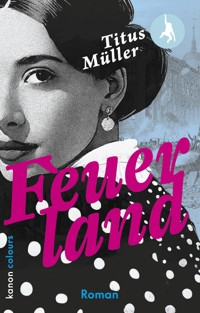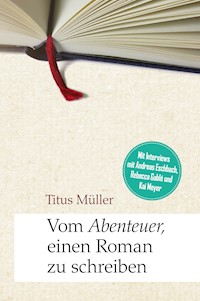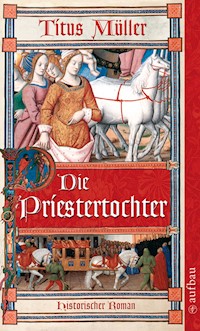
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Sprach- und bildmächtig, mitreißend erzählt." Berliner Morgenpost.
Das Orakel von Rethra fordert ein Menschenopfer, doch Alena, die schöne und kluge Tochter des Hochpriesters, verliebt sich in den todgeweihten Feind. Während sich Franken und Slawen zur Schlacht rüsten, kämpft Alena um ihre verbotene Liebe ...
Titus Müller lässt die Welt des 9. Jhds. wiederaufleben, die voll christlichen Eifers und heidnischen Aufbegehrens ist.
Ein magischer Roman von einem "erstaunlichen Autor." Hessischer Rundfunk.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 615
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Titus Müller
Die Priestertochter
Historischer Roman
Impressum
ISBN 978-3-8412-0122-5
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, Mai 2012
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Die Erstausgabe erschien 2003 bei Aufbau Taschenbuch,
einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung Preuße & Hülpüsch Grafik Design
unter Verwendung von Buchmalereien:
Schule von Rouen, um 1460; Sean Fouquet, um 1500
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,
KN digital - die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
Epilog
Einige Worte zu Rethra
Danksagung
MEINEN ELTERN IN DANKBARKEIT ZUGEEIGNET.
Meinem Vater, Matthias Müller, der mir beigebracht hat, Werkzeuge mit dem Griff voran weiterzureichen, Fehler zu verzeihen und in angenehmen wie in unangenehmen Zeiten für meinen Glauben geradezustehen. Meiner Mutter, Ulrike Müller, die mich zu reden gelehrt hat und zu lieben. Sie hat mir und meinen Brüdern gezeigt, was Phantasie ist und – sehr nützlich für das Romanschreiben – wie man große Arbeiten in kleine Etappen einteilt.
1. Kapitel
Es gelang den Herrschern des fränkischen Großreichs nicht, das wilde Land im Osten zu unterwerfen. Sie errichteten Kastelle am Elbufer, und bald erhoben sich Burgen der slawischen Fürsten aus den gegenüberliegenden Wäldern. Sie sandten Missionare aus. Nicht einer kehrte zurück. Raubzüge wurden mit Plünderungen beantwortet.
Zwar hatte man den Obodritenkönig Dobemysl und seine fünfzig Burgen durch Landgeschenke gewonnen, auch das ihm zu Kriegstreue verpflichtete Linonenvolk. Aber was war mit den hundertfünfundzwanzig Burgbezirken der Milzener im Süden, der Redarier und Tollensanen östlich der Peene, der Zirzipanen und Kessiner westlich davon? Was war mit den grimmigen Polaben? Eine geheimnisvolle Kraft hielt diese Völker zusammen, regierte sie mit so großer Macht, daß die Kleinkönige der Stämme dagegen wie Schatten erschienen.
Rethra.
Wälder und Sümpfe schlangen sich ineinander im Land der Slawen, Seen funkelten, Moore hauchten schwarzen Atem. Irgendwo, an einem geheimen Ort, lauerte Rethra als Spinne im Netz. Das Orakel zog an Fäden, begann Kriege und beendete sie, bestimmte das Schicksal der Völker. Es hieß, das Pferd eines Gottes bewohne die Tempelburg, und wie auch immer die Frage lautete, es wisse ihre Antwort. Blutige Opferrituale seien der Preis, es milde zu stimmen.
Der Kaiser suchte, Zwietracht unter den slawischen Stämmen zu schüren. Es gelang ihm, den Weletenbund zu zerschlagen, indem er dessen Bundeskönig Cealadrag durch einen gezielten Angriff der Obodriten töten ließ.
Rethra hörte davon.
Der Kaiser förderte die Grenzkriege der reichstreuen Thüringer, hieß sie, wieder und wieder ins slawische Land einzufallen, Felder zu verwüsten, Ortschaften niederzubrennen.
Rethra hörte davon.
Dann, im Jahr 873 nach der Geburt Jesu Christi, verweigerten die Sorben den Tribut an Kaiser Ludwig, und er antwortete mit Krieg. Die Heere des Erzkanzlers Liutbert und des Markgrafen Ratolf vereinigten sich und überquerten im Januar 874 die Elbe. Sie plünderten Häuser, äscherten Dörfer ein, mordeten die aufständischen Sorben.
Rethra hörte davon. Und Rethra entschied, daß es an der Zeit war, die Stämme für einen Orakelspruch zusammenzurufen.
Während sich Männer und Frauen aus dem ganzen Slawenland auf den Weg zur geheimen Tempelburg machten, kam ein Mönch aus Corbeia Nova im fränkischen Großreich herangereist, ein Mann mit marderhaftem, vernarbtem Gesicht, Tietgaud genannt. Fest entschlossen, den Orakelkult Rethras zu beenden, verschaffte er sich zwei Dutzend mit Panzerhemden gerüstete Männer und überquerte den Grenzfluß in der Nähe Bardowicks. Er schwor, nicht umzukehren, bevor die düstere Stätte des Götzendienstes vernichtet war.
So flocht der Allmächtige, der aus unseren Schicksalen den farbenreichen Teppich der Geschichte webt, Tietgauds Faden in das Gewirk, gemeinsam mit dem spröden Zwirn eines Mannes, der seit zwanzig Jahren tot war, und doch lebte, und sich weigerte zu sterben. Einen dritten Faden färbte Gott rot und legte ihn hinzu, rot für Alena, die Tochter des Hochpriesters von Rethra. Sie sollte die Mächtigen im Zeitgewebe das Fürchten lehren.
Die Finger der Flötenspieler hüpften auf den Löchern. Ihre Füße klopften den Boden. Es erhob sich eine schrille, fröhliche Melodie in den Himmel, und obwohl sie neu war, sangen Dutzende aus vollem Hals mit. Dunkel quäkte eine Birkentute. Trommeln flogen durch die Luft, im Flug geschlagen. Es hätte heller Tag sein mögen: Mit Kraft leuchtete das Feuer in die Gesichter, zeichnete Glut auf die Wangen.
Alena lächelte den jungen Kessiner an, der sie im Tanz am Unterarm umgriffen hielt und mit sich wirbelte. Die Schritte lief sie von allein, sie verschwendete keine Aufmerksamkeit darauf; lang, lang, kurz, kurz, lang. Die Musik befahl, und Alenas Füße gehorchten willig.
Er hatte keine Ahnung, wer sie war. Auch die anderen Kessiner nicht. Auf eine vergnügte Art machte es sie unsicher. Der hübsche Schwarzschopf tanzte mit ihr, weil sie ihm gefiel, und nicht, weil sie die Tochter ihres Vaters war.
Zwei Dudelsäcke brummten, von Männern unter die Achsel gepreßt. Mit aufgeblähten Wangen bliesen die Männer in die Sackpfeifen, folgten der Flötenmelodie, trieben sie an mit dem grellen Quieken der Pfeifen.
Inmitten einer Drehung warf Alena einen kurzen Blick auf den Fürsten, der außerhalb der Tanzenden stand. Große Nase, seitlich davon breite, unschöne Falten. Wilde Wohlgestalt, trotz allem. In der silbernen Kette, die seinen Fellumhang zusammenhielt, spiegelte sich der Feuerschein. Er hatte Alena noch nicht bemerkt.
Sie warf das Haar, das lange, dunkle, und ließ die Schläfenringe klingeln. Mit den Augen funkelte sie ihrem Tanzpartner eine glühende Aufforderung zu. Er grinste, packte sie mit beiden Händen und hob sie in die Luft. Jauchzend ließ sie sich in die Bögen des Tanzes fallen, bis der Kessiner sie absetzte.
Wieder ein Blick. Der Fürst stopfte sich ölglänzendes, bleiches Fischfleisch in den Mund. Er sah stumpf vor sich hin, angelte mit fettigen Fingern zwischen den Zähnen nach Gräten.
»Wie heißt dieser Mann?« keuchte sie.
»Želechel«, antwortete ihr junger Tanzpartner. »Du bist Redarierin, richtig?«
Sie antwortete mit einem Augenzwinkern. Sorgfältig darauf bedacht, daß er es nicht bemerkte, schob sie den jungen Kessiner in Tanzschritten um das Feuer herum, näher zum Fürsten. Sie stieß ihren Partner an, lachte und zog dabei die Nase kraus.
Da. Endlich sah der Fürst herüber. Er hob eine Schöpfkelle an die Lippen, schlürfte die Suppe aber nicht, sondern pustete Luft darauf, ohne den Blick von Alena zu nehmen. Sie senkte die Lider, sah auf die kupferne Gürtelschnalle des Fürsten. Dann riß sie der Tanz weiter. Wenn er ein Herr war wie Vater, würde er Bescheidenheit und Anstand mögen. Augenblicklich setzte sie die Füße ruhiger, folgte der Melodie und den Trommelschlägen mit geschmeidigen, aber kontrollierten Bewegungen.
»Warst du schon oft hier?« fragte sie ihren Tanzpartner. »Erst einmal, letztes Jahr. Die Burg beeindruckt mich immer noch.«
»Und der Tempel?«
»Davon halte ich mich lieber fern.«
Sie verzog spöttisch die Lippen. »Du fürchtest dich?«
»Fürchtest du dich nicht? Immerhin wohnt der Dreiköpfige darin.«
Drehung um Drehung. Fliegende Zelte, Feuerfunken, Gesichter. Die Musik ein Dröhnen im Bauch, in den Füßen, in den Ellenbogen.
Der Kessinerfürst hielt sich unverändert die Kelle vor das Kinn. Unmöglich konnte er ihr Gespräch belauscht haben: Die Flöten und Dudelsäcke waren zu laut. Aber er beobachtete Alena mit strengem Blick, verfolgte den Weg des Tanzpaares. Sie führte den jungen Schwarzschopf zur anderen Seite des Feuers.
»Wüßte gern, wie es im Tempel aussieht«, sinnierte er. »Diese schrecklichen Geisterstatuen rings herum … Verbergen sie Lichterglanz? Oder rote Glut inmitten eines dunklen Raums?«
»Ich kenne das Innere des Tempels.«
Der Kessiner unterbrach den Tanz. Ein anderes Paar rempelte sie an, aber er stand wie angewurzelt und starrte ihr ins Gesicht. »Warst du drinnen?« hauchte er.
Sie ließ ein wenig die Mundwinkel zucken, geheimnisvoll.
»Svarožić – du hast ihn gesehen?« Alle Farbe wich aus seinem Gesicht. Dann plötzlich griente er wieder, schüttelte den Kopf. »Du legst mich aufs Kreuz, oder?«
»Ich habe gehört, daß euer Fürst sein junges Weib verstoßen hat. Ist das richtig?«
Der Kessiner runzelte die Brauen, nickte. »Du kannst niemals im Tempel gewesen sein. Allein die Priester haben Zutritt, und nicht einmal sie dürfen Luft schöpfen, wenn sie im Inneren sind, um den Dreiköpfigen nicht mit ihrem sterblichen Atem zu beschmutzen.«
»Hat Želechel schon erneut gewählt?«
»Wer bist du, daß dich das interessiert?«
Alena schlug die Augen nieder. »Komm, laß uns weitertanzen.«
Zwar gehorchte der Kessiner, aber er war sichtlich verwirrt. Widerwillig umfaßte er ihren Arm, als verbrenne er sich daran die Finger. Er musterte sie, die Lippen zu einem schmalen Strich zusammengepreßt, die Stirn umwölkt. Seine Füße fielen aus dem Rhythmus der Trommeln, und er schien es nicht einmal zu bemerken.
»Was ist los?« Alena kniff ihn in die Schulter.
»Nichts.«
»Schon müde?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich frage mich, was du wirklich hier willst. Du bist doch nicht zum Tanzen zu uns gekommen.« Seine Stimme begann zu zittern. »Gehörst du nach da oben?«
Sie sah hinauf. Schwarz schoben sich die Wälle Rethras vor die Sternenpracht. Der Mond balancierte wie ein rundes, fahles Brot auf dem Westtorturm, die anderen Türme drohten zu beiden Seiten, emporgereckte Stierhörner. Über einer Zinne funkelte silbern die Speerspitze eines Postens. Ein geisterhafter, weißer Schimmer glomm hinter den Mauern.
»Und wenn es so wäre?«
»Bist du eine Vila?«
Lauthals lachend legte sie den Kopf in den Nacken. »Ich ein Geist? Sehe ich aus wie eine Vila? Ich hätte dir öfter auf die Füße treten sollen.« Eine Hand senkte sich auf ihre Schulter. »Was soll das?« fuhr sie herum und stieß einen Mann von sich.
Als wäre es Staub, putzte sich der Gestoßene die Berührung von der Brust. Dann hob er den Kopf: ein ernstes, bleiches Gesicht. Donik. Vaters Bote. »Er will dich sehen.«
»Nicht jetzt.«
»Das ist nicht dein Ernst, oder?« fragte Donik ruhig.
Sie knirschte mit den Zähnen. Knurrte: »Du hast recht. Ich habe keine Wahl. Gehen wir.«
»Wartet«, rief der junge Kessiner, und wies mit der Hand auf sie. »Wer ist diese Frau?«
Donik verzog keine Miene. »Das ist Alena, Nevopors Tochter.«
»Die Nawyša Devka«, flüsterte ihr Tanzpartner. Er rührte an seine Lippen, als wollte er das Gesagte zurücknehmen. Einige Paare unterbrachen ihren Tanz.
Als die ersten Menschen begannen, sich erschrocken zu verneigen, packte Alena den Boten am Hemd und zog ihn fort. »Danke«, fauchte sie. »Das war ja ein fabelhafter Auftritt.«
Donik schwieg. Sie stampften durch das Lager, hielten sich in der Dunkelheit zwischen den Feuern der einzelnen Zeltstädte.
»Ist dir nicht in den Sinn gekommen, daß man unter den Kessinern vielleicht nicht wußte, wer ich bin, und daß es gut sein könnte, es dabei zu belassen?«
»Du hast keinen Grund, dich zu verstecken.«
»Verstecken? Es wird der Priestertochter doch wohl gestattet sein, ein Fest zu genießen!«
Sie erklommen die Treppe zum Westtor. Wie stumme Recken wuchsen die Wälle vor ihnen in die Höhe.
»Wir wissen beide«, sagte Donik ruhig, »daß du anderes im Sinn hattest als ein Fest.«
»Paß auf, was du sagst, Wurm!« Sie atmete heftig, und es hatte nicht nur mit den Stufen zu tun. Die Dreistigkeit Doniks ärgerte sie mindestens so sehr, wie der mißglückte Abend es tat. Zugleich wütete die Vorahnung auf einen weiteren Streit mit Vater in ihrem Bauch. »Wie ist er gelaunt?«
Das Tor öffnete sich vor ihnen.
»Finde es selbst heraus.«
Fackelschein im Burginneren. Nackte Oberkörper, sich voranstemmende Männer, Seile über den Schultern. Eine Felsplatte, darunter rollende Bäume. Leicht hügelan auf dem höchsten Platz strotzte der Tempel, errichtet auf bleichen Tierknochen. Wächterstatuen umzäunten ihn: lange, bis zum Tempeldach aufragende Bohlen mit weit aufgerissenen Mäulern, geifernd, zähnefletschend, gespaltene Zungen in die Nacht gereckt. Geister waren es, die ihre Wut genossen.
Neben den arbeitenden Männern flatterte ein schwarzer Mantel. Vater. Er überwachte die mühsam voranknirschende Felsplatte mit verschränkten Armen. Es sah aus, als sei es nicht die Muskelkraft der Männer, sondern Vaters Blick, der die Platte bewegte. Ein Windhauch spielte in den langen Haaren, zupfte am Bart und ließ die Enden der Priesterbinde am Hinterkopf flattern.
Spürte er, daß sie ihn musterte? Vater drehte sich um, löste sich von den keuchenden Männern, kam näher.
»Warum läßt du das erst jetzt in der Nacht machen?« fragte Alena wie beiläufig. Sie hoffte auf ein leichtes Zucken der Augenwinkel, ein Zeichen des Wohlwollens. Aber Vaters Gesicht blieb starr.
»Es ist gut, wenn die Menschen am Morgen etwas Neues sehen.«
»Du willst, daß sie denken, der Dreiköpfige habe den Altar dorthin getragen?«
Nevopor wendete sich an Donik. »Überwache für mich die Arbeit. Die Blutrinne in der Felsplatte soll zum Westtor zeigen.« Der Dienstbote nickte knapp und schritt auf die nackten Schultern zu. Währenddessen wies Vater auf ihr Haus. »Komm, wir müssen reden.«
»Sie sollen tatsächlich glauben –«
»Niemand denkt das, Alena.«
Im Haus knirschte Sand unter den Füßen. Mondlicht wehte durch die Giebelöffnung und die Fenster hinein, weckte die schlafenden Wandbehänge, senkte sich auf den kalten Ofen, huschte über die gedrechselten Bänke ringsum an den Wänden. Ein silberner Sprung über den Webstuhl – die Fäden glitzerten leise –, weiches Landen auf Vaters Truhe.
Der Vater nahm Platz und klopfte neben sich auf die Bank. Als Alena sich setzte, stand er auf, trat zum Webstuhl hinüber und zog sich einen Schemel heran. Natürlich, er wollte ihr gegenüber sitzen, wie er es gern tat, wenn er ihr den Kopf wusch.
Das Kleid klebte ihr am Rücken und an der Brust. Vorsichtig senkte sie die Nase: Schweißgeruch. Er mußte sehen, wie wild sie getanzt hatte. Nein, sie würde sich Vaters Willen nicht beugen. Sie war die einzige in Rethra, die es wagte, sich ihm zu widersetzen. Die einzige, die nicht zur Masse jener Menschen gehörte, die sich von seinen Augen regieren ließen wie fügsame Puppen von der Hand eines Gottes.
»Alena.«
Erschrocken sah sie auf. Der scharfe Klang in Vaters Stimme war ungewohnt.
»Ich habe dich nicht gerufen, damit du sitzt und träumst.«
»Und weshalb dann?«
Statt einer Antwort durchbohrte der Vater sie mit den Augen. Schwieg.
»Weil ich bei den Kessinern war. Sie haben gefeiert, und ich habe mit den Leuten getanzt. Du bist zornig auf mich deswegen, richtig?«
»Versuchst du, an Želechel heranzukommen?«
Beim Namen des Fürsten zuckte sie zusammen.
»Zwei Priester Rethras haben einen Sohn, Alena.«
»Jarich und Miesko, ich weiß.« Sie runzelte verdrossen die Stirn.
»Du kannst zwischen ihren Söhnen wählen.«
»Großartig!« Sie warf die Hände in die Luft. »Jarichs Sohn hat das Pferdegebiß seines Vaters geerbt. Weder spricht er viel, noch können seine schlacksigen Arme und die dürre Brust auf irgendeine Art beeindrucken. Und Cozilo … Ich habe ihn gestern beobachtet, wie er am Seeufer kniete, die Arme entblößt, um das Muskelspiel im Spiegel der Wasseroberfläche zu betrachten. Danach ist er in den Wald gegangen und hat einen halben Tag lang Pfeifen geübt; krächzende Pfeifversuche. Cozilo ist genauso wie Jarichs Sohn ein Junge, der verkrampft versucht, ein Mann zu sein, nichts weiter. Was soll ich mit denen? Ich bin zwanzig Jahre alt, Vater!«
»Wenn ich einmal nicht mehr lebe, wird einer von ihnen Hochpriester Rethras sein.«
»Entschuldige, daß aus mir ein Mädchen geworden ist«, fauchte sie.
Vater schüttelte den Kopf. »Darum geht es nicht. Ich versuche, deine Zukunft aufzubauen.«
»Du willst einen Enkelsohn, das ist alles. Aber es ist kein Jüngling hier in Rethra, dem ich mich hingeben wollte, verstehst du? Morgen ist die Orakelzeremonie, die Vorburg wimmelt von Menschen. Warum erlaubst du es mir nicht, daß ich mich unter ihnen umsehe?«
»Du bist die Nawyša Devka! Bei deiner Heirat geht es um mehr als nur um deinen Geschmack.«
»Ich werde schon jemanden auswählen, der Rang und Namen hat.«
»Spare dir die Suche. Du heiratest einen redarischen Priestersohn.«
»Warum muß es unbedingt –«
»Du weißt es. Man kennt dich, man schaut auf dich. Du bist kein gewöhnlicher Mensch. Das Volk ist sich mehr darüber im klaren als du selbst, wie es scheint.«
»Willst du mich zwingen?« Sie sprang auf, wurde am Arm gepackt und festgehalten.
»Du fügst dich, hast du mich verstanden? Ich dulde keinen Ungehorsam – nicht von einem beliebigen Pferdeknecht, und nicht von meiner Tochter.« Einige Haare waren über die Priesterbinde in die Stirn gefallen; sie zitterten. Deutlich sah Alena graue Strähnen in der Mähne des Vaters. »Indem du ihn heiratest, wirst du einem der Priestersöhne Ansehen im Volk verschaffen. Du wirst dich morgen als Nawyša zeigen.« Er zog böse die Mundwinkel herab. »Und ich weiß auch schon, wie.«
Grauer, kühler Morgen. Sterne noch am Himmel, kaum Licht. Menschen, Tausende, von den äußeren Wällen Rethras umarmt, ein Menschenheer in einer riesigen Schüssel. Männer mit Schnauzbärten und rasiertem Kinn, Frauen, der Schmuck an den Schläfen stumpf in der Dunkelheit, Kinder mit schmutzigen Mündern. Erwartungsvolle, furchtsame Blicke zum Tempel hinauf, zum Altar. Zu Alena.
Sie war eingerahmt von Priestern, den einzigen Männern im Volk, die Bart und Haare lang wachsen ließen: Jarich und Gnažek zur Linken des Altars, Miesko und Lodiš zur Rechten. Den Kopf und die Hände der Priester konnte sie deutlich sehen, wenn sie sich zu ihnen drehte; der Rest ihrer Körper verbarg sich in der Dunkelheit unter schwarzen Taillenmänteln, und selbst die Stirn bedeckte eine schwarze Binde. Alena hingegen trug ihr weißes Leinenkleid. Die Tochter des Höchsten, die Nawyša Devka. Vater hatte recht, sie konnte der wartenden Masse nicht als Mensch erscheinen. Vielleicht sah man die Priester überhaupt nicht von dort hinten – Alena mußte zu sehen sein in ihrem hellen Kleid. Eine Vila vor dem Tempel Svarožićs.
Sie erkannte Rostislav in vorderster Reihe. Heute war er nicht der aufmerksame, unbestechliche Wächter auf dem Nordturm. Er hatte den Arm um die Schulter seiner Frau gelegt, als wollte er ihr die Furcht nehmen. Zum erstenmal kam Alena der Gedanke, daß er ein einfacher Mann war wie andere auch, und daß er älter geworden war, seit sie ihm in ihren Kindheitstagen Streiche gespielt hatte. An Kraft hatte er sicher kaum etwas eingebüßt, aber der Rücken hatte sich ein wenig gekrümmt, und die gesenkten Augenlider ließen ihn müde erscheinen.
Der Vater war durch den Tempel vor den Blicken der Menge verborgen. Er überwachte auf dem rückseitigen, nach Osten gewandten Wall der Burg den Himmel und würde ein Zeichen geben, sobald die Sonne sich zeigte. Dann würde Alena das erste Blut des Tages vergießen.
Der Hahn, dessen Flügel sie unter seinen Leib gebogen hatte und dort mit den Beinen zusammenhielt, verdrehte unruhig die braunen Äuglein, zwinkerte mit dünner Haut darüber. Alena spürte seinen warmen Körper an ihrer Brust, sie roch den Duft des Stalls, der aus dem Gefieder aufstieg, sah den leicht gebogenen Schnabel zum Himmel rucken. Würde er ihn aufreißen und krähen, wenn das Sonnenlicht sich zeigte? Ein letztes Mal krähen?
Ihre Rechte umklammerte den Griff des Beils. »Verabschiede dich vom Leben, stolzer Hahn«, raunte sie. »Du wirst in wenigen Augenblicken sterben müssen.«
Und mitten hinein in die erwartungsvolle Stille dröhnte ein Horn. Das Zeichen. Die Priester nickten ihr zu.
Sorgfältig umklammerte sie die Flügelspitzen und die Beine des Hahns, neigte ihn nach vorn, um seinen Kopf seitlich auf den Altar zu legen. Da begann der Hahn zu kreischen. Er zeigte seine kleine Zunge und zeterte. Ein ungewohntes Geräusch: Immer nur dann war es zu hören gewesen, wenn ein Bussard über der Burg kreiste und der Hahn die Hennen warnte. Ein kurzer Schrei dieser Art genügte, und unvermittelt war alles Federvieh vom Hof gefegt. Nun aber kreischte der Hahn mit hoher, gellender Stimme ohne Unterbrechung, spitze Schreie wie Messerklingen. Es betäubte Alenas Sinne. In Todesangst begann das Tier zu kämpfen, zerkratzte mit den Krallen ihren Bauch, ruckte mit den Flügeln, um sich zu befreien.
Sie hob das Beil und schlug zu. Schweigen.
Der Kopf lag abgetrennt auf dem Altar, die braunen Äuglein aufgerissen. Blut schoß aus dem Hals des Hahns. Und doch war der Kampf nicht zu Ende: Der ganze Körper zappelte, wand sich, zuckte in ihrer Hand mit schier unheimlicher Kraft. Sie verlor die Flügel aus ihrem Griff, und der kopflose Hahn erhob sich flatternd in die Höhe. Verzweifelt zog sie ihn an den Beinen herunter, versuchte, ihn zu packen. Warme Spritzer landeten auf ihren Wangen, auf den Lippen, dem Kleid. Der Geköpfte kämpfte gegen ihre Hände, die ihn auf den Altar herunterdrückten. Es erschien ihr wie Stunden, bis die Kräfte des sterbenden Tiers nachließen, bis es endlich erlahmte und still liegenblieb.
Ein Raunen von Gebeten erhob sich in der Menschenmenge, daß Alena die Ohren davon rauschten. Sie taumelte zurück, machte Platz für die Priester, die die bronzenen Opfermesser gezückt hatten und den Blutstrom nicht abreißen ließen: Ziegen starben, Hühner, Gänse. Eine Schlange von Männern wartete darauf, den Priestern Opfertiere zu übergeben. Als ein Lamm auf den Altar gehoben wurde, schloß Alena die Augen. Sie rieb die klebrigen, stumpf nach Blut und Hühnerkot riechenden Finger aneinander.
Wenig später sah sie das Lamm mit rot verfärbtem Fell neben dem Altar liegen. Die Körper der geopferten Tiere bildeten Reihen auf beiden Seiten. Endlich war es ruhig, kein ängstliches Blöken oder Kreischen hallte mehr durch die Burg. Auch das Rufen und Beten der Menge verstummte. Man sah hinauf zum Tempel.
Wie zuvor standen die Priester paarweise zu Seiten des Altars. Leise strich der Wind über ihre Mäntel; roter Lebenssaft tropfte noch vom Mantelsaum zu Boden und von den bronzenen Opfermessern herab, die sie in den Händen hielten.
Das Volk erstarrte, es spürte wohl, was nun kommen würde. Fürsten mußten darunter sein, Krieger, Mitglieder aller Stämme – sie schwiegen in Ehrfurcht, während der Vater aus dem Tempel trat, in der Hand das goldene Trinkhorn. Er schritt ruhig an Alena vorüber, hielt den Kopf so würdevoll erhoben, als hätte er soeben im Tempel noch einmal Angesicht zu Angesicht vor Svarožić gestanden, dem Geber der Gesetze, dem Feuerfürsten, der Verderben schleuderte und Fruchtbarkeit pflanzte, der Kriege mit seinem Hauch entschied und die Welt mit drei wachsamen Augenpaaren hütete. Die Sonne folgte seinem Befehl und empfing ihren Glanz von ihm, den Toten wies er ihren Platz in der Unterwelt.
Mit emporgerecktem Arm – das schwarze Leinen des Umhangs hing weit herab – schöpfte Nevopor Blut vom Altar in das Horn. Er verharrte einige Augenblicke mit dem Gefäß vor der Brust. Kein Vogel schrie, kein Fuß scharrte. Nicht einmal die Kinder brabbelten mehr. Es herrschte absolute Stille. Über und über war das Horn mit feinen Linien verziert. Blut lief daran herunter. Vater setzte es an den Mund und trank. Als er es wieder heruntergenommen hatte, wurde er leichenblaß. Lange stand er so, starrte blind vor sich hin, wankte. Schließlich öffnete er den Mund und krächzte leise: »Ein Menschenopfer.«
Bis in die hintersten Reihen brandete die Nachricht. Wie viele Jahre war es her, daß Svarožić ein Menschenopfer gefordert hatte? Ein Mensch sollte sterben! Das Blut der Tiere genügte nicht.
Miesko hatte seinen Platz verlassen und war an den Vater herangetreten. Er füllte ihm das goldene Horn aus einem Krug mit Honigwein. Erneut setzte Vater das Horn an den Mund und trank in langen Zügen. Er hob es hoch über den Kopf zum Trinken, holte nicht ein einziges Mal Luft, und als er es von den Lippen nahm und umkehrte, ohne daß ein Tropfen herausfiel, schrie die Menge in lautem Jubel. Es war ein gutes Zeichen, wenn das Horn in einem Anlauf geleert wurde.
Vater zog sich ohne Eile hinter den Tempel zurück. Er kehrte wieder mit der Weißen am Zügel. Dunkle Hufe pochten erhaben auf den Boden, Haare wehten wie Pulverschnee aus der Mähne auf. Muskeln spannten sich unter dem makellosen Fell. So dünn und seidig war die Haut des Tiers, daß sich auf der Brust und an den Beinen Adern hervorwölbten, ineinandergeschlungene Pfade, Netze der Kraft. Die Nüstern der Stute trugen eine hautfarbene Zeichnung, ohne daß der Fleck die Schönheit des Pferdes zerstörte: Er ließ es klug erscheinen. Wimpern schwebten über schwarzen Kugelaugen.
Die Stute ließ ein Schnauben über den Burghof hallen wie einen Gruß. Tausende Stimmen gingen in ein Raunen über, in ehrfürchtiges Flüstern und Zischen. Das Pferd Svarožićs. Es würde, es mußte das Orakel bestätigen.
Die Priester rammten zwei Reihen von Speeren in den Boden, so, daß sie schräg hervorschauten und ihre Enden wenige Handbreit über dem Boden schwebten. Dort, wo sie sich kreuzten, bildeten sie Tore; drei niedrige Hindernisse. Die Hufe der Weißen näherten sich dem ersten Tor. Alena heftete ihren Blick an den rechten Huf. Da, die Stute hob das Bein und trat über die erste Stange. Ein gutes Zeichen.
War das Schweiß auf der Stirn des Vaters? Er sah nicht hinab. Vater konnte es hören, welcher Huf zuerst auftrat. Er hörte es daran, ob die Menge still blieb oder in ängstliches Jammern ausbrach. Wieder der rechte Huf.
Vor dem dritten Speer verlangsamte der Hochpriester die Schritte. Alena sah den Vater am Zügel ziehen, als wollte er das Pferd zur Seite lenken. Der linke Huf: Er hatte sich leicht erhoben, fiel zurück auf den Boden. Die Stute hob den Kopf höher, wieherte leise. Sie stand vor dem letzten Speer. Sie mußte entscheiden, mit welchem Huf sie hinübertrat.
In der Menge begannen viele zu beten. Ein Ruck ging durch Vaters Arm. Er zog die Stute voran. Und schließlich hob sie ihr rechtes Bein und trat über das letzte Tor.
Jubel wollte ausbrechen, stockte, erstickte wieder. Der Schrecken und das Staunen über das Orakel kämpften miteinander. Ein Mensch sollte sterben.
Zunächst schien es, als wollte Vater mit der Stute zum Stall zurückkehren. Dann aber blieb er vor dem Altar stehen und senkte seinen Blick in Alenas Gesicht. Sie erschauderte. Was hatte das zu bedeuten? Vater wendete sich zur Menge um. »Das Heer der Franken ist über die Elbe gekommen. Seit Wochen verwüsten unsere Feinde slawisches Land. Svarožić sieht es genau, und er hat unsere Hilferufe gehört. Einen großen Tod fordert er, bevor er uns durch seine Kraft zu Rächern macht. Die Nawyša Devka hat heute das Opfer eröffnet – das Wohlwollen des Dreiköpfigen liegt auf ihr. Und so soll sie es sein, die den erwählt, der sterben wird. Es wird ein stattlicher Franke sein; in vier Wochen findet er auf diesem Altar den Tod.« Vater wies auf die blutbefleckte Felsplatte. Schließlich hob er den Arm zum Himmel hinauf: »Feiert das Orakel des Lichtbringers! Erfreut Svarožić, den Feuergott, indem ihr die Trinkhörner mit fröhlichem Lachen leert! Er wird uns den Sieg schenken.«
»Du schickst mich zu den Franken?« flüsterte Alena fassungslos. Der Vater ging an ihr vorüber, ohne sie anzusehen.
Gelächter und Musik erfüllten die Luft. Kinderkreischen dazwischen: Halbwüchsige hatten sich zusammengerottet, um in Ballspielen ihre Kräfte zu messen: Redarier gegen Tollensanen, Kessiner gegen Zirzipanen. An Spießen drehten sich die Opfertiere über den Feuern. Met schwappte aus Trinkhörnern – wer sich nicht betrank, würde den Zorn Svarožićs auf sich ziehen.
Abseits des Trubels, am Nordwall der Vorburg, kroch Alena zwischen duftende Schafleiber und rief leise einen Namen. Es hob sich ein brauner Kopf, zwei dick gewölbte Augen blickten sie an. Alena bückte sich unter das Dach, aus dem morsche Bretter herabhingen, schob sich zwischen die grauen, weißen und braunen Tiere. Die Schafe duldeten sie still. Sie kannten sie.
»Hallo, kleiner Wolleball. Geht es dir gut?«
Die Braune blökte zur Antwort.
»Wir schicken mal deine Freunde fort.« Sie streckte den Arm über die Tierrücken und schüttete Hafer aus einem Säckchen vor den Unterstand. Vierzehn Schafe drängten die Köpfe danach, nur eines stand still und sah Alena an.
»Das ist für dich.« Alena hielt ihm die Spitze einer Rübe vor das Maul. Vorsichtig tastete das Tier den Leckerbissen mit den weichen Lippen ab, nahm ihn zwischen die Zähne, malmte und fraß. »Erinnerst du dich, wie ich dir das erstemal Hafer gab? Du wolltest ihn nicht haben, wolltest weiter mit Milch aus einem Lederschlauch getränkt werden. Gewartet hast du, bis ich Milch brachte.«
Die Nase im weißen Gesicht der Braunen zuckte. Sie kam näher, noch kauend am Rübenstück. Alena fuhr ihr mit der Hand über den Kopf, kämmte die Wolle mit den Fingern. Die Braune blökte klagend. Sie roch nach Kot und feuchtem Stroh.
»Ich kann nicht tun, was du dir wünschst. Deine Ziehmutter muß dich verlassen. Wir werden uns einige Wochen nicht sehen.«
Als wäre sie beleidigt, drehte die Braune den Kopf zur Seite und sah Alena mit einem Auge an. Ihre Ohren wedelten, zuckten. Dann stand sie reglos, gaffend, als suchte sie zu begreifen, was ihr gesagt worden war.
»Es gibt böse Menschen. Nicht die gleichen, die deine Mutter getötet haben, aber andere böse Menschen. Einen von ihnen soll ich hierherbringen, und wenn er geschlachtet ist, kann ich dich wieder besuchen kommen.«
Blöken.
Sie ging in die Hocke, streichelte den Rücken des Schafs, zupfte einige Strohhalme aus der dichten Wolle. Die Braune drückte sich an sie, als wollte sie sie umwerfen. »Ist gut, es ist gut, mein Wolleball. Du weißt doch, daß ich dich nicht mehr tragen kann. Du bist kein kleines Lämmchen mehr! Eine junge Frau bist du geworden, die einiges wiegt.«
Plötzlich ruckten die Köpfe der Schafe auf. Rennen, Springen in einer dichten Traube, fort vom Unterstand, wilde Flucht der Herde zwischen Wall und Zelten. Die Braune sprang ihnen nach.
Dort stand der junge Kessiner, einen dürren, gefleckten Hund neben sich. Beide, Hund und Herr, blickten ernst. »Du gehst also fort«, stellte der Schwarzschopf fest. Der Hund leckte sich die Schnauze.
»So ist es.« Alena erhob sich. »Želechel wünscht, dich zu sehen.«
»Bedaure. Es ist nicht der Wille meines Vaters.«
Der Kessiner nickte. Einen kurzen Augenblick musterte er sie, dann wendete er sich zum Gehen.
Sie wartete, bis er sich einige Schritte entfernt hatte, dann rief sie: »Du wolltest wissen, wie es im Tempel aussieht?«
Ohne sich umzudrehen, hielt er inne. Nur der gefleckte Köter sah zurück, ließ die Zunge hängen und blinzelte.
»Die Gesichter des Dreiköpfigen glänzen wie Gold, und er ist in Purpur gekleidet. Ein Schwert hält er in den Händen, das zehn Männer gemeinsam nicht anheben könnten. An der Tempelwand zu seiner Rechten steht Belboh, der weiße Gott, und Belboh gegenüber der schwarze Gott Cernoboh. Aber ich war auch nie drinnen. Ich weiß es … von meinem Vater.«
»Lebe wohl.«
Erst als der Kessiner zwischen den Zelten verschwunden war, verließ sie den Unterstand der Schafe.
In kerzengerader Haltung schritt sie hügelan. Ein Schwan unter Enten in schmutzigbraunem, zerrissenem Gefieder. Die angeschwollenen, weinseligen Gesichter der Bauern blickten ihr nach. Es waren alles Schafsmörder, Betrüger waren es, die einen Sack Wolle eintauschten, der unter einer dünnen, ehrlichen Schicht mit Gras gefüllt war. »Sieh dich vor, du Trottel«, bellte sie und stieß einen Alten beiseite, der nicht recht aus dem Weg torkeln wollte. Nun wichen sie noch weiter vor ihr zurück, fürchteten sich offenbar, als würde sie mit der Anwendung von Zauberkräften drohen.
»Wo schleppst du das hin?« herrschte Alena eine Frau an, der unter der Last einer bis zum Genick mit Holz beladenen Kiepe die Knie einknickten.
»Zum Lager der Milzener, Nawyša.« Ächzend hielt sie das Gleichgewicht.
»Haben die Zweige, die du da aufgelesen hast, auch sämtlich auf der Erde gelegen? Du weißt, welche Strafe dir droht, wenn du in den heiligen Wäldern um Rethra einen Ast abknickst!«
Schweißtropfen rannen der Frau zwischen den Augen hinunter. »Willst du sehen? Alles trockenes Holz. Für die Festfeuer.«
Es dauerte Alena, wie sich die Frau mühsam auf den Füßen hielt. Und zugleich war es reizvoll, sie zu befragen, bis die Kiepe sie niederzwang. »In welchem Wald warst du?«
»Bei den Buchen im kleinen Bukov.«
»Hast du Tierspuren gesehen?«
»Verzeihung, ich …« Sie schwankte, packte verzweifelt die Schulterriemen der Kiepe, stemmte sich, keuchte.
»Wohl alles leergejagt für das Fest?«
»Hasenkot war da, sonst nichts.«
Gnädig winkte Alena: »Also gut, geh.« Als sie sich zur großen Treppe wandte, die in die Hauptburg hinaufführte, und so die Frau aus den Augen ließ, hörte sie ein lautes Krachen hinter sich. Es erfüllte sie mit Genugtuung.
Das war die Priestertochter, die sich Vater wünschte. Sie tat, was er erwartete, und obwohl Alena keine Erklärung dafür fand – es stellte sie zufrieden. Er würde sich im Haus befinden, weil er betrunkene Menschen haßte, und dort würde sie ihm eisig entgegentreten, ihn um einige Begleiter bitten. Daß es ihr schwerfiel, Rethra zu verlassen, und daß sie es verabscheute, von ihm dazu gezwungen zu werden, davon würde sie nichts sagen. Er wußte es ohnehin. Womit er nicht rechnete, das würde ihre Selbstbeherrschung sein. Vater würde erstaunt einsehen, daß er es mit einer ebenbürtigen Gegnerin zu tun hatte.
Am Tor wachten Mstislav und Nakon der Eber. Sie waren Freunde Rostislavs, gehörten zu einer Gruppe von erfahrenen, besonnenen Männern innerhalb der Tempelgarde, ein Kreis von Kriegern, der gern schweigend beisammensaß und bei Einbruch der Nacht mit Stecken im Feuer stocherte. Kaum jemand genoß Vaters Vertrauen so wie sie.
Sie erwiderte ihr Nicken. Dann klopfte sie kräftig an die Tür des väterlichen Hauses und trat ein, ohne auf Antwort zu warten.
Miesko, Jarich und Vater saßen am Tisch vor einer Platte mit abgenagten Knochen. Es roch nach gebratenem Fleisch. Braune Blutstropfen im Sand unter den Mantelsäumen der Priester.
»Schön, daß du kommst, Alena. Wir haben gerade beraten, wen wir mit dir schicken. Die auserwählten Männer sollten sich nicht allzu sehr besaufen heute, damit ihr im Morgengrauen aufbrechen könnt.« Vater winkte sie näher, aber sie blieb in der offenen Tür stehen.
»Schicke Jarich und Miesko hinaus, ich habe allein mit dir zu sprechen.«
Es war ein Augenkampf. Streng blickte der Vater sie an, runzelte die Brauen, kniff die Lippen zusammen. Er hielt ihr stand, zwinkerte nicht einmal. Schließlich aber rang sie ihn nieder. Zufrieden sah sie, wie er die beiden alten Priester mit einer kleinen Handbewegung hinauswarf. Im Gehen schüttelten sie die Köpfe. Schließlich spürte Alena die Tür im Rücken.
»Vielleicht bist du zornig, Tochter, aber das gibt dir nicht das Recht zu einem solchen Tonfall. Auch du hast den Priestern mit Ehrerbietung zu begegnen.«
Sie zuckte die Achseln. »Ich werde dir gehorchen und in den Westen ziehen, um ein Opfer herbeizuschaffen. Aber als Preis fordere ich, daß ich mir einen Mann erwählen darf.«
»Du wagst … Einen Preis forderst du?« Der Vater erbleichte. »Seit wann lassen sich Kinder für ihren Gehorsam bezahlen?«
»Bin ich ein Kind? Ich bin eine erwachsene Frau, und wie du immer sagst: Das Volk schaut auf mich. Meine Ausstrahlung wird den Mann, den ich heirate, zum Priester machen.«
»Hör auf, mir die Worte im Mund herumzudrehen! Das hat deine Mutter zur Genüge getan.«
»Laß Mutter aus dem Spiel«, zischte sie. »Oder willst du, daß uns ihr Geist besucht? Das Volk achtet mich, es wird auch meinen Mann achten.«
»Wie stellst du dir das vor? Was sollen Jarich und Miesko davon halten, wenn ein Fremder statt einem ihrer Söhne Hochpriester wird?«
»Sie können froh sein, wenn ihre Söhne eines Tages überhaupt den Priestermantel tragen dürfen. Sie sind es kaum wert. Mein Ruf als Nawyša, als Tochter des Höchsten, wird einen neuen Hochpriester rechtfertigen.«
Plötzlich zeigte sich Nachdenklichkeit in Vaters Gesichtszügen, und kleine Fältchen rafften die Augenwinkel zusammen. Er nickte langsam. »Meine Tochter. Du bist und bleibst doch meine Tochter. Vielleicht kann dein Plan noch Größeres möglich machen – sofern du einen Fürstensohn heiratest. Das Volk liebt dich jetzt schon. Wir werden dafür sorgen, daß sie vor dir erzittern.«
»Heißt das, ich darf wählen?«
Der Vater lächelte, wechselte in die fränkische Sprache. »Bevor du abreist, solltest du einiges Wissen auffrischen. Wie viele Könige hat das fränkische Großreich?«
»Drei. Ich darf also wählen?«
»Drei? Das genügt nicht zur Antwort!« Hart fügten sich die fremden Laute aneinander. »Du mußt wissen, wie sie zueinander stehen! Du mußt wissen, wie sie denken! Auf der Reise in den Westen wirst du die Männer führen. Und irgendwann stehst du an der Seite Cozilos.« Er lachte heiser. »Oder meinetwegen an der Seite eines stumpfsinnigen Fürstensohns, und du wirst ihn lenken müssen, damit Rethra nicht untergeht. Du wirst die unsichtbare Herrin über die Tempelburg sein, die Herrin, deren Arme ein geheimnisvolles, großes Reich regieren. Also, die Könige?«
»Im Osten regiert Ludwig, im Westen Karl, und im Süden, im Süden …«
»Was nützen die Namen? Ist Karl ein Halbbruder Ludwigs? Das ist wichtig! Herrscht im Süden sein Neffe? Ernährt das Westreich seine Einwohner vielleicht üppiger, und doch hält keiner der drei Könige sein Gebiet in so starker Faust wie Ludwig seinen östlichen Teil? Unser Ludwig, unser Feind! Er ist ein Greis von eisigem, grauem Blick und schmalen Lippen. Er hat die Kaiserkrone, nicht aber Hoheit über die anderen fränkischen Gebiete. Du mußt ihn kennen, seine Entscheidungen vorausahnen! Mit Härte herrscht er über Alemannen, Bayern, Thüringer, Sachsen und Ostfranken. Er läßt das Land durch seine Söhne verwalten und verhindert wieder und wieder ihre Versuche, die Krone zu ergreifen. Da ist eine Schwachstelle, denke immer daran.«
Ein Schwindel ergriff sie ob der schnell gesprochenen, fremden Sprache. Mit Mühe folgte sie dem, was der Vater sagte, stolperte über Wörter, die sie nicht kannte, hing an den immer schneller schnappenden Lippen in Vaters Bart. Und ihr Herz sprang vor Freude. Sie würde frei wählen! Sie hatte gewonnen. Es war, als wäre ein Bann gebrochen, der Vater, seit sie denken konnte, zum Unbesiegbaren gemacht hatte.
»Hörst du mir zu, Alena? Des Kaisers Macht stützt sich auf einen Mann mit dem Namen Luitbert. Man nennt ihn überall den ›Erzkanzler‹. Seine Macht ist unvergleichlich: Erzkapellan des Kaisers ist er und zugleich dessen Kanzler. Er übt die Würde des Erzbischofs von Mainz aus und ist zudem Bischof von Worms, Bischof von Speyer, von Konstanz, Chur, Augsburg, Eichstätt, Würzburg, Halberstadt, Paderborn, Hildesheim …«
Sie gab das Zuhören auf. Wen würde sie wählen? Stand ihr nun nicht das gesamte Land offen? All die Tausende, die die Vorburg füllten – konnte sie nicht einen jeden zum Mann nehmen? Ihre Wangen kribbelten.
»Eben dieser Luitbert wütet in den Dörfern der Sorben. Er ist eine Gefahr. Halte dich nördlich, wenn ihr auf die Elbe zukommt, nähere dich niemals seinem Heer! Alena?«
»Ja, Vater.«
»Wenn du zu weit in den Norden gerätst, betrittst du das Gebiet der Sachsen. Dort regiert der Sohn Ludwigs. Die Verschwörung gegen den Vater ist vergeben und vergessen, er wird nun vom Vater gebraucht, um mit Hilfe der Sachsen gegen uns vorzugehen. Du mußt auch schon auf unserer Elbseite damit rechnen, einer Räuberhorde der Sachsen zu begegnen, hörst du?«
»Gut, ich merke es mir.«
»Ich schicke nicht mehr als ein Dutzend Krieger mit dir. Kein großer Angriff, hörst du? Ein Wespenstich, den sie schnell wieder vergessen.«
Sie nickte.
»Und rechne nicht damit, bei den Stämmen auf freundliche Gesinnung zu treffen, nur weil du ihnen hier in Rethra begegnet bist. Auch unsere Feinde schicken Abgesandte. Sie vertrauen dem Orakel; das hindert sie nicht daran, die Macht der Redarier anzufechten.«
»Vater, darf ich dich um einen Gefallen bitten?«
»Was ist es, kluges Töchterchen?«
»Gib mir nicht Cozilo als Begleiter mit. Ich wünsche mir Mstislav, Nakon und die anderen, die dazugehören.«
»Eine gute Wahl. Du sollst sie haben.«
Der Gestank biß immer kräftiger in die Nase, und er schien vom See her zu kommen. Beleidigende Gerüche am Tag des Orakels? Gerüche, die über den heiligen Tempel hinwegzogen? Alena preßte die Zähne aufeinander, trat auf das Seetor zu. Das Volk erzittern lassen, hatte Vater gerade gesagt, ja, dafür wollte sie schon sorgen. Sie straffte die Brust, hob das Kinn – und erstarrte. Der Puls beschleunigte sich, sie duckte sich leicht, schluckte. Ängstlich spähte sie zum Altar hinüber, zur Felsplatte. In Alenas Ohren sang es, ein hoher, feiner Ton. Nichts. Kein Schatten mehr, keine Augen. Sie suchte die Wächterstatuen ab. Keiner der übermenschengroßen, dünnen Geister fehlte. Ihre Blicke aber schienen sie ungeduldig zu verfolgen.
Was war das gewesen? Welcher Geist war um den Altar gehuscht, hatte sich darunter verborgen und sie aus seinen blutrünstigen Augen angestarrt? Mit zitternden Knien schlich sie näher heran. Als ein feines Stimmchen unter der Felsplatte hervorkroch, erschauderte sie.
»Bitte, komm nicht näher.«
»Wer bist du?« flüsterte sie.
»Ich bins, Golek. Wenn mein Bruder mich findet, dreht er mir den Hals um.«
Erleichtert lockerte sie die Schultern, atmete aus. »Du hast mich erschreckt.« Sie lächelte. Golek ängstigte sie, mit seinen fünf Jahren! Bald würde sie selbst einen Sohn haben wie ihn.
»Geh weg, du verrätst mich.«
»Hör zu, Süßer, du kannst dich nicht unter dem Altar verstecken. Stell dir vor, dein Vater sieht dich dort! Kinder haben so nah beim Tempel nichts zu suchen.«
»Lieber laß ich mich verprügeln, als daß Cozilo mich kriegt.«
Cozilo dröhnte über den Hof. »Golek!« Es war der rauhe Kehlton eines Betrunkenen.
»Rühr dich nicht.« Alena entfernte sich einige Schritte vom Altar, dann rief sie: »Was hat er denn verbrochen?« Sie gab ihrer Stimme einen spöttischen Beiklang.
Augenblicklich änderte sich Cozilos Haltung. Die Arme schienen nicht recht zu wissen, wie sie herabhängen sollten, und ein verlegenes Grinsen huschte über das breitschädlige Gesicht. »Hast du ihn gesehen?« lallte er.
»Der große Bruder auf der Suche nach dem kleinen. Das ist ja wie in einer dieser Geschichten, die im Winter vor dem Ofen erzählt werden. Ist er weggelaufen?«
»Ach, das … Das ist nicht weiter …« Er trat von einem Bein auf das andere. »Sag mal, Alena, möchtest du vielleicht mit mir, wenn das Fest vorüber ist, einmal auf den See rausfahren, einfach zum Angeln, ich rudere, und du hältst die Rute?«
»Bedaure.«
»Ich kann auch die Rute halten, wenn du –«
»Sag mal, läuft nicht Golek gern unten bei den Ställen herum? Aber in der Vorburg bei den Feiernden hast du sicher schon nachgesehen.«
Cozilo kratzte sich die Nase, dann das Genick. »Ich gehe mal. Überlege dir das mit dem Angeln. Ich glaube, dein Vater würde es sehr gerne sehen.«
Sie sah ihm nach, wie er zwischen den Häusern zum Torturm trottete, wartete, daß der Schlagschatten des Tores ihn verschlang. »Nicht mehr«, flüsterte sie. Dann schlich sie zurück zum Altar. »Hab dich gerettet, Kleiner.«
Ein Knäuel aus winziger Hose und winzigem Hemd krabbelte hervor. Fest drückte sich ein rundes Gesicht an ihr Bein. »Danke.«
Sie lachte, streichelte Goleks Schopf. »Und jetzt schnell, verbirg dich hinter eurem Haus. Da wird er ganz zum Schluß suchen. Was hast du denn getan?«
»Ich habe seinen Gürtel im Garten vergraben. Er hat gesagt, wenn er den Gürtel nicht gleich wiederfindet, dann bringt er mich um. Weil er nicht tanzen kann ohne.«
»Du hast was?« Alena ging vor dem Fünfjährigen in die Hocke und sah ihm erstaunt ins Gesicht. »Den gräbst du aber rasch wieder aus und säuberst ihn, hast du mich verstanden? Sonst macht Cozilo am Ende seine Drohung wahr.«
»Ist gut.« Golek lief so schnell auf die Häuser zu, daß Alena fürchtete, er würde jeden Augenblick lang hinschlagen.
Mit einem Kopfschütteln wandte sie sich wieder dem Seetor zu. Knapp nickte Witzan ihr zu, der dort wachte. Er gehörte zu Mstislavs Truppe.
Sie tauchte ein in die Dunkelheit unterhalb des Turms, trat auf der anderen Seite wieder ins Tageslicht, und blieb stehen. Tief unter ihr, am Fuß des Hangs, breitete sich der Lucinsee aus, umrahmt vom Wald, die Seefläche am diesseitigen Ufer durchstochen von den Pfählen der Fischreusen. Zur Linken des steilen Pfads, der hinabführte, war der Hang mit Granitblöcken verkleidet. Das Bild, das sich Alena unten bot, ließ sie innehalten.
Einige Frauen wuschen Wäsche im See. Sie tauchten die Kleider vor ihren Knien in das flache Wasser, kneteten sie, rieben den Schmutz heraus, hoben sie hoch und tunkten sie wieder ein. Neben ihnen stand ein Kessel am Ufer, an dessen Boden Feuerflammen züngelten; eine Frau rührte darin. Sie kochte wohl Seife aus Asche und Tierfett. Der stinkende Qualm, der sich aus dem Kessel erhob, reichte als Säule hinauf bis zu den Wolken, sich fortwährend verbreiternd – es war, als wäre es diese Frau und dieser Kessel, die die graue Wolkendecke brauten, die heute das Land überschattete, es war, als nähme hier am Ufer des Lucinsees ein Unglück seinen Anfang, ein Unglück, das weit, weit seine Fänge ausreckte. Eine Sorge ohne Namen, nur ein Gefühl war es, das Alenas Schultern niederdrückte wie eine schwere Last.
Sie seufzte. Ohne Eile stieg sie den Hang hinab. Die Frauen ließen ihre Wäsche fallen und näherten sich. Mit bewundernden Blicken küßten sie Alenas Kleidersaum, nahmen sie bei den Händen, zogen sie in die eine, dann in die andere Richtung, lachten.
»Schön, daß du uns besuchst.«
»Du hast es gut, daß du von hier fort kannst.«
Alena wollte eine ernste Miene machen, aber es gelang ihr nicht. Sie mußte schmunzeln. Obwohl allesamt längst verheiratet waren, waren es doch ihre Spielkameradinnen, die, mit denen sie auf dem Lucinsee im Winter Schlittschuh gelaufen war, die, deren Rockzipfel sie beim Versteckspiel hinter einem Faß hervorlugen gesehen hatte, und obwohl es schon in der Kindheit immer Alena gewesen war, die anführte und entschied, wurde sie doch erst seit wenigen Jahren mit der Scheu behandelt, die man auch den Priestern entgegenbrachte. Beinahe meinte sie, ein einfacher Ruf – »Versteckt euch!« – würde genügen, und sie würden auseinanderstieben und sich verbergen, Kinder, jauchzende, kreischende Mädchen, Gefährtinnen.
»Ihr könnt heute keine Seife kochen«, sagte sie. »Der Gestank zieht über die ganze Burg hinweg. Macht das aus.«
Ohne Widerspruch gehorchten die Frauen. Sie schöpften Wasser mit den Händen und schütteten es auf die Flammen, bis nichts als zischende, schmauchende Asche davon übrigblieb.
»Und nebenbei bemerkt, freue ich mich überhaupt nicht, Rethra zu verlassen. Ich werde mich freuen wiederzukehren. Denn dann« – sie senkte die Stimme, und die Köpfe der Gefährtinnen drängten heran – »dann wähle ich mir einen Ehemann.«
Bis die Dunkelheit hereinbrach, gab sich Alena dem Genuß der Heimat hin, aß und trank, lachte und tanzte, schalt, herrschte, verbreitete Schrecken und dann wieder Wohlwollen.
Mit den Sternen kam die Angst.
Sie flehte, vor dem Tempel kniend, um Svarožićs Schutz, sie floh die Menschen und spähte vom Turm aus entsetzt über die weiten, finsteren Wälder. Es war das erstemal, daß sie Rethra verlassen sollte. Plötzlich erschien es ihr wie der Sprung von der Klippe in den sicheren Tod. Als der Nachthimmel den nahenden Morgen mit einem grauen Dämmerstreifen verkündete, fand er Alena schweigsam, müde und mit fieberglühendem Kopf. Knapp nahm sie Abschied vom Vater. Sie verließ Rethra wie eine Gefangene, letzte Blicke nach der sich entfernenden Burg sendend.
2. Kapitel
In den Rindenfurchen der Buchen verbarg sich Moos. Die alten Bäume verströmten Harzgeruch und den Duft nassen Holzes. Morgenlicht tropfte durch die Zweige. Sanft wiegten sich die Blätter im Wind, rauschten und wisperten.
Es war ein Lied, das der Wald sang, ein uraltes Lied. In den Tagen der ersten erschaffenen Bäume hatte es begonnen und war seitdem in unveränderlichem Chor erklungen, lauter im Sturm, fast unhörbar in windloser Sommerhitze. Wagten sich Tierlaute dazwischen: Kratzen und Schaben, Tapsen und Nagen, Pochen, Zwitschern, Summen, so lauschten die Bäume gnädig.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!