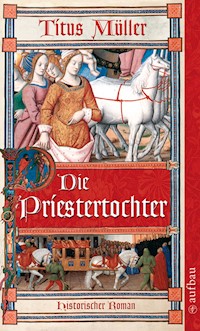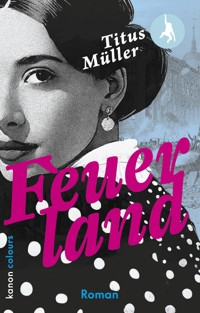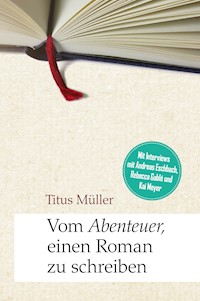Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kanon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1912, mitten im Atlantik: Die Tänzerin Nele Stern will in ein neues Leben aufbrechen. Nach einem verpatzten Auftritt im renommierten Varieté in Berlin wartet das Glück in Amerika. An Bord der Titanic lernt sie den Pastor Matheus kennen, der in einer Ehekrise steckt. Beide stehen am Scheideweg. Finden sie einen gemeinsamen Anfang oder ein dunkles Ende?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Nele Stern wird ein Traum wahr: Als Tänzerin feiert sie ihren ersten Soloauftritt im renommiertesten Varieté ihrer Zeit, dem Berliner Wintergarten. Doch sie fällt beim Publikum durch und beschließt, nach Amerika auszuwandern. Das Geld reicht gerade für eine Fahrt in der 3. Klasse der Titanic. An Bord des Luxusliners ist auch Matheus, ein Pastor aus Berlin, der gerade eine Ehekrise durchlebt. Außerdem ein Engländer, der sich höchst verdächtig benimmt und sich als Spion der britischen Krone herausstellt. Die Passagiere eint ihre Hoffnung auf einen Neubeginn – doch der Eisberg ist stärker. Einfühlsam und fesselnd schildert Titus Müller Menschen am Scheideweg ihres Lebens und wirft ein neues Licht auf die Bedeutung der Titanic in der Zeit europäischer Aufrüstung.
Titus Müller, geboren 1977, über ein Dutzend Romane. Er lebt mit seiner Familie in Landshut, ist Mitglied des Pen-Clubs und wurde u. a. mit dem C. S. Lewis-Preis und dem Homer-Preis ausgezeichnet. Seine Trilogie um Die fremde Spionin ist ein spiegel-Bestseller.
Titus Müller
Tanz unter Sternen
Roman
kanon verlag
Für Lena
ISBN 978-3-98568-157-0
1. Auflage 2024
© Kanon Verlag Berlin GmbH, 2024
© der Originalausgabe Blessing Verlag/Titus Müller, 2011
Umschlaggestaltung: Heilmeyer und Sernau Gestaltung
Herstellung: Daniel Klotz/Die Lettertypen
Satz: Heilmeyer und Sernau Gestaltung
Druck und Bindung: Pustet, Regensburg
Printed in Germany
www.kanon-verlag.de
Titus Müller
Tanz unter Sternen
ILÜGE
1
Mondlicht spiegelte sich in den Pfützen am überschwemmten Tunnel der Untergrundbahn. Es roch nach feuchtem Zement. Der Mann mit den schwarzen Handschuhen lud acht Patronen in das Magazin seiner Pistole und schob es mit einem Ruck zurück in den Griff der Waffe. Er steckte die P08 in das verborgene Halfter an seinem Rücken.
Vor zwei Wochen war hier die Spree in den Tunnel eingebrochen, in dem Moment, als man Nord- und Südstrecke miteinander verband, und hatte die U-Bahn bis zum Potsdamer Platz überschwemmt. Ein neuer Wall war errichtet worden, um das Wasser aufzuhalten.
Der Mann stieg über Eisenbleche, Sandsäcke und Schaufeln. Er sah sich aufmerksam um, bevor er in den Schatten eines Bauwagens trat.
Ein zweiter Mann tauchte auf, klein, schmächtig, mit Drahtbrille. Der Zylinder auf seinem Kopf schimmerte im Sternenlicht. Der Mann trug einen feinen Gehrock und fluchte bei jedem Schritt. Seine Schuhe sanken im Schlamm ein. Verzweifelt sah er sich um.
»Guten Abend«, ertönte hinter ihm eine Stimme. Aus dem Schatten des Bauwagens löste sich eine Gestalt mit schwarzen Handschuhen.
»Musste es sein, dass wir uns auf dieser morastigen Baustelle treffen?«
»Durchaus.«
»Wer sind Sie, und warum wollten Sie mir am Telephon nicht Ihre Identität enthüllen?«
»Haben Sie den Artikel?«
Der kleine Mann kniff unwillig die Augen zusammen. Schließlich nahm er seine Tasche vor die Brust und zog einen Papierbogen heraus.
»In der Redaktion der Berliner Zeitung weiß man noch nichts von Ihren Recherchen?«, fragte der andere.
»Bisher nicht.«
»Geben Sie mir den Text.« Der Große streckte die Hand nach dem Papier aus.
Der Mann mit dem Seidenzylinder schüttelte den Kopf. »Erst will ich ein paar Antworten. Wieso sind Sie bereit, dreißig Mark für einen einfachen Artikel zu bezahlen? Und was stellen Sie damit an? Von welcher Redaktion sind Sie geschickt?«
»Das sage ich Ihnen, wenn ich den Artikel gesehen habe.«
Widerwillig reichte ihm der Journalist das Papier, und der Große zog eine Taschenlampe hervor, ein Ding aus Blech, das er mit einem Drehschalter entzündete. Er richtete den Lichtkegel auf das Blatt. Im Widerschein, der vom Papier ins Gesicht des Mannes fiel, traten feine Gesichtszüge hervor, das Antlitz eines Dandys, nur die Lippen waren blass und streng.
Deutsche Firmen statten größtes Dampfschiff der Welt aus
Die Innenausstattung der Titanic ist nahezu abgeschlossen. Britische Nationalisten überschlagen sich vor Stolz, aber ein Reporter der Berliner Zeitung enthüllt: Bevor der weltgrößte Dampfer am Mittwoch nächster Woche zu seiner Jungfernfahrt aufbricht, liefern deutsche Firmen Teile der luxuriösen Ausstattung. So stammen die Sportgeräte für den Gymnastikraum von der Firma Rossel, Schwarz & Co. AG aus Wiesbaden. Steinway’s Pianofortefabrik in Hamburg liefert fünf Flügel, jeweils 2,11 Meter lang, und drei Konzertklaviere für die Speisesäle und das Treppenhaus der ersten Klasse. Selbst bei ihrem Prestigeobjekt kommen die Engländer nicht ohne deutsche Hilfe aus.
Schon im Mai, gute vier Wochen nach der Titanic, läuft das deutsche Schiff Imperator vom Stapel. Spätestens in einem Jahr wird sein Innenausbau abgeschlossen sein. Dann löst es die Titanic als größten Dampfer der Welt ab. Der deutsche Flottenbau triumphiert.
Der Mann hob die Taschenlampe und blendete sein Gegenüber. »Haben Sie eine Abschrift Ihres Entwurfes zu Hause?«
Der Gefragte hielt sich den Unterarm vor die Augen. »Nehmen Sie die Lampe runter!«
»Haben Sie, oder haben Sie nicht?«
»Nein.«
Er schaltete die Taschenlampe aus. Ruhig zog er die Pistole aus dem Halfter. »Knien Sie sich hin.« Er richtete die Pistolenmündung auf den Journalisten.
»Sind Sie übergeschnappt?«
»Ich sagte: Knien Sie sich hin.«
Der Journalist ging in die Knie. Seine blassgestreifte Hose versank im Morast, an der Bügelfalte gluckerte schmutziges Wasser herauf. »Nehmen Sie den Artikel, nehmen Sie ihn einfach …«
Der Mann mit den dunklen Handschuhen setzte ihm die Mündung an die Schläfe und drückte ab. Es krachte. Vom Schuss wurde der Körper des Journalisten hingeworfen, in den Schlamm gestreckt. Sein Mörder drückte ihm die P08 in die rechte Hand und bog die Finger des Toten um den Griff der Waffe.
Er steckte sich den Artikel in die Jackentasche und ging.
*
Die Schiffswand riss. Wassermassen strömten hinein und spülten Matheus aus seinem Bett, das Meer packte ihn und zog ihn durch den Spalt hinaus in die Schwärze. Er sah das Schiff, es hing schief im Wasser. Ihn aber saugte das Meer gierig in die Tiefe, bald war der Schiffsrumpf nur noch ein entfernter heller Punkt, und um ihn herum herrschte Dunkelheit. Obwohl er verzweifelt versuchte, die Lippen geschlossen zu halten, drang das Salzwasser in seinen Mund ein, es jagte die Gurgel hinab und füllte die Lungen bis in den letzten Winkel mit Kälte. Er hielt es nicht mehr aus, er musste nach Luft schnappen. Da war keine Luft, nur das Meer, und während er zu atmen versuchte, drang es noch tiefer in ihn ein. Seine Glieder zuckten. Er wollte schreien und konnte es nicht, er wollte schwimmen, nach oben entkommen, er ruderte und strampelte. Anstatt aufwärts zu gelangen, sank er immer tiefer hinab.
Matheus riss die Augen auf. Er japste nach Luft, richtete sich im Bett auf. Nur ein Traum, es war nur ein Traum gewesen. Das Nachthemd klebte an seiner Haut, nass vom Meerwasser. Nein, es war durchgeschwitzt.
Cäcilie richtete sich ebenfalls im Bett auf. »Geht es dir nicht gut?«, fragte sie. »Hast du Fieber?«
»Ich hatte einen Albtraum. Ich bin ertrunken.«
»Das ist jetzt sechs Jahre her. Und du warst nicht mal im Wasser, ihr seid doch rechtzeitig gerettet worden von eurem Mittelmeerdampfer.«
Er ließ sich wieder auf den Rücken sinken. »Wir mussten die Schwimmwesten anziehen. Diese Angst kann ich nicht vergessen, die Angst zu ertrinken.«
»Euer Schiff war bloß leckgeschlagen. Ich fasse es nicht, dass du das dauernd aufbringst.«
Er schloss die Augen und sah das Wasser vor sich, eine dunkle, wogende Masse.
»Warum hast du solche Angst vor dem Tod?«, fragte Cäcilie und legte sich wieder hin. »Du glaubst an die Ewigkeit, du vertraust darauf, dass Gott dir eine Wohnung im Himmel geben wird, oder etwa nicht? Du bist Pastor, Matheus. Du bringst den Leuten bei, dass das irdische Leben nur die Theaterprobe ist.«
Das stimmte. Aber anstatt sich auf das ewige Leben zu freuen, fürchtete er sich davor zu sterben.
Er lag da und starrte in die Dunkelheit. Er hörte auf seine Atemzüge. Erstaunlich, dass da ein Herz in seiner Brust schlug, ein Muskel, der jahrzehntelang unermüdlich Blut durch die Adern pumpte. Tagsüber fütterte man den Körper mit Sardellenbrötchen, Schokolade oder Klößen, und der Körper machte daraus Hautzellen, Fingernägel, Knochen und Fleisch. Was für ein seltsamer Prozess! Wie konnte aus Schokolade lebendiges Fleisch werden?
Er wartete lange, um sicherzugehen, dass Cäcilie eingeschlafen war. Dann richtete er sich auf, tastete mit den Füßen nach den Pantoffeln, schlüpfte hinein und schlich durch den Flur ins Arbeitszimmer. Der kleine Ofen hatte den Raum überheizt. Stickige warme Luft legte sich auf seine Wangen, sie roch nach den Ledereinbänden seiner Bücher.
Durch das Fenster fiel Licht der elektrischen Straßenlaterne und färbte die Wände blau. Er kniete sich vor den Schreibtisch, sah noch einmal zur Tür und überzeugte sich, dass Cäcilie ihm nicht gefolgt war. Er zog die dritte Schublade auf. Unter einem Folioheft fischte er das Telegramm hervor. Er hielt es in den blauen Lichtschein.
telegraphie des deutschen reichsamt charlottenburg 1telegramm aus chicago
Der Text darunter war in Englisch verfasst. Das Moody Bible Institute lud ihn nach Amerika ein, die Überfahrt werde bezahlt. Thank you for your inquiry, stand da. Den ganzen Tag, seit der Postbote da gewesen war, hatte er sich darüber gewundert. Er hatte sich dieser christlichen Vereinigung aus Chicago nie angeboten.
Die Fahrt über das Mittelmeer vor sechs Jahren sollte seine letzte Schiffsreise gewesen sein, das hatte er sich geschworen, als der leckgeschlagene Dampfer mit Schlagseite in den stürmischen Wellen hing und ihm der Rettungsgurt den Leib abschnürte. Schon der bloße Gedanke an ein Schiff ließ kalte Wogen an seinen Beinen herauflecken.
Im Flur ging das Licht an. Rasch legte er das Telegramm ins Schubfach und stand auf. Cäcilie erschien im Nachthemd an der Tür. »Was machst du da?«
Der Schreibtisch stand zwischen ihnen, sie konnte die Schubladen nicht sehen. Vielleicht hatte sie nichts bemerkt. Vorsichtig schob er mit dem Bein die Lade zu, während er nahe an den Schreibtisch herantrat. Er machte ein gequältes Gesicht. »Die Beerdigung am Donnerstag geht mir nicht aus dem Kopf. Was soll ich den Angehörigen sagen? Das Mädchen war erst sechzehn! Ich begreife ja selber nicht, wie Gott das zulassen konnte.« Er nahm den Predigtentwurf vom Schreibtisch und hob ihn hoch. »Ich schreibe fünf Sachen hin, und vier davon streiche ich wieder durch.«
»Komm, leg dich ins Bett«, sagte sie. »Es wird nicht besser, wenn du im Halbschlaf darüber brütest.«
2
Nele kauerte sich nieder und legte ihre flache Hand auf den Bühnenboden. Er roch nach Holz und »Vim«-Putzmittel, eine Mischung, die seltsamerweise ihren Appetit anregte: Hineinbeißen müsste man, in diese Bühne hineinbeißen! Eine Staubflocke flog über das Parkett. Nele fing sie auf. Natürlich, es war Dreck, aber der Dreck flüsterte von Weltruhm. Unter den fünfzig Berliner Varietés rangierte der Wintergarten ganz vorn. Hier gastierten Stars wie der Meisterhumorist Otto Reutter oder der Entfesselungskünstler Houdini.
Noch war der berühmte Sternenhimmel nicht entzündet. Die Vorbereitungen für den Abend liefen auf Hochtouren. Nele stieg von der Bühne hinunter und spazierte an ihren ehemaligen Kollegen vorbei, die Kisten mit Champagner und Wein aus dem Keller herbeischleppten und das Buffet aufbauten. »Braucht ihr Hilfe?«, fragte sie und fegte Krümel von der Tischdecke.
»Wir schaffen das schon«, sagte der Koch.
Hinter ihr raunte Peto: »Unsere Künstlerin hält sich für was Besseres«, und kniff sie in die Seite.
Nele sprang dem Koch in die Arme und lachte.
»Alles Gute für nachher«, sagte Peto. Sein aufgedunsenes Gesicht strahlte Wärme aus. »Wir sind stolz auf dich, Nele. Vergiss uns nicht, wenn du berühmt geworden bist, ja?«
»Erst mal muss heute der Auftritt gelingen.« Sie ging zu den Trampolinartisten, die in Bademänteln ihr Gerät überprüften, elf Schritte machte sie, und bei diesen elf Schritten verlor sie alles, was sie an fröhlicher Selbstsicherheit besessen hatte. Das war nicht mehr Bedienungspersonal – hier begann das Reich der Artisten und Künstler. Als Eindringling kam sie und behauptete, von nun an dazuzugehören. »Ich wünschte, ich könnte fliegen so wie ihr.«
Erich, der Ältere, sah sie an. »Nele, du kannst auch fliegen. Auf eine andere Art als wir, aber du fliegst. Lass dich nicht von Senta einschüchtern.«
»Manchmal frage ich mich –«
»Da kommt sie«, sagte der jüngere Artistenbruder. »Passt auf, was ihr redet.«
Falls Senta etwas gehört haben sollte, so ließ sie es sich nicht anmerken. Sie warf ihre schwarz gelockten Haare zurück und legte den Kopf schief wie ein kleines Mädchen, während sie die Hand nach Nele ausstreckte. »Komm noch mal kurz, ich habe ein paar Ratschläge für dich für heute Abend.«
Erich sah Nele eindringlich an.
Hab schon kapiert, dachte sie, ich soll nicht mitgehen. Sie blinzelte ihm verschwörerisch zu und ließ sich von Senta fortziehen.
»Wie fühlst du dich, wenn du an den Auftritt denkst?«, fragte Senta.
»Gut.«
»Vor Publikum ist es etwas anderes als in den Proben. Im ersten Moment wirst du dich an nichts erinnern. Ein furchtbarer Augenblick …«
»Bisher war’s nie so.«
»Doch nicht bei deiner Kaninchennummer.« Senta schnaubte verächtlich. »Da ging es um die Kaninchen und den Zauberer. Du warst bloß Gehilfin. Nachher bist du allein auf der Bühne, ist dir das bewusst?«
Sie versucht, mir Angst zu machen, dachte Nele. »Was rätst du mir?«
»Irgendwann fällt dir der Tanz wieder ein, das kommt schon. Hoffen wir, dass der schreckliche Moment nicht zu lange anhält.«
Wie dreist von ihr. Kein Wunder, dass sie Wert darauf gelegt hatte, allein mit ihr zu sprechen.
»Weißt du, Nele, was mir Sorgen macht? Du bist keine Künstlerin. Schon wie du läufst! Halt die Schultern gerade, bleib geschmeidig in der Hüfte! So geht das nicht. Dazu dieser bäurische Blick! Dein Körper spielt nicht. Tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber als Künstlerin muss man Selbstbewusstsein haben. Eine Ausstrahlung, eine Faszination. Die kann man sich nicht durch Tanzunterricht aneignen. Du wirst es schwer haben.«
Nele wand sich aus ihrem Arm. »Das ist unverschämt, wie du hier mit mir redest.«
»Du tanzt ja ganz passabel«, sagte Senta, »das bestreite ich nicht. Was man einüben kann, hast du eingeübt. Ich will nur nicht, dass du enttäuscht bist nach dem Auftritt heute. Als erfahrene Tänzerin muss ich dir das sagen. Ich glaube nicht an deinen Erfolg.«
Wieder stach sie zu mit ihrem vergifteten Messer. Unwillkürlich fragte Nele sich: Was, wenn sie recht hat?
»Direktor Hundrich glaubt auch nicht, dass du besonders gut ankommen wirst«, setzte Senta nach.
»Unsinn! Er glaubt an mich, sonst hätte er mich nicht ins Programm genommen.«
»Schätzchen, was bezahlt er dir? An deinem Lohn kannst du schon sehen, dass er kaum mit einem Durchbruch rechnet. Aber spinn dich ruhig in deine Träume ein und bau weiter an deinen Luftschlössern!«
Nele blieb stehen. »Du versuchst mir Angst einzujagen, damit ich heute Abend versage«, zischte sie. »Dabei bist du es, die sich fürchtet, sonst wäre ich dir doch egal! Du zitterst, dass ich besser werden könnte als du.«
Senta lachte. Ihr ganzer Körper bäumte sich auf in diesem Lachen. »Besser als ich? Meine Liebe, da habe ich keine Befürchtungen.« Sie wischte sich Tränen aus den Augenwinkeln. »Ich mag es nur nicht, dass du mit deiner Stümperei ein schlechtes Licht auf den Solotanz wirfst. Er ist etwas Majestätisches, verstehst du? Aber nein, das verstehst du nicht. Ich muss zur Garderobe. Hals und Beinbruch, Nele.«
Im vorderen Teil der Bühne stellten sich Dutzende von Frauen in knappen Kostümen auf. Auf ein Zeichen des Direktors hin erscholl Musik. Licht flammte auf. Die Frauen kamen in wiegenden Schritten die Showtreppe hinunter, juchzten und präsentierten zum Cancan ihre zartbestrumpften Schenkel. Die Bewegungen der Tänzerinnen wurden rasender, ihre Wangen glühten.
Wie betäubt stand Nele davor und starrte auf die Bühne.
Der Direktor klatschte in die Hände. »Gut so«, rief er, »das genügt.« Er winkte den Frauen, sie sollten die Bühne verlassen. Dann wandte er sich Nele zu. »Das ist deine große Chance heute, Mädchen. Gib alles. Feg die Männer von den Stühlen.«
Sie nickte.
»Das ist noch nicht das Kostüm, oder?«
»Doch.« Das Kleid mit Rüschen, Federn und Pailletten hatte sie erst Montag gekauft. Mutter und sie würden sich deswegen einen Monat lang von Kartoffeln ernähren müssen. Auch den Tanzunterricht zahlte sie ja noch ab; bei der alten Meisterin Irene Sanden, die ihr das Tanzen beibrachte, war sie sechs Monate im Rückstand.
»Hast du nicht gesagt, es ist aus Seide?«
Seide war zu teuer gewesen. »Ich konnte leider nicht –«
»Zu spät, wir sind mitten im Schnelldurchlauf. Du bist dran. Du hast fünf Minuten.«
Nele stieg die seitliche Treppe hinauf. Heute Abend gehörte ihr für die Dauer eines Boleros die wichtigste Bühne Berlins. Jedes der Cancan-Mädchen würde sterben für eine solche Chance.
Sie musste nicht gleich so erfolgreich sein wie Senta und auf Tourneen durch Europa und Amerika reisen. Im Wintergarten wechselte alle vierzehn Tage das Programm. Wenn sie es schaffte, zwei Wochen lang das Publikum zu begeistern, konnte sie sich bereits einen Namen als Tänzerin machen. Eine Künstleragentur würde sie unter Vertrag nehmen und ihr weitere Auftritte verschaffen.
Direktor Hundrich gab ein Zeichen, und es erklang ihr Stück, der Bolero von Moritz Moszkowski. Sie zog die Schuhe aus. Ein Zugeständnis, das sie Hundrich hatte machen müssen, er versprach sich einiges davon, dass er sie im Programm als Barfußtänzerin bezeichnete. Der dicke Direktor hielt die Augen prüfend auf sie geheftet. Was, wenn er plötzlich der Meinung war, dass sie nicht gut genug war für seine Bühne?
Nele schloss die Augen. Sie lauschte auf die Musik, hob langsam ihr rechtes Bein in eine Arabesque, ging über zu einer Attitude, endete in einem Developpé. Sie stellte sich auf die Spitzen, ließ sich in einem Ausfallschritt nach vorne fallen, und ihre Arme kreisten in einem großen Port de bras über ihrem Kopf. Alles gelang ihr, sie war zufrieden. Sie drehte einige Châinés durch die Diagonale der Bühne, verharrte, sprang in kleinen Jetés zurück zur Mitte und drehte sich erneut. Sie blühte auf wie eine Rose. Ihre Brust und ihr schlanker Bauch hoben und senkten sich unter ihrem Atem. Noch ein Port de bras und anschließend einige Pirouetten.
Sie war gut, das merkte sie. Nicht mit Glück hatte sie das Engagement im Rahmen des Revue-Abends ergattert, sondern mit Können.
Hundrich klatschte und rief: »Deine Zeit ist um, andere müssen auch noch proben.« Abrupt erstarb die Musik. »Wo ist Franz, wo sind die Seelöwen? Und du, Nele, komm nochmal her.«
Sie richtete sich auf. Der Seelöwen-Dresseur brachte Wassereimer mit Fischen auf die Bühne. Balalaikaklänge drangen aus den hinteren Räumen, und Männergesang: Die russische Tanztruppe Samowar bereitete sich vor, deren Mitglieder Nele immer schöne Augen machten.
»Hör zu, Kind«, sagte Hundrich, kaum dass Nele von der Bühne hinuntergestiegen war, »ich habe dich als Barfußtänzerin angekündigt. Eine Ballerina brauche ich hier nicht. Deine Tanzdramaturgie ist zu kompliziert, verstehst du? Beim Varieté müssen wir mit starken Reizen arbeiten. Was du da machst, ist zu schwierig.«
»Sie haben mich doch in den Proben gesehen. Gefällt es Ihnen nicht mehr?« Dieses Zittern in ihr! Senta hatte es tatsächlich geschafft, sie zu verunsichern.
»Die Menschen wollen sich im Wintergarten amüsieren. Sie wollen Rausch, sie wollen Freude. Du musst mit deinen Reizen ihre Gier nach nackter Haut befriedigen.«
»Wie meinen Sie das?«
»Du hast alles, was ein Mädchen braucht, warum zeigst du es nicht?«
»Ich werde noch mehr üben. Und ich kann Seide anlegen, das wird den Männern gefallen.«
»Tu das. Arbeite an deinem Kostüm. Und denk daran: weniger Kunst, mehr Körper! Ich will deinen Po und deine Brust sehen.« Energisch riss er die Arme hoch und schrie in Richtung Bühne: »Wo sind die Seelöwen? Deine Zeit ist um, Franz, wir haben sechzehn Nummern heute Abend, es müssen sich noch elf andere warmmachen!«
Die Welt hinter dem Vorhang leuchtete und flimmerte nicht, sie war nüchtern. Was für die Zuschauer ein Zauber war, ein märchenhaftes Vergnügen, bedeutete für die Artisten Knochenarbeit. Das wusste Nele. In den Jahren als Gehilfin hatte sie Zeit gehabt, sich an den rauen Ton im Wintergarten zu gewöhnen, an den lüsternen Direktor, an die Ansprüche.
Heute aber tat ihr alles weh. Die Haut ihrer Seele fühlte sich wund an, durch die Anspannung war sie verletzlicher als sonst. Es war ihr großer Tag. Sie stand im Programm, zum ersten Mal war der Name Nele Stern an die Litfaßsäulen angeschlagen.
Für dich, Senta, dachte sie, werde ich besonders gut sein. Dein spöttisches Lachen wird dir im Halse stecken bleiben.
Wenn er gefragt wurde, wie Gott das Böse zulassen konnte, antwortete Matheus immer, die Menschen seien dafür selbst verantwortlich. Schließlich hatte Gott ihnen Willensfreiheit verliehen, und die wäre wertlos, wenn er nur gute Taten zuließ, die bösen aber jedes Mal verhinderte. Nur: Was konnte das Mädchen für seine Diphtherie? Welcher Mensch trug die Schuld daran? Dass Gott Kriege zuließ und Schläge und Lügen, das verstand er. Warum aber verhinderte er nicht solche ungerechten Krankheiten?
Seufzend stand er auf und streckte sich. Sein Rücken schmerzte, und der Mund war trocken. Matheus ging in die Küche, goss sich Sinalco in ein Glas und trank. Die Limonade war teuer, und während er schluckte, litt er deswegen Gewissensbisse. In seiner Kindheit hatte es Limonade nur zu besonderen Anlässen gegeben. Um sich zu beruhigen, dachte er an die Mineralsalze und Fruchtsäuren, die seinem Körper gut taten, zumindest wenn man der Reklame glaubte.
Es war still in der Wohnung. Er trat in den Flur. Hatte er Samuel nicht erst vor einer Stunde zum Spielen nach draußen geschickt? Wieso hingen Jacke und Mütze an der Garderobe? Er sah in Samuels Zimmer. Der Siebenjährige kniete an seiner Sitzbank, ein Blatt Papier vor sich, und malte.
»Setz dich doch an den Tisch«, sagte Matheus. »Das ist bequemer.«
»Ja«, sagte Samuel. Er blieb, wo er war. Sein blasses Gesicht ließ ihn oft kränklich aussehen, die Haut war beinahe durchsichtig. Samuel war ein Träumer, ein stilles Kind, das man leicht übersah. Er war so unauffällig, dass Matheus befürchtete, ihn eines Tages in einem Geschäft in der Stadt zu vergessen und erst am nächsten Tag zu bemerken, dass er fehlte. Nicht, dass er ihn nicht liebte, nein, er liebte ihn sehr! Aber der Kleine forderte nichts, er war mit allem zufrieden, was er bekam.
Matheus ging zu ihm und streichelte ihm den Kopf. »Was malst du denn?«
»Das ist der Schnee, den eine Dampflok aufwirbelt. Wenn sie im Winter fährt.«
Auf dem Blatt sah man hellblaue Wolken, die Lok dahinter war mit wenigen Bleistiftstrichen angedeutet, sie ließ sich nur erahnen. »Das Bild ist dir gut gelungen, Samuel.« Andere Kinder malten Rennautomobile, sein Sohn malte Schneeflocken. »Wollen wir spielen?«
Ungläubig sah Samuel auf.
»Ich habe ein bisschen Zeit. Wie wäre es, wenn wir Mehl aus der Küche holen und es auf den Boden schütten, und dann fahren wir mit deiner Spielzeuglok hindurch?«
»Wir spielen Winter!« Samuel sprang auf und brachte die Mehldose ins Zimmer. Vorsichtig schütteten sie Häufchen auf den Boden. Der Junge holte die Blechlokomotive aus dem Spielzeugschrank, sie sah neu aus, ihre Oberfläche war frei von Kratzern, obwohl er sie schon zu Weihnachten bekommen hatte. Er spielte kaum mit ihr. Mehr als die Autos und Loks liebte Samuel die Kartons, in die sie verpackt waren. In den Schachteln mit dem zerdrückten Seidenpapier bewahrte er Murmeln, seltene Steine und Vogelfedern auf.
»Fahr kräftig hindurch«, sagte Matheus, »warte, ich puste, dann fliegt der Schnee!«
Samuel legte das Gesicht auf den Boden, um die Lok besser sehen zu können, und schickte sie durch die Mehlhaufen. Dabei pustete Matheus so sehr, dass Samuel sich aufrichten und die Augen schließen musste, weil ihm Mehl hineingeflogen war. »Tut es weh?«, fragte Matheus besorgt.
Aber der Junge schüttelte den Kopf. Er zwinkerte einige Male, dann nahm er wieder die Lok.
Die Lok fuhr durch das ganze Zimmer. »Hier ist ein Fußgänger langgelaufen«, sagte Matheus, und drückte mit den Fingerspitzen feine Spuren in das Mehl.
»Und hier ist einer mit dem Fahrrad gefahren.« Samuel zog eine Linie.
Matheus griff noch mal in die Dose und streute eine Handvoll Mehl aus. »Jetzt schneit es die Spuren zu.«
»Wind kommt auf!«, rief Samuel und blies das Mehl über den Boden.
Sie lachten laut. Ihre Kleider waren weiß bestäubt.
Cäcilie erschien in der Tür und riss die Augen auf. »Ihr habt das ganze Mehl verschüttet!«
»Nur einen Teil«, sagte Matheus.
»Für solchen Unfug hast du Zeit! Und wenn ich dich mal brauche …«
»Ich spiele mit unserem Sohn.«
»Das kann ich sehen. Fragt sich nur, wer von euch das größere Kind ist. Seht zu, wie ihr das wieder sauber kriegt!« Sie warf die Tür mit lautem Knall zu.
Matheus sah Samuel an, der schaute zurück. Sie zuckten beide mit den Schultern. »Das war es wert«, sagte Matheus und grinste.
»Ich hole Kehrschaufel und Besen, Papa.«
Rasch war Samuel mit dem Versprochenen zurück, und sie fegten das Mehl auf. Etliches blieb in den Ritzen zwischen den Dielen hängen.
»Ich glaube, hier müssen wir nass wischen.«
»Nein, Papa, mich stört’s nicht.«
»Sicher.« Er lachte. »Aber ich kenne jemanden, den es stört.«
Cäcilie kam herein und fragte: »Gab es Post?«
»Nein, nichts.«
Sie zog hinter ihrem Rücken das Telegramm hervor: »Und was ist das hier? Warum lügst du mich an?«
Matheus schwieg. Eine Ader pochte an seinem Hals.
»Ich ertrage das nicht länger«, fauchte sie, »deine ständigen Schwindeleien!«
Er stand auf. »Mir bleibt ja nichts anderes übrig, als zu lügen. Du behandelst mich wie einen Verbrecher. Denkst du, das macht mir Spaß? Wieso schnüffelst du mir nach und durchsuchst den Schreibtisch?«
»Ach, jetzt bin ich es, ja, ich verstehe, ich bin schuld.« Sie funkelte ihn böse an.
»Es ist doch nichts passiert. Ich habe bloß ein Telegramm in die Schublade gelegt.«
Sie hielt es anklagend hoch. »Hältst du mich für dumm? Was bezweckst du damit, die Post vor mir zu verstecken?«
»Ich wusste, dass du ein Fass aufmachen würdest.«
»Das heißt, du willst die Einladung der Amerikaner ablehnen. Hinter meinem Rücken, weil du dich nicht traust, es mir zu sagen.«
»Wundert dich das?«
Der Zettel in Cäcilies Hand zitterte. Tränen sammelten sich in ihren Augen. »Ist es denn zu viel verlangt«, fragte sie leise, »dass du ehrlich zu mir bist und ab und an Zeit für mich hast?«
Er nahm einen tiefen Atemzug. »Nein«, sagte er. »Nein, ist es nicht.« Er trat auf sie zu und nahm sie in die Arme. »Cäcilie, verzeih.« Jetzt wirkte sie auf ihn so dünn, so schutzbedürftig. Ein Rest Zorn war noch in ihm, aber er verflog angesichts ihrer Schwäche.
»Mir tut es auch leid. Ich will nicht mit dir streiten.« Sie löste sich aus seiner Umarmung und gab ihm einen Kuss auf die Wange. Dann wandte sie sich an ihren Sohn, der die ganze Zeit reglos dagestanden hatte. »Ach, Samuel, jetzt schau nicht so ernst. Wir vertragen uns ja schon wieder. Hast du Hunger?«
Der Kleine nickte.
»Komm, wir zwei decken den Tisch.« Sie nahm den Jungen mit hinaus.
Wenig später riefen sie zum Abendessen. Matheus wusch sich die Hände, bis sich durch das Schrubben die Haut rot färbte. Seit er von Bakterien gelesen hatte, war es ihm wichtig, dass keine an seinen Händen klebten, wenn er aß. Die Biester übertrugen schreckliche Krankheiten.
Unter den Nägeln putzte er mit einer Bürste den Schmutz weg. Bald schimmerten sie milchweiß auf den geröteten Fingerkuppen. Auch die Fingerzwischenräume seifte er ein und spülte sie unter dem Wasserstrahl aus.
»Habt ihr euch gründlich die Hände gewaschen?«, fragte er, als er sich an den Tisch setzte. Er wartete, bis beide bejaht hatten, und sah Samuel noch einmal streng an.
Der Junge hob seine Hände in die Höhe. »Kannst nachgucken!«
Matheus sprach das Gebet. Seine Hände brannten vom kräftigen Waschen. Er nahm Butter auf die Messerspitze und strich sie auf ein Brot. »Ist das nicht«, er zeigte mit dem Messer darauf, »dieser teure französische Käse?«
»Genieße ihn, wenn wir ihn schon einmal haben.«
»Du hast Geld von deinem Vater angenommen«, sagte er.
»Nein, habe ich nicht.«
Seit er sich damals in sie verliebt hatte, fürchtete er, ihren Ansprüchen nicht zu genügen. Wie könnte er auch! Cäcilie war die Tochter des kaiserlichen Schatullenverwalters Ludwig Delbrück. Ihr Vater war Mitinhaber des Bankhauses Delbrück, Schickler & Co., er saß im Aktionärsausschuss der Bank des Berliner Kassenvereins und in zahlreichen Aufsichtsräten, unter anderem bei der Friedrich Krupp Ag – als Einziger, der nicht der Familie Krupp angehörte. Niemals konnte er, Matheus Singvogel, einfacher Baptistenpastor, dieser Frau ein Leben bieten, wie sie es von zu Hause kannte, mit Köchin, Dienstmädchen, Mercedes und Chauffeur, ganz abgesehen von Kleidern und gutem Essen.
»Mach dir nicht so viele Gedanken, Matheus.« Cäcilie legte ihm die Hand auf den Arm.
Samuel sagte kleinlaut: »Mir schmeckt der Käse nicht.«
»Du weißt einfach nicht, was gut ist.« Cäcilie seufzte. »Gib mir dein Brot. Du kannst dir ein neues machen.«
Matheus sah sich im Zimmer um und fragte sich zum hundertsten Mal, ob die Einrichtung nicht auf Cäcilie schäbig wirken musste: die quastenbesetzten Sessel, die Dattelpalme im großen Kübel, die gemusterte Tapete, die Kommode mit den drei Schubladen, Nussbaum furniert, wobei die mittlere Schublade bereits zerkratzt und angestoßen war. Sicher hatte Cäcilie sich ihr Leben anders vorgestellt.
»Das Telegramm geht mir nicht aus dem Kopf«, sagte sie. »Wir könnten kostenlos nach Amerika reisen!«
»Sie zahlen die Überfahrt«, sagte er. »Und dann? Wie kommen wir nach Chicago? Wo übernachten wir unterwegs? So eine Reise verschlingt Unsummen.«
»Denk an Samuel. Du kannst mit deinem Sohn nicht bloß Ausflüge in die brandenburgischen Kiefernwälder machen. Er muss auch mal etwas erleben.«
»Mir gefällt es hier gut«, beteuerte Samuel.
Cäcilie streichelte seinen Arm. »Wir streiten nicht, Liebling, hab keine Angst.« Sie wandte sich wieder Matheus zu. »Den tristen Alltag haben wir immer, und jetzt, wo sich uns eine Gelegenheit für ein Abenteuer bietet, willst du kneifen.«
»Ich kneife nicht. Ich habe eine Entscheidung getroffen, das ist alles.«
»Willst du nicht auch mal allem hier die lange Nase zeigen? Die Frauen fangen den Frühjahrsputz an, sie klopfen um die Wette ihre Teppiche, und gucken, wessen Wäscheleinen am schwersten behangen sind. Nur wir reisen fort und machen da nicht mit. Das wäre es doch!« Ihre Augen leuchteten. »Matheus, es gibt da ein neues Schiff, die Titanic. Das größte bewegliche Ding, das die Menschheit je gebaut hat, ein Hotel, das über das Meer fährt. Eine Reise auf diesem Schiff, das wäre traumhaft.«
Es klingelte an der Tür. Noch während er aufstand, verlangte Cäcilie von ihm, sich endlich einmal zu verweigern. »Für die anderen arbeitest du, ohne Geld zu verlangen«, sagte sie, »du verschenkst deine Arbeitskraft, und deine Familie? Sag Nein, egal, was sie von dir wollen!«
Als er öffnete, stand die Nachbarin im Treppenflur, im Kittelkleid, und sah ihn mit flehentlichem Blick an: »Herr Singvogel, meine Mutter dreht durch.«
»Ich bin gleich bei Ihnen.«
Sie ergriff seine Hand. »Ich danke Ihnen.« Ihre Finger waren weich und geschwollen, sie hatte vermutlich Wäsche gewaschen.
Kaum hatte er die Tür geschlossen, vernahm er auch schon Cäcilies vorwurfsvolle Stimme: »Habe ich gehört: Nein, ich habe keine Zeit?«
»Ich würde mich gern ausruhen«, sagte er, »ich bin müde. Aber ich kann der Nachbarin doch nicht sagen, dass sie die Sache mit ihrer Mutter allein bewältigen soll.«
»Du bist feige!« Cäcilie erschien in der Küchentür. Ihre Nasenflügel wölbten sich. »Du traust dich nicht, Nein zu sagen, weil du Angst hast, dass die Leute dich dann weniger lieben.«
»Das stimmt nicht.«
»O doch. Du hast Angst, dass sie nicht mehr das Idealbild ihres hoch geschätzten Pastors anbeten.«
Er schlüpfte aus den Pantoffeln und zog sich Straßenschuhe an. Seine alten Pantoffeln – Cäcilie hasste sie – hatten zwei Löcher vorn bei den Zehen, und waren keinesfalls für einen seelsorgerlichen Besuch bei der Nachbarin geeignet. »Ich bin gleich wieder da«, sagte er und verließ die Wohnung.
Im Treppenhaus war es kalt. Er schaltete das elektrische Licht ein. Dann drehte er den kleinen Griff der Klingel und ließ sie schrillen. »Ich bin es«, sagte er.
Die Nachbarin öffnete. »Kommen Sie herein.«
Er kannte die Wohnung bereits von mehreren Besuchen. Überall standen Figuren aus Porzellan herum, eine Büste von Beethoven, kleine Hunde, Gänse, der Kaiser, eine Schäferin. Nur der lackierte Tisch im Wohnzimmer war frei davon und die Konsole mit Spiegel, deren Seitenflügel aus geschliffenem Glas im Licht der Stehlampe glitzerten. Es roch nach Kohlsuppe und Urin.
»Frau Bodewell, was machen Sie für Sachen?« Matheus trat auf die Alte zu, die sich hinterm Sofa verkrochen hatte.
»Französische Soldaten«, erwiderte sie und riss die Augen auf. »Die wollen uns erschießen.«
Also ging es wieder um den Deutsch-Französischen Krieg. Sie war 1870 dabei gewesen, war dem Heer mit der Verwundetenpflege nach Frankreich gefolgt und hatte dafür sogar das preußische Verdienstkreuz für Frauen erhalten – aber was nützte ein schwarz emailliertes Kreuz am weißen Band, wenn man die Schreie der Sterbenden nicht vergessen konnte.
»Wir haben doch gewonnen in Sedan«, sagte er.
»Sie rächen sich. Mein Walter hat so viele von ihnen auf dem Gewissen. Sie wollen es uns heimzahlen.« Die Alte machte schauerliche Laute mit hohem Stimmchen, und sie begann, am ganzen Leib zu zittern.
»Im Ernst?« Er kroch ebenfalls hinter das Sofa, woraufhin ihm die Nachbarin einen verwirrten Blick zuwarf. Aber darum kümmerte er sich nicht, er kauerte sich nieder, spähte über die Sofakante und flüsterte: »Ja, da kommen sie, verstecken Sie sich, rasch!«
Behände ging die Alte in die Knie und duckte sich hinter die Sofalehne.
Matheus meldete: »Sie sehen uns nicht! Sie marschieren vorüber.« Er wartete, während neben ihm die Alte wimmerte. »Ja«, sagte er, »sie gehen vorbei. Jetzt sind sie verschwunden.« Er atmete laut hörbar auf.
Mutter Bodewell erhob sich und sah sich um. Ungestüm fiel sie ihm um den Hals. »Danke, Sie haben uns gerettet, Pastor Singvogel!« Sie juchzte laut. Speicheltropfen benetzten sein Ohr.
Er klopfte ihr auf den Rücken.
Als er in seine Wohnung zurückkehrte, räumte Cäcilie bereits den Tisch ab. Sie tat es mit fahrigen, zornigen Bewegungen.
»Ich war noch nicht fertig mit dem Essen«, sagte er.
»Wir schon.«
»Cäcilie, wie lange war ich fort, fünf Minuten? Mach deswegen nicht einen solchen Aufstand, hörst du?«
Sie räumte weiter den Tisch leer. »Das war unser Familienabendbrot. Du hast eine Frau und einen Sohn, auch wenn du das dauernd vergisst.«
3
Die vier Seelöwen schwammen zum Beckenrand, hoben die Köpfe aus dem Wasser und sahen ihrem Meister aus großen, dunklen Kinderaugen hinterher. Ihre Schnurrhaare tropften. Die glatten Leiber glänzten wie Onyx.
»Kannst du kurz auf meine Jungs aufpassen, Nele?«, fragte der Seelöwendresseur.
»Aber beeile dich, ich bin gleich dran! Hören sie denn überhaupt auf mich?«
Franz’ Schnauzbart zog sich in die Breite. »Du musst sie nicht durch den Reifen springen lassen. Hab einfach ein Auge auf sie, ja?«
Dumm wäre es, dachte Nele, wenn sie die Glocke läuten. Das würde im großen Saal zu hören sein. Neben dem Becken lag alles für den Auftritt bereit: der Springreifen, kleine Bälle, eine Puppe. Neu war die Glocke, die am hölzernen Pfosten hing, erst kürzlich hatten die Seelöwen gelernt, sich auf Kommando aus dem Wasser zu recken und sie zu läuten. Seitdem gab es noch mehr Gelächter im Publikum, wenn sie ihren Auftritt hatten.
Nele streichelte die nassen Köpfe. »Er ist gleich wieder da. Ihr habt Hunger, nicht wahr?«
Einer der Seelöwen tauchte ab, die anderen drei drängelten sich unter ihre Hand. Schnurrhaare kitzelten Neles Finger.
»Bestimmt macht ihr es gut heute Abend. Wisst ihr was? Ich trete auch auf. Nicht mehr mit den Kaninchen, sondern allein, und ich tanze! Unglaublich, oder?«
Die Köpfe der Seelöwen ruckten hoch.
»Bei Nele seid ihr brav, das wusste ich.« Der Dresseur kehrte zurück.
»Sie sind klug, nicht wahr?«, fragte sie. »So klug wie Hunde?«
»Schlauer! In der Freiheit tricksen sie sogar die Möwen aus. Wenn sie eine sehen, tauchen sie tief ins Wasser und erscheinen vorsichtig an anderer Stelle wieder. Aber sie tauchen nicht richtig auf, sie stecken bloß die Nasenspitze aus dem Wasser und bringen es in Bewegung. Die Möwe denkt, einen leckeren Fisch vor sich zu haben, stürzt sich darauf und wird gefressen.«
Neles Hand zuckte zurück. »Ihr seid mir welche!« An die scharfen Zähne der Seelöwen hatte sie nicht mehr gedacht. »Ich trockne mir rasch die Hände ab«, sagte sie, und umarmte Franz noch einmal. »Viel Glück.«
»Dir vor allem, Mädchen! Dein erster Abend … Meine Jungs und ich jubeln dir von hier hinten zu.«
»Wenigstens ihr.«
Er sah sie an. »Macht Senta dir das Leben schwer?«
»Allerdings. Aber die meinte ich nicht. Meine Mutter kriegen keine zehn Pferde in den Wintergarten. Und Irene Sanden liegt mit Fieber im Krankenhaus.«
»Deine Tanzlehrerin? Sei froh. Meistens gibt es nach der Premiere noch etwas zu verbessern. Ist von Vorteil für dich, wenn sie einen späteren Auftritt sieht. Sie wird hin und weg sein!«
»Ach, Franz.« Nele umarmte ihn noch einmal. Er war eine Art Vater für sie geworden im Varieté, ein gütiger Mann, weder von verbissenem Ehrgeiz getrieben wie die meisten der anderen Künstler noch verlogen wie das Management.
»Du hast es dir hart erarbeitet.« Er hielt sie vor sich, als wollte er Nele noch einmal begutachten, bevor sie in die Schlacht hinauszog.
»Das kannst du laut sagen!« Sie lachte, und er ließ sie los. »Im schweren Handwagen habe ich Kästen mit Zinnsoldaten aus der Fabrik geholt und den ganzen Tag Soldaten und Pferde bemalt, und das beim ätzenden Gestank der Farbe. Überall in der Wohnung haben die Figuren zum Trocknen gestanden, auf jedem Stuhl, auf jedem Fensterbrett. Und nach dem Tanzunterricht habe ich die Armee sortiert, spät nachts, und in Kartons eingenäht. Jeden Pfennig meines Lohns habe ich für den Tanzunterricht ausgegeben.«
»Deswegen hat’s hier immer so gestunken! Aber im Ernst: Heute bekommst du den Lohn für deine Mühe, Nele.«
Der Abend im Berliner Wintergarten war lang: Um acht Uhr hatte er begonnen, und er würde bis Mitternacht andauern, mit zwei kurzen Pausen von jeweils zehn Minuten. Hinter dem Seelöwenbecken jonglierte Bruno mit Zylinderhüten, sein Gesicht verriet angestrengte Konzentration. Auf der anderen Seite dehnte sich der Schlangenmensch und machte sich warm für den Auftritt.
Niemand wagte, Otto Reutter anzusprechen, der bereits im Frack vor dem Spiegel stand und seine Mimik übte. Der berühmte Sänger und Komiker war geschminkt, die Lippen leuchteten blutrot, die Augen waren schwarz umrandet.
»Nele, du bist gleich dran«, sagte der Bühnenmeister und winkte sie zum Bühnenaufgang. Franz reichte ihr ein Tuch. Hastig trocknete sie sich die Hände ab und stieg das Treppchen hinauf. Der Seitenvorhang verbarg sie noch, aber sie konnte bereits auf die Bühne sehen. Dort führte die Allison-Truppe ihre »Ikarischen Spiele auf lebenden Kissen« vor. Es wurde still im Publikum. Eine Artistin sprang aus der Hand des Kollegen ab, vollführte einen Salto in der Luft und wurde von zwei anderen Artisten, die sich Rücken auf Rücken festhielten, wieder aufgefangen. Ein bewunderndes Raunen ging durch den Saal. Dann der Schlusssprung, und der Applaus toste. Nach mehreren Verbeugungen gingen die Allisons von der Bühne.
Jetzt setzte eine neue Musik ein, und Nele trat hinaus. Das Licht der Scheinwerfer war hell, sie konnte die Zuschauer nicht erkennen, aber sie wusste, sie waren da, der Saal war gefüllt mit steifen Hemdbrüsten, Fracks und tief ausgeschnittenen Kleidern, sechs Mark fünfzig der Logenplatz, zwei Mark die reservierten Plätze an den Tischen, eine Mark das Entree. Sie, Nele Stern, stand auf der wichtigsten Varieté-Bühne Berlins. Nicht als Gehilfin bei einem Trick, auch nicht zum Kulissenräumen, sondern für ihren eigenen Soloauftritt als Tänzerin.
Noch war die Musik leise, und sie meinte, über die Töne hinweg die Menschen zu hören, ein Knistern und Flüstern und Rascheln von Stoff. Was, wenn Senta recht behielt, und ihr fiel plötzlich die Choreographie nicht mehr ein? Was, wenn sie gleich vor den Zuschauern versagte, wenn sie mit rotem Kopf von der Bühne gehen musste? Der Bolero lief, nun gab es kein Zurück mehr. Das Herz hämmerte in ihrer Brust. Nele hob die Arme, ließ ihren Kopf, dann ihren Oberkörper kreisen. Sie drehte Châinés, sprang einen Grand jeté, wechselte mit einigen Glissades zur anderen Bühnenseite, drehte sich, hielt anmutig inne … Sie fühlte die Musik und gab sie mit ihrem Körper wieder. Wie zu einem Luftkuss führte sie die Hand vom Kinn in Richtung des Publikums, neigte sich in einem Port de bras zur Seite und hob die Fußspitze bis in den Himmel. Bald hatte sie alles um sich herum vergessen, für sie gab es nur noch die Musik.
Als der Bolero endete, war sie schweißgebadet, aber glücklich. Sie verbeugte sich. Ihr war kein Fehler unterlaufen! Am liebsten hätte sie gelacht vor Freude. Gleich ihr erster Auftritt als Tänzerin war ein großer Erfolg.
Allerdings stimmte etwas mit dem Publikum nicht. Nele wartete vergebens auf den rauschenden Applaus. Schwächlich applaudierte ein Teil des Publikums, dann schickte der Bühnenmeister schon die Nächsten heraus, zwei Kunstradfahrer. Mit weichen Knien stieg Nele die Stufen hinunter. »Was ist los? Hab ich etwas falsch gemacht?«
»Hast du nicht.« Der Bühnenmeister sah sie mitleidig an.
»Aber warum klatschen sie nicht?«
»Man steckt nicht drin.« Er zuckte die Achseln. »Nele, der Direktor war gerade hier, er will dich sprechen.«
»Jetzt gleich?«
Der Bühnenmeister nickte.
Direktor Hundrich hat gesehen, dass es den Leuten nicht gefällt, dachte sie. Der Schweiß auf ihrer Haut wurde kalt, er ließ sie frösteln. Besser, ich gehe nicht sofort hin, sondern warte, bis er sich beruhigt hat.
Im Umkleideraum entledigte sie sich des glitzernden Kleidchens. Nachdem sie Bluse, Rock und Schuhe angezogen hatte, fühlte sie sich sicherer. Sie zupfte den bestickten Kragen zurecht. Sie war eine gute Tänzerin, auch wenn der erste Auftritt aus irgendeinem Grund kaum Beifall ausgelöst hatte. Morgen konnte bereits alles anders sein, dann saßen andere Zuschauer im Publikum, womöglich hatte sie heute einfach Pech gehabt, und es waren vor allem Leute gewesen, die auf das Muskelspiel der Artisten gewartet hatten oder auf die Schleuderbrettnummern oder auf Otto Reutter, den Star. Womöglich mochten die heutigen Gäste Bauchredner oder Drahtseilakte lieber, und morgen kamen die Tanzliebhaber.
Glaubst du das wirklich?, dachte sie. Mach dir nichts vor, Nele!
direktion stand an der Tür zu Hundrichs Büro. Sie durfte auf keinen Fall zaghaft klopfen, er sollte merken, dass sie ein würdiges Mitglied seiner Revue war. Aber gegen ihren Willen geriet ihr das Klopfen mädchenhaft und flüchtig.
»Herein«, dröhnte von drinnen die Stimme des Direktors.
Sie trat ein. Der Direktor saß am Besprechungstisch und rauchte eine Zigarre. Er hatte keine Papiere vor sich, offensichtlich hatte er auf Nele gewartet. Die wenigen Haare, die er noch hatte, lagen quer über der Glatze, mit Zuckerwasser geglättet. »Nele, Mädchen«, sagte er, »warum hörst du nicht auf mich?«
»Wie meinen Sie das, Herr Direktor?«
»Ich habe dir gesagt, dass dein Tanz zu kompliziert ist. Die Dramaturgie, das Kleid – da fehlen die Impulse, es fehlt die sinnliche Note.«
Ihre Kehle schnürte sich zusammen. »Morgen wird es besser, ich versprech’s Ihnen.«
»Nein, Kind. Wir setzen deine Nummer erst mal ab. Du bist ja völlig durchgefallen beim Publikum! Das können wir so nicht wiederholen.« Er paffte Rauch. »Wir müssen uns etwas Neues ausdenken. Lass dich mal sehen! Dreh dich mal!«
Sie drehte sich. Er will mich feuern, dachte sie, er setzt meine Nummer ab. Ein flaues Gefühl breitete sich in ihrem Magen aus.
»Bist ein hübsches Mädchen. Das müssen wir den Männern im Publikum zeigen. Nackte Haut kommt gut an. Meinst du nicht? Wir könnten einen Riesenerfolg haben.«
»Wenn ich mich ausziehe, kommt die Sittenpolizei.«
»Genau das wollen wir.« Hundrich klopfte Asche von der Zigarrenspitze. »Sie sollen deinen Auftritt verbieten! Die Zeitungen werden darüber schreiben, und das wird die Massen anziehen. Wir finden dann schon einen Schlupfwinkel im Gesetz, lass das mal meine Sorge sein. Natürlich darfst du dich nicht einfach nur ausziehen. Vielleicht spielst du ›Phryné erscheint nackt vor ihren Richtern‹, wie Olga Desmond. Ich mache dich groß, Kind!«
Olga Desmond hatte vor drei Jahren durch ihre unbekleideten Auftritte im Berliner Wintergarten einen so großen Skandal ausgelöst, dass darüber sogar im Preußischen Landtag debattiert worden war. Aber Nele hatte sie gesehen, sie tanzte nicht gut. Leidenschaftliche Rhythmen der Musik unterstrich sie durch Aufreißen der Augen und Vorstoßen des Unterkiefers, außerdem warf sie auf unschöne Weise die Arme herum. Den Erfolg hatte sie nur ihrer Nacktheit zu verdanken.
»Oder du gehst nackt zu Bett«, sagte der Direktor, »du musst sündhafte Assoziationen wecken, am besten lassen wir Schlangen über deine Brust kriechen, die Schlange und Eva, das versteht jeder. Du kannst dich auf der Bühne biegen und winden, und wir geben dir durchsichtige Schleier, die werden deine erotische Ausstrahlung verstärken.«
Ein bitterer Geschmack breitete sich in Neles Mund aus. »Ich will tanzen«, sagte sie.
Er zog an seiner Zigarre, die Spitze glühte auf. »Dann muss ich dich feuern. Tut mir leid.« Er sah sie an und schwieg.
Nele verspürte Atemnot. Das durfte nicht passieren. Er durfte sie nicht wegschicken. »Ich habe vier Jahre für Sie gearbeitet«, sagte sie. »Für einen Hungerlohn.«
»Nanana, werd nicht undankbar.« Er legte die Zigarre weg. »Komm mal her.«
Zögerlich trat sie näher an ihn heran.
Schon bevor sie ihn erreichte, streckte er seine Pranke aus, umfasste ihren Hintern und zog sie zu sich. »Nele, du musst dich für nichts schämen. Für gar nichts.« Er zwang sie auf seinen Schoß. »Ich war in meiner Jugendzeit in Hamburg. Dort zeigt Carl Hagenbeck im Zoo primitive Menschen. Die sind nackt, und es stört sich niemand daran. Menschen aus Finnland, Ceylon, Ostafrika, jeder will wissen, wie die unter der Kleidung aussehen, und Hagenbeck präsentiert sie den Leuten. Sie machen das nicht nur in Hamburg, da gibt es Tourneen durch ganz Europa! Du zeigst den Menschen eben, wie ein preußisches Mädchen unten drunter aussieht. Das ist Bildung.«
Nele stand auf. »Nehmen Sie Ihre Hände weg.« Sie verließ das Büro, lief den Flur entlang. Ich zerstöre meinen Lebenstraum, wenn ich jetzt gehe, dachte sie. Aber der Zorn gab ihr Kraft. Du widerlicher Raffzahn, ich hasse dich, ich hasse dich!
»Überleg’s dir!«, rief er ihr hinterher. »Wenn du dich ausziehst, kriegst du die Bühne! Ohne Bühne kannst du nicht leben, Mädchen!«
Die Allisons kamen ihr entgegen, im Bademantel. Ihre Körper dampften, und Schweiß zeichnete Bahnen in die weiße Schicht von Schminke und Puder. Senta steckte ihren Kopf aus der Tür der Garderobe. »Nele«, sagte sie, »nimm’s nicht so schwer. Du kannst doch Kellnerin werden.«
Aus dem Saal hörte man Otto Reutter. Das Mikrofon knisterte zu seinen Worten, und schon nach wenigen Phrasen folgte schallendes Gelächter des Publikums. Nahezu jeder in Deutschland kannte ihn und seine Lieder von den Grammophon-Platten. Sicher war er zu keinem Zeitpunkt seiner Karriere in der Gefahr gewesen, hinausgeworfen zu werden.
Sie holte ihr Kleid und ihre Jacke, durchquerte das Foyer. Draußen auf der Friedrichstraße wehte ihr kühle Luft ins Gesicht. Es roch nach Regen, auch wenn die Straße trocken war. Über ihr strahlte in weißen Lichtbuchstaben der Schriftzug Wintergarten.
Sie sah die Amüsiermeile mit neuen Augen, nicht mehr als jemand, der hierhergehörte, sondern als Ausgestoßene. Da war der Admiralspalast mit seinen Bädern, seiner Arena fürs Eisballett und dem Lichtspieltheater, da war die endlose Kette von Nachtlokalen, Tanzbars und Animierkneipen. Männer flanierten auf der Suche nach Gesellschaft durch die Nacht, und am Straßenrand boten sich ihnen Prostituierte an, Frauen mit Federboas, hochgeschnürtem Busen und glänzenden kleinen Taschen. Bin ich einfach zu prüde?, fragte Nele sich. Verbaue ich mir mit meinen Hemmungen den Weg als Künstlerin?
Diese Mädchen gehörten Zuhältern und waren in die Halbwelt abgerutscht, zu den Kokainhändlern, Opiumsüchtigen, Auftragsmördern. Von ihr, Nele, verlangte man doch nur, dass sie sich auszog.
Natürlich, sagte eine spöttische Stimme in ihr, du findest immer jemanden, dem es schlechter geht. Hundrich hat dich reingelegt! Er wollte von Anfang an, dass du nackt auf der Bühne tanzt, damit er Geld scheffeln kann. Die Zeitungen sollen über dich schreiben, auf der Straße sollen dir die Männer hinterherpfeifen, und die Mütter sollen die Straßenseite wechseln, wenn sie dir mit ihren Kindern begegnen.
Aber so unwürdig wollte sie sich nicht verkaufen. Sie dachte an die Zinnsoldaten, die zu Hause warteten, und an den Gestank der Farbe. Ihrer Mutter hatte sie versprochen, dass es damit ein für alle Mal vorbei war, dass sie die stechenden Dämpfe nicht länger ertragen müsste.
»Fräulein, die Nacht ist noch jung.« Ein Mann mit Zylinderhut trat ihr in den Weg. »Darf ich Sie auf eine Rote Ente einladen?«
»Nein.«
Er blinzelte verwirrt. »Pardon, Rote Ente, das ist eine Mischung aus Rotwein und Champagner. Wird gern getrunken in Berlin. Sie sind nicht von hier?«
»Ich weiß, was eine Rote Ente ist. Aber ich bin keine von denen.« Sie wies in Richtung der Prostituierten.
Er lachte. »Das ist mir bewusst. Kommen Sie!« Er bot ihr seinen Arm an.
Es ist sowieso alles zerbrochen, dachte sie. Kurz zögerte sie noch, dann hakte sie sich unter und ließ sich in Richtung der Kneipen ziehen.
Durch den Türspalt fiel Licht in Samuels Zimmer und zeichnete einen hellen Keil auf das Bett. Matheus setzte sich auf die Bettkante.
Samuel sagte: »Du hast gelogen, Papa, das darf man nicht.«
»Kannst du deshalb nicht schlafen?«
Samuel nickte.
»Wann hab ich denn gelogen?«
»Am Nachmittag. Als Mama dich nach der Post gefragt hat.«
»Das Telegramm meinst du.« Er sah ins dunkle Zimmer. »Ich habe ihr nichts davon gesagt, weil deine Mutter mir sonst die Hölle heiß gemacht hätte. Sie will unbedingt, dass ich für die Amerikafahrt zusage.«
»Trotzdem darf man nicht lügen.«
»Du hast recht«, sagte Matheus. »Es wird nicht mehr vorkommen.« Schon das war die nächste Lüge, dachte er. Er überlegte, ob er sich korrigieren sollte.
»Mama hat mir gesagt, dass es gar nicht gefährlich ist, mit einem Schiff zu fahren.«
Natürlich sagt sie das, dachte er, sie hat noch nie eine Havarie erlebt.
»Wie funktioniert eigentlich Gaslicht?«, fragte Samuel.
»Wie eine Kerze.«
»Und wo kommt das Gas her?«
»Aus dem Gaswerk. Dort wird Kohle verbrannt. Dadurch erzeugt man Gas. Das säubert man von Giftstoffen, und dann fließt es durch die Rohre in die Häuser.«
»Und das Gift? Was macht man mit dem Gift?«
»Aus dem Gift werden Färbemittel hergestellt«, sagte Matheus. »Oder etwas, das man für Kühlschränke braucht. Baumaterial für Straßen macht man auch daraus.«
»Und wie schickt man das Gas zu den Leuten ins Haus?«
Er dachte nach. Durch den Druck vielleicht, wie beim Wasser? »Gas ist leicht«, sagte er, »leichter als Luft. Deswegen steigt es in den Leitungen auf. Wenn das Gaswerk in einer Senke liegt, kann das Gas von dort in die Häuser fließen, es fließt aufwärts, verstehst du?« Sicher steckte noch etwas anderes dahinter. Das musste er einmal nachlesen.
»Früher hatten wir noch Gaslicht, als ich klein war, richtig?«
»Ja, und jetzt haben wir elektrischen Strom, weil es moderner ist.« Er zog ihm die Bettdecke zurecht. »Du solltest schlafen.«
»Darf ich dich noch eine Sache fragen? Bitte!«
»In Ordnung.«
Samuel schwieg, er lag still im Bett. Schließlich sagte er mit leiser Stimme: »Wie findet man einen Freund?«
Matheus hielt den Atem an. Der Kleine klang so verletzlich! Er streichelte Samuel das Gesicht. »Das kann man nicht erzwingen, es muss sich ergeben. Ist denn unter den Nachbarsjungen keiner, mit dem du gern spielst?«
»Die hänseln mich. Und sie spielen andauernd Soldaten, das mag ich nicht.«
»In der Schule, in deiner Klasse, ist da kein Vernünftiger?«
»Da behandeln sie mich wie Luft. Außerdem, was soll ich mit denen? Die haben sich Gucklöcher in die Wand vom Schlachthaus gebohrt und schauen zu, wie die Tiere sterben. Die lachen über das Blut und das Ersticken!«
»Sie lassen dich einfach stehen und reden nicht mit dir?«
»In der Schule ist es wie auf dem Exerzierplatz«, sagte Samuel. »Weißt du noch, du hast mich auf den Schultern getragen, und wir haben den Übungen zugesehen.«
»Ja, das weiß ich noch.«
»Genauso ist es in der Schule. Das musst du dir mal vorstellen: Wir sollen uns gerade hinsetzen, und wenn der Lehrer sagt: ›Steht – auf!‹, dann müssen wir aufstehen, aber erst, wenn er ›auf‹ sagt. Und wenn er sagt: ›Setzt – euch!‹, dann setzen wir uns hin, aber erst, wenn er ›euch‹ sagt. Und die Schiefertafel müssen wir hervorholen, alle gleichzeitig auf Kommando, und die Hände auf dem Tisch ablegen.«
»Na ja, ein bisschen Disziplin schadet nicht.«
»Warum mögen alle die Soldaten? Und warum marschieren so oft welche, wenn wir in der Stadt sind?«
»Die ziehen zu irgendeiner Zeremonie oder zu einer Parade«, sagte Matheus.
In Wahrheit hatte er sich diese Frage auch schon oft gestellt. Weshalb sah man immer mehr Soldaten in den Straßen? Bereitete sich das Reich auf einen Krieg vor? In der Bevölkerung wünschten sich das viele. Das Deutsche Reich war stark geworden, und die Menschen begeisterten sich für das Militärische. Die Deutschen respektierten jede mit Metallknöpfen geschmückte Uniform, selbst die von kleinen Bahnbeamten, und sobald ein Offizier den Raum betrat, flogen ihm die Blicke der jungen Frauen zu. Die Gesellschaft veränderte sich, sie verehrte Stärke und sehnte sich nach einem bewaffneten Wettstreit der Völker.
Er musste an das Buch denken, das Cäcilie neulich für Samuel gekauft hatte, die Geschichte von der Biene Maja und ihren Abenteuern. Selbst in diesem Kinderbuch wurde gekämpft, die Hornissen zogen in den Krieg gegen die Bienen. Die Bienen waren Soldaten, und es gab Offiziere, und die Bienenkönigin sagte: Im Namen eines ewigen Rechts, verteidigt das Reich! Dann starben viele, das wurde beschrieben, als sei es schön, das Sterben. Aber Sterben war nicht schön.
»Komm, wir beten darum, dass du einen Freund findest.« Matheus schloss die Augen.
Da begann Samuel auch schon. »Lieber Gott, ich wünsche mir einen Freund. Es ist so schwer, einen zu finden!«
Mitten im Gebet öffnete Matheus die Augen. Er sah, wie sein Sohn die kleinen Hände ineinanderkniff und die Stirn angestrengt in Falten zog, als würde er eine schwierige Matheaufgabe lösen.
»Kannst du mir zeigen, wer ein guter Freund wäre, Gott? Amen.«
»Amen.« Matheus deckte den Siebenjährigen zu. »Jetzt kümmert sich Gott darum.«
4
Schon nach dem ersten halbherzigen Versuch, sie betrunken zu machen, legte der Mann Nele die Hand aufs Bein. »Ein Freund von mir ist verreist«, sagte er, »ich hab die Schlüssel zur Wohnung. Wir wären ungestört.«
Nele schob seine Hand weg. »Ich habe Ihnen gesagt, dass ich nicht so eine bin.«
»Das gefällt mir ja gerade!« Er lächelte. »Komm, trink noch was.« Er stützte den Arm auf dem dunklen Holz des Tresens ab. Gleich riss er ihn wieder hoch und schüttelte den Ärmel, der in einer Bierpfütze zum Liegen gekommen war. Fluchend zog er ein Taschentuch hervor und putzte damit über den Fleck.
Sie stand auf und verließ die Kneipe. Draußen prasselten kalte Regentropfen auf sie nieder.
Der Mann stürzte ihr nach. »Bleib doch, es regnet, du wirst dir was wegholen!«
»Ich hab keine Lust auf eine süße Nacht mit einem Mann, dem ich morgen gleichgültig bin. Geht das in Ihren Kopf?«
»Blöde, prüde Pute.« Er machte kehrt.
Das Licht der Straßenlaternen spiegelte sich auf dem nassen Asphalt. Eine Elektrische rumpelte heran, der Boden bebte vom Gewicht des Eisenkolosses. Die Linie 12 Richtung Görlitzer Bahnhof, ein Glücksfall. Auf die zehn Pfennige kam es jetzt auch nicht mehr an. Nele stieg ein.
Die Schaffnerin zog an der Schnur, die durch den Wagen lief, und die Glocke läutete. Mit einem Ruck fuhr die Bahn an. »Noch zugestiegen?«, fragte die Schaffnerin, obwohl sie genau gesehen hatte, dass Nele soeben eingestiegen war.
Nele bezahlte und erhielt die Karte. In der Bahn war es genauso kalt wie draußen. Jedes Holpern, jedes Ächzen der Schienen ließ ihren Sitzplatz vibrieren. Sie war eins mit dem eisernen Ungetüm, es hatte sie verschluckt und zu einem Teil seiner Mechanik gemacht. So schaukelten sie durch die Stadt.
Um sich abzulenken, sah Nele aus dem Fenster und las Schilder.
Franz Noack. Gas & Wasser. 2. Stock.
Ross-Schlächterei. Spezialität feine Wurstwaren.
Achtung! Bissige Hunde.
Beerdigungs-Institut. Lieferung in alle Krankenhäuser.
Das eiserne Ungetüm ächzte durch die Nacht, Weidendamm – Prinz-Louis-Ferdinand-Straße – Dorotheenstraße – Kastanienwäldchen – Opernplatz – Hedwigskirche – Oberwallstraße. Es kämpfte sich in das ärmere Berlin hinein, auf Straßen mit Kopfsteinpflaster, wo die Gaslaternen mit ihrem trüben Schein kaum die Dunkelheit zu durchdringen vermochten. Die Fahrt brachte Nele zu den Mietskasernen und den schmutzigen Hinterhöfen, Hausvogteiplatz – Jerusalemer Straße – Oranienstraße.
Mit ihr stieg ein Arbeiter aus, der stumm in die Nacht davonlief, die Schiebermütze tief in die Stirn geschoben. Nele ging über breite Bodenplatten. Aus überfüllten Regenrinnen stürzte das Wasser von den Hausdächern.
Die Elektrische rumpelte davon. Sie hatte Gleise, die sie durch die Nacht führten. Und mein Leben, dachte Nele, ist aus den Schienen gesprungen. Wie soll ich nur weitermachen? Sie konnte sich vor lauter Schulden nicht einmal Chlorodont zum Zähneputzen leisten, geschweige denn ein Stück Käse oder Fleisch oder ein paar Eier. Im Kolonialwarenladen hatte sie so oft anschreiben lassen, dass die Inhaberin ihr nichts mehr gab, und wenn sie woanders hinging, wo man sie nicht kannte, lieh man ihr erst recht nichts. Verkäufer besaßen einen unfehlbaren Blick, der die Abgestürzten, die Verarmten entlarvte.