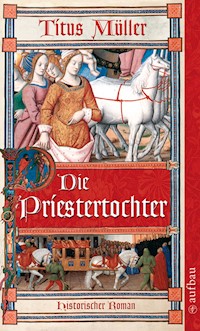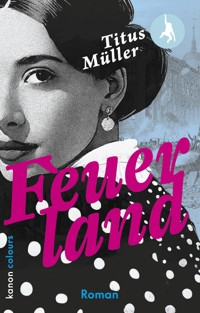
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kanon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hannes Böhm lebt in dem Industrieviertel, das die Berliner »Feuerland« nennen, weil hier die Schornsteine qualmen. Er verdient sich ein kleines Zubrot, indem er neugierigen Bürgern die Armut in den Hinterhäusern zeigt. Bei einer solchen Gelegenheit lernt er Alice kennen, die als Tochter des Kastellans im Berliner Stadtschloss wohnt. Dass es hinter der herrschaftlichen Fassade kalt ist wie in den Hinterhöfen der Stadt, lernt Hannes bald, während Alice tief beeindruckt ist von seinem Ehrgeiz. Doch als die Märzunruhen 1848 ausbrechen, scheint es für die Gefühle, die Hannes und Alice füreinander entwickeln, keine Zukunft zu geben. – Ein epochales Porträt einer Zeit im Umbruch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 610
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hannes Böhm lebt in dem Industrieviertel, das die Berliner »Feuerland« nennen, weil hier die Schornsteine qualmen. Er verdient sich ein kleines Zubrot, indem er neugierigen Bürgern die Armut in den Hinterhäusern zeigt. Bei einer solchen Gelegenheit lernt er Alice kennen, die als Tochter des Kastellans im Berliner Stadtschloss wohnt. Dass es hinter der herrschaftlichen Fassade kalt ist wie in den Hinterhöfen der Stadt, lernt Hannes bald, während Alice tief beeindruckt ist von seinem Ehrgeiz. Doch als die Märzunruhen 1848 ausbrechen, scheint es für die Gefühle, die Hannes und Alice füreinander entwickeln, keine Zukunft zu geben. – Ein epochales Porträt einer Zeit im Umbruch.
»Die Märzrevolution, zuvor so weit entfernt, ist einem nahe gerückt.«
Der Tagesspiegel
Titus Müller, geboren 1977, über ein Dutzend Romane. Er lebt mit seiner Familie in Landshut, ist Mitglied des pen-Clubs und wurde u. a. mit dem C. S. Lewis-Preis und dem Homer-Preis ausgezeichnet. Seine Trilogie um Die fremde Spionin ist ein spiegel-Bestseller.
Titus Müller
Feuerland
Roman
kanon verlag
INHALT
Cover
Halftitle
Title
Impressum
Saint-Germain-en-Laye, Freitag, 25. Februar 1848
Kapitel 1
Berlin, Montag, 6. März 1848
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Der historische Hintergrund
Geführte Touren durch die Elendsviertel
Der Polizeipräsident
Ernst von Pfuel
Der Revolutionsausbruch auf dem Schlossplatz
Prinz Wilhelm von Preußen
Öffentliche Trauer
Revolution und Reaktion
Das Schloss
Die folgenden Bücher waren besonders hilfreich zur Vertiefung in die Themen des Romans:
Der Autor dankt
ISBN 978-3-98568-156-3
1. Auflage 2024
© Kanon Verlag Berlin GmbH, 2024
© der Originalausgabe Blessing Verlag/Titus Müller, 2015
Umschlaggestaltung: Heilmeyer und Sernau Gestaltung
Herstellung: Daniel Klotz/Die Lettertypen
Satz: Heilmeyer und Sernau Gestaltung
Druck und Bindung: Pustet, Regensburg
Printed in Germany
www.kanon-verlag.de
Titus Müller
Feuerland
Saint-Germain-en-Laye, Freitag, 25. Februar 1848
Der Gefangene, ein dickleibiger Mann mit hängendem Augenlid, sah stur auf den Weg. Er wirkte abwesend, als sei er mit seinen Gedanken an einem anderen Ort. Hinter ihm folgten zwei Soldaten mit aufgesteckten Bajonetten, und am Schluss des Zuges trugen vier Füsiliere eine längliche Kiste. Trotz der Kälte schwitzten sie unter ihren Tschakos aus schwarzem Filz, und die Haare klebten ihnen an der Stirn. Unter ihren Schritten schwankte die Kiste wie ein klobiges Schiff bei Seegang.
An der alten Mauer unweit der Bahnstrecke nach Paris befahl der Capitaine, die Kiste abzusetzen und den Gefangenen mit dem Rücken zur Mauer aufzustellen. »Möchten Sie, dass wir Ihnen die Augen verbinden?«, fragte er.
Der Gefangene verneinte.
»Dann wollen wir mal hoffen, dass Ihre Hehlerware gut schießt.«
Die Füsiliere legten ihre gebrauchten Gewehre auf der Wiese ab und hoben den Deckel von der Kiste. Nacheinander entnahm ihr jeder ein fabrikneues Gewehr, während der Capitaine den Gefangenen mit der Pistole in Schach hielt. Sie bissen Papierpatronen auf, schütteten das Pulver in die Gewehrläufe und stopften eine Kugel darauf fest.
Der Capitaine sicherte die Pistole, steckte sie zurück ins Halfter und sagte: »Zur Zündung – fertig!« Die Füsiliere hoben die Gewehre. Sie spannten den Hahn und holten ein Zündhütchen aus der Tasche, um es auf den Zündkegel zu setzen.
»Legt an!«
Sie richteten die Gewehrmündungen geradeaus.
Unbeeindruckt blickte der Gefangene sie an. Ihr mit eurem kleinkarierten Leben, dachte er. Gefesselt an eine Frau, die euch aufmüpfige Kinder in die Welt setzt, Münder, die ihr zu stopfen habt, ob euch danach ist oder nicht. Unterdrückt von eurem Offizier. Der hält euch die Bratwurst an einer Angel vor die Nase, und ihr rennt ihr nach, jahrelang, ihr schuftet für eine armselige Beförderung, ein paar Francs, einen läppischen Blechorden auf der Brust. Nie werdet ihr den inneren Aufruhr kennenlernen und das Rieseln des Glücks in euren Gliedern, wenn ein Coup glückt und ihr im Alleingang Gendarmerie und Armee ein Schnippchen schlagt. Nie werdet ihr dem Duft des Abenteuers folgen. Schießt doch! Ihr könnt mich töten, aber im Gegensatz zu euch habe ich wenigstens gelebt und genossen.
Im Dachzimmer in Paris stand noch ein Paar feiner Schuhe, um die war es schade. Und um Lucienne, mit ihrem dichten schwarzen Haar, die hätte er gern noch mal besucht. Oder Julie, die frecher und frivoler war als alle anderen, die er kennengelernt hatte.
Die Füsiliere warteten. Lange Augenblicke verstrichen. Das Kommando »Feuer!« ertönte nicht. Wie ein Wolf, der auf der Lauer gelegen hatte, sprang der Überlebenswille in ihm auf.
»Hahn in die Ruh!«, befahl der Capitaine. »Schultert das Gewehr.« Er trat an ihn heran und verzog dabei sein Gesicht, als ziehe er eine Kakerlake am Hinterbein aus der Suppe. »Es gibt eine Möglichkeit, wie Sie Ihr Leben retten können. Ich habe einen Auftrag für Sie. Kommt von ganz oben.«
»Natürlich«, sagte er, als habe er nichts anderes erwartet.
»Nehmen Sie den Auftrag an, oder sollen wir das Urteil vollstrecken?«
Er sagte: »Gestern hätte ich zweitausend Francs verlangt. Jetzt ist der Preis gestiegen.«
Dem Capitaine entgleisten die Gesichtszüge. »Wie bitte?«
»Dreitausend Francs, und keinen Centime weniger.«
»Sie haben hier keine Forderungen zu stellen! Und bilden Sie sich ja nicht ein, wir würden Sie in Preußen nicht finden, wenn Sie versuchen sollten, sich abzusetzen. Die Republik hat Mittel und Wege.«
Preußen. Also stimmten die Gerüchte. »Die Republik hat vor allem ein Interesse daran, die preußische Geheimwaffe in die Hände zu bekommen.« Er musterte den Capitaine. »Ihre Vorgesetzten kennen mich«, sagte er. »Aber scheinbar nicht gut genug.«
1
Berlin, Montag, 6. März 1848
»Das sind die berüchtigten Familienhäuser?« Die Frauen sahen mit großen Augen an der Fassade hinauf.
Hannes machte eine Geste wie ein Zirkusimpresario. »Treten Sie näher, treten Sie ein, meine Damen! Dieses hier nennt man das Lange Haus. Das Souterrain wurde bereits vermietet, bevor das erste Obergeschoss fertig gebaut war. Damals war die Kellerdecke so nass, dass das Wasser herabtropfte. Heute enthält jedes Stockwerk dreißig elende Wohnungen.«
Sie spähten verunsichert in das dunkle Treppenhaus.
»Solange Sie sich nicht in eines der flohverseuchten Betten legen, ist der Besuch ungefährlich.« Er bugsierte die Damen durch den Flur in die Wohnung. Verschüchtert drückte sich eine schmutzige Kinderschar an die Wand. Ihre Kleider hätte man andernorts nur noch als Putzlappen verwendet. Ein Mann richtete sich vom Tisch auf. Hannes stutzte. Wer war das? Was war mit dem Scherenschleifer geschehen, mit dem er sich gestern verabredet hatte? Garnreste lagen auf dem Tisch, er improvisierte: »Das ist Lorenz. Er ist ein verarmter Weber. Tag für Tag sucht er sich bei anderen Webern unbrauchbares Garn zusammen und fertigt daraus Schürzenschnüre. Wie viele Kinder hast du, Lorenz?«
»Sieben«, antwortete der Weber.
»Nicht so bescheiden! Du musst dich vor den Damen nicht genieren. Er hat dreizehn Kinder«, sagte Hannes, »aber er schämt sich, denn von der achtjährigen Pauline bis zum vierzehnjährigen Emil arbeiten sie alle in der Fabrik. Nur die Jüngsten sind hier und quälen sich im Hungerfieber durch den Tag.«
Die Frauen seufzten vor Mitleid. Die Rothaarige nestelte einen Silbergroschen aus ihrer Börse und legte ihn auf den Tisch. »Für die Kinder«, hauchte sie. Die drei anderen folgten ihrem Beispiel.
Der Weber verbeugte sich. »Meinen aufrichtigen Dank.«
Die mädchenhaften Gesichter der Besucherinnen glühten vor Zufriedenheit, während Hannes sie in die nächste Wohnung führte. »Dieses Zimmer wird von zwei Familien bewohnt. Sie sehen es am Strick, der quer hindurch gespannt ist und den Raum in zwei Hälften teilt. Meist hängt eine graue, filzige Decke darüber.« Er wies auf den schlafenden Säufer, der hier jeden Tag die Morgenstunden verdämmerte. »Das ist Ulrich. Er ist zweiundachtzig Jahre alt und vollständig gelähmt.«
»Zwei Familien in dieser engen Kammer?«, fragte eine der Frauen erstaunt. »Aber wo sind die Schlafgemächer und die Küche?«
Beinahe hätte Hannes laut aufgelacht. Er hatte Jahre seines Lebens in einem ähnlichen Raum verbracht, und am Abend, wenn sie die Strohsäcke auf den Boden legten, war kaum genug Platz gewesen für alle. Aber das band er den Frauen gewiss nicht auf die Nase. Nichts Persönliches, war seine Devise. »Die gesamte Wohnung besteht aus diesem Zimmer. So sind die meisten Wohnungen hier. Es gibt auch welche mit einer kleinen Küche, aber die kosten einen ganzen Taler mehr im Monat, das kann sich kaum jemand leisten.«
Die Damen tauschten betroffene Blicke aus.
Er führte sie nach draußen. An der Haustür lauerte, wie verabredet, Pelle mit der Kinderschar. Die Kinder umringten die Besucherinnen und reckten ihnen bettelnd die Hände entgegen. Sie befühlten den zarten Stoff ihrer Kleider, was die Damen empört aufschreien ließ. Nach einer Weile nickte ihm Pelle zufrieden zu und spazierte in Richtung des Querhauses davon, offenbar hatte er etwas stibitzen können. Hannes verscheuchte die Kinder und führte die Damen zu den Toilettenverschlägen. »Ursprünglich kam eine Toilette auf fünfzig Bewohner. Die Senkgruben sind regelmäßig übergelaufen. Sie können sich nicht vorstellen, wie das gestunken hat!«
»Doch, doch.« Die Damen hielten sich parfümierte Seidentücher vor das Gesicht und baten ihn, diesen Ort nicht weiter zu erläutern, sie würden stattdessen gern noch die Armenschule besichtigen und, wenn er für ihre Sicherheit garantieren könne, eine Kneipe, in der sich Räuber trafen.
Am späten Nachmittag brachte er sie in einer Droschke ins Stadtzentrum zurück und ließ es sich nicht nehmen, sie bis vor ihre stuckgeschmückten Häuser Unter den Linden zu geleiten. Solche Gefälligkeiten waren es, die weitere Aufträge einbrachten.
Den Heimweg trat er zu Fuß an, um die fünf Groschen zu sparen. Als er durch das Oranienburger Tor trat, sah er seinen Freund in die Chausseestraße einbiegen.
»Kutte, du alte Sau«, rief er.
Kutte trug einen länglichen Gegenstand, in schmutzig weiße Lumpen eingewickelt. »Tagchen, Sackfratze«, erwiderte er. »Kommst du nachher mal bei mir vorbei?«
An Kuttes Unterlippe klebte Blut. Wenn er sich so ausdauernd auf die Unterlippe biss, bedeutete das, er heckte etwas aus. Hannes nahm sich vor, zu allem Nein zu sagen. Er grüßte mit zwei Fingern an der Mütze und folgte der Gartenstraße zu den Familienhäusern. Sie prunkten in der Oranienburger Vorstadt wie fünf heruntergekommene Schlösser, erbaut, um die Wohnungsnot der Ärmsten auszubeuten. Ihre zweieinhalbtausend Bewohner waren genauso mittellos wie die Hüttenbewohner ringsum und standen außerdem unter der Fuchtel der strengen Hausinspektoren. Hier wohnte nur, wer kurz davor war, auf der Straße zu landen.
Hannes betrat wieder das Lange Haus. Die Tür zur Wohnung des Webers stand offen. Er klopfte kurz und trat ein. »Gestern hat ein Scherenschleifer hier gewohnt. Wo ist er?«
Der Weber zuckte die Achseln. »Im Gefängnis. Er konnte seine Schulden nicht bezahlen. Oder er hat geklaut. Irgendwas in der Art. Wir enden doch alle dort, früher oder später.«
»Vier Silbergroschen habt ihr von den feinen Damen erhalten. Ich hätte gern zwei davon.« Hannes hielt die Hand auf.
»Warum?« Der Weber hob die Brauen.
Am Fenster stand eine Frau auf. »Gib sie ihm, Mathis. Dann bringt er die großzügigen Damen beim nächsten Mal wieder zu uns.«
Hannes nickte. »Sie hat’s kapiert.«
»Wie hast du die Trullas aufgegabelt?«, fragte der Weber, während er mit einem säuerlichen Gesichtsausdruck die Münzen aus einem kleinen Beutel fischte, den er um den Hals trug.
»War nicht schwer. Sie wollen sich gruseln. Sie wollen heute Abend in ihren weichen Himmelbetten liegen und sich daran berauschen, dass sie nicht so erbärmlich leben müssen wie wir.« Er steckte die Silbergroschen ein. »Bist du überhaupt Weber?«
»Dann würde ich mich wohl kaum mit Schürzenschnüren abgeben. Ich bin Tischler.«
»Und du arbeitest mit Garn?« Ungläubig sah Hannes zum Zwirn auf dem Tisch und zu dem Häufchen fertig gewickelter Schürzenschnüre.
»Gegenfrage, du Schlaumeier: Kennst du jemanden, der noch beim Tischler Möbel bestellt? Die Damen vielleicht, mit denen du hier warst. Aber sonst kauft doch jeder bei den Magazinen ein, diesen ramschigen neuen Kaufhäusern.«
»Ich weiß. Und die Möbelfabriken liefern die billige Ware. Trotzdem, die schaffen’s nicht, die ganze Nachfrage zu decken. Ich kenne einen Tischler, der Arbeit hat. Er ist pfiffig und stellt Kleiderschränke für die Kaufhäuser her.«
»Frag ihn mal, was er verdient. Ich hab das auch gemacht, ich habe aus billigem Material jahrein, jahraus dasselbe Möbelstück gebaut, und mein Lehrling hat überhaupt nichts gelernt, weil er während der Lehrjahre nur diesen einen Schrank bauen durfte. Das ist doch kein Handwerk! Man bekommt so wenig für die Schufterei, dass der Staat noch nicht mal Gewerbesteuer davon abzwacken kann. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Glaub mir, dein Freund ist nicht pfiffig. Er ist verzweifelt. Er steht am Abgrund wie wir alle.«
»Meinst du«, fragte die Frau mit banger Hoffnung, »deine Damen könnten bei meinem Mann ein Beistelltischchen oder eine kleine Kommode in Auftrag geben?«
»Wir haben das Werkzeug verkauft«, sagte der Tischler. »Schon vergessen? Außerdem bin ich ein Niemand für die. Wenn sie feine Möbel haben wollen, gehen sie zu Werkstätten mit Rang und Namen.«
Erneut wandte sie sich an Hannes. »Komm bald wieder zu uns«, bat sie. »Nächstes Mal koche ich Hafergrütze, und wir lassen sie davon kosten.«
»Glänzende Idee. Du hast verstanden, wie der Hase läuft. Ich überleg’s mir, ja? Wichtig sind die Kinder. Wenn keine Kinder da sind, geben sie nichts.« Er musterte die spielenden Gören, die zwei Wäscheklammern durch den Schmutz schoben und Stampfgeräusche machten, als wären es Dampfer. Ein Mädchen mit langen blonden Haaren half dem Vater beim Wickeln der Schürzenschnüre, die Frau hatte einen Säugling auf dem Arm. »Habt ihr nur diese sieben?«
»Wir könnten uns welche ausleihen von den Nachbarn.«
»Wäre gut. Es sollten zwölf Kinder sein oder dreizehn. Wenn ich das nächste Mal komme, stellt sie in einer Reihe auf, von der Größten zum Kleinsten.«
Er verließ das Haus. Kuttes blutige Unterlippe ging ihm nicht aus dem Kopf. Am besten suchte er den Freund gleich auf, um das Schlimmste zu verhindern. Kuttes Ideen führten nie zu etwas Gutem, auf sein Talent, sich in Schwierigkeiten zu bringen, war Verlass. Den Anteil vom Diebesgut würde er Pelle später abknöpfen, Kutte war jetzt wichtiger.
In der Nähe der Invalidenstraße hatte es heftig geregnet, erdiger Matschgeruch lag in der Luft. Hannes lief zwischen den Pfützen entlang. Hier glich keine Hütte der anderen. Mal waren Holzplanken zusammengenagelt worden, mal hatte man Blech gebogen oder Segeltuch mit Steinen beschwert, damit es nicht vom Dach wehte. Zaunlatten waren verbaut worden, alte Lumpen, Draht.
Kutte behauptete immer, seine Vorfahren, Handwerker aus dem Vogtland im Süden, seien vor einhundert Jahren hier gelandet. Auf Anordnung Friedrichs des Großen habe man sie dauerhaft in Berlin angesiedelt. »Der Stadtteil heißt nach meinen Großeltern«, brüstete sich Kutte, doch das war Unsinn. Erstens sagten die meisten inzwischen Feuerland zur Umgebung der Fabriken und nicht mehr Vogtland nach den vogtländischen Handwerkern, und zweitens war das Elendsviertel kein Stadtteil, sondern eine eitrige Pocke vor den Mauern Berlins.
Wie eine aufgeplatzte Pocke sah auch die Hütte aus, vor der er jetzt stand. »Kutte?« Er klopfte an die Tür. Sie wackelte in ihren notdürftigen Angeln aus Hanfstricken. Er öffnete und bückte sich in den Raum.
»Wie ist es gelaufen?« Kutte sah nicht hoch, er schnitt sich konzentriert mit dem Messer in die Handfläche.
»Hast du dir schon wieder einen Splitter reingezogen?«
Kutte legte das Messer beiseite und fasste mit spitzen Fingern nach dem Splitter. Er zog ihn heraus und hielt ihn hoch. »Wenn man die Splitter zusammensetzt, die ich mir beim Kanalbau jetzt schon in die Hand gerammt habe, kommt ein eigener Balken dabei raus.«
»Zieh dir Handschuhe an!«
»Weißt du, was ein Paar Arbeitshandschuhe kostet?« Er rollte die Augen. »Erzähl mir lieber, wie’s mit deinen Frauen war.«
»Es wird mir weitere Anmeldungen bringen. Und Pelle hat was eingesackt. Die vornehmen Damen können ihren Freundinnen also sogar davon vorschwärmen, dass sie beklaut wurden. Sie haben sich in die Höhle der Löwen gewagt und sind mit ein paar Kratzern wieder rausgekommen. Die Kratzer müssen sein, sonst hat man nichts, womit man prahlen kann.«
»Nimm sie ruhig aus, die Hühnchen. Willst du ein Stück?« Er hielt ihm einen Brotkanten hin.
Natürlich hatte er Hunger. Aber Kutte knurrte der Magen sicher ärger als ihm. »Danke, nein. Ich ess später einen Teller Suppe. Was hast du aus der Stadt geschleppt?«
Kutte überhörte die Frage. »Dein Alter war hier. Hat nach dir gefragt.«
»Ich will ihn nicht sehen.«
Kutte biss vom Brot ab, fahrig und unkonzentriert, er sah ihn nur flüchtig an, ständig waren seine Augen in Bewegung. »Weiß ich.«
Was verbarg er? Hannes ließ den Blick durch den Raum schweifen. »Sag mal, hast du den Ofen umgestellt?«
Kutte fuhr hoch. »Verzwickte Wagenschmiere! Fällt es sehr auf?«
Der gusseiserne Ofen war Kuttes ganzer Stolz. Diesen Winter hatten Pelle und er hier übernachtet, weil es in ihren Zimmern eiskalt gewesen war. Kutte hatte nachmittags sogar die Nachbarn eingeladen, damit sie sich bei ihm Hände und Füße aufwärmen konnten.
Der Onkel, der ihm den Ofen vermacht hatte, war Kutte eigentlich kaum bekannt gewesen – aber seitdem er geerbt hatte, erwähnte er seinen Gönner, »Onkel Richard«, häufig und voller Ehrfurcht.
»Ich seh’s«, sagte Hannes, »weil ich weiß, wo er immer steht.«
»Das wissen andere auch. Wenn ein Nachbar mich verpfeift, lande ich in Spandau. Und mir ist nicht nach Zuchthaus.« Kutte fasste in die Ofentür und hinten ans Rohr. »Pack mal mit an.«
So winzig der Ofen auch war, wog er doch schwer wie Blei. Hannes war froh, als sie ihn endlich wieder absetzten, und dehnte vorsichtig den schmerzenden Rücken. »Wie hast du den allein von der Stelle gekriegt?«
»Ich bin kein fauler Hund wie du. Wenn man wochenlang für die Eisenbahntrasse Erde schaufelt …«
»Ja, ja, ich weiß schon«, unterbrach ihn Hannes, »die Eisenbahntrasse. Und der Luisenstädtische Kanal. Du bist ein Held, Kutte.«
»Ich sag ja nur: Vom Schaufeln und vom Balkenschleppen kriegt man Muskeln.«
»Jetzt zeig schon, was du unter dem Ofen versteckt hältst.«
Kutte legte warnend den Finger an die Lippen. »Draußen hört man jedes Wort.« Nach einem Blick zur Tür zog er den löchrigen Teppich beiseite und begann zu graben. Er scharrte ein langes, in Lumpen gewickeltes Päckchen frei, hob es heraus und schlug den Stoff zurück.
»Bist du wahnsinnig geworden?« Hannes wich zurück. In den Lumpen lag ein Steinschlossgewehr, eindeutig aus Armeebeständen, mit Ladestock und einer Schachtel Papierpatronen.
»Ich such mir noch ein besseres Versteck.«
»Wozu brauchst du ein Gewehr? Planst du etwa einen Raubüberfall?«
Kutte raunte: »Etwas Größeres. Ich zähl übrigens auf dich. Du musst unbedingt dabei sein.«
»Du weißt, wie gereizt die Polizei gerade ist. Die fackeln nicht lange. Wenn die das hier finden, kommst du lebenslang hinter Gitter! Oder die Soldaten erwischen dich. Die knallen dich einfach ab!«
Kutte grinste. »Und wenn ich dir sage, dass ich nicht allein bin?«
2
Wehmütig hob Alice die Eintrittsbilletts aus dem Schatzkistchen. 5 Sgr. Entree, Zoologischer Garten Berlin stand darauf. Victor war so herrlich ausgelassen gewesen im Zoo, er hatte die Bären nachgeahmt und die Affen, und sie hatten gemeinsam gelacht, bis ihnen die Tränen kamen. Die Kängurus, die Lamas, die Büffel und die Löwen hatten sie bestaunt.
Sie legte die Billetts zurück und hob die Eulenfeder heraus. Victor hatte sie auf der Pfaueninsel gefunden an dem Tag, als er sie das erste Mal geküsst hatte. Alice strich damit über ihre Lippen.
Wie sie seine Nähe vermisste, die tiefe Stimme und das Lachen! Da lag der Ring, den er ihr geschenkt hatte, ein goldener Ring mit einem kleinen Smaragd. Damals hatte die Mutter gesagt: »Pass auf, was du tust, Alice, noch seid ihr nicht verlobt.« Aber sie liebte diesen Ring, sie würde zehn Jahre ihres Lebens hergeben, um ihn wieder mit Stolz tragen zu dürfen.
Das Bündel mit Briefen war zerfleddert vom häufigen Lesen. Traurig legte sie alles in die Kiste zurück und verschloss sie.
Sie verstaute die Kiste im Sekretär, hängte sich den Schlüssel um den Hals und holte Das schöne Mädchen von Perth aus dem Bücherschrank. Mit dem Roman legte sie sich aufs Kanapee. Drei- oder viermal hatte sie ihn bereits gelesen, sie konnte ganze Passagen innerlich mitsprechen, aber sie bekam nicht genug davon. Kein anderer Roman von Walter Scott hatte sie so sehr berührt wie dieser. Lag es daran, dass Das schöne Mädchen von Perth ein Geschenk ihres Vaters gewesen war? Damals war sie noch ein Kind gewesen und hatte zu ihm aufgeschaut. Oder lag’s an Victor? Wenn sie im Roman las, hatte sie oft seine Stimme im Ohr und ihren melodiösen Wohlklang, weil er ihr ein paar Mal daraus vorgelesen hatte. Sie schlug Seite 19 auf, dort fing sie neuerdings an, weil sie den Anfang schon zu gut kannte. Auf Seite 19 ging es wirklich los, da warnte der Handschuhmacher seine Tochter Katharina vor den Adligen.
»Lass sie gehen«, sagte er, »lass sie gehen, Katharina, diese edlen Herren mit ihren munteren Rossen, ihren glänzenden Sporen, ihren Federhüten und wohlgepflegten Schnurrbärten. Sie gehören nicht in unsern Stand und wir wollen uns nicht zu ihnen zu erheben suchen. Morgen ist St. Valentin, der Tag, an welchem jeder Vogel sein Weibchen wählt, aber du wirst weder den Hänfling mit dem Sperber, noch das Rotkehlchen mit dem Geier sich paaren sehen. Mein Vater war ein ehrsamer Bürger von Perth, und wusste die Nadel so gut zu führen wie ich. Wenn sich aber den Thoren unserer guten Stadt der Krieg nahte, warf er Nadel, Faden und Gemshaut weg, holte aus dem dunkeln Winkel, wo er sie aufgehängt hatte, Pickelhaube und Schild und nahm seine lange Lanze vom Kamine. Nenne mir jemand einen Tag, wo ich oder er gefehlt hätten, wenn der Hauptmann Musterung hielt! So haben wir’s gehalten, mein Mädchen, gearbeitet, um Brot zu gewinnen, und gefochten, es zu verteidigen, und ich mag keinen Schwiegersohn, der sich einbildet mehr zu sein, denn ich; und was jene Herren und Ritter betrifft, so hoffe ich, du werdest dich stets erinnern, dass du zu niedrig bist, um ihre Gemahlin, und zu hoch, um ihre Buhldirne zu sein.«
Jemand trat ins Zimmer.
»Ich möchte nicht gestört werden«, rief sie ärgerlich und ließ die Hand mit dem Buch sinken.
Aber es war nicht das Zimmermädchen, sondern die Mutter, die sich beschwerte, dass Alice heute noch gar nicht Klavier geübt habe.
»Das mach ich später.«
»Den Walzer von Chopin hast du jetzt schon zwei Wochen auf.« Missbilligend musterte die Mutter das Buch in Alices Händen. »Statt dich mit Goethe oder Schiller zu bilden, liest du diesen Schund.«
»Dann mag ich eben Schund.«
Sie kniff die Augen zusammen. »Hat er dir etwa wieder geschrieben?«
»Nein.« Warum klang ihr Nein so zittrig? Alice ärgerte sich darüber. Die Mutter musste nicht unbedingt bemerken, wie sehr sie auf eine Nachricht von Victor hoffte.
»Du solltest allmählich abschließen mit dem Taugenichts.«
»Hab ich doch«, log sie.
»Dann gib mir das Buch.«
»Ich hebe es nicht wegen Victor auf.«
Die Mutter hielt weiter die Hand ausgestreckt. »Gib’s mir. Es erinnert dich fortwährend an ihn.«
»Nur weil mir Victor mal daraus vorgelesen hat? Ich kann das trennen!«
Die Mutter verharrte und sah ihre Tochter an. Sie glaubte ihr zwar nicht, zog aber schließlich die Hand zurück: »Du musst es selbst wissen. Aber du wirst nicht länger auf dem Kanapee herumlümmeln und lesen, sondern du übst Klavier. Und zwar sofort.«
Das Zimmermädchen erschien in der offenen Tür und klopfte, um auf sich aufmerksam zu machen. »Störe ich? Die Damen von Stetten und von Arnim-Boitzenburg lassen fragen, ob Sie bereit sind, Sie zu empfangen.«
Alice stand auf und stellte das Buch in den Bücherschrank. Wenn ihre Mutter es wagen sollte, den Band herauszunehmen und verschwinden zu lassen, würde sie sich wehren. »Bitte sie herein. Und serviere uns Baisers und Trinkschokolade.«
Das Zimmermädchen knickste.
Die Mutter stolzierte an ihr vorbei und begrüßte im Nebenraum Alices Freundinnen. »Sie muss noch Klavier üben«, sagte sie, ging dann aber, weil sie scheinbar für den Moment ihre Niederlage einsah.
Kaum hatten Ottilie und Gemma das Zimmer betreten und die Tür hinter sich zugemacht, fragte Ottilie, ob es wieder Streit gegeben habe.
Alice rollte die Augen. »Wenn wir nächstes Jahr die Höhere Mädchenschule hinter uns haben, feiern wir ein Fest, ja?« Sie räumte das kleine Tischchen vom Stickzeug frei und bot ihren Freundinnen Plätze an. Wortreich beklagte sie sich über das zu große Klavierpensum und über die strenge Lehrerin in Haushaltsführung.
Gemma setzte sich und erwiderte: »Mathematik und Französisch, das sind die eigentlichen Quälgeister. Das Sticken ist doch Erholung!«
»Für dich vielleicht.«
Ottilie machte große Augen.
»Was ist?« Alice begriff nicht.
Die Freundin platzte heraus: »Unser Gemmachen hat was Verrücktes getan.« Sie gab Gemma einen Stoß mit dem Ellenbogen. »Sag’s ihr.«
Gemmas Gesicht leuchtete. »Ich war im Feuerland. Ohne Polizeischutz. Ich bin höchstpersönlich in den Familienhäusern herumspaziert!«
Alice schlug die flache Hand auf den Tisch. »Und du hast mich nicht mitgenommen? Du weißt doch, wie sehr mich die Vorstädte interessieren.«
»Deshalb sind wir hier. Ottilie und ich wollten dich fragen, ob du heute mitkommen willst. Ich kenne jemanden, der uns durch das Armenviertel führt. Eine Freundin hat ihn mir empfohlen, und ich bin begeistert! Er zeigt einem alles. Natürlich ist es nicht ganz ungefährlich, gestern bin ich bestohlen worden, stell dir vor, der schöne silberne Armreif. Die müssen ihn mir geschickt abgestreift haben, gemerkt hab ich nichts. Erst zu Hause ist mir aufgefallen, dass er fehlte. Und sie schauen einen manchmal finster an, als wollten sie einem was antun. Man braucht schon Mut, um da hinzugehen.«
Bettine, das Zimmermädchen, brachte ein Tablett mit einem Kaffeekännchen und Tassen. Sie deckte den Tisch. Leise sagte sie: »Die Trinkschokolade ist aus, Fräulein Alice. Dafür habe ich besonders viele Baisers gebracht, und ich habe Kaffee gekocht.«
»Ist schon recht, Bettine.« Alice nahm sich ein Baiserhäubchen und biss ab. Der harte Zucker zerschmolz in ihrem Mund zu einem süßen Schaum.
Gemma wartete, bis Bettine das Zimmer verlassen hatte, und sagte dann: »Dieser junge Kerl, der durch das Armenviertel führt – ich bin regelrecht verschossen in ihn.«
Alice runzelte die Stirn. »Weiß Heinrich davon?«
»Natürlich nicht. Habt ihr einen Vorschlag, was ich diesem Hannes als Geschenk mitbringen könnte?«
Alice legte das angebissene Baiser weg. »Was du da vorhast, ist falsch! Nicht nur wegen Heinrich. Wie kannst du dem armen Mann Hoffnungen machen, die sich nie erfüllen werden?«
»Nimm nicht alles so ernst, was ich sage.« Gemma schüttelte den Kopf. »Natürlich werde ich Heinrich heiraten. Aber ein wenig Glanz darf ich doch vielleicht in Hannes’ Alltag bringen. Der flickt Töpfe oder schleift Scheren oder was weiß ich. Hat keine Aussichten, keine Freuden im Leben und jeden Tag Hunger.«
Hannes lehnte am Oranienburger Tor und beobachtete das Kommen und Gehen. Wenn das Tor ein Maul war, dann war Berlin die gewaltige Kreatur, in deren Magen es führte. Die Menschen fütterten die Stadt, sie schleppten Nahrung und Rohstoffe hinein und durften im Gegenzug in ihren Poren nisten. Die Kreatur Berlin stellte Kattunkleider, Werkzeugkisten und Kleiderschränke her, und ihre Wärter schleppten sie hinaus ins Land und brachten ihr dafür Fleisch, Getreide und Schnaps.
Die Loks im nahen Stettiner Bahnhof schnauften, mit schrillen Pfeifsignalen versuchten die Bahnbeamten, sie zu zähmen. Die Dampfmaschinen der Fabriken rumpelten. Meist hörte er das Stoßen und Klopfen gar nicht mehr, so vertraut war es ihm. Jetzt aber, da er seine Sinne schärfte, fiel ihm wieder auf, wie laut es hier eigentlich war.
Aus den Schloten, die der Oranienburger Vorstadt den Namen Feuerland eingebracht hatten, wölkte schwarzer Ruß. Darunter dienten in den Werkshallen die Menschen den prasselnden Öfen und den zuckenden, rumpelnden Apparaturen.
Wer nicht mehr im hektischen Takt der Maschinen mitmachen wollte, stürzte sich vor die Eisenbahn und ließ sich zermalmen, so häufig kam das inzwischen vor, dass es einen eigenen Namen erhalten hatte: »Polkatod«.
Im Januar hatte man die »Berliner Normalzeit« eingeführt und im ganzen Land einheitliche Streckenfahrpläne durchgesetzt, um den Eisenbahnverkehr zu koordinieren oder, besser: durch den Eisenbahnverkehr die Menschen zu koordinieren. Berlin streckte seine eisernen Fühler nach anderen Städten aus, hier war die erste Lokomotive Deutschlands gebaut worden, und jetzt fuhren ihre Schwestern wie eiserne Kriegerinnen nach Dessau, nach Hamburg, nach Frankfurt. Die Uhr tickte nicht mehr nach den Bedürfnissen der Menschen, sondern nach den Bedürfnissen der Großstadt, die ihre Eisenkinder ausgesandt hatte und unwillig pfiff, wenn die menschlichen Sklaven nicht eilig in die Coupés und Waggons stiegen.
Er lachte in sich hinein. Wenn er das Kutte erzählte, der würde ihn einen albernen Guckkästner nennen, nach den altmodischen Schaustellern, die mit einem Kasten auf den Plätzen standen und Wissbegierigen für ein paar preußische Pfenninge erlaubten, durch die Gucklöcher ihres Kastens auf eine Fantasiewelt mit Menschenfressern, in einen Dschungel oder einen Palast zu schauen. Aber war es nicht heilsam, die ganze Welt einmal aus einem bestimmten, aus reiner Lust bezogenen Blickwinkel zu betrachten? Er sah zu dem schäbigen Karussell hinüber, das vor dem Tor von einem Schimmel gezogen wurde. Das arme Tier lief den ganzen Tag im Kreis. Gerade mal drei Kinder saßen jetzt auf dem Karussell und ließen sich kutschieren, die restlichen Plätze waren verwaist. Das Pferd sah müde aus, müde wie die Milchmädchen, die Kattundrucker, die Eisengießer, Bürstenmacher, Schachtelmädchen und Posamentenmacherinnen, die tagein tagaus schufteten.
Der Tischler fiel ihm ein. War es hartherzig gewesen, ihm die Hälfte der Spenden abzuknöpfen? Aber auch er, Hannes, musste sehen, wo er blieb. Er würde niemals seine Werkzeuge verkaufen können. Sein Werkzeug war die blühende Fantasie.
Dass die Berliner heute einen wacheren Gesichtsausdruck hatten, entsprang allerdings nicht seiner Vorstellungskraft. Sogar die unbescholtenen Bürger behielten die Gendarmen vorsichtig im Auge. Und der Eckensteher dort hinten schien die patrouillierenden Soldaten zu zählen.
Gab es niemanden, der das dem König und seinen Ministern meldete? Die Bevölkerung war kurz davor aufzubegehren. Sie wollte wissen, wem die Maschinen gehorchten, sie wollte etwas hören von den Fabrikbesitzern, den Handelsherren und Schlossbewohnern. Eine kleine Preissteigerung bei Brot oder Fleisch würde genügen, um das Fass zum Überlaufen zu bringen.
Andererseits: Eine richtige Revolution wie im Februar in Paris war in Berlin undenkbar. Dafür war man zu nüchtern. In Frankreich verstiegen sich die Menschen ins Philosophische und kämpften um Ideen. Der Berliner dagegen war stupide dem Irdischen zugewandt. Er teilte Abschätzigkeiten aus, biss nach allen Seiten. Und doch liebte er sein kleines Zuhause, liebte es so sehr, dass er es niemals für umstürzlerische Wagnisse aufs Spiel setzen würde.
Eine Droschke fuhr durch den mittleren Bogen des Oranienburger Tors. Die Hufeisen knallten auf das steinerne Pflaster, ihre Schläge hallten von den Wänden wider. Hinter dem Tor hielt das Gefährt. Der Kutscher sprang vom Bock. Er reichte einer Dame die Hand und half ihr beim Aussteigen, dann einer zweiten und einer dritten Dame.
Hannes löste sich vom Torbogen und trat auf das Grüppchen zu. »Willkommen im Feuerland«, sagte er und verbeugte sich.
Die Rothaarige, die schon gestern die Führung durchs Armenviertel mitgemacht hatte, gab ihm sechs Silbergroschen.
Ein Gendarm kam forschen Schrittes näher und fragte: »Belästigt Sie dieser Kerl?«
Über Hannes’ Kopfhaut zog ein Prickeln. Er konnte keine Arbeitsstelle nachweisen, gemäß dem »Gesetz über die Bestrafung der Landstreicher, Bettler und Arbeitsscheuen« drohten ihm sechs Wochen Gefängnis, wenn ihm der Gendarm Bettelei unterstellte – immerhin hatte er vor den Augen des Polizisten Geld von den Damen erhalten. Er sagte: »Die Damen gehören zum Verein für das Wohl der arbeitenden Klassen.«
Misstrauisch musterte ihn der Polizist. »Und du, Bursche?«
»Wir wollen gemeinsam einige kranke Arbeiter besuchen«, sagte er. »Die Damen haben Geld zusammengelegt, ich soll unterwegs Brot und Wurst für die Hilfsbedürftigen kaufen.«
Der Polizist wandte sich an die Frauen. »Stimmt das?«
Sie nickten. Ein wenig zu rasch, zu eilfertig, fand Hannes. Schöpfte der Polizist Verdacht?
Er brummte etwas, ließ sie stehen und überquerte die Chausseestraße.
»Das war fabelhaft. Wie gut du improvisieren kannst!« Die Rothaarige reichte ihm die Hand. »Ich bin Gemma von Stetten. Wir hatten gestern gar keine Zeit, uns vorzustellen.«
Sie streifte beim Händeschütteln mit dem Daumen seinen Handrücken. Wie weich der Glacéhandschuh war! Die zärtliche Berührung verblüffte ihn.
Die zwei anderen stellten sich als Alice Gauer und Ottilie von Arnim-Boitzenburg vor.
Er sagte: »Ich bin Hannes. Wollen wir?« Er führte sie die Chausseestraße entlang und wies auf die einzelnen Fabriken. »Das da ist die Fabrik von Eggels, sie stellt Dampfmaschinen her für Schiffe und für den Bergbau. Und hier produziert August Borsig Dampflokomotiven.« Dass besagter Maschinenfabrikant gerade ein Drittel seiner tausendzweihundert Beschäftigten entlassen hatte, brauchte er sicher nicht zu erwähnen. Davon mussten sie gehört haben. »Adolf Pflug«, sagte er beim nächsten Fabriktor. »Die machen Eisenbahnwaggons. Und dort hinten in Wöhlerts Eisengießerei und Maschinenbauanstalt werden Kräne, Achsen und Werkzeugmaschinen hergestellt, und dieses Jahr soll die erste Wöhlert-Lokomotive gebaut werden. Konkurrenz für Borsig.«
Der Rauch, den die rot gemauerten Fabrikschornsteine ausstießen, beschwerte die Atemluft und schmeckte stumpf. Das Pochen der Dampfhammer erschütterte den Boden. Alice fühlte die Stöße bis in die Knie. Erstaunlich, dass Menschen so nahe bei den lärmenden Fabriken leben konnten.
Durch die vielen Begegnungen und Gespräche im Schloss glaubte Alice ein Gespür dafür zu besitzen, wem man vertrauen konnte und wem nicht. Dieser Hannes führte sie tiefer und tiefer ins Feuerland hinein, er plauderte gemütlich vor sich hin und wies in verschiedene schmutzige Ecken, aber dahinter steckte etwas anderes. Die Rolle des Fremdenführers spielte er nur, das spürte sie deutlich.
Wie konnte Gemma Freude daran finden, sich von ihm bestehlen zu lassen? Ein Betrüger war er, eine räudige Hyäne. Solche Betrüger gehörten entlarvt, nicht angeschwärmt.
Als sie die berüchtigten Familienhäuser betraten und Hannes auf einen schlafenden alten Mann zeigte und behauptete, er sei gelähmt, hielt sie seine Dreistigkeit nicht länger aus. Meinte er, sie für dumm verkaufen zu können? Sie sagte: »Lügen haben kurze Beine, Hannes, das solltest du dir mal zu Herzen nehmen.«
»Ich … Was?«
»Du lügst. Der Mann ist nicht gelähmt, und er lebt auch nicht von den gespendeten Brotstücken der Nachbarn.«
»Woher wollen Sie das wissen?« Er verengte die Augen.
»Zum Beispiel stehen da Schuhe. Wozu braucht er die?«
»Sie sind das Einzige, was er noch hat. Eine Erinnerung an die guten Tage, als er noch laufen konnte.«
Sie hockte sich hin und hob einen der Schuhe hoch. Grüne zertretene Halme klebten an der Schuhsohle. »Eine Erinnerung mit frischem Gras an den Sohlen?«
»Manchmal leiht sich sein Sohn die Schuhe aus.«
Die Kaltschnäuzigkeit, mit der er seine Lügengeschichte weiterspann, erzürnte sie noch mehr. Er benutzte das Leid der Armen rücksichtslos für seine faulen Geschäfte.
»Alice, was soll das?« Gemma legte ihr beschwichtigend die Hand auf die Schulter. »Wenn Hannes sagt, dass der Mann gelähmt ist, stimmt das auch. Du bist das erste Mal hier. Wie kannst du da alles in Zweifel ziehen? So arrogant kenne ich dich gar nicht!«
»Arrogant? Ich zeig dir mal, wer hier arrogant ist.« Sie beugte sich über den schlafenden Mann. Er roch, als habe er eine ganze Wagenladung Schnaps getrunken. Sie rüttelte ihn. »Wach auf!«
Sein Hemd war schmierig, und etwas von der Schmiere blieb an ihren Fingern kleben. Sie wischte sie an der Wand ab.
Mühsam öffnete er die Augen. »Was soll das?«, lallte er.
»Alice!«, rief nun auch Ottilie entrüstet.
Sie sah hoch: »Entweder versorgen ihn die lieben Nachbarn außer mit Brot auch noch üppig mit Gebranntem, oder die Geschichte vom armen, gelähmten Ulrich ist von vorn bis hinten erlogen.« Als sie sah, dass Hannes’ Gesicht versteinerte, ergänzte sie triumphierend: »Ich vermute, Letzteres.«
Sie wandte sich wieder dem verschwitzten Trunkenbold zu. »Kannst du aufstehen?« Der letzte Beweis fehlte noch. Also griff sie ihm kurzerhand unter die Achseln und zog an ihm, um ihn aufzurichten.
»Lass mich.« Er ruderte mit dem Arm.
»Wenn du es schaffst, aufzustehen, gebe ich dir einen Silbergroschen.« Sie zog das Geldstück hervor und hielt es ihm unter die Nase.
Das tat seine Wirkung. Er zeigte die fleckigen Zähne. Obwohl er vor Anstrengung zitterte, gelang es ihm, Stück für Stück seinen Körper in die Höhe zu hieven, indem er sich an der Wand abstützte. Schwankend hielt er sich mit der Rechten fest. Die schmutzige Linke streckte er ihr hin.
Sie legte den Silbergroschen hinein. »Ich sollte mich als Armenärztin betätigen. Und du solltest dich schämen, uns –« Sie drehte sich nach Hannes um. Er war verschwunden. »Wo ist er hin?«
Gemma und Ottilie blickten sich ebenfalls um. »Wunderbar, Alice«, zischte Gemma, »wirklich fabelhaft.«
3
»Ich wette, das war nicht seine einzige Lüge. Sicher hat er mit den Taschendieben eine Vereinbarung. Er lenkt uns ab, während sie den Schmuck stehlen.«
»Wir wollten einen interessanten Nachmittag im Feuerland erleben, und du machst alles kaputt«, schimpfte Ottilie.
Wie konnten sie so naiv sein? »Da gab es nichts kaputtzumachen. Was habt ihr denn erwartet? Meint ihr im Ernst, sie lassen uns zuschauen, wie sie verhungern? Das sind doch keine Zootiere!«
»Für noch einen Silbergroschen würde ich … eine Kniebeuge … versuchen«, lallte der Säufer.
»Alice, wir sind hier um zu helfen«, verteidigte sich Gemma.
»Diesem Hannes liegt aber nichts an den Leuten. Das siehst du allein schon daran, dass er abgehauen ist. Betrüger machen das immer so, wenn man ihnen auf die Schliche kommt.«
Gemma giftete: »Das weißt du wohl aus deinen schlauen Büchern.«
»Und jetzt?« Ottilie sah sich unbehaglich im kahlen Raum um.
»Wir gehen heim«, sagte Alice.
»Ohne Schutz, durch diese Straßen?«
»Ich bringe euch zurück.« Die Wut, die immer noch in ihr brodelte, verlieh ihr Zuversicht. Sie zweifelte nicht daran, dass sie ungehindert aus dem Armenviertel wieder hinausgelangen würden.
Als sie zur Tür trat, prallte sie beinahe mit einem Mann zusammen. Er sah aus wie Hannes – das strohblonde Haar, die knochigen Schultern, das geflickte Hemd. Aber er wirkte rundum verändert, alles Lässige schien von ihm abgefallen zu sein. In sein Gesicht stand ein innerer Kampf geschrieben. »Sie wollen das wirkliche Elend sehen?«, sagte er. »Kommen Sie mit.«
Er ging die Treppe hinauf in die Dunkelheit. Was wollte er ihnen zeigen? Plötzlich fürchtete sich Alice. Sie drehte sich zu ihren Freundinnen um. Aus großen Augen starrten Gemma und Ottilie sie an.
Sie stiegen die krumme Treppe hoch. Alice fürchtete sich vor dem, was ihr begegnen würde, sie hatte Angst, es nicht auszuhalten, und doch wollte sie es sehen. Eine kalte Neugier trieb sie weiter.
Auf der dritten Etage wartete Hannes und sagte: »Wählen Sie eine Tür aus. Ich habe nichts vorbereitet. Sie entscheiden.«
Alice sah von Tür zu Tür. Die Wände waren nackt und fleckig, und durch die Türritzen zog fauliger Geruch in den Flur. Sie zeigte auf die Tür rechts von sich.
Er klopfte. Schritte schlurften näher, dann wurde die Tür geöffnet. Eine Frau sah sie verunsichert an. Hannes redete leise mit ihr, dann nickte sie zögerlich. Sie öffnete die Tür zur Gänze.
»Wir dürfen eintreten«, sagte Hannes.
Alice wollte sich bei der Frau bedanken, aber als sie sah, dass ihr die Schamesröte im Gesicht stand, brachte sie nichts heraus. Wir sollten das nicht tun, dachte sie. Wir haben kein Recht, in ihr Leben einzudringen. Trotzdem betrat sie das Zimmer.
Die Wohnung bestand allein aus diesem einen Raum. Die Frau nahm einen verbeulten Blechteller mit Kartoffelschalen vom Tisch und versteckte ihn unter einem Lumpen. Warum verbarg sie die Schalen? Und wo waren die Kartoffeln, die sie geschält hatte? Alice schluckte. Ihr dämmerte die furchtbare Wahrheit. Diese Frau aß vor lauter Hunger Kartoffelschalen, die sie irgendwo erbettelt hatte.
Warum stank es hier so? Gemma und Ottilie bemerkten es auch, sie zückten ihre parfümierten Tücher und hielten sie sich unter die Nasen.
An der Wand dort, war das ein Kind? Die Kleine lag auf einem schmutzigen Laken, das einen Strohsack notdürftig bedeckte. Ihre Augen waren geschlossen, der Atem ging stoßweise. »Ist sie krank?«, fragte Alice. Sie kauerte sich vor das Bettlager und strich dem Kind über die Löckchen. Der Kopf war heiß, es hatte offenbar Fieber.
Alice erstarrte mitten in der Bewegung. Die Locken lösten sich vom Kopf! Sie zog erschrocken die Hand zurück. Ein Bündel Haare fiel zu Boden.
Ottilie stöhnte auf.
»Was hat die Kleine?«, hauchte Alice.
Die Mutter sagte ein Wort, knapp, als zöge es ihr die Kehle zu. Das Wort hing in der Luft, eine Ewigkeit lang, bis Alices Verstand bereit war, es zu verarbeiten. »Typhus.«
Sie schüttelte die restlichen Haare von der Hand. Wenn sie sich ansteckte! »Sie braucht einen Arzt.«
»Der Armenarzt war gestern Abend hier. Man kann nichts mehr tun.« Der Mutter standen Tränen in den Augen.
»Wie alt ist sie?«
»Ich hätte ihr gern mehr zu essen gegeben«, brach es aus der Mutter heraus. »Der Arzt hat gesagt, der Hunger … und die schlechte Nahrung … Aber ich hatte nicht mehr, es hat gerade so für die Miete gereicht. Ich …« Sie schluchzte. »Ich habe meinem Kind zu wenig zu essen gegeben.«
Alice schwirrte der Kopf.
»Wenn man aus der Wohnung rausfliegt und nicht sofort eine neue findet«, kommentierte Hannes trocken, »wird man von der Polizei aufgegriffen und kommt für Jahre ins Arbeitshaus. Da findet kaum einer wieder heraus.«
Stumm legten Gemma und Ottilie einige Münzen auf den Tisch. Sie hielten sich immer noch die Tücher vors Gesicht. »Gehen wir«, raunte Gemma, »komm, Alice, du kannst hier nicht helfen.«
Aber Alice wollte sich nicht lösen. Das Leid, das sie sah, grub seine Krallen tief in ihr Herz. Sie konnte doch nicht einfach fortgehen und die Mutter mit der sterbenden Kleinen allein lassen! »Können wir irgendwie behilflich sein?«, fragte sie.
Der Mutter liefen die Tränen über das Gesicht. Sie schluchzte immer lauter.
Hannes nahm Alice am Arm und führte sie hinaus.
Draußen im Flur schimpfte Gemma: »Das hast du ganz genau gewusst! Die Frau hat’s dir schon an der Tür gesagt, nicht wahr? Du hast uns dem Typhus ausgesetzt! Wenn eine von uns krank wird – ich verspreche dir, wir bringen dich vor Gericht.«
Er ging stumm die Treppe hinunter, ohne Alice loszulassen.
»Schau mal, wie blass sie ist«, sagte Ottilie, als sie nach draußen traten.
»Bring uns hier weg«, befahl Gemma.
Er schlug den Weg in die Stadt ein, an den stampfenden, zischenden Fabriken vorüber. Aber kaum, dass sie durch das Oranienburger Tor getreten waren, sagte er: »Kommen Sie, ich zeige Ihnen ein weiteres Gesicht der Armut.«
»Pah!«, sagte Gemma. Sie winkte einen Gendarmen heran. »Wären Sie so gut, uns eine Droschke zu rufen?«
Alice sah in Hannes’ Gesicht und erkannte in seinem Blick die Erschütterung. Konnte es sein, dass auch er, der Führer durch das Armenviertel, die meiste Zeit die Augen vor dem Schlimmsten verschloss? Was sie gesehen hatten, berührte selbst ihn. Sie fragte: »Was willst du uns zeigen?«
»Folgen Sie mir.«
Sie ging ihm nach. Hinter sich hörte sie das wütende Rufen von Gemma. »Wo willst du hin? Alice, wir fahren! Wir werden nicht auf dich warten!«
Er bog um eine Hausecke. Vor einem Wohnhaus blieb er stehen. »He, ihr zwei«, rief er, »kommt mal her!«
Jetzt erst fiel ihr Blick auf die dünnbeinigen Kinder, die vor dem Haus mit Stöcken im Rinnstein stocherten. Sie standen auf und kamen näher.
»Das ist Alice Gauer«, sagte er. »Sie wird euch etwas schenken, wenn ihr uns erzählt, was ihr hier macht.«
»Nee«, sagte der Ältere der beiden. Seine zerrissene Hose und das Hemd waren mit Morast bekleckert. »Erst dit Jeschenk.«
Sie holte zwei Pfenninge heraus und gab jedem einen.
Die Jungen wechselten einen Blick. »Also, wir graben im Rinnstein nach Brauchbarem. Man findet immer ma wat. Een Stückchen Draht, eenen Nagel oder so. Lässt sich allet zu Jeld mach’n.«
Nie im Leben wäre Alice eingefallen, sich in den fauligen Schlamm des Rinnsteins zu knien und zwischen Kot und Abwasser nach Müll zu suchen, der sich noch reinigen und verkaufen ließ. Ihren Vater regte es ja schon auf, dass das Zeug überhaupt entlang der Straße floss und die Berliner Stadtverwaltung keine Kanalisation baute.
»Das bringt doch kaum was ein«, sagte Hannes. »Was esst ihr jeden Tag?«
»Manchma find ick eenen Knochen, den nagen wir ab. Oder wir …« Der Junge sah sich vorsichtig nach weiteren Zuhörern um. »Also, manchma fällt ooch was vom Wagen runter.«
Was hieß das? Dass sie stahlen? »Habt ihr keine Eltern?«, fragte sie.
Die Jungen lachten. »Wat? Wo komm Sie denn her? Schon ma Kinder jesehn, die keene Eltern haam?«
»Kümmern sich denn eure Eltern nicht um euch?«
»Die sind den janzen Tach inne Fabrik und schuften!«
»Der Vater ja, aber die Mutter?«
»Die Olle muss jenauso ran.«
»Und gibt es kein gemeinsames Mittagessen? Diese Knochen, die ihr da abnagt, ich meine, die lagen doch in der Gosse …«
»Mittachessen? Nee, weeßte, der Trick is, du musst die richtigen Häuser wissen, also wo viele wohnen und viel in de Josse jeworfen wird. Da findste dann ooch was.«
Sie gab ihnen noch mal Geld, jedem zwei Pfenninge. Dann verabschiedete sie sich. Als sie außer Hörweite waren, fragte sie Hannes, was aus den Kindern werden würde, später.
»Wenn sie alt genug sind, arbeiten sie auch in der Fabrik«, antwortete er. »Die meisten ziehen mit zwölf, dreizehn von zu Hause aus. Die Väter saufen viel, das erträgt keiner auf Dauer.«
Betroffen sah Alice zurück zu den kleinen Jungs. Sie knieten bereits wieder am Rinnstein und stocherten mit ihren Stöcken im Unrat.
»Wo müssen Sie hin?«, fragte er.
»Zum Schloss.«
»Kommen Sie.« Er brachte sie zur Oranienburger Straße. Dort winkte er einer heranfahrenden Droschke, aber sie war besetzt und der Kutscher hielt nicht an, er fuhr vorüber.
»Ich gehe zu Fuß«, sagte sie.
»Dann begleite ich Sie.«
»Musst du nicht. Ich finde selbst den Weg.«
Er ließ sich nicht abweisen. Sie folgten der Straße bis zur Herkulesbrücke.
»Sie haben Angst vor mir, nicht wahr?«, fragte er.
»Wie kommst du darauf?«
»Sie denken, wenn ich Sie nach Hause begleite, kundschafte ich Ihr Haus aus, und in ein, zwei Wochen breche ich dann nachts mit ein paar Spießgesellen bei Ihnen ein, um Sie zu bestehlen.«
»Nein, das habe ich nicht gedacht.«
»Aber Sie wollten mir nicht sagen, wo Sie wohnen.«
»Hab ich doch! Bist du immer so aufdringlich?«
»Ich möchte nur nicht, dass Sie etwas Falsches von mir denken. Ich schmücke manchmal eine Geschichte aus, aber ich bin kein Ganove.«
»Ach nein? Du lügst, dass sich die Balken biegen. Und du betrügst andere Menschen um ihr Geld. Wenn du mich fragst, handelt genau so ein Ganove.«
»Sie haben doch genauso gelogen«, sagte er.
»Ach ja?« Sie blieb stehen. »Wann hab ich heute gelogen?«
»Tun Sie nicht so, als wären Sie uns Ärmeren moralisch überlegen. Die Reichen stehlen auch, nur kommen sie dafür nicht vors Gericht.«
»Da wüsste ich gern ein Beispiel.«
»Die Fabrikbesitzer, nehmen wir die. Warum bekommt ein Kind in der Fabrik nur ein Sechstel des Lohns, den ein Erwachsener verdient, auch wenn es dieselbe Arbeit macht? Das ist doch Diebstahl. Und mit welchem Recht zieht man einem Arbeiter, der drei Minuten zu spät kommt, den Lohn von zwei Stunden ab?«
»Wo ist das so?«
»In der Maschinenbauanstalt der Seehandlung in Moabit, ich hab’s selbst erlebt. Der Portier schließt Punkt sechs Uhr die Tür, und wer drei Minuten nach sechs da ist, wird zwar eingelassen, aber er muss bis acht Uhr ohne Lohn arbeiten.«
Sie gingen weiter. »Das würde ich nicht mit mir machen lassen.«
Er lachte freudlos. »Wer damit nicht einverstanden ist, kann seinen Arbeitsplatz jederzeit räumen und ihn einem von den Hunderten anderen überlassen, die schon darauf warten, dass jemand gekündigt wird.«
»Hast du die Stelle auf diese Art verloren?«
»Nein. Ich bin freiwillig gegangen. Ich will nicht mit vierzig aussehen wie ein alter Mann. Jeden Tag die Schufterei von sechs in der früh bis sieben am Abend, das geht zu sehr auf die Knochen.«
Warum legte er solchen Wert darauf, mit ihr zu reden? Hoffte er auf eine Spende für die Begleitung durch die Stadt? Wenn Droschkenkutscher so redselig wurden, waren sie versessen aufs Trinkgeld.
»Und Sie?«, fragte er. »Was machen Sie?«
»Ich gehe auf eine Privatschule. Bin im letzten Jahr.« Es war ihr ein wenig unangenehm, das auszusprechen.
»Sie sind sicher froh, dass Ihre Eltern das bezahlen. Ich hatte nur sechs Jahre Schule und bin immer gern hingegangen. Unsere Lehrer an der Volksschule waren ehemalige Berufssoldaten und nicht besonders feinfühlig. Aber das Lernen hat mir Spaß gemacht.«
»Wie viele waren Sie in der Klasse?«
»Hundertzwanzig.«
Sie schluckte. »Und nur ein Lehrer?«
»Keine Sorge, der konnte sich durchsetzen.« Sie gelangten an die Börse am Lustgarten, ein dreigeschossiges Gebäude mit rotem Dach und wohlproportionierter Fassade. Er blieb stehen und sagte: »Ich lasse Sie dann mal. Werd auch nicht gucken, wo Sie hingehen. Versprochen.«
Keine Bitte um Geld? Kein fordernder Blick? Erstaunlich. »Das ist kein Geheimnis. Ich laufe einfach am Dom vorbei und bin zu Hause.«
Er musterte sie verblüfft. »Das heißt, Sie leben wirklich im Schloss?«
»Was dachtest du denn?«
»Dass Sie mich anlügen und vom Schloss aus ungesehen weitergehen wollten bis zu Ihrer Straße.«
»So was habe ich nicht nötig. Das Gebäude, in dem ich wohne, ist gut bewacht.« Sie lachte. »Da können du und deine – wie hast du’s gesagt? – deine Spießgesellen nicht einbrechen.«
»Ich dachte, der König wohnt im Schloss.« Er war immer noch verdattert.
»Das Schloss ist groß genug. Da wohnen noch ein paar mehr Leute.«
»Und Sie leben da als … Kammerzofe? Aber dann könnten Sie ja unmöglich zur Schule gehen.«
»Mein Vater ist der Kastellan.« Sein Erstaunen gefiel ihr. »Danke«, sagte sie, »dass du am Ende noch mal wiedergekommen bist. Die ehrliche Führung war beeindruckender als die erfundene. Du solltest immer ehrlich sein, Hannes, es steht dir gut.«
Er verneigte sich galant. »Wie machen Sie das bei Hofe?«, fragte er und wollte ihre Hand für einen Handkuss greifen.
Sie zog sie weg. »Lass den albernen Quatsch. Adieu, Hannes.« Sie ging. Kaum war er ihr aus den Augen, fielen ihr wieder die schluchzende Mutter und das kranke Mädchen ein. Gab es wirklich keinen Weg mehr, der Kleinen zu helfen?
Grübelnd passierte sie den Dom und trat auf das Schloss zu. Die Wache am Tor grüßte. Alice überquerte den Schlosshof. So vertraut war ihr das Treppenhaus im Spreeflügel mit seinen verzierten Geländern und den Marmorsäulen. Sie war es gewohnt, auf dem Weg nach oben an der Tür zu den Gemächern des Königs vorüberzugehen. Seit der Geburt lebte sie im Schloss, dieses Gebäude war ihr Zuhause, ihre Welt. Wie viele Wirklichkeiten gab es noch in Berlin außer ihrer eigenen?
Als Tochter des Kastellans war sie Gräfinnen und Freiherrn und Rittern begegnet. Weilte der König nicht im Stadtschloss, bewegte sie sich frei darin, beinahe so, als wäre das ganze prunkvolle Gebäude ihres. Sie kannte jedes Zimmer, jeden Dachboden, jede Küche. Und die Dienstboten schätzten sie, seit sie ein kleines Kind gewesen war.
Aber da draußen gab es eine Welt, in der man am Typhus verreckte, in der man hungerte, soff und klaute. Natürlich kannte sie Berlin. Sie kannte den Lebensrhythmus der Stadt. Zwei Stunden nach Mitternacht verhallte das Rasseln der Wagen, und es gab drei Stunden Ruhe. Dann, um fünf, öffneten die Läden, und die Arbeiter zogen in Richtung der Werkstätten und Fabriken. Sie liebte diese Uhrzeit, wenn eine wohltuende Frische über der Stadt lag wie ein unschuldiges Erwachen.
Was sie nicht gekannt hatte, war das Alltagsleben dieser Verkäuferinnen, Schlosser, Handschuhmacher und Brettschneider. Nach dem heutigen Einblick in ihre Welt kam ihr das helle, nach Kerzenwachs duftende Treppenhaus im Schloss verschwenderisch vor. Die hohen vergoldeten Türen, die sauberen Glasfenster. Die exotischen Pflanzen, die man zum Schmuck in badewannengroßen Tontöpfen aufgestellt hatte und deren Blätter glänzten, weil man sie täglich sauber wischte.
Als sie die Dachwohnung erreichte und gerade eintreten wollte, schlüpfte Bettine hinaus und schloss hinter sich die Tür. »Gnädiges Fräulein, gehen Sie da jetzt besser nicht rein.«
Ihr stockte der Atem. War den Eltern etwas zugestoßen? Oder ihrem Bruder? »Warum nicht?«, fragte sie.
In Bettines Gesicht stand Mitleid geschrieben. Sie schwieg. Es musste etwas Ungehöriges sein, das sie nicht auszusprechen wagte, etwas, von dem sie als Dienstmädchen nichts wissen durfte.
»Lass mich durch«, befahl Alice.
»Bitte, hören Sie auf mich«, versuchte es Bettine noch einmal.
»Ich sagte, du sollst mich durchlassen!«
Bettine gehorchte und machte Platz.
Im Vorzimmer sah sie keine Veränderung, nur ein Offizierssäbel lehnte da, also war ihr Bruder zu Besuch. Das war doch eine gute Nachricht! Oder hatte man ihn gerufen, weil es der Mutter oder dem Vater nicht gut ging?
Mit klopfendem Herzen öffnete sie die Tür zum Salon.
Ihr stockte der Atem. Nicht der Bruder saß dort im Sessel und plauderte mit dem Vater, sondern Victor.
Er sah zur Tür und erhob sich sofort. »Alice!« Schwungvoll trat er auf sie zu, als wollte er sie umarmen. Erst kurz vor ihr stockte er und nahm ihre Hand. Er deutete einen höflichen Kuss auf die Finger an.
Sie presste fest die Lippen aufeinander.
»So zornig? Immer noch?«
Der Vater stand ebenfalls auf.
»Ich war in der Oranienburger Vorstadt«, sagte sie, »und habe einem typhuskranken Mädchen den Kopf gestreichelt. Kein guter Tag für einen Handkuss.«
»Alice«, rief der Vater, »willst du uns den Tod ins Haus bringen? Was hast du in den Vorstädten verloren?«
»Wild und ungezähmt«, raunte Victor, »wie eh und je.« Er lächelte sein Premierleutnantslächeln, wischte sich dennoch vorsichtshalber die Lippen ab.
Die Uniform hatte Victor immer gut gestanden. Das Preußischblau des Waffenrocks wiederholte sich in seinen Augen, und die weiße Weste mit den goldenen Knöpfen gab ihm das Aussehen eines Prinzen.
»Kann ich dich nachher unter vier Augen sprechen?«, fragte er leise.
Wenn sie ihm das gestattete, hatte er sie wieder in der Hand. Ihr Ja würde die Vergangenheit vom Tisch wischen, als wäre nichts gewesen. Sie wünschte sich, mit ihm nach nebenan zu gehen und zu hören, was er erlebt hatte im vergangenen halben Jahr und ob er an sie gedacht hatte. Sie wünschte sich, wieder an seinem Arm spazieren zu gehen. Zugleich war sie wütend über das Geschehene. Gerade jetzt, da er vor ihr stand, spürte sie die Verletzung wie eine kühle Fremdheit zwischen sie fahren. Sie sagte: »Gestatten Sie, dass ich mich zu Ihnen setze?«
Der Vater sagte nichts, aber er sah sie widerstrebend an.
Sie nahmen Platz, und Vater und Victor setzten ihr Gespräch fort. Es ging um eiserne Zäune, die in Zukunft das Schloss schützen sollten. Der Stadtkommandant hatte ihn mit diesem Vorschlag zu Vater geschickt.
»So ein Unsinn«, sagte sie. »Das wäre furchtbar hässlich.«
»Es geht hier um keine Verschönerung«, erklärte Victor. »Sie sollen das Schloss schützen, falls es zum offenen Aufruhr kommt.«
»Ein Revolte gegen den König? Das sind doch Märchen.«
Vater fragte streng: »Seit wann interessierst du dich für Politik, Alice?«
Die Zurechtweisung ärgerte sie. Sie war keine, die nach der Schule nur im Zimmer hockte und Blumen malte. »Seit ich die Armut mit eigenen Augen gesehen habe«, sagte sie. »Sie ist hier in unserer Stadt, und wir tun nichts dagegen.«
»Stellst du dich etwa auf die Seite dieser Aufrührer?«, fragte Vater.
»Welche Aufrührer?«
Die Männer schmunzelten spöttisch und ein wenig erleichtert. Victor ließ sich herab, es ihr zu erklären. »Einige Rädelsführer wollen die Stadt in Unruhe versetzen. Ist dir nichts aufgefallen? In den Kaffeehäusern, Lesekabinetten und Konditoreien drängen sich die Leute um die Zeitungen, Männer steigen auf einen Stuhl und lesen der Meute Artikel vor. Man verlangt Unterstützungskassen für Krankheit und Alter. Viele fordern sogar eine Verfassung.«
»Der König wird natürlich Stärke zeigen«, sagte Vater. »Nur mit dem Königtum als Eckpfeiler können wir die Zivilisation verteidigen. Eine Volkssouveränität wie in Frankreich oder Amerika bringt Anarchie und Chaos.«
»Wie wollen Sie das wissen, Vater, wo wir doch eine preußische Volkssouveränität noch nicht probiert haben?«, fragte sie.
Der Vater nahm Fahrt auf. Wie immer, wenn er sich in Rage redete, fing er an, feine Tröpfchen zu spucken. »Ich muss nicht meine Hand ins Feuer halten, um auszuprobieren, ob es heiß ist. Andere Staaten auf dieser Welt brennen bereits. Da sollten wir das Zündeln sein lassen. Diese Tendenzen, diese gleichmacherischen Anwandlungen werden im Keim erstickt, oder es geht mit Preußen bergab. Wir dürfen das ungebildete Volk nicht ans Ruder lassen.«
Sie wandte ein: »Aber sind wir nicht alle von Gott gleich geschaffen?«
»Natürlich nicht!«
»Es gibt Talente und Begabungen, das meine ich aber nicht.« Sie sah Hannes vor sich und das typhuskranke Mädchen auf seinem Strohlager. »Ich wollte sagen, wir haben alle den gleichen Wert vor Gott.«
»Meinetwegen sollen gebildete Bürger über den Staatsetat mitbestimmen. Ich bin kein Konservativer. Aber gewisse Grenzen müssen gewahrt bleiben. Das ungebildete Volk hat nichts in der Regierung verloren.«
»Ist das nicht ungerecht«, fragte sie, »wenn wir den Großteil der Bevölkerung für dumm erklären und ihn von vornherein benachteiligen? Ich hab heute gesehen, wie man in der Oranienburger Vorstadt hungert. Die Kinder nagen Knochen ab, die sie in der Gosse gefunden haben! Und die Eltern arbeiten von früh bis spät in der Fabrik, Mann wie Frau, und kommen doch auf keinen grünen Zweig. Selbst die Armenärzte sind machtlos gegenüber der Mangelernährung und dem Schmutz, in dem die Menschen dort hausen müssen.«
Victor schien verwirrt zu sein, nickte jedoch anerkennend. Seine blauen Augen leuchteten.
Unter seinem intensiven Blick fühlte sie sich lebendiger als sonst, es war, als würde ein erfrischender Sturm ihr Inneres aufwühlen.
»Ungerecht ist das nicht«, wehrte Vater ab, »jeder kann ja, wenn er sich bemüht und fleißig ist, in das Bürgertum aufsteigen. Der Geselle wird zum Meister, der Lehrling zum Ladenbesitzer. Wir leben nicht mehr im Mittelalter, Alice, heute stehen den Leuten alle Wege offen.«
»Wenn das so einfach ist, warum machen das dann nicht alle? Meister werden oder Ladenbesitzer – glauben Sie nicht, die Mittellosen würden vor Freude im Dreieck springen, wenn sie eine solche Chance bekämen? Aber sie kriegen ja nicht mal anständige Löhne in der Fabrik.«
»Du argumentierst mit Einzelfällen, Alice. Hier geht es um die großen Zusammenhänge. Das ist alles komplizierter, als du meinst.«
»Ja, vielleicht.« Sie stand auf. »Bitte entschuldigen Sie mich. Ich bin müde. Ich werde Sie nicht länger stören.«
»Reden wir nachher noch ein wenig?«, fragte Victor.
»Lieber ein andermal.« Sie verließ den Salon.
Als sie die Tür hinter sich geschlossen hatte, lief ein freudiges Zittern über ihren Körper. Die Gewissheit, das Richtige getan zu haben, berauschte sie. Sie war stark gewesen. Natürlich würde es Victor ohne ihre Zustimmung nicht wagen, sie nach dem Gespräch mit Vater aufzusuchen. Sie hatte ihm gezeigt, dass nicht einfach alles vergeben und vergessen war.
4
Polizeipräsident von Berlin – dieses Amt vergaben sie nur deshalb außerhalb des üblichen Ämtergeschachers, weil die Zeiten schwierig waren. Das war Julius von Anfang an bewusst gewesen. Wie gefährlich die Lage war, dämmerte ihm allerdings erst jetzt, im neunten Monat nach Dienstantritt.
»Sind Sie sicher?«, fragte er und musterte den Spitzel.
»Herr Polizeipräsident, ich schwöre, sie sitzen im Hinterzimmer der Zeitungshalle und schmieden Pläne.«
Er schob ihm ein Blatt Papier und eine Feder hin. »Notieren Sie die Namen aller Personen, die Ihnen bekannt sind.«
Während der Spitzel schrieb, massierte sich Julius die Schläfen. Anfangs hatte ihm die Arbeit Spaß gemacht. Er hatte seinen Spionen Decknamen wie Nepomuk oder Heimbert gegeben und war höchstpersönlich zu Pferde durch die Stadt Patrouille geritten und hatte die Straßen erkundet. Seit er vor zwanzig Jahren zu Beginn seines Studiums die preußische Hauptstadt verlassen hatte, war Berlin um einiges gewachsen. Die Stadt war so anders als Posen, so gewaltig, so imposant!
Inzwischen aber drohte ihm die Sache über den Kopf zu wachsen. Das hässliche Gefühl, dass ihm die Zügel aus den Fingern glitten, ließ ihn nachts kaum noch schlafen.
Er nahm den Zettel entgegen und überflog die Namen. »Gehen Sie«, sagte er.
Der Spitzel kratzte sich das Kinn. »Meinen Sie nicht, ich sollte –«
»Gehen Sie«, wiederholte er.
»Ja, Herr Polizeipräsident.« Der Spitzel verließ mit kaum verhohlener Unzufriedenheit das Büro.
In Posen war es Julius mehrfach gelungen, nationalpolnische Aufstandsversuche zu ersticken. Bis in die höhere Aristokratie hinein hatte er die Rädelsführer aufgespürt und festgenommen, sogar den Erzbischof von Gnesen und Posen, der am Aufstand beteiligt war, hatte er von Berittenen auf die Festung Kolberg bringen lassen. Aber Berlin war anders. Die Rebellen verbargen sich im wogenden Menschenmeer und waren darin unauffindbar, bis sie plötzlich irgendwo auftauchten und zuschlugen.
»Paul!«, rief er.
Der Sekretär betrat den Raum.
»Setzen Sie sich hin, ich diktiere einen Brief.«
Er wartete, bis der Sekretär umständlich Platz genommen hatte, die Federspitze eintauchte und sie am gläsernen Fässchen abstreifte.
»Sind Sie so weit? Schreiben Sie: Ich erachte es als erforderlich, beim ersten Ausbruch einer Bewegung erstens das Königliche Schloss zu besetzen.«