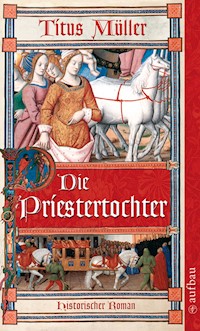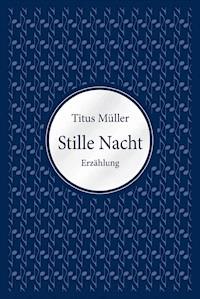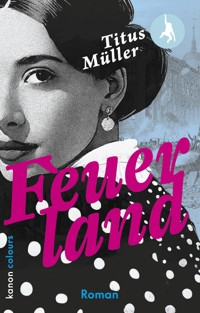Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: adeo
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In diesem zauberhaften Buch machen Titus Müller und Gaby Trombello-Wirkus ganz neu Lust auf die fast vergessene Kunst des Briefeschreibens. Wir erfahren von Titus Müller, warum Briefeschreiben glücklich macht und warum diese entschleunigende Art der Kommunikation gerade eine Renaissance erlebt. Auf seine unnachahmliche Art erzählt er Geschichten um besondere Briefe und Briefwechsel von Robert Schumann und Clara Wieck, Harry Rowohlt, Antoine de Saint-Exupéry, C.S. Lewis, Ludwig van Beethoven oder Rosa Luxemburg, die berühren und inspirieren. Gaby Trombello-Wirkus, Grafikerin mit einer Passion für schönes Schreiben, trägt die "praktische" Seite bei: Was braucht man eigentlich, um einen schönen Brief zu schreiben? Mit praktischen Material-Tipps, einfachen Übungen, die eigene Handschrift zu verschönern, und inspirierenden Ideen, einen Brief stilvoll und lebendig zu entwerfen, weckt sie die Begeisterung, sofort loszuschreiben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Einführung: Die fast vergessene Kunst des Briefeschreibens
„Schreiben Sie mir nur ein einfaches Ja?“ Robert Schumann und Clara Wieck
Wie das Schreiben eines Briefes hellwach und lebenszugewandt macht
„Sagen Sie mir ein Mittel, damit ich nicht wie ein Narr vor Freude zittere“ Franz Kafka und Felice Bauer
Zärtliche, entzückte oder erboste Briefe
Die wunderbare Qual der Wahl: Das Handwerkszeug
Sonntagsbriefe Antoine de Saint-Exupéry und Consuelo Carrillo
„Sind Sie vielleicht bey Cassa ...“ Heikle Briefinhalte
So individuell wie Ihr Fingerabdruck – das Schriftbild
Lebenswichtige Briefe
„Nicht mein Herz zerreißen“ Josephine von Brunsvik und Ludwig van Beethoven
Komponiert mit Herz und Hand – der Brief
„Ein Brief fühlt sich an wie Unsterblichkeit“ Wenn Briefe die großen Fragen behandeln
„Warum läßt Du mich allein?“ Rosa Luxemburg und Leo Jogiches
Auf einer einzigen Seite die Welt
Über die Autoren
Verwendete Literatur (gut geeignet zum Weiterlesen)
Anhang
Einführung:Die fast vergessene Kunst des Briefeschreibens
»Das Einzige, was wir verloren haben, ist die Zeit, die wir mit unserem Zorn und unseren Klagen vertan haben. Man hätte diese Zeit retten und stattdessen irgendetwas anderes schaffen sollen, einen Tisch, einen Brief, ein Liebeslied …«1
Consuelo de Saint-Exupéry
Ich habe eine besondere Beziehung zu Briefen.
Während meiner Schulzeit in der DDR wurde mir ein russisches Mädchen als Brieffreundin zugewiesen. Meine Motivation, Russisch zu lernen, wuchs rapide. Ich erinnere mich an ihre schöne Handschrift und an die Freude, die es machte, Briefe von ihr zu empfangen.
Dann fiel die Mauer, und ich verbrachte mit 15, als Teenager, zusammen mit meiner Familie ein Jahr in den USA. Während dieser Zeit lernte ich George Dunder kennen. Seine Frau kochte Suppe für einige Freunde und mich, und wir verbrachten anderthalb Stunden in ihrem Haus. George saß im Rollstuhl, er liebte seinen Garten, und wir unterhielten uns gut.
Ich sah George nur dieses eine Mal. Aber wir schrieben uns von da an Briefe, über Jahre hinweg. Ich teilte alles mit ihm – mein erstes Verliebtsein, meine Lebensträume, bedrückende Fremdheitsgefühle (die wohl jeder Teenager durchmacht) genauso wie Höhenflüge. Er war weit weg, auf einem anderen Kontinent. Ich vertraute ihm Dinge an, die ich nicht einmal meiner Familie erzählte.
Eines Tages schrieb er mir: »Titus, deine Briefe sind was Besonderes. Du solltest aus dem Schreiben etwas machen.«
Er war ein Mentor für mich geworden, und er half mir zu sehen, wo meine Talente lagen. Ich fing an, Biografien von Autoren zu lesen. Ich gründete eine Literaturzeitschrift, die Federwelt, und erzählte ihm begeistert davon.
Inzwischen habe ich über ein Dutzend Romane und etliche Erzählungen und Sachbücher veröffentlicht und ernähre meine Familie mit dem Schreiben. Dass ich gewagt habe, diesen Weg einzuschlagen, verdanke ich dem Briefwechsel mit George.
Kein Wunder also, dass die fast vergessene Kunst des Briefeschreibens mir am Herzen liegt. Viele Erfindungen vergangener Jahrhunderte brauchen wir nicht mehr. Zwischengas beim Autofahren? Braucht kein Mensch. Klobige Datasetten statt winziger USB-Sticks? Zum Glück abgeschafft. Kratzige Unterwäsche aus Wolle? Muss nicht sein.
Es gibt aber auch Errungenschaften der Menschheit, die sich über die Jahrhunderte kaum verändert haben und die wir nicht entbehren wollen. Die Brille. Das Rad. Frisch gebackenes Brot. Bücher.
Wie sieht es mit Briefen aus?
Während wir dieses Buch schreiben, will die Post in Deutschland das Austragen von Briefen an Montagen beenden. Sie will ihr Filialnetz ausdünnen und zudem die Vorgabe lockern, dass 80 Prozent aller Briefe am nächsten Tag bei ihren Empfängern sein müssen. (Wozu sie bisher gesetzlich verpflichtet ist. Im Gegenzug für diese flächendeckende Versorgung ist die Post weitgehend von der Mehrwertsteuer befreit.)
Ich finde es nicht schlimm, wenn montags keine Post mehr im Kasten ist. Aber es ist unverkennbar: Der Brief ist auf dem absteigenden Ast. Dabei schreibt man nirgendwo auf der Welt so fleißig wie bei uns. Immer noch sind es knapp 60 Millionen Briefe jeden Tag, die von der Post befördert werden. Gerade in Zeiten der Corona-Krise sind persönliche Begegnungen erschwert und ein Brief kostbar wie der Besuch eines guten Freundes.
Vor hundert Jahren wurde die Post zweimal täglich ausgetragen, außer sonntags, da kam sie nur einmal. Kleine Poststationen fuhren mit dem Zug mit; man konnte einen Brief, wenn er besonders schnell befördert werden sollte, direkt zum Bahnhof bringen und am Gepäckwagen bei der Bahnpost einwerfen, kurz bevor beispielsweise der Schnellzug von Prag nach Berlin losfuhr. Der Brief hatte einen anderen Stellenwert, als das heute der Fall ist.
Ich bin kein rückwärtsgewandter Mensch. Ich genieße zum Beispiel die Fußbodenheizung bei uns im Bad. In meiner Kindheit mussten meine Eltern noch Eimer voller Kohle aus dem Keller heraufschleppen und Öfen beheizen, heute wird über Leitungen von Tausenden Kilometern Länge Erdgas in unser Haus gebracht und verbrennt in einer Therme und sorgt für Wärme in der Wohnung. Ich schätze die beschleunigte Bahnstrecke von München zu meinem Bruder nach Berlin (jetzt nur noch viereinhalb Stunden!), und ich schreibe E-Mails, weil ich nicht gern telefoniere. So kann ich mit meinem anderen Bruder, der in den USA lebt, kommunizieren, ohne wochenlang auf Antwort zu warten.
Aber eine E-Mail schreibt man anders als einen Brief. Die Mail wird vom Gegenüber eilig überflogen, beantwortet und weggeklickt, das wissen wir beim Verfassen. Entsprechend zerstreut ist unsere Stimmung, während wir die Mail tippen. Sie wird nicht von ihm zum Tisch getragen, behutsam geöffnet, glatt gestrichen und dann genussvoll gelesen. Sie wird nicht jahrelang in einer Schuhschachtel aufbewahrt und später wieder herausgeholt, um sie erneut zu lesen. E-Mails haben etwas Bürohaftes, sie tragen den Beigeschmack von Strafarbeit, von Erledigung, auch wenn wir täglich mehrmals voller Gier unser Mailpostfach überprüfen. Sobald neue Mails geöffnet sind, sinkt ihr Wert für uns rapide.
Ein Brief dagegen verhilft nicht nur dem Empfänger zu tiefgründigen Gedanken, er schenkt auch dem Schreibenden etwas: Konzentration und die wohltuende Versenkung in einen Gedankengang.
Einen Brief beginnt man nur, wenn die Tagessituation eine gewisse Ruhe und Konzentration ermöglicht, während eine Mail oder ein Anruf einen jederzeit ereilen können, man hat den Kopf voll mit anderem, geht unkonzentriert an den Apparat und ist gezwungen, plötzlich zu reagieren, ist während des Redens womöglich außerdem abgelenkt von den anderen Leuten im Raum, den wartenden Aufgaben, den Nebenbei-Tätigkeiten (meine Frau spült während des Telefonierens ab oder legt Wäsche zusammen). Wir sind »eigentlich gerade auf dem Sprung«, unsere Konzentration ist nur oberflächlich. Im echten Gespräch sind wir schlagfertiger und präsenter als beim Telefonieren – und ebenso im Brief, für den wir uns sammeln können.
Indem jemand sich im Brief ausdrückt, ordnet sich sein Leben. Er nimmt seine Ziele fester in den Blick, kann sich eine neue Klarheit schaffen. Das Eintauchen ins eigene Bewusstsein (das wir in der Eile des Alltags meist lieber vermeiden, aus Sorge, in diffusen Gefühlsbereichen herumzutasten und uns darin zu verirren), ist hier gewollt: Beim Schreiben eines Briefs durchwandern wir dieses Land mit neu gewonnener Sicherheit. Insofern hat der Brief Ähnlichkeit mit dem Tagebuch, er hilft dabei, mich zu formen.
Für eine Mail brauche ich Mikroprozessoren, die von Lüftern gekühlt werden, Speicherplatz, Strom, eine Internetverbindung, einen Bildschirm, eine klackernde Tastatur. Für einen Brief genügen ein Blatt Papier und ein Stift.
Ein Brief macht den Tag schöner
Echte Briefe sind heutzutage selten geworden. Umso mehr werden sie geschätzt. Sie geben uns das Gefühl, für jemanden wichtig zu sein. Ein Brief macht den Tag schöner, und nichts anderes hat der Absender bezweckt.
Menschen wie Gaby Trombello-Wirkus sind in der Lage, diesen Schönheitsgenuss noch zu steigern, indem sie die Schrift zum Kunstwerk machen. In ihrem SCHRIFTSCHATZ-Atelier in Düsseldorf lehrt sie andere Menschen die Kunst des schönen Schreibens. Ihre Schrift singt, sie ist musikalisch.
Als wir uns trafen, war mir schnell klar, dass Gaby und ich uns für dieses Buchprojekt perfekt ergänzen. Nicht nur, weil meine Handschrift, wenn ich mich nicht sehr bemühe, ausschließlich von mir entziffert werden kann.
Gaby vermag die Stärken des Briefs in einem wichtigen Bereich auszuleuchten, über den ich nur unbeholfen reden kann. Jeder Brief ist ein Unikat, und wenn der Verfasser oder die Verfasserin besondere Liebe in das Schreiben legt, wird er zum Wunderwerk. Ich bin sicher, ihre Kunst wird Sie genauso bezaubern, wie sie mich bezaubert hat.
Gemeinsam würden wir uns freuen, nicht nur Ihre Bewunderung zu wecken, sondern auch Ihre Experimentierbereitschaft und den Wunsch, selbst einmal auszuprobieren, einen Brief schön zu gestalten. Wir hoffen, dass wir einen kleinen Beitrag dazu leisten können, die fast vergessene Kunst des Briefeschreibens ins 21. Jahrhundert hinüberzuretten, und wollen in Ihnen die Lust wecken, wieder einmal zu Stift und Papier zu greifen.
Ein lohnender Blick zurück
Erstaunlicherweise haben, während wir allmählich die Briefpost abschaffen, in Buchform veröffentlichte Briefsammlungen Hochkonjunktur. Wir lechzen nach authentischen Briefen, nach ihrer pointierten Tiefe. Die Zusammenstellung von Briefen bekannter Persönlichkeiten mit dem Titel »Letters of Note«2 war ein Bestseller in vielen Ländern. Inzwischen sind weitere Bände erschienen, und Events mit dem Titel »Letters live«, bei denen Promis wie Benedict Cumberbatch, Katie Holmes, Jude Law und Sir Ben Kingsley Briefe vorlesen, locken große Menschenmengen in die Säle in London, New York oder Los Angeles. Währenddessen erscheinen weitere Briefsammlungen berühmter Autoren, Künstler, Wissenschaftler oder die gesammelten Briefe eines Liebespaars.
In Europa glaubte man lange, es gehe mit der Menschheit ausschließlich vorwärts und aufwärts. Die Technik würde helfen, alle Probleme zu lösen, und vom Wissen und den moralischen Standards her entwickele sich die Gesellschaft immerzu weiter.
Der Untergang der Titanic gab dieser Sichtweise den ersten Dämpfer. Dann kamen der Erste und der Zweite Weltkrieg, und man bemerkte erschrocken, dass es auch bestürzende Rückschritte geben konnte.
Immer noch sehen wir eher nach vorn als zurück, und es ist gut so. Aber es gibt auch vieles, das wir aus der Vergangenheit lernen können. Deshalb widmet sich dieses Buch nicht nur den vielen guten Seiten und Techniken des schönen Schreibens, sondern auch besonderen Briefen von besonderen Menschen, in denen wir Vieles wieder neu entdecken können: Intensität, Offenheit, Briefkunst. Für sie haben Briefe ähnlich viel bedeutet wie für mich selbst. Sie haben den Glauben erklärt und tiefe Gedanken in Worte gekleidet, haben Liebe aufblühen lassen oder sie zerstört, haben Abschied bedeutet und Neubeginn.
Ich hoffe, dass die kleinen Reisen in die Briefwechsel und das Seelenleben bekannter Persönlichkeiten, auf die ich Sie mitnehmen möchte, Ihnen ebenso viel Freude machen wie mir.
Willkommen in der Welt der Briefe!
Es ist das Jahr 1828. Robert, Sohn eines Verlagsbuchhändlers und musisch begabt, beginnt aus Vernunftgründen ein Jurastudium. Aber statt sich auf seine Studien zu konzentrieren, spielt er jeden Tag zwei Stunden Klavier. Er spaziert durch Leipzig, nimmt Unterricht beim berühmten Klavierpädagogen Friedrich Wieck, und Wieck erkennt bald sein Talent: Er nennt ihn einen »Tollwütigen« auf dem Klavier.
Friedrich Wieck hat eine Tochter, Clara, sie ist dreizehn und auf dem Weg, eine berühmte Virtuosin zu werden. Auch sie unterrichtet der Vater, und sie tritt in diesem Jahr zum ersten Mal öffentlich auf – im Gewandhaus.
Bald freunden sich Clara und Robert an. Die Dreizehnjährige widmet ihm, der neun Jahre älter ist als sie, ein von ihr selbst komponiertes Klavierstück, »Romance variée«. Robert antwortet darauf, indem auch er ein Musikstück für sie schreibt, das »Impromptu Nr. 5«, und darin Claras Thema aufnimmt. Ein frühes musikalisches Gespräch, als hätten die beiden damals schon geahnt, dass sie einmal ein Paar werden würden.
Noch ist sie ein Kind, und er erzählt ihr Gespenstergeschichten, sie lachen gemeinsam, albern herum. An Liebe ist nicht zu denken.
1829, ein Jahr später, wechselt Robert an die Universität Heidelberg. Auch dort widmet er sich nicht in erster Linie dem Jurastudium, sondern der Musik. Bald ist er der bekannteste Klavierspieler in der Stadt, jeden Abend ist er irgendwo eingeladen, und es kommen sogar Besucher vom Hof in Mannheim, um ihn zu hören.
In einem Brief bittet er die Mutter, sie möge verstehen, dass er sich künftig ganz der Musik widmen wolle. Sie fragt bei Wieck in Leipzig nach, was er davon halte, und der rät zu und sagt, aus Robert könne viel werden.
Robert kommt 1830 also zurück nach Leipzig und zieht jetzt bei seinem Klavierlehrer ein. Die Freundschaft von Clara und Robert vertieft sich. Das Mädchen ist wild und stürmisch, aber auch frühreif-klug. Vor allem zeigt sich ihr überragendes Talent als Pianistin, das durch zahllose strenge Übungsstunden mit dem Vater geschliffen wird.
Roberts Weg als Pianist hingegen kommt abrupt zu einem Ende, als durch einen Nervenschaden der dritte Finger seiner rechten Hand gelähmt wird. Er muss sich auf das Schreiben über Musik und auf das Komponieren verlegen.
Clara und ihr Vater sind auf großen Konzerttourneen unterwegs, Clara tritt in Magdeburg auf, in Braunschweig, Hannover, Bremen und Hamburg.
Als sie 1835 von einer solchen Tournee nach Leipzig zurückkehrt, sieht Robert sie mit neuen Augen. Sie hat sich verändert. Längst ist sie nicht mehr das Kind, das sich bei seinen Gespenstergeschichten gruselte oder über seine Scherze lachte. Ihre weibliche Ausstrahlung fasziniert ihn, macht ihn scheu.
Als er auf Verwandtenbesuch in Zwickau ist, vermisst er Clara. Er hat ihr schon früher, als sie noch ein Kind war, Briefe geschrieben, und sie hat ihm kindlich vergnügt geantwortet, aber jetzt schreibt er einen Brief, der anders klingt. Vorsichtig gesteht er ihr, dass er immerzu an sie denken muss. Clara antwortet kurz darauf:
»Eben wand ich mich wie ein Wurm durch Ihre Sonate, welche zwei Herren aus Hannover gern hören wollten, als ein Brief an mich kam, und woher, dachte ich? Da las ich Zwickau. Sehr überrascht war ich, denn als Sie hier weggingen, gaben Sie mir nicht viel Hoffnung zu solch einem Brief. Zwei Stunden lang hab ich ihn studiert, und doch sind noch einige trotzige Wörter da, welche durchaus nicht in meinen Kopf wollen.«3
Der Rest ihres Briefes beschäftigt sich mit der Partitur, die sie gerade schreibt, mit einem Besuch von Mendelssohn bei ihnen, mit Grüßen. Aber kleine Gesten verraten, dass ihr Robert auch nicht gleichgültig ist: Warum würde man zwei Stunden mit einem Brief verbringen, wenn er einem nicht viel bedeutet?
Wenige Wochen später, im November 1835, küssen sie sich zum ersten Mal. Clara Wieck ist 16 Jahre alt. Er nennt sie zärtlich »Chiara« und gibt einem Stück aus seinem Klavierzyklus »Carnaval« den Titel »Chiarina«.
Als Clara Anfang des Jahres 1836 auf eine Konzertreise nach Dresden geht, reist Robert ihr nach, und sie treffen sich heimlich. Vier Tage verbringen sie zusammen, dann müssen sie sich verabschieden. Robert reist weiter nach Zwickau.
Friedrich Wieck erfährt von den beiden und tobt. Ein Nichtsnutz sei Robert Schumann, ein Schlendrian! Was wolle Clara mit diesem Studenten ohne Abschluss? Er droht damit, Schumann zu erschießen. Hart und unmissverständlich befiehlt er Clara, die Sache zu beenden. Sein Haus dürfe Schumann nicht mehr betreten, und Briefe Schumanns habe sie ungelesen zurückzuschicken. Er weiß, dass diese Briefe gefährlich sind.
Robert Schumann kann gut schreiben, schon mit fünfzehn Jahren hat er mit seinen Freunden einen Literaturkreis gegründet, er liest viel, und Friedrich Wieck ahnt, dass nur wenige Zeilen genügen würden, in Clara neue Liebe zu entfachen.
Man kann Wiecks Furor nachvollziehen. Clara ist eine Ausnahmepianistin geworden, eine Berühmtheit, und die Sorge ist nicht unberechtigt, dass ihr Weg auf den Bühnen Europas nach einer Heirat abrupt zu Ende wäre. Robert Schumann hingegen ist als Schwärmer bekannt. Wie viel kann man auf seinen Gefühlsüberschwang geben? Dass Robert es ernst meint, dass echte Liebe entstanden ist zwischen Clara und ihm, sieht Friedrich Wieck nicht.
Robert bricht es das Herz. Er fantasiert nächtelang auf dem Klavier, bis es Ärger mit der Hauswirtin gibt. Er widmet Clara seine erste Sonate, ohne Antwort von ihr zu erhalten, und versucht, seinen Kummer mit Wein zu ersäufen.
Ein ganzes Jahr lang sieht er Clara nicht, obwohl er in der Nähe wohnt. Manchmal steht er im abendlichen Dunkel vor ihrem Haus und hört sie Klavier üben. Ob sie ihn überhaupt noch liebt, weiß er nicht, sie nimmt keinen Kontakt zu ihm auf.
Auch Clara ist sich unsicher, ob Robert noch an sie denkt oder ob seine Gefühle längst erloschen sind. Von einer längeren Tournee nach Leipzig zurückgekehrt, lässt sie Robert über einen gemeinsamen Freund zum Konzert im Börsensaal am 13. August 1837 einladen.
Als sie sich an diesem Abend auf der Bühne an den Flügel setzt, ist es erneut die Musik, die zwischen ihnen eine Verbindung aufbaut. Denn Clara spielt eine Komposition des Mannes, den sie liebt: Sie spielt die »Symphonischen Etüden« von Robert Schumann, die noch nie aufgeführt worden sind. Es ist wie eine Frage, die ohne Worte durch den Raum schwebt zu dem Platz, auf dem Robert sitzt: Denkst du noch an mich? Ich denke an dich.
Nach diesem Konzert finden die zwei wieder zusammen. Sehen dürfen sie sich nicht, nur selten einmal gelingen heimliche Treffen. Aber sie schreiben sich Briefe. Anfangs sind sie unsicher, sie Siezen sich nach der langen Schweigezeit, obwohl sie längst beim Du gewesen waren.
Robert beginnt, er schreibt den ersten Brief noch am Tag des Konzerts, am 13. August. Der entscheidende Satz darin lautet: »Schreiben Sie mir nur ein einfaches Ja?« Clara wird in vier Wochen achtzehn werden, und Roberts Plan ist es, sich am Tag ihres Geburtstags noch einmal mit einem Brief an Friedrich Wieck zu wenden. Clara antwortet:
»Nur ein einfaches ›Ja‹ verlangen Sie? So ein kleines Wörtchen – so wichtig! doch – sollte nicht ein Herz so voll unaussprechlicher Liebe, wie das meine, dies kleine Wörtchen von ganzer Seele aussprechen können? Ich tue es und mein Innerstes flüstert es Ihnen ewig zu. Die Schmerzen meines Herzens, die vielen Tränen, konnt’ ich das schildern – o nein! – Vielleicht will es das Schicksal, daß wir uns bald einmal sprechen und dann – Ihr Vorhaben erscheint mir riskiert, doch ein liebend Herz achtet der Gefahren nicht viel. Also abermals sage ich ›Ja!‹. […] Ihre Clara«4
Was muss es ihm bedeutet haben, diesen Brief zu empfangen! Mit welchem Herzklopfen wird er ihn geöffnet, wie oft wird er ihn gelesen haben! Allein die Handschrift Claras zu sehen.
Dass die Handschrift bei einem Brief eine weitere Ebene öffnet, dass sie etwas sagt über das Empfinden der Verfasserin, ist auch Clara bewusst. Ein paar Tage später schickt sie Robert einen weiteren heimlichen Brief, überbracht von ihrer Nanny, die sie eingeweiht hat, und schreibt darin: »Meine Unruhe sehen Sie aus dieser Schrift.«5
Der Vater reagiert auf Roberts vorsichtige Anfrage kalt und abweisend, er sieht Robert als Querkopf, dem er seine sorgsam erzogene Tochter mit all ihren kostbaren Talenten und Fähigkeiten unmöglich anvertrauen kann. Von seinen Kompositionen und redaktionellen Arbeiten wird Robert kaum eine Familie ernähren können, und ob die Liebe hält? Robert Schumann ist ein Herumtreiber, der in Kaffeehäusern und Kneipen sitzt und unmäßig trinkt – so denkt Wieck von ihm. Friedrich Wieck untersagt ihm jeden Kontakt zu Clara.
Robert ist niedergeschmettert. Aber diesmal bleiben die Liebenden in Verbindung, und sie betrachten sich als (heimlich) verlobt. Treffen sind kaum möglich, immerhin, ihnen gelingt mitunter ein kurzer Blickwechsel. Am 9. Oktober 1837 schreibt Robert:
»Dein ›guten Abend‹ gestern, Dein Blick, als wir uns vor der Türe sahen, ich will es nie vergessen. Also diese Clara, dachte ich, dieselbe ist dein – ist dein, und du kannst nicht zu ihr, ihr nicht einmal die Hand drücken.«6
Clara schreibt, es zerreiße ihr das Herz, ihn im Rosental in einer Laube sitzen zu sehen,
»von Vater und Mutter beobachtet, gleichgültig scheinen zu müssen – gleichgültig gegen Dich! Nein, das ist nicht zu ertragen […] und ich soll da allein sitzen mit meinem Gram und meiner Sehnsucht, […] zwanzig Schritte von Dir und doch so ferne!«7
Wenige sind eingeweiht, und so kommt es zu eigenartigen Situationen. Einmal gibt ein gemeinsamer Bekannter Clara einen Brief Robert Schumanns, weil er einige Zeilen nicht lesen kann, ob sie die entziffern könne? (Robert entschuldigt sich in Briefen oft für seine schlechte Handschrift.) Und Clara schreibt später heimlich an Robert davon:
»Wie wohl tat mir die Hand[schrift] und als ich Deinen Namen unten stehen sah, da wurde mir so wohl und weh um’s Herz – ich hätt mögen weinen aus Schmerz, aus Freude!«8
Friedrich Wieck überwacht Clara streng und erlaubt keinen privaten Briefwechsel mit Robert Schumann, nur kurze offiziell Zeilen, wenn Schumann Klaviernoten übersendet.
Die Liebenden finden Abhilfe. Robert soll die Briefe an Clara nicht selbst adressieren, schreibt sie ihm von einer Konzertreise aus Prag, »der Vater könnte sich auf der Post die Briefe zeigen lassen und Deine Hand[schrift] erkennen«, sie bittet ihn, dass er Dr. Reuter die Adresse auf den Umschlag schreiben lasse.9
Zwei Wochen später erwähnt sie, wie schwierig es ist, ihm heimlich zu schreiben: