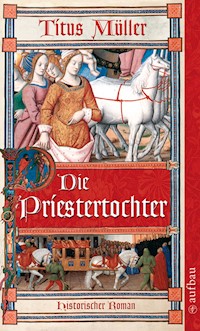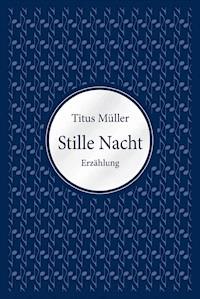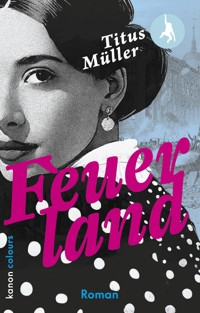Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: adeo
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Zusammengepfercht stehen die Menschen in verriegelten Waggons, die am Bahnsteig auf die Abfahrt warten. Es geht ins Verderben - das ahnen längst alle. Plötzlich hält ein Mann sein Instrument durch eine Luke nach draußen und ruft einem Passanten zu: "Nehmen Sie die Geige! Ich werde ohnehin nie mehr spielen." Zwei Hände greifen in letzter Minute danach, ehe sich der Deportationszug in Bewegung setzt. Fast 40 Jahre später beugt sich Amnon Weinstein über eine zerkratzte und verfärbte Geige. Mühsam restauriert der Geigenbauer das ramponierte Instrument. Über 60 Geigen hat Amnon Weinstein im Lauf der Jahre aufgespürt und wieder zum Klingen gebracht. Diese "Violins of Hope" werden heute in den größten Konzertsälen der Welt gespielt - und erinnern daran, dass wir das Leid der Opfer nie vergessen dürfen. Für Recherchen zum Buch war Journalistin Christa Roth mehrfach bei Amnon Weinstein in Tel Aviv zu Gast.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Teil 1 – Erinnerungsorte
Teil 2 – Amnons Reich
Teil 3 – Triumph über Nazi-Barbarei
Nachwort
Titus Müller dankt
Christa Roth dankt
Quellen
Bildteil
Teil 1
Erinnerungsorte
Ihr wollt wissen, wie viele Männer unter einem Dach wohnen? Schaut an die Wände! Es wohnen so viele Männer dort, wie Geigen daran hängen!
Isaac Lejbusch Peretz: Die Seelenwanderung einer Melodie
Dass die Nacht bereits hereingebrochen war, bemerkte Amnon Weinstein nicht. Über eine Geige gebeugt saß er in seiner kleinen Kellerwerkstatt, vor ihm das kalte, flackernde Licht einer Neonröhre. Von allen Seiten betrachtete er das Instrument. Geruhsam, sorgsam. Dann seufzte er tief. Die Geige befand sich in einem erbärmlichen Zustand, das sah er sofort. Die Oberseite ramponiert und abgenutzt. Das Holz gesplittert, ausgebleicht. Die gelackte Unterseite dagegen glänzte geradezu herausfordernd und wies weit weniger Gebrauchsspuren auf. Es schien, als würden beide Teile nicht zusammenpassen. Als seien sie zusammengesetzte Hinterlassenschaften aus verschiedenen Welten, die nichts weiter miteinander verband als die Passform. Das Verstörendste aber, das erst auf den zweiten Blick zum Vorschein kam, befand sich im Inneren des filigranen Klangkörpers. Denn was aussah wie schwarzer Staub, stellte sich als Asche heraus.
„Nehmen Sie meine Geige oder ich verbrenne sie!“ Mit diesen Worten suchten Ende der 1940er-Jahre zahlreiche verzweifelte Musiker die Werkstatt auf, die Amnons Vater Moshe gehörte, einem der ersten Geigenbauer Israels. Viele, die zu ihm kamen, hatten die Vernichtungsversuche der Nazis nur nach außen hin überlebt. Verachtet, verschleppt und verstümmelt an Leib und Seele quälten sie sich nach dem Krieg durch ihr neues Leben. Mit der Vergangenheit abzuschließen gelang den wenigsten. Auch diejenigen, die selbst nicht unmittelbar Opfer von Gewalt geworden waren, hatten zu oft mitansehen müssen, wie anderen Schreckliches widerfuhr. Die Erinnerungen an die Nazizeit waren ihnen allen ständige Begleiter. Manchen sogar in Form von Musik. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich wieder das Violinkonzert von Brahms hören konnte, sagten sie etwa. Auf Instrumenten zu musizieren, die vor den Toren der Konzentrationslager gespielt werden mussten, während entkräftete, vor Angst gelähmte Menschen in die Gaskammern getrieben wurden? Allein die Vorstellung daran war unerträglich. Um sich davon frei zu machen, sollten die einst geliebten Instrumente verstummen, in der Hoffnung, das Erlebte möge entsprechend verblassen.
Auch unschuldige Geigen, Bratschen oder Celli, die nie Teil der Tötungsmaschinerie geworden waren, wurden nach 1945, als man das Ausmaß der Verbrechen erfuhr, nahezu unantastbar. Sie zu spielen kam einem Frevel gleich. Immerhin waren nicht wenige deutscher Machart. Moshe Weinstein, der 1938 mit seiner Frau Golda gerade rechtzeitig aus dem damals noch polnischen Vilnius in das britische Mandatsgebiet Palästina fliehen konnte, nahm sich der nutzlos gewordenen, weil schwer verkäuflichen Ware an. Er verstaute sie in der hintersten Ecke seiner eigentlich viel zu kleinen Werkstatt und schützte sie so vor dem Verfall. Sein Handeln kam in gewisser Weise einer Form des Widerstands gegen die Nazis gleich. Denn die Instrumente – und damit auch die viele Arbeit, die darin steckte und seine eigene hätte sein können – zu Brennholz zu verarbeiten, war für ihn im Grunde nichts anderes, als sie nachträglich ebenfalls den Nazis zum Opfer fallen zu lassen. Das aber brachte Moshe nicht übers Herz. Genauso wenig wie darüber zu reden. Für seinen 1939 in Tel Aviv zur Welt gekommenen Sohn Amnon bedeutete dieser sprachlose Umgang mit der Nazizeit ein Leben im Schatten des Holocausts.
„Die Begriffe ‚Oma‘, ‚Opa‘ oder ‚Tante‘ und ‚Onkel‘ kannte ich als Kind nicht“, eröffnet er mir eines Nachmittags in der Werkstatt. In den Achtzigern hat er sie von seinem Vater übernommen und verbringt nun Tag für Tag in ihr – wie in einem Kokon. Außer Amnons Eltern und einem Bruder seines Vaters, der in die Vereinigten Staaten gezogen ist, hat niemand sonst den Krieg überlebt. „Meine Mutter und meine Schwester haben einmal versucht auszurechnen, wie viele Angehörige unserer Familie umgebracht wurden“, erzählt er und hält plötzlich inne, um mich direkt anzuschauen. „Sie kamen auf fast 400 Namen!“ Den Nachsatz, dass es wohl auch deshalb so viele seien, weil die Familien oft mit zehn oder mehr Kindern gesegnet waren, nehme ich kaum wahr. Überwältigt von der schieren Zahl weiß ich nichts zu erwidern und werde mir stattdessen der betretenen Stille bewusst, die sich schlagartig zwischen uns breitmacht. Nach ein paar Sekunden schließlich, die mir wie eine halbe Ewigkeit vorkommen, setzt Amnon mit gesenkten Lidern nach: „Wie kann ein Mensch am Morgen aufstehen, sich mit einem Kuss von seiner Frau verabschieden, den Tag über Juden umbringen und am Abend auf dem Klavier Chopin spielen, als sei nichts gewesen?“ Ihn treiben solche Gedanken um. Er weiß zwar, dass er auf Fragen wie diese niemals irgendwelche Antworten erhalten wird. Aber anders als früher will er sie jetzt, im stattlichen Alter von fast 80 Jahren, nicht länger ignorieren, sondern sich ihnen stellen. „Ich versuche es immer wieder“, sagt er etwas leiser und klingt dabei, als würde er sich rechtfertigen. „Ich suche einen Weg, um zu verstehen, wie so etwas Furchtbares geschehen konnte.“
Vergangenheitsbewältigung – für Amnons ehrgeizigen Vater Moshe bedeutete das vor allem verdrängen. Und vergessen, dass es einmal ein Leben gegeben hatte, in dem so viele andere gewesen waren, die auch später noch geliebt und vermisst wurden, aber dennoch unerwähnt blieben. Für ihn zählte die Gegenwart, das Auskommen seiner Familie. „Mein Vater wollte nie mit uns über früher sprechen. Sein Kummer war zu groß“, sagt Amnon, während er sich an einer Geige zu schaffen macht. Mit einem schmalen Pinsel trägt er an der Zarge durchsichtigen Lack auf, der sofort süßlich-stechend in die Nase steigt. Worüber hätte Moshe sprechen sollen, denke ich bei mir. Wie seine weißrussisch-polnische Heimat, die lange Zeit wie keine andere Region im Baltikum für Aufklärung stand, mit der Besetzung durch Hitler-Deutschland gezwungen wurde, nicht nur sich, sondern auch alles in ihr gediehene Jüdische aufzugeben? Vilnius, in das der junge, Geige spielende Moshe aus Brest-Litowsk wegen des Konservatoriums gezogen war, galt schon früh als einer der liberalsten Orte Europas. Hier fanden verfolgte Juden aus Mitteleuropa und Russland Schutz. Das sprach sich schnell herum. Weil immer mehr von ihnen in das Stadtgebiet zogen und dort zur größten Minderheit aufstiegen, nannte man Vilnius bald das „Jerusalem des Nordens“. Doch die Hochzeit dieses kulturellen Zentrums währte nur ein paar Hundert Jahre. Am Ende des Zweiten Weltkriegs war davon nichts mehr übrig. Hunderttausende Bewohner waren ermordet worden. Und die, die den Nazis entkommen waren, wurden von den Sowjets vertrieben oder deportiert. Ab Mitte der 1940er-Jahre besiedelten ausschließlich Litauer und Russen die Stadt neu und veränderten damit nachhaltig ihr Gesicht.
Zur gleichen Zeit blühte die bekannteste jüdische Siedlung – das 1909 gegründete Tel Aviv – immer weiter auf. Ab 1921 städtisch verwaltet, erhielten die dort lebenden Juden von den Briten 1934 ihre volle Unabhängigkeit. Der „Frühlingshügel“, wie das Städtchen auf Deutsch heißt, war nur wenige Kilometer entfernt von dem in südlicher Richtung liegenden Jaffa aufgebaut worden, einer mittelgroßen, nicht unbedeutenden arabischen Hafenstadt. Hier, unter der heißen Sonne des Nahen Ostens, umgeben von fruchtig duftenden Orangenhainen, hätte der Unterschied zu den antisemitischen Pogromen im kalten Europa nicht größer sein können. Und wie zum Beweis wusste man über die prekäre Lage jenseits des Mittelmeers in der „Weißen Stadt“ Tel Aviv nur wenig. Wenn überhaupt. Das wiederum, was an grausamen Details zu erfahren war, wollten viele nicht wahrhaben, weil sie das Unaussprechliche schlicht nicht für möglich hielten. Man konzentrierte sich auf die alltägliche Arbeit in den ländlichen Kommunen, sogenannten Kibbutzim, und auf das Zusammenleben mit den Arabern vor Ort, das sich immer weniger friedlich und zunehmend feindlich gestaltete. Je mehr Juden nach Nahost gelangten. Diesem neuen sich anbahnenden Konflikt schenkte jedoch noch keiner wirklich Beachtung. Die Hauptsache in jenen Jahren war, jüdischen Ankömmlingen eine Heimstätte zu bieten. Überall wurden Straßen gebaut. Im Wochentakt entstanden neue Häuser, weil der Zustrom an Neueinwanderern immer mehr anschwoll. Zumindest bis zum Ende der 1930er-Jahre, als der Zionismus seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht hatte.
Wie nah sich Moshe und Amnon waren, lässt sich für Außenstehende leicht ausmachen. In der Werkstatt hängen nicht nur mehrere Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die den Vater zeigen, sondern auch gerahmte Zertifikate, die auf seinen Namen ausgestellt sind. Die Inneneinrichtung, die einen Hauch von Antiquariat verströmt und mit teilweise fürchterlich verstaubten Instrumenten bis unter die Decke vollgestopft ist, trägt immer noch eindeutig seine Handschrift. Selbst die schmalen Laufwege, die sich Amnon etliche Male am Tag zwischen Tür, Schrank und Werkbank entlangschraubt, sind die gleichen, wie sie auch Moshe zurückgelegt hat. Unzählige Stunden haben beide hier mit- und nebeneinander gearbeitet. Wenn Amnon über seinen Vater spricht, scheint es darum beinahe so, als könnte dieser jeden Moment den Raum betreten.
Wie so viele, die den Visionen des österreichischen Publizisten Theodor Herzl über einen „Judenstaat“ anhingen, zog es auch Moshe und seine Golda in das pulsierende, aufstrebende Tel Aviv, als über Europa bereits dunkle Wolken hingen. Nachdem ihr Antrag auf Einwanderung nach Palästina durch die Briten genehmigt worden war, drehte sich bei beiden alles nur noch um ihre Ausreise. Obwohl sie einer zionistischen Familie entstammte, verfügte nur er über Hebräischkenntnisse. Golda erlernte die Sprache erst im verheißungsvollen „Heiligen Land“, nachdem sie ihr altes, unter Trümmern begrabenes Leben endgültig hinter sich gelassen hatte. Ihr gemeinsamer Weg führte das junge Paar zunächst aber nicht in die Stadt am Meer, sondern etwas weiter östlich davon. Petach Tikwa – wörtlich übersetzt „Tor der Hoffnung“ – wurde nach ihrer Ankunft die erste Station der beiden. Dort fand Moshe als Orangenpflücker Arbeit. Zu schade war er sich dafür nicht. Seine Zuversicht, die anstrengende körperliche Betätigung würde nicht von langer Dauer sein, ließ ihn das frühe Aufstehen, die Gluthitze und auch jegliche Monotonie ertragen. In weiser Voraussicht hatte er sich bereits darauf eingestellt, den Unterhalt für sich und Golda im „Gelobten Land“ wohl kaum als Musiker bestreiten zu können. Vor ihrer Emigration hatte er sich deshalb in die Kunst des Geigenbaus einweisen lassen. Als Handwerker, so nahm er an, würde er eines Tages ein sicheres Einkommen haben.
„Golda, es ist so weit!“ Golda, die gerade mit Kochen beschäftigt war, drehte sich vom Herd weg und offenbarte ihren kleinen Babybauch. Moshe strahlte. Nach einigen Monaten harter Feldarbeit war sein Plan tatsächlich aufgegangen. In der Rambam, einer kleinen, engen Seitenstraße nahe des großen Markts in Tel Aviv, sollte er endlich seine Reparaturwerkstatt für Streichinstrumente eröffnen können. Dass es sich dabei genau genommen nur um ein Zimmer in einer kleinen Zweiraumwohnung handelte, störte weder ihn noch seine Kunden. Wohnen und Arbeiten waren eins in Moshes Leben. Abgesehen von einigen wenigen Gebäuden im Dessauer Bauhausstil war man im britischen Mandatsgebiet von modernen Wohnstandards zu dieser Zeit mangels Material und Facharbeitern ohnehin noch entfernt. 1950 – sechs Jahre nach der Geburt von Amnons kleiner Schwester Esther – zogen die Weinsteins in den wohlhabenderen Norden der Stadt. In der König-Salomon-Straße etablierte Moshe seine zweite, repräsentativere Adresse. Rein äußerlich ging es der jungen Familie nicht schlecht. Auch was die Zukunft betraf, gab es nicht wirklich Grund zur Sorge. Reparaturbedürftige Instrumente fanden sich in der musikaffinen jüdischen Gesellschaft genug. Das Leben der Weinsteins war in diesen Jahren geprägt von einer willkommenen Beständigkeit. Während Moshe in der Werkstatt arbeitete, schuf Golda ein behagliches Zuhause für ihre beiden Kinder, mit denen sie ausschließlich Hebräisch sprach. Was mit der Vergangenheit zusammenhing, hatte vergleichsweise wenig Platz in Moshes und Goldas neuem Leben. Nur wer genau hinhörte und hinsah, dem fiel etwa die sich häufende, aber unkommentierte Ansammlung ungewollter Instrumente in der Werkstatt auf. Wer die Oberfläche hinter sich ließ, bemerkte, dass hinter der Fassade dieser scheinbar glücklichen Familie vieles nicht in Ordnung war.
Welche Bedeutung die unbrauchbar gewordenen Instrumente für Moshe gehabt haben mögen – offenbart hat er seine Ansichten dazu nie. Zumindest nicht gegenüber Amnon. „Wir haben nicht darüber geredet. Es gab zu viel anderes zu tun“, sagt er schnell, um einen Anflug von Wehmut zu verhindern. Vergeblich. Die sonst blau-grün strahlenden Augen glänzen verräterisch. Sein Blick wandert verlegen zu Boden. Das Licht seiner Arbeitslampe überströmt sein Gesicht wie Tränen. Immer wieder von Neuem ruft Amnon anderen und sich selbst die Leiden von Holocaust-Opfern in Erinnerung. Sich über seine ganz eigene Not zu beklagen, sein Bedürfnis nach Trost mitzuteilen, fällt ihm dagegen schwer – wie auch schon seinem Vater. Die ganze Wahrheit des Unheils, das über die, die ihm und seiner Frau in der Heimat nahegestanden hatten, erfuhr Moshe erst nach Kriegsende. Ein befreundeter Arzt aus Vilnius überbrachte ihm die Nachricht. Nach dem Einmarsch der Nazis in die Sowjetunion 1941 waren Moshes Eltern und seine Geschwister aus Brest-Litowsk in Richtung Vilnius geflohen. Wenig später wurden sie von den Nazis eingeholt und zusammen mit allen anderen Juden aus der Region nach Treblinka und Auschwitz deportiert. Das Wissen um den schrecklichen Verlust seiner Familie führte gleich in der darauffolgenden Nacht zu Moshes erstem Herzinfarkt. Seine Besuche in der Synagoge stellte er von einem Tag auf den anderen ein. „Mein Vater war nicht übermäßig religiös, aber als Sohn eines Rabbis durchaus konservativ“, erinnert sich Amnon. „Doch dieses Unglück hat ihm den Glauben genommen.“
Dieses „Unglück“, von dem so viele jüdische Familien betroffen sind, bekam den Namen „Shoah“ – Katastrophe. Die hebräische Übersetzung des griechischen Begriffs „Holocaust“ – vollständig verbrannt – steht für das bislang größte Leid, das dem jüdischen Volk widerfahren ist. Darüber zu sprechen wagte niemand. Wenn etwa der junge Amnon es doch nicht mehr aushielt und seine Mutter nach ihren Vorfahren befragte, nahm sie zur Antwort ein Buch aus dem Regal. Ein Geschichtsbuch. Auf die Fotos von entsetzlich abgemagerten, aufeinandergestapelten Toten zeigend, sagte sie zitternd: „Da! Dort ist unsere Familie.“ Danach brach sie in einen Strom von Tränen aus, der über Stunden hinweg anhalten konnte. Denn nicht nur die Familie seines Vaters, auch die seiner Mutter hatte den deutschen Todesschwadronen nicht entfliehen können. In Ponary, einem für Freizeitausflüge beliebten Wäldchen unweit von Vilnius, waren Goldas Verwandte zusammen mit zehntausend anderen Juden, sowjetischen, litauischen und polnischen Kriegsgefangenen 1941 in Massen exekutiert worden. Wie man sich dieses grausame Tun vorzustellen hatte, das beschrieb das Buch haargenau. Dennoch beließ es der verwirrte Amnon bei einer flüchtigen Betrachtung. Seine Mutter in einem derart elenden Zustand zu sehen, wollte er aller Neugier zum Trotz vermeiden. Ihm blieb nichts anderes übrig, als das Fragen einzustellen.
Das Unfassbare unterdrücken, nichts wissen wollen – das konnte die gesamte Bevölkerung des 1948 neu gegründeten Israel. Man dachte nicht an früher, sondern genoss und feierte das Leben, sich selbst, den jüdischen Zusammenhalt. Bis zum Eichmann-Prozess 1961. Da gelang es der israelischen Öffentlichkeit, die planmäßige Tötung aller europäischen Juden erstmals wirklich in ihr kollektives Bewusstsein aufzunehmen. „Ich war einen Tag bei dem Prozess dabei, weil ich musste“, sagt Amnon. „Das hat gereicht. Wir jungen Leute verstanden nämlich nicht, wie das alles hatte passieren können. Wir wollten nicht begreifen, wie man sich wehrlos töten lassen konnte. Wie man Schlange stehen konnte, nur um sich am Ende der Reihe eine Kugel durch den Kopf jagen zu lassen.“ Er spricht laut, ist sichtlich aufgebracht, so als könnte die Zündschnur seiner Worte in die Vergangenheit reichen und irgendetwas an ihrem Verlauf ändern. Seine damalige Wahrnehmung entsprach der seiner Altersgenossen. Der Staat Israel war eine neugeborene Nation der Kämpfer. „Wir haben uns im Unabhängigkeitskrieg gegen fünf arabische Armeen verteidigt! Fünf gegen einen!“, bricht es aus ihm heraus, seine Augen blitzen. „Verstehst du, was das bedeutet?“, fragt er und fährt direkt fort, ohne eine Regung abzuwarten. „Was auch immer uns noch in diesem Land erwarten sollte, hier war allen klar, dass die Geschichte sich nicht noch einmal wiederholen durfte.“
Die Kinder der Überlebenden, die sogenannte Zweite Generation, hatten nur wenig Verständnis für den Opferstatus ihrer Eltern. Insbesondere diejenigen, die mit eintätowierten Nummern auf den Armen aus den Lagern kamen, schämten sich sehr. Einerseits, weil sie überlebt hatten und damit die Frage nach dem Wie aufwarfen. Andererseits, weil sie sich überhaupt hatten vertreiben oder einsperren lassen, anstatt gegen ihre Henker aufzubegehren. Am Ende war es egal, welcher Gruppe man angehörte – die meisten fürchteten negative Reaktionen zu sehr, um sich öffentlich zu beklagen. Mitleid erwartete kaum jemand. So wurde schlichtweg verschwiegen, was keiner hören wollte. Den Holocaust detailliert aufzuarbeiten ebenso wie sich einzugestehen, dass ein Großteil der Gesellschaft traumatisiert worden war, sollte erst der dritten Generation ein Anliegen werden. Amnon stand dem Thema, wie er selbst zugibt, als Heranwachsender auch eher gleichgültig gegenüber. Krieg, Unterdrückung, Hunger und Tod, das alles betraf ihn nicht. „Sicher, ich hätte von meiner Mutter wenigstens richtig Jiddisch lernen können. Aber ich wollte mit der Diaspora nichts zu tun haben. Keiner von uns.“ Untereinander sprachen die Eltern Jiddisch und ein paar Brocken sind auch in Amnons Ohr hängen geblieben. Ärgert ihn jemand, macht er seiner Ansicht in einer Mischung aus Jiddisch und nicht ganz korrektem Deutsch Luft, das von einem schweren osteuropäischen Akzent getragen wird: „So eine Chuzpe! Das ist eine Ganove!“ Wenn man ihm daraufhin anerkennend zunickt, freut er sich wie ein kleiner Junge und erwidert stolz: „Heute habe ich wieder genug Jiddisch in meine verstopfte Dickkopf.“
Was früher nicht sein sollte und deshalb keine Beachtung fand, hütet Amnon inzwischen wie einen Schatz. Seine Abstammung verleugnet der selbstbewusste, säkulare Israeli in ihm längst nicht mehr. „Vilnius ist die Stadt meiner Eltern. Und Herman Kruks Buch1 über Vilnius ist meine Bibel“, sagt er unverblümt. Zu dieser neuen alten Identität gehört nicht nur das Sammeln von Literatur, sondern auch das Knüpfen von Kontakten und die Suche nach Hinweisen auf Vergangenes. Damit könnten sich sein desinteressiertes früheres Ich und der wissbegierige Mann, den er heute darstellt, kaum mehr voneinander unterscheiden. Amnon ist sich dieser Wandlung bewusst und lacht unverhohlen, wenn man ihn darauf anspricht, nur um kurz darauf mit einigem Ernst in der Stimme hinzuzufügen: „Wie ich haben sich viele ihrer eigenen Historie mittlerweile geöffnet. Heute wissen wir durch Projekte wie Steven Spielbergs Shoah Foundation und Museen wie Yad Vashem fast alles darüber, was unserem Volk angetan wurde.“
Obwohl es an diesem Herbsttag draußen deutlich über 30 Grad hat, merkt man im „Atelier Weinstein“ nur wenig davon. Heruntergelassene Jalousien vor den beiden Kellerfenstern sperren einen Gutteil der Hitze aus. Ebenso die Klimaanlage und der Ventilator. Das Ergebnis: Das Thermometer zeigt frische 19 Grad Celsius Raumtemperatur an. Den konzentriert arbeitenden Amnon stört das kaum. Als Israeli ist er diesen Gegensatz gewöhnt. Ich hingegen bin nach mehreren Stunden an seiner Seite froh, mich draußen in der Abendsonne aufwärmen zu können, und verabschiede mich bis zum nächsten Tag. Als ich die Treppe zum Garten hinaufsteige, kommen mir zwei Straßenkatzen entgegen. Nicht um gestreichelt zu werden, das weiß ich. Die wenigsten Katzen in Israel lassen sich so schnell auf Fremde ein. Sie nähern sich nur, weil sie auf Futter aus sind, das ihnen Amnon gibt, wenn er aus der Werkstatt kommt. Ich hingegen tauge nur wenig als Objekt der Begierde. Ich habe nichts für die beiden und bin nach kurzem Schnuppern wieder allein. Zumindest bis zur nächsten Kreuzung. Dort biege ich in die Ben-Gurion-Straße ein – einer der breitesten Boulevards, der Tel Aviv horizontal durchschneidet und nach Westen hin die Sicht auf das Meer freigibt und auf einen Haufen gut gelaunter Menschen.
Anstatt direkt zu meinem Hotel zu gehen, schlendere ich durch die Stadt. Den Gehweg säumen eine Vielzahl von Israelis, die ihren Tag bei einem Feierabendbier ausklingen lassen. Es riecht nach Gegrilltem. Nirgendwo gelingt die israelische Variante des Savoir-vivre besser als in Tel Aviv: Mittelmeerklima, Straßencafés und Bars, wohin das Auge reicht, modisch gekleidete, braun gebrannte junge Städter, die sich angeregt unterhalten, flirten. Der Nahostkonflikt mit den Palästinensern könnte nicht weiter weg sein. Das Gleiche gilt für den Holocaust. Ein paar Augenpaare lachen mich an, als ich mir an einem Kiosk ein Wasser holen will. „Shalom! Du willst Wasser? Lass mich dir etwas Richtiges zu trinken kaufen!“ – „Nein danke“, winke ich ab, lächle und gehe weiter. Mir ist nicht nach einem seichten Zeitvertreib zumute. Wie immer, wenn ich aus Amnons Welt trete, muss ich das Gehörte erst gänzlich verarbeiten, bevor ich mich auf Neues einlassen kann. Am Strand angekommen, bläst mir der Wind durch die Haare. Meine Füße vergrabe ich so tief ich kann im warmen Sand. Außer ein paar Spaziergängern und Hunden ist niemand sonst zu sehen, stelle ich erleichtert fest. Amnons Worte klingen noch in mir nach. Dabei war ich mir sicher, dass das Rauschen der Wellen mich endlich vollständig ein- und alle Schwermut aus mir herausnehmen würde. Doch mich von der Tragik des Erzählten zu lösen, fällt mir an diesem Abend schwer. Immer noch ergriffen mache ich mich nach einer Stunde in mein Hotelzimmer auf. Die Dialektik des Seins, denke ich müde, bevor ich erschöpft auf mein Kissen sinke, kann nichts anderes bedeuten, als Widersprüche zu erkennen und auszuhalten. Diese Devise gilt nicht nur für Amnons Leben, ganz Israel ist voll davon.
Mit gut zwanzig Jahren, erfahre ich am nächsten Tag, entschied Amnon, Israel den Rücken zu kehren. Sein Ziel: die Lombardei. In Cremona, am Flussufer des Po, wo die Stradivaris, Amatis und Guarneris herstammen und bis heute gültige Maßstäbe im Geigenbau setzen, wollte er die Kunst italienischer Meister erlernen. Doch so manches Spezialwerkzeug ebenso wie besonders geeignetes Holz galt es, in der oberbayrischen Isar-Stadt Mittenwald zu besorgen. Fichte für den Deckel, Ahorn für Seiten und Boden. Gutes Instrumentenholz, wie es bei Mittenwald wächst, ist nicht einfach aufzutreiben. Damit etwa das Fichtenholz besonders langfaserig und gleichmäßig wird, braucht es nährstoffarme Böden. Derartige regionale Vorzüge führten Mitte des 19. Jahrhunderts zur Eröffnung einer der bekanntesten Geigenbauschulen vor Ort. Für aufstrebende Geigenbauer wie Amnon kam es deshalb gar nicht infrage, nicht nach Deutschland zu gehen. Für den Juden in ihm konnte es kaum etwas Schlimmeres geben, als dort – gerade einmal 100 Kilometer südlich von Dachau – dem Geheimnis des perfekten Instrumentenkorpus näherzukommen.
Doch Amnons Leidenschaft war größer als seine Abscheu. Seine Liebe zur Musik ging bereits in jungen Jahren tief. Selbst eine unnötige und nicht ganz ungefährliche Operation am rechten Ohr, die seine besorgte Mutter nach einer schweren Entzündung an ihm vornehmen ließ und die ihn als Kleinkind fast sein Gehör gekostet hätte, konnte ihn nicht davon abhalten, in die verschiedenen Klangwelten von Violine, Viola und Trompete einzutauchen. Als er 17-jährig zum Armeedienst eingezogen wurde, fand er sich auch sogleich im Militärorchester wieder. Amnon schmunzelt. „Ich will mich nicht selbst loben. Aber ich war ziemlich gut.“ Paraden und Konzerte boten eine willkommene Abwechslung in dem sonst eher eintönigen Soldatenalltag. Ein Grund mehr für Amnon, sich der Musik zu verschreiben. Es sollte die Blütezeit seiner musikalischen Karriere bleiben. Sein Berufswunsch stand früh fest und ging in eine andere, wenn auch wenig überraschende Richtung. Als Junge hatte er seinem Vater regelmäßig in der Werkstatt geholfen und so das Handwerk eines Geigenbauers kennengelernt. Nach dem dreijährigen Wehrdienst galt es, Spezialwissen zu erlangen. In Italien und während der Besuche in Mittenwald und Paris absolvierte er alle notwendigen Stationen, um unter neuen kulturellen Vorzeichen handwerkliche Feinheiten auszumachen. „Das war eine fantastische Zeit“, fasst er seine Wanderjahre zusammen. Wenn er nicht arbeitete, musizierte er – und umgekehrt. Denn ein Meister seines Handwerks, das wusste Amnon bereits von klein auf, ist nicht nur Schreiner, Lackierer und Zeichner, sondern auch Musiker. Und wer musiziert, schenkt seinem Körper Halt, Takt und Harmonie. Nur rund zehn Jahre später fand Amnons Spiel ein abruptes Ende.
Es ist noch früh am Abend, als Amnon, der als Linkshänder schon immer auf seine Position besonders achtgeben musste, sein linkes Handgelenk plötzlich nicht mehr drehen kann. Seine Geige fest unter das Kinn geklemmt, nimmt er die Hand vom Griffbrett, schüttelt sie vorsichtig, um die Muskeln zu entspannen, setzt wieder an. Keine Sekunde später entweicht ihm ein Schmerzensschrei – ein kurzer, aber heftiger Krampf bemächtigt sich seiner. Fast wäre ihm das Instrument auf den Boden gefallen. An diesem Tag wird Amnon klar, was er lange befürchtet hat: Die tägliche Handarbeit an den Instrumenten verträgt sich nicht mehr mit seinem intensiven Musikspiel. Die Belastung für seine Hände ist zu groß geworden. „Darum habe ich das Geigespielen aufgegeben“, spricht er in mein Diktiergerät und erhebt sich kurz darauf ruckartig von seinem Drehstuhl, nimmt die Haltung eines Violinisten ein und demonstriert mir – an einer imaginierten Geige –, wozu genau er seit jenem Abend nicht mehr imstande ist. Der Moment dauert gerade lange genug für einen unerfahrenen Blick wie meinen, um zu verstehen, wie schwer es Amnon wirklich fällt, alle Finger der linken Hand zu kontrollieren. Dann lässt er die Arme wieder sinken und zuckt mit den Achseln. Vermissen, meint er, würde er das Violinenspiel nicht. „Ich war damals nicht schlecht, wie gesagt. Aber jetzt würde ich sicher grauenhaft klingen. Arbeiten und spielen zugleich – das geht nicht. Meine Hände sind zerstört. Also, lassen wir das!“
Von Deutschland ließ sich Amnon trotz der schmerzhaften Vergangenheit nicht abbringen. Knapp zwanzig Jahre nach seinem ersten Besuch stand der zweite bevor. Diesmal kam er allerdings aus einer gänzlich anderen Motivation. 1979 nahm er in Westberlin erfolgreich an den 30. Weltmeisterschaften im Bogenschießen teil. Unter 95 Teilnehmern erreichte er als 58. eine beeindruckende Platzierung – von der der Ausschnitt eines vergilbten Zeitungsartikels zeugt, der seitdem an einer Vitrinentür in der Werkstatt klebt. Der amerikanische Bogenschütze Larry Wise nannte Amnon in einem Interview 2007 „einen der talentiertesten Geigenbauer und Schützen, die ich kenne“. Der Sport entschädigte Amnon ein Stück weit für den Mangel an Musik. Kennengelernt hatten die beiden sich um die Jahrtausendwende, als Wise in einem Kibbutz in Westgaliläa als Trainer für die Violinschüler der dortigen Musikschule auftrat. Drei Wochen lang trainierten täglich über 50 Musiker aus mehr als 20 Ländern neben der richtigen Bogenführung in der Musik auch den treffsicheren Umgang damit im Sport. Aus der Bekanntschaft mit Wise entstand bald eine Freundschaft. Wise brachte Amnon sogar die Geige seines Großvaters zur Reparatur. „Streichinstrumente“, erklärte Amnon wie beseelt, „sind quasi Nachfahren von Pfeil und Bogen. Eine Geige, das ist eigentlich nur das Aneinanderreiben zweier Bögen.“ Während Wise ergänzt: „Mich fasziniert am Bogenschießen die lebenslange Herausforderung, die damit einhergeht. Man muss immer wieder aufs Neue versuchen, mit einem einzelnen Pfeil das anvisierte Ziel zu treffen. Außerdem liebe ich es, dem Pfeil auf seinem Weg hinterherzuschauen.“
Rückblickend lässt sich Wise’ Satz ebenso gut auf Amnons bisheriges Leben anwenden. Dass er, ausgesandt wie ein Pfeil, irgendwann Moshes Vermächtnis antreten würde, war ihm das wirklich schon als Kind klar? Stand zu keiner Zeit der Gedanke an eine andere Biografie im Raum? Amnon antwortet zunächst mit einem fragenden Blick. Dann sagt er: „Das ist für unseren Beruf nicht eben ungewöhnlich. Der Vater gibt sein Wissen an den Sohn weiter mit dem Auftrag, den Familienbetrieb fortzuführen. So wie ich es auch gemacht habe.“ Ich blicke auf seinen Arbeitstisch. Vor ihm liegt eine in ihre Einzelteile zerlegte Geige. Auf dem Tisch neben ihm eine ganze Armada von Werkzeugen. Viele ähneln Messern und kleinen Sägen, andere Stiften mit metallischen Spitzen. Das Ganze erinnert an Zahnarztbesteck. Aber ich schiebe diese Assoziation schnell beiseite und lasse mir eine kleine Einführung in die Arbeit eines Geigenbauers geben. Gleichgültig, wie gewissenhaft ein Musiker sein Instrument auch pflegt, lerne ich, mit der Zeit finden sich selbst bei den Besten Risse. Hinzu kommen Leimungen, die sich lösen sowie nötige Wirbel- und Saitenwechsel. Um etwa einen Bogen neu zu behaaren, müssen Bogenspitze und der Frosch – das Spannelement am Ende des Streichbogens – in einem speziellen Spannstock fixiert werden. Danach braucht es kleine Hobel, Schnitzer und Garn für die weitere Verarbeitung.
Mir schwirrt der Kopf. „Und wie kommt die Wölbung der Decke zustande?“, frage ich. „Holz lässt sich unter Feuchtigkeit und Hitze gut biegen. Beim Erkalten festigt sich das Material wieder und bleibt stabil. Für alles andere verwendet man einen Hobel“, antwortet Amnon. „Die Zargen bringe ich mit einem Biegeeisen in Form.“ Um die Holzstärke am offenen Gerät zu prüfen, nimmt Amnon ein Messgerät zur Hand, das wie eine Uhr aussieht und bis auf ein Zehntelmillimeter genau ist. Ich könnte ihm stundenlang schweigend zusehen, wie er ein Detail nach dem anderen unter die Lupe nimmt, doch wir haben keine Zeit. Es gilt, mumifizierte Gedanken aufzulösen, die Vergangenheit für die Dauer unserer Gespräche zur Gegenwart werden zu lassen. Zum Abschluss seiner Lehreinheit gibt er mir ein paar wichtige Tipps. „Die besten Retuschierpinsel sind aus Marderhaar, das läuft sich am besten aus.“ – „Ein gut reparierter Riss bedeutet für ein Streichinstrument selten einen klanglichen Makel. Oft schwingt der Instrumentenkorpus danach sogar viel freier.“ – „Dieser Deckenriss unterhalb eines Kinnhalters wurde nicht rechtzeitig beachtet. Staub und Schmutz haben sich an den Bruchkanten gesammelt. Siehst du? Bei einer solchen Reparatur muss der Riss vorsichtig ausgewaschen werden, bevor die beiden Teile wieder zusammengeleimt werden können. Damit erhöhen sich der Reparaturaufwand und natürlich auch die Kosten.“
Man braucht nicht lange, um zu begreifen, hier ist einer bei der Arbeit ganz in seinem Element. Man könnte fast sagen, den Geigen, Bratschen und Celli ist Amnon nicht weniger treu ergeben als seinerzeit als Soldat dem Militär. Längst ist aber die Militärmontur einer anderen, einzigartigen „Uniform“ gewichen. Klassischerweise sitzt Amnon in Leinenhose und Jeanshemd da, gelegentlich trägt er auch bräunliche Cord- oder gar rote Stoffhemden. Je nach Arbeitssituation umhüllt eine dunkelblaue Schürze seine Aufmachung. Sein dichtes, lockiges Haar bändigt er mit einem galanten Seitenscheitel, den Mund umrahmt ein hufeisenförmiger Schnurrbart. Über die Jahre hat er sich kaum verändert. Mittlerweile zwar ergraut und einen ansehnlichen runden Bauch vor sich hertragend – doch seine Augen leuchten immer noch interessiert unter dicken Augenbrauen hervor und verstärken den schelmischen Ausdruck in seinem Gesicht, wenn er sich zu einem Lächeln hinreißen lässt.
Rückblick. „Shalom, Herr Weinstein! Ich komme, um meine Violine reparieren zu lassen. Für meinen Enkel“, sagt ein alter Mann. Mit Mühe hieven seine steifen Finger den Geigenkasten auf den Holztisch vor Amnon. „Ich habe sie sehr lange nicht mehr gespielt“, sagt der Mann halb entschuldigend, während ein Amnon im besten Alter vorsichtig den Koffer öffnet. „Kein Problem, das kriegen wir schon hin.“ Amnon hört sich diese Worte zwar sagen, glauben kann er sie aber nicht, als er das Instrument zum ersten Mal in Augenschein nimmt. Dafür ist die Geige zu sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. „Oj, was haben Sie denn damit angestellt?“, will Amnon wissen. Es dauert ein paar Sekunden, erst dann hebt der alte Mann den Blick und fängt an zu erzählen. „Im KZ-Orchester habe ich zuletzt darauf gespielt.“ Pause. „Bei Wind und Wetter, morgens und abends, sogar mit klammen Händen. Es ging nicht anders.“ Es ist Amnons erste nachhaltige Konfrontation mit einem Überlebenden. Als ihm das klar wird, kann sich der junge Familienvater nicht darauf einlassen und fragt nicht weiter. Er spürt, dass er nicht in der Lage ist, dem standzuhalten, was hinter einer Mauer aus jahrelangem Schweigen verborgen lag. Noch nicht. „Am darauffolgenden Abend entdeckte ich im Inneren der Geige Aschereste. Allein der Gedanke, dass es menschliche Überbleibsel aus den Krematorien sein könnten, war so ein Schock, dass ich noch immer nicht mehr über diese Zeit hören wollte“, sagt Amnon heute.