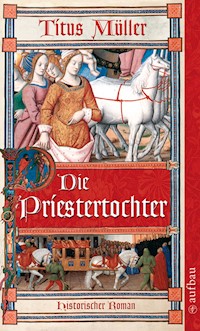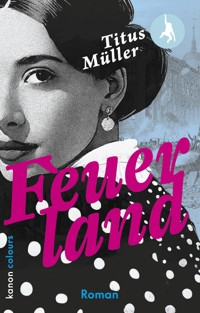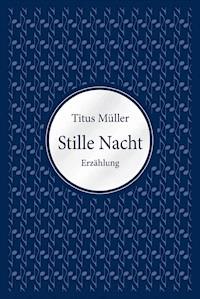
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: adeo
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die letzten Töne des Liedes hallten nach. Dann war es still in der Kirche. Die Leute sahen mit großen Augen zur Krippe hin. Endlich kamen Einzelne und bedankten sich. Es wurden immer mehr, sie wollten unbedingt Josephs Hand schütteln und die von Franz. "Stille Nacht, heilige Nacht" - am Heiligabend 1818 erklang das Lied zum ersten Mal. Heute gilt es als das bekannteste Weihnachtslied der Welt. Eingewoben in eine Erzählung voller Licht und Schatten, Brüche und Versöhnung erzählt Titus Müller, wie es entstand. 'Stille Nacht, heilige Nacht' ist eines der erfolgreichsten Lieder der Welt. Und immer wieder berührt es die Menschen, die es singen. Wo kommt es her? Und wem verdanken wir den Text und die Melodie? Das hat mich interessiert. Titus Müller
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Herbstluft war dünn, es lag ein Hauch von Gletscherkälte darin. Joseph folgte dem steinigen Weg nach oben. Ich bin zweiundzwanzig, dachte er, in meinem Alter sollte ich auf einem Bein den Berg hochhüpfen. An einer verkrüppelten Tanne blieb er stehen und hielt sich die Seiten. Vor ihm standen einige breite Bauernhäuser mit tief herabhängendem Dach, umgeben von Ställen und Scheunen. Das Haus, das er suchte, sollte anders aussehen. „Eine Keusche“, hatten sie ihm in Stranach gesagt, und als er nicht verstand: „Ein kleines Holzhaus mit ein bisschen Acker drum herum, nicht genug zum Leben und nicht genug zum Sterben. Was suchen Sie denn beim alten Keuschler?“
Er habe Grüße auszurichten, hatte er gesagt. Eine Lüge.
Drei Kühe am Hang hoben die Köpfe. Ihre Halsglocken läuteten. Er stieg weiter hinauf.
Er wusste, er gehörte nicht hierher. Ein Musiker und Theologe, ein Dichter und Hilfspriester aus der Stadt, was hatte er in den Bergen verloren? Die Waden und die Oberschenkel brannten unangenehm, er würde morgen Muskelkater haben.
Diese Berge! Wie klein und unbedeutend war man als Mensch angesichts ihrer Größe, kaum mehr als ein Floh, der ihnen über den Körper kroch. Für gewöhnlich lebte man in seiner Straße in seiner Stadt und vergaß die Weltmeere, die Wälder und die gewaltigen Berge. Heute zwangen sie ihn, ihre Majestät zu respektieren, und spendeten zum Lohn kalte Bergluft voller Wachheit und Frische.
Ein Haus hinter der Wegbiegung. Dunkle, feuchte Holzwände, der Gemüsegarten von einem schiefen Zaun umgeben. An zwei Stellen waren die Pflöcke umgesunken, dort lehnte der Zaun am Gebüsch. Im Unterstand am Haus lagen Fichtenscheite bis unter das Dach gestapelt, der Bewohner rechnete offensichtlich mit einem langen Winter. Eine Ziege war auf der Wiese angebunden. Sie kam neugierig näher, bis der Strick sich spannte.
Das musste die Keusche sein. Aufregung schoss durch seine Glieder wie ein süßer Strom. Vielleicht beobachtete man ihn bereits durch das Fenster. Er ging zur Tür und klopfte. Seine Handflächen begannen zu schwitzen. Er wischte die Hände an der Hose ab und klopfte erneut.
Niemand öffnete. Beinahe war er erleichtert. Er wandte sich der Ziege zu. Im kreisrunden Bereich, den sie vom Pflock aus erreichen konnte, war das Gras kurz gefressen. Er kauerte sich nieder, rupfte lange Halme vom Wiesenrand und hielt sie ihr hin.
Gierig fasste sie mit den haarigen Lippen danach, zog das Gras mit der Zunge in ihr Maul und kaute es. Ihre gelben Augen musterten ihn streng. Mit einem trockenen Meckern forderte sie weiteres Gras.
„Wenn du sie stehlen willst“, sagte eine brüchige Stimme, „musst du sie schon vorher losbinden.“
Joseph stand auf und drehte sich um.
Ein groß gewachsener Greis stand da, das Gesicht zerfurcht wie die Rinde einer Jahrhunderteiche. Auf dem Rücken trug er eine Kiepe mit Holz.
„Ich will sie nicht stehlen“, sagte er. „Habe ihr nur etwas Gras gegeben.“
Der Alte setzte die Kiepe auf dem Boden ab. „Was willst du hier? Verkaufst du Bürsten oder Knöpfe? Ich brauche nichts. Deinen Plunder kannst du behalten.“
Hundertmal hatte er sich diese Begegnung vorgestellt, hatte sich überlegt, was er dem Alten sagen würde. Aber dass er für einen Bürstenkrämer gehalten werden könnte, war ihm nicht in den Sinn gekommen. „Ich bin kein Teilacher. Man hat mich als Mitarbeiter im Pfarrdienst hierher versetzt.“
„Der neue Hilfspriester! Hab davon gehört.“ Der Alte streckte sich, dass die Knochen knackten. „Kommen Sie in ein paar Jahren wieder. Ich habe noch nicht vor zu sterben.“
„Sind Sie Joseph Mohr?“
Der Alte hob misstrauisch eine Augenbraue. Dann nickte er.
Hitze ergoss sich in Josephs Bauchraum und jagte anschließend hinauf in den Kopf. Wegen Ihnen habe ich mich hierher versetzen lassen, wollte er sagen, nur damit ich heute hier stehe. Beide hatten sie wasserhelle Augen. Und die Form der Ohren war ähnlich. „Ich heiße genauso“, sagte er. „Joseph Mohr. Ich glaube, Sie sind mein Großvater. Ihr Sohn, Franz, war mein Vater.“
Schlagartig verfinsterte sich das Gesicht des Alten. „Hören Sie auf mit dem Unsinn.“ Er ließ die Kiepe stehen und wandte sich zur Tür. „Wenn Franz einen Sohn gehabt hätte, wüsste ich das. Ihre Hirngespinste können Sie an der Wirtshaustheke erzählen. Bei mir sind Sie damit falsch.“ Er machte sich am Schloss zu schaffen.
„Franz Mohr ist mein Vater“, sagte er, „Musketier im Dienst des Fürsterzbischofs von Salzburg und letztes Jahr gestorben.“
„Ich weiß, wann mein Sohn gestorben ist. Was wollen Sie? Mich beerben? Hier gibt es nichts zu holen.“ Er trat ins Haus und warf die Tür hinter sich zu. Staub rieselte aus den Holzfugen.
Joseph hörte, wie der Riegel von innen vorgeschoben wurde. Dass ihn der Großvater in die Arme schloss und freundlich als Familienmitglied willkommen hieß, konnte er nicht erwarten. Aber derart harsch zurückgewiesen zu werden, machte ihm zu schaffen. Er drehte sich um und sah auf die Gipfel der Großen Tauern. Die Felswände verschwammen vor seinen Augen. Er wischte die Tränen fort und wandte sich wieder zum Haus um. Er klopfte.
„Ja, was denn noch?“, ertönte es von drinnen. Der Riegel wurde fortgeschoben und die Tür öffnete sich um einen Spalt. „Franz hatte keine Kinder, und damit basta. Lassen Sie mich in Ruhe.“
„Ich bin unter Frauen aufgewachsen“, sagte er leise. „In Salzburg, in drei armseligen dunklen Kammern, zwanzig Stufen hoch von der Straße. Meine Mutter, meine Großmutter, meine Halbschwester und meine Base, vier Frauen – das war meine Familie. Aber sie war nur halb, immer nur halb. Ich habe meinen Vater vom ersten Tag meines Lebens an vermisst.“
Der Alte starrte ihn an.
„Die Mutter hat neben mir noch drei weitere Kinder, jedes von einem anderen Mann. Jedes Mal musste sie ihr Verbrechen in einem demütigenden Fornikationsprotokoll vor dem Stadtgericht bekennen und die Strafe für Hurerei bezahlen. Aber sie hat uns zur Welt gebracht und uns aufgezogen, dafür sitzt sie vom ersten Lichtstrahl an bis zur letzten Abendsonne am winzigen Fenster und näht. Wenn Sie mich fragen, ist Näherin der hässlichste Beruf auf dieser Erde. Sie hat die Lungenschwindsucht und näht doch weiter und weiter, zersticht sich die Finger und macht sich die Augen kaputt bei dem schwachen Licht. Als sie jung und gesund war, ist ihr der Musketier Franz Mohr begegnet. Aus dieser Begegnung bin ich entstanden.“
„So etwas hätte mein Sohn niemals getan“, sagte der Alte durch den Türspalt. „Ihre Mutter hat Ihnen irgendwas erzählt, damit Sie aufhören zu fragen. Franz war ein gestandener Kerl. Wenn er eine Frau geschwängert hätte, dann hätte er sie geheiratet.“
„Ich habe als kleiner Junge das Pfeifen gelernt und davon geträumt, es meinem Vater zu zeigen. Ich habe gelernt, einen Stein über das Wasser springen zu lassen, und die Anzahl der Sprünge gezählt und mir aufgeschrieben, wie viele es waren, um es eines Tages meinem Vater zu erzählen. Als mich der Domvikar unter seine Fittiche nahm und ich an das Akademische Gymnasium durfte, habe ich Latein gelernt für Vater. Ich habe Geige geübt, um eines Tages für Vater zu spielen. Ich wollte ausgerechnet dem Mann gefallen, der aus meinem Leben verschwunden war. Verstehen Sie das?“
Der Alte schwieg.
„Philosophie, Musik, Theologie – das habe ich alles für ihn studiert. Und dann, als ich endlich meinte, gut genug zu sein, um von ihm geliebt und akzeptiert zu werden, und mich mithilfe meiner Mutter auf die Suche nach ihm gemacht hatte, musste ich hören, dass er gerade gestorben war. Er ist gegangen, ohne mir Lebewohl zu sagen. Ohne mich auch nur einmal anzusehen, bloß anzusehen, und seinen Sohn zu nennen.“
Der Alte schluckte. Er kratzte sich am Hals und sah betreten zu Boden.
„Ich habe Fragen. Ihm konnte ich diese Fragen nie stellen. Sie sind der einzige Mann, der mein Fleisch und Blut ist. Wenn Sie mich jetzt wegschicken …“ Von ihm hatte sein Vater doch das Wegducken und Verschwinden gelernt. Was erwartete er? Es war bezeichnend für seine Familie.
„Was wollen Sie denn fragen?“ Die Stimme des Alten klang jetzt heiser.
Wortlos sahen sie sich an. Da öffnete der Alte die Tür und ließ ihn eintreten.
Der Innenraum der Keusche war sauber gefegt. Es gab keine Stühle, nur eine Sitzbank, die mit der hölzernen Hauswand verschraubt war, und davor einen wackeligen Tisch. Der Alte bat ihn, Platz zu nehmen. Er machte Feuer, stellte den Wasserkessel auf den Kochofen und holte aus einer kleinen Nebenkammer einen Schemel, um sich darauf zu setzen, Joseph gegenüber. „Sie sind also Priester.“
„Wie gesagt, ich hatte einen Förderer, sonst wäre das nie was geworden.“
Der Greis schwieg. Ihm schien die Stille nichts auszumachen. Sein Atem ging ruhig und die faltige Hand lag still auf dem Tisch. Er sah in die Ferne, als würde er nachdenken. Seine Augen schimmerten von Tränenflüssigkeit, wie es die Augen der Alten zu tun pflegen.
Joseph fragte: „Hat er hier gelebt? In diesem Haus, meine ich.“
„Franz? Nein. Damals wohnten wir in Stranach unten.“
„Geschwister hatte er nicht?“
„Keine Geschwister.“
Der Teekessel begann zu singen. Ein schwacher Ton, der sich in die Höhe schraubte und dabei lauter wurde, bis er zum dringlichen Pfeifen geworden war. Der Alte stand auf, ging zum Ofen und nahm den Kessel herunter. Er schippte mit einem Löffel Kräuter in ein eisernes Sieb. Das hängte er in einen Krug und überbrühte es mit dem kochenden Wasser.
„Wie war er?“, fragte Joseph.
Der Alte blies Luft durch die Lippen, als habe man ihm eine schwere Rechenaufgabe gestellt. „Groß. Schlank. Ein feiner Kerl.“ Er brachte Tassen.
„Haben Sie ihn oft gesehen? Hat er Sie besucht?“
Der Alte verschwand in der kleinen Kammer nebenan. Er kehrte mit einem Blatt Papier zurück und legte es vor Joseph auf den Tisch. Es zeigte eine Kinderzeichnung, ein Baum war zu erkennen und Wolken und Vögel. „Das hat er gemalt, als er zehn war, glaube ich.“
Seltsam, ein Relikt aus der Kindheit des Vaters zu sehen. Auch Franz Mohr war einmal jung und verletzlich gewesen. „War er gut in der Schule?“
„Es geht.“
Besonders gesprächig war der Alte nicht. Joseph sagte: „Wie kommt es, dass er Musketier geworden ist?“
„Das haben wir uns auch gefragt. Er hätte hier im Lungau bleiben können. Aber plötzlich hatte er diese Idee, nach Salzburg zu gehen.“
Wer weiß, was er sich von der großen Stadt erträumt hat, dachte Joseph. Immerhin hat er Arbeit gefunden. Und meine Mutter, eine Frau, die ihn geliebt hat. Wahrscheinlich hat sie ihn mehr geliebt, als ihm bewusst war. Nachdem er gegangen war, hat sie es mit keinem Mann mehr lange ausgehalten.
„Es wird dunkel“, sagte der Alte. „Trinken Sie Ihren Tee. Wenn Sie noch bei Tageslicht ins Tal kommen wollen, sollten Sie sich auf den Weg machen.“
Er blies Luft auf den heißen Kräutertee, um ihn abzukühlen. „Darf ich Sie wieder besuchen?“
„Wozu?“
„Ich würde gern mehr über meinen Vater erfahren.“
Der Alte musterte ihn. „Ich habe keine Zeit, herumzusitzen und zu plaudern.“
„Dann helfe ich Ihnen bei der Arbeit.“
Mit einem Kopfschütteln stand der Alte auf. „Wenn Sie es nicht lassen können.“
Wann immer er konnte, ging Joseph zur Keusche. Meist hackten sie gemeinsam Holz. Er trug es für den Alten hinunter nach Stranach oder nach Mariapfarr auf den Markt.
War sein Vater wie der Großvater gewesen, ein schweigsamer, fleißiger Anpacker?
„Kann schon sein“, sagte der Großvater zwischen zwei Beilhieben, eine Antwort, die alles und nichts bedeuten konnte.
Wenn Vater so gewesen war, dann hatte er sich deutlich von Mutter unterschieden. Sie redete gern und viel. Wie hatten die beiden sich verstanden? Oder war gerade daran die Beziehung zerbrochen, an ihrer Verschiedenartigkeit?
Mutter sagte immer, Franz sei einfach verschwunden, ohne Abschied. Sie habe bei der Kommandantur des Fürsterzbischofs nachgefragt und erfahren, dass er fahnenflüchtig sei. Er war untergetaucht. Dass sie schwanger war, wusste er. War er aus Angst vor der Schande gegangen? Oder hatte er schon länger vorgehabt, die Muskete an den Nagel zu hängen, und Mutters ungewollte Schwangerschaft hatte ihm den Anstoß gegeben?
Joseph hob ein Aststück auf den Hackklotz und holte aus. Er spaltete es mit einem Hieb entzwei, die Hälften fielen rechts und links vom Klotz hinunter. „Hatte mein Vater ein besonderes Interesse? Eine Sache, die ihm Freude gemacht hat neben den Wachdiensten beim Fürsterzbischof?“
Der Großvater lud die Holzscheite in die Kiepe. „Musik. Er hat Musik geliebt.“
Joseph erstarrte. Als habe er es gewusst, als habe er all die Jahre geahnt, dass die Musik ihn mit dem Vater verband.
„Das war der Moment, in dem ich angefangen habe, dir zu glauben“, sagte der Alte und las kleine Splitter vom Boden auf. „Als du von deinem Geigeüben erzählt hast. Dein Vater hatte zwar keine Geige, aber er besaß eine Gitarre. In jeder freien Minute spielte er darauf, schon als Junge von kaum zwölf Jahren. Furchtbar war es. Er konnte nie Ruhe geben.“
Stumm sank Joseph auf den Hackklotz nieder. Sie hätten zusammen musizieren können, der Vater und er. Hätte er ihn nur etwas früher gesucht, oder hätte Vater sich einmal bei Mutter nach ihm erkundigt! Dann hätten sie Lieder spielen können, er hätte auf der Geige die Melodie gespielt, und Vater hätte ihn begleitet.
In die Enttäuschung mischte sich eine bittere Süße. Der Vater hatte ihm doch etwas mitgegeben, ein Geschenk. Er hatte ihm seine Musikalität vererbt. „Was mochte er für Musik? Gab es Stücke oder Lieder, die er besonders gern gespielt hat?“
„Hab’s vergessen. Von Musik verstehe ich nichts.“
Jetzt erst wurde ihm bewusst, dass der Großvater ihn gerade geduzt hatte, zum ersten Mal. Er fängt an, dachte er, in mir seinen Enkel zu sehen. Endlich kam er in seiner Familie an. Es war, als wäre er im Säuglingsalter auf einen fernen Kontinent gebracht worden und kehrte jetzt zurück in eine Heimat, die er nicht kannte, nach der er sich aber immer gesehnt hatte.
Als er an diesem Abend in den Pfarrhof zurückkehrte, ließ er das Abendessen ausfallen. Er holte seine Geige heraus und spielte den Anfang von Haydns Violinkonzert A-Dur, sehr langsam. Das hätte ich dir gern vorgespielt, Vater, dachte er.
Zehn Tage später besuchte er die Keusche erneut. Er fragte den Großvater, während sie den Zaun reparierten: „Habe ich Verwandte?“ Womöglich liefen da draußen eine ganze Reihe von Onkeln und Tanten und Vettern herum und wussten gar nicht, dass er existierte.
„Du hast welche“, sagte der Großvater, „aber ich habe keinen Kontakt mehr zu ihnen. Dein Vater mochte sie auch nicht. Geschwätzige Leute. Sie leben in der Nähe von Graz. Lohnt nicht, sie aufzusuchen.“
Bei Taufen und Beerdigungen hielt er sich zurück, aber die Hausbesuche nutzte Joseph, um weitere Erkundigungen über seine Familie einzuziehen. Kein noch so anstrengender Fußmarsch durch das weite Tal konnte ihn abhalten. War das harte Urteil über die Grazer Verwandten berechtigt? Und was erzählte man sich über den Großvater?
Man sagte ihm, sein Großvater sei arbeitsam und zuverlässig, habe es aber nie zu etwas gebracht. Und Franz sei wegen seiner Musik bei den Mädchen beliebt gewesen. Mehrere von ihnen hätten Tränen vergossen, als er nach Salzburg abgehauen war.
Die Älteren schimpften auf die bayrischen Soldaten. Bei ihrem Abzug hätten sie das kostbarste Buch der ganzen Gegend gestohlen, eine große, auf Pergament geschriebene Bibel aus dem 15. Jahrhundert.
Immer wieder wanderte Joseph zur Keusche. Der Großvater akzeptierte ihn – auf seine eigene, ruppige Art – als Teil der Familie, zur Begrüßung sagte er jetzt nicht mehr: „Du schon wieder?“ Stattdessen empfing er Joseph mit den Worten: „Du kannst die Axt holen. Wir haben einen Baum zu fällen.“ Oder: „Die Brombeeren sind reif, es wartet Arbeit auf uns.“
Abends aßen sie dann gemeinsam eine Suppe. Der Großvater löffelte schweigend, und er, Joseph, erzählte von seinem Leben in Salzburg, von Domvikar Hiernle oder vom Streit mit dem Stiftschor in St. Peter, dem er als Sängerknabe und Violinist für sechshundert Auftritte im Jahr zur Verfügung gestanden hatte, um sich Mittagstisch und Abendbrot zu verdienen, und dessen Leiter ihm übelgenommen hatte, dass er zusätzlich Zeit fand, im Studentenchor zu singen.
Großvater gab ab und an einen Knurrlaut von sich, der wohl aussagen sollte, dass er zugehört hatte. Nach dem Essen stopfte er sich eine Pfeife, das war das Zeichen, dass er wünschte, allein zu sein.