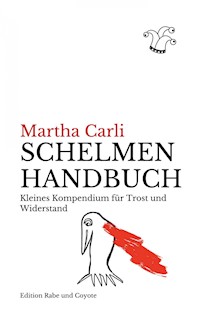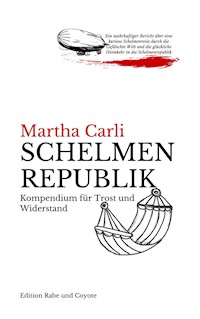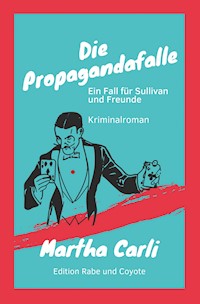
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
1928. Die englische Kleinstadt Milford soll Versuchsfeld für ein großes Vorhaben werden. Einflussreiche Kreise der besten Londoner Gesellschaft aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft wollen die "Stadt der Zukunft" errichten. Hindernisse sollen dabei kein Problem sein. Sie gründen ein Forschungsinstitut, das mittels "amerikanischer Methoden" eines gewissen Edward Bernays und seines soeben erschienenen Werks "Propaganda" Überzeugungsarbeit leisten soll. Als der enge Mitarbeiter desjenigen Abgeordneten ermordet wird, der im Parlament den Wissenschaftsausschuss leitet und maßgeblich an dem Projekt beteiligt ist, nimmt Chefinspektor Leonard Sullivan von Scotland Yard das neue Forschungsinstitut und seinen schillernden Leiter unter die Lupe. Der Journalist Tommy Faraday und seine Schwester Henrietta, eine Physikerin, versorgen ihn mit wertvollen Hintergrundinformationen. Gehören zu den "Methoden" am Ende auch Mord und andere Verbrechen? Wer steckt wirklich hinter den "Zukunftsplänen"? Und was ist das eigentliche Ziel? Die Kriminalintrige ist – auch – eine Referenz an den Altmeister der leichten Kriminalunterhaltung Edgar Wallace. Szenen, die sich nachts im Nebel an der Themse abspielen, pittoreske Landschaften und schräge Typen erhöhen das Lesevergnügen. Die Kombination bekannter und geliebter Klischees und des zeittypischen Kolorits trägt das schwergewichtige Thema leichtfüßig und witzig durch die Geschichte – eine Geschichte, die sich genauso gut heute abspielen könnte. Denn einige Dinge haben sich in 100 Jahren nicht geändert. Weitere Zutaten: ehrgeizige Provinzhonoratioren, ein Mörder, zwei Leichen, ein guter und ein böser Millionär, ein cholerischer Chefredakteur, ein Anarchist und viele andere mehr. Liebeskitsch natürlich, Machenschaften im Hintergrund, Edgar Wallace's London und ein englischer Langbogen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 629
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek. Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http:// dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Weg und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben vorbehalten.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Verlag, Herausgeber und Autoren übernehmen keine Haftung für inhaltliche oder satztechnische Fehler.
©Martha Carli 2022
marthacarli.com
Martha Carli
Die Propagandafalle
Ein Fall für Sullivan
und Freunde
Edition Rabe und Coyote
MMXXII
Inhaltsverzeichnis
Mörderische Manipulation
Phantome
Amerikanische Methoden
Allegro
Stadt der Zukunft
Trio infernale
Mörder!
Freuds Neffe
Kabale in Kensington
Entführung
Südafrikanische Geschichten
Schlagabtausch
Sein letztes Lied
Charly
Personal für eine Verschwörung
Die Reue der Ratsherren
Planänderungen
Besuch in Berkshire
Aufgeflogen
Die Küchentür
Seid umschlungen, Millionen(Von Thomas Faraday)
Schokolade
Anhang(Figurenverzeichnis; „Amerikanische Methoden“)
Mehr von Martha Carli
Mörderische Manipulation
Horace Ingram war sehr zufrieden mit sich selbst und mit seinem Verhandlungsgeschick. Trotz der späten Stunde ging er von seinem Londoner Club zu Fuß zum Waterloo-Bahnhof. Er war aufgeregt wie ein junger Bursche vor einem wichtigen Fußballspiel. Wenn er die Möglichkeiten, die sich ihm plötzlich boten, richtig einsetzte, würde er bald alle Probleme gelöst haben. Er lachte ein wenig schadenfroh in sich hinein, als er an seine „lieben Kollegen“ dachte. Gut gelaunt summte er eine bekannte Schlagermelodie vor sich hin und sah auf die Uhr. Es war kurz nach Mitternacht. Den Null Uhr 45 nach Milford würde er bequem erreichen.
Horace Ingram war in Milford zu Hause und mehr noch. Er war der Bürgermeister dieser aufstrebenden Stadt, ein stattlicher Mann in den Fünfzigern mit einer leichten Neigung zur Fülle, festem Schritt und streng gescheiteltem weißem Haar. Seine moderne dickrandige Brille, die seine kleinen hellen Augen verdeckte, gab seinem harmlos wirkenden breiten Gesicht etwas Fortschrittliches, wie er fand. Er rühmte sich, dass ihn so schnell nichts und niemand beeindrucken konnte und dass er immer das Heft in der Hand behielte. Doch der junge Wissenschaftler, den er heute Abend in seinem Londoner Club hatte erleben können, hatte in Horace Ingram die kühnsten Hoffnungen auf Verwirklichung seiner lang gehegten Träume geweckt. Die Quelle seines Vergnügens war William Crofton, Psychologe und Berater hochgestellter Persönlichkeiten. Ein angesehenes Mitglied des Clubs, das leider kurzfristig verhindert gewesen war, hatte den jungen Mann eingeladen, einen Vortrag zu halten. Er war als Absolvent der besten Universitäten des Königreichs, der Kolonien und des Kontinents vorgestellt worden, und sein geradezu aufwühlender Vortrag in exklusiver Runde hatte die Revolutionierung des politischen Handwerks durch Wissenschaft und Psychologie behandelt.
„Die Wissenschaft ist der Schlüssel zur Bewältigung der großen Herausforderungen, meine Herren“, hatte Crofton seinen Vortrag geschlossen. „Wenn wir die erkenntnisgeleitete Forschung nicht stärken, steht die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes auf dem Spiel. Auf dem Kontinent, und mehr noch in Amerika, macht die psychologische Forschung große Fortschritte und wird bald Eingang in die politischen Entscheidungen finden. In schwierigen Situationen sind Lösungen gefragt, die schnell zur Verfügung stehen. Dazu brauchen wir Freiräume für die Wissenschaft.“ Bürgermeister Horace Ingram war ganz und gar seiner Meinung.
„Sie meinen Geld.“ Der Abgeordnete Prendergast war für seinen trockenen Humor bekannt. Die übrigen Herren der Runde hatten leise gelacht und einander verständnisinnig zugenickt. William Crofton hatte verbindlich gelächelt und sich höflich verbeugt. Geld schien nicht das Problem seines neuen Instituts zu sein, das er indessen nur beiläufig erwähnt hatte.
Allgemein hatte man Croftons Ideen für überspannt gehalten. „Ein Mann, der diese Bezeichnung verdient, braucht doch keine Wissenschaft, um sich von ihr wie ein Hündchen an der Leine herumführen zu lassen“, hatte der bekannte Anwalt Millar-Smythe in der ihm eigenen pompösen Art zum Besten gegeben.
Ingram beschleunigte seinen Schritt und beglückwünschte sich einmal mehr zu seiner kühlen Klugheit, dass er sich an dieser Stelle mit einem Kommentar zurückgehalten hatte. Leute wie Millar-Smythe steckten fest in alten Zeiten und alten Gewohnheiten und würden die strahlende Zukunft verpassen, die vor ihm – Horace Ingram – und seinesgleichen lag.
Nach der Auflösung der Runde hatte Ingram die Gelegenheit ergriffen und den Redner zu einem späten Imbiss eingeladen. Seine Initiative war belohnt worden, und im Nachhinein staunte er darüber, wie leicht alles vonstatten gegangen war. Professor Crofton hatte sich sogar seines Namen erinnert, ein gutes Zeichen und eine gute Verhandlungsbasis. Aber Horace Ingram musste auch zugeben, dass er sich geschmeichelt gefühlt hatte. Er sah nach der Uhr. In zehn Minuten ging sein Zug. Sie hatten sich bei einer kleinen Mahlzeit aus kaltem Fleisch, Mixed Pickles und Brot außerordentlich angenehm unterhalten. Die kleine Sitzgruppe auf der Galerie über der großen Treppe zum Foyer des Clubs war um die späte Stunde wenig besucht gewesen, so dass die Angelegenheit sehr diskret vonstatten gehen konnte. Dennoch waren zunächst Belanglosigkeiten wie die gestiegenen Preise für Elektrizität oder die Qualität bestimmter Zigarrenmarken das Gesprächsthema gewesen. Erst nachdem der Clubkellner das Geschirr abgeräumt und teuren französischen Cognak serviert hatte, hatte William Crofton sich vertraulich zu Horace Ingram herübergeneigt.
Als Ingram den Bahnhof betrat und auf seinen Zug zueilte, dachte er an den klugen, intensiv forschenden und interessierten Blick Croftons. Dessen erste Frage hatte ihm ausgesprochen gut gefallen. „Was kann ich für Sie tun?“, hatte der Psychologe mit großer Liebenswürdigkeit wissen wollen.
„Als Bürgermeister einer nicht ganz unbedeutenden Stadt trage ich eine große Verantwortung, wenn es darum geht, das Beste für diese meine Stadt zu erreichen“, hatte das Stadtoberhaupt dem Professor in festem Ton versichert, und war dabei auf volles Verständnis gestoßen. Horace Ingram lobte sich nachträglich für diesen gelungenen Auftakt des eigentlichen Gesprächs. Der nächste Schritt hatte sich daraus fast wie von allein ergeben, als er Crofton sein Leid geklagt hatte über die Rückschrittlichkeit mancher Zeitgenossen, besonders im Stadtrat, die in der Vergangenheit feststecken und …“
„… aus Unwissenheit den Fortschritt behindern.“ Crofton hatte ihm das Wort aus dem Mund genommen. Noch einmal entfuhr Ingram bei dieser Erinnerung ein Seufzer der Erleichterung. Übrigens war Crofton gar nicht so jung, wie es auf den ersten Blick den Anschein hatte. Den Bürgermeister beruhigte dieser Umstand zutiefst. Er war wohl so um Ende dreißig, vielleicht sogar etwas älter. Seine Haut schien sehr glatt zu sein. Wahrscheinlich kam daher das jugendliche Aussehen. Auch das dunkle, fast schwarze Haar und die intelligenten und wachen grauen Augen verstärkten diesen Eindruck. Was Ingram aber besonders erfreute, war Croftons offensichtliche Gabe, seine ganze Aufmerksamkeit auf den Menschen zu richten, mit dem er gerade sprach. Das würde ihm, vor allem in seinem Amt als Bürgermeister, sehr nützlich sein, wenn dieser aufstrebende Psychologe erst einmal für ihn arbeitete. Seinem Akzent nach war der Professor wohl Südafrikaner oder er hatte zumindest lange dort gelebt.
Der Zug nach Milford verließ London auf die Minute pünktlich. Bürgermeister Ingram ließ sich zufrieden in einem Abteil erster Klasse nieder, zündete sich für die Fahrt eine Zigarre an und studierte aufmerksam die Papiere, die Crofton ihm mitgegeben hatte. Darin, wie schon in ihrem Gespräch zuvor, ging es um die praktische Umsetzung der modernen Methoden des Professors, die helfen konnten, die ewig Gestrigen in die Zukunft zu führen. Der Bürgermeister war beeindruckt vom sachlich-bodenständigen Tonfall des Wissenschaftlers, der offenbar jede Theorie ohne Mühe in jede Praxis umsetzen konnte. Er wusste, dass er den Richtigen für die Umsetzung seiner eigenen Pläne gefunden hatte, einen eigenen wissenschaftlichen Berater. Und Crofton hatte ihm in großer Ruhe versichert, dass er mehr als bereit sei, ihn, Bürgermeister Horace Ingram, zu unterstützen. Dann hatte er seinem neuen Berater in groben Zügen erklärt, was ihn umtrieb und welche Lösung er sich erhoffte.
Horace Ingram sah versonnen aus dem Fenster. Der Zug verließ gerade das Stadtgebiet, und beim Gedanken an seine Kollegen im Stadtrat musste er wieder schmunzeln. Er nahm einen tiefen Zug aus seiner teuren Zigarre und hüllte sich in den wohlduftenden Nebel. Er hätte sich gern noch länger mit seinem neuen Verbündeten unterhalten, aber er wollte den letzten Zug nach Milford nicht verpassen. In seiner gehobenen Laune gönnte Ingram sich einen milden Gedanken an den alt gedienten und schon leicht gebeugten Garderobier des Clubs, den er sonst geflissentlich übersah. Heute hatte er ihm zum ersten Mal ein Trinkgeld gegeben und ihn dabei gebeten, seinen Chauffeur zum Bahnhof in Milford zu bestellen. Ganz umsonst sollte die milde Gabe nun auch nicht sein.
Wie so oft, war das Beste zum Schluss gekommen. Ingram konnte schwören, er hätte beim Verlassen des Clubs am anderen Ende des Foyers seinen neuen Berater in angeregtem Gespräch mit dem Abgeordneten Wilkinson, dem großen Förderer der Wissenschaften, gesehen. Ingram kicherte leise. Umso besser. Bald würde ganz Milford nach seiner Pfeife tanzen. Und das war erst der Anfang.
***
Das war leicht. William Crofton lehnte sich behaglich zurück. Mit lässig übereinandergeschlagenen Beinen saß er in einem tiefen, weichen Sessel und studierte seine Umgebung. Er hatte einen Tisch am Rande gewählt, von wo aus er eine gute Übersicht hatte, aber selbst nicht sofort gesehen wurde. Die Gäste des bekannten und immer gut besuchten Nachtclubs waren Angehörige der besten Kreise oder hielten sich zumindest dafür. Es hieß, dass man hier bedeutende Geschäfte anbahnen konnte, die nicht unbedingt der Neugier der Behörden ausgesetzt werden sollten. Crofton lächelte amüsiert vor sich hin, während er sich genießerisch eine teure Zigarre anzündete. Er betrachtete die hübsche Kellnerin, die gerade am Nebentisch servierte und überlegte … nein, das musste warten. Auf der Bühne spielte ein kleines Orchester langsame Tanzmusik. Der Bürgermeister von Milford hatte also große Pläne. Aber wie so viele ambitionierte Politiker hatte er Gegner, die von gewissen Plänen wenig begeistert waren. Darunter einflussreiche Mitglieder des Stadtrats, deren Namen das ehrgeizige Stadtoberhaupt ihm unter dem Siegel der Verschwiegenheit zugeflüstert hatte. Bei der Erinnerung an die kindische Geheimnistuerei des Bürgermeisters kicherte der aufstrebende Professor für Psychologie und angewandte Überredungskunst in sich hinein. Tatsächlich war Milford das ideale Versuchsfeld, nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Seine Förderer, wie er sie gern nannte, würden begeistert sein, wenn sie erst die Einzelheiten des Arrangements erfuhren. Der Bürgermeister legte ihnen seine ganze Stadt zu Füßen.
Offiziell leitete William Crofton das neue Institut für vergleichende und experimentelle Psychologie mit dem schönen Namen „Futura“. Ein besonderes Augenmerk dieser Arbeit lag darauf, Methoden zu finden, die Politik darin zu unterstützen, die Gewohnheiten und Meinungen der Bevölkerung mit sanften Methoden in die richtigen Bahnen zu lenken und darüber hinaus ausgewählte Führungspersönlichkeiten in dieser Kunst zu beraten, um sie schließlich zu den Weltenlenkern der Zukunft zu machen. Es galt also, menschliches Verhalten zu studieren. Futura arbeitete auf der Grundlage neuester amerikanischer Methoden und Erkenntnisse für das große Ziel, moderne Techniken und Verfahren zu entwickeln, die alle Abläufe des Alltags beschleunigen und verbessern würden und schließlich die Bildung einer effizient organisierten Gesellschaft ermöglichten, die den Ballast der Traditionen und überkommene Vorstellungen abwerfen und den Fortschritt freudig begüßen würde. Im Zuge dieser Bemühungen sollte zudem das Ansehen der Wissenschaften auch in den einfachen Bevölkerungsschichten gesteigert werden, denn nur die Wissenschaften konnten die Grundlage moderner Politik sein. So oder ähnlich sollte es auch in den Broschüren zu lesen sein, die das Institut bald in großer Zahl herausgeben würde, und so stünde es dann schließlich ebenfalls in den Zeitungsberichten. Professor William Croftons Vortrag in einem der angesehensten Londoner Clubs war der Auftakt gewesen, die Arbeit des Instituts bekannt zu machen.
Bedeutende Persönlichkeiten, die sich dem Fortschritt verpflichtet fühlten, aber vorerst anonym bleiben wollten, hatten sich zur Gründung des Instituts entschlossen und es großzügig ausgestattet.
Mit halb geschlossenen Augen sah Crofton dem Rauch seiner Zigarre hinterher. Er bestellte noch einen Whisky und überlegte wieder, ob er der Kellnerin die Ehre seiner Gesellschaft zuteil werden lassen wollte. Doch seine Gedanken kehrten ganz von allein zu den ungeheuren Möglichkeiten zurück, die sich ihm demnächst böten. Er würde so bald wie möglich nach Milford fahren, um das Feld zu sondieren. Doch zuerst hatte er eine Menge vorzubereiten. Ungeduldig sah er auf die Uhr. Es war kurz nach zwei. Wie zufällig ließ er seinen Blick zur Tür schweifen, die sich in diesem Moment öffnete. Ein schlecht gekleideter mittelgroßer Mann mit finsterer Miene und dem Hut in beiden Händen trat ein und sah sich mit kleinen lauernden Augen, die nie stillstanden, misstrauisch um. Er entdeckte Crofton, senkte den Kopf und ging eilig zu dessen Tisch. Sein Gesicht war bleich, auf seiner linken Wange hatte er eine auffällig gezackte Narbe.
„Da bist Du ja endlich.“
„Ging nicht schneller, Boss. Die Bullen waren ziemlich lästig.“
Die Kellnerin trat an den Tisch, doch bevor sie den neuen Gast nach seinen Wünschen fragen konnte, winkte Crofton mit einer Handbewegung ab. „Der Herr bleibt nicht lang“, schickte er hinterher. „Setz dich“, forderte er den Mann mit der Narbe auf, der sich zur Zeit Peter Jones nannte. Jones schluckte eine unflätige Bemerkung herunter und schaute gierig auf das Glas, das Crofton lässig in der Hand schwenkte. Crofton lächelte nachsichtig, als hätte er ein unbotmäßiges Kind dabei erwischt, verbotene Früchte in Nachbars Garten pflücken zu wollen. „Über die Bullen reden wir später. Hast Du schon einmal etwas von Milford gehört?“ Jones schüttelte den Kopf. Mit gesenktem Kopf musterte er den Club und seine Gäste wie ein Prospektor auf der Suche nach den besten Schürfstellen. Crofton beugte sich vor und sprach mit bedrohlich leiser Stimme. „Ich würde es vorziehen, wenn Du Dich konzentriertest.“ Er steckte seinem Helfer halb unter dem Tisch einen Umschlag zu und lehnte sich wieder zurück. „Du fährst nächste Woche nach Milford in Sussex und siehst Dich da um. Vorher mach Dich vertraut mit der Stadt. Hör Dich bei Deinen Kumpanen um, ob Du da vielleicht Kollegen hast, auf die Du im Falle eines Falles zurückgreifen kannst. In dem Umschlag sind Geld, Wegbeschreibungen, weitere Instruktionen und der Name Deines Hotels. Und versuch bitte, nicht allzu sehr aufzufallen.“ Crofton musterte seinen Helfer mit einem abschätzigen Blick. „Das Geld reicht auch für einen neuen Mantel. Hast Du mich verstanden?“
Jones steckte den Umschlag mit einem brummenden Laut ein und zupfte unwillkürlich an den zerschlissenen Ärmeln seines Mantels. „Du kannst gehen“, ließ Crofton ihn wissen. Jones stützte beide Hände auf den Tisch und stand auf. „Und mach Dir keine Sorgen“, sagte Croftron mit einem jovialen Lächeln. „Guten Whisky gibt es bald reichlich.“ Peter Jones war entlassen.
***
Am Morgen nach seinem erfolgreichen Ausflug in die Hauptstadt nahm Horace Ingram eine Extraportion Speck zum Frückstück. Er war bester Laune. „Nun, mein Guter, hast Du wieder die wichtigen Leute getroffen, die Dir Deine Märchenprojekte finanzieren?“ Mrs. Griselda Ingram, eine gelegentlich furchteinflößende Dame mit einem Hang zu kräftigen Farben, betrat den Raum in der ihr eigenen Art mit gelangweiltem Blick unter halb geschlossenen Lidern. Sie interessierte sich wenig für die Geschäfte ihres Mannes und noch weniger für seine politischen Ambitionen. Ein Onkel hatte sie in seinem Testament ausgesprochen größzügig bedacht, so dass sie die weltlichen Dinge, die ihren Gatten so überaus intensiv beschäftigten, ignorieren konnte. Sie hasste es, als Bürgermeistergattin auftreten zu müssen, und sie fand das nicht ganz gesunde und – wie sie überzeugt war – undurchsichtige Baugeschäft ihres Mannes rundheraus fade. „Allerdings sollte das kein Grund sein, mitten in der Nacht nach Jackson zu telefonieren, damit er Dich die halbe Meile vom Bahnhof nach Hause fährt.“ Damit setzte sie sich, um eine bessere Perspektive für einen verächtlichen Blick auf ihren Mann zu haben. „Der arme Mann ist völlig übernächtigt und zu nichts zu gebrauchen. Wozu bezahlt man einen Chauffeur, wenn er einen vor lauter Müdigkeit gegen den nächsten Baum fährt?“
Bislang hatte der Bürgermeister in solchen Momenten das Äußerste an Kraft aufbringen müssen, um seiner Frau nicht eine volle Teekanne an den Kopf zu werfen oder ihr gleich ein Messer in die Brust zu stoßen. Der gesunde Instinkt des geborenen Feiglings hatte ihn jedoch stets vor dem Äußersten bewahrt. Aber heute war alles anders. Er nahm ein weiteres Stück Speck, lächelte seine protestierende Gemahlin freundlich an und sagte: „Du wirst schon sehen, meine Liebe, Du wirst schon sehen.“ Giseldas Blick verriet Skepsis. Sie konnte sich zwar auf das Verhalten ihres Gatten keinen Reim machen, aber sie war auch nicht sehr erpicht darauf, das Rätsel zu lösen.
„Wo ist Patricia?“, fragte Ingram. „Ach, da bist Du ja, Kind.“ In diesem Moment trat eine junge Frau von seltener Schönheit ein, die seit dem Tode ihrer Eltern im Hause Ingram lebte. Ihre Mutter war Horace Ingrams Schwester gewesen. Sie und ihr Mann waren vor drei Jahren kurz hintereinander an einer schweren Grippe gestorben. Patricia Walters war von schlanker aufrechter Gestalt, trug ihr blondes Haar halblang und beobachtete die Welt aus wachen Augen, die in einem sehr seltenen dunklen Blau glänzten.
Die Anwesenheit seiner Nichte spendete Horace Ingram Trost, brachte sie doch ein wenig unverbildete Heiterkeit in das oft sorgenbeladene Leben des schwer arbeitenden Bürgermeisters. Patricia war nicht die leibliche Nichte der Ingrams. Horace Ingrams Schwester und ihr Ehemann hatten sie als sehr kleines Kind adoptiert und vor gut 20 Jahren aus Südafrika mitgebracht. Als sie fanden, dass sie alt genug war, entschlossen sie sich, sie über ihre Geburt aufzuklären. Aber Patricia hatte ihre Adoptiveltern sehr geliebt und sich für ihre leiblichen Eltern niemals interessiert.
Als Patricia sich gesetzt hatte, beugte Griselda sich leicht vor und wies mit einem diskreten Blick auf die linke Schulter ihrer Nichte. „Oh!“, flüsterte Patricia. Hastig rückte sie ihr Kleid zurecht, um ein kleines sternförmiges Muttermal zu verbergen. Griselda wusste, dass es Patricia unangenehm war, es zu zeigen. Mit einem dankbaren Blick nickte die junge Frau ihrer Adoptivtante zu und widmete sich ihrem Frühstück.
Horace Ingram stand auf und verließ die beiden Damen. Er ging in sein Arbeitszimmer und setzte sich an seinen großen Schreibtisch aus schwerer Eiche, der in ihm stets ein behagliches Gefühl von Bedeutung erzeugte. Immer noch lächelnd griff er zum Telefon und wählte. „Guten Morgen, mein Lieber. Wie geht es Dir?“, fragte Ingram süßlich und nickte vergnügt. „Das hast Du ganz richtig erkannt, mein Freund. Mir geht es ausgezeichnet. Und Dir auch gleich, wenn ich Dir erzähle, welchen Fisch ich an Land gezogen habe. Sei doch bitte in einer halben Stunde hier, ja, bist Du so gut? Um 11 Uhr habe ich eine Ratssitzung … ja, ist gut, bis gleich.“ Während der nächtlichen Zugfahrt hatte er sich genau überlegt, wie er die genialen Methoden des jungen Crofton einsetzen würde, um alle seine Ziele zu erreichen.
Ingram sah Papiere und Dokumente für die Ratssitzung durch, aber er war nicht ganz bei der Sache. Die exzellenten Aussichten, die sich so überraschend aufgetan hatten, machten es ihm schwer, sich noch mit den Niederungen der Kommunalpolitik zu beschäftigen. Aber er tröstete sich mit dem Gedanken, dass sogar die anstehende Arbeit für die Gemeinde ihn seinem großen Ziel ein gutes Stück näherbringen würde. Um kurz nach neun Uhr traf Arnold Sperling im Hause Ingram ein und wurde von Mary, dem Hausmädchen, ins Arbeitszimmer geführt. Sperling, ein magerer Mann mit kurzen dunkelblonden Haaren und einem rundlichen Gesicht, das nicht zu seinem Körper passte, war ein arbeitsloser Ingenieur, den Ingram für ein bescheidenes Salär zum offiziellen Eigentümer seiner neu gegründeten Firma „Land Improvement Corporation“ gemacht hatte. Aufgrund gewisser Engpässe und bürokratischer Missverständnisse mit verschiedenen Behörden hielt der Bürgermeister es für klüger, seinen Namen nicht auf Firmenschildern und in Geschäftspapieren erscheinen zu lassen. Anderen gegenüber – vor allem im Stadtrat – würde er das moderne Unternehmen in den höchsten Tönen loben. Ingram setzte Sperling ins Bild, so weit er es für angebracht hielt. Er malte die Zukunft Milfords und ihrer gemeinsamen Geschäfte in den strahlendsten Farben. „Und unsere lieben Mitbürger werden uns aus der Hand fressen, wenn wir sie nur richtig davon überzeugen, dass alles, was zu unserem Vorteil ist, auch gut für sie ist.“ Ingram machte ein zufriedenes Gesicht. Er war sich seiner Sache vollkommen sicher.
„Und was ist, wenn Dir das keiner glaubt?“, gab Sperling zu bedenken. „Wenn sie ihren eigenen Vorteil mitnichten so erkennen, wie Du Dir das vorstellst? Und wenn sie herausfinden, dass die Corporation in Wahrheit Deine Firma ist?“ Der Ingenieur sah sich in Ingrams fast luxuriös ausgestattetem Arbeitszimmer um. Argwöhnisch betrachtete er die feinen Teppiche und teuren Möbelstücke. „Dann ist die ganze Pracht dahin.“ Noch bevor Sperling seinen Einwand zu Ende bringen konnte, schüttelte Ingram mitleidig den Kopf. „Lass mich Dir erst einmal erzählen, warum ich Dich hergebeten habe“, sagte er in seinem freundlichsten Ton. Sperling rutschte in seinem Stuhl vor Ingrams Schreibtisch hin und her. „Meinetwegen.“
„Hör zu, mein Freund. Ich habe gestern in London erfahren, dass es neue wissenschaftliche Methoden gibt, mit denen man Menschen praktisch von allem überzeugen kann, was man nur will. Und das Schönste ist: Sie merken es nicht einmal.“ Horace Ingram lehnte sich in seinem reich geschnitzten und kostbar gepolsterten Lehnstuhl zurück und lächelte vergnügt über das skeptische Gesicht seines Kompagnons. „Es hat mit Psychologie zu tun“, fuhr er fort. „Der Professor, den ich gestern kennenlernte und der uns unterstützen wird … ja, da staunst Du, was? …, hat mir erklärt, wie man den Leuten mit psychologischen Methoden klar machen kann, was sie in Wirklichkeit wollen – auch wenn sie noch gar nicht wissen, was das sein könnte.“
Sperling, der Ingenieur, war gewohnt, mit konkreten Dingen in einer konkreten Welt zu hantieren. Er starrte Ingram aus großen Augen an. „Du machst Witze.“
„Keineswegs, mein Freund, keineswegs. Der Professor erzählte mir von den neuesten amerikanischen Methoden, bahnbrechend, sage ich Dir.“ In Ingrams Augen glitzerte die Begeisterung, als er lebhaft gestikulierend fortfuhr. „Damit können wir Menschen dazu bringen, nicht ihre eigenen, sondern unsere Ziele zu verfolgen. Ist das nicht großartig?“
„Aber das ist doch …“, wollte Sperling protestieren.
„Nicht doch“, fiel ihm der Bürgermeister ins Wort. „Das ist modern, Sperling. Das ist Wissenschaft. So macht man heute Politik … und Geschäfte“, schob er hinterher. Ingram räusperte sich kurz und rückte seine Krawatte zurecht. „Ich werde mich in Kürze erneut mit Professor Crofton treffen, um mit ihm zusammen einen Plan auszuarbeiten, wie man das Ganze praktisch zu unserem Vorteil und natürlich zum Besten unserer schönen Stadt Milford umsetzen kann. Wenn es soweit ist, werden der Professor und ich Dich instruieren, damit Du an der richtigen Stelle die richtigen Dinge sagst.“ Der Bürgemeister steckte die Daumen in die Ärmellöcher seiner Weste und senkte den Kopf. „Noch Fragen?“
Arnold Sperling hatte keine Fragen. Ingram entließ ihn und widmete sich den Vorbereitungen zur anstehenden Ratssitzung.
***
So schlimm ein gewaltsamer Tod auch war, stellte Chefinspektor Leo Sullivan doch mit grimmiger Genugtuung fest, dass auch in den Elysien der Wissenschaft gemordet wurde. Der engste Mitarbeiter des ehrenwerten Abgeordneten Matthew Wilkinson war auf brutale Weise in jungen Jahren aus dem Leben gerissen worden. Ein Parlamentsdiener hatte David Bickerell am Mittwoch, dem 13. Juli kurz nach acht Uhr abends mit zertrümmertem Schädel in einem der Innenhöfe des Hohen Hauses gefunden. Der einflussreiche Abgeordnete, der den Ausschuss für Wissenschaft und Fortschritt leitete, war unmittelbar nach dem schrecklichen Ereignis für niemanden zu sprechen gewesen, hatte aber eine kurze Erklärung herausgeben lassen, in der er sich tief erschüttert über den Tod seines Mitarbeiters zeigte und einige vage Andeutungen über eine Krise machen ließ, in der der junge Mann sich wohl befunden habe. Die meisten Blätter nahmen die Theorie begierig auf und reihten Spekulation an Spekulation.
Leo Sullivan hatte keine Sekunde an einen Selbstmord geglaubt. Ein Blick auf die Schuhe des Toten hatte ihm genügt. Der Parlamentsdiener war geistesgegenwärtig genug gewesen, die Leiche des jungen Bickerell mit einer schnell herbeigeschafften Decke zu verhüllen und in die Obhut eines zuverlässigen Kollegen zu geben, während er die Polizei rief. Sullivan hatte das Parlamentsgebäude noch vor halb neun zusammen mit einem Polizeifotografen erreicht. Die Blitzlichter hatten unheimliche Schatten an die Wände des Hohen Hauses geworfen und die ganze Szenerie unwirklich erscheinen lassen. Sullivan hatte den Fotografen zur Eile gemahnt, damit er den Toten aus dem einsetzenden Dämmerlicht im Parlament in einen gut beleuchteten Raum bringen konnte, um ihn zu untersuchen. An der direkten Todesursache hatte scheinbar wenig Zweifel bestanden. Bickerell war aus einem Fenster gestürzt und mit dem Kopf aufgeschlagen. Doch seine Kleidung hatte Sullivan die ersten Rätsel aufgegeben. Der Tote hatte nämlich Hemd und Hose getragen, wie sie zu einer eleganten Abendgarderobe passten und nicht zum Anzug, wie man ihn in einem Büro trug. Was nicht zu dieser Garderobe passte, waren die gewöhnlichen Straßenschuhe, die Bickerell trug. Aber das war noch nicht alles. Sullivans scharfe Augen hatten unzweifelhaft registriert, dass die Schuhe falsch herum geschnürt waren. Bickerell konnte die Schuhe nicht selbst zugebunden haben. Jemand anderes hatte das getan, als er schon tot war.
Im Polizeipräsidium herrschte am Morgen nach der Tat eine angespannte Atmosphäre. „Das ist eine äußerst heikle Angelegenheit, Sullivan“, erklärte Sir Arthur Sevenfield während der morgendlichen Runde mit Nachdruck. Der Polizeipräsident senkte die Stimme zu einem Flüstern, das bedrohlich klingen sollte. „Hier ist äußerstes Fingerspitzengefühl vonnöten, verstehen Sie! Ein Skandal muss um jeden Preis vermieden werden.“
„Mord ist Mord“, sagte Sullivan kurz und bündig. Doch der Polizeipräsident wünschte sich dringend einen ganz normalen Selbstmord und warf Sullivan einen strengen Blick zu. In den oberen Etagen wusste man, dass der Chefinspektor sich oft genug nicht unbedingt vorschriftsmäßig verhielt. Verschiedenen höheren Beamten war er ein Dorn im Auge, weil es ihm häufig an konventionellem Respekt mangelte. Er debattierte, wenn es sein musste, bis zum Umfallen und hatte darüber hinaus die unangenehme Eigenschaft, meistens recht zu behalten. Trotz seiner erst 34 Jahre war er Scotland Yards bester Detektiv.
Leo Sullivan war groß, schlacksig, durchtrainiert und schnell, was nach Auffassung einiger Leute einen merkwürdigen Kontrapunkt zu seiner gelegentlichen Neigung zur Melancholie setzte. Irgendwie konnte man sich nie sicher sein, wer der echte Sullivan war. Seine betont unaufdringliche Kleidung stammte aus der Schneiderwerkstatt eines Onkels, dessen Adresse in den Kreisen echter Kenner wie ein Geheimrezept für ewige Jugend gehandelt wurde. Sein schmales, ausdrucksstarkes Gesicht mit wohlgeformter Nase und festem Kinn zeigte allererste Falten, und sein dunkelbraunes welliges Haar ließ bei Sonnenschein einen leichten Rotstich erkennen. Seine weiche Baritonstimme nahm seinen Gesprächspartnern jeden Argwohn, was bei Verhören ein unschätzbarer Vorteil war. Den grünbraunen Augen entging nicht viel. Auffallend waren die feingliedrigen Hände des Chefinspektors, die ständig in Bewegung zu sein schienen und denen kein Schloss und kein Geldschrank widerstehen konnte – wenn es denn der Wahrheitsfindung diente. Das nötige Handwerk hatte er bei den Besten gelernt. „Man muss immer genau wissen, womit man es zu tun hat“, war Leo Sullivans Philosophie, die er umso mehr vertrat, je mehr sich die Polizeiarbeit auf Betreiben gewisser Kreise neuerdings auf Theorie und Wissenschaft stützen sollte. Sullivan war durch und durch ein Mann der Praxis, für den die gedankliche Navigation in Abstraktionen so etwas war wie eine Autofahrt im Londoner Nebel.
Da an dem Abend von Wilkinsons Mitarbeitern niemand mehr im Hause gewesen war, hatte Sullivan ohne weitere Umstände einige Unterlagen aus Bickerells Büro mitgenommen und sie bis spät in die Nacht hinein in seinem häuslichen Arbeitszimmer aufmerksam studiert. Der junge Mann war zuständig für die interne Koordination der inzwischen so genannten Wilkinson-Initiative gewesen, insbesondere, was die Gründung neuer Institute anging. Sullivan war erstaunt über die hochfliegenden Ambitionen des Abgeordneten und seiner Mitstreiter. Offenbar hatte man sich dem ambitionierten Ziel verschrieben, das ganze Land auf die nächste Stufe des Fortschritts zu heben. Mit gezielter Aufklärung sollte die Bevölkerung über die Segnungen der Zukunft informiert werden, und die Wissenschaften würden für all dies das Fundament bauen und den Weg bereiten. Man würde alle gesellschaftlichen Bereiche zum Wohle des Landes in einer großen Anstrengung vereinigen, damit sie zielgerichtet und konzertiert an einem Strange zögen.
An einigen Stellen der Unterlagen hatte Bickerell rote Markierungen angebracht, andere mit Ausrufe- oder Fragezeichen versehen. Auf einer Seite fand Sullivan eine Anmerkung. „Unsichtbare Regierung“. Glaubte Bickerell etwa an eine Verschwörung? Sullivan schüttelte ungeduldig den Kopf. Das war nun doch ziemlich weit hergeholt. Hinter dieser kryptischen Anmerkung stand ein Name. „Bernays“. Wer mochte das sein? Das erste der neuen Institute existierte bereits und trug den Namen „Futura“. Geleitet wurde es von einem gewissen William Crofton, mit dem Bickerell der Korrespondenz und dem Kalender nach häufig zu tun gehabt hatte. Also warum nicht dort beginnen.
Gegen zehn Uhr am anderen Morgen klingelte Sullivans Telefon in seinem Büro in Scotland Yard. Es war der Gerichtsmediziner, der die Leiche des jungen Mannes untersucht hatte. Er bestätigte Sullivans Vermutung, dass Bickerell nicht an den Folgen des Sturzes gestorben war. Die Todesursache war vielmehr ein heftiger Schlag auf den Hinterkopf gewesen. „Er war schon tot, als er unten ankam“, sagte der Pathologe. Die Mordwaffe war ein schwerer kantiger Gegenstand, der eine Art Kerbe in den Schädel geschlagen hatte.
Als Sullivan den Polizeipräsidenten mit der unschönen Wahrheit konfrontierte, legte er dabei eine gespielt bedauernde Miene auf. „Es tut mir leid“, sagte er höflich.
„Kann ja sein, dass der Pathologe das so sieht, Sullivan“, erklärte der Polizeipräsident in gewohnt barschem Ton, „aber schließen Sie einen Selbstmord deshalb nicht vollkommen aus. Kann ja sein, dass der Junge auf alle mögliche Art in Berührung mit diesem Gegenstand gekommen ist. Haben wir uns verstanden?“
Sullivan senkte nur kurz die Augenlider zur Bestätigung. „Ich gehe jetzt noch einmal an den Tatort, Sir. Es ist noch viel zu tun.“
„Hören Sie auf, mich auf den Arm zu nehmen, Sullivan“, rügte der Polizeipräsident ihn und brummte noch etwas Unverständliches. „Also gehen Sie schon.“
15 Minuten später traf der Chefinspektor am Parlamentsgebäude ein. Er gab sich einem der Tagespförtner zu erkennen, der sofort nickte und einen kleinen Funken Sensationslust im Blick nicht ganz unterdrücken konnte. Die außergewöhnliche Neuigkeit hatte sich offenbar über Nacht wie ein Lauffeuer herumgesprochen. Die Ermordung von Abgeordnetenhelfern gehörte nicht zur üblichen Tagesordnung des Hohen Hauses, jedenfalls nicht direkt vor Ort.
Nach wenigen Minuten erreichte Sullivan Bickerells Büro, das er am Abend zuvor versiegelt hatte und verschaffte sich Einlass. Er schaute sich noch einmal sorgfältig in dem kleinen Raum um, der sparsam eingerichtet war, aber irgendwie intelligent wirkte. Vielleicht waren es die Bücherregale, die außer Parlamentsprotokollen und Gesetzestexten auch die besseren unter den historischen Werken enthielten. Sullivan fand sogar Werke über moderne Naturwissenschaften. Auf dem routiniert aufgeräumten Schreibtisch standen eine Kaffeetasse, das silbergerahmte Foto einer bezaubernden jungen Frau und ein antik wirkender kleiner Globus. Aber er fand keinen Gegenstand, der nach Art und Schwere die Mordwaffe hätte sein können.
Sullivan verließ das Zimmer und versiegelte es erneut. Die nächste Tür führte zum Sekretariat des Abgeordneten. Sie war angelehnt, und als er den Spalt ein wenig weiter öffnete, sah er, dass der Raum leer war. Für Honneurs hatte er jetzt keine Zeit, also trat er ein und erkannte mit geschultem Blick, dass auch hier außer Regalen und Schreibtisch nebst Stuhl und Kleinigkeiten nichts zu finden war. Sullivan trat wieder zur Tür und spähte auf den Korridor. Niemand war zu sehen. Wahrscheinlich hatte man sich in irgendeiner Teeküche versammelt, frönte allgemeiner Aufregung und spekulierte über das gestrige Ereignis. Mit drei Schritten war er in Wilkinsons Büro, das sich weniger in der Ausstattung als in der Größe von den anderen Räumen unterschied. Natürlich waren die Möbel prächtiger, die Bücher ledergebunden, mit Goldschnitt versehen und ungelesen, der Teppich war tief und weich, und an den Wänden hingen Porträts von Alexander dem Großen, Albert Einstein, Francis Galton und einem jungen Mann in Siegerpose, das wohl den Abgeordneten in jungen Jahren zeigte. Einige Pokale bezeugten gewonnene Preise, aber keine Spuren einer Mordtat. Sie waren auch nicht schwer genug. Sullivan glaubte im Grunde ohnehin nicht, dass er die Tatwaffe hier finden würde. Aber die Sorgfalt verlangte es, nichts unversucht zu lassen. Dennoch war er verärgert über seinen Misserfolg und überlegte fieberhaft, wo er sinnvollerweise weitersuchen könnte, während er mit halb gesenktem Kopf den Korridor entlanglief.
Er hatte schon fast die Treppe erreicht, als sich ein Bild aus seinem Hinterkopf ins Wachbewusstsein drängte. Jäh blieb er stehen und ging ein paar Schritte zurück. Schließlich verharrte er reglos vor der kleinen, aber schweren Marmorskulptur einer Aphrodite, die auf einem quadratischen Sockel ruhte, der in den Abmessungen perfekt zu Bickerells Verletzungen passte. Sullivan drehte die Aphrodite herum und entdeckte an der Rückseite des Sockels nachlässig abgewischte Blutspuren. Der Mörder musste ein Mensch mit guten Nerven sein. Die kleine Skulptur als Mordwaffe zu wählen, die in der Menge all der anderen nicht auffiel und dann noch die Stirn zu haben, sie nach vollbrachter Tat wieder an ihren Platz zu stellen, zeugte von überlegener Berechnung und großer Eiseskälte des Täters. Dennoch schien der Mord nicht geplant gewesen zu sein, jedenfalls nicht unbedingt zu diesem Zeitpunkt oder an diesem Ort. Aber möglicherweise hatte Bickerell genau an diesem Tag etwas herausgefunden, was den Mörder oder seinen Auftraggeber in solche Gefahr bringen konnte, dass unverzüglich gehandelt werden musste. Sullivan hob Aphrodite aus ihrer Nische und nahm sie unter den Arm, sorgfältig darauf achtend, die Blutspuren nicht zu berühren. Ausgerechnet Aphrodite, sinnierte er. Zum Trost der Göttin der Liebe diente aber vielleicht der strahlende Sommertag, in den er ihr Abbild gleich hinaustragen würde, weg aus dem immerwährenden Zwielicht eines Parlamentskorridors, in dem Schönheit und Anmut ganz und gar verschwendet waren.
***
So kam es, dass William Crofton wenige Tage nach seinem erfolgreichen Vortrag in einem exklusiven Londoner Club unerwarteten Besuch von Scotland Yard bekam. Freitag Morgen um halb zehn stand Leo Sullivan vor dem modernen Bürogebäude in der Lower Regent Street, in dem Croftons Institut Räume bezogen hatte. Die anderen Mieter waren Kontore, Niederlassungen verschiedener Firmen, Anwaltskanzleien und Börsenagenten. Seltsame Nachbarschaft für ein wissenschaftliches Institut, dachte Sullivan, als er mit federnden Schritten die Stufen ins Vestibül nahm und sich in den dritten Stock fahren ließ. Der Chefinspektor nahm seinen englischen Langbogen, dem er später am Tag in seinem Sportclub etwas Beschäftigung verschaffen wollte, über die linke Schulter und drückte mit der rechten Hand auf den messingnen Klingelknopf neben der Tür mit der Aufschrift „Futura“.
Der Assistent, der ihn einließ, fiel durch seine besonders schlechte Haltung auf, die gut zu seiner Unterwürfigkeit passte. Der kleine blonde Mann mit dem schütteren Haar betrachtete den Besucher mit einem blöden Blick, starrte den Bogen an, führte den Gast mit einem undefinierbaren Laut zu einer Doppeltür und bedeutete ihm zu warten. Er klopfte so zögerlich, als befüchtete er, der massiven Tür einen Schaden zuzufügen. In gebeugter Haltung wartete er, bis von jenseits der Tür ein „Herein“ zu hören war. Er öffnete und ließ Sullivan eintreten.
William Croftons Büro war zurückhaltend, aber in gewisser Weise luxuriös eingerichtet. Die modernen Möbel zeigten ausgezeichnete Qualität und elegante klare Linien. Die Täfelung des Raums bestand aus Rosenholz. An der linken Wand entdeckte Sullivan einen Durchgang zu einer offenbar gut ausgestatteten Bibliothek. „Sie können gehen, Seamons“, sagte Crofton zu dem Sekretär, der wartend in der Tür stehengeblieben war. „Sie glauben ja gar nicht, wie schwer es ist, gutes Personal für ein wissenschaftliches Institut zu finden. Ich hoffe, bei der Polizei ist das besser“, meinte Crofton jovial, nachdem der Assistent verschwunden war. Sullivan ließ den Bogen in der Nähe der Tür stehen. „Ich darf meine Waffe doch kurz hier abstellen? Danke schön!“
Mit einem irritierten Blick auf den Bogen und anschließend auf Sullivans Anzug stellte William Crofton sich vor und bat seinen Gast, Platz zu nehmen. Sullivan sah sich mit anerkennendem Blick um. „Schön haben Sie’s hier, Mr. Crofton. Doch ja, gutes Personal haben wir bei der Polizei, aber leider nicht so gute Möbel.“ Crofton lächelte bescheiden. Sullivan zog seinen Besucherstuhl etwas näher an Croftons Schreibtisch heran. „Ich fange mal gleich an. Meine Vorgesetzten haben mich ermahnt, in einem delikaten Fall wie diesem viel Fingerspitzengefühl zu zeigen.“ Dabei zeigte er Crofton seine offenen Handflächen und wies mit den Fingerspitzen in dessen Richtung, als solle sein Gastgeber sich von den rechten Gefühlen darin überzeugen. Sullivan ließ sein Gegenüber nicht aus den Augen. „Es gibt eine Menge Leute, die keine Ironie vertragen“, sagte er leise. „Und dann bekommt man Probleme.“ Jetzt lachte Crofton. „Sie gefallen mir, Chefinspektor. Aber nur zu. Ich bin Psychologe. Wir haben viel Verständnis für alle Äußerungen des Lebens, und seien sie noch so sonderbar.“
„Wie schön, Mr. Crofton, ich freue mich immer über Leute mit einem geschmeidigen Gemüt. Sonderbare Dinge des Lebens. Aha.“ Sullivan sah sich scheinbar unbeteiligt in dem großen Raum um. Plötzlich fixierte er Crofton mit einem scharfem Blick. „So sonderbar wie Mord?“ Für einen winzigen Moment versteinerte Croftons Gesicht, und bevor er irgendetwas sagen konnte, fuhr Sullivan fort. „Sie haben eng mit David Bickerell zusammengearbeitet. Wie gut kannten Sie ihn?“
Crofton wiegte den Kopf wie in schweren Gedanken. „Ja, das stimmt“, sagte er traurig. „Er war ein vielversprechender junger Mann, intelligent und gewissenhaft, wenn auch bisweilen etwas schwermütig.“
Sullivan nickte ihm aufmunternd zu, während er weitersprach. „Wann haben Sie David Bickerell denn zum letzten Mal gesehen?“
Crofton zog die Augenbrauen zusammen. „Das war vorgestern, glaube ich … Moment.“ Der Professor konsultierte seinen Kalender. „Ja, es war vorgestern, Mittwoch, so gegen vier Uhr nachmittags. Es ging um eine Rede des Abgeordneten, in der einige der neuen Institute erwähnt werden sollten.“
„Danach nicht mehr?“
„Danach nicht mehr.“
Sullivan schürzte die Lippen und machte ein nachdenkliches Gesicht. Dabei betrachtete er unauffällig den extravaganten Ring aus Weißgold, den Crofton am rechten kleinen Finger trug. Es war ein funkelnder Smaragd, der von einer Fassung in Form sich windender Schlangen gehalten wurde. Umständlich zog der Chefinspektor ein ledergebundenes Buch aus der Tasche, um sich in größter Ruhe Notizen zu machen. „Danach nicht mehr …“ murmelte er bei der Niederschrift, die in Wahrheit vollkommen überflüssig war, da Leo Sullivan über ein ausgezeichnetes Gedächtnis verfügte. Lügen konnte er sich besonders gut merken. „Und wo waren Sie, nachdem Sie das Parlamentsgebäude verlassen hatten?“ Die Herablassung in Croftons verständnisvoll mildem Blick, mit der er der Freage begegnete, verfehlte bei Sullivan ihr Ziel. Er sah Crofton mit lang eingeübter Ausdruckslosigkeit an und wartete.
„Hier, Mr. Sullivan. Ich war hier“, erklärte Crofton und rief nach dem Sekretär. „Seamons!“ Der Gerufene erschien wie ein Schemen in der Tür, die sich lautlos geöffnet hatte. „Seamons, wo war ich vorgestern Nachmittag, sagen wir ab halb fünf?“
Seamons verharrte vollkommen reglos im Türrahmen. „Hier. Sie waren hier.“ Crofton entließ ihn mit einer Handbewegung, und so lautlos der Assistent erschienen war, verschwand er auch wieder. „Reicht Ihnen das, Chefinspektor?“, fragte Crofton lächelnd. „Natürlich nicht“, sagte Sullivan lapidar, während er sein Notizbuch zuklappte und wieder einsteckte.
„Wollen Sie mich etwa aus der Fassung bringen, Chefinspektor?“ Crofton lachte leise und schüttelte den Kopf.
„Aber nein, Mr. Crofton“ beteuerte Sullivan mit vollendeter Unschuldsmiene. „Das wäre ja auch ein sehr dilettantischer Versuch eines einfachen Polizisten, einen bedeutenden Wissenschaftler mürbe zu machen, nicht wahr? Nichts läge mir ferner.“ Er bedachte Crofton mit einem liebenswürdigen Lächeln.
„Aber Sie müssen entschuldigen. Ich bin ja ein schrecklicher Gastgeber“, sagte Crofton plötzlich lauter als nötig. „Möchten Sie etwas trinken? Ich lasse Ihnen auch gern einen Kaffee machen. Zigarre?“ Crofton fixierte seinen Gast, wie um ihn zu bannen. Sullivan lehnte das Angebot höflich ab. „Nein danke.“
„Psychologische Tricks sind nicht mein Metier, Mr. Crofton“, sagte Sullivan ernst, wobei er seine Stimme zum Ende des Satzes hin fast in ein Flüstern übergehen ließ. „Davon verstehen Sie mehr. Lassen Sie mich also an Ihrem psychologischen Wissen über den armen David Bickerell teilhaben.“
Crofton setzte die überlegene Miene des gemachten Mannes der Wissenschaft auf. „Nun gut“, sagte er nach einer Weile. „Bickerell war der klassisch labile Typ. Sie wissen vielleicht nicht, dass es in vielen europäischen Ländern eine Selbstmordwelle unter jungen Männern gab, die alle ein Stück des großen Goethe gelesen hatten. Das Stück handelt von einer Figur namens Werther und seiner Empfindung von Weltschmerz.“
„Ah ja. Und an Weltschmerz kann man sterben?“, meinte Sullivan trocken. Crofton riss seinen Blick von Sullivans Bogen los. „Depressionen sind eine ernste Sache, Mr. Sullivan“, sagte William Crofton in dozierendem Ton. „Der junge Bickerell hatte Sorgen. Er machte Andeutungen über finanzielle Probleme, und es scheint auch ein wenig Liebeskummer im Spiel gewesen zu sein. Entscheidend war aber seine insgesamt schwache Gemütsverfassung. Die äußeren Umstände haben das nur verstärkt.“ Crofton legte die Hände wie zum Gebet zusammen. „Laien verstehen das nicht unbedingt auf Anhieb“, fuhr er fort. „Sie erkennen die Zeichen nicht und missdeuten die Äußerungen des Betroffenen.“
„Das ist … wie soll ich sagen … Ihre fachliche Meinung?“
„Falls Scotland Yard ein Gutachten wünscht …“
„Danke vielmals“, unterbrach Sullivan ihn. „Mit Gutachten aller Art sind wir bestens versorgt. Sagen Sie, kamen die Gemütsschwankungen plötzlich?“
„Allmählich.“ Sullivan legte den Kopf schief, scheinbar in tiefe Gedanken versunken.
„Seltsam“, murmelte Sullivan.
„Was ist seltsam, Chefinspektor?“
„Ach nichts. Ich wünschte, ich wüsste auch so viel über Psychologie wie Sie. Das würde meine Arbeit enorm erleichtern. Aber ich kann immer nur das beobachten, was an der Oberfläche ist, und wenn man sich die Schuhe des Toten ansieht … Ach, du meine Güte. Ich muss mich beeilen.“ Mit einer übertriebenen Geste sah Sullivan auf seine Uhr. „Danke vielmals, Professor“, sagte er gut gelaunt, erhob sich, griff seinen Bogen und stand auch schon in der Doppeltür, wo er fast über den Sekretär mit dem krummen Rücken stolperte. „Warten Sie, Sullivan!“ Mit einem Gesichtsausdruck wie ein schwer gelangweilter Aristokrat drehte der Detektiv sich noch einmal um. „Ja?“ Aber es kam nicht die Frage, die er erwartet hatte. „Was um alles in der Welt tun Sie mit diesem Bogen?“ Croftons Gesicht war eine einzige verwirrte Frage. „Schießen, Mr. Crofton. Schießen. Das tut man für gewöhnlich mit Bögen.“
Sullivan verließ das Gebäude in der Lower Regent Street in entschlossener Stimmung. Das Opfer David Bickerell war weder an Weltschmerz noch an Liebeskummer gestorben. Es konnte ja sein, dass Crofton dieses Zeug selber glaubte. Doch die Erfahrung lehrte Sullivan, dass bewegliche Figuren wie dieser Psychologe fähig waren, jeden Tag etwas anderes zu glauben. Wo hatte er bloß Croftons Gesicht schon gesehen?
Wie viele intelligente Menschen konnte Sullivan beim Gehen besonders gut denken und spazierte deswegen zu Fuß zurück nach Scotland Yard. Am Trafalgar Square warf er einen sehnsüchtigen Blick auf die National Gallery. Er erinnerte sich lebhaft an eine Ausstellung berühmter Expressionisten des Kontinents, ein Rausch aus Farben und ungestümen Formen, die in ihm eine bleibende Liebe zu den Werken dieser Künstler entfacht hatte.
„Ich muss jetzt wirklich mit dem Abgeordneten Wilkinson sprechen“, erklärte der Detektiv seinem Vorgesetzten Sir Arthur Sevenfield bald darauf im Präsidium mit Nachdruck. „Und das wissen Sie auch ganz genau. Er war Bickerells Chef und sollte wissen, was mit dem Jungen los war oder ob er in Schwierigkeiten steckte. Diesem Crofton mit seinem Weltschmerzgerede traue ich keinen Zentimeter über den Weg. Bickerell wurde ermordet.“ Sullivan machte eine kleine Kunstpause und sah den Polizeipräsidenten, der sich so sehnlichst einen Selbstmord wünschte, fast heiter an. „Ich habe übrigens die Mordwaffe gefunden. Sie wird gerade im Labor untersucht. Und Sie werden nicht glauben, was es war.“ Sullivan ließ Sevenfield zappeln, doch bevor der ihn anherrschen konnte, sprach er weiter. „Es war Aphrodite, die Göttin der Liebe.“
„Ich weiß, wer Aphrodite ist, schnauzte der Polizeipräsident ihn an. „Was meinen Sie überhaupt damit! Also kommen Sie zur Sache.“
„Natürlich Sir. Bei Aphrodite handelt es sich im eine Statuette aus dem Korridor, an dem die Räume des Abgeordneten Wilkinson liegen. Der Mörder stellte sie schlicht und ergreifend wieder an ihren Platz, nachdem er Bickerell damit erschlagen hatte und ihn dann aus dem Fenster warf, um es wie Selbstmord aussehen zu lassen. Er hat nur dummerweise den Blutfleck an ihrem Sockel übersehen. Sie sehen, Sir, ich sollte schnellstens mit dem Abgeordneten reden. Er sollte doch wohl ein Interesse daran haben, zu erfahren, wer seinen Mitarbeiter umgebracht hat. Es ist Gefahr im Verzug.“ Sullivan verschränkte die Arme und sah an die Decke. „Wenn Sie es wünschen, wende ich mich auch persönlich an den Innenminister …“
„Hören Sie schon auf, um Himmels Willen!“ Der Polizeipräsident schnaubte ärgerlich und blitzte Sullivan aus kleinen Augen an. „Und packen Sie Ihren verdammten Bogen weg.“ Sir Arthur Sevenfield war ein beleibter Mann Ende Fünfzig. Er hasste nichts so sehr wie Morde, die nicht innerhalb der kriminellen Klassen verübt wurden. Solange die Leute unter sich blieben, interessierte sich außer ein paar übereifrigen Polizisten niemand für Untersuchungsergebnisse, und man hatte auch nicht diese Eile. Schließlich sicherte er Sullivan dennoch zu, ihm ein Entrée beim Abgeordneten Wilkinson zu verschaffen „Warten Sie draußen oder gehen Sie in Ihr Büro. Ich lasse Sie rufen.“
Eine halbe Stunde später brachte ein Beamter Leo Sullivan die Nachricht, dass Matthew Wilkinson eine viertel Stunde Zeit habe, und zwar in einer halben Stunde.
***
Sullivan nahm wie schon so oft in den letzten Tagen den Ausgang nach Whitehall und war in weniger als zehn Minuten am Parlamentsgebäude, ganze 20 Minuten vor der verabredeten Zeit. Gehabe wie das des Abgeordneten Wilkinson machte ihn streitlustig. Leute, die nicht wussten, wann sie einen angenommenen Habitus besser ablegen sollten, setzten sich gegenüber dem Chefinspektor in einen Nachteil, von dem sie nichts ahnten. Wilkinson konnte ihn gern warten lassen. Aber vielleicht würde er sich auch überlegen, welchen Eindruck es machte, wenn ein bekannter hoher Beamter von Scotland Yard ungeduldig vor seinen Räumen auf und ab ging.
Heather Collins, die selbstbewusste Sekretärin des Abgeordneten, musterte ihn mit einem neugierigen, aber freundlichen Blick, nachdem er sich vorgestellt hatte. Trotz ihrer offensichtlichen Trauer und Erschütterung hatte sie die Aura der langgedienten Vertreterinnen ihres Standes nicht verloren. Die Aura derjenigen, die immer übersehen wurden, die aber alles sahen, alles hörten, alles wussten und alles in den Taschen ihrer korrekt geschnittenen Kostüme verbargen. Ihr kurz geschnittener rotblonder Bob tanzte um ihren Kopf, als sie Sullivan bat, sich einen Moment zu gedulden. Sie klopfte energisch an die Tür ihres Chefs und öffnete sie, ohne eine Antwort abzuwarten. Während Sekretärin und Abgeordneter offenbar aushandelten, wie zu verfahren sei, sah Sullivan sich in dem geräumigen Büro um und schrak ein wenig zusammen, als er in einer Ecke, verdeckt von Büchern und Papierstapeln eine junge Frau mit einem dunklen Pferdeschwanz sitzen sah. Er trat näher, um sich zu vergewissern, dass er keine Erscheinung habe. „Wer sind Sie?“, fragte er etwas unhöflich und entschuldigte sich im selben Moment. „Schon gut, Herr Chefinspektor, Sie sind nicht der Einzige, dem das passiert. Ich bin Emily Cook, Hilfssekretärin.“ Sullivan entdeckte, dass Emiliy Cooks Augen verweint waren. „Kannten Sie David Bickerell gut?“, fragte er leise und bedachtsam. Emily Cook nickte traurig. „Er war ein guter Mensch.“
Heather Collins’ übertrieben resolute Stimme beendete die kurze Szene verhangener Trauer. „Chefinspektor Sullivan? Bitte.“ Sie hielt die Tür zum Büro des Abgeordneten weit offen und winkte ihn mit einem schwer zu deutenden Blick hinein. Sullivan war davon überzeugt, dass ihr Lächeln etwas anderes war als die professionelle Freundlichkeit, die man von ihr erwartete.
Matthew Wilkinson, ein schmaler, streng wirkender Mann, ließ keinen Zweifel daran, dass er sich über alle Maßen belästigt fühlte. „Jeder weiß, dass der arme Bickerell ein verhangenes Gemüt hatte“, näselte er mit vorgerecktem Kinn. Sein rosiges Gesicht war ein wenig aufgedunsen von all den langen Sitzungen bis tief in die Nacht, sein schütteres aschblondes Haar hatte er nach hinten aus der Stirn gekämmt. Alle Kunst seines Schneiders und seines Kammerdieners konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass er für einen Mann seiner öffentlichen Bedeutung zu schmal, zu dünn und zu knochig war war. „Wenn Sie etwas über den Gemütszustand des armen Jungen wissen wollen, gehen Sie zu Crofton, Professor Crofton. Der kann Ihnen alles dazu sagen. Er hatte viel mit Bickerell zu tun und ist vom Fach.“
„Das wäre eine gute Idee, wenn ich nicht schon bei Professor Crofton gewesen wäre“, sagte Sullivan ehrerbietig leise, während er einen Schritt auf den pompösen Schreibtisch des Abgeordneten zuging. Man hatte ihm nicht angeboten, sich zu setzen. „Er hat mir freundlicherweise ein psychologisches Gutachten in Aussicht gestellt.“ Wilkinson öffnete den Mund und schloss ihn wieder, ohne etwas zu sagen. Er holte tief Luft. „Ja, sehr entgegenkommend, der Professor“, meinte er dann. „Haben Sie’s genommen?“
„Was genommen?“
„Das Gutachten“, zischte Wilkinson.
„Nein.“ Leo Sullivan bewegte sich langsam Richtung Tür, bis Wilkinson sich entspannt hatte. „Wo waren Sie zur Zeit des Todes Ihres geschätzten Mitarbeiters David Bickerell, Herr Abgeordneter?“
„Ich höre ja wohl nicht richtig“, schnaubte Wilkinson.
„Soll ich die Frage wiederholen?“, bot Sullivan liebenswürdig an. Er ging langsam wieder zurück zum Schreibtisch des Abgeordneten. „Das ist ganz normale Polizeiarbeit“, sagte er milde. „Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie als Mitglied des Parlaments die Ordnungskräfte dieses Landes unterstützen. Und wissen Sie, wenn wir bei der Polizei unsere Arbeit auf wissenschaftliche Methoden umstellen könnten, wären wir glücklich, Sie an unserer Seite zu wissen.“ Sullivan senkte den Kopf wie ein nachsichtiger Lehrer, steckte die Hände in die Hosentaschen und wartete.
In Wilkinsons Augen blitzte etwas auf wie eine plötzliche Erkenntnis. Er räusperte sich und nahm eine konziliante Haltung ein. „Gewiss, mein Lieber. Gewiss. Ich leitete zu der Zeit, als der arme Junge starb, eine Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft und Fortschritt. Es gibt ein Protokoll. Zufrieden?“
„Zufrieden. Für den Moment. Was genau waren Bickerells Aufgaben, sagen wir, in den letzten sechs Monaten?“
„Im letzten halben Jahr hatte er nur eine Aufgabe, nämlich die Vorbereitung und Begleitung der neuen Institutsgründungen, mit denen ich die Wissenschaft dieses Landes und das Bewusstsein der Bevölkerung auf eine neue Stufe heben will“, erklärte der Abgeordnete, wieder ganz der großspurige Politiker.
„Da hatte er sicher Einblick in alle möglichen vertraulichen Papiere, nehme ich an.“ Sullivan beobachtete Wilkinson genau. Nicht die kleinste Regung entging ihm, auch nicht das ganz leichte Zucken um den Mund des Abgeordneten, bevor er antwortete. „Er hatte ständig mit vertraulichen Dingen zu tun. Das liegt in der Natur unserer Arbeit.“ Wilkinsons Antwort kam etwas zu schroff.
Sullivan nickte verständnisvoll. „Natürlich. Und wie verstanden sich aus Ihrer Sicht die Mitarbeiter der anderen Abgeordneten mit Bickerell?“
„Im Allgemeinen gut, denke ich“, sagte Wilkinson scheinbar nachdenklich. Er hatte von derlei Dingen offensichtlich nicht die geringste Ahnung und fühlte sich entsprechend sicher. „David war ein zurückhaltender Typ“, sinnierte er. weiter. „Er bot wenig Anlass, irgendwo anzuecken. Aber genau weiß ich gar nicht, mit wem er näheren Kontakt hatte. Fragen Sie die Leute selber.“
„Da machen Sie sich mal keine Sorgen“, sagte Sullivan, als er sich nun endgültig zum Gehen wandte. „Das werde ich alles herausfinden, Herr Abgeordneter.“ Er hatte den Türknauf schon in der Hand, als er sich noch einmal umdrehte. „Es war übrigens kein Selbstmord.“ Er warf nur noch einen kurzen Blick auf das plötzlich bleiche Gesicht des entgeisterten Matthew Wilkinson und schloss die Tür. Aber er schloss sie nicht ganz.
Sullivan wusste, dass Wilkinson für einen Moment viel zu erschüttert sein würde, um das zu bemerken. Er blieb direkt bei der Tür stehen und lauschte. Er warf Heather Collins einen zuckersüßen Blick zu und tat so, als müsse er sich eine Notiz machen. Er erkannte sofort, dass sie ihn durchschaute und war ebenso erstaunt wie dankbar, dass sie so tat, als bemerkte sie nichts. Emily Cook zog es vor, nicht einmal den Kopf zu heben.
Durch den Türspalt hörte Sullivan, wie der Abgeordnete am Telefon jemanden in heftigem Ton anherrschte. „Übertreiben Sie es nicht. Sonst fliegt uns das hier alles um die Ohren!“ Ein Mitglied einer alten, in Jahrzehnten gewachsenen Seilschaft wies einen Emporkömmling zurecht. Sullivan kannte den Ton sehr genau. Den Rest konnte er nicht mehr verstehen, weil der Abgeordnete nach seinem kurzen Wutanfall sehr viel leiser weitersprach. Aber Sullivan hatte genug gehört. Er wettete mit sich selbst, dass Wilkinson sich niemand anderen als Crofton vorgenommen hatte. Er würde das später überprüfen lassen. Dann hörte er das leise Klicken einer Tür. Wilkinson hatte sein Büro durch den anderen Ausgang verlassen.
Von Miss Collins erfuhr er noch, dass Bickerell außer einer Tante in Berkshire keine Verwandten mehr hatte und dass seine Verlobte sich derzeit mit ihren Eltern in einem der beliebten belgischen Seebäder aufhielt. Wie sie zu erreichen war, wusste sie nicht.
„Hatte er Freunde, ging er in einen Club?“, wollte Sullivan noch wissen. Heather Collins musste nicht lang überlegen. „David war freundlich und aufgeräumt“, sagte sie. „Aber er war nicht sehr gesellig, jedenfalls nicht auf die konventionelle Art. Er liebte es zu lesen und zu lernen, und in seiner Shirley hatte er eine verwandte Seele gefunden.“ Heathers Augen füllten sich mit Tränen, die sie mit einer schnellen Handbewegung wegzuwischen versuchte. „Sie wären bestimmt ein großes Forscherpaar geworden. Wissen Sie, das war es, was sie vorhatten.“ Sie drehte sich schnell weg und atmete schwer.
„Ich komme später noch einmal vorbei … wenn auch die Luft rein ist.“ sagte er in einem Ton, den die beiden Frauen gut verstanden. Heather Collins versuchte ein zustimmendes Lächeln, und Emily Cook sah kurz von ihrer Arbeit auf, Neugier im Blick.
In den Gängen und in der Lobby des Parlaments herrschte um diese Zeit reges Treiben, und Leo Sullivan wusste ganz genau, dass hier mehr Politik gemacht wurde als in allen Ausschusssitzungen und Parlamentsdebatten zusammen. Als er das Gebäude gerade verlassen wollte, zupfte ihn jemand vorsichtig am Ärmel. Er drehte sich um und blickte in das ängstliche Gesicht der jungen Miss Cook, die aus der plötzlichen Nähe betrachtet, viel hübscher war, als es zuerst den Anschein gehabt hatte. Es war wohl ihr einfaches graues Kostüm, das sie auf den ersten Blick so unscheinbar wirken ließ. Sie schaute Sullivan aus intelligenten Augen an und legte sofort den Zeigefinger an die Lippen. Mit einer sparsamen Bewegung steckte sie Sullivan einen Zettel zu. Bevor er reagieren konnte, war sie auch schon wieder verschwunden, untergetaucht in der Menge der Abgeordneten, Besucher, Reporter und Lobbyisten. Er sah sofort, dass es keinen Zweck haben würde, sie in der Lobby oder den belebten Gängen wiederfinden zu wollen. Unter einem Vorwand zu Wilkinsons Büro zurückzugehen, konnte die junge Frau in Gefahr bringen, denn durch die Art der Übergabe war klar, dass es sich nicht um eine harmlose Nachricht handelte. Sullivan sah sich noch einmal um und beschloss, so wenig konspirativ wie möglich zu wirken, als er auf den Ausgang zusteuerte. Dabei schaute er ganz beiläufig auf den Zettel, den die junge Frau ihm zugesteckt hatte. Er enthielt Zeit und Ort für ein Treffen. Aber warum an einem solchen Ort? Und um diese Zeit? Was konnte eine Hilfssekretärin wie Emily Cook wissen, dass sie eine derartige Methode der Informationsübermittlung wählte?
Bevor er das mächtige Backsteingebäude von Scotland Yard betrat, blieb er ein paar Momente lang am Embankment stehen und beobachtete den Schiffsverkehr auf der Themse. An kaum einem anderen Ort fühlte er sich so zuhause. Die Schönheit von Architektur interessierte ihn nicht. Der ewige Strom, die Lebensader mit ihrem Schiffsdiesel- und Altölgestank, mit den Nebelhörnern und dem unflätigen Gebrüll der Schauerleute hatte mehr Seele als jedes noch so schöne Haus. Eine Stadt musste nicht schön sein, fand Sullivan. Sie musste funktionieren. Plötzlich bemerkte er, wie dick und schwer die Luft am Fluss war. Es war warm geworden, und es würde heiß werden. Dann ging er hinein.
Wunschgemäß erstattete Sullivan dem Polizeipräsidenten Bericht über seinen Besuch beim Abgeordneten Wilkinson.
„Sir, ich halte es für das Beste, eine Telefonüberwachung einzurichten.“ Sevenfields Gesicht wurde dunkelrot. „Sind Sie völlig übergeschnappt?“, brüllte er Sullivan an. „Sie werden sich vom Abgeordneten Wilkinson fernhalten. Ist das klar? Sie haben ihn schon genug belästigt mit ihrer Mordtheorie. Wenn es überhaupt ein Mord war, dann geht er mit Sicherheit auf das Konto dieser Radikalen, die neuerdings wieder einmal die öffentliche Ordnung stören, und jetzt raus mit Ihnen.“ Sullivan ging nicht zurück in sein Büro. Er traf sich ganz in der Nähe mit einem Spezialisten für Telefontechnik, den er vor Jahren im Zuge von Ermittlungen kennengelernt hatte und dem er seitdem zufällig immer wieder begegnete.
***
Am Beginn der folgenden Woche und wenige Tage nach Sullivans Besuch bei Crofton und Wilkinson, erfuhr das geschätzte Publikum der besseren Londoner Blätter von der bahnbrechenden Initiative des Abgeordneten Wilkinson. Um das Land auf allen Gebieten moderner Wissenschaft nach vorn zu bringen und der Welt zu zeigen, wie man den Fortschritt organisiert, sollten mehrere neue Institute gegründet werden. Den Anfang hatte die kürzlich gegründete neuartige Forschungseinrichtung mit dem Namen „Futura“ gemacht, die sich der modernen Psychologie und der Begleitung und Verbesserung des politischen Handwerks widmete.
Arbeiterstreiks epischen Ausmaßes, die heftig bekämpfte Streikverbote nach sich zogen, der lähmende Konkurrenzdruck durch entlegene Länder, deren Namen man noch kaum gehört hatte und der fast hoffungslose Rückstand in den modernen Industriezweigen waren Entwicklungen und Ereignisse, die den Stolz des Empires zu unterminieren drohten. Absatzmärkte gingen verloren, die Schulden wuchsen in astronomische Höhen und in den Kolonien rumorte es. In solchen Zeiten konnte man es sich nicht leisten, dem tief sitzenden Misstrauen der Bevölkerung gegen Maschinenzeitalter und wissenschaftlichen Fortschritt nachzugeben. Einflussreiche Fabrikbesitzer, Kapitaleigner und Politiker beschworen wortreich die Gefahr eines neuen Maschinensturms wild gewordener Neo-Ludditen herauf. Ihre Vorgänger hatten schon 100 Jahre zuvor unter dem schwer zu greifenden Anführer Ned Ludd fast die englische Textilindustrie zu Fall gebracht. Umso lebhafter wurde die Initiative des Abgeordneten Wilkinson begrüßt, die sowohl geeignet sein würde, in einer gemeinsamen Anstrengung der vereinten Wissenschaft das Land nach vorn zu bringen und in eine sichere Zukunft zu führen als auch die Unterstützung der Bevölkerung zu gewinnen.
London, 18. Juli 1928
„Die neuen Institute (so die in fast allen Blättern gleichlautende Meldung) werden großzügig ausgestattet, so dass sie nicht nur ihre Aufgabe meistern, sondern geradezu Revolutionen in der Forschung hervorbringen können. Nur die besten Wissenschaftler werden berufen, die Institute zu leiten und weiteres Personal nach ihrem Gutdünken auszusuchen. Nach anfänglicher Skepsis begrüßten die traditionellen wissenschaftlichen Gesellschaften und Akademien die Initiative ausdrücklich und sicherten Zusammenarbeit und Unterstützung zu. Den Gemeinsinn von Wissenschaft und Wirtschaft auf diese besondere Weise zu entfalten, sei ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, erklärte der Minister und dankte dem Abgeordneten und Ausschussvorsitzenden Wilkinson für sein unermüdliches Engagement. Wilkinson selbst erklärte: „Unser Land ist arm an Rohstoffen, aber reich an Ideen, und in der Wissenschaft liegt unsere Zukunft. Von der Geografie mit ihren Grönland-Expeditionen über die Industrialisierung bis zu gesellschaftlichen und philosophischen Fragen: Wir werden den Weg in die Zukunft nicht im Dunkeln finden, wir brauchen das Licht der Wissenschaft.“
Überschattet wurde der Gründungsauftakt durch den tragischen Tod des engsten Mitarbeiters Wilkinsons, der maßgeblich an der Vorbereitung und Durchführung der Initiative beteiligt war.
Am selben Abend löste sich in der Lower Regent Street ein Schatten aus einem Mauervorsprung gleich neben dem Sitz des Instituts „Futura“. Er näherte sich auf leisen Sohlen einem kleinen Mann mit einer auffallend schlechten Haltung, der das Gebäude gerade verlassen hatte, und legte ihm einen Arm um die Schulter. „Nun, Seamons, mein Junge“, sagte Chefinspektor Sullivan in scheinbar vergnügtem Ton. „Wo war Ihr Chef denn wirklich am Nachmittag des 13. Juli?“
„Hier, er war hier“, war alles, was Seamons herausbrachte. Sullivan zog ihn in den Lichtkegel einer Straßenlaterne, um sein Gesicht besser sehen zu können. Er blickte in glasige blöde Augen, aus denen jedes Leben gewichen war, und er erkannte, dass er von dem Sekretär niemals eine vernünftige Antwort bekommen würde. „Seien Sie vorsichtig mit dem Zeug“, rief Sullivan ihm noch hinterher. „Es wird Sie umbringen.“
***
„Steh auf, Tommy!“ Henrietta schüttelte ihren Bruder mit einem festen Griff an der Schulter. Es war bereits zehn Uhr, aber Tommy schlief noch immer tief und fest. Vorsichtig öffnete er ein Auge und blinzelte seine Schwester misstrauisch an. „Harry, Du Folterknecht“, krächzte er, „hast Du eine Ahnung, wie lange ich gestern gearbeitet habe?“ Er drehte sich um in der festen Absicht, weiterzuschlafen.
„Dein Chef ist am Telefon.“ Henrietta ließ nicht locker. „Und ich habe hier einen Eimer Wasser“, drohte sie.
„Chef … Wasser …“ murmelte Tommy vor sich hin. „Was?!“ Wie vom Blitz getroffen fuhr er auf und saß senkrecht im Bett. „Warum hast Du mich nicht geweckt?“ Seine Schwester legte den Kopf schief und lachte. „Hier.“ Wie durch Zauberei materialisierte sich eine Tasse Kaffee in ihrer Hand. Tommy schälte sich aus dem Bett, warf sich den Morgenmantel um die Schultern und stürzte den Kaffee mit einem dankbaren Blick auf Henrietta herunter. Er rannte die Treppe hinunter zum Telefon in ihrem kleinen gemeinsamen Arbeitszimmer, in dem die übervollen Regale bis zur Decke reichten und wo heitere Gelehrsamkeit wie ein freundliches Gemälde über allem schwebte. Zwei Schreibtische standen einander so gegenüber, dass Gespräche unvermeidlich waren, wenn die Geschwister gleichzeitig arbeiteten. Und nachdem ihre Haushälterin, Mrs. Parker, schließlich eingesehen hatte, dass es sinnlos war, den „Kindern“ hinterherzuräumen, konnte das systematische Chaos frei und ungehindert den sich überkreuzenden Gedankengängen von Henrietta und Thomas Faraday folgen.
Fünf Minuten lang sprach Tommy mit seinem Chef, was wie üblich bedeutete, fünf Minuten lang zuzuhören. „Und was machst Du noch hier?“, fragte er in gespielt schnippischem Ton, als er zu Henrietta ins Wohnzimmer ging. „Musst Du nicht längst in der Universität sein und Atome sezieren?“ Statt einer Antwort bekam er eine neugierige Frage. „Was wollte denn der verehrte Herr Chefredakteur so … früh … von Dir?“
Tommy fuhr sich nachdenklich durch die zerzausten Haare. „Das weiß ich noch nicht so genau.“