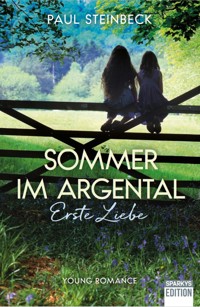2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Sparkys Edition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wenn aus Opfern Täter werden! Die Nachfahren der Schwabenkinder begehren auf! Eine Gruppe von Verschwörern will vermeintliches Unrecht aus den vergangenen Jahrhunderten in Selbstjustiz rächen. Oberschwaben wird überzogen von einer Welle der Gewalt. Anführer der At-tentäter ist Johannes. Er ist überzeugt, dass dieser Wohlstand durch die Arbeit der Schwabenkinder möglich wurde. Er findet Anhänger in der Schweiz, in Liechtenstein, in Österreich. Kommissar Steven Plodowski stellt sich mit seinen Kollegen der Gewalt entgegen und taucht unwillkürlich ein in die Geschichte der Schwabenkinder. St. Martini, der Zeitpunkt des Ultimatums naht. Die Märkte werden vorbereitet. Johannes zieht sich in die Bergdörfer von Graubünden zurück. Begegnet Steven, der selbst einer Spur folgt. Es kommt zum Konflikt und zur Auseinandersetzung. Johannes stößt Steven in den Abgrund einer verlassenen Höhle und flieht. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Stevens Leben ist in Gefahr. Die Attentäter reisen nach Ravensburg. Der große Showdown naht. Ravensburg sieht sich der größten Gefahr gegenüber, seit die Menschen sich erinnern können. Plodowski wird es mit letzter Kraft schaffen, die Täter rechtzeitig zu stoppen. Auch Dank ehemaliger Schwabenkinder. Einge-woben in die Handlung ist Stevens sehnsuchtsvolle Beziehung mit Andrea-Domenica, die aus Ko-lumbien nach Deutschland zieht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Zum Buch
Das Schicksal
Schweres Erinnern
Hundstage
Aufstand der Wenigen
Regen an Sankt Remigius …
Die Unerträglichkeit des Seins
»Wer einen guten Nachbarn hat, braucht keinen Zaun«
Herbstnebel
Karriere
Lebensglück
Graue Schatten
Richtung Abgrund
Auf dem Lande
Abgründe
Dunkelheit
Donnert’s im November gar …
Vermisst
Radikal
Freiheit
Drohender Sturm
Auf Leben und Tod
Hat Martini einen weißen Bart …
Todesmut
Showdown
Zukunft
Der Autor Paul Steinbeck …
Bibliografie:
Sparkys Edition
Zum Buch
»Man erkennt die Abstammung. Man erkennt sie! Das Unglück ist also auch auf dich übergesprungen.« Da war es wieder, dieses Dunkel vor seinen Augen. Diese Wut. Johannes konnte nichts mehr sehen, nichts mehr hören. Mit einem lauten Knall krachte der schwere Esstisch auf den Boden. Flaschen zersplitterten, Teller zerbrachen. Er sprang wie ein Puma über ihn hinweg und schmetterte Johanna mit brachialer Gewalt gegen die Wand. Beinahe 400 Jahre lang machten sich in den Alpenregionen Jahr für Jahr Heerscharen junger Menschen auf, um ins nördliche Voralpenland zu gelangen. Die Not und Armut trieben ihre Familien dazu, die Kinder schon ab dem sechsten Lebensjahr im März auf die lebensgefährliche Wanderschaft durch die schneebedeckten Berge zu schicken. In der Hoffnung, dass die Mädchen und Jungen von den schwäbischen Bauern auf den Kindermärkten auf Zeit gekauft wurden.
Viel Unrecht geschah, viel Leid musste erlitten werden. Doch das soll nun gesühnt werden! Eine Gruppe von Nachfahren will sich rächen. Oberschwaben wird von einer Welle der Gewalt überzogen. Kommissar Steven Plodowski stemmt sich mit seinen Kollegen der Gewalt entgegen und gerät dabei in Lebensgefahr. Der große Showdown naht. Ravensburg sieht sich der größten Gefahr gegenüber, an die sich deren Bewohner erinnern können. Wird es Steven Plodowski schaffen, die Täter rechtzeitig zu stoppen?
Ein Kriminalroman voller Spannung und Leidenschaft, im Herzen Oberschwabens.
Die Rache der Schwabenkinder
Plodowski ermittelt 2
Alle Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen oder Institutionen sind reiner Zufall. Die Orte aber sind real und oberschwäbische Schönheit.
Alle Rechte unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung und Vervielfältigung von Text und Bild nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages.
E-Mail: [email protected]
Lektorat: Dorthe Teßarek, Augsburg
Korrektorat: Susanna Kando, Stuttgart
Umschlaggestaltung: Designwerk-Kussmaul,
Weilheim/Teck, www.designwerk-kussmaul.de
Titelbild: Nadezda Ledyaeva – stock.adobe.com
© 2021, 2024 Sparkys Edition
Herstellung und Verlag: Sparkys Edition, Zu den Schafhofäckern 134, 73230 Kirchheim/Teck
ISBN: 978-3-9810604-8-5
In Gedenken an all die tapferen jungen Menschen, die über viele Jahrhunderte schweres Leid ertragen mussten!
Das Schicksal
Beinahe 400 Jahre lang machten sich in den Alpenregionen Jahr für Jahr Heerscharen junger Menschen auf, um ins nördliche Voralpenland zu gelangen. Die Not und Armut trieben ihre Familien dazu, die Kinder schon ab dem sechsten Lebensjahr im März auf die lebensgefährliche Wanderschaft durch die schneebedeckten Berge zu schicken, in der Hoffnung, dass die Mädchen und Jungen auf den Kindermärkten in Ravensburg, Wangen oder Kempten von den schwäbischen Bauern auf Zeit gekauft wurden. Vorausgesetzt, sie kamen nach ihrer beschwerlichen Wanderschaft heil an.
Bis zu St. Martin mussten die Kinder dann bis zum Umfallen auf den Höfen arbeiten, litten unter chronischem Schlafmangel und unsäglichem Heimweh. Niemand kümmerte sich um sie, denn sie waren Kreaturen der unteren Klasse. Sie wurden ausgenutzt und nicht selten missbraucht. Nur wenige fanden gute Aufnahme und Behandlung. Einige verunglückten bei der Arbeit, wurden zu Krüppeln oder starben. Schwangerschaften junger Mädchen wurden ebenfalls dokumentiert.
Erst zu Beginn der Vierzigerjahre des 20. Jahrhunderts fand diese unglückliche Tradition ein Ende. Zurück blieb das persönliche Erinnern an das große Leid und die Entbehrungen, die man in der Blüte seiner Kindheit ertragen musste. Durch die Tabuisierung wurde diese Erinnerung tief in die eigene Biografie vergraben und konnte dort all das Unheil einer nicht verarbeiteten Familiengeschichte entfalten.
Über Generationen hinweg sind die Auswirkungen zu spüren. Doch man redet nicht gerne darüber. Das Schwabengehen ist trotz einiger Bemühungen bis heute eine verborgene Geschichte, die man nur an ausgewählten Stellen ans Tageslicht lässt – in Museen und bei Einzelausstellungen.
Aber: Es braut sich Unheil zusammen.
Einzelne wollen Wiedergutmachung.
Es dürstet sie nach Rache.
Schweres Erinnern
++ August ++
Heftig knallte Johannes Vetter die Praxistür zu. Der laute Donner hallte durch die enge Gasse der mittelalterlichen Bergstadt. Aufgewühlt fuhr er mit der Hand durch seine blonde Mähne, die wild in alle Richtungen ragte. Wütend? Nein, mehr als das. Saumäßig wütend! Und diese Wut ließ ihn mit einem kräftigen Tritt einen schweren Mülleimer gegen die Hauswand krachen. Ängstlich blickten um ihn herum Menschen aus den Fenstern.
»Alles gut, Johannes? Brauchst du Hilfe?« Seine Therapeutin lehnte sich besorgt aus dem Fenster.
Doch er beachtete sie nicht, rannte los, lief durch die Gassen der Stadt, stolperte über hervorstehende Randsteine in Richtung Waldhaus der psychiatrischen Klinik. Das unebene Kopfsteinpflaster ließ ihn straucheln. Nur mit Mühe konnte er einen Sturz vermeiden.
Der junge Patient hatte keinen Blick für die wunderschönen Berge. Stattdessen lief wieder und wieder dieser schreckliche Film in ihm ab. Graue Fratzen vernebelten seinen Blick. Sie erschienen immer, wenn die Wut in ihm hochstieg, einer Lavamasse gleich, die mehr und mehr Druck entwickelte und mit einem Knall auszubrechen drohte. Nervös kratzte sich Johannes an den Unterarmen. Unentwegt. Er bemerkte es nicht, spürte nicht den Schmerz, den die langen Fingernägel auf der schon feurig roten Haut verursachten.
»Schwermütig, ohne dass er weiß warum. Traurige Kindheit aufgrund dysfunktionaler Familienverhältnisse. Zeigt Verhaltensauffälligkeiten. Wird psychotherapeutisch behandelt. Bisher keine Veränderung. Auch die Schwester leidet an diesen Symptomen. Will seine Medikamente absetzen. Habe ihn ausdrücklich davor gewarnt.«
Er flüsterte auswendig, was auf dem Papier in seiner Hand geschrieben stand. Notiert von dieser alten Zicke dort oben im ersten Stock. Er hatte ihn von ihrem Schreibtisch entwendet. Was erlaubte sie sich nur, über ihn und seine Familie so zu urteilen?
Eigentlich hätte er auf seinem gut dreieinhalb Kilometer langen Fußweg zur Klinik seiner Schwester nach Norden abbiegen müssen, um zur Anhöhe zu gelangen. Stattdessen führten ihn seine Füße unvermittelt nach rechts, Richtung Süden, tiefer hinein in die Altstadt. Nein, er wollte jetzt nicht zu ihr, zu seiner Schwester Mila, auch wenn sie auf ihn warten mochte. Sie war der Beginn seiner eigenen Reise zu sich selbst. Nun gut, so wirklich hatte er bisher nicht angefangen mit dieser Reise in sein Innerstes. Immer wieder war er kurz vor dem Eintauchen abgebogen und geflüchtet. Hatte die Reißleine gezogen. Milas Geschichte schreckte ihn ab, es ihr gleich zu tun. Sie war zerbrochen an psychischen Problemen, die sie nicht einordnen konnte. Ängste, die sie nicht in der Lage war zuzuordnen; Zwänge, die ihr das Leben schwer machten; unbändige Wut, die unvermittelt herausbrach und die sie gegen sich wendete. Ihr zartes Wesen konnte dem Druck nicht standhalten, der sich in ihrem Inneren immer wieder aufbaute und entlud. Sie konnte ihr eigenes Leben derzeit nicht meistern. Und jetzt war er selbst mittendrin im Schlamassel.
Johannes ballte die Hände zur Faust. Die Fingernägel bohrten sich in die Handballen. Heftig schüttelte er im Gehen den Kopf. Hätte er doch besser nicht begonnen mit dieser Therapie. Dieser Schmerz, den die Gefühle in ihm auslösten, war unerträglich. Das feinfühlige Bohren der Therapeutin war für ihn schlimmer als die Folter eines jeden Zahnarztes. Johannes atmete heftig, die Brust schmerzte ihm. Er musste seinen schnellen Schritt verlangsamen.
In der Grabenstraße lenkte der junge Student direkt auf das dortige Café zu. Seine Muskeln und Sehnen spannten sich an, als er sich auf den Stuhl warf. Schweiß rann ihm am Hals entlang und suchte sich seinen Weg nach unten. Das dunkle T-Shirt legte sich an diesem heißen Sommertag schwer auf seine Haut. Johannes blinzelte in die grelle Sonne. Der August schenkte seiner Heimatstadt an diesem Tag erneut tropische Hitze.
Das Vibrieren seines Handys riss den Aufgewühlten aus seinen Gedanken. Pflichtbewusst griff er in seine Hosentasche und zog es mühsam heraus. Irgendeiner seiner wenigen Bekannten aus Zürich, wie das Display verriet. Doch Johannes hatte keine Lust auf Gespräche und drückte den Anrufer weg. Stattdessen bestellte er sich einen Espresso und ein schönes Helles. »Gleich einen halben Liter, bitte!«, rief Johannes der Bedienung hinterher. So langsam kam er wieder zur Ruhe. Der Alkohol würde am heißen Sommertag auf den leeren Magen schnell und heftig einschlagen und sein Übriges tun. Er beobachtete halb im Stuhl versunken die wenigen Besucher, die sich nach Chur verloren hatten. Sie würden zu wenig Zeit investieren, um diese schöne Stadt zu entdecken. Das taten so gut wie alle Menschen, die auf der Durchreise waren. Chur mied man, als ob auf dieser Stadt ein Fluch liegen würde. Eilig nahm Johannes der Bedienung das Bier aus der Hand und genoss gierig einen tiefen Schluck. Quengelnde Touristenkinder zerrten ihre Eltern zur nahegelegenen Eisdiele.
»Tsss, die Deutschen mal wieder«, brummte jemand am Nachbartisch.
Johannes blickte zu dem Sprecher hinüber und nickte. Das Bier leerte sich schnell, nebelte ihn ein. Seine tiefblauen Augen erhielten einen matten Schleier. Doch dieser Schleier legte sich auch wohltuend auf sein Gehirn, lullte die Gedanken ein und ließ so langsam die Fratzen verschwinden. Diese ewigen Quälgeister.
»Sie sind wieder in Scharen in Richtung Süden unterwegs«, kommentierte der Unbekannte am Nachbartisch. Er suchte das Gespräch. Doch Johannes nickte nur stumm. Er war mit seinem Bier beschäftigt und ließ sich vom Geschehen auf dem Platz vor ihnen ablenken.
Johannes nannte Chur seine Heimat. Hier war er groß geworden. Mit Chur pflegte er eine Hassliebe, wie wohl jeder junge Mensch, den es aufgrund der Enge in die Welt hinaustrieb und doch immer wieder herzog. Die Enge der Stadt und der Täler gab Heimat und Geborgenheit – wenn man noch ein Kind war. Je älter Johannes aber wurde, desto magischer wurde die Anziehungskraft des Rheins, der mit mächtiger Kraft nach Norden strebte, in das weit ausladende Land der Deutschen und weiter in die Welt hinaus. Dorthin wollte der junge Mann nach seinem Studium an der ETH, jener Elitehochschule in Zürich, flüchten, denn auch Zürich war nicht genug weite Welt. Nach Mittel- oder Südamerika. Weit weg von diesen traurigen Orten. Es musste bald geschehen, das spürte er.
Ein kleiner Spatz platzierte sich frech vor ihm auf dem Bistrotisch. Er war im Begriff, Johannes den Rest seines Zimtkekses streitig zu machen. Verärgert warf dieser dem Dieb einen silbernen Kaffeelöffel entgegen, den er noch immer in der Hand gehalten hatte.
»Verschwinde, du Biest. Kümmere dich um deinen eigenen Dreck.« Eilig stopfte Johannes die Reste seines Kekses in den Mund, damit kein Vogel der Erde auf den Gedanken kommen konnte, es ebenfalls zu versuchen. Der Zettel mit seiner Diagnose knisterte in der Hosentasche, als er sich wieder aufrecht hinsetzte.
»Vielleicht habe ich ja einen an der Waffel, will das aber nicht zugeben«, sinnierte Johannes vor sich hin.
Die Geschichte mit seinen Ahnen und ihr Unglück, das auf ihn übergesprungen war, wie die Therapeutin andeutete, gab ihm eine gute Rechtfertigung.
Johannes Gedanken wurden gestört durch eine kleine Gruppe von Rentnern, die mit ihren Rollatoren neben ihm am Tisch Platz nahmen. Ihre Gehhilfen klapperten etwas und schlugen gegen die Metallstühle, als die Damen und Herren im Schatten mühevoll ihre Sitzgelegenheiten zurechtrückten. Die Senioren lachten viel und plapperten durcheinander. Er kam nicht umhin, ihnen seine Aufmerksamkeit zu schenken. Trotz sichtbarer Behinderungen und Beschwerden, die das Alter mit sich brachte und die dazu beitrugen, dass der Vorgang des Setzens einige Zeit in Anspruch nahm, schien sie das nicht zu stören. Sie hatten offenbar eine gute Zeit miteinander.
Johannes kniff die Augen zusammen, um gegen das Licht besser sehen zu können. Dabei wollte er das alles gar nicht mitkriegen! Lachende und zufriedene Menschen in direkter Nachbarschaft, das brauchte er jetzt nicht. Mehr Bier, das war es, was ihm guttat. Und so nahm er einen weiteren tiefen Schluck.
»Hallo Johannes, alles gut bei dir?« Eine der älteren Damen winkte ihm freundlich zu. Er nickte zögerlich, gab sich aber einen Ruck und hob zum Gruß sein zweites Glas Bier. Nun erkannte er einzelne Gesichter in der Gruppe. Seine Großmutter pflegte zu Lebzeiten hin und wieder mit dieser Seniorengruppe die Stadt unsicher zu machen. Die »Rollatorengang« wurden sie von der Bevölkerung genannt. Sie konnten ihr Leben genießen; in vollen Zügen, wie es schien.
Er zwang sich zu einem Lächeln beim Anblick der fröhlichen Gruppe. Und ohne es anfangs zu wollen, hellte sich sein Gemüt mit diesem Lächeln etwas auf. Die Ablenkung schien gutzutun. Seine Neugierde verdrängte zusehends das Grübeln. Neugierde darauf, wie diese Menschen ihr Leben gemeistert hatten und wie sie mit den Schicksalsschlägen umgingen, die sie sicherlich alle während ihrer vielen Jahrzehnte ertragen mussten.
Gut, dass sich die Zeiten geändert hatten. Johannes erinnerte sich der Erzählungen der alten Menschen oben in den Bergdörfern. Bevor der Tourismus und die Industrialisierung in diese Welt gelangten, war das Leben karg und voller Entbehrungen gewesen. Seine Großmutter, Gott habe sie selig, hatte ihm viele schreckliche und grausame Geschichten aus jenen Tagen erzählt. Im vergangenen Winter auf ihrem Krankenbett, das an der Pforte zum Frühling auch ihr Sterbebett wurde. Ein langes und im Ganzen doch mühevolles Leben fand damit ein sanftes Ende. Doch für den traurigen Enkel bedeutete dies ein weiteres schweres Erbe, das sich auf seine Schwermut legte.
Die Therapeutin sollte ihm helfen, dieses Gift zu entfernen, um ihm endlich innere Ruhe zu geben. Doch seinem Empfinden nach verschlimmerte sie die Situation nur noch mehr. Keine Stunde war es her, dass er in der Therapiesitzung laut heraus brüllte: »Ausgebeutet, missbraucht und geschändet haben uns die Sau-Schwaben! Meine Familie genauso wie alle Schwabenkinder in dieser Zeit. Haben Leben zerstört, unserer Familie eine glückliche Zukunft genommen!« Johannes schüttelte sich, wollte die Gedanken an die letzte Sitzung verdrängen. »Darf ich mich zu euch setzen?« Er blickte fast schüchtern zur Gruppe der Senioren.
Doch diese zögerten nicht lange und machten erfreut Platz. »Was ist dein Anliegen, junger Mann?«, forderte ihn einer der alten Herren auf, der seinen Blick richtig interpretierte.
Johannes druckste etwas herum, startete aber direkt mit seinen Fragen, obschon das Bier ihn etwas beim Reden einschränkte. »Mich bewegen die Erzählungen von Großmutter, in denen sie vom vielen Leid in früheren Tagen sprach. Sie berichtete, dass das Leben in den Bergen für unsere Vorfahren mehr einer Hölle glich als einem lebenswerten Dasein. Sie sprach von Hunger, Kälte und Not, die die Menschen Jahr für Jahr nach Norden ins Alpenvorland trieben. Was wisst ihr selbst davon?« Die Runde räusperte sich. Niemand antwortete zunächst, bis die ehemalige Freundin seiner Großmutter reagierte. »Was genau meinst du denn? Es gab immer und überall viel Leid.«
»Nun, zum Beispiel die Schwabenkinder oder Hütekinder! Wart ihr selbst welche?«
Unruhe machte sich am Tisch breit. Aus dem willkommenen Gast wurde plötzlich ein ungemütlicher. »Nein, wir sind zu jung, um diese Zeit noch erlebt zu haben. Aber wir kennen die Geschichten. Warum willst du das wissen?«
»Na, weil es Teil meiner Geschichte ist, weil es Teil der Geschichte unserer Familie ist, weil es wie ein schwarzer Fleck auf unser aller Vergangenheit lastet«, wollte Johannes antworten. Doch er behielt dies für sich. Stattdessen entgegnete er: »Ich will die Welt unserer Ahnen und das Leben in eurer Jugend kennenlernen und besser verstehen. Deshalb.« Erwartungsvoll blickte er in die Runde. Die Kühle des Schattens war an diesem sengenden Sommertag eine Wohltat. Um die Stille zu überbrücken, schnappte sich Johannes wieder seinen Krug und nahm einen weiteren kräftigen Schluck des inzwischen lau gewordenen Bieres. Zu seiner Überraschung erhielt er keine Antwort, sondern eine Gegenfrage aus dem Munde einer der Seniorinnen.
»Johannes, lass es uns doch mal umdrehen: Erzähl du uns, was deine Großmutter auf ihrem Sterbebett berichtet hat. Dann können wir mit unserem Wissen ergänzen, was möglich ist. Für mich wäre es aber auch eine Hilfe, um manches Verhalten deiner Großmutter zu ihren Lebzeiten besser verstehen zu können. Nicht immer haben wir alles verstanden, wenn sie so plötzliche und impulsive Gefühlsschwankungen hatte.«
Der Angesprochene schluckte schwer. Das hatte er nicht erwartet. Er wollte erfahren, nicht von sich preisgeben. Doch die Runde blickte ihn erwartungsvoll, beinahe drängend an. »Sprich, was hat sie dir erzählt?« Ein Kloß lag in seinem Magen. Hatte er nicht gerade eben eine Stunde lang einer fremden Person, seiner Therapeutin, von sich erzählen müssen? Entgegen seiner Gefühle und entgegen seiner Natur? Einem älteren Herrn ging das zu lange: »Na, warst schon immer ein introvertierter, wortfauler Junge.« Er winkte mit der Hand ab: »So war schon die ganze Familie – eigenartig.«
»Pius, benimm dich!« Die ältere Dame neben ihm stieß ihm hart in die Rippen. Doch der wehrte störrisch ab.
»Niemand war bei uns eigenartig!« Johannes zischte einer Schlange gleich die Worte durch die Zähne. Jede seiner Muskeln spannte sich an. Schweiß rann von seiner Stirn.
»Dann erzähl endlich. Und wir erzählen dir.« Der Pius genannte Herr ließ nicht locker.
Gereizt drehte sich Johannes ihm zu: »Also gut! Ich erzähls euch! Denn das verdammte Unheil liegt nicht nur auf uns. Das weiß ich jetzt! Das ist ein Fluch aus der Zeit der Schwabenkinder!«
Das Schreien der Touristenbälger vor der Eisdiele hallte über den sommerlichen Marktplatz. Sie stritten mit ihren Eltern um die Anzahl der Eiskugeln. Mehr als wohlgenährt standen sie in ihren verschwitzten T-Shirts vor der Eisvitrine und zeigten mit dicken Fingern auf bunte Eisbehälter.
Johannes öffnete die Lippen, um zu beginnen, doch der alte Herr kam ihm unvermittelt zuvor. Der Begriff Schwabenkinder war offenbar ein Schlüssel, um ihn zu öffnen. »Na gut, dann erzähle ich etwas: Es waren schwere Zeiten für alle in den früheren Jahrhunderten. So gut wie keine der Familien in den Alpen blieb vom Gang ins Schwabenland verschont«, erklärte Pius. Er blickte Johannes an. Seine Stirn lag in Falten. Eigentlich hatte er sich den Nachmittag ganz anders vorgestellt. »Doch warum wissen die Menschen hier nur so wenig von diesem unsäglichen Thema? Warum sperren wir es in kleine Museen und schweigen es sonst zu Tode?« Johannes stellte sein Bier energisch auf dem metallenen Bistrotisch ab. »Niemand redet darüber. Niemand!«
»Weil nicht alles schlecht daran war und wir dadurch überleben konnten, junger Mann! Niemand hatte es früher so gut wie ihr! Für euch ist rundherum gesorgt. Die Zukunft steht euch offen. Den Begriff Hunger kennt ihr doch nur aus Erzählungen.«
Johannes wehrte mit den Händen ab und schüttelte den Kopf: »Großmutter hat mir erzählt, dass der Schwabengang großes Unglück über unsere Familie gebracht hat. Damals muss etwas passiert sein, was niemand erzählen möchte, aber uns bis heute kaputt macht.«
Schweigen setzte ein. Alle griffen beinahe zeitgleich nach Kaffeetassen und Gläsern, um einen Schluck zu nehmen. Alle hatten sie einen Gedanken hierzu, niemand aber wollte sprechen. Auch Johannes nicht, obwohl er schon sehr viel hatte in Erfahrung bringen können, seit dem Tod seiner Großmutter.
»Unglücke gehören zum Leben in den Bergen, mein Sohn«, durchbrach ein kleinerer Mann die Stille. Er saß in sich zusammengesackt da. Sein Kopf hing vornüber, ihm fiel es schwer, den Blick zu heben. »Sie sind Gottes Strafe für unsere Nachlässigkeit im Glauben. Wir müssen diese Sühne annehmen. Ich weiß, ihr jungen Leut’ versteht das nicht mehr. Aber glaub mir, ich weiß, wovon ich rede.«
Johannes wandte seinen Blick von ihnen ab und biss sich auf die Lippen. Sie kamen nicht wirklich weiter. Niemand würde ihm konkrete Informationen preisgeben wollen oder über Dinge sprechen, die lange zurücklagen. Schmachvolle Geschichten verdrängte man besser. Er fühlte sich plötzlich erschöpft und müde. »Lasst es gut sein«, winkte er dann auch ab. »Wir sollten die Vergangenheit ruhen lassen und uns der Gegenwart zuwenden.« Er versuchte ein zögerliches Lächeln und hob sein Bier zum Gruß. Nur allzu gerne nahmen die Senioren das Angebot an und starteten unvermittelt ein Gespräch übers Wetter, die Kühe auf den Almen und die diesjährige Milchproduktion dort oben in den Bergen, die in kilometerlangen Pipelines ins Tal gepumpt wurde. Johannes wollte höflich sein und lauschte noch einige Zeit. Dann aber bezahlte er, verabschiedete sich und ging seiner Wege.
Die grauen Schatten tauchten wieder auf und begleiteten ihn hartnäckig. Er konnte noch so schnell gehen, an der nächsten Biegung standen sie wieder vor seinen Augen, durchdrangen ihn, verfolgten den Gepeinigten. Doch je mehr er sich der psychiatrischen Klinik näherte, desto lichter wurde es um ihn und in seinem Kopf. Die Aussicht, gleich seine Schwester, den wichtigsten Menschen in seinem Leben zu treffen, munterte ihn etwas auf.
Langsam wurde sein Kopf wieder klarer, und Johannes schaffte es, sein dumpfes Gehirn ein wenig zu sortieren. An Tagen wie diesen beneidete er seine Schwester Mila, die gut versorgt wurde und in der Klinik ein entsprechend manierliches Leben führen konnte. Mila war so klug gewesen zu verstehen, dass ihre Depressionen ein Leben lang ihre Begleiter sein würden. Sie konnte ihnen nicht entkommen, aber lernen mit ihnen zu leben. Und das schaffte sie mit der Betreuung in der Klinik.
Nach ihrem zweiten Selbstmordversuch, den sie vor wenigen Jahren nur mit Glück überstanden hatte, befand sich seine Schwester in der Einrichtung für psychisch Erkrankte. Großmutter war seinerzeit ihr Schutzengel gewesen und rief in letzter Minute die Ambulanz, bevor die Tabletten ihre fatale Wirkung zu Ende hatten führen können.
Johannes schoss ein Schmerz durch die Brust, als die Bilder jenes schrecklichen Tages wieder vor ihm auftauchten. Nein, Mila brauchte den Schutz. Er durfte sie nicht verlieren. Sie war seine letzte große Säule, die ihm Halt gab in diesem Leben.
Der Duft frisch gemähten Grases auf den angrenzenden Wiesen und würziger Kräuter empfing ihn, als er die weitläufige Anlage mit ihren zahlreichen Gebäuden betrat. Die Ruhe hier draußen tat gut. Keine Touristen, die mit ihrem Geplapper nervten, kein Durchgangsverkehr oder Stadtlärm. Einfach Ruhe, die sofort das eigene Gemüt besänftigte. Er entdeckte Mila in den Grünanlagen. Sie saß auf einer Bank und winkte ihm zögerlich zu, als er den Kiesweg entlangschritt.
»Hi, Süße, hast du auf mich gewartet?«
Sie nickte. »Ja, schon seit dem Nachmittag.«
Sofort erwischte ihn sein schlechtes Gewissen. »Es tut mir leid, ich wurde aufgehalten.«
Mila blickte ihm in die Augen und strich fürsorglich eine Strähne aus seinem Gesicht. »Traurig?«
Er blickte zur Seite. »Nein, alles gut. Nur ein wenig Heuallergie«, log er. »Sie ernten heute im Umland. Wie geht es dir?«
»Gut, sehr gut. Wir machen Fortschritte.« Mila zeigte in Richtung Terrasse. »Es gibt gleich Abendessen, isst du mit?« Als er etwas zögerte, zog sie ihn mit. »Komm schon, ich habe vorhin gefragt. Sie freuen sich, wenn du mir Gesellschaft leistest. Sie wissen, wie gut du mir tust.«
Das Lächeln kehrte wieder in sein Gesicht zurück. Ja, seine kleine Schwester, sie verstand es schon immer, ihn wieder einzufangen, wenn er am Abdriften war. Sie beide waren ein Team, ein Leben lang. Das gab ihnen Halt und Stärke bei schwachen Eltern, die mit ihrem eigenen Leben, ihrer Ehe und der folgenden Scheidung vollauf beschäftigt und mit der Fürsorge für die Kinder hoffnungslos überfordert waren. Gut, dass die Großmutter in Chur die Erziehung der beiden übernommen hatte, während die Eltern versuchten, möglichst weit auseinanderzuziehen und der Welt wie dem Leben überhaupt zu entfliehen.
Die Mitarbeiter der Klinik hatten ihnen einen eigenen kleinen Tisch im Freien eingedeckt, sodass sie für sich sein konnten.
»Warst du heute bei deiner Therapeutin?«
Er nickte, wandte aber seinen Blick ab. Ihm war nicht daran gelegen, mit ihr darüber zu sprechen. »Und?« Mila hakte nach.
Um etwas Zeit zu gewinnen, nahm sich Johannes eines der frischen Bauernbrote und strich es mit Kräuterquark voll, um darauf Radieschen, Käse und etwas Schinken zu platzieren. Mit gepresster Stimme setzte er an: »Sie ist nervig! Sie bohrt unentwegt nach und lässt nicht locker.« Genau dort, wo es ihm am meisten wehtat. Kein Faustschlag ins Gesicht konnte so viel Schmerz verursachen wie dieses konsequente Drücken auf die wunde Seele.
»Johannes, es ist wichtig, dass du in die Gefühle reingehst. Wenn du in diesem Bereich deines Innersten aufgeräumt hast, dann wird’s leichter. Glaub mir. Die Frage ist nur, ob diese Therapeutin und diese Therapierichtung für dich am geeignetsten sind.«
Doch er schüttelte den Kopf. Im Grunde mochte er seine Therapeutin, auch wenn er immer wieder wütend auf sie war. Der impulsive Patient spürte, dass sie ihm helfen wollte. Sie war für ihn da. Und doch, brach oftmals diese unbändige Wut, dieser ziellose Hass aus ihm heraus, wenn er bei ihr war. Johannes konnte das nicht kontrollieren, und das machte ihn verrückt.
Aufmerksam beobachtete Mila ihn, während er seinen Gefühlen nachforschte. »Bruderherz, du musst lernen zu unterscheiden, was deine eigenen psychischen Probleme sind und was du über Generationen hinweg vererbt bekommen hast.«
Johannes nickte. »Das sagte sie heute auch. Neuere Forschungsergebnisse hätten das nun belegt.« Er schmatzte genussvoll.
»Ja, da hat sie recht, deine Therapeutin. Sie haben das bei Nachfahren von Kriegsopfern entdeckt. Über mehrere Generationen hinweg war eine unergründliche Angst und Panik bei den Menschen zu verzeichnen. Niemand konnte das nachvollziehen oder verstehen. Nun aber ist klar: Diese Ängste werden kollektiv weitervererbt. Von einer Generation auf die andere.«
Johannes blickte von seinem zweiten Brot auf, das er mühsam mit einem Messer zu teilen versuchte. »Alles verstanden so weit. Was hat das aber mit uns zu tun? Gab es etwas wirklich so Schlimmes bei unseren Urahnen?« Er hätte sich die Antwort selbst geben können!
Ein früher Käuzchenruf hallte durch den lauen Sommerabend. Rufer des Todes, schoss es unmittelbar durch seinen Kopf.
»Hat Großmutter dir nichts von ihrem Schicksal und dem ihrer Vorfahren erzählt?«
Er zog die Schultern hoch: »Ja sicher hat sie von Früher gesprochen. Aber, ob es sich um diese Sache mit dem Vererben dreht, kann ich nicht sagen. Woher weißt du das alles?«
»Aus meiner Therapie. Seit gut einem Jahr arbeiten wir vermehrt an unserer Familiengeschichte. Und Großmutter ist ein wichtiger Baustein.« Mila richtete sich auf und begann zu erzählen. »Einer meiner Therapeuten hat Großmutter im Krankenhaus besucht. Und erst, als er ihr klarmachte, dass dies alles für meine Heilung notwendig wäre, brach sie ihr jahrzehntelanges Schweigen. Es begann mit einer unserer Ururgroßmütter, die 1888 geboren wurde. Oben in Arosa, wo unsere Familie ursprünglich herkommt. Sie wurde als junges Mädel 1903 genauso wie tausende anderer Kinder im Alter von fünfzehn Jahren hinausgeschickt zu den Schwabenbauern, wie du weißt.«
Johannes nickte. Er hatte das im Internet mühsam nachrecherchiert, nachdem Großmutter nur bruchstückhaft darüber reden wollte.
Mila breitete beide Arme aus und hielt die Hände nach oben, als wolle sie abwägen. »Manche waren wohl nett, andere waren die reinsten Sklaventreiber und Sadisten.« Sie ließ die Arme wieder sinken und schwieg, als schien sie in sich hineinzuhorchen, um zu verstehen, was das Gesagte mit ihr machte. Der Ruf des Käuzchens kam näher. Johannes lauschte aufmerksam dem eigentümlichen Geräusch. Ein leichter Schauer lief ihm über den Rücken.
Mila tupfte sich mit einer Serviette den Mund ab und fuhr fort: »Unsere Urahnin, ich erinnere mich gerade leider nicht an ihren Namen, wurde von einem Bauern gekauft, auf dessen Hof sie bis zu dreizehn Stunden am Tag schuften musste. Hier, schau mal, das sind Notizen, die Urgroßvater auf einer Schreibmaschine von einem älteren Aufschrieb abgetippt und mit eigenen Kommentaren versehen haben soll.« Mila reichte ihm mehrere zusammengefaltete Blätter, die von oben bis unten vollgetippt waren. Das Papier war vom häufigen Lesen kräftig abgegriffen. Mila musste darin regelrecht gewühlt haben.
Johannes begann, die knittrigen Zettel zu überfliegen, während Mila mit ihrer Schilderung fortfuhr. »Mit fünfzehn Jahren war sie ja schon größer als manch anderes Kind in der Fremde. Das war dem Bauern wohl auch aufgefallen, und er schwängerte sie. Die Hintergründe kenne ich nicht. Ob mit Gewalt oder mit Lockmitteln. Du musst wissen, die Not und Angst der Kinder waren groß.«
Johannes blieb der Bissen im Mund stecken. »Weiß man, welcher Bauer das war? Gibt es eine Adresse?« Und wieder quoll diese unergründliche dunkle Masse in ihm hoch. Seine Hand legte sich krampfhaft um die Armlehne des Stuhls. Er drückte so fest er konnte, um diese Wut unter Kontrolle zu bringen.
Milas Stimme klang brüchig, als sie weiter erzählte: »Stell dir vor, ein schwangeres Mädel in diesem Alter. Geschwängert von einem Schwabenbauern. Was für eine Schande für die Familie. Wer wollte sie noch heiraten? Welche Zukunft konnte ein geschändetes Mädchen noch haben in jener Zeit? Dennoch ist sie im Oktober schweren Herzens zurück nach Hause gewandert. Wo hätte sie sonst hingehen sollen? Doch niemand wollte was mit einer Hure im Dorf zu tun haben. Die eigene Familie hat sie verstoßen. Man warf das arme Mädchen einfach vor die Tür wie einen streunenden Hund. Kannst du alles in diesen Kopien nachlesen. Es gibt noch mehr davon. Kann ich dir beim nächsten Mal geben, wenn du willst.«
Johannes nickte. Sein Blick wirkte düster. Wenn er den Namen des Bauern und seiner Nachfahren herausbekommen würde, dann … »Sprich weiter«, forderte er seine Schwester auf, der das Drohende in seiner Stimme nicht entging.
»Soll ich wirklich? Alles in Ordnung mit dir?«
Ungeduldig nickte er. »Ja, sicher. Ich bin groß genug, um das zu hören. Sprich weiter!«
Mila legte sanft ihre Hand auf seinen linken Arm, der frei auf dem Tisch lag, während die andere Hand noch immer die Armlehne zu zerquetschen versuchte. Er ließ die zärtliche Nähe kurz geschehen, bevor er die Linke zurückzog. Mila blickte ihn irritiert an, ließ ihre Hand aber auf dem Tisch liegen. »Den kleinen Sohn brachte sie im Frühjahr 1904 somit allein in einer armseligen Hütte zur Welt. Mit der Hilfe einer Kräuterfrau. Nur notdürftig hat sie sich um den Sohn gekümmert, und wäre die Kräuterfrau nicht gewesen, wäre der Neugeborene wohl nicht übers Jahr gekommen. Ururgroßmutter aber hat sich im Sommer darauf voller Kummer das Leben genommen.« Sie schluchzte. »Wie kann man nur so kaltherzig mit einem armen Geschöpf umgehen, Johannes? Sie war doch noch ein Mädchen und vollkommen unschuldig!«
Wieder spürte Johannes diese unsägliche Hilflosigkeit in sich aufsteigen, die sich mit jener tiefschwarzen Masse in ihm vermischte. Doch zum ersten Mal verband er diese zerstörerische Energie mit einem Menschen. Dem Bauern in Oberschwaben. Dieses Schwein. Was hatte er nur angerichtet. Johannes blickte zu seiner Schwester auf, die sich gerade die Tränen aus dem Gesicht wischte. Mit aller Macht kämpfte er selbst dagegen an.
»Unser Urgroßvater wuchs ohne Eltern bei der Kräuterfrau auf, die im hohen Alter starb, als er selbst noch nicht einmal zwölf war. Kann es sein, dass er Thomas hieß?«
Seine Schwester schien zerstreut und müde. Jetzt nahm Johannes ihre Hand in die seine und streichelte sie sanft. »Gut möglich, Süße. Komm, lassen wir es für heute sein. Das strengt dich zu sehr an.«
Doch Mila atmete tief ein und fuhr fort: »Dieser junge Thomas, der so viel jünger war, als wir beide es sind, musste sich allein durchschlagen, stahl, was er zum Leben brauchte, und wurde am Ende von den Menschen aus der Gemeinde verjagt. Er musste in einem der Jahre genauso den schweren Marsch über die Berge zu den Schwaben auf sich nehmen, wie die anderen Kinder auch. Als er aber im Herbst darauf zurückkehren wollte, nahm man ihn nicht mehr in die Gemeinschaft auf. Ein Schwabenbastard hatte keine Zukunft in deren Welt. Dieser junge Thomas schlug sich deshalb in der Fremde durch, bis er inmitten der Kriegswirren an einem der Häfen im Westen landete, die die Menschen nach Übersee brachten. Er musste flüchten. Ich vermute, er hatte zu viele Straftaten auf seinem Weg an die französische Küste begangen. Sicherlich, um zu überleben, aber wer weiß das schon? Ein Junge, der mit ihm flüchten wollte, aber kalte Füße bekam, berichtete nach seiner Rückkehr davon, dass dieser junge Thomas bei seinen Überfällen äußerst brutal und aggressiv war. Er habe dem Jungen Angst gemacht. Sie trennten sich deshalb voneinander, und der Bub ging reumütig zurück ins Dorf.«
Johannes schlug mit lautem Klatschen eine Mücke tot, die sich auf sein Gesicht gesetzt hatte. »Woher wusste Großmutter solche Dinge? Nur von den Aufschrieben?« Voller Grimm zerrieb er die Mücke zwischen Daumen und Zeigefinger zu einem Brei.
Mila zeigte in Richtung südlicher Berge. »Sie soll das von einem guten Freund erfahren haben, der noch heute in Arosa lebt. Wohl der Sohn des Jungen, der mit Thomas geflüchtet war. Louis heißt er, wenn ich mich richtig erinnere. Er arbeitet im Heimatmuseum. Ich weiß es nicht genau. Aber unser Urgroßvater heuerte auf einem dieser Ozeandampfer als Bootsjunge an und verschwand für viele Jahre in der neuen Welt. Was er auf der anderen Seite des Ozeans gemacht hat und wo er genau war, weiß niemand. Doch ungefähr fünfzehn Jahre nach dem ersten Weltkrieg tauchte er unvermittelt wieder auf. Gut gekleidet, mit einem großen Beutel voller Dollars am Gürtel. Gut sichtbar für alle im Dorf. Niemand erkannte zunächst den reichen Herrn, der auf großen Füßen zu leben beliebte und für genügend Gerede in der Gegend oben in den Bergen sorgte. Mit seinem Geld aber kaufte er sich ausgerechnet in Arosa ein großes Anwesen, inmitten der Menschen, die seine Mutter und ihn einst verstießen und ihn nicht als den Sohn ihrer Gemeinde erkannt haben. Unser reicher Urgroßvater schnappte sich das schönste Mädel im Dorf. Oder besser gesagt: Sie war seinem vielen Geld erlegen. Von einer glücklichen Ehe konnte man nicht sprechen, wie es hieß. 1935 wurde unsere Großmutter Anna geboren. Sie hatte sich eine Familie ausgewählt, die von Hass und Rachsucht geprägt war.«
Mila unterbrach ihre Erzählung, um Atem zu holen. Sie schwieg längere Zeit. Die folgenden unglücklichen Jahrzehnte breiteten sich vor ihrem geistigen Auge aus.
Johannes rutschte unruhig auf seinem Stuhl umher und drückte ungeduldig ihre Hand. Mila versorgte ihn durch ihre Erzählung mit einigen Puzzleteilen, die sich mit denen aus den Erzählungen seiner Großmutter verbanden. »Sprich weiter – bitte!« Er registrierte die Pfleger, die bereits mehrfach aus der Tür geblickt hatten, um den Tisch abzuräumen und um seine Schwester mit hineinzunehmen.
Mila gab sich nochmals einen Ruck und fuhr fort. »Mit den Menschen im Dorf hat unser Urgroßvater seine hässlichen Späße getrieben, sie gedemütigt, wenn sie bei ihm ihre Schulden nicht begleichen konnten und hat Streit und Zwietracht unter den Bergbauern gestreut, wann immer er konnte. Das Leben muss für die Dorfbewohner und ihre Familien die Hölle gewesen sein. Doch für die Frauen auf dem Hof war dieses Leiden noch um einiges mehr. Sie wurden von ihm misshandelt und vergewaltigt. Sein Hass und sein Drang anderen wehzutun war gewaltig. Er machte vor niemandem halt. Auch Großmutter ist nicht von ihm verschont geblieben. Seine eigene Tochter! Er hat sie verprügelt, wenn sie sich ihm verwehrte. Als unsere Mutter 1969 ebenfalls als uneheliches Kind geboren wurde, keimte die Angst, dass er sich eines Tages auch an dem Mädchen vergreifen würde.«
Johannes fragte sich, warum ihre Großmutter nicht vom Hof geflohen war. Hatte sie Angst? Wusste sie nicht, wohin? Zerstreut zerbröselte er einzelne Brotkrumen zwischen seinen Fingern. Großmutter war für ihn immer eine willensstarke und energische Frau gewesen. Warum aber war sie damals nicht einfach gegangen?
Mila presste kurz die Lippen zusammen und blickte in den Nachthimmel. Dann sprach sie mit leiser Stimme weiter: »Den Vater unserer Mutter gab Oma niemals preis. Wir können nur spekulieren. Der Tag aber, vor dem sich unsere Großmutter gefürchtet hatte, kam, als Mutter acht oder neun Jahre alt war. Ich erinnere mich gerade nicht genau an ihr Alter. Unsere Urgroßmutter war längst gestorben, als der Schänder Mutter in den Schuppen zerrte. Oma hörte das Schreien, als sie aus dem Garten ins Haus gehen wollte. Danach ging alles ganz schnell: Der Hof brannte lichterloh, die Kleine konnte gerettet werden, doch der Alte kam elendig in den Flammen um. Die genauen Umstände des Feuers konnten nie geklärt werden, und Großmutter nahm als einzige Zeugin dieses Geheimnis mit ins Grab. Er habe eine brennende Zigarre ins Heu fallen lassen, so ihre Version, der aber niemand so richtig Glauben schenkte. Wahrscheinlich wollte es auch niemand so richtig wissen. Sicher waren die Menschen froh, dass der alte Teufel endlich aus ihrem Leben verschwunden war.«
Johannes starrte Mila wortlos an. Der Appetit war ihm längst vergangen. »Aber warum hat Großmutter mir das nicht erzählt? Ich war doch bei ihr, als sie starb.« Seine Worte wirkten hilflos.
»Weil sie dich geliebt hat und weil sie Sorge hatte, dass du das nicht verarbeiten kannst. Sie wollte es eigentlich niemandem erzählen. Auch mir nicht.« Die Nacht begann um sich zu greifen. »Großmutter glaubte, nach dem Brand alles hinter sich lassen zu können. Sie packte Mama und das, was ihnen noch geblieben war, um hier unten in Chur ein neues Leben zu beginnen. Doch der schwarze Schatten der Vergangenheit verfolgte sie ins Tal hinunter, hatte bereits auch von Mama Besitz ergriffen. Der versuchte Missbrauch durch den Alten und die brutalen Erlebnisse versetzten sie in eine Art Schockstarre. Sie sprach über beinahe zwei Jahre kein einziges Wort, stierte nur vor sich hin. Wann immer sie älteren Männern begegnete oder wann immer sie irgendwo ein offenes Feuer sah, brach sie in Panik aus. Erst als junge Frau soll sie langsam normal geworden sein. Was immer normal ist.«
Mila war erschöpft vom langen Erzählen und von der Gewalt der Emotionen, die die Worte in ihr ausgelöst hatten. Johannes erhob sich und nahm sie vorsichtig in den Arm. Sie schluchzte: »Johannes, es hat mit der Vergewaltigung unserer Ururgroßmutter angefangen, aber der Alte hat mit Sicherheit die Hauptschuld an allem.«
Ihr Bruder nahm sie behutsam bei der Hand und geleitete seine Schwester in die Klinik. Er war doch selbst ein Opfer, sprach Johannes stumm zu sich, Urgroßvater wurde zu dem gemacht, was er war. Das tat er nicht freiwillig. Und nun musste der junge Mann erfahren, dass seine Großmutter, diese gütige und stolze Frau, höchstwahrscheinlich eine Mörderin war?
Johannes umarmte Mila innig zum Abschied, als ob es für immer wäre, und ging seiner Wege. Der Ruf des Käuzchens begleitete ihn hinunter in die Altstadt, wo er müde die Tür zur ehemaligen Wohnung seiner Großmutter aufschloss. Die enge Treppe in sein kleines Zimmer wurde ihm zu einem beschwerlichen Aufstieg. Er hatte das Gefühl, eine niederdrückende Last auf den Schultern zu tragen. Immer wieder schossen die Gedanken kreuz und quer durch seinen Kopf. Täter und Opfer vermischten sich dabei, tauschten immerzu die Rollen. Am Ende aber waren es die Schwabenbauern, die die Schuldigen waren.
Johannes zog nur Schuhe und Hosen aus und warf sich aufs Bett. Die Schwüle öffnete alle Poren an seinem Körper und ließ ihn in Schweiß baden. Unruhige Träume begleiteten den Gepeinigten durch die Nacht.
***
Am folgenden Morgen war Johannes froh, schon früh die Bahn besteigen zu können, um zu den einsamen Siedlungen der südlichen Berge zu gelangen. Von seiner sonst so charismatischen Ausstrahlung war nicht viel zu spüren. Der Entschluss, auf Spurensuche zu gehen, war mitten in der beinahe schlaflosen Nacht in ihm aufgetaucht. Wenn er etwas über den Urgroßvater in Erfahrung bringen wollte, dann mit Sicherheit dort oben in den Bergen. Er wollte die Familie des Jungen ausfindig machen, der seinen Urgroßvater auf seiner damaligen Flucht begleitet hatte. Vielleicht war das ein Anhaltspunkt?
Nicht viele Fahrgäste taten es ihm gleich an diesem sommerlichen Morgen, und so besaß er ein Abteil bis auf eine Handvoll Gäste beinahe für sich allein. Gemächlich begann die Fahrt durch Chur, vorbei an der Stadtmauer, dem Malteserturm und Obertor, einer touristischen Stadtfahrt gleich. Doch schon bald endete der Stadtbummel auf Schienen, und der rote Zug verwandelte sich zur Gebirgsbahn, kaum, dass er die Stadtgrenze erreicht hatte. Ein möglicher Mord, Vergewaltigung und schändliche Untaten hatten sich seit dem gestrigen Tag in seine Familiengeschichte geschlichen. Sie trübten sein Gemüt auf melancholische Weise ein. Johannes fühlte sich plötzlich so einsam inmitten all dieser Menschen. Irgendwie ausgeschlossen und – sonderbar!
Innerhalb einer Stunde beförderte die Rhätische Bahn ihre Gäste auf einer Strecke von kaum sechsundzwanzig Kilometern um über tausend Höhenmeter nach oben in die alpinen Gefilde von Arosa. In zahlreichen Kurven und Windungen arbeitete sich fortan das Gefährt durch unberührte Natur und die Gebirgslandschaften des Schanfigg. Das Langwieser Viadukt schien geradezu majestätisch in großer Höhe über der Plessur zu schweben, während der Fluss tief unter ihnen in der engen Schlucht schäumte und gurgelte.
Johannes döste träge vor sich hin, während die anderen Fahrgäste aufgeregt von einer Seite zur anderen rannten. Ihn interessierte diese fantastische Welt dort draußen ebenfalls, doch an diesem Morgen war es einfach noch zu früh. Als Arosa sie mit frischer Bergluft, Sonne und einer Prise alpiner Folklore empfing, wachte er vollends auf.
Der direkt an den Bahnhof anschließende Obersee mit seinem smaragdenen Wasser verleitete sehr dazu, einfach kurz reinzuspringen. Doch Johannes zügelte sich, er hatte anderes im Kopf und lief direkt von der modernen Bahnstation hinüber zum alten Ortskern.
Das Leben war an diesem frühen Sommertag bereits in vollem Gange. Touristen und Wanderer suchten den Einstieg in ihren Bergpfad. Bedienstete aus aller Herren Länder eilten emsig in die Hotels, um dort die Zimmer zu reinigen und die Gäste zu umsorgen. Johannes vernahm eine Vielzahl fremdländischer Sprachen, in denen sich die Saisonarbeiter unterhielten. Ironie der Geschichte, dachte er sich, nun kommen sie aus wirtschaftlichen Gründen zu uns, wohingegen die Unsrigen über gut vierhundert Jahre lang nach Norden wandern mussten, um nicht zu verrecken. Vehement kickte er einen Stein aus dem Weg, der laut gegen das Kennzeichen eines unerlaubt parkenden Touristenautos mit Kürzel WN knallte. Waiblingen, ein Schwabe. Trotzig streckte er sein Kinn in die Höhe, dem erschrockenen Fahrer entgegen. Doch der traute sich nicht aufzubegehren. Verächtlich wandte Johannes seinen Blick ab. Was für eine Demütigung, blitzte es in ihm auf. Diejenigen, die damals die Kinder dieser Berge als Saison-Sklaven in ihren Landen missbrauchten, kommen nun hierher, um sich mit ihren fetten Geldbeuteln als Könige bedienen zu lassen. Und wieder wurden die Bewohner der Berge zu Handlangern ebendieser Menschen.
»Kann ich Ihnen helfen?« Der Besitzer eines Sportladens stand urplötzlich vor ihm, durch den Knall aufmerksam geworden.
Doch Johannes schüttelte den Kopf und suchte eilig das Weite. Er war auf dem Weg zu einem besonderen Haus, dem Eggahuus. Dort befand sich das Heimatmuseum Schanfigg. Wie er im Internet erfahren hatte, war es ein Strickbau aus dem Beginn des 17. Jahrhunderts. Was auch immer dies bedeutete.
Johannes marschierte zügig durch die Gassen des alten Dorfes, um von der verschlossenen Tür des Museums aufgehalten zu werden. Der junge Wanderer war mehr als eine Stunde zu früh. Das hatte er nicht nachgeschaut im Internet. Zu dumm! Höflich grüßte er einen uralten Mann, der vor dem Haus auf einer Bank saß. Dieser Oheim schien selbst zur Museumsausstellung zu gehören, so alt, wie er aussah, mit seiner ledrigen Haut, die in tiefe Falten gelegt war. Alte Tracht kleidete den hageren, kleinen Körper, der leicht nach vorn gebeugt vor Johannes saß.
Er nickte zurück und musterte den Jungen. »Kommst aus der Stadt?« Er wies mit der Hand auf den Platz neben sich. »Aus Chur, meinen Sie? Ja, da komm ich her. Wohnen tu ich aber sonst in Zürich, wo ich studier’.«
»Ah, ein Städter.« Der Alte schwieg und schaute ins Tal hinunter, wo immerzu neue Touristengruppen ankamen.
»Aber meine Vorfahren kamen von hier.« Johannes versuchte sein Glück. »Kann es sein, dass Sie der Louis sind?« Erstaunt blickte ihn der Oheim an. »Woher weißt das? Und wer will das wissen?« Aufregung machte sich bei Johannes breit. Er war es also. »Meine Schwester Mila hat von Ihnen erzählt. Sie hat Ihren Namen von unserer Großmutter, der Anna Vetter. Sie sagte, man findet Sie häufig hier im Haus.«
Der Blick des alten Herrn hellte sich bei der Nennung des Namens auf, verdüsterte sich aber schnell wieder. »Ja, die Anna, ein nettes Mädel. Aber ihr Vater – dieser Teufel. Der hat Unglück über uns und euch gebracht.« Er verstummte. Johannes traute sich nicht, die Stille zu stören. »Wie heißt du, junger Mann?«
Mit brüchiger Stimme antwortete der Angesprochene. »Johannes.« Wieder Schweigen. Die Touristen waren inzwischen in ihren Hotel- und Bettenburgen verschwunden.
»Aha. Ein schöner Name. Aber, er wird dich nicht vor dem Fluch schützen.«
Johannes drückte seinen Rücken gegen die unebene Holzwand des Hauses, dass es ihn schmerzte. »Was für ein Fluch denn? Verdammt noch mal.« Er stierte angestrengt ins Tal, suchte mit den Blicken Halt. Dieses dauernde Stocken des Alten ärgerte ihn. »So sprich doch!«
Doch der Greis ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Bedächtig füllte er seine Pfeife mit würzig duftendem Tabak und drückte ihn mit seinem durch die Jahre braun gewordenen Daumen nach unten. »Genau das meine ich, diesen Jähzorn. Das ist das sichtbare Zeichen dieses Schwabenfluchs.« Es knisterte, als er den Tabak mit einem langen Streichholz anzündete.
Johannes wäre ihm am liebsten an die Gurgel gesprungen. Diese unbändige, unkontrollierbare Wut, die sich explosionsartig ohne Vorwarnung in ihm breitmachte, er hasste sie. Schnell schloss er seine Augen und atmete tief und konzentriert ein – und wieder aus – wieder ein – und aus. So, wie er es von der Therapeutin gelernt hatte. Es half. Johannes kam wieder langsam zur Ruhe, öffnete die Augen. Der Strahl der Sommersonne kitzelte ihn ins Gesicht. Sie verbreitete schon in der frühen Morgenstunde große Wärme. Es sollte ein heißer Sommertag werden.
»Weißt du, Johannes, ich habe deine Großmutter sehr gemocht, sie war eine kluge und wunderschöne Frau. Immer so fröhlich und dann doch unvermittelt so unsagbar traurig und schwermütig. Wie geht es ihr denn heute?«
Johannes traf diese Frage unvorbereitet, doch er antwortete tapfer: »Gestorben. Im vergangenen Winter, im Krankenhaus in Chur.« Wieder trat dieses Schweigen ein. Johannes war solch eine langgezogene Art der Unterhaltung nicht gewohnt und rutschte schwerfällig auf der Bank hin und her. »Gott hab sie selig. Eine schwere Last ging mit ihr ins Grab. Jetzt hat sie es leichter.« Der alte Mann beobachtete in Ruhe, wie sich zwei Fliegen auf seiner Hand balgten. »Dort oben«, er wies in Richtung einer abseits liegenden kleinen Anhöhe, »dort stand euer alter Hof. Ein stolzes Anwesen. Das größte in der ganzen Gemarkung. Doch in jenem unseligen Jahr niedergebrannt, mitsamt dem alten Teufel, und von niemandem wiederaufgebaut. Weißt du, dass bis heute keiner dort oben sein will? Die Menschen haben Angst, dass der böse Geist des Alten auf sie überspringt.« Johannes blinzelte, um etwas gegen die Sonne sehen zu können. »Wie war er, der Urgroßvater? Kanntest ihn doch, richtig?«
Der Bergbewohner nickte. »Selbstverständlich. Alle kannten ihn. Er, der aus dem gelobten Land Amerika zurückgekommen war, mit großem Reichtum, und der es uns allen zeigen wollte, was für ein besonderer Kerl er war. Man sagt, er war selbst ein Schwabenkind. Musste bereits als kleiner Junge hinaus zu den Deutschen, nachdem seine Mutter gestorben war. Keine Ahnung, ob das stimmt.« Er zog an seiner Pfeife und stieß den Rauch mit leichtem Zischen aus. »Mein Vater hat mir erzählt, sie habe sich umgebracht. Aus Kummer, weil sie wohl von einem Bauern dort in Schwaben geschwängert worden war.« Er verstummte erneut. Johannes merkte erst jetzt, dass es seinem Gesprächspartner schwerfiel, so lange und so viel zu reden.
Die Tür des Museums hatte sich inzwischen geöffnet, ein in Graubündener Tracht gekleideter Museumswärter tauchte auf und beobachtete die beiden. Louis hob die Hand zum Gruß.
»Findet man da drin etwas von diesen Geschichten?« Johannes blickte von dem Wärter zurück zu seinem Sitznachbarn.
»Nein. Dazu gibt es nur wenig. An die Schwabengänge und die Schicksale der vielen tausenden von jungen Menschen will man sich nicht erinnern. Das ist eine Schmach. Niemand will an die traurigen Zeiten erinnert werden!«
Johannes wollte gerade aufstehen, um ins Museum hineinzugelangen, als der Alte fortfuhr. »Dein Urgroßvater kam viele Jahre nicht mehr zurück, als man ihn damals verjagt hatte. Man glaubte, er wäre tot und suchte ihn nur kurze Zeit, falls er in der Nähe untergetaucht wäre und weiterhin Schaden anrichten würde. Doch der wütende Kerl war verschwunden. Mein Vater hat später erzählt, er wäre in Amerika gewesen. Als er zurück ins Dorf kam, spielte er den reichen Mann von Welt. Er hat sich allen Menschen hier vollkommen überlegen gefühlt. Aber vor allem war er von Hass getrieben. Hass gegen alles und jeden. Er hasste sich selbst. Für sein Leben, für sein Unglücklichsein und dafür, dass er das Schöne in der Welt nicht sah.«
Allmählich sickerte es Johannes ins Gehirn, dass er tatsächlich der Spross eines unehelichen Urahns war, gezeugt im Ausland, kriminell geworden in der Ferne.
»Aber Augen für die kleinen Mädchen hatte er. Man warf ihn oft genug aus der Dorfwirtschaft, wenn er sich an den jungen Bedienungen vergriff. Dann schaffte er sich nach Hause und soll wohl die arme Anna … und nicht nur die …«
»Sei still, Alter! Was lügst du nur in der Gegend herum!« Johannes war aufgesprungen. Stand zitternd vor ihm. »Du fantasierst! Redest wirres Zeug. Wenn du noch ein Wort gegen meine Familie sagst, dann schlage ich dir den Schädel ein!« Dabei hatte doch seine Schwester das alles schon gesagt. Jetzt erst verstand er es. Aber es war etwas anderes, wenn Fremde seine Familie beschmutzten. Sie waren nicht schuld. Andere hatten ihn dazu getrieben! Die Schwaben! Schnell hob Johannes einen schweren Stein in die Luft und wandte sich drohend gegen den Greis.
Doch der ließ sich nicht einschüchtern. »Man erkennt die Abstammung. Man erkennt sie! Das Unglück ist also auch auf dich übergesprungen.«
Johannes holte aus. Sterne tanzten vor seinen Augen. Er zitterte, als der Arm niedersausen wollte. Doch diese dunkle Wut stachelte ihn an, den Schlag zu tun. Er wollte Schmerzen zufügen und hätte es getan, wäre nicht unvermittelt die Faust des Wächters in seine Rippen geschossen. Heftig schleuderte es Johannes gegen die Holzwand.
Der Stein traf den alten Herrn leicht an der Schulter. Der schien das aber nicht zu spüren. Blickte nur den Jungen an und schüttelte den Kopf. »Das Gift verbreitet sich über mindestens drei Generationen hinaus, sagt man. Du hast es in dir. Das ist jetzt sicher!«
Mehrere Menschen scharten sich inzwischen um sie, packten Johannes an seiner Jacke und zogen ihn vom Haus weg. »Du Lump, du. Was erlaubst du dir, den Louis anzugreifen? Hast du keinen Anstand?« Sie schlugen auf ihn ein.
»Lasst ihn. Er kann nichts dafür. Lasst ihn«, rief der Alte noch.
Doch sie hatten Johannes bereits geschnappt und samt seinem kleinen Rucksack den Hang hinuntergestoßen. Hart schlug er auf, als er einige Dutzend Meter hinunterstolperte und beim Versuch sich abzufangen, das Bein verstauchte.
»Fickt euch, ihr Idioten!« brüllte er den Hang hoch. »Mein Urgroßvater hatte wohl recht mit dem, was er von euch gehalten hat. Er hat schon richtig gehandelt!«
Kräftig gebaute Bauern eilten von den gemähten Wiesen aus der Nähe hinzu. Bedrohlich schwangen sie ihre Heugabeln. »Schick dich, du Gauner. Aber schnell«, drohten sie ihm, und Johannes ließ sich das nicht zweimal sagen. Er flüchtete überstürzt die Straße hinunter und rannte, ohne sich umzuschauen, den Weg entlang. Diese Schweine! Hatten die keine Ehre? Warum stießen sie die Tapferen aus, die sich gegen die Ungerechtigkeiten des Lebens wendeten? Denn genau das würde er tun: die Gerechtigkeit für seine Familie wiederherstellen. Seine Lunge brannte. Das Stechen in der Brust wurde unausstehlich. Doch Johannes rannte. Humpelte immer weiter. Lief sich die Wut und Energie aus dem Leib.
Hundstage
Die Hitze der Nacht, gut vier Wochen nach dem Vorfall in Arosa, war beinahe unerträglich. Johannes wälzte sich von einer Seite auf die andere. Das Dachfenster seines Studentenzimmers inmitten der Altstadt von Zürich war weit geöffnet. Der Vollmond erhellte die schwüle Sommernacht und brachte weitere Schlaflosigkeit mit sich. Im Zimmer direkt nebenan vergnügte sich ein Liebespaar schon seit einer gefühlten Ewigkeit. Zu allem Überfluss hatten sie ihr Fenster geöffnet. Johannes hörte jedes Aufstöhnen, hörte jedes Schlagen der Schenkel des Begattenden im lustvollen Takt gegen ihren Hintern. Er zählte die einzelnen Klopfer, erregte sich an ihrem Stöhnen, kam irritiert aus dem Takt, wenn eine Hand heftig auf Fleisch klatschte. Er zog die Decke über den Kopf, um gleich darauf wieder gierig zu lauschen. Neben ihm lag kein anderer Mensch, mit dem er hätte Zärtlichkeiten austauschen können. Einsamkeit umfing ihn einmal mehr.
Nach dem heftigen Streit heute Abend mit seiner Freundin war er sich nicht mehr sicher, ob er überhaupt noch eine Beziehung hatte. Mit den Worten, dass sie einen harten Kerl an ihrer Seite brauche und keinen Schlappschwanz, der seinen jämmerlichen Familiengeschichten hinterherhechle, ließ Geli ihn von einem der Türsteher aus ihrem Nachtclub schmeißen. Sie war deutlich älter als Johannes und machte mit ihrem zwielichtigen Etablissement, in dem er selbst als Türsteher jobbte, gutes Geld.
Warum Geli sich in ihn verguckt hatte, erschloss sich Johannes nicht wirklich. Vielleicht wollte sie eine kurze und erfrischende Abwechslung, und jetzt wars genug. Blöde Tussi. Wenn die wüsste, mit wem sie sich angelegt hat. Ihr würde er noch früh genug zeigen, was für ein Kerl in ihm steckte.
Wütend warf sich der Gepeinigte von einer Seite auf die andere. Das Stöhnen nebenan schwoll an, klang ab, schwoll an, nahm kein Ende. Johannes nahm zornig den Takt auf und fühlte sich bei seiner einsamen Handlung ein weiteres Mal als Verlierer und Versager. Er war allein, die da drüben zu zweit und offenbar glücklich miteinander. Es half ihm nicht sich vorzustellen, dass die Stöhnende – denn von ihm war so gut wie nichts zu hören – eine hässliche, unschlanke, dumme Göre war, die er im Leben nicht angeschaut hätte, wäre sie ihm auf der Straße begegnet. Das Bild wollte nicht gelingen, und die Gemeinheit seiner Gedanken wurde ihm nicht bewusst. Tatsache war, die beiden hatten mächtig Spaß miteinander. Und er musste es ertragen. Johannes war froh, als mit beginnender Dämmerung das Konzert der Vögel einsetzte und damit den Tag einläutete.
Früh stieg er die enge Treppe, die eher einer Hühnerleiter glich, in die Küche hinunter, um sich Kaffee zu machen. Keiner seiner beiden Mitbewohner regte sich. Sie schienen gut zu schlafen. Johannes schnappte sich den fertigen Kaffee, nachdem das Surren der Maschine verstummt war, und ging mit einem dicken Buch wieder nach oben ins Bett. Nebenan war endlich Ruhe eingekehrt. Der Duft des Kaffees brachte den träge quer auf dem Bett Sitzenden auf andere Gedanken.
Eigentlich müsste der Wälzer in seiner Hand ein anderer sein. Einer zur Metallurgie und den Eigenschaften der verschiedenen Metalle; Wissen, das er an der ETH in Zürich für die Vorlesungen brauchte. Doch stattdessen entpuppte sich der dicke Brocken als historisches Werk, in dem er weitere Informationen zur Geschichte seiner Ahnen und tausender anderer unglücklicher Kinder über die Jahrhunderte hinweg erhoffte.
Das Buch hatte er im Staatsarchiv entdeckt. Eines der wenigen, die man in der Schweiz finden konnte. In Liechtenstein gab es Forschungsprojekte und in einem kleinen Dorf namens Wolfegg eine Ausstellung, drüben bei den Deutschen. Viel musste selbst recherchiert werden, das hatte er schon früh erkannt. Studieren an der ETH selbst, das schaffte Johannes schon lange nicht mehr. Er sah den Nutzen aber auch nicht. Seine Mission war eine andere. Je mehr Johannes in die Geschichten der Schwabenkinder eintauchte und in ihre leidvollen Erlebnisse, desto mehr wurde ihm bewusst, was seine Bestimmung war.
»Mutter, warum holt ihr mich nicht ab? Ich flehe euch an. Bitte holt mich, sonst muss ich hier sterben.«
Johannes’ Blick flog erneut über die aufwühlenden Zeilen voller Zitate aus Briefen und flüchtigen Notizen gepeinigter junger Kreaturen jener Zeit.
»Den Toni haben sie gestern unter der Kuh herausziehen müssen. Der soll noch immer nicht bei Sinnen sein. Zerquetscht hat’s ihn unter dem maledeiten Stück Vieh. Aber meinst, die würden ihn ins Krankenhaus bringen? Ein dummer Schweizerbub ist selbst schuld, wenn so was passiert, sagen sie. Ich glaub, der ist bald tot.«
Johannes wischte sich den Schweiß von der Stirn. Sein kleines Verlies hoch oben über den Dächern der Altstadt glich eher einer Sauna denn einer Wohnung. Die Hitze des heißen Sommers raubte ihm beinahe die Sinne. Doch Johannes verstand diese Tage als Momente der Läuterung, als Weg zur inneren Reinigung. »Hundstage« nannte der Bauernkalender diesen späten August. Studium, Freundin, Liebesschmerz und nachbarliche Lustspiele gerieten dabei in den Hintergrund.
»Warum hilft uns nur niemand in unserer großen Not. Warum haben unsere Eltern uns verstoßen? Das frage ich mich die ganze Zeit, wenn ich so viele Stunden draußen auf den Feldern bin und die Kühe hüten muss. Die Kälte ist schier unerträglich, wenn es geregnet hat und der Wind durch die nassen Kleider dringt.«
Johannes las aufmerksam die Berichte der armen Schwabenkinder. Einen um den anderen, auf der Suche nach Namen, die zu seiner Ururgroßmutter oder zum Urgroßvater führen konnten.
»… die einzige Wärme geben mir die Kühe mit ihren Kuhfladen. Ich stecke da meine Füße hinein und wärme mich. Denn Schuhe habe ich die ganze Zeit nicht. Warum haben sie mir die weggenommen? Oh, lieber Gott, sind meine Sünden so groß, dass du mich so bestrafst? Ich habe seit Wochen diesen schlimmen Husten. Ich hoffe, ich muss nicht sterben. Bitte, lieber Gott. Wenigstens einmal will ich die Heimat noch erleben. Tag und Nacht weine ich. Das Heimweh will mir die Brust zerreißen.«
Johannes wischte sich Tränen aus den Augen. Er konnte sich der Emotionen nicht erwehren, die ihn überströmten. Niemand hatte diesen hilflosen Geschöpfen jemals geholfen. Alle ertrugen die Erniedrigungen und Qualen ihrer Kinder. Johannes klappte mit lautem Schlag das Buch zu. Das erschöpfte Liebespaar nebenan musste sicherlich erschrocken zusammenzucken.
Johannes wollte nicht mehr weiterlesen. Er wusste von früheren Lektüren, was nun kam: Berichte von weiterem Missbrauch und auch Vergewaltigungen. Er wollte das nicht mehr lesen müssen. Die Suche nach Namen und Tätern, die seiner Familie das Schlimme angetan hatten, führten ihn immer tiefer in eine Welt von Leid und Schmerz. Für Johannes war das keine gute Basis, um sich selbst von seinen Gefühlswelten zu befreien, die ihn quälten. In den Unterlagen seiner Großmutter, in Arosa und im Web: Überall fanden sich Mosaiksteine, die ihm halfen, ein Bild zu entwerfen, wie er es brauchte! Ein Bild, das klar darstellte, dass bis heute ein Jahrhunderte altes Verbrechen ungesühnt war. Bodnegg war der Ort, zu dem seine Urahnin zur Arbeit hatte wandern müssen. Das hatte Johannes schon als sicher feststellen können. Dieser Ort tauchte in einzelnen Aufschrieben seines Urgroßvaters immer wieder auf.
Er warf das Buch zur Seite. Zahlreiche Blätter voll mit handgeschriebenen Notizen fielen heraus, verteilten sich auf Bett und Boden. Johannes ließ sie liegen, wo sie waren. Er kannte so gut wie jedes einzelne Blatt und jede Notiz darauf, verbunden mit Namen einzelner Schweizer Kinder und ihren Schicksalen.
Einigen dieser Geschichten war er in den vergangenen drei Wochen hinterhergereist. War zuerst nach Ravensburg, Wangen und Kempten gefahren. Dorthin, wo die Sklavenmärkte oder Hütekindermärkte, wie sie genannt wurden, jährlich zu Josephi, also am 19. März, stattfanden. Von dort aus bereiste er die zahlreichen übers weite Land verteilten Bauernhöfe, fotografierte die frisch renovierten und stolzen Gehöfte, sprach mit den Bauersleut’ übers Wetter, die kommende Ernte und das Leben auf dem Land. Johannes fühlte sich in diesen Momenten den Menschen überlegen. Denn er wusste vieles über deren Geschichte. Sie aber rein gar nichts über ihn und das, was er vorhatte.
Mit Leichtigkeit konstruierte Johannes eine Karte, die Namen, Schicksale und historische Schilderungen miteinander verband. Doch seine Spur führte auch zurück in die Städte. Dorthin, wo mancher Landbewohner zu Wohlstand und Ehren als Kaufmann oder Bürgermeister wie auch Landrat gekommen war. Er spürte ihnen allen nach. Beobachtete ihre Lebensgewohnheiten, ihre Familien, verfolgte deren Kinder in die Schulen und auf die Spielplätze oder die Älteren in die Discos.
Auch in jenes sogenannte Humpis-Quartier in Ravensburg, in dem die Schwaben ihre Geschichte festhalten wollten, trieb es Johannes.
In einem kleinen Raum tauchten Exponate zu den Schwabenkindern auf. Er fragte sich, warum die Ravensburger das taten. War es eher die Verarbeitung eines schlechten Gewissens, was sie dort betrieben? Oder ein weiteres Symbol der Demütigung der tausenden und tausenden von Schwabenkindern? Johannes tendierte zu Letzterem. In dem Museum huldigten sie ihrem Stolz und ihrer Geschichte. Unfassbar, dass sie die Schicksale der Schwabenkinder darin einbetteten. Schließlich war es eine Dokumentation von ungesühntem Unrecht.
»Tod verjährt nicht. Müsste die Polizei nicht auch jetzt noch ungesühnte Morde der Vergangenheit ahnden?« Johannes fragte sich das immer wieder. Vor allem, wenn er Beweise fand. Wenn er die Bauern ausfindig machte oder deren Nachfahren. Und mit dieser Frage wurde ihm klarer denn je: Er war für diese Aufgabe bestimmt. Das wusste er inzwischen. Und für diese Mission musste er sich vorbereiten – und Gesinnungsgenossen finden.
Johannes spürte nicht, dass er schon eine kleine Ewigkeit wie hypnotisiert auf die Blätter um sich herum starrte. Die Bilder liefen vor seinen Augen ab, als ob er es selbst erlebt hätte. Der Kaffee war längst kalt geworden und die Tasse drohte, ihm aus den Händen zu gleiten. Angestrengt mühte er sich, seinen Blick von den geschwungenen Buchstaben auf brüchigem Papier abzuwenden, hin zum dicken Buch, das er wieder aufschlug.
Verächtlich überblätterte er alle Passagen, die versuchten, positive Aspekte jener jährlichen Schwabengänge und diverser Einzelgeschichten darzustellen. Er wollte nicht die Bilder sehen, wie nach vielen Jahren die Schwabenkinder als Erwachsene zurück zu ihren Bauern reisten und in Freundschaft mit ihnen verkehrten. Das konnten nur wenige Einzelfälle unter vielen tausenden von Schicksalen sein!