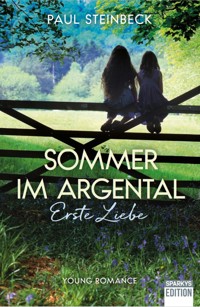3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Sparkys Edition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Marc, ein Manager wie aus dem Bilderbuch: top erfolgreich, immer auf dem Weg steil nach oben. Nichts ist zu viel, nichts zu schwierig, immer wild am Rodeo-Reiten in der Arena der Erfolgreichen. Frau, Kinder, Geliebte, Macht, Geld, Haus, Rasen mit Gartenzaun drum herum, alles vorhanden. Es könnte wunderbar so weitergehen. Wenn nicht die Seele aufgeschrien hätte, wenn nicht alles aus ihm herausgebrochen wäre, an jenem fatalen Tag auf dem Flughafen in Amsterdam. Er läuft Amok, dreht durch, rastet aus. Zerstört damit sein bisheriges Leben und wagt den Schritt hinaus in eine vollkommen neue Welt, die ihm alles nimmt und vieles gibt. Vor allem wird er mit den dunklen Seiten seiner Vergangenheit konfrontiert. Marcs Suche ist die Geschichte zweier Menschen, die auf dem vermeintlichen Scheitelpunkt ihres Lebens mit ihrer Sinnfrage konfrontiert werden. Die keine Antworten darauf haben, was ihnen ihr bisheriges Leben gegeben hat und ob dies für ein erfülltes Leben ausreichend ist. Mit der Figur der Marissa begegnen sie einer mystischen Frau, die sie aufrüttelt, bewegt und in bedrohliche Konflikte stößt. Ein Buch für Menschen, die über das Leben nachdenken und weitergehen wollen. Eine moderne Parabel, ein Märchen neu erzählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Paul Steinbeck
Marcs Suche
Marcs Suche ist die Geschichte zweier Menschen, die auf dem vermeintlichen Scheitelpunkt ihres Lebens mit ihrer Sinnfrage konfrontiert werden.Inhaltsverzeichnis
Zum Buch
Prolog
Entscheidung
Sündenbock
Das Camp
Verlassen
Aufbruch
Frühling des Lebens
Antiparadies
Verschollen
Neue Welt
Radiergummi fürs GehIrn
Die Verschwörung
Neue Welt
Flashback
Marissa
Härtetest
Schlachtbank
Frost
Streit
Platons Kinder
Familien-Glück
Flucht
In Lauerstellung
Ankunft und Gefahr
Epilog
Der Autor Paul Steinbeck
Paul Steinbeck in den Social Media
Bibliografie
Impressum
Sparkys Edition
Zum Buch
„Ich habe Angst vor dem Gefühl, etwas im Leben verpasst zu haben. Habe Angst, dass man mich als alt bezeichnet.“ Marc, ein Manager wie aus dem Bilderbuch: top erfolgreich, immer auf dem Weg steil nach oben. Nichts ist zu viel, nichts zu schwierig, immer wild am Rodeo-Reiten in der Arena der Erfolgreichen. Frau, Kinder, Geliebte, Macht, Geld, Haus, Rasen mit Gartenzaun drum herum, alles vorhanden. Es könnte wunderbar so weitergehen. Wenn nicht die Seele aufgeschrien hätte, wenn nicht alles aus ihm herausgebrochen wäre, an jenem fatalen Tag auf dem Flughafen in Amsterdam. Er läuft Amok, dreht durch, rastet aus. Zerstört damit sein bisheriges Leben und wagt den Schritt hinaus in eine vollkommen neue Welt, die ihm alles nimmt und vieles gibt. Vor allem wird er mit den dunklen Seiten seiner Vergangenheit konfrontiert.
Marcs Suche ist die Geschichte zweier Menschen, die auf dem vermeintlichen Scheitelpunkt ihres Lebens mit ihrer Sinnfrage konfrontiert werden. Die keine Antworten darauf haben, was ihnen ihr bisheriges Dasein gegeben hat und ob dies für ein erfülltes Leben ausreichend ist. Mit der Figur der Marissa begegnen sie einer mystischen Frau, die sie aufrüttelt, bewegt und in bedrohliche Konflikte stößt.
Paul Steinbeck
Marcs Suche
Roman
Alle Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen oder Institutionen sind reiner Zufall.
Alle Rechte unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung und Vervielfältigung von Text und Bild nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages.
E-Mail: [email protected]
Lektorat: Susanna Kando, Stuttgart
Korrektorat: Hubert Romer/Susanna Kando
Umschlaggestaltung: Designwerk-Kussmaul,
Weilheim/Teck, www.designwerk-kussmaul.de
Grafische Umsetzung Titelmontage: Designwerk Kussmaul, Mumemories / AdobeStock, 9_fingers_ / Envato, westend61 / Envato)
© 2022 Sparkys Edition
Herstellung und Verlag: Sparkys Edition,
Zu den Schafhofäckern 134, 73230 Kirchheim/Teck
ISBN Softcover: 978-3-949768-05-7
„Suchst du den Ursprung?
Dann finde das Licht in dir.“
(Marissa)
Prolog
„Tanze, auch wenn die Musik schlecht ist.“ (Unbekannt)
„Ich bin die Welle. Ich bin die Welle.“ Immer und immer wieder flüsterte ich unmerklich diesen Spruch vor mich hin. „Ja Marc, du bist die Welle, sie müssen nach deiner Pfeife tanzen, wenn sie darauf surfen wollen“, antwortete die Stimme in mir. Aus den Augenwinkeln heraus beobachtete ich die Menschen, die mit mir in diesem eiskalten Gefängnis unter der Langeweile litten. Blickte in die Gesichter der Frauen und Männer, die genauso umherschauten wie ich. Nach Ablenkung suchend. Es waren derer gut zehn in diesem langgezogenen Konferenzraum hoch über Berlin – oder war ich gerade in Hamburg? Nein, keine Sorge. Natürlich war es Berlin. Das wusste ich dann schon noch. Aber, in diesem vollkommen abgedunkelten Zimmer war alles ohne Zeit und ohne Ort. Kein Unterschied. Diese Meetings unter eitlen Fratzen, waren lästiger als alle Mückenschwärme der Welt. Ihr Serum wirkte nervtötender als alles andere in der Natur. Wir waren gelähmt und nur Wenige in diesem Raum waren mit Eifer bei der Sache, krallten sich an die Situation und die langweiligen Inhalte. Wie ein Ertrinkender sich an einem Strohhalm festzuhalten versucht. „Ich bin die Welle“, murmelte ich erneut. Das gebetsmühlenartige Wiederholen tat mir gut. Die Botschaft bedeutete nichts anderes, als dass die anderen sich nach mir zu richten hatten. Sie mussten meine Gesetzmäßigkeiten beachten. Hätte ich zumindest gerne so gehabt, doch das klappte leider nicht immer. Warum musste ich gerade jetzt transpirieren? Der Schweiß schien in kleinen Bächen unter meinen Achseln hervorquellen zu wollen. Für mich sonst ein sichtbares Zeichen von Schwäche bei meinen Gegenübern, welche ich dann sofort ausnutzte. Mein Unwohlsein steigerte sich. Alles so künstlich, so anstrengend, so zerreibend. Die Luft war zum Schneiden. Mein Instinkt sagte mir, dass die Stimmung nur vorgetäuscht war, wie sie Lähmung vortäuschte. Alle in diesem Raum suchten ein Opfer, auf das sie einschlagen konnten. Suchten den weichen Knorpel, den man zermahlen würde. Als Präsentator war ich grundsätzlich prädestiniert für solche Rollen. Ich wollte von ihnen Geld. Sehr viel Geld. Für unsere Konzepte und Großprojekte. Für meine zahlreichen Unternehmen, für die ich in unserem Unternehmensverbund zuständig war. Man konnte sie inzwischen nicht mehr an einer Hand abzählen. Deshalb musste ich mich doppelt und dreifach anstrengen, um gerade nicht dieses Opfer zu sein. Im Gegenteil, mit heruntergezogenem Visier musste ich als erster angreifen, bevor es die anderen taten. Mir gelang das auch so gut wie immer. Sicher, der Preis war hoch, aber für den Sieg in jedem Fall wert. Nur, warum leitete niemand diese Sitzung? Wer wartete auf wen? Zeit zum Handeln! Ich schoss aus der Tiefe meiner Versenkung nach oben, katapultierte mich aus dem Stuhl heraus und wanderte in Richtung des Großbildschirmes. Die Fernbedienung jonglierte in meiner Hand, wie ein rotierender Colt. Immer bereit zu schießen, mit einem süffisanten Lächeln im Gesicht. Die Aussicht auf den Sieg, diese Wollust, erfüllte mich in solchen Momenten mit Glückshormonen, die ich zwingend brauchte. Ich legte mir in meinem Kopf die Munition zurecht, die ich gleich auf meine Opfer abfeuern wollte. Doch irgendwie hatte ich heute Ladehemmung. Die Worte wollten nicht so schnell aus meinem Mund hervorschnellen, wie ich es jetzt bräuchte. Ich stotterte beinahe. Jemand gähnte im Raum. Ein schlechtes Zeichen. Die Konferenzplörre tat ihr Übriges. Dieses Gesöff durfte sich nicht im Entferntesten als Kaffee bezeichnen. Nicht nur ich blickte angewidert in die weiße Porzellantasse. Schon wieder. Jemand zweites gähnte! Ich drückte meinen Rücken gegen die Kante des Schrankes hinter mir, um irgendetwas Lebendiges zu spüren. Unglücklicherweise verhakte sich meine Anzugsjacke an einem der kantigen Griffe. Ich musste mich freikämpfen. Das kostete Konzentration. Mein Anzug gab nach und ein Reißen auf Höhe des rechten Schulterblattes verhieß nichts Gutes. Ich fluchte, was das Zeug hergab. Erst jetzt bemerkte ich, dass alle Blicke auf mich gerichtet waren. „Alles gut?“ Eine in edlen Zwirn gehüllte Dame versuchte besorgt zu wirken, konnte aber ihre Ungeduld nicht verstecken. Schnell nickte ich und bestätigte: „Aber sicher. Ich habe nur nach der richtigen Formulierung gesucht, um Ihnen von der gigantischen Projektidee in der gebührenden Weise zu erzählen.“ Sie lächelte gnädig und ich beeilte mich, die Präsentation, die an der Wand aufleuchtete, so schnell wie möglich zum Höhepunkt zu bringen. Die Erkenntnis dieses Tages: Sie war eindeutig zu lang geraten. Ich sollte die Kollegen in der nächsten Teamsitzung kräftig zusammenstauchen, damit sie mich nicht mit Blabla-Seiten in peinliche Situationen manövrierten. Scheiß PowerPoint-Präsentationen. Scheiß Theatervorstellungen. „Fi… euch doch alle ins Knie“, würde mein Neffe in solchen Momenten sagen, wenn ich ihn so direkt zitieren hätte dürfen. Doch ich wäre nicht jener erfolgreiche Unternehmer Marc Schillocks, wenn ich mich nicht zum rechten Zeitpunkt zusammenreißen könnte, um alle Energie für den Höhepunkt zu sammeln. Schnell zog ich einen Joker aus dem Ärmel, benahm mich wie ein Magier, der gleich Geschenke hervorzauberte und versuchte mit versteinertem Lächeln die Runde für mich zu gewinnen. Meist war es die Aussicht auf Rendite oder gute Geschäfte. An diesem Tag aber ging es ums Renommee des Konzerns, sprich Gutmenschentum. Hier das Corporate Social Responsibility. Ach was! Bei uns sagte man richtigerweise CSR. Und dieses Ding, das brauchte jetzt diese Firma. Denn sie hatte gerade einen wirklich miesen Ruf in der Öffentlichkeit. Ist ja auch nicht verwunderlich, wenn man mitten in der Umweltschutzdebatte, Fridays for Future-Demonstrationen und Klimawandel meint, schnell noch einige Milliarden mehr an Gewinnen mit fossilen Rohstoffen zu machen. Die Kraftwerke wurden gleich mitgeliefert. Mit dem Segen der Politik. Natürlich geschmiert. Ach Gott, wie liebte ich diese jungen Demonstranten, die die Welt besser machen wollten. Seit es diese gab, klingelten bei uns nur so die Kassen. Denn wir lieferten jedem Auftraggeber exakt jenes Image, das er brauchte. Besser gesagt, ich! Denn ich war der King des Green-washing. Sicher, billig ist das nicht. Aber, umsonst ist ja nicht mal der Tod und es traf ja keine Armen. Ich kam zum Höhepunkt meiner Zaubershow. Sprach von der Sonne, die fortan in die Gesichter der Menschen strahlen würde, wenn sie den Blick auf das Logo dieses Konzerns hier richteten. Erzählte von einer Glückseligkeit, die die Firmenvertreter beim Lesen der Zeitungsreportagen über die Wohltätigkeit just ihres Unternehmens überkäme und dass die Manager des so mildtätigen Konzerns als gern gesehene Gäste von einer Talkshow zur anderen reisen würden. Vorausgesetzt, dieses wunderbare Konzept, das einem Glückselixier gleichkäme, würde umgesetzt. Dafür müssten sie nur ein paar Millionen in ein nachhaltiges Projekt investieren, das zufälligerweise eine meiner Firmen betreute. Eine echte Win-Win-Situation sozusagen. Dankbar nahm die Runde mein verbales Feuerwerk auf, während dessen ich vor der Projektionswand einen wilden Präsentationstanz vollführte. So bewahrte ich mit dieser rituellen Handlung sie und mich vor dem Einschlafen. Dankbarkeit war mein Lohn. Ausgedrückt durch das Klopfen der Teilnehmer mit den Handknöcheln auf den langgezogenen Konferenztisch. Die Intensität erlaubte mir, den Erfolg zu messen. Verlogenes Händeschütteln vom Chef, sogar mit beiden Händen um die meinen, folgte. Leere Worthülsen des Lobes umhüllten mich. Die Endorphine aber wurden mit den Worten jener Dame in mir ausgeschüttet: „Machen wir so. Ist gekauft Herr Schillocks.“ Ich seufzte innerlich auf. Die Dosis tat meinem Nervensystem gut. Die Droge wirkte. Schnell leerte sich der Raum, genauso wie ich selbst wenige Minuten später den lichtdurchfluteten Gang hinuntereilte, dem Ausgang entgegen.
„Gut gemacht“, lobte mich mein Verbindungsmann vor Ort auf dem Weg und klopfte mir anerkennend auf die Schulter. Ich nickte. Der Tanzbär hatte seine Schuldigkeit getan. Ich hatte am Ende eine gute Show geliefert, auch wenn es zwischendurch nicht optimal aussah. Die Finanzierung schien gesichert und die Option auf ein Folgeprojekt war bereits in Aussicht gestellt. Wichtiger aber war, dass unsere zahlreichen Schwesterfirmen im Fahrwasser dieses Projektes mitschwammen und mit der Umsetzung der Gutmenschaktionen die wirklich wichtigen Geschäfte tätigten. Lärmender Verkehr empfing uns vor dem Konferenzhotel. Menschen eilten wild von einer Richtung in die andere. Alle irgendwie auf der Flucht. Wir reihten uns in den Strom nach rechts ein und versuchten mit schnellen Schritten mithalten zu können. Die Krawatten wehten uns um die Ohren. Ich zog im Gehen mein Handy aus der Tasche. Schon satte zehn Minuten keine Mails mehr gecheckt. „Gehen wir noch was Trinken? Auf den Erfolg?“ Die unsichere Stimme meines Begleiters störte mich. Ich schielte auf die Uhr. Dann wieder aufs Handy. Die neuen Mails poppten nur so auf dem Display auf. Fünf, zehn, zwanzig, es hörte nicht auf. Anfragen meiner Aufsichtsräte, hilflose Mails der Projektteams, Infos zu Terminvereinbarungen… Es würden bis zum Abend noch einige Dutzend mehr nervtötende Nachrichten werden. Sinnlos, jetzt mit dem Abarbeiten dieser zu beginnen. Ich steckte das Gerät in die Hosentasche, nickte und zog den jungen Kerl mit zur nächsten Bar. Ein Whisky zur Feier des Tages durfte vor dem Weiterflug schon noch sein. „Kollege, ich übergebe das Projekt vertrauensvoll in deine Hände. Mach was draus.“ Ich prostete ihm mit dem Wasserglas zu: „Bau keine Scheiße, dann wirst du es in unserem Haus weit bringen.“ Wütend schickte ich den Ober wieder weg, der es wagte, Whisky mit Eis zu servieren. Ich war außer mir vor Wut. Sind wir in Amerika? So ein Dilettant. Der Milchbub, also mein Verbindungsmann hier in Berlin, zitterte vor Aufregung. „Ja, sicher, das mache ich. Versprochen. Wichtiges Projekt!“ Er stockte kurz, trank einen großen Schluck vom jetzt richtig servierten Single Malt und hustete: „Ich will werden wie du. Du bist der Guru der Manipulation.“ Ich klopfte ihm wohlwollend auf den Rücken, als das Husten nicht aufhören wollte. „Dann beginnen wir mit der ersten Lektion: Whisky genießt man und trinkt ihn nicht wie Wasser, mein Freund.“ Mein Handy lag bereits wieder in der anderen Hand und sammelte weitere dutzende Mails. „Mach was aus diesem Projekt. Das ist so wichtig für die Firma und die Gesellschaft.“ Ich versuchte, ein ernstes Gesicht aufzusetzen. In Gedanken war ich aber schon am nächsten Ort, bei der nächsten Aufgabe. Dann würde ein anderer Jungspund dieser Klon-Yuppies assistieren und vermutlich die gleichen Worte wählen. Die Mails in meinem Handy schossen nur so auf mich zu wie Schwärme von Insekten an schwülen Sommerabenden am See. Mein Vorstand schrieb, dass sie dringend mit mir über ein wirklich sehr wichtiges Projekt mit internationalen Partnern sprechen müssten. Sofort, da ungeduldige VVVIP-Kunden. Ich wüsste schon, was sie meinten. Ich schob die Nachricht heimlich mit dem Finger weg und ließ mich von einer anderen in Beschlag nehmen. Von Celine… Innerlich begann ich dahinzuschmelzen. Ihre Sanftheit schlich mit den geschriebenen Worten in mein Bewusstsein, zog mich kurz in ihren Bann. Celine… „Was?“ Irritiert blickte ich auf. „Na das Projekt, ich verspreche, dass ich das perfekt zu Ende führen werde.“ Mein Gegenüber war feuerrot im Gesicht. Ich nickte wieder und wieder. „Jaja, das Projekt. Schon sehr gewaltig und relevant für uns alle.“ Ich machte ein ernstes Gesicht. War doch unwichtig, ob das Projekt inhaltlich sinnvoll oder einfach nur eine Seifenblase war, die möglichst lange im hellen Sonnenlicht in allen Farben schimmern musste. Platzen durfte sie natürlich erst dann, wenn sich alle längst wieder einer anderen Attraktion zugewandt hatten. Ich war Marc Schillocks! Der Magier der Bilder. Der Zauberer der schönsten Illusionen für leidgeplagte, arme Seelen in den Etagen der Topmanager und Konzerne. Marc Schillocks schenkte ihnen bunte Farbspritzer in einer tristen, betonartigen Lebenswelt.
Ich strich mit der Hand über meine braunen, kräftigen Haare. Sie waren unverschämt struppig an diesem Tag, da ich am Morgen keine Lust hatte, sie mit Styling-Gel in Form zu bringen. Heimlich warf ich einen Blick auf die verspiegelten Wände am Ausgang. Bisher hatten sich nur sehr wenige graue Haare gezeigt. Aber sie häuften sich in letzter Zeit mehr und mehr. Mit Auszupfen würde das bald nicht mehr getan sein. Schnell zog ich meine Schiebermütze aus dem Business-Rucksack und versteckte alle Zeichen des Älterwerdens unter ihr. Mein Gegenüber war noch immer inmitten seines Redeschwalls. Mir fiel auf, dass ich in den letzten Minuten nicht ein Wort zugehört hatte. Den übereifrigen Kollegen störte das offenbar nicht. Sein Labern drohte bereits die Bar zu überfluten. Besorgt zog ich die Füße vom Boden hoch und stellte sie auf die Fußleisten des Barhockers. Noch war alles trocken. Zum Glück. Der Schwall aber wollte nicht enden. „Ich muss dann mal“, unterbrach ich ihn mit einem Gesichtsausdruck, der ein aufrichtiges Bedauern zeigen sollte. Ja, Mimik, das konnte ich gut. Neben dem Magier war ich mit Sicherheit auch Meister der Pantomime. Das durfte ich nur niemandem verraten. „Aber sicher doch“, mein Gegenüber sprang vom Hocker und übernahm erwartungsgemäß die Rechnung. „Speichellecker“, schoss es mir durch den Kopf. „Willst dich einschleimen. Aber soll mir recht sein.“ Mit einem kurzen Gruß und dem gegenseitigen Versprechen, dass wir „nächstes Mal dringend wieder einen Trinken gehen müssten, nur eben heute nicht, weil…“, schob ich mich mit meinen circa eins achtzig durch die Drehtür und verschwand im Getümmel der Stadt. Wenigstens nebelte der Whisky ein wenig ein. Umständlich suchte ich die Mail von Celine heraus und schwelgte in Gedanken durch die Straßen Berlins.
***
Nur eine halbe Stunde später befand ich mich auf einer hektischen Fahrt zum Flughafen. Die Nacharbeit dieser Sitzung, die hinter mir lag, mussten andere im Team übernehmen. Scherben mussten sie heute keine zusammenkehren. Jetzt aber schnell in die nächste Show. Nächster Termin. Dann mit dem Zug zum darauffolgenden Treffen mit weiteren wichtigen Menschen und irgendwann, spät am nächsten Tag, endlich wieder heimwärts. Dazwischen: Warten. Unendlich viel Warten. Ich hatte seit geraumer Zeit Sorge, dass dieses die Zeit totschlagen ein Gesetz des Lebens war. Dass es dazu gehörte wie Tag und Nacht, Sommer und Winter. Ob es nur mein Schicksal war oder das aller anderen Anzugträger und Anzugträgerinnen auch, das musste ich dringend erforschen. So mein Vorsatz an der kleinen Bar in der Nähe meines Gates. Schlimmer aber war ein anderes, ungutes Gefühl, das in solchen Momenten huckepack mitkam, beim Warten. Es überfiel mich just in dem Moment, in dem ich einen weiteren Shot bestellte und darauf wartete, dass endlich das Boarding begann. Es war dieses Gefühl, gefangen zu sein. Eingesperrt in ein Korsett, das mich nicht das machen ließ, wonach ich mich eigentlich sehnte: allein sein. Auf meinem Bike sitzen, inmitten der Natur, mit viel Ruhe und keinen Menschen. Extrem tauchte dieses flaue Gefühl im Zug auf. Dann, wenn wir mit Hochgeschwindigkeit übers Land schossen. Nur nicht zu langsam! Es könnte ja etwas von der Stimmung und Ruhe der Wälder, Wiesen und Berge, durch die wir rasten, am Zug haften bleiben. Doch darum mussten sich die Lokführer keine Sorgen machen: Die Businessreisenden sahen das eh nicht. Denn alle hatten ihre Laptops vor sich auf den Tischchen und stierten Stunde um Stunde hinein. Auch ich. Zeit ist kostbar. Und jede Minute, die ich nicht arbeitete, sorgte dafür, dass die E-Mail-Flut noch bedrohlicher wurde. Sie lastete auf meinem Gemüt und es gab keine schönere Belohnung, als zu sehen, dass die Anzahl der ungelesenen Mails unter Einhundert gerutscht war. Zumindest kurzfristig. Doch immer wieder ließ mich ein unbekannter, beinahe unprofessioneller Impuls aufblicken. Am Horizont sah ich aus meiner Blechdose heraus die Reiter, die Radfahrer, die Wanderer und die Menschen an den Seen. Sie genossen ihr Leben in der Freiheit da draußen. Und ich war eingesperrt. Ein Gefangener meiner eigenen Termine und Projekte. Doch was jammerte ich? Ich hatte mir dieses Gefängnis selbst gebaut. Hatte mich selbst darin eingesperrt. Und irgendwie gefiel mir auch das Durchsausen durch Raum und Zeit. Das war so ähnlich, wie leckeres Eis mit großen Löffeln verschlingen. Nein, eher war es wie eine Droge. Wie ein Betäuben. Damit ich nichts spüren musste. Mich nicht spüren! Ich müsste mich ja mit mir auseinandersetzen… Oft wurde nur schnell der eine Koffer mit dem anderen ausgetauscht. Das Hamsterrad lief. Und ich lief darin perfekt mit. Süchtig danach, obwohl ich wusste, dass es auch mein Verderben werden könnte.
Müde warf ich mich spät am besagten Tag auf dem Flug nach Brüssel in meinen Sitz und schloss die Augen. Wenigstens ein wenig Schlaf wollte ich noch ergattern zwischen dem Hier und dem Nirgendwo. Ich spürte, ich hatte einen Hänger. Es waren doch mehr alkoholisierte Getränke gewesen, als geplant. Eine mahnende Stimme in mir sprach: „Bis zum Abendessen muss der Kopf wieder fit werden.“ – „Ist schon klar, kannst dich auf mich verlassen“, sprach eine andere, leicht bockig. Ich ließ sie miteinander reden und machte die Augen zu. Meine Gedanken schwelgten in schönen Alltagsbildern. Erfolg im Job war für mich wie Opium. Die Anerkennung anderer ein Aphrodisiakum. Ein Team umsorgte mich rund um die Uhr. Was für ein Gefühl der Wichtigkeit und der Macht!
So viele wollten mit mir freund sein. Dabei war egal, dass das nur wegen meiner Machtposition und nicht wegen mir als Person war. Macht ist sexy. Für mich war es ein erregendes Gefühl, wenn junge Frauen sich von mir begleiten und bespringen ließen. Was soll ich lügen oder die Dinge schöner beschreiben als sie waren? So war das. Und nicht anders.
Im Dämmerzustand tauchte die Analogie in mir auf, die ich auch meinen Mitarbeitern beigebracht hatte. Das Bild des Wellenreitens. „Reitest du noch auf der Welle oder drückt sie dich gerade unter das Wasser?“ Meiner Meinung nach lag es an jeder und jedem selbst, nicht in zerstörerische Stress-Situationen zu gelangen. Man musste immer nur Bock haben und cool drauf sein. Pause machten nur Weicheier. Das war unser Credo. Wir befanden uns immer im Kampf mit den Gewalten, wollten sie beherrschen. Ich selbst war das dümmste Beispiel dafür, dass ich der irrsinnigen Überzeugung war, immer und ewig auf der Welle reiten zu können. Erholung brauchte ich nicht. Mehr, immer mehr. Ich wollte das Adrenalin!
Der Abgrund nahte schon damals, ohne, dass ich es bemerkt hatte. So, als ob ich auf meinem Surfbrett des Lebens unbemerkt in einen gigantischen Strudel hineingezogen wurde.
***
Dieser Kollaps ließ dann auch nicht lange auf sich warten. Selbst ein Marc Schillocks sollte mit seinen 46 Jahren daran denken, etwas Auszeit vom Hamsterrad zu nehmen. Oder, um bei der Welle zu bleiben, mal vom Brett runterzusteigen und Erholung an Land zu suchen.
Das aber tat ich nicht. Stattdessen durfte ich die Härte des Gesetzes erleben, die einen trifft, wenn man im Flughafen plötzlich hohldreht und einen Großteil des Wartebereichs zertrümmert. Das war in Amsterdam geschehen. Ich war einfach nur müde. Erschöpft. Die Sitzungen liefen nicht wie gewünscht. Die Folien, die das Team zugeliefert hatte, waren schlichtweg großer Mist. Ich hätte sie für eine Trauerrede nutzen können. Aber nicht für eine der weltgrößten Minengesellschaften, die sich auf die Ausbeutung großer Landstriche in Afrika und Südamerika vorbereitete. Seltene Rohstoffe und die Befreiung von der Abhängigkeit chinesischer Anbieter waren das wohlwollende Argument. Unsägliche Umweltverschmutzungen, Vertreibungen und Korruption waren das andere. Da brauchte es großes Können und geniale Kommunikationsstrategien, um das eine hervorzuheben und das andere unter den Teppich zu kehren. „Ich verspreche Ihnen, meine Damen und Herren, die Öffentlichkeit wird das Jammern der Menschen in den betreffenden Gebieten nicht hören. Sie werden es aus der Ferne als ein Lächeln wahrnehmen und sich für die armen Menschen in diesen Ländern freuen.“ Ich bemühte den Meister der Pantomime, setzte Marcs strahlendes Siegerlächeln auf. Doch vergebens. Auch meine magischen Kräfte konnten den Mangel nicht mehr wettmachen. Die honorige Zuhörerschaft blickte mich mit jenem Gesichtsausdruck an, der keiner Worte mehr bedarf. „Wir dachten, Sie sind der Beste. Wir hörten, dass Ihre Teams unschlagbar sind. Aber jetzt das?“ Es brauchte keinerlei Übersetzung mehr aus der Mimik-Sprache der Herkunftsländer dieser Menschen hier im Raum. Ich hatte verstanden. Dieser Job war versaut! Verdammt. Wenn ich irgendjemanden aus diesem Looser-Team in die Hände bekommen würde, welches die Folien und die Konzepte entwickelt hatte! Nun gut, ich hätte mich auch vorher mit den Unterlagen auseinandersetzen sollen. Vielleicht hätte ich besser verstanden, um was es ging. Während einer Präsentation das zu lernen, bedeutet immer, einen Tick zu spät zu sein. Egal. Sie waren wenigstens höflich gewesen, als sie mich verabschiedeten. Wahrscheinlich vereinbarten die Assistentinnen und Assistenten schon Termine mit der Konkurrenz. „Verdammt“, schoss es aus mir heraus, als die Bilder dieser vermaledeiten Sitzung im Hotel direkt neben dem Flughafen wieder vor meinen Augen auftauchten. Ich hatte versagt! Der Magier Marc Schillocks hatte seinen Zaubertrick versaut!
Direkt an der Hotelbar hatte ich mir einen kräftigen Shot gegönnt. Ohne auf meine Umgebung zu achten, schob ich mir auch andere Dinge rein. Das hätte ich besser nicht tun sollen. Der Weg zum Flughafen, das Einchecken und die Security-Folter wurden dadurch bereits zur Qual. Die misstrauischen Blicke der Flughafensicherheit, die meine Pupillen zu scannen schienen verunsicherten mich. Ärger staute sich in mir auf. Und dann wieder dieses Warten. Schon mehr als eine Stunde lungerte meine gepeinigte körperliche Hülle am Gate B34 herum, um endlich das verdammte Flugzeug nach Stuttgart zu bekommen. Unruhig marschierte ich umher. Die Stühle waren zu hart, zu kalt und zu ungemütlich zum Sitzen. Mein Geist war bereits mit den hochprozentigen Getränken davongeflogen, die ich noch zusätzlich auf der Strecke vom Security Check bis zum Gate in jeder Bar, die ich fand, zu mir genommen hatte. Viel schlimmer aber war der persönliche Supergau: Die Akkuladungen aller meiner mobilen Geräte gingen gegen Null und von Gate B0 bis zu Gate B34 gab es keinen einzigen freien Stromstecker!!! Unfassbar! Wann hatte ich zuletzt meine Mails geprüft? Vor fünf Minuten? Vor zehn? Natürlich flippte ich aus. Gewaltig sogar. Mein Tablett zeigte ebenfalls 0% Akkuladung an. Beim Laptop wusste ich ohne nachzuschauen, dass da nichts mehr ging. Ich konnte mich nur mit Mühe zurückhalten, die Penner von den Steckdosen wegzuzerren, die sie besetzten. Dumm nur, dass sie recht stark und wehrhaft auf mich wirkten. Der Druckkessel in mir stand unter Druck. Ich suchte nach Ersatz für meinen Frust und ahnte, lange konnte mein gemartertes Hirn die Dämme nicht mehr halten. Und endlich setzte der Neandertaler in mir die Energie frei: Der kleine Kiosk an der Kopfseite des Flughafens musste zuerst dran glauben. Alles flog aus den Regalen und Kühlschränken. Ich stürmte wie ein Wirbelwind durch die Gänge, warf Gepäckwägen um, brüllte aufgeschreckte Mitarbeiterinnen an, genauso, wie die Idioten, die mir meine Steckdosen wegnahmen. Was erlaubten die sich.
Ich wütete eine kleine Ewigkeit. Eltern nahmen ihre verängstigten Kinder in die Arme, um sie zu schützen. Dabei hatten sie selbst große Angst, was mir in meiner abgrundtiefen Wut so richtig gefiel! Das gab mir ein Gefühl der Macht, die ich in meiner schmachvollen Sitzung vermisst hatte. Euphorie erfüllte mich und ich wütete noch mehr. Jetzt kamen die Taschen und Kabinenkoffer der Fluggäste dran. Ich schleuderte sie durch die Gegend, erfreute mich am hysterischen Geschrei der Menschen. Schweiß trat mir auf die Stirn. Ich wischte ihn mit dem Anzugärmel weg, schob meine störrischen Haare nach hinten und sprang brüllend über die Bänke hinweg. Das befreite. Sollte jeder mal versuchen, der Druck in sich spürt. Die Schmach der Niederlage verließ hektisch mein Inneres, wo es nach dem Abgang meines Bewusstseins eh nur noch Leere gab. Ich enterte einen dieser komischen Golf-Caddys, stieß die Fahrerin vom Sitz und schoss mit kreischenden Senioren und Seniorinnen durch die Fluren des Terminals. Was für ein Spaß! Die Gänge des Souvenirladens waren leider zu eng. Doch ich kämpfte mich mit meinen Gästen durch. Blumenzwiebeln, Holzschuhe und stinkender Käse flogen durch die Gegend. Ich hatte noch viel zu tun, bei all den Geschäften. Mein Amoklauf führte mich in Richtung MC Donalds. Starbucks ließ ich links liegen und schoss weiter. Freute mich, dass die Menschen aufgeschreckt auseinanderstoben. Bei zwei meiner Fahrgäste hatte ich die Befürchtung, dass sie einen Herzanfall erlitten hatten. Sie hingen nur noch leichenblass in ihren Sitzen. Ob ich zum Notarzt sollte? Eventuell. Doch vorher wollte ich Pommes ergattern. Es war mir ein Anliegen, anständig mit meinem Fahrzeug am Tresen zu halten und ordentlich zu bestellen. Doch dazu kam ich leider nicht mehr. Ob es an meinem schlechten Holländisch lag, mit dem ich Pommes orderte? Ich weiß es nicht mehr. Aber die Härte des Gesetzes traf mich just in dem Moment mit voller Wucht, als ich mich mit Ketchup-Tüten versorgte. Ein ganzer Trupp holländischer Sicherheitsleute warf sich auf mich und ich wurde in die Katakomben des Flughafens geschleppt. Dorthin, wo man Verrückte einsperrte, die sich auf ein lebenslanges Hausverbot und eine Anzeige freuen durften. Wenigstens versaute der Ketchup aus den aufgeplatzten Tüten nicht nur meinen Anzug. Die Jungs vom Sondereinsatzkommando sahen auch ganz witzig aus wie ich fand. Ein gutes Zeichen, dass ich mich nicht kampflos ergeben hatte. Stundenlange Isolation in einer dunklen, muffigen Zelle war der Lohn. Wollten die mich verrotten lassen? Ich schlug gegen die Türen, die Wände, warf das Gitterbett quer durch den Raum, schlug mir mit der Kopfstütze den Schädel blutig und brüllte die ganze Zeit nach meinem Handy. Ich musste doch meine Mails prüfen. Mein nächstes Projekt, mein Aufsichtsrat, der amerikanische Präsident, der Papst… Mein Herz raste. Mein Atem wurde schnell und flach. Dunkelheit machte sich vor meinen Augen breit. Panik stieg in mir auf. Würden sie mich hier verrecken lassen? Ich hatte doch Angst vor der Enge. Wussten die das nicht? Ich warf mich wieder und wieder gegen die Tür. Mein Herz schlug bis zum Hals. Flatterte. Ich kollabierte. Klappte einfach zusammen und wäre wahrscheinlich dort eingegangen, hätte nicht eine fürsorgende Dame, die nach mir schaute, Alarm geschlagen.
Der Rest der Geschichte ist schnell erzählt: Ein ernstes Gespräch mit dem Aufsichtsrat unserer Unternehmensgruppe, Krankschreibung für mindestens vier Wochen und mächtig Ärger zu Hause. Denn meine Frau hatte nur zu gut mitbekommen, dass mir meine Assistentin im Krankenhaus sehr viel Aufmerksamkeit hatte zukommen lassen. Deutlich mehr, als man von einer geschäftlichen Beziehung erwarten konnte. Jetzt war es raus. Und irgendwie musste es raus! Der Krach war vorgezeichnet.
Ich fragte mich nur die ganze Zeit, warum man mir nicht so etwas gönnte, was man gemeinhin Krankheitsgewinn nannte. Zum Beispiel, dass man mich schonte, mir meine Ruhe ließ, da ich ja sehr krank war, wie man mir sagte. Meine Umwelt musste mich doch schonen. Das meinte ich mit Krankheitsgewinn. Aber nein, im Gegenteil. Mich schonte niemand. Und alles schien über mich hereinbrechen zu wollen. Meine Frau wegen der Geliebten. Meine Geliebte wegen der Frage nach der Zukunft. Mein Aufsichtsrat, der prüfte, ob ich zu einem faulen Apfel im Korb der süßen Firmenfrüchte wurde. Die Behörden, die mich wegen der Amsterdam-Geschichte fest am Wickel hatten. Zu Recht. Ich hatte dort ganz schön gewütet. Heiliger Strohsack!
Einzig meine Kinder, mein Sohn mit fünfzehn und meine Tochter mit siebzehn Jahren hatten wenigstens einen Funken Mitleid mit mir. Auf ihr „du armes Schwein, wir fühlen mit dir“, gab ich viel. Als sie aber von meinen Eskapaden erfuhren, die beinahe täglich herauströpfelten, dank der Vernehmungstalente meiner Frau, stellte sich mehr und mehr Distanz ein. Jetzt war ich kein armes Schwein mehr. Dieses mutierte zur fiesen Ratte. Ich suchte Trost darin, dass auch Ratten sympathisch sein konnten. Half aber nicht viel. Besonders sorgte mich die Ungewissheit, ob mein Amsterdam-Ausraster direkt in den Knast führte oder was da sonst so mit einem passieren würde. Ich bald ein Knasti? Was für ein Horror!
„Kümmern Sie sich erst einmal ums Gesund werden“, wurde unser Hausanwalt nicht müde zu sagen, wenn er mich wieder beschwichtigen wollte. Die Gespräche mit ihm waren durchaus sehr beunruhigend, wann immer er mich im Krankenhaus besuchte. Schon sein Anblick ließ mir kalten Schweiß aus allen Poren schießen. Er war das Sinnbild für die große Gefahr, die mir drohen konnte. Verdammt! Was hatte ich nur für einen Bockmist gebaut. Warum nur? „Die Psychologin, die Sie untersucht hat, ist der Ansicht, dass unverarbeitete seelische Schockzustände aus Ihnen herausgebrochen sind. Deshalb, weil Sie in diesem Moment vollkommen überlastet und somit schutzlos den inneren Sturzfluten ausgesetzt waren, die durch den Dammbruch in Ihnen herausgeschossen sind.“ Ich fragte mich, warum ich dieser Psychologin erlaubt hatte, ihm alles zu sagen. Wie peinlich war das denn? Als er mit dem Vorschlag um die Ecke kam, dass wir auf „Unzurechnungsfähigkeit aufgrund einer seelischen Belastungsstörung besonderer Art plädieren können“, platzte mir der Kragen und ich warf den guten Herrn mit der Krawatte aus dem Zimmer. Was erlaubte er sich? Ich sollte eine geistige Umnachtung und Beklopptheit eingestehen? Nur um einer Verurteilung zu entgehen? Der hatte ja einen an der Waffel. Nicht mit mir. Am Ende würden sie mich in die Klapse stecken… no way. Nicht mit mir. Wütend warf ich die Akten zu meinem Fall in Richtung Tür, durch die mein Anwalt gerade eben geflüchtet war und verbrachte den restlichen Nachmittag schmollend im Bett.
Freunde, von denen ich doch eigentlich so viele hätte haben müssen, kamen recht wenige zu Besuch. Ich fragte mich, ob ich Krätze oder andere ansteckende Krankheiten hatte. Doch trotz intensiver Untersuchung meiner gesamten körperlichen Oberfläche, erhielt ich keinen positiven Befund. Das konnte nicht der Grund für die wenigen Besucher sein. Einsam zog ich meine Kreise …
Die Verhöre meiner Frau wurden mir nach der Entlassung aus dem Krankenhaus fast schon zu einer liebgewordenen Abwechslung im tristen Alltag. Ein Zustand, der bereits mehrere Wochen anhielt. Ich schaute zum Fenster hinaus. Der Sommer war voll im Gange. Menschen sonnten sich auf den Wiesen, Kinder tobten über volle Spielplätze, an der Eisdiele standen bestimmt lange Schlangen Genuss-Süchtiger. Nur ich musste hier den Kranken spielen und im Arrest schmoren. Wenigstens war ich zu Hause. In Kürze sollte nach der so genannten Anamnese eine Therapie beginnen. Ambulant bei einer Psychotherapeutin. Meine Anwälte wollten dies wie erwähnt als Teil der Verteidigungsstrategie nutzen, um mich in Holland vor dem Gefängnis zu bewahren. Irgendetwas von Unzurechnungsfähigkeit, psychischer Überbelastung wurde in den Schreiben trotz meiner Widerstände angemerkt. Wie ich das mit der Arbeit, die ja bald wieder anfangen sollte, in Einklang bringen könnte, war mir nicht wirklich klar. Anderen offenbar schon. Denn, als die vier Wochen Krankschreibung vorüber waren und umgehend eine weitere Bescheinigung über vier zusätzliche Wochen eintrudelte, wurde ich doch sehr nachdenklich. Von meinem Arbeitgeber kam kein Lebenszeichen. Man wollte mir Auszeit gönnen, obwohl ich dringend zurück an die Front musste, schien mir. Oder wollten mich meine Bosse in die Krankheit abschieben, trotz der Tatsache, dass meine Firmen und Projekte ohne mich nicht klarkommen würden? Undenkbar!
Stattdessen musste ich in Woche sieben erfahren, dass der Aufsichtsrat mir anbot, nach meiner Rückkehr eine ruhigere Stelle im „Innendienst“ anzunehmen, wie man mir sagte. Ich hätte mir das verdient. An die Front sollten die jungen Heißsporne kommen, die sich erst einmal ihre Sporen verdienen müssten. Dazu hätte man eine neue Vertriebs- und Ansprache-Strategie entwickelt. Eine, die besser den ethischen und authentischen Werten der Gegenwart entsprach. Ich zertrümmerte das halbe Arbeitszimmer, als ich die Nachricht erfuhr. Ein klassischer Rückfall, wie meine Therapeutin diagnostizierte. Doch ich war kein Dummkopf. Das bedeutete nichts anderes, als dass man mich kaltstellen wollte. Mich, Marc Schillocks! Was für eine Schmach. Klar, dass mein Ego das nicht wahrhaben wollte. „Ein Irrtum“, sagte ich mir, „einfach ein Irrtum“, und schlug mit einem Brett von der Schrankwand auf die Sitzecke ein. Mir selbst war sonnenklar, dass es ein Missverständnis war. Ich musste es einfach nur den Damen und Herren im Aufsichtsrat zeigen, musste beweisen, dass ohne mich alles den Bach hinunterging. Sie würden schon sehen. Sehr bald. Dann nämlich, wenn die nächsten Quartalszahlen ohne meine Erfolge vorlagen! Nein, das wollte ich ihnen aber auch nicht zumuten. Ich bereitete deshalb konsequent meinen Wiedereinstieg in den Beruf vor. Sobald ich wieder kampf- und einsatzbereit war, würde ich den Damen und Herren zeigen, was in mir steckte und wie unverzichtbar ich war. Das war der Plan.
Ohne es zu wollen, steigerte sich mein Alkoholkonsum von Tag zu Tag. Es war irgendwie gemütlich und schön, den Abend mit diesem pelzigen Gefühl ausklingen zu lassen. Zusätzlich half es, die innere Stimmung stumpf zu schalten. Es bekam ja niemand mit, wie ich hin und wieder durch die Gegend schwankte. Tagsüber leistete mir eine alte Modelleisenbahn, die ich in erstaunlich gutem Zustand auf dem Dachboden entdeckt hatte, Gesellschaft. Sie war, wenn ich mich richtig erinnerte, das Erbstück eines Großonkels, welches mir vor einigen Jahren zuteilwurde. Es war entspannend und schön zu sehen, wie die Lokomotive mit ihren Waggons ihre Kreise zog, während ich meinen Whisky im Glas schwenkte. Irgendwie hypnotisierend. Mal zupfte ich hier, mal dort, setzte ein Häuschen auf einen neuen Platz, reparierte ein Licht und freute mich ein wenig über meine kleinen Ergebnisse, die ich mit der Hand geschaffen hatte. Bis ich eines Tages durch die angelehnte Tür meinen Sohn zu meiner Frau sagen hörte: „Papa wird alt, jetzt kümmert er sich schon um alte Männer-Hobbies.“ Die Wut kochte in mir hoch. Wie diskriminierend war das denn?! Gegenüber den älteren Herren, gegenüber diesem schönen Hobby und gegenüber mir! Der Stachel saß tief. Ich kriegte dieses „alte Männer“-Thema nicht mehr aus dem Kopf.
An diesem Abend legte ich die kleine Lokomotive behutsam auf den samtig grünen Belag der Eisenbahnplatte, stellte meinen Whisky ab und blickte zum Spiegel neben mir. Das Gesicht, welches mir dabei entgegenblickte, sprach Bände. Was Alkohol und Nichtstun anrichten konnten! Ich musste schleunigst was ändern! Musste wieder eine strenge Organisation in mein Leben bringen. Ein Marc Schillocks brauchte Regeln, Rituale, feste Abläufe. In meinen Firmen, genauso, wie Zuhause und im Privatleben. Auch beim Konsumieren von Alkohol.
***
Der Tag der Veränderung war da! Ich spürte es an diesem Morgen, als ich mich aufmachte endlich wieder meinen Körper in Bewegung zu setzen. Die Sporthose war ganz schön eng geworden. Das war die erste schockierende Erkenntnis in diesen frühen Stunden des neuen Tages. Doch ich quetschte mich hinein und schleppte meinen aus der Form gekommenen Körper hinaus auf die Straße, rein in den Park, hinunter zum Neckar. Meine gewohnte Laufstrecke bis zum Max-Eyth-See und dann wieder zurück musste ich mir erst wieder erarbeiten. Schon nach wenigen Metern ging mir die Luft aus. Und dennoch. Ich schleppte mich von Tag zu Tag hinunter ans Wasser und joggte immer weitere Strecken. Ich liebte diesen Fluss, wie er sich in die Felsen hineingrub, die Weinberge entlang glitt und durch Staumauern langgezogene Seen bildete. Besonders im Herbst, wenn die grauen Nebel durchs Tal zogen, dann wurde er, zumindest für mich, zur schwäbischen Themse. Danke Freund Paddy für den tollen Ausdruck, den er der Welt nach einem Whisky-Abend schenkte.
Erstaunlicherweise hielt meine Assistentin den Kontakt zu mir aufrecht. Niemand sonst aus der Firma meldete sich. Seit gut zwei Wochen nicht mehr! Offenbar warteten alle ab, was mit der Strafsache in Holland passieren würde. Ich fühlte mich von Gott und der Welt verlassen. Nicht aber von meiner wunderbaren Celine, die ich fortan auf meinen täglichen Joggingstrecken am See traf. Ihr schien etwas an mir zu liegen, wenn ich das richtig interpretierte. Das erstaunte mich doch sehr. Denn selbst bei meiner Frau hatte ich das Gefühl, dass sie nicht mich als Person, sondern meine gesellschaftliche Stellung, das schöne Haus und das Geld geheiratet hatte. Die Begegnungen mit Celine aber waren der Lichtblick des Tages. Oft setzten wir uns am Max-Eyth-See mit einem Becher Kaffee ans Wasser oder mieteten eines der Ruderboote, die auf der Halbinsel angeboten wurden. Auch an diesem Tag genossen wir wieder die Ruhe des beginnenden Tages. Wir hatten uns direkt an den Neckar gesetzt und beobachteten die Frachter, die gemächlich an uns vorbeizogen. Celine lächelte, als sie mein Gesicht studierte: „Man sieht schon ein klein wenig, dass du wieder Sport machst.“ Zärtlich strich sie über meine Wangen. „Bald wirst du wieder so fit sein wie früher.“ Ich mühte mich um ein Lächeln. Eigentlich hätte ich ihr jetzt einen Kuss geben müssen. Doch war ich gehemmt. Dieses `wie früher´ – diese Worte hallten in meinem Kopf nach. Ihr Echo verstärkte sich zu einem bedrohlichen Donner. Ich erinnerte mich der spöttischen Äußerung meines Schwiegervaters, die wie ein Blitz durch meinen Schädel zuckte: „Du bist nicht krank Kerl, du wirst nur alt! Das ist nichts anderes als die Geschichte eines eitlen Gockels, der auf dem vermeintlichen Scheitelpunkt seines Lebens mit so etwas wie der Sinnfrage konfrontiert wird. Der keine Antwort darauf hat, was ihm sein bisheriges Leben gegeben hat und ob dies für ein erfülltes Leben ausreichend ist. Da bringt es absolut nichts, wenn du die jungen Dinger vögelst und dich abreagierst. Ins Unglück wirst du sie reißen. Mehr nicht. Reiß dich verdammt nochmal zusammen und sei endlich ein Mann!“ Sein fieses Gelächter begleitete an diesem Abend am Esstisch die Spötteleien. Am liebsten wäre ich aufgesprungen und hätte ihm die Gänsekeule in sein freches Maul gestopft.
„Marc, alles gut? Was ist mit dir?“ Celines Lächeln war verschwunden. „Ja, alles gut, du kleiner Engel.“ Ich nahm sie in den Arm und genoss es, wie sie sich an mich schmiegte. Wie sollte ich jemals darauf verzichten können? Auf diese Wärme, auf diesen Duft ihres Haares, auf die Stütze, die sie mir war. Das wilde Gebell zweier Kampfhunde durchbrach unsere Idylle. Hysterisches Geschrei von Menschen mischte sich darunter. Die Tiere fielen übereinander her, fletschten die Zähne, bevor sie von ihren Besitzern an den Leinen weggerissen wurden. „Idiot, passen Sie doch auf mit Ihrer Missgeburt.“ – „Halts Maul Alter, sonst lasse ich mein Baby auf dich los!“ Die Menschen brüllten sich an. So schnell konnte alles kippen. Wir standen auf und suchten das Weite. Während ich neben Celine herlief, versuchte ich, in mich reinzuhorchen. Ich wusste nur zu gut, dass ich diese wunderbare Frau loslassen musste. Sie litt unter der Situation, litt wegen und mit mir. Ihre tiefdunklen Augenränder und der traurige Blick hinter dem Lächeln zeugten davon. Hätte ich damals schon gewusst, was das war, dann hätte ich gesagt, ein schlechtes Gewissen regte sich in mir. Wie konnte es nur sein, dass so viele so unbekannte Dinge in mir aufbrachen, sich ihren Weg nach oben bahnten und mich mehr und mehr verwirrten. Eines Tages musste ich es Celine sagen und den harten Schnitt vollziehen. „Nein“, dachte ich plötzlich: „Es muss jetzt geschehen. Je früher, desto besser!“ Ich sammelte allen Mut, nahm Celine bei der Hand, sprach aus, was mein Herz und meine Angst vor dem Verlassenwerden nie hätten sagen wollen und war schockiert von dem Sturzbach an Tränen, der plötzlich aus ihr herausschoss. „Das kannst du doch nicht tun“, sprach sie leise und suchte hinter dem Tränenvorhang meinen Blick. Ich schaute nur geradeaus und setzte ein: „Doch, es muss sein. Weil ich dich liebe und weil du für mich der wertvollste Mensch in meinem Leben bist“, hinzu. Das klassische „Glaub mir, es ist besser für dich. Ich schade dir“, stotterte ich nur noch heiser hervor. Das aber hatte sie nicht mehr gehört. Sie war bereits losgerannt, weg von mir.
Passanten blickten irritiert von ihr zu mir.
Eine kleine Ewigkeit stierte ich nur so vor mich hin. Nicht in der Lage zu denken oder mich zu bewegen. Der Verlust, den ich gerade selbst heraufbeschworen hatte, tat mehr weh, als ich zugeben wollte. Dabei hatte ich das doch früher häufig vollzogen und immer gut gemeistert. Da waren: vorangegangene Kolleginnen von Celine, Stewardessen auf meinen Reisen, von anderen weiblichen Gästen in Hotels ganz zu schweigen. Mit Celine verlor ich jedoch einen besonderen Menschen. Hatte ich wirklich richtig gehandelt?
Eine dicke, fette Nordlandgans pickte mit ihrem Schnabel an meinen Schuhen herum und schnatterte empört. Hatte ich ihren Schlafplatz für den Mittag besetzt? Ich brummte genervt ein „lass mich in Ruhe du Biest. Jetzt bin ich hier“, und versuchte, sie zu verscheuchen. Doch der nervige Weihnachtsbraten legte sich mit etwas Sicherheitsabstand ins Gras und ließ mich nicht mehr aus den Augen. Langsam lichteten sich wieder meine Gedanken. Ich zog mein Handy aus dem Laufrucksack. Keine Nachrichten. Niemand schrieb. Selbst die Spam-Botschaften fehlten mir inzwischen. Es knisterte, als ich das Handy zurücksteckte. Neugierig blickte ich in meinen Rucksack und zog zerknüllte Blätter heraus. Notizen meiner Psychotherapeutin. Warum auch immer hatte ich sie am Morgen eingepackt. Sicher nicht, um sie Celine zu zeigen. Wäre mir zu peinlich gewesen. Denn die Anmerkungen dieser Therapeutin waren echt der Burner. Oder eher `ne große Sauerei. Nachdem ich sie gestohlen hatte und einen ersten Blick darauf werfen konnte, war ich schockiert.
Auch wenn jetzt nicht gerade der beste Augenblick war, setzte ich mich ans Wasser und begann zu lesen:
„Marc Schillocks ist ein Mensch, der egozentrisch wirkt. Er hat nur sich im Blick.
Keine Augen für die Belange anderer.
Nur materielle Ziele.
Versucht immer, seine primären Bedürfnisse zu befriedigen. Sport exzessiv, Lust, Erfolg etc.
Geht nicht in die Tiefe. Materielle Bedürfnisse bestimmen ihn. Er wirkt rücksichtslos, wenn es um Beruf, Anerkennung und Macht geht.
Dabei war er offenbar nicht immer so. Laut eigener Auskünfte und aus seinem Umfeld, war er ein sensibler junger Mensch, hatte Ideale und Ziele in seiner Jugend.“
Hatte ich das wirklich gesagt? Ich konnte mich nicht erinnern, las weiter:
„Er wollte was bewegen. Verändern. Die Welt verbessern.
Doch die Zeit hat ihn verändert.
Es gab zum Beispiel Verletzungen in seinem Leben.
Bruchkanten.
Verhärtungen.
Seine Umwelt lockte ihn durch Ruhm, Macht, Anerkennung, Betäubung durch Hyperarbeit. Die Ziele änderten sich.
Erfolg im Job ist wie Opium. Die Anerkennung anderer ein Aphrodisiakum.
Er hat Erschöpfungserscheinungen. Müdigkeit am helllichten Tag und Schlappheit gehören zu seinen Begleitern. Drogen nimmt er laut eigener Auskunft keine. Diese Aussage ist anzuzweifeln. Koffein und noch mehr Sport sind weiterer Ersatz.
Was waren die Verletzungen in seinem Leben? Es muss schmerzvolle Ereignisse in der Kindheit gegeben haben, die er ausgeblendet hat, die ihn in bestimmten Momenten schutzlos wirken ließen.“
What?
Woher wollte sie das Alles wissen? Ich legte mich auf den Boden und hob den Zettel über mich in Augenhöhe, um weiterlesen zu können:
„Das nutzten die anderen Jungs in der Clique aus. Allein trauten sie es sich nicht. Zusammen aber schmiedeten sie einen Komplott nach dem anderen gegen ihn. Er zog sich zurück. Blieb allein.
Zuhause gab es keine Wertschätzung oder mentale Unterstützung. Niemand gab ihm Rückmeldung dazu, dass er genauso okay war wie er war.
Erst mit dem Beruf, in der Ausbildung, kam das. Dann später mit dem Studium, das er anschloss.
Freundin betrog ihn, als er in Afrika war.
Er wurde scheinbar missbraucht: Ältere Schwester und Freundinnen; Pfarrer; …
Verfolgt ihn eine Geschichte aus der Vergangenheit? Die ihm immer wieder als Albtraum erscheint?
Hat er in seinem Beruf andere ins Unglück gestürzt? Aus beruflichem Ehrgeiz? Mobbing? Hat er an ihnen seine unterdrückten Aggressionen ausgelebt? Vermutlich.“
Nur widerwillig wollte ich mir eingestehen, dass ich tatsächlich in den Sitzungen darüber geredet hatte. In schwachen Momenten. Das nun zu lesen, schockierte mich aber dennoch. Was meinte sie mit den Kollegen und dem Mobbing? Wen soll ich ins Unglück gestürzt haben? Ich konnte mich in diesem Moment nur an die „fairen“ Fights und Wettkämpfe in meinem Beruf erinnern, die es natürlich immer gab. Nachdenklich erhob ich mich und schlurfte nach Hause. Zum Joggen fehlte die Lust und Kraft. Unvermittelt schossen mir Tränen aus den Augen. Rannen die Wangen hinunter. Ich ließ es geschehen, schluchzte aus tiefstem Herzen. Mein Brustkorb wollte mir dabei wie Glas zerspringen. Warum nur dieser Ausbruch? Woher kamen diese Gefühle? Ich konnte es nicht orten. Die Dämme in mir schienen nicht mehr zu halten.
***
George Winstons Klarvierkomposition „December“ ertönte aus meinen Kopfhörern. Noch immer lag ich am Nachmittag dieses Tages auf dem Boden und starrte an die Decke. Auch wenn Sommer war, trug mich diese Wintermusik weit mit sich fort. Schon seit jungen Studentenjahren begleitete mich diese Klaviermusik in meine innere Welt. Die Brust weitete sich urplötzlich. Der Druck auf meinem Herzen verschwand. Ich befand mich in einer vollkommen zeitlosen, eigenen Welt. Glitt durch die Jahrzehnte und empfand an diesem Tag dasselbe, wie damals, als ich mit Mitte zwanzig in meinem Studentenzimmer auf dem Boden lag und sehnsüchtig zum Fenster hinaus auf die Berge der anderen Moselseite blickte. Nicht wissend, was die Zukunft bringen würde. Sehnsüchtig hoffend, dass diese Ungewissheit bald ein Ende finden würde. Es hätte sich eigentlich bei dieser Erinnerung eine Traurigkeit oder Melancholie einstellen müssen. Traurigkeit, dass die vergangenen Zeiten unwiederbringlich verschwunden waren und niemals mehr zurückkommen würden. Doch das war nicht der Fall! Diese Musik verband mich immer, wenn ich sie in meinen Ohren hatte, über diesen zeitlosen Raum mit all meinen Lebensphasen und ließ mich darin schweben. Am Tag zuvor hatte ich tatsächlich auf dem Dachboden in einer verramschten Umzugskiste meine alten Tagebücher gefunden. Ja, ich schrieb früher wohl solche Dinger voll. Hatte ich vollkommen vergessen. Eines davon hielt ich gerade in der Hand. Es war aus meiner Zivildienstzeit. Ich blätterte wahllos darin herum. An einem Text blieb ich hängen:
„An die Freunde – ein Abschied
Mit dem Abschied in der Hand wende ich mich an Euch, meine Freunde. Ein Heimatloser wird eine ihm heimelnd gewordene Wohnstatt verlassen. Ein Einsamer, der ich war und der ich bin. Mitten unter Euch weilte ich – und war doch nie richtig da.
Ich werde nun gehen, werde Euch lebet wohl sagen und gehen. In die Flucht mag ich mich begeben. Dorthin, wo ich all meiner Unrast und Probleme flüchte.
Was mag das Leben schon sein? Ein Wandern durch die Zeiten. Ein Suchen ohne Gleichen. Ein zu langes Verweilen an einem Punkt.
Ich werde nun gehen und Schmerz empfinden. Schmerzen des Abschieds. Gefühle, die mir sagen, Ihr seid für mich etwas, Freunde. Aber, einsam war ich auch mitten unter Euch. Bemerkt habt ihrs nie.
Tränen mögen mein Gesicht erfüllen, schaue ich mein Spiegelbild im Fenster an. Ich frage mich: Warum dieses Vagabundieren? Wo mag die Heimat sein, wo die Gemeinschaft?
Fremd ist mir der Inhalt Eurer Leben, fremd das Gefühl, wie tief Euch die Lebensgenüsse erfüllen können. Es ist jene Unrast in mir, die mich immerzu anstachelt, mich dazu antreibt, immer weiterzugehen.
Freunde, es ist nicht leicht.
Doch ich werde gehen, all meine Wurzeln einpacken, die doch schon recht lang gewordenen, und sie einem anderen Boden anvertrauen. In der Hoffnung, auch dort etwas zu verwurzeln.
Doch sagt mir, ist die Gemeinschaft mit Euch ersetzbar, seid Ihr austauschbar?
Will ich überhaupt gehen?
Renne meinen Bildern nach, suche die Bestimmung. Irgendwo mag sie sein. Irgendwo werde ich sie wohl finden.
Wird sie fernab von allen weltlichen Dingen, fernab auch von Euch und allen liegen?
Doch will ich das?
Weg werde ich sein und ihr lebt weiter. Vergessen ist schnell. Werde ich Euch vergessen? Ich reiße ein Stück Heimat aus mir heraus.
Doch bedenket, es ist auch die Angst, hier gefangen zu werden. Gefesselt an diese graue Stadt am Fluss, die mir schon zahlreiche male Freude, Sinneslust, Liebe und Schmerzen beschert hat. Die mich für ein paar kurze Jahre hindurch in ihrem abgasgeschwängerten Leib aufgenommen hat. Graue Stadt, du magst es aber trotzdem nicht sein, welche mich zurückhält.
Will Heimat erfahren, will Liebe, Wärme, Geborgenheit spüren und die Kälte der Fremde, des sich neu Einzulebenden hinter mir lassen.
Ich, ein Staubkörnchen in der Masse der Menschen. Ich mache es mir so schwer, nehme mich so wichtig.
Aber, die Stunde wird kommen. Wie ein Kleid werde ich auch diesmal mein Leben ablegen. Wie ein Reptil werde ich mich häuten. In neuem Gewand, ein neues Leben beginnen. In einer anderen Stadt, mit anderen Menschen und anderen Träumen, wie schon manches Mal geschrieben.
Das alltägliche Leben als Wegwerfartikel, austauschbar.“
Ich drehte das Buch hin und her. Studierte den Umschlag. Hatte wirklich ich das geschrieben? So poetisch, so tiefgründig. Ein Staubkorn in der Masse der Menschen. Wahrhaftig. Dabei habe ich in den vergangenen Jahren immer geglaubt, ich wäre der größte Goldklumpen inmitten dieser armseligen Sandkörner. Ich versuchte, mich an die Zeit zu erinnern, in der ich das geschrieben haben muss. Alte Gefühle drangen an die Oberfläche. So viele Emotionen. Hätte ich nicht gedacht! Das waren doch Gefühle, oder? Irgendwie schon sagte ich mir und schüttelte den Kopf. Die Therapeutin hatte sicher unrecht, was meine Diagnose betraf. Marc Schillocks war kein egoistischer Zombie!
Ich schleppte mich zur Hausbar. Eigentlich war es noch zu früh für ein hartes Getränk. Doch der Blick auf das Schreiben meines Arbeitgebers erinnerte mich wieder, dass es vollkommen in Ordnung war. Die Änderungskündigung kam extra per Einschreiben ins Haus.
Es lag vor mir auf dem Esszimmertisch. Die perfekte Abrundung dieses abstrusen Tages. Ich prostete diesem zu, versuchte, in mich reinzuhorchen, wollte mein Leid fühlen, mein Verletzt sein. Doch nichts dergleichen. Das war einfach nur dumpf, was da in mir war. Dennoch beschloss ich an diesem Tag, dass ich verletzt war. Und einsam und überhaupt. Celine, wie mochte es ihr gehen? Der alte Ouzo bot sich als Freund an. Der Whisky war ausgegangen. Wir schwelgten in unserer Traurigkeit. Ich und meine multiplen Persönlichkeiten.
Das ging leider nur so lange, bis meine Frau auftauchte und mir eine unglaubliche Szene machte. Sie behauptete tatsächlich, dass ich verwahrlost aussähe. „Wie ein Obdachloser: ungewaschen, unrasiert, in alten Klamotten. Und wie man nur so angetrunken sein kann. Am helllichten Tag! Ekelhaft.“ Celine sah das anders. Meiner Frau prostete ich aufmunternd zu. Doch ging sie auf die Einladung mitzutrinken nicht ein. Im Gegenteil, ich hatte den Eindruck, sie fühlte sich provoziert. Verstand ich jetzt gar nicht. „Mach nur so weiter! Dann werden deine Huren die Lust an dir verlieren. Immerhin. Aber, nicht nur die!“ Auch sie, meine Frau, würde ich verlieren. Meinte sie. Ich nahm einen tiefen Schluck, jetzt direkt aus der Flasche und stierte sie mit schräg gestelltem Kopf an. Das sah urkomisch aus. Also, nicht ich, sondern meine Frau, die dadurch schräg stand. Ich lachte fröhlich los. Komisch. Das berührte mich alles irgendwie gar nicht. In diesem kurzen Moment zumindest. Als sie mir aber drohte, die Kinder zu nehmen und jeglichen Kontakt zu verbieten, da entglitten mir die Gesichtszüge. Das dumpfe Lächeln schmolz dahin. Es folgte der Gravitation und die Mundwinkel sanken unweigerlich nach unten. Ein kurzes Zucken ging durch meinen Arm, die Hand erhob sich. Doch ich konnte mich gerade noch zusammenreißen. Ohne ein Wort stellte ich die Flasche ab und begab mich ins Schlafzimmer. Dort, vor dem großen Glasspiegel, stand ich nun und beobachtete stumm und für lange Zeit diesen fremden Menschen, der mich selbst neugierig zu betrachten schien. Hinter mir flog die Schlafzimmertür krachend ins Schloss.
Ich zitterte. Alles bröckelte ab, zerrann mir in den Fingern. Tag der Verluste! Angst machte sich breit. Angst davor, dass der Panzer zerbrach und etwas explosionsartig aus mir herausbrach. Etwas, was ich nicht kontrollieren konnte und meine Umwelt in Schutt und Asche legen wollte. Ich spürte das. Die Dämonen wollten ans Tageslicht. Wie damals im Flughafen in Amsterdam. Nur schlimmer. Zu lange hatte ich sie im Kerker meines Seins weggeschlossen. Ihre Wut musste grenzenlos sein.
„Tu was!“ Ich erschrak zu Tode bei den Worten meiner Frau hinter mir. Sie hatte sich wieder ins Schlafzimmer geschlichen und beobachtete mich aus sicherer Entfernung. „Ich gebe dir noch eine einzige Chance. Nutze sie!“
Entscheidung
„Wer sich nicht bewegt,
wird sein Ziel nie erreichen.“ (Unbekannt)
Und plötzlich wurde mir eines klar - ich wollte nicht mehr! Ich wollte verschwinden. Aus allen Situationen entfliehen. Alles verlassen. Ab in die Einsamkeit. Für mich sein. Ich schleppte mich an jenem Morgen mühsam meine Strecke am Neckar entlang. Der Restalkohol schien in mir hin und her zu schwappen. Hoffnung, Celine zu treffen, keimte in mir auf. Doch das war Utopie, nachdem ich sie rüde weggeschickt hatte. Es sollte zu ihrem Guten sein. Jetzt vermisste ich sie. Mein Blick raste umher, schweifte über die gesamte Parkanlage, über den See hinweg. Doch keine Celine weit und breit. Ich musste anhalten und stemmte meine Arme auf die Knie. Mein Atem raste. Senioren mit Rollatoren überholten mich und schauten mitleidig zu mir rüber. So weit war es also mit mir gekommen. Ich setzte mich ans Ufer. Merkte nicht, dass ich mitten in der Kacke der nordischen Gänse saß, die schon seit Jahren keinen Bock mehr hatten, von diesem schönen Ort wegzugehen. Dabei hatte die Natur sie doch als Zugvögel erschaffen! Galt denn das Gesetz der Natur heutzutage auch nichts mehr? Angewidert streifte ich die Exkremente von meinen Händen. Die Gedanken zu verschwinden kamen wieder zurück. Drängten sich mir auf, besetzten meinen Verstand. „Hau ab. Verschwinde von hier, fang neu an. Du bist die Welle!“ Die Stimme in mir ließ nicht locker. Doch ich schüttelte in einem letzten Aufbäumen mit dem Kopf. „Geht nicht, die Therapie!“, entgegnete ich dem Aufrührer in mir. Ich wollte sie weitermachen. Das hatte der Betriebspsychologe als freundschaftlichen Rat bei einem Bier empfohlen. Ich war diesem Tipp auch gefolgt. Eigentlich war die Therapeutin richtig gut. Packte mich so an, wie ich es brauchte und ging in dem Tempo voran, wie ich es wohl ertragen konnte. Wobei: Wer konnte einen Lawinenabgang schon kontrolliert durchführen und glauben, er wäre in der Lage die Schneemassen, die ins Tal stürzten, jederzeit kontrolliert zu bremsen oder aufzuhalten, ohne selbst mitgerissen und verschüttet zu werden? Konnte meine Therapeutin das? Die Massen an Emotionen kontrolliert ablassen, wenn einmal der Damm gebrochen war? Ich war grundsätzlich bereit, trotz aller Angst, auf ihre therapeutischen Angebote einzugehen und mich auf eine tiefe, gemeinsame Reise in mein Innerstes zu begeben. „Aber das hat sie dir doch vermiest.“ – „Wer?“ Irritiert horchte ich auf mein Innerstes. „Na sie, deine Alte. Denn eines will sie auf keinen Fall. Eine Therapie, in der du Seelenstriptease vollziehst. Man, da wird sie doch mit reingezogen und dann kommt´s raus… ihre Geheimnisse.“ Aha, das stimmte! Sie hatte eher Sorge um ihren Ruf, als um mein Wohlbefinden. Denn für meine weitere Therapie hätte auch eine Paartherapie angedockt werden sollen, so die Empfehlung. Ihre eigenen Geschichten würden ans Tageslicht kommen. Geschichten, die sie mir immer verheimlicht hatte. Das zweite Kind zum Beispiel. Es war nicht meines! Gezeugt wurde dieses bewundernswerte Wesen von einem anderen Mann. Dabei hätte sie diese Angst hinter sich lassen können. Ich wusste es doch längst. Das Kind glich mir in keinster Weise. Es hatte die Augen des Anwaltskollegen meiner Gattin. Das Gesicht war dem leiblichen Vater exakt nachgeformt. Der heimliche DNA-Test schaffte schon früh Klarheit. Doch ich hatte es für mich behalten. Denn das Kind liebte ich innig und dafür nahm ich die Schmach und Verletzung auf mich. Nicht meiner Frau zuliebe, sondern meines Kindes wegen. Schon verrückt: Diese Liebe und die Fähigkeit, Zuneigung zeigen zu können, beschränkte sich tatsächlich nur auf die Kinder. Ansonsten hätte man mich tatsächlich als emotionalen Zombie bezeichnen können. Den Kuckuckskind-Verursacher hatte ich aber dennoch in einer kalten Dezembernacht kräftig verprügelt. Krankenhausreif. So besoffen, wie der nach der Weihnachtsfeier mit seinen Kollegen war, konnte der Kerl sich nicht wehren. Meine Frau war betroffen, besorgt und schockiert. Wer konnte nur so etwas machen? Ich hätte es ihr sagen können. Doch egal. Weihnachten musste der Arme schließlich im Krankenhaus verbringen. Umsorgt von meiner Frau. Mir war es recht.
Eine der Nordmanngänse bäumte sich vor mir auf und schnatterte gewaltig. Vermutlich die freche Gans, die schon beim letzten Besuch am See meine Gedanken störte. „Schon gut, schon gut, ich gehe ja schon.“ Mühsam erhob ich mich und streckte ihr abwehrend die Hände entgegen. Energischen Schrittes machte ich mich auf meinen Heimweg. Meine Entscheidung war gefallen.
Sollte doch meine Frau an ihren Geheimnissen ersticken. Dann eben keine Weiterführung der Therapie. Stattdessen dieses Selbsterfahrungscamp in den Bergen. Wer weiß, vielleicht erreichte ich damit schneller meine Ziele, um wieder fit für den Job und das Leben zu werden.
***
Der Morgen jenes folgenden Sommertages war mild, als ich mich daran machte, meine Sachen zu packen. Sanfte, fönartige Luft schmiegte sich an mich. Mir war, als ob sie mich noch einmal am Gehen hindern wollte. Mich umgarnen, um mein Leben in diesem schönen Villenviertel in einer der exklusivsten Sonnenlagen Stuttgarts nicht aufzugeben. Doch es war zu spät. Ich musste gehen. Die Entscheidung war gefallen. Es gab kein Zurück mehr. Auch wenn ich die verrücktesten Geschichten gelesen hatte, was solche Camps mit labilen Menschen anstellen konnten. Soweit war es also schon. Marc Schillocks bezeichnete sich selbst als labil. Ich zog das kleine Gartentürchen hinter mir zu, blickte über die Buchsbaum-Hecke, die vor wenigen Tagen vom Gärtner nach Vorgaben meiner Frau zurechtgestutzt worden war, und schritt auf den Gehweg.