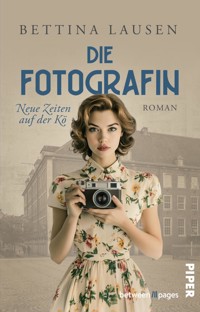5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Historien-Highlight aus dem späten Mittelalter Köln, Anfang des 16. Jahrhunderts: Mit dem verzweifelten Kauf eines Ablassbriefes hofft die Brauerstochter Jonata, ihren toten Bruder vor dem Fegefeuer retten zu können. Als sie jedoch im Auftrag ihres Vaters nach Wittenberg reist und dort Martin Luther begegnet, ändert das alles. Jonata will das Treiben der katholischen Kirche nicht weiter unterstützen. Zurück in Köln wagt sie das gefährliche Unternehmen, im Geheimen die Schriften Luthers zu verbreiten und schließt sich dazu mit dem jungen Druckermeister Simon zusammen. Doch Jonatas eigener Bruder, der Mönch Enderlin, in fanatischem Glauben entflammt, hat geschworen, die Lutheranhänger in Köln auszumerzen. Und auch Simon hütet ein Geheimnis vor Jonata, das sie bald alles kosten könnte … »Der Sprachstil, beeindruckende Schilderungen und die tiefgründige Recherche verleihen der Handlung jene teils düstere und doch immer wieder von Hoffnung durchdrängte Atmosphäre des Mittelalters.« Rezensentin auf LovelyBooks Ein fesselnder, detailreich recherchierter historischer Roman, der Fans von Sabine Ebert begeistern wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 657
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch:
Köln, Anfang des 16. Jahrhunderts: Mit dem verzweifelten Kauf eines Ablassbriefes hofft die Brauerstochter Jonata, ihren toten Bruder vor dem Fegefeuer retten zu können. Als sie jedoch im Auftrag ihres Vaters nach Wittenberg reist und dort Martin Luther begegnet, ändert das alles. Jonata will das Treiben der katholischen Kirche nicht weiter unterstützen. Zurück in Köln wagt sie das gefährliche Unternehmen, im Geheimen die Schriften Luthers zu verbreiten und schließt sich dazu mit dem jungen Druckermeister Simon zusammen. Doch Jonatas eigener Bruder, der Mönch Enderlin, in fanatischem Glauben entflammt, hat geschworen, die Lutheranhänger in Köln auszumerzen. Und auch Simon hütet ein Geheimnis vor Jonata, das sie bald alles kosten könnte …
Über die Autorin:
Bettina Lausen, geboren 1985, lebt mit ihrer Familie in Haan und hat einen Bachelor in Kulturwissenschaften mit den Schwerpunkten Literatur und Geschichte. Sie veröffentlichte bereits mehrere Romane, sowohl im historischen Bereich wie auch in der Spannung. Seit 2018 gibt sie Kurse für Kreatives Schreiben und verfasst Artikel für die Fachzeitschrift »Federwelt«. Außerdem ist sie als Schreibcoach und Lektorin tätig.
Die Autorin im Internet:
www.bettinalausen.de
www.instagram.com/bettina.lausen
www.facebook.com/bettinalausen.de
Bettina Lausen veröffentlichte bei dotbooks außerdem ihren Kriminalroman »Das vermisste Mädchen«, der auch als Hörbuch bei Saga Egmont erscheint.
***
eBook-Neuausgabe Januar 2025
Copyright © der Originalausgabe 2017 Emons Verlag GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Artem Sokolov und AdobeStock/Arceli und Buchmalerei Köln
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98952-704-1
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13, 4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Bettina Lausen
Die Reformatorin von Köln
Historischer Roman
dotbooks.
Für Mona
Kapitel 1
»Requiem aeternam dona ei, Domine.«
Jonata hasste es, die lateinischen Worte des Priesters nicht zu verstehen. Was predigte Enderlin über ihren gemeinsamen Bruder Lucas? Ihr Herz zog sich zusammen. Sie konnte es immer noch nicht fassen. Er hatte ihr das Lesen und Schreiben beigebracht, ihr den Umgang mit dem Abakus gelehrt und immer ein offenes Ohr für sie gehabt. Und vor drei Wochen — sie schluchzte auf, wischte sich die Tränen von den Wangen – hatte er erzählt, dass er sich verliebt hatte. Adelhaid hieß sie. Er hatte von ihrer melodischen Stimme und ihrer Klugheit geschwärmt, war in der Stube auf und ab gegangen, hatte Jonata in die Luft gehoben und sie im Kreis gedreht. Seine Augen hatten geleuchtet wie schon lange nicht mehr. Verloben wollte er sich, hatte unbekümmert gescherzt, dass er Vater mühelos von ihren Vorzügen überzeugen könnte. Jonata war in sein Lachen eingestiegen, doch nun rannen Tränen über ihre Wangen, brannten auf ihrer kalten Haut. Sie hatte nicht einmal die Möglichkeit gehabt, die Frau seines Herzens kennenzulernen.
Ein dicker Kloß im Hals raubte ihr die Luft zum Atmen. Wieso, oh HERR, schickst du mir diese schwere Prüfung? Womit haben wir deinen Zorn auf uns gebracht? Sie schluckte und warf einen Blick über die Schulter. Eng gedrängt saßen die Menschen in den Bänken der Heilig-Kreuz-Kirche. Einige standen zwischen den dicken Pfeilern. Ein Windstoß fegte durch die Fensteröffnungen. Sie zog ihren Mantel enger um sich. Die Kälte fraß sich in ihr Inneres und ließ sie erschaudern.
Zwei Reihen hinter ihr saß eine junge Frau mit gesenktem Kopf und schluchzte unablässig. Ihr Oberkörper bebte. Das lange schwarze Haar hatte sie zu einem Zopf geflochten, der über ihrer Schulter lag. Ein Schleier verdeckte ihr Antlitz, und doch glaubte Jonata, wache Augen zu erkennen. Das musste Adelhaid sein. Wenn Lucas sie zu seiner Braut auserwählt hatte, musste sie über einen scharfen Verstand verfügen und zum Lachen aufgelegt sein.
Jonata wandte den Kopf wieder nach vorn. Enderlin verließ die Kanzel, um Wein und Brot darzubringen. Ein Ministrant ließ die Altarschellen erklingen, ein anderer schwenkte die Weihrauchschale, sodass sich dichter Rauch über die Trauergäste legte. Alle sanken auf die Knie, als Enderlin die Hostie hochhielt. Er murmelte leise vor sich hin. Im flackernden Licht der Kerzen wirkte sein Gesicht schmerzverzerrt und schauderhaft, als ob er die Leiden Christi selbst durchleben würde. Dies war der Moment, so hatte es sie der Vater schon in Kindertagen gelehrt, in dem Christus anwesend sein sollte.
Jonata klammerte sich an diesen Gedanken und betete stumm. Bitte, oh HERR, nimm Lucas in deinen ewigen Wohnungen auf, nimm dich seiner Seele an. Bitte, oh HERR, erbarme dich. Erhörte der HERR ihre stummen Gebete? War Jesus Christus in dieser Hostie lebendig?
»Pater noster, qui es in caelis.«
Jonata schloss die Augen, ihre Lippen formten das Vaterunser, so wie Lucas es ihr ins Deutsche übersetzt hatte. Sie verwahrte die Worte im Herzen. Warum musste alles in Latein gepredigt werden? Wer verstand schon die Sprache der Gelehrten und Geistlichen?
»Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen«, beendete sie das Gebet. Der Schluss der heiligen Messe rauschte an ihr vorbei, zu schmerzhaft waren die Erinnerungen an Lucas. Erst das Glockengeläut, das den Auszug ankündigte, holte sie aus ihren Gedanken zurück. Sechs Männer hoben den Sarg an und trugen ihn aus der Kirche. Enderlin, einige Dominikanermönche und die Ministranten folgten, dann kamen Jonata und ihre Familie mit den Knechten und Mägden der Brauerei. Sie schirmte die Augen gegen die tief stehende Sonne ab. Der Mönch an der Klosterpforte sah sie grimmig an. Auch er schien das Lachen verlernt zu haben. Wie fühlte es sich an, tagein, tagaus hinter diesen Mauern zu leben? Einsam und eingeengt? Oder voller Freude in Gemeinsamkeit mit Gott? Sie atmete auf, als sie das Klostergelände verließen. Die letzten Schneeklumpen zerbrachen unter ihren Schuhen. Einige Male musste sie schlammigen Pfützen ausweichen.
Als sie den Friedhof erreichten, sprach Enderlin erneut ein paar Worte. Schließlich ließen die Träger den Sarg in die Erde sinken. Jemand schluchzte laut auf. Adelhaid? Jonata wagte nicht, sich umzudrehen. Erneut stiegen Tränen in ihre Augen. In der Holzkiste lag Lucas. Die unvorstellbare Realität legte sich wie ein Eisklotz um ihr Herz, umfasste es und drückte es zusammen, als sollte es ebenfalls stehen bleiben. Doch es schlug weiter, ohne Unterlass. Wie hatte der HERR ihr nur den geliebten Bruder nehmen können? Er war so jung, so voller Lebenslust gewesen. Hatte geliebt, gelacht, sollte die Brauerei irgendwann übernehmen. Die Nachricht seines Todes hatte sie so unvermittelt getroffen.
Ein Klopfen an der Pforte hatte sie aus dem Schlaf gerissen. Sie hatte gelauscht, keine Geräusche vernommen. Beim erneuten Klopfen hatte sie ihren Mantel übergeworfen und war die Treppen hinuntergeeilt.
»Wer ist da?«
»Hier sind Jobst und Veit. Lasst uns ein.« Sie erkannte sofort die dunkle Stimme des Stadtbüttels Jobst.
»Was wollt Ihr?« Sie fühlte sich unwohl, die Tür zu öffnen, wenn alle anderen im Haus schliefen.
»Wir bringen Euren Bruder Lucas.«
Was hatte Lucas angestellt? Hastig entriegelte Jonata die Tür und erschrak. Lucas’ schlaffer Körper hing zwischen den Bütteln hinab wie ein Sack. Im ersten Moment ärgerte sie sich, dass Lucas so viel getrunken hatte, dass ihn seine Beine nicht mehr trugen. Dann sah sie das Blut an seinem Hinterkopf. Die beiden Büttel ließen den Körper auf den Tisch in der Stube fallen.
»Seid doch vorsichtig!«, schrie sie.
»Bei dem ist keine Vorsicht mehr vonnöten«, brummte Jobst.
»Was meint Ihr damit?« Sie trat an ihren Bruder heran. Sein Gesicht war aschfahl und aufgedunsen, die Lippen blau, seine Kleidung triefte vor Nässe. Sie streckte die Hand aus, wollte ihn wachrütteln, doch sie hielt inne. Es polterte auf der Treppe. Das waren unverkennbar die Schritte ihres Vaters. Im nächsten Moment stand er auf der Schwelle. »Was ist hier los? Was soll die Ruhestörung mitten in der Nacht?«
Sie war froh, endlich Unterstützung zu erhalten. Die Büttel traten einen Schritt zurück, sodass ihr Vater Lucas auf dem Tisch liegen sah.
»Was ist mit ihm?«, schrie er, stürzte vor und stieß die Büttel zur Seite.
»Wir haben ihn im Rhein gefunden. Sein toter Körper hat sich im Geäst am Ufer verfangen.«
»Tot?« Jonata presste die Hand vor den Mund, als sie begriff, was dieses Wort zu bedeuten hatte. Ihr wurde schwindelig, sie stolperte nach hinten, ließ sich auf einen Schemel fallen.
»Nein! Bei allen Heiligen und der Jungfrau Maria!« Ihr Vater betrachtete Lucas eingehend, strich mit den Händen über das Gesicht und die Arme. Er keuchte, als nähme ihm der Schmerz den Atem. Jonatas Herz zog sich zusammen, und ihr wurde übel. Lucas. Tot? Das musste ein Traum sein. Sie schloss die Augen, öffnete sie wieder, in der Hoffnung, Lucas lebendig vor sich zu sehen. Doch er lag immer noch reglos auf dem Tisch, und die Büttel standen ratlos daneben. Warum? Was war passiert? Weshalb ihr Bruder? Das konnte nicht sein. Jonata rieb sich über die schweißfeuchte Stirn.
»Was ... was ist passiert?« Ihre Stimme gehorchte ihr nicht, die Silben formten sich nur brüchig.
Veit zuckte mit den Schultern, Jobst antwortete: »Er hat zu viel Bier gesoffen.«
Jonata sprang auf. »Habt Ihr die Wunde am Hinterkopf nicht gesehen?«
»Er hat sich den Kopf gestoßen und ist in den Rhein gestürzt. So etwas passiert nicht das erste Mal«, antwortete Jobst.
»Wie könnt Ihr so was behaupten?«, rief Jonata.
»Riecht doch selbst! Auch jetzt noch stinkt es aus seinem Mund wie in Gottfrieds Bierschank.« Jobst lachte. Das war die berüchtigtste Schenke Kölns, in der sich Halunken und Gauner aufhielten. Auch Hübschlerinnen gingen dort ein und aus, sagte man sich. »Ich bin Eurem Bruder schon ein paarmal begegnet. Ihr solltet ihn nicht auf ein zu hohes Ross setzen, sondern erkennen, was er war: ein Trunkenbold!«
»Ihr ...«Jonata stürzte auf Jobst zu, doch ihr Vater hielt sie zurück. »Das reicht, Jonata! Die Büttel haben ihre Schuldigkeit getan. Habt Dank, dass Ihr meinen Sohn hergebracht habt.«
»Aber Vater!«, protestierte Jonata.
»Schweig!«
Die Büttel verneigten sich und waren im Begriff zu gehen.
»Was, wenn es kein Unfall war, sondern Mord?« Sie packte ihres Vaters Arm und sah ihn entschlossen an. Seine Augen waren ruhelos, zuckten hin und her, wie immer, wenn er aufgeregt oder besorgt war. »Willst du nicht die Wahrheit erfahren?«, drängte sie. »Es muss doch Zeugen geben.«
Die Strenge verschwand aus seinem Gesicht, und seine Züge wurden weicher, ein winziges Lächeln zeichnete sich ab. Wahrscheinlich belächelte er ihre Hartnäckigkeit, die er so oft rügte.
»Wartet«, rief er den Bütteln hinterher. Die Männer drehten sich auf der Türschwelle um. »Findet heraus, was passiert ist. Wo war mein Sohn zuletzt? Wen hat er getroffen? Hat irgendjemand etwas gesehen?«
»Wir werden die Angelegenheit dem Bürgermeister vortragen. Der wird anordnen, was zu tun ist«, antwortete Jobst.
»Ich danke Euch«, sagte ihr Vater. Die Büttel verschwanden, und die Tür fiel krachend ins Schloss. Im nächsten Moment traf sie ein Schlag ins Gesicht.
»Au!« Sie hielt sich die Wange, die brannte, als stünde sie in Flammen.
»Du wirst meine Anweisungen nie mehr vor anderen in Frage stellen!« Seine Augen blitzten auf. Ruckartig drehte er sich um und stapfte die Treppe hoch.
Für Lucas würde sie es immer wieder tun. Der körperliche Schmerz war eine willkommene Wohltat und legte sich wie ein sanftes Wiegenlied um ihre Seelenqual. Jonata trat erneut an den Tisch. Sie ballte die Hand und biss in den Zeigefinger, ihr ganzer Körper bebte. Sie wollte nicht wahrhaben, was ihre Augen sahen. Die quälende Frage nach dem Grund krampfte ihr Herz zusammen. Zweiundzwanzig Lenze zählte er erst. Vaters ganzer Stolz und ihr Vertrauter, Zuhörer, Beschützer und Lehrer. Lucas war kein Trunkenbold. Nur wenn es ihm schlecht ging oder er sich Sorgen machte, trank er zu viel von dem Dickbier. Hatte ihn etwas bedrückt? Lucas, wieso hast du nicht mit mir gesprochen? Sie hatten doch immer alle Last und Sorge geteilt. Sie schloss die Augen. Ein Rascheln, ein Flüstern. Sprach er mit ihr? Nein, die Geräusche kamen aus dem oberen Stock.
Ihre Ziehmutter Elisabeth war aufgestanden. Jonata musste ihr sagen, was passiert war.
Die Nachforschungen der Büttel hatten keine Erkenntnisse zutage gebracht. Lucas war in der Schenke nahe Sankt Maria Lyskirchen gewesen und hatte sie betrunken und torkelnd verlassen. Danach wollte ihn keiner mehr gesehen haben. Sein Tod wurde vom Bürgermeister als Unfall deklariert. Jonata vermutete, dass die Büttel die Zeugenbefragungen nur halbherzig durchgeführt hatten. Für die beiden war die Angelegenheit von Anfang an klar gewesen. Jonata hatte selbst in die Schenke gehen und Nachforschungen anstellen wollen, doch ihr Vater hatte es verboten.
»Davon wird er auch nicht wieder lebendig«, hatte er gesagt.
Jonata starrte in das dunkle Loch im Boden, in das die Trauergäste als letztes Geleit eine Handvoll Erde warfen.
»So geht mit Gott«, beendete Enderlin die Beisetzung. »Doch bevor Ihr zum Alltag zurückkehrt, bedenkt den Moment, an dem Ihr dem Schöpfer gegenübertretet. Eure Sünden wiegen schwer! Kauft einen Petersablass, und Euch werden sieben Jahre Fegefeuer erlassen. Knausert nicht, wenn es um Euer Seelenheil geht, und bedenkt auch Eure Verstorbenen.«
Einige nickten, andere wandten sich murmelnd um und gingen. Wie konnte er es wagen, die Ablassbriefe anzupreisen wie ein Marktschreier? Die Worte des Priesters sollten allein Lucas gewidmet sein und nicht den Sünden der Trauergäste. Woher wusste Enderlin schon, wie groß die Sünden der Anwesenden waren? Und was war schon ein Erlass von sieben Jahren? Wie viele Ablassbriefe musste man erwerben, um den Qualen zu entgehen? Wie schwer wog eine Sünde? Wie viele Tage Fegefeuer standen für einen unkeuschen Gedanken oder ein böses Wort gegen den Vater? Dies hatte ihr bisher keiner beantworten können, und Vater hatte von diesen Fragen nichts wissen wollen. Auch ihr Beichtvater hatte sie für solche Fragen nur gescholten, ihr Entsagungen wie Fasten und das mehrmalige Aufsprechen des Ave-Maria aufgetragen, damit sich ihr Glauben festigte. Nur mit Lucas hatte sie über diese Ungewissheiten, die so heiß in ihrem Inneren brannten, diskutieren können. Er hatte sie nicht für ihre Neugier gerügt, sondern sie für ihren scharfen Verstand bewundert. Mit wem sollte sie nun darüber sprechen?
Enderlin trat zu ihnen und riss sie jäh aus den Gedanken. Ihr Vater fasste ihn an der Schulter. »Danke, dass du die Messe für Lucas gehalten hast. Es muss dich viel Kraft gekostet haben. Du bist stark, mein Sohn, das macht mich stolz. Zu Recht haben dir deine Brüder die geistige Leitung der Bruderschaft anvertraut.«
Enderlins Mundwinkel zuckten. Jonata wusste, dass dies ein Zeichen der Freude darstellte. Es war eine Ewigkeit her, seitdem Enderlin das letzte Mal herzhaft oder freundlich gelacht hatte.
»Es war mir eine Ehre.«
»Begleitest du uns zum Totenmahl?«, fragte ihr Vater.
Enderlin nickte. Seine Haut war im Winter blass geworden. Sein Gesicht wirkte eingefallen und knochig, sodass die Hakennase noch markanter hervorstach. Er hatte es sicherlich mit der Askese und der Selbstkasteiung wieder übertrieben.
»Verlieren wir keine Zeit. Wenn meine Gaffelbrüder Bier nur erahnen, sind sie so schnell zu Tisch, als wären Dämonen hinter ihnen her«, sagte ihr Vater.
Sie machten sich mit den Lehrlingen und Gesellen auf den Weg zur Schildergasse, in der sich seit fünfundzwanzig Jahren das Gemeinschaftshaus der Brauerbruderschaft befand. Als sie den geräumigen Saal betraten, waren die meisten Bänke bereits besetzt. Es roch nach Männerschweiß und Bier. Die Trauergäste unterhielten sich lautstark, hatten den Anlass der Zusammenkunft wohl vergessen. Erst als Enderlin nach vorn trat, ebbten die Gespräche ab.
»Lucas verstand es, sowohl mit Gerste und Hopfen umzugehen, als auch mit den Kaufleuten zu verhandeln«, ertönte Enderlins Stimme im Saal. »Er war verständig und ein guter Kerl, der keinem ein Leid zufügen konnte. Das sage ich nicht nur als Bruder, sondern auch als Mönch.«
Wie wollte Enderlin das beurteilen? Jahre schon hatte er sich im Kloster verschanzt. Erst seitdem er für die geistige Leitung der Brauerbruderschaft zuständig war, hatte Jonata ihn wiedergesehen.
»Lasst diesen Abend im Gedenken an diesen besonderen Menschen ausklingen, den der HERR so früh zu sich geholt hat.«
Diejenigen, die bereits einen Becher Bier vor sich stehen hatten, hoben diesen für einen Trinkspruch zu Ehren von Lucas. Enderlin trat zur Seite, sodass ihr Vater die Gäste begrüßen konnte. Jonata hörte kaum mehr zu, sie war zu erschöpft. Sie ließ sich auf einem freien Scherenstuhl nieder und war froh, als ihr jemand einen Becher mit Keutebier hinschob.
»Ein schwerer Tag für Euch«, sagte der Mann.
Jonata trank einen Schluck und erkannte jetzt erst, wer neben ihr saß. Sebalt sah sie mitfühlend an, doch sie konnte seinem Blick kaum ein paar Augenaufschläge standhalten. Er schielte, seine Nase war klobig, und in seine Haut hatten sich trotz der noch jungen Jahre tiefe Falten gegraben. Als er nach seinem Becher griff, streiften sich ihre Hände. Diese Berührung war kein Zufall. Vor einem Monat hatte er sie auf dem Markt angesprochen, doch da hatte sich Lucas geschickt zwischen sie geschoben und ihn abgewiesen. Seither hatte sie seine Blicke im Nacken gespürt, wann immer sie ihm begegnete. Jetzt war sie auf sich allein gestellt. Sie nickte, da sie nicht wusste, was sie ihm antworten sollte. Sie nahm den Becher und trank. Er tat es ihr gleich, rülpste und wischte sich mit dem Ärmel den Schaum aus dem Bart.
»Hat Euer Vater schon über die Nachfolge der Brauerei nachgedacht, jetzt wo ...«
Sie warf ihm einen zornigen Blick zu, der ihn zum Schweigen brachte. Was für eine Unverfrorenheit. »Was fällt Euch ein, am Tag der Beerdigung darüber zu sprechen?« Das konnte nur eins bedeuten, und dieser Gedanke bereitete ihr Übelkeit. Sie erhob sich, obwohl ihr Väter seine Rede noch nicht beendet hatte.
»Bitte entschuldigt.«
Der Stuhl kippte nach hinten, es war ihr egal. Die Blicke der anderen waren auf sie gerichtet. Ihr Vater hielt in der Rede inne und sah verärgert zu ihr herüber. Sie hob entschuldigend die Schultern und stürmte nach draußen. Bloß weg.
Erleichtert lehnte sie sich an die Hauswand und atmete tief ein. Die Sonne verschwand hinter den Dächern. Ein Schwein durchwühlte grunzend den Unrat nach etwas Essbarem. Die neue Magd des Fassbinders mühte sich mit einem Bündel auf den Schultern ab. Jonata nickte ihr zum Gruße zu, doch das Mädchen schien sie nicht wahrzunehmen, keuchte unter der schweren Last.
Jonata griff in ihren Beutel und zog das kleine Messer hervor. Sie hatte es an sich genommen, als niemand sie beobachtet hatte. Lucas hatte es immer am Gürtel getragen. Mit dem Finger fuhr sie über das Ornament auf der Lederscheide. Sie zog die Klinge heraus und betrachtete das glänzende Metall. Jeden Morgen hatte er sein Messer gesäubert und nachgeschärft, wenn es nötig war. »Der richtige Winkel ist beim Schärfen entscheidend«, hatte er gesagt. Natürlich hatte er es ihr nie gezeigt, aber vorerst wollte sie das Messer nicht benutzen. Sie war froh, diesen Gegenstand, der Lucas so kostbar gewesen war, für sich behalten zu können.
»Hier hältst du dich auf.« Enderlins schneidende Stimme ließ Jonata zusammenzucken. Geschwind ließ sie das Messer in der Scheide verschwinden und stopfte es in den Beutel. Er beäugte sie misstrauisch. Hoffentlich fragte er nicht, was sie vor ihm versteckte. Es geziemte sich für eine Frau nicht, ein Messer bei sich zu tragen.
***
Enderlin atmete tief ein, als er durch die Pforte des Klosters schritt. Geradewegs ging er auf die Kirche zu. Es war an der Zeit, mit den Klosterbrüdern für Lucas zu beten. Das Saufgelage, das sein Vater als »Totenmahl« bezeichnete, war in keinster Weise für das Gedenken eines Verstorbenen angemessen. »Sei nicht unter den Säufern und Schlemmern«, stand in der Bibel. Hatte er es ihnen nicht oft genug gepredigt? Doch die ungebildeten Säufer hörten einfach nicht zu. Selbst aus dem Tod von Lucas hatten sie nichts gelernt. Zu viel von dem flüssigen Gold brachte die Menschen ins Verderben.
Enderlin betrat die Abteikirche, in der sich die anderen Klosterbrüder versammelt hatten. Auf dem Altar brannten Kerzen. Er genoss die Ruhe. Wenn sie unter sich waren, gab es kein Husten oder Getuschel. Der Prior trat nach vorn und eröffnete die Vesper. Der Organist spielte die ersten Töne, und Enderlin sang mit den Klosterbrüdern. Ihre Stimmen hallten von den Wänden wider. Der Klang füllte den ganzen Chor aus und verschaffte ihm gleichzeitig eine innere Ruhe. Der HERR wurde durch ihre Klänge gerufen und gesellte sich zu ihnen.
Enderlin hätte stundenlang hier sitzen können, doch wie schnell waren die Horen vorbei. Dann fieberte er dem nächsten Stundengebet entgegen oder zog sich in eine Kapelle zurück. Immer dann, wenn es die Arbeit zuließ. Nach den Psalmengesängen und dem neutestamentlichen Canticum begann der Prior mit der Schriftlesung. » Verba Ecclesiastes filii David regis Hierusalem.« – Dies sind die Reden des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs zu Jerusalem. Der Beginn des Buches Kohelet. Eine passende Stelle zum Gedenken an seinen Bruder.
»Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger, es ist alles ganz eitel. Was hat der Mensch für Gewinn von aller seiner Mühe, die er hat unter der Sonne?«, fuhr der Prior in Latein fort.
Nichts hatte Lucas davon! Er schmorte im Fegefeuer für seine Sünden und den übermäßigen Biergenuss. Wie fühlt es sich an, Bruder, wenn die Flammen deine Glieder zerfressen? Enderlin zwang sich, den Worten des Priors zu folgen. Als die Lesung beendet war, trat Enderlin mit drei weiteren Brüdern nach vorn, um das Responsorium zu singen. Wieder erfüllten die irdischen und zugleich himmlischen Wechselgesänge den Chorraum. Die Fürbitten widmete der Prior Lucas. Nach dem Tagesgebet und dem Segen läuteten die Glocken. Enderlin zog mit den Brüdern aus der Kirche aus. Als sie den Kreuzgang betraten, raunte ihm der Prior zu: »Ich erwarte dich gleich im Priorhaus.«
Enderlin blieb stehen, wollte etwas erwidern, doch Jakob Hochstraten war bereits in der Klausur verschwunden. Was hatte das zu bedeuten? Hatte er das Totengedenken für Lucas nicht zu seiner Zufriedenheit gehalten? Unruhig lief er im Kreuzgarten auf und ab, betete stumm zwanzig Ave-Maria, bis er sich zum Haus des Priors aufmachte.
Es lag im hinteren Teil der Klosteranlage und war nur für Mitglieder des Ordens zugänglich. Das herrschaftlich anmutende Fachwerkhaus hätte ebenso das eines wohlhabenden Kaufmanns sein können. Gelächter drang aus dem Fenster. Enderlin sprang die drei Stufen hoch und klopfte an die Tür. Bruder Walter öffnete ihm und zeigte auf die hohe Holztür. Wenigstens er hielt sich an das Schweigegebot nach der Vesper. Enderlin trat in die Kemenate. Drei Lehnstühle standen im Halbkreis um den Kamin. In einem saß der Prior, neben ihm der Ablassprediger aus den Sachsenlanden. Er verweilte seit drei Tagen im Kloster, aber Enderlin hatte ihn bisher nur im Refektorium beim Frühmahl zu Gesicht bekommen.
»Bruder Enderlin, setz dich zu uns«, rief der Prior und winkte ihn heran. Das große Kreuz an der Kette um seinen Hals schimmerte im flackernden Licht des Feuers.
Enderlin tat wie ihm geheißen und ließ sich auf dem freien Lehnstuhl nieder. Über Sitz- und Lehnfläche lag ein Schaffell, was den Stuhl viel zu bequem machte. An der Wand hing ein Teppich mit einer Abbildung des Paradieses. Daneben thronte ein Schrank mit vielen Verzierungen und Eisenbeschlägen. Der Prior bewahrte dort die wertvollsten Folianten auf. Darunter sollte sich die Originalschrift der »Catena aurea« von Thomas von Aquin befinden. Enderlin hatte dieses Buch nie zu Gesicht bekommen. Ob es so prunkvoll war, wie die Brüder sich erzählten? An den Wänden hingen aufwendig geschmiedete Kerzenhalter. Der Prior hätte in diesem Raum mehr Demut und Bescheidenheit walten lassen sollen. Wenn er selbst einmal Prior war, würde er diese Prunkstücke verschwinden lassen. Doch bis dahin war es noch ein langer Weg. Subprior Vallentin war mit seinen über sechzig Lenzen nicht mehr sehr gewandt. Seitdem er im Herbst bei der Apfelernte von der Leiter gestürzt war, zog er das rechte Bein nach. Es würde nicht mehr allzu lange dauern, bis dieses Amt neu zu besetzen war. Enderlin würde frühzeitig den Prior auf sich aufmerksam machen.
»Bruder Tetzel brachte uns Kunde von einem Ketzer aus Sachsen«, sagte der Prior.
»Auch in Köln gibt es Ketzer«, antwortete Enderlin.
»Keiner ist so wie dieser Augustinermönch.« Tetzel beugte sich vor. Er war so beleibt wie ein Kaufmann und besaß bis auf einen kleinen Flaum an der Stirn nur noch einen Kranz aus grauen Haaren. Der Tonsur schien er nicht mehr nachhelfen zu müssen. »Er gefährdet den Ablassverkauf und damit die Errettung der armen Seelen aus dem Fegefeuer.«
»Er tut was?«, fragte Enderlin erstaunt. »Ein einzelner Mönch?« Tetzel trank einen Schluck und stellte den Becher auf den kleinen Holztisch. »Du hast noch nicht von Luthers fünfundneunzig Thesen gehört?«
»Nein.« Was kümmerten ihn Thesen eines Augustiners aus dem entfernten Sachsen? Darum sollte sich die dortige Geistlichkeit kümmern. In Köln gab es andere Probleme: Die Menschen missgönnten einander den Schinken zum Brot, gaben sich der Fleischeslust hin und nahmen sowohl zu viel Bier als auch Wein zu sich. Das hatte nicht zuletzt der Tod seines Bruders bewiesen. Seine Schwester hatte bestritten, dass Lucas zu viel Dickbier getrunken hatte, aber sie war nur ein Weib. Sie hatte keine Ahnung. Jemand musste die Einwohner Kölns ermahnen, sich wieder auf Gottes Gebote und die Heiligkeit der Kirche zu besinnen.
»In seiner einundzwanzigsten These sagt er, dass jene Ablassprediger irren, die sagen, dass durch die Ablässe des Papstes der Mensch von jeder Strafe frei werde.«
»Es gibt wirksame Maßnahmen gegen solche Ketzer«, sagte Enderlin.
»Sei gewiss, die Anklage wird vorbereitet. Doch seine Kunde verbreitet sich im ganzen Land und vergiftet die armen Seelen«, sagte Tetzel. »Der Papst habe nicht die Fähigkeit, Strafen zu erlassen. Blasphemie!«
»Wenn er erst einmal brennt und seine Anhänger mit ihm, werden die Menschen den Irrglauben erkennen und zur Kirche zurückkehren«, sagte Enderlin.
Tetzel nickte und warf dem Prior einen Seitenblick zu. Dieser lehnte sich entspannt im Stuhl zurück und erwiderte das Nicken. Er lächelte, wobei das Grübchen in seinem Kinn deutlich hervortrat.
Enderlin fragte sich, was diese wortlose Verständigung zu bedeuten hatte. Dann hob der Prior die Hand. »Du kannst gehen.«
Unschlüssig stand Enderlin auf, verbeugte sich und ging zur Tür. Er drehte sich noch einmal um. Im Kamin knackte ein Holzscheit. Funken sprühten. Was hatten die beiden mit ihm vor? Zu gern hätte er danach gefragt, doch die Aufforderung des Priors war unmissverständlich. Seine Anwesenheit war nicht weiter erwünscht.
***
»Kommst du?«, rief seine Mutter.
»Nur diese Seite noch.« Simon klaubte die Lettern aus dem Setzkasten und platzierte sie im Winkelhaken. Zwei Zeilen fehlten, dann wäre eine weitere Seite fertig und könnte der Druckform hinzugefügt werden.
»Du kannst danach Weiterarbeiten.« Die Stimme seiner Mutter wurde energischer.
Er seufzte, legte das Werkzeug auf den Tisch und stand auf. In einer Woche musste er die Gebetsbücher im Beginenkloster abgeben. Und er hatte erst die Hälfte der Seiten gedruckt. Es würde keine Zeit mehr bleiben, um die Bücher zum Illuminator für die aufwendigen Initialen und Abbildungen zu bringen. Die Beginen würden ihm einen geringeren Preis pro Buch zahlen als ursprünglich vereinbart, aber es war besser als nichts.
Es war der letzte Auftrag, den sein Vater noch herangeholt hatte. Danach musste er sich selbst um neue bemühen. Wie er das hasste! Doch ihm blieb keine andere Wahl. Sein Bruder Nickell würde ihm dabei keine Hilfe sein. Er könnte bei der Kirche anfragen. Ablassbriefe wurden zurzeit in großer Zahl gebraucht. Doch dieser Quentell hatte sich bisher alle kirchlichen Aufträge vom Erzbischof persönlich zusichern lassen. Es würde schwierig werden, dazwischenzukommen.
»Simon!«
Es hatte keinen Sinn, sie länger warten zu lassen. Er verließ die Werkstatt und zog die Tür hinter sich zu. Sie griff nach seinen Händen und begutachtete sie. »Wie du schon wieder aussiehst.«
Die Druckerschwärze und das Grau der Bleilettern hatten sich tief in seine Haut gegraben, aber es war zwecklos, die Hände jedes Mal zu waschen. Sie wurden nur sauber, wenn er sie täglich schrubbte und mehrere Tage von der Arbeit fernblieb, wie vor Kurzem, als sein Vater gestorben war und er es eine Woche nicht übers Herz gebracht hatte, die Werkstatt zu betreten.
»Wir gehen nur zum Schreinsamt, nicht zu einer gesellschaftlichen Veranstaltung.«
Seine Mutter nickte und zupfte ein paar Flusen von seinem Wams. Warum war sie nur so nervös?
»Ich muss schnell wieder zurück sein, lass uns jetzt gehen«, sagte Simon und zerrte sie nach draußen. Auf dem ganzen Weg nestelte seine Mutter an ihrem Rock herum. Er legte einen Arm um ihre Schultern und drückte sie an sich. »Was sorgst du dich? Ich bin dein mündiger Sohn. Vater hat ein Testament hinterlassen. Der Schreinsmeister kann uns das Haus nicht wegnehmen.«
Seine Mutter nickte stumm. Irgendetwas bedrückte sie, das hatte er schon gestern Abend beim Essen gemerkt. Sie war ungewöhnlich still gewesen, sogar das Tischgebet hatte sie ihm überlassen.
Als sie ankamen, wurden sie von einem Buben mit zotteligen Haaren zur Kammer des Schreinsmeisters geführt. Er saß hinter einem großen Schreibpult mit reichlichen Verzierungen. Ein Kerzenständer mit sechs Wachskerzen stand neben einem Papierstapel. Die Fensteröffnung mit den in Blei gefassten Butzenscheiben spendete eigentlich genug Licht für die Schreibtätigkeit. An der rechten Wand befand sich ein Schrank. Eine Flügeltür stand offen und gab den Blick auf die Bücher und Folianten frei.
Der Schreinsmeister blickte auf, ohne den Federkiel beiseitezulegen. »Gott zum Gruße!« Er wies mit der freien Hand auf die beiden Scherenstühle, die vor dem Pult standen. Simon und seine Mutter setzten sich.
»Diese Zeile noch«, brummte er und ließ die Feder über das Pergament kratzen. Seine Finger waren flink trotz seines fortgeschrittenen Alters. Die wenigen Haare auf seinem Kopf waren ergraut, und die Gesichtshaut war von den langen Tagen in der Schreibstube gezeichnet. An der rechten Hand trug er einen klobigen Ring aus Gold, um den ihn so manch einer beneiden mochte. Störte ihn dieses Ding nicht bei der Arbeit?
Der Schreinsmeister atmete tief ein, legte die Feder auf das Schreibpult und blickte auf. »Von Werden, richtig?«
Simons Mutter nickte. »Ihr wisst, wir haben meinen Ehemann vor zwei Wochen zu Grabe getragen. Wir sind hier, um das Haus ›Zur goldenen Pforte‹ auf meinen ältesten Sohn umzuschreiben.«
Ihr Haus hatte diesen Namen wegen der Fassade erhalten. Der Vorbesitzer, ein Goldschmied, hatte den Torbogen der Pforte in einem Farbton streichen lassen, der im Sonnenlicht golden schimmerte.
»Gibt es ein Testament?«, fragte der Schreinsmeister.
Simons Mutter nestelte in ihrem Umhang und zog ein Pergament hervor. Er riss es ihr förmlich aus der Hand und begann zu lesen: »All mein Erbgut ...«
Seine Mutter räusperte sich. »Ist es denn nötig, alles vorzulesen? Ich dachte, es wird nur ein Eintrag im Schreinsbuch vorgenommen.«
»Vorerst müssen wir doch ergründen, wie der Wille Eures verstorbenen Ehegatten lautet«, sagte der Schreinsmeister und wedelte mit der Hand, als wollte er ihren Einwand verscheuchen.
Sie nickte betreten.
»All mein Erbgut, das Haus ›Zur goldenen Pforte‹, die Druckerei samt ihrer zur Arbeit notwendigen Gerätschaften sollen an Simon von Werden gehen, den unehelichen Sohn meiner Frau Irmel von Werden, den ich als meinen rechtmäßigen Sohn und Erben anerkenne.«
»Was?« Simon sprang auf, der Scherenstuhl kippte nach hinten. Was hatte der Schreinsmeister vorgelesen? Hatte er richtig gehört? »Mutter, was ...«
Seine Mutter saß wie ein Häufchen Elend auf dem Stuhl, die Hände versteckte sie in den Rockfalten. Sie hatte ihm das Testament nicht zu lesen gegeben, und er hatte nicht danach gefragt. Sie hatte ihm erzählt, dass sein Vater ihn als den alleinigen Erben eingesetzt hatte. Das hatte er erwartet, und mehr hatte er nicht zu wissen gebraucht – so hatte er zumindest geglaubt.
»Was hat das zu bedeuten?«
Sie murmelte etwas vor sich hin. Er beugte sich zu ihr. »Ich kann dich nicht verstehen.«
»Es ... es ist die Wahrheit«, flüsterte sie.
Simon wusste nicht, ob er lachen oder schreien sollte. Sein Vater, sein geliebter Vater sollte nicht derselbige sein? Und er ein Bastard, gezeugt von einem Fremden, den er womöglich nicht kannte? Er glaubte, den Boden unter den Füßen zu verlieren, konnte den Gedanken kaum fassen, der sich mit Brutalität in seine Wirklichkeit drängte. Wie eine lästige Krankheit, die man mit aller Macht zu bekämpfen versuchte und doch nicht wieder loswurde.
»Wer?«, schrie er.
Seine Mutter rührte sich nicht. Er stellte sich vor sie, packte sie an den Schultern und zwang sie, ihn anzusehen. »Wer ist mein Vater?«
Sie schwieg. Eine Träne rann über ihre Wange. »Martin war dir ein guter Vater und wird immer dein Vater bleiben.«
Vater ... ein guter Vater und doch nicht. Hatte Martin je was angedeutet? Hatte Simon was übersehen? Wieso hatten seine Eltern ihm nie etwas erzählt? Seine Gedanken kreisten, sodass ihm schwindelig wurde und die Beine nachzugeben drohten.
»Ihr habt mich angelogen. Mein Leben lang.« Er keuchte.
»Wir haben dich geliebt, Simon.«
Er wandte sich von ihr ab und trat ans Fenster, stützte sich mit den Händen an den kalten Steinen ab. Auf dem Sims stand ein Teller mit ein paar Krümeln und einem Apfelbutzen.
»Martin hat dich so geliebt, dass er dich zum Erben gemacht hat.«
Simons Herz raste. Er schloss die Augen, konzentrierte sich auf die Kälte, die die Steine an seine Hände abgaben. Genau mit dieser Erwartung war er hierhergekommen. Er war der ältere Sohn, ihm stand die Druckerei zu. Was, wenn sein Vater ... Martin von Werden seinen einzigen leiblichen Sohn Nickell zum Erben erkoren hätte? Dann hätte er vor dem Nichts gestanden. Und doch ... In Wahrheit stand das Erbe seinem Bruder zu — diesem Nichtsnutz. Mit einem Ruck drehte er sich um. »Weiß es Nickell?«
Seine Mutter schüttelte den Kopf.
Der Schreinsmeister räusperte sich. »Sollen wir fortfahren?«
Simon schloss die Augen. Wieso hatte sie ihm das nicht schon früher gesagt? Wieso musste sie ihn so demütigen? Er ballte die Hände, hätte am liebsten einen Strohsack verdroschen. Wieder ein Räuspern des alten Mannes. Dies war nicht der richtige Ort für weitere Fragen oder Anschuldigungen. Er öffnete die Augen und schluckte schwer. Er richtete den Stuhl auf und ließ sich darauf nieder. Wie hatte sie ihm das nur antun können? Die, die jeden Verstoß gegen die Gebote Gottes scharf rügte? Dabei war sie selbst kein bisschen besser. Wahrscheinlich fürchtete sie sich wegen ihrer schwerwiegenden Sünde ihr Leben lang vor den Höllenqualen im Fegefeuer.
Der Schreinsmeister blickte ihn mitfühlend, fast entschuldigend an. Dann zog er den Kerzenständer näher heran und hielt das Pergament in den Lichtkegel.
»Meine Ehefrau Irmel von Werden soll das lebenslange Wohnrecht im Haus behalten. Mein jüngerer Sohn Nickell soll seine Gesellenzeit vollständig in der Druckerei ableisten können und den üblichen Lohn erhalten. Anschließend soll ihm wahlweise eine Anfangshilfe von zwanzig Gulden oder eine Weiterbeschäftigung für zehn Jahre zum üblichen Lohn zugestanden werden. Gezeichnet Martin von Werden. Dezember 1517.«
Schon vor vier Monaten hatte sein Vater gewusst, dass sich sein Leben dem Ende zuneigte, und hatte sich nichts anmerken lassen. Simon biss die Zähne aufeinander. Sein ganzes Leben schien sich in eine Lüge zu verwandeln. Vor ihm tat sich ein großes Loch auf, in das er kopfüber hineinzufallen drohte. »Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.« Zählte dieses Gebot Gottes für seine Eltern nicht?
»Ihr hättet Euren zweiten Sohn Nickell mitbringen sollen«, sagte der Schreinsmeister. Sie zuckte stumm mit den Schultern, ohne den Kopf zu heben. »Die Einspruchsfrist für die Übertragung des Hauses beträgt ein Jahr.«
»Aber ...«, begann seine Mutter. Ihre Stimme brach. Sie schluckte und wischte sich über das Gesicht. »Aber im Testament steht doch ...«
» ... dass Euer Mann Euren Bastard zum Erben ernennt, ja. Doch wenn in der vorgegebenen Zeit triftige Gründe dagegen vorgebracht werden, kann die Eintragung im Schreinsbuch nachträglich korrigiert werden.«
Sie nickte beklommen. Simon rutschte auf dem Stuhl hin und her. Sie hatten nicht nur ihn, sondern auch seinen Bruder belogen.
»Dem Testament nach übergeht das Haus ›Zur goldenen Pforte‹ samt Druckerei und allen Gerätschaften an Euch, Simon von Werden. Seid Ihr damit einverstanden?«
Simon fand in dem Gesicht seiner Mutter keine Regung. Was sollte er anderes tun, als den Willen von Martin von Werden zu bestätigen? Sollte er Nickell die Druckerei überlassen und sich selbst bei einem anderen Drucker verdingen? Nickell würde es nicht zustande bringen, die Werkstatt zu fuhren, geschweige denn ein einziges Gebetsbuch allein fertigzustellen. Er würde das Erbe ihres Vaters ruinieren und die Existenzgrundlage ihrer Mutter in Gefahr bringen. Simon blieb keine Wahl.
»Ich nehme das Erbe an.«
Der Schreinsmeister nickte und drückte sich schwerfällig aus dem Stuhl hoch. Er war kleiner, als Simon vermutet hatte. Hinkend trat er zu dem Schrank und zog einen Folianten heraus. Simon hatte Angst, dass der alte Mann unter der schweren Last zusammenbrechen würde, doch mit wenigen Schritten war er am Schreibpult und legte das Buch behutsam darauf ab, als wäre es ein Schatz, der zu zerbrechen drohte. Er setzte sich und blätterte, bis er die richtige Seite gefunden hatte.
»Das Haus ›Zur goldenen Pforte‹«, murmelte er. Er tunkte die Feder in das Tintenfass und notierte Simons Namen in dem Schreinsbuch. Dann begutachtete er sein Werk und nickte zufrieden. »Das könnt Ihr wieder an Euch nehmen.« Er reichte seiner Mutter das Pergament. »Und unterrichtet Euren jüngeren Sohn von dem Inhalt des Testaments. Versündigt Euch nicht gegen Gott, indem Ihr in Eurem Haus eine Lüge leben lasst.« Scharf standen die Worte des alten Mannes im Raum.
Simon wandte sich zum Gehen, doch seine Mutter zögerte. Sie klaubte ein paar Münzen aus der Rocktasche und reichte sie dem Schreinsmeister. Dieser runzelte die Stirn und rührte sich nicht.
»Bitte«, sagte sie flehend. »Erzählt niemandem, was Ihr heute erfahren habt. Das Gerede ...«
Der Schreinsmeister beugte sich vor und nahm die Münzen. »Das Geheimnis Eures Bastardsohns ist bei mir in treuen Händen. Darauf könnt Ihr Euch verlassen.«
Simon zerrte seine Mutter aus dem Amtszimmer. Als sie nach draußen traten, wollte Simon sie für diese Ungeheuerlichkeit rügen. Sie konnten das Geld weitaus besser gebrauchen, als es diesem Gierlappen in den Hals zu werfen. Ob er sich an das Versprechen hielt, war ohnehin zweifelhaft.
Sie griff nach seiner Hand. »Nicht auf der Straße.« Ihre Augen waren rot und wässrig, flehend. Er hatte sie noch nie so niedergeschlagen gesehen, noch nicht einmal auf der Beerdigung seines Vaters. Wie er dieses Wort zu hassen begann. Er wusste noch nicht einmal, wie er Martin von Werden nun nennen sollte. Grob entzog er der Mutter die Hand und rannte die Gasse hinunter. Diesmal achtete er nicht auf seine Schritte und trat immer wieder in schlammige Pfützen, sodass dreckiges Wasser an seinen Beinen hochspritzte. Er ließ sich von seinen Gedanken treiben und erreichte die dicke Eiche an der Ulrepforte. Hier hatten Nickell und er als Kinder gespielt. Als er älter geworden war, hatte er oft ein Buch mitgenommen, sich in den Schatten des Baumes gesetzt und stundenlang gelesen. Simon lehnte sich an den Stamm und ließ sich in die Hocke gleiten. Wäre nur ein Sommertag im letzten Jahr, und hätte er das heutige Wissen damals schon gehabt. Es gäbe so viele Fragen, die er seinem Vater stellen wollte ...
»Braucht Ihr ein Lager für die Nacht?«
Diese Worte rissen Simon aus den Grübeleien. Ein Reiter hatte neben ihm gehalten. Er trug ein Gewand aus feinstem Brokat und ein samtgrünes Barett mit einer Feder. Ein Kaufmann, schätzte Simon. Eine verlockende Vorstellung, heute nicht in der eigenen Bettstatt zu nächtigen und damit seiner Mutter aus dem Weg zu gehen. Doch er war kein Almosenempfänger, wie der Reiter wohl vermuten musste. Simon schüttelte den Kopf.
»Dann gehabt Euch wohl!« Der Reiter stieß dem Pferd die Hacken in die Seite und galoppierte Richtung Stadt.
Die Sonne versank bereits hinter dem Horizont. Als Simon sich erhob, schmerzten seine Beine. Sie waren steif von stundenlanger Bewegungslosigkeit. Seine Hose war mit Schlamm besprenkelt. Kein Wunder, dass der Kaufmann ihn für einen Vagabunden gehalten hatte. Simon machte sich auf den Weg nach Hause. Der Rückweg kam ihm länger und beschwerlicher vor als der Hinweg.
Als die Sonne untergegangen war, begegnete ihm in einer engen Gasse eine zwielichtige Gestalt. Sie ging gebückt, trug einen zerschlissenen Mantel, der mehr an eine alte Pferdedecke erinnerte als an ein Kleidungsstück. Sie hatte die Kapuze so weit ins Gesicht gezogen, dass Simon nicht einmal erkennen konnte, ob es ein Mann oder ein Weib war. Obwohl er am äußersten Rand ging, kam die Gestalt immer näher. Als sie auf gleicher Höhe waren, griff derjenige an Simons Gürtel. Bevor Simon reagieren konnte, hatte die Gestalt ihm den Beutel abgeschnitten und die Flucht ergriffen.
»Halt!«, rief Simon und rannte hinterher. Der Dieb vergrößerte den Abstand, blickte nicht zurück. Simon keuchte, versuchte, schneller zu laufen, doch seine Beine waren schwer. Der Dieb hetzte über den Heumarkt und verschwand zwischen den Häusern. Als Simon in der Gasse ankam, war die Gestalt verschwunden.
»Vermaledeiter Tag!« Simon schnaufte, lehnte sich an die Hauswand, um wieder zu Atem zu kommen. In dem Beutel waren nicht nur ein paar Münzen, sondern auch ein Messer und seine Letter. Der Druckbuchstabe, dessen Druckbild ein großes »S« zeigte, besaß auf der Kegelstärke ein eingraviertes »Simon Zelotes«, der Name des heiligen Simon, des Vetters von Jesus. Diese Letter hatte ihm sein Vater zum zehnten Namenstag des Heiligen geschenkt.
Simons Herz krampfte sich zusammen. Dass ihm am heutigen Tag der Verlust dieses Erinnerungsstücks so zusetzte, wunderte ihn. Und doch war eine geliebte Person von ihm gegangen – auf zweifache Weise. Nicht nur, dass Martin körperlich aus der Welt geschieden war, auch die neue Erkenntnis hatte ihn von Simon entfernt. Wenn er genau darüber nachdachte, war es seine Mutter, der er die Schuld gab. Sein Leben lang hatte sie ihn belogen. Ihm seine wahre Identität vorenthalten.
Wer war er? Diese Frage brannte in seinem Inneren wie ein glühendes Scheit, das einen Berg aus Hölzern in Flammen setzte. Einen Bastard hatte ihn der Schreinsmeister genannt. Stimmte das? Er ballte die Hand. Wie abschätzig er früher über Bastarde geurteilt hatte. Nun begriff er, dass diese Personen am wenigsten für ihr Schicksal konnten. Er lockerte die Hand. Ging er mit seiner Mutter zu hart ins Gericht? Konnte sie nicht ebenso bei der Eheschließung mit Martin Witwe gewesen sein und ein Kind eines verstorbenen Mannes unter dem Herzen getragen haben? Diese Möglichkeit hatte er noch gar nicht in Betracht gezogen. Vielleicht war seine Mutter ehrbarer, als er nach dem Besuch im Schreinsamt angenommen hatte, und er tat ihr unrecht. Dann wäre er kein Bastard. Was hatte seine Mutter für Leid erfahren müssen? Dass sie gelitten haben musste, hatte er in ihren Augen gelesen. Dennoch hätte sie ihm von seiner wahren Identität berichten müssen. Er würde sie zur Rede stellen. Heute noch. Er musste wissen, woher er stammte und wer sein Vater war.
Simon ging strammen Schrittes heim. Als er das Haus betrat, fiel ein Lichtstrahl aus der Druckerei in den Flur. Die Tür war angelehnt. Er schob sie leise auf und trat ein. Nickell zog kräftig an dem Hebel der Druckerpresse.
»Was machst du da?« Simon trat näher heran.
Nickells Gesichtsausdruck war unergründlich. Hatte ihre Mutter schon mit ihm gesprochen? Simon wartete einen Moment, um eine Reaktion des Bruders abzuwarten, die ihm eine Antwort liefern würde.
»Ich arbeite an dem Gebetsbuch, da du es nicht für nötig hältst.«
Simon wollte seinen Bruder maßregeln und ihm vorhalten, wie oft er der Druckerei fernblieb, doch er biss sich auf die Zunge. Meist war er froh, wenn sein Bruder mit Klaus durch die Straßen zog. Wenn Nickell in der Druckerei war, lief meistens etwas schief. Sein Vater hatte Simon zur Nachsicht angehalten und ... Er sah kurz zu Boden. Auch sein Bruder war ein Betrogener.
»Wie weit bist du?«, fragte Simon.
»Die nächsten fünfunddreißig Bogen sind fertig«, sagte Nickell stolz.
Simon trat zur Leine, an der die Blätter zum Trocknen aufgehängt waren. Er hatte für das Gebetsbuch das Quartformat gewählt, bei dem auf jeder Seite eines Bogens vier Seiten gedruckt wurden. Sein Bruder hatte die letzte Seite zu Ende gesetzt, bevor er mit dem Drucken begonnen hatte. Simon las die Zeilen: »Pleni sunt caeli et terra, maiestatis gloria tua.«
»Bei ›gloria‹ und ›tua‹ fehlt jeweils ein ›e‹. Es muss ›gloriae tuae‹ heißen«, sagte Simon zornig.
»Was?«, fragte Nickell und trat zu ihm.
»Du musst sorgfältiger beim Setzen sein, wie oft habe ich dir das schon gesagt!«
Meist hatten sie die Arbeit aufgeteilt: Simon fertigte den Satz, löste ihn nach dem Druck wieder auf und legte die Lettern zurück in die Fächer des Setzkastens, ihr Vater las Korrektur und legte die Papierbogen ein, und Nickell färbte die Lettern, schob den Schlitten unter die Presse und betätigte den Hebel. Doch ihr Vater war immer darauf bedacht gewesen, dass jeder alle Arbeitsschritte beherrschte.
Nickell warf einen Blick auf die Vorlage, dann auf den neu gedruckten Bogen. »Keiner wird den Fehler merken.«
»Die Beginen schon! Sie sind des Lateinischen mächtig«, sagte Simon scharf. Seine Nachsicht flog dahin. Sie würden alle fünfunddreißig Blätter aussortieren und neu drucken müssen. Hoffentlich war noch genug Papier vorrätig. Martin hatte kurz vor dem Tod davon gesprochen, neues Papier erwerben zu müssen. Simon hoffte, dass sie noch Geld besaßen, um den Händler für Nachschub zu bezahlen. Außerdem würde es wiederum Zeit kosten.
Nickell schnaubte. Seine Nasenflügel bebten, und die Augen glänzten vor Wut. Er stand so dicht vor ihm, dass Simon seinen Atem auf dem Gesicht spürte. Er glaubte, Nickell würde ihm einen Fausthieb verpassen. Seitdem er vor zwei Wochen gesehen hatte, wozu sein Bruder fähig war, traute er ihm alles zu. Doch anstatt ihn seine Hand spüren zu lassen, machte Nickell auf dem Absatz kehrt und stürmte aus der Druckerei. Die Tür fiel krachend ins Schloss. Simon ließ sich auf einen Schemel sinken und stützte den Kopf in die Hände. Sein ganzes Leben schien zu zerbrechen.
Kapitel 2
Vögel zwitscherten. Jonata atmete die kühle Morgenluft ein. Sie hatte gestern vergessen, die Fensterläden zu schließen, war ins Bett gekrochen und hatte sich in den Schlaf geweint. Hoffentlich waren ihre Augen nicht zu arg verquollen. Sie schlug die Decken beiseite und stieg aus der Bettstatt. Auf dem Schränkchen war die Zinnschüssel mit frischem Wasser gefüllt. Elisabeth musste bereits in der Kammer gewesen sein. Meistens wurde Jonata von dem morgendlichen Treiben der Mägde wach, doch heute hatte sie geschlafen wie eine Tote. Tot wie ... Ihr Herz krampfte sich zusammen. Mit jeder Faser ihres Leibes vermisste sie Lucas. Erneut stiegen Tränen in ihre Augen. Sie schluckte, spritzte sich Wasser ins Gesicht und hoffte, so die nächtliche Drangsal aus ihren Zügen vertreiben zu können. Sie würde mit neuem Mut den Tag beginnen. Nicht schon wieder wollte sie sich der Trauer hingeben. Sie streifte das graue Kleid über, das sie am Abend achtlos auf den Schemel geworfen hatte, und schlüpfte in die Schuhe.
In der Küche bereiteten Elisabeth und Margret das Frühmahl vor. Kuntz saß auf dem Boden und schob sein Rollpferd vor und zurück. Dabei miaute er leise vor sich hin.
Jonata kniete sich zu ihm und legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Du machst die Geräusche von Pauli nach. Ein Pferd macht so.« Sie imitierte das Wiehern eines Rosses. Kuntz sah sie mit großen Augen an. Wie auf Befehl sprang Pauli durchs Fenster herein, streckte sich und strich miauend um Elisabeths Beine.
»Pauli«, rief Kuntz freudig.
»Willst du ihm die Milch geben?«, fragte Elisabeth.
Kuntz nickte. Sie stellte den Napf auf den Tisch, hob Kuntz auf einen Schemel und schlang den Arm um ihn, damit er nicht herunterfiel. Mit der freien Hand schob sie ihm den Krug hin.
»Aber nicht zu viel.« Elisabeth half dem Kleinen, da das Gefäß zu schwer für ihn war. Als sie die Katzenschüssel auf dem Boden absetzten, stürzte sich Pauli darauf und schleckte gierig. Kuntz bückte sich und streichelte den Kater.
Jonata trat zu Margret und half ihr, den Brotteig zu kneten. Die Magd sah traurig zu ihrem Sohn. »Ob er den Unterschied zwischen einem Pferd und einer Katze jemals begreift?«
»Gewiss wird er das.«
»Ich habe es ihm schon so oft erklärt.«
»Warte ab. Wenn Vater ihn auf Bernando setzt, wird er es verstehen.«
Pauli hatte den Napf leer geleckt und eilte nach draußen. Kuntz folgte ihm. Sein Lachen drang noch in die Küche, als er im Garten war. Das Herz ging Jonata auf, und sie musste lächeln. Kuntz war der Sonnenschein der Familie, kannte keine Sorgen und beschäftigte sich am liebsten mit den Tieren. Wenn es ihr nicht gut ging und sie sein Lachen hörte, konnte sie jeglichen Kummer vergessen.
»Wie glücklich er ist. Das ist das Wichtigste«, sagte sie. Sie hasste es, wenn man ihm nichts zutraute. Er mochte langsamer begreifen als seine Altersgenossen, aber er lernte genauso dazu. Er würde nie lesen oder schreiben lernen, aber das konnten ohnehin die wenigsten. Man musste nur Geduld aufbringen, doch Margret hatte den ganzen Tag im Haus und in der Schenke zu tun. Und ihr Vater sah diesen Makel als Strafe Gottes an, dafür, dass er sich nach dem Tod seiner Frau mit einer Hausmagd vergnügt hatte.
»Wie oft habe ich dir schon gesagt ...?« Elisabeth stieß Jonata sanft zur Seite und nahm ihr den Brotteig aus der Hand. »Wenn dein Vater dich hier erwischt.« Elisabeth sah sie streng an, doch in ihren Augen lag die gewohnte Wärme. Da Jonatas Mutter bei ihrer Geburt gestorben war, hatte die Magd deren Funktion eingenommen und sie mit Liebe großgezogen. Elisabeth war für sie mehr eine Mutter denn eine Magd, auch wenn ihr Vater sie gern daran erinnerte, wer die höhere Stellung in diesem Haus innehatte.
Jonata lächelte. »Du brauchst mich nicht zu verscheuchen, nur weil Vater nicht will, dass ich in der Küche helfe.«
»Er erwartet dich in der Stube«, antwortete Elisabeth und begann, energisch den Brotteig zu bearbeiten.
Jonata wusch sich die Hände und betrat den Wohnraum. Ihr Vater saß am Kopfende des Tisches und starrte in den Becher.
»Vater.«
Er blickte auf. Augenringe zeugten von einer schlaflosen Nacht. In der letzten Woche schien er mehr graue Haare bekommen zu haben als in den zwei Jahren zuvor. Sein braunes Wams war zerknittert, als habe er darin genächtigt. »Setz dich.«
Jonata ließ sich auf einem Schemel nieder und sah ihn erwartungsvoll an. Elisabeth brachte zwei Schüsseln Haferbrei und einen Krug mit Dünnbier für Jonata.
»Wohl bekomm’s.« Ihre Ziehmutter legte ihr kurz eine Hand auf die Schulter. Wusste sie bereits, was Vater ihr zu sagen hatte?
Als sie allein waren, faltete ihr Vater die Hände und sprach ein Dankesgebet. Er nahm einen Löffel von dem Brei.
»Was liegt dir auf der Seele?«, fragte Jonata. Sie vermochte den Brei nicht anzurühren.
Ihr Vater ließ den Löffel sinken und strich sich mit der Hand über das Kinn. »Da ...« Er zögerte. »Da Lucas von uns gegangen ist ...« Er machte wieder eine Pause. Sie empfand den gleichen Schmerz, aber sie hasste es, so auf die Folter gespannt zu werden. Dennoch gab sie ihm die Zeit, die er brauchte. » ... muss jemand nach Bernburg reisen.«
Jonata riss die Augen auf. Dachte er an sie? »Aber ...« »Auch nach Lucas’ Tod muss die Brauerei weiterlaufen.« Ihre Knie wurden weich. Lucas hatte ihr zwar von der Geschäftsreise erzählt, aber sie hatte es völlig vergessen. Sie hatte es gehasst, wenn er weg war, und seine Rückkehr herbeigesehnt. Nun würde er niemals mehr zurückkommen.
»Ich kann die Verhandlungen nicht einem Gesellen oder gar einem Lehrling übertragen. Außerdem brauche ich sie im Brauhaus.«
»Du traust mir die Verhandlungen zu?«
Er nickte. »Du hast bei Ekarius dein Verhandlungsgeschick unter Beweis gestellt.«
Ihr Onkel war hergekommen, um zwei Fässer Bier abzuholen, als keiner der Männer zugegen war. Er hatte die Fässer für den halben Preis mitnehmen wollen und gesagt, das sei mit ihrem Vater abgesprochen gewesen. Sie hatte den vollen Preis verlangt oder ihm angeboten, auf ihren Vater zu warten. Ihr Vater hatte sie später gelobt, denn einen solch hohen Nachlass hätte er seinem Bruder nicht gewährt.
»Ich werde einen Brief an Hannes von Wieskau aufsetzen.«
Jonata nickte. Nur auf ihr Verhandlungsgeschick wollte sich ihr Vater also nicht verlassen.
»Steffan wird dich begleiten.« Er war der Knecht, der sich in erster Linie um die zwei Pferde kümmerte und alles erledigte, was starke Arme erforderte. »Außerdem wird Brid dir auf der Reise Gesellschaft leisten.«
»Brid? Willst du etwa Margret die Arbeit in der Schenke allein aufbürden?« Das würde bedeuten, dass sie sich noch weniger um Kuntz kümmern konnte.
»Ich gedenke, eine neue Magd ins Haus zu holen.«
»Eine neue .. .«Jonata schluckte. So lange hatte sich ihr Vater gegen eine neue Arbeitskraft gesträubt. »Hast du schon jemanden im Sinn?«
Ihr Vater schüttelte den Kopf. »Ich werde Ekarius fragen. Er kommt viel rum und weiß, wer sich als Magd verdingen will.«
Den Rat ihres Onkels als Bader nahmen meistens die ärmlichen Familien in Anspruch, weil sie sich einen Medicus nicht leisten konnten. Ekarius war ein Schwätzer und Wichtigtuer. Sie vertraute ihm nicht, doch diese Entscheidung oblag allein ihrem Vater.
»Ihr werdet das Fuhrwerk nehmen. Drei Fässer Bier sollen als Geschenk an von Wieskau gehen. Mal sehen, ob ihn das an die alte Handelsvereinbarung erinnert.«
Von Wieskau weigerte sich, Hopfen an sie zu verkaufen.
»Ich könnte versuchen, mit dem Älteren von Wieskau zu sprechen«, schlug sie vor. Ihr Vater hatte sich letztens mit Lucas beim Nachtmahl über ihn unterhalten. Sie hatte mitbekommen, dass er krank geworden war, aber nicht weiter zugehört. Hätte sie nur den Tischgesprächen öfter aufmerksam gelauscht. Dabei hätte sie viel gelernt.
»Damit verschwendest du deine Zeit. Er soll seinen Verstand verloren haben, liegt im Bett und schwafelt dummes Zeug. Morgen werdet ihr aufbrechen.«
»So früh?« Ihr Herz klopfte. Das würde ihr keine Zeit geben, sich mit dem Gedanken an diese Reise anzufreunden.
»Hannes von Wieskau hatte bereits gestern mit deinem Bruder gerechnet. Ich will ihn nicht zu lange warten lassen.«
Jonata war noch nie aus Köln fort gewesen, und nun sollte sie nach Sachsen reisen. Sie wusste noch nicht einmal, wie lange die Reise dauern würde, nur dass sie mehrere Tage unterwegs sein würden. Sie wollte ihren Vater danach fragen, als er entschlossen nach dem Löffel griff. »Nun iss, mein Kind!«
Sie aßen schweigend. Der klebrige Brei blieb ihr im Hals stecken. Sie spülte mit Bier nach. Lucas hätte mit ihnen gegessen, Witze gerissen, vielleicht von Adelhaid gesprochen. Ihr Vater stand auf und riss sie aus den Gedanken. Er blieb neben ihr stehen, sah sie an, als wollte er etwas sagen, doch dann verschwand er ohne ein Wort nach draußen.
Jonata brachte das Geschirr in die Küche. Margret las Linsen aus, und Elisabeth schürte den Ofen, um das Brot zu backen. Sie hängte den Schürhaken an den Ständer und kam auf sie zu. »Wohin schickt dich dein Vater?«
»Er hat dir schon von der Reise erzählt?«
»Er deutete an, dass du morgen für eine Weile fortgehen wirst.«
»Nach Bernburg zum Hopfenanbauer. Ich soll ihn an die Handelsvereinbarungen erinnern.«
»Dein Vater sollte lieber den Hopfen aus dem heimischen Stommeln oder Kerpen beziehen, anstatt dich auf eine so lange Reise zu schicken.«
Jonata legte die Finger auf die Lippen und sah sich um. »Du solltest nicht so über Vater sprechen.«
»Wenn es doch wahr ist! Eine solche Reise ist nichts für ein junges Ding, wie du es bist.«
Jonata drückte die Schultern durch. Auch wenn sie sich selbst noch nicht mit dem Gedanken angefreundet hatte, wollte sie sich beweisen. »Vater hat mich für die Verhandlungen ausgewählt. Ich werde ihn nicht enttäuschen. Außerdem begleiten mich Steffan und Brid.«
»Bei allen Heiligen, was denkt er sich?« Sie verdrehte die Augen.
Jonata schielte zur Tür. Ihr Vater würde ihre Ziehmutter für die frechen Worte rügen, doch es war niemand zu sehen.
»Will er für die Zeit die Schenke schließen?«, führ Elisabeth fort.
Jonata hatte keine Lust, weiterzudiskutieren und ihr auch noch zu eröffnen, dass eine neue Magd ins Haus kommen sollte. Elisabeth würde lamentieren, dass sie dem Mädchen das Hühnerrupfen, Linsenauslesen und Fegen von Grund auf beibringen musste. Jonata ließ sie stehen und ging in den Vorratskeller. Sie nahm den Korb und füllte ihn mit Brot, Käse, Äpfeln, gepökeltem Hering und ein paar gedörrten Kirschen. Als Schritte auf der Treppe ertönten, drehte sie sich um.
»Was machst ...?« Elisabeth starrte auf den gefüllten Korb. »Du willst zum Waisenhaus?«
»Die Kinder haben mich fünf Tage nicht gesehen.«
»Du solltest dich lieber auf die Reise vorbereiten.«
»Mir wird es an nichts mangeln«, sagte Jonata und drückte Elisabeth an sich. Der vertraute Geruch nach Lavendel stieg ihr in die Nase. »Ich weiß, du wirst uns mit allem Nötigen ausstatten.« Sie löste sich von ihrer Ziehmutter.
Diese schüttelte den Kopf und lächelte. »Unverbesserlich bist du.«
Als Jonata das Waisenhaus betrat, wurde sie direkt von einer Schar Kinder umzingelt. Sie beugte sich hinunter, strich einem Jungen über das strubbelige Haar und kniff einem anderen liebevoll in die Wange. Der Junge quiekte vergnügt, lief hinter den Türrahmen, versteckte sich und lugte hervor. Agnes kam herbeigeeilt, drückte sie und nahm ihr den Korb ab, bevor die Sprösslinge etwas daraus stibitzen konnten.
»Dich schickt der Himmel«, sagte sie. Sie war ausgemergelt und trug ein zerschlissenes Kleid. Ihre braunen Haare hatte sie nachlässig unter die Haube geschoben. Alles Geld gab sie lieber für die Kinder aus, als sich selbst mit neuer Kleidung auszustatten.
»War die Gemeinde diese Woche wieder kniepig?«, fragte Jonata.
»Lieber schmeißen sie ihre Münzen dem Ablassprediger in den Rachen, als den Klingelbeutel zu füllen.« Agnes zog die Brauen über den müden Augen zusammen. Jeden zweiten Sonntag bekam das Waisenhaus die Kollekte von Sankt Maria Ablass. Das Geld reichte kaum, alle zweiundvierzig Kinder zu ernähren, geschweige denn neue Kleidung oder neues Geschirr zu kaufen, wenn etwas zu Bruch ging.
»Mach dem Priester klar, dass du die Kollekte von drei Sonntagen im Monat benötigst.«
»Der denkt doch nur an sein eigenes Wohl.« Agnes imitierte den watschelnden Gang des Priesters. Die Kinder lachten. »Wenn ich so beleibt wäre, könnte ich ein halbes Jahr auf Früh- und Nachtmahl verzichten.« Agnes prustete los.
Jonata schmunzelte. »Wenigstens ist dir das Lachen nicht vergangen.«
Agnes reichte ihr die Pergamentrolle aus dem Korb. »Ich bringe die Lebensmittel in die Küche.«
Jonata nahm die Rolle und hielt sie hoch, sodass die Kinder sie nicht erreichen konnten. »Soll ich euch etwas vorlesen?«
Die Kinder jubelten. Ein Junge sprang hoch und versuchte, nach dem Pergament zu greifen. Jonata hatte ihn noch nie gesehen, er musste in den letzten Tagen gekommen sein. In seiner Oberlippe klaffte eine Spalte, die bis zur Nase reichte, sodass man die oberen Zähne sah. »Wie heißt du?« Sie beugte sich zu ihm hinunter.
»Wilheln«, sagte er. Das »m« vermochte er nicht auszusprechen. Sie strich ihm über die braunen Locken.
»Ich lese euch die Vita der heiligen Ursula vor. Hast du schon einmal von ihr gehört?«
Er schüttelte heftig den Kopf.
»Kommt, ab in die Stube.«
Mit Geschrei und wildem Gerede stürmten die Kinder los, kabbelten sich um die besten Plätze. Die Großen drängten sich auf den Bänken, während sich die Kleinen auf dem Lehmboden niederließen. Wilhelm hatte sich auf die Bank gesetzt und wurde von einem anderen Jungen runtergeschubst. Der Neuling warf dem Älteren einen bösen Blick zu, ließ sich mit verschränkten Armen auf dem Schemel nieder. Jonata lachte und strich Wilhelm über den Schopf.
»Das ist mein Platz«, sagte sie lächelnd und zeigte auf den Boden. »Setz dich zu den anderen.«