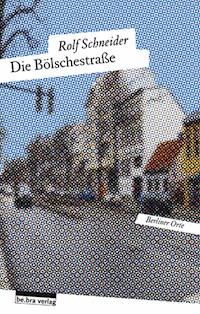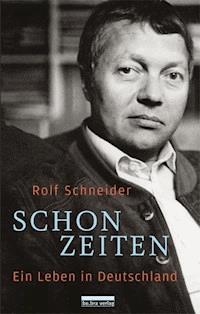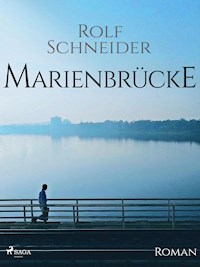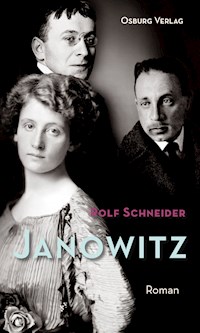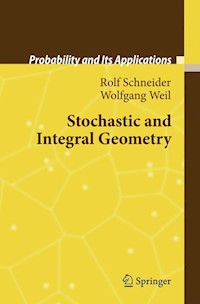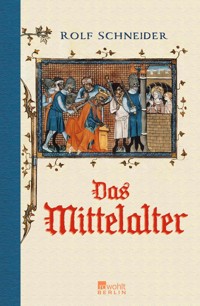4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Über das Buch Gittie hat die Nase gestrichen voll. Seit Ihre Großmutter gestorben ist und ihre Eltern in einen Plattenbau nach Berlin-Mitte gezogen sind, hält sie es kaum noch aus. Als sie keinen Abiturplatz in der Oberschule bekommt, packt sie ihre Sachen und macht sich auf den Weg nach Jarosław, wo ihre Oma Hela vor langer Zeit gelebt hat. Gittie mochte den Singsang in ihrer Stimme, sie lauschte gerne den Geschichten ihrer Großmutter, sie liebte die von ihr gekochten Speisen. Aber wo liegt Jarosław? Gittie geht zum Bahnhof Friedrichstraße, nimmt eine S-Bahn nach Erkner und fährt mit dem Zug in Richtung Frankfurt (Oder). Auf ihrem Weg trifft Gittie Jan, einen polnischen Studenten, der Deutsch in der Art von Oma Hela spricht, der Backsteingotik studiert und von dem sie etwas über Polen und die Liebe lernt. Ein Stück quicklebendiger Literaturgeschichte und ein authentischer Roman aus der Zeit vor der Wende, der die Protagonistin in lakonisch-schnoddrigem Ton ihre Reise gen Osten und eine kleine Liebesgeschichte erzählen lässt. »Die Reise nach Jarosław« ruft eine Vergangenheit auf, die viele nicht oder nicht mehr kennen, an die zu erinnern sich gleichwohl empfiehlt, da man wissen sollte, woher man kommt. Der erstmals 1974 erschiene Roman über eine jugendliche Aussteigerin war in der DDR ein Bestseller und erschien außer in der Bunderepublik in Italien, Frankreich, Dänemark, Tschechien, Ungarn und Polen. In der DDR erregte er heftige Diskussionen. Schneider gehörte 1976 zu den Initiatoren der Proteste gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns und wurde 1979 aus dem DDR-Schriftstellerverband ausgeschlossen. »Werther und der Taugenichts, Tonio Kröger oder der Fänger im Roggen – bis jetzt waren die Stürmer und Dränger, die Außenseiter und Ausreißer fast immer junge Männer. Jünglinge flippten mit der Postkutsche nach Italien, pubertierende Männer flohen in Rauschzustände, männliche Jugendliche unternahmen den Revolver-Trip ins Jenseits, weil sie den Schmerz darüber nicht verwinden konnten, dass die Welt nicht so gut und nicht so schön ist, wie sie sein sollte. Im Roman des Ost-Berliner Autors Rolf Schneider, 42, ist es nun eine junge Frau, die dieses Leiden an der Welt in Rebellion umsetzt. Das ist bemerkenswert. « DER SPIEGEL Über den Autor Rolf Schneider wurde 1932 in Chemnitz geboren, studierte Germanistik, Anglistik und Romanistik in Halle-Wittenberg und ist seit 1958 freier Schriftsteller.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Über das Buch
Gittie hat die Nase gestrichen voll. Seit ihre Großmutter gestorben ist und ihre Eltern in einen Plattenbau nach Berlin-Mitte gezogen sind, hält sie es kaum noch aus. Als sie keinen Abiturplatz an der Oberschule bekommt, packt sie ihre Sachen und macht sich auf den Weg nach Jarosław, wo ihre Oma Hela vor langer Zeit gelebt hat. Gittie mochte den Singsang in ihrer Stimme, sie lauschte gern den Geschichten ihrer Großmutter, sie liebte die von ihr gekochten Speisen. Aber wo liegt Jarosław? Gittie geht zum Bahnhof Friedrichstraße, nimmt eine S-Bahn nach Erkner und fährt mit dem Zug in Richtung Frankfurt (Oder). Auf ihrem Weg trifft Gittie Jan, einen polnischen Studenten, der Deutsch in der Art von Oma Hela spricht, der Backsteingotik studiert und von dem sie etwas über Polen und die Liebe lernt.
Ein Stück quicklebendige Literaturgeschichte und ein authentischer Roman aus der Zeit vor der Wende, der die Protagonistin in lakonisch-schnoddrigem Ton ihre Reise gen Osten und eine kleine Liebesgeschichte erzählen lässt. »Die Reise nach Jarosław« ruft eine Vergangenheit auf, die viele nicht oder nicht mehr kennen, an die zu erinnern sich gleichwohl empfiehlt, da man wissen sollte, woher man kommt.
Der erstmals 1974 erschienene Roman über eine jugendliche Aussteigerin war in der DDR ein Bestseller und erschien außer in der Bunderepublik in Italien, Frankreich, Dänemark, Tschechien, Ungarn und Polen. In der DDR erregte er heftige Diskussionen. Schneider gehörte 1976 zu den Initiatoren der Proteste gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns und wurde 1979 aus dem DDR-Schriftstellerverband ausgeschlossen.
»Werther und der Taugenichts, Tonio Kröger oder der Fänger im Roggen – bis jetzt waren die Stürmer und Dränger, die Außenseiter und Ausreißer fast immer junge Männer. Jünglinge flippten mit der Postkutsche nach Italien, pubertierende Männer flohen in Rauschzustände, männliche Jugendliche unternahmen den Revolver-Trip ins Jenseits, weil sie den Schmerz darüber nicht verwinden konnten, dass die Welt nicht so gut und nicht so schön ist, wie sie sein sollte. Im Roman des Ost-Berliner Autors Rolf Schneider, 42, ist es nun eine junge Frau, die dieses Leiden an der Welt in Rebellion umsetzt. Das ist bemerkenswert.« DER SPIEGEL
»Ich war schon Feminist, als nur Simone de Beauvoir und ich wussten, was das ist.« Rolf Schneider
Über den Autor
Rolf Schneider wurde 1932 in Chemnitz geboren, studierte Germanistik, Anglistik und Romanistik in Halle-Wittenberg und ist seit 1958 freier Schriftsteller. Nach Protesten gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns wurden seine Publikationsmöglichkeiten stark eingeschränkt, 1979 folgte der Ausschluss aus dem DDR-Schriftstellerverband.
Rolf Schneider verfasste zahlreiche Romane, Bühnenstücke, Essays und Sachbücher, die in über 20 Sprachen übersetzt wurden. Zuletzt erschienen u. a. der Roman »Marienbrücke« (2009) und die Sachbücher »Das Mittelalter« (2010) sowie die Biografie »Schonzeiten. Ein Leben in Deutschland« (2013). Rolf Schneider wurde ausgezeichnet mit dem Lessing-Preis der DDR, dem Hörspielpreis der Kriegsblinden sowie mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse. Er lebt heute als Autor und Publizist in Schöneiche bei Berlin.
Rolf Schneider
Die Reise nach Jarosław
Roman
Mit einem Vorwort des Autors
CulturBooks Verlag
www.culturbooks.de
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2014
www.culturbooks.de
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Deutsche Printausgabe: © Hinstorff Verlag Rostock 1974/Hermann Luchterhand Verlag 1975
Umschlaggestaltung: Magdalena Gadaj
Erscheinungsdatum: 01.08.2014
ISBN: 978-3-944818-55-9
Vorwort
»Dann setzte ich mich auf eine Bank. Ich konnte kaum atmen und schwitzte blödsinnig. Dort blieb ich ungefähr eine Stunde lang sitzen, glaube ich. Schließlich beschloss ich, wirklich wegzugehen. Ich wollte nie mehr nach Hause und nie mehr in eine Schule gehen.«
Der dies so von sich sagt, heißt Holden Caulfield. Er ist siebzehn Jahre alt, hat sich mit der Erwachsenenwelt überworfen, will sie fliehen und streunt eine Nacht lang durch die Straßen von New York City. Erfunden hat ihn 1951 der US-amerikanische Schriftsteller Jerome D. Salinger mit seinem Buch »Der Fänger im Roggen«, das ein Welterfolg wurde und ein Welterfolg blieb. Holden Caulfield verkörpert jene jugendliche Mischung aus Zivilisationsflüchtling und Rebell, für die wir im Deutschen den Begriff Aussteiger haben.
Die Nachhaltigkeit von Salingers Buch gründet darauf, dass die darin beschriebenen Konflikte, Gefühle und Reaktionen immer wiederkehren, von einer Generation zur nächsten, Fluchtorte mögen eine Hippie-Kommune sein oder Poona oder die Guerilla in Lateinamerika oder Drogen. Die zwei letzten können tödlich enden. Dies ist eine der Perspektiven für Aussteiger. Holden Caulfield kehrt in die Welt, die er geflohen ist, wieder zurück. Dies ist eine andere Perspektive.
Holden Caulfield hat viele Vorgänger. Er selbst erwähnt David Copperfield von Charles Dickens, also einen Briten. Ebenso hätte er, im eigenen Land zu bleiben, Mark Twains Tom Sawyer und Huckleberry Finn nennen können. Die Figur des Aussteigers kommt in fast allen großen Literaturen vor, in der deutschen etwa mit Eichendorffs »Taugenichts«, mit Georg Büchners »Lenz« und, nicht zu vergessen, mit Goethes »Werther«. Die zwei letzten enden tragisch: Den Zusammenstoß mit ihrer Umwelt überstehen sie nicht.
Holden Caulfields bleibender Erfolg hat unter anderem damit zu tun, dass die Umwelt, auf die er stößt, modern und wiedererkennbar die unsere ist. Diese Umwelt wird kritisch gesehen. Sozialkritik, auch literarische, kann zum Politikum werden. In der DDR des Jahres 1974 war sie das.
Der ostdeutsche Teilstaat, damals fünfundzwanzig Jahre alt, befand sich in einer Phase, da er sich etwas liberal zu gerieren gedachte. Der erste Mann im Land hatte den Künsten ein paar Freiheiten eingeräumt, die sie auch nutzten. Das politische Establishment zeigte sich beunruhigt und würde der Sache bald ein Ende bereiten.
Die literarischen Aussteiger jenes Jahres hießen Edgar Wibeau und Gittie Marczinkowski. Beide stießen sich an den Zuständen der DDR. Wibeau floh in eine Gartenkolonie, in die Liebe und starb bei einer technischen Bastelei. Gittie floh ins liberalere Polen, in die Liebe und kehrte wieder zurück, um sich in die vorgegebenen Umstände einzupassen. Die Erfinder beider Figuren kannten einander persönlich und waren Autoren im gleichen Rostocker Verlag.
Ihre Texte schrieben sie, ohne voneinander zu wissen. Wibeau trat etwas früher an die Öffentlichkeit, da sein Erfinder, Ulrich Plenzdorf, den Text vorab in einer literarischen Zeitschrift drucken ließ, das Echo war gleich außerordentlich. Ich, der ich noch an Gitties Prosa saß, wollte, als erste Reaktion, mein Vorhaben aufgeben. Ich habe es nicht getan. Als kleine Reverenz ließ ich Edgar Wibeau in meinem Buche auftreten: Der Jeansträger namens Ed, dem Gittie auf dem nächtlichen Bahnhof Friedrichstraße begegnet und den man heute nicht ohne weiteres identifizieren wird, ist Wibeau.
Dafür, den Text weiterzuschreiben und zu veröffentlichen, gab es zweierlei Grund.
Ich wollte meinen Enthusiasmus für Polen mitteilen. Den hatte ich immer schon und habe ihn bis heute. Dann noch: Die bisherigen Aussteiger in der schönen Literatur waren durchweg männlichen Geschlechts. Gittie war eine junge Frau. Ich hatte (und habe) in meinen literarischen Arbeiten seit jeher eine Präferenz für weibliche Zentralfiguren, erfundene oder historische wie George Sand, Maria Szymanowska und Jeanne d’Arc. Über zwei ausschließlich Frauenrollen enthaltende Einakter meiner Feder ließ ich, das ist lange her, in einer Vorbemerkung wissen, ich sei schon ein Feminist gewesen zu Zeiten, als bloß Simone de Beauvoir und ich wussten, was das ist.
Mittlerweile schreiben wir das Jahr 2014. Den Staat DDR gibt es nicht mehr. Untergegangen ist er auch infolge von Anregungen und Anstößen aus dem benachbarten Polen. Eine Sehnsuchtsregion alternativen Lebens ist das Land östlich der Oder geblieben, der Ansturm der internationalen Intellektuellen-Boheme auf Krakau belegt es. Gitties Schwärmerei für diese Stadt hat von ihrer Gültigkeit nichts eingebüßt.
Ostdeutschland nun?
Mit der alten staatlichen Ordnung ist vieles verschwunden: Institutionen, Bezeichnungen, Personen, Gebräuche, Emotionen. »Die Reise nach Jarosław« ruft eine Vergangenheit auf, die viele nicht oder nicht mehr kennen, an die zu erinnern sich gleichwohl empfiehlt, da man vielleicht wissen sollte, woher man kommt. Gegenwärtig erleben wir deswegen eine förmliche DDR-Retro-Konjunktur. Ein authentisches Zeugnis jener Zeit sollte darin seinen Platz haben.
Die westdeutsche Ausgabe meines Buches von 1974 schloss mit einem Glossar, das allerlei DDR-Bezeichnungen erklären musste. Hier wurde es in Teilen übernommen und ergänzt.
»Ich weiß eigentlich nur, dass mir alle irgendwie fehlen, von denen ich erzählt habe«, sagt Haulden Caulfield. »Komisch. Man sollte nie jemand etwas erzählen. Sonst fangen sie alle an, einem zu fehlen.«
Ich weiß von ein paar Leuten, dass ihnen Gittie Marczinkowski fehlt. Deshalb soll sie im Folgenden wieder auftreten.
Rolf Schneider
die trockene wolke pocht an den leeren himmel
ich kehre morgen zurück übermorgen auf jeden fall
man wird sich einstellen müssen aufs neue mit dem gesicht
Zbigniew Herbert
1
Ich heiße Gittie und wiege einundneunzig Pfund. Das ist nicht zu wenig bei hundertneunundfünfzig Zentimeter Körperlänge, aber die Wahrheit ist, dass die Medizinmänner ihre Visagen in Falten legen, wenn sie mich abklopfen. Ich sage ihnen dann: Mann, ich fühle mich erstklassig, Tatsache. Die gruppieren daraufhin ihre Falten um und grinsen. Sie grinsen ausgesprochen affig, weil sie sowieso alles besser wissen.
Irgendwie habe ich es ihnen auch zu verdanken, dass ich beinahe acht war, als ich auf die Penne kam, und der Rest der Verantwortung ist reine Kalendersache. Ich bin Ende Juni geboren, und der Stichtag für die Einschulung ist, glaube ich, Ende Mai. Demnach hätte ich das erste Mal meinen Fuß in die Penne setzen müssen, als ich sieben war, aber dazu kam es nicht. Ich kriegte in diesem Jahr einen ganzen Haufen Krankheiten. Angina, Scharlach, Masern, noch mal Angina und Röteln. Ich war sieben Monate hintereinander buchstäblich ununterbrochen krank, und als ich es nicht mehr war, sah ich so furchtbar aus, dass der Schularzt die Hände über dem Kopf zusammenschlug, als er mich sah. Er stellte mich schleunigst noch ein Jahr von der Schule zurück. Er verschrieb mir ungefähr dreihundert Stärkungsmittel, die alle überhaupt nichts halfen, und jedenfalls war ich acht, als. ich auf die Penne kam, Vieles wäre wahrscheinlich anders gekommen, wenn ich heute nicht achtzehn wäre, sondern beispielsweise zwei Jahre jünger. Dabei bereue ich überhaupt nichts: Ich stelle das alles bloß fest, sachlich.
Ich habe einen Personalausweis, mittelblau, mit Folie. Der Pass enthält eine Menge Angaben über mich, zum Beispiel dass ich in Berlin geboren bin und wann. Berlin ist groß, und kein Mensch kann ernsthaft behaupten, dass Grünau und Weißensee dieselbe Stadt sind, nicht mal dieselbe Welt. Ich persönlich bin Prenzlauer Berg aufgewachsen. Ich bin großzügig und schlag bisschen von Berlin-Mitte dazu, sagen wir: alles zwischen Alexanderplatz und Weidendammbrücke; mir reicht das als Berlin, und ich bin sowieso der Meinung, die Hauptstraße von Mitteleuropa ist die Schönhauser Allee.
Ich komme hier nicht drum herum, fünf Worte über die Greise zu sagen. Mein Greis ist ein dürrer Typ mit Halbglatze und vierzig. Der Greis arbeitet irgendwas mit Biologie und Chemie und Pillen und macht das in Buch in irgendeinem Riesenstall, wo sie zweihundert oder zwei Millionen Eierköpfe eingesperrt haben, damit sie was mit Biologie und Chemie und Pillen machen. Abends ist der Greis still. Früher interessierte er sich für Fußball, aber seit ein paar Jahren ist er Sammler. Er hat ungefähr drei Dutzend Modelllokomotiven. Diesel und Dampf und elektrisch und alle möglichen Baujahre und Firmen. Aber Lokomotiven und eben auch Modelllokomotiven gibt es längst nicht so oft wie zum Beispiel Geldstücke, und deswegen sammelt der Greis zusätzlich Münzen. Zehn-Mark-Baden von achtzehnhundertzweiundsiebzig und Zwei-Mark-Lippe von neunzehnhundertsechs und so. Die Münzen hat er in einem kleinen dunkelbraunen Rollschrank mit lauter flachen Schüben. Oben auf dem Rollschrank stehen die Modelllokomotiven. Bis vor einem Jahr hätte ich gesagt, der Greis ist nicht umwerfend, aber er ist in Ordnung, Tatsache. Wahrscheinlich hätte ich vor einem Jahr auch dasselbe von der Greisin gesagt, und jedenfalls muss ich feststellen, dass sie ungeheuer rumort. Mann, die schafft sich! Zum Beispiel, die Greisin hält Vorträge, und gleichzeitig besucht sie Vorträge. Manchmal frage ich mich, warum sie Vorträge besucht, wenn sie selber welche hält. Die Greisin ist vierzig wie der Greis und will irgendeine Prüfung machen. Ihr Job ist Ingenieur. Irgendwas mit Kältetechnik. Ich kann mir nicht viel darunter vorstellen. Ich verstehe nichts davon. Interessiert mich auch nicht, sachlich.
Die Greisin behauptet, sie wäre als junges Mädchen so spillerig gewesen wie ich. Keine Ahnung, was sie mit solchen Sprüchen bezweckt. Mich schockt sie nicht. Vielleicht will sie sich selber trösten. Die Greisin hat Übergewicht und geht jede Woche für zehn Em in die Sauna am Alexanderplatz. Sie ist hinterher immer leicht violett um die Kiemen. Ich finde nicht, dass sich das Schwitzen bei ihr lohnt.
Ich war nie dagegen, dass die Greise bei jedem Anlass, der sich ergibt, Fahnen vors Fenster hängen, aber ich war schon lange dagegen, dass ihr Lieblingstyp im Fernsehen Lembke heißt, ein bebrillter Penner, der vier andere Penner raten lässt, was noch ein anderer Penner für einen Beruf hat, Knopfmacher zum Beispiel oder Rollmopsdreherin.
Ich kann nicht sagen, dass mich die Greise viel gestört haben, und ich kann nicht sagen, dass ich die Greise viel gestört habe, dazu war einfach zu wenig Gelegenheit, jedenfalls ungefähr siebzehn Jahre, und von denen gab es vierzehn Jahre schließlich Oma Hela.
2
Für Oma Hela muss ich ganz weit ausholen. Für Oma Hela muss ich mich ungeheuer anstrengen, damit ich Sätze finde, die ich sonst nicht brauche, weil es so was wie Oma Hela nicht noch mal gibt.
Ich fange damit an, dass ich sage, Oma Hela kam aus Jarosław. Auf Landkarten ist Jarosław eine kleine Stadt in Ostgalizien, auf der Strecke zwischen Krakau und Przemyśl. Für mich liegt Jarosław erst mal im Kehlkopf und in den Händen von Oma Hela.
Ich muss dazu sagen, dass ich mit vollem Namen Brigitte Marczinkowski heiße. Ich heiße Marczinkowski, weil mein Greis Marczinkowski. heißt. Oma Hela hieß mit Vornamen Halina und kam, wie gesagt, aus Jarosław. Jetzt wird ziemlich jeder kommen und sagen, Oma Hela aus Jarosław ist die Mutter von Günter Marczinkowski, meinem Greis. Das stimmt aber nicht, weil Günter Marczinkowski aus Döbeln in Sachsen kommt. Er redet auch so, bisschen. Oma Hela hieß mit Nachnamen Schroeter, wie die Greisin, ehe die Marczinkowski hieß. Oma Hela kam aus Jarosław, und also kam auch die Greisin aus Jarosław, so ist das.
Ich bin Prenzlauer Berg aufgewachsen und rede, wie die Leute Prenzlauer Berg reden. Bei mir endet zirka jedes dritte Wort auf a. Die Greisin rollt das r mit der Zunge, und wer scharfe Ohren hat, merkt hundertprozentig, dass die Greisin nicht aus Prenzlauer Berg kommt. Ich spreche gar nicht von Döbeln in Sachsen. Und wenn schon die Greisin nicht redet, wie die Leute Prenzlauer Berg oder Döbeln in Sachsen reden, so ist das noch gar nichts gegen die Art, wie Oma Hela geredet hat. Mann, das war Sprache! Das war nicht Sprache, das war Musik. Das war nicht Musik, das war großer Auftritt. So wie, wenn der berühmte Rocksänger Jimi Hendrix seine Gitarre röhren lässt in seinen größten Momenten, und falls ich mich damit nicht deutlich mache: Oma Hela hat genau so geredet, wie eben Leute aus Jarosław reden. Wenn die Greisin heute behauptet, sie hätte früher ausgesehen, wie ich inzwischen aussehe, was ich für eine glatte Lüge halte, so behaupte ich dagegen, dass ich aussehe, wie Oma Hela ausgesehen hat, ganz früher und ganz zuletzt. Oma Hela war keine einsneunundfünfzig groß, höchstens einssiebenundfünfzig. Oma Hela hatte schwarze Augen und rotblonde Haare, das wirkte ungeheuer. Oma Hela hatte weiße Zähne, die waren garantiert echt, und auch ihre Haare waren echt, ich meine die Farbe; Oma Hela hätte lieber sonst was mit dem Geld gemacht, als Frisörfarbe dafür zu kaufen, wie es beispielsweise die Greisin macht. Oma Hela war mager und ungeheuer kregel.
Auf die Gefahr, dass mir dabei der Saft aus allen Poren läuft, muss ich daran denken, wie ich mit Oma Hela in der Küche hocke. Ich meine jetzt die Küche in unserer alten Wohnung. Die alte Wohnung lag direkt an der Schönhauser. Die Wohnung war ziemlich dunkel. Vom Küchenfenster konnte ich links runter spucken Richtung Magistratsschirm. In der Küche stand ein altes Sofa. In dem Sofa waren ein paar Federn kaputt. Wenn ich mich auf das Sofa setzte, knackten die kaputten Federn. Außer mir setzte sich niemand auf das Sofa, höchstens noch Oma Hela. Die Greise wollten, dass das Sofa aus der Wohnung verschwindet, zum Trödelhändler oder auf den Müll. Oma Hela sagte, das Sofa stammt aus Jarosław. Ich habe das Sofa verteidigt, und Oma Hela hat. Die Greise waren sowieso selten in der Küche. Solange Oma Hela da war, wurde gemacht, was Oma Hela wollte, die Greise hatten nicht viel zu sagen.
Ich hockte auf, dem Sofa, wenn Oma Hela Bigos kochte. Bigos ist ungefähr dasselbe wie Irish Stew, wenn bekannt sein sollte, was Irish Stew ist, und jedenfalls ist Bigos eine ziemlich schwere Sache. Ich habe lange Zeit keine schweren Sachen im Magen behalten. Ich gab sie immer gleich von mir. Ziemlich ekelhaft, aber Tatsache. War vermutlich der Grund, warum ich so spillerig war. Die Greisin hat mich mit allen möglichen Plempen gefüttert, mal süß, mal pfeffrig. Schmeckte alles ziemlich ekelhaft, aber blieb drin. Ich war bloß weiter spillerig, weil einer von Plempen eben nichts anderes werden kann als spillerig. Oma Hela hat mir Bigos gekocht, und als der wieder hochkommen wollte, hat sie geredet und Geschichten erzählt von Jarosław und ganz früher und Galizien, und da ist der Bigos drinnen geblieben; und sie hat noch eine Menge mehr gekocht, alles schwere Sachen, und die sind auch drin geblieben, und dem verdanke ich, dass ich einsneunundfünfzig geworden bin, zwei Zentimeter mehr als Oma Hela selber.
Oma Hela konnte auch singen. Ehrlich, es klang ungeheuer, wenn Oma Hela sang, und drei mittlere Kreissägen sind eine Art Caruso gegen die Art, wie Oma Hela sang. Und was sie sang, war Tatsache meistens Latein. Oma Hela sang nämlich am liebsten Kirchenlieder. Oma Hela war katholisch und fromm. Oma Hela sang ungeheuer, von Donanobispacem und so, während sie Bigos kochte, und durchs offene Fenster kam der Autolärm von der Schönhauser, ich hockte auf dem Sofa, und die kaputten Federn in dem Sofa knackten; und insgesamt muss gesagt werden, dass vielleicht gut war, wenn niemand Oma Helas Gesang hören konnte bei dem Autolärm von der Schönhauser, außer mir.
Oma Hela ging jeden Sonntag zur ersten Messe in die Sankt-Gertruden-Kirche in der Greifswalder Straße. Ich will nicht nachrechnen, wie viel Zentner Wachs die Kerzen ausmachen, die sie allmählich verkokelt hat. Dabei war Oma Hela geizig. Im Gemüseladen hat sie aus Prinzip um fünf Pfennige gehandelt, und sie hat das Grünzeug erst genommen, wenn ihr der Gemüsefritze die fünf Pfennige nachgelassen hat. Wahrscheinlich dachte er, die Alte spinnt. Oma Hela war aber dann auch wieder nicht geizig, denn bei dem Leierkastenmann, der früher manchmal kam Ecke Schönhauser Allee/Buchholzer Straße, gab sie immer zwei Em, wo andere höchstens einen Groschen. gaben.
Oma Hela konnte erstklassig stricken.
Mit Oma Hela bin ich zum ersten Mal in meinem Leben richtig verreist. Ich war damals sieben, und es war nach meiner Krankheit. Die Reise passierte überhaupt bloß, weil ich die Krankheit hinter mir hatte und so furchtbar aussah. Oma Hela hatte eine Verwandte in Mecklenburg. Cousine von einer Cousine von einer Cousine oder so. Aber wie verzwickt die Verwandtschaft auch gewesen ist, Jarosław macht seine Leute. Die beiden alten Frauen glichen sich so hundertprozentig, dass sie hätten Schwestern sein können. Sie waren beide auf die gleiche Art drahtig und klein und irgendwie verrückt. Wir wohnten in einem winzigen Dorf, von dem ich heute bloß noch weiß, dass es auf -ow endete. Wir wohnten in einem hornalten Bauernhaus. Ich schlief auf einem Strohsack, der immer fabelhaft knisterte, wenn ich mich bewegte. Oma Hela ging mit mir in riesige Buchenwälder. Wir sammelten Maipilze und kochten sie hinterher mit Wein und weißem Pfeffer. Oma Hela zeigte mir, wie sie eine Ziege ganz erstklassig melken konnte; das beeindruckte mich maßlos, und ich trank die warme Ziegenmilch ohne Widerspruch, obwohl sie grauenvoll schmeckte. Oma Hela zeigte mir ungefähr fünfzig, sechzig verschiedene Arten von Frühlingspflanzen, und von den meisten kannte sie bloß die polnischen Namen. Oma Hela redete abends mit ihrer Verwandten, die nicht ihre Schwester war, sondern bloß so aussah, und sie redete auf eine Art, dass ich kein Wort verstehen konnte, und dazu tranken die beiden schwarzen Tee und Kräutergeist. In dem Haus gab es zwei Hunde und acht Katzen. Ich lief mit nackten Füßen durch das Sumpfgras, das phantastisch kalt war, und es blieb lange Zeit überhaupt die schönste Reise, die ich je gemacht hatte, und ich wurde beinahe fett dabei.
Oma Hela konnte Mäuse mit der Hand fangen. Einmal hat sie einen Abend in der Küche gehockt bis tief in die Nacht. Sie hat gewartet, dass die Maus aus ihrem Loch kam. Oma Hela hat die Maus gefangen, und anschließend hat sie geheult vor Triumph, dass die Greise aus den Betten fielen. Sie hat uns allen die Maus gezeigt, und der Greisin wurde daraufhin schlecht. Oma Hela tat die Maus dann plötzlich leid. Sie zeigte mir, was für schwarze Knopfaugen eine Maus hat. Oma Hela wurde völlig sentimental, als sie sah, wie die Maus immer wieder versuchte, nach ihrem, Oma Helas, Daumen zu beißen. Von einem Augenblick auf den anderen wurde Oma Hela wütend. Sie schrie mich an, ich sollte mich gefälligst ins Bett scheren, was ich aber nicht tat. Ich legte mich ins Fenster und sah prompt, wie Oma Hela den Hof betrat, irgendwelche Sätze aus Jarosław murmelte und dabei die Maus ganz behutsam wieder aussetzte.
Oma Hela kam mitten im Krieg von Jarosław nach Berlin, weil sie keinen Mann mehr hatte, bloß ein kleines Kind, und dass sie aus Jarosław fortgegangen war, ist die einzige Tat in ihrem Leben, die sie wirklich bereut hat.
Oma Hela war ungeheuer abergläubisch. Sie hat auch an Geister und Stimmen geglaubt, aber sie hat nie darüber geredet, und ich habe sie auch nie danach gefragt.
Ich war vierzehn, und Oma Hela war neunundsechzig, da fing sie an, schlecht zu schlafen, und sie sagte auch was von Schmerzen in der Brust. Die Greisin ließ einen Medizinmann kommen, und der Medizinmann verschrieb ihr eine Menge Tabletten und Soßen in dunkelbraunen Flaschen. Oma Hela schmiss das Zeug heimlich in den Abfall. Oma Hela hielt nichts von Medizinmännern. Oma Helas einziges Buch war ein Kräuterbuch. Das Kräuterbuch war uralt und speckig und völlig zerfleddert und stammte todsicher aus Jarosław. Ich musste mit dem Kräuterbuch nach Mahlow fahren oder bis nach Blankenfelde und musste die Sachen suchen, die mir Oma Hela in ihrem Kräuterbuch angekreuzt hatte. Ich fand immer bloß die Hälfte. Vielleicht wäre es einfacher gewesen, der Greis hätte die Kräuter gesucht. Der Greis arbeitete in Biologie und hatte hundertprozentig viel mehr Ahnung von Kräutern. Oma Hela hat ihn trotzdem nicht gefragt. Sie hatte ihre Gründe, und die Gründe waren völlig in Ordnung.
Oma Hela kam ins Städtische Krankenhaus in der Nordmarkstraße. Ich bin jeden Nachmittag hingegangen. Ich habe sie besucht, und ich habe mit ihr über Jarosław geredet. Die Greise sind bloß zweimal die Woche gegangen, wenn öffentliche Besuchszeit war.
Oma Hela hat über sechs Wochen gelegen. In dieser Zeit hat sie plötzlich angefangen zu rauchen, obwohl das streng verboten war. Ich musste ihr trotzdem Zigaretten und Streichhölzer mitbringen, und manchmal, wenn ich sie besuchte, roch sie ganz eindeutig nach verbranntem Tabak, jedenfalls in der ersten Zeit.
Später wurde sie immer kleiner in ihrem Bett und irgendwie gelb. Als ich eines Nachmittags in das Krankenhaus kam, fingen mich die Schwestern auf dem Korridor ab. Sie sagten, Oma Hela wäre verlegt worden und ich sollte lieber wieder gehen. Sie sagten das auf eine Art und zogen dabei Gesichter, dass ich gleich Bescheid wusste. Ich kehrte um und hatte einen Kloß im Hals. Ich erinnere mich noch, es war ein enorm windiger Tag.
Als die Greise die Beerdigung machen wollten für Oma Hela, war plötzlich klar, dass sich so einfach kein Priester dafür kriegen ließ. Oma Hela ist ihr Leben lang jeden Sonntag in die erste Messe gegangen, sie hat zentnerweise Kerzen gestiftet, sie hat lateinische Kirchenlieder gesungen, nicht bloß in der Kirche, auch in unserer Küche, beispielsweise beim Bigoskochen, sie war ungeheuer katholisch und fromm, aber sie hat nie, solange sie in Berlin gewohnt hat, und das waren bald dreißig Jahre, niemals in dieser Zeit, sage ich, hat sie einen Pfennig Kirchensteuer bezahlt. Sie war eben zu geizig. Der Greis ist zu irgendeiner Behörde gelaufen und hat dort offenbar was versucht. Sein Pech war vermutlich, dass er selber nicht in der Kirche war, auch die Greisin war nicht; jedenfalls hat er nichts erreicht, wie meistens, wenn er so was unternimmt.
Oma Hela ist nach Baumschulenweg gekommen. Sie ist verbrannt worden. Ich weiß nicht, ob ihr das recht gewesen wäre. Ich kann sie ja nicht mehr fragen.
3
Mit dem Tod von Oma Hela hatte ich meinen ersten Kneks. Das Wort ist meine Erfindung, und darauf bin ich unheimlich stolz. Dabei ist Kneks eine Sache, von der ich überhaupt nicht weiß, ob sie auch andere haben, und überhaupt ist es so, dass sich von einem Kneks wahrscheinlich niemand einen Begriff machen kann.
In Berlin gibt es eine Menge Sand. Zwischen dem Sand gibt es manchmal große schwarze Mistkäfer. Wenn jemand mit seiner Ledersohle auf einen von diesen dicken schwarzen Pillendrehern tritt und der Käfer platzt unter dem Gewicht, macht es kneks. Das Geräusch ist genau so, dass sich einem das Gedärm verknotet, und ich kann danach zirka zwei Nächte nur schlecht schlafen.
Ich will damit sagen, Kneks ist auf jeden Fall furchtbar, aber ich habe nicht bloß Kneks, wenn dicke schwarze Mistkäfer platzen. Denke ich genau darüber nach, ist mir das mit den kaputten Pillendrehern höchstens einmal in meinem Leben passiert. Es macht kneks bei ganz verschiedenen Sachen; die können für sich ganz stille Sachen sein, und es macht dann eben in mir kneks, irgendwo im Hinterkopf, und genau das ist das Furchtbare. Es gibt natürlich großen und kleinen Kneks. Denke ich genau darüber nach, ist die Welt voll von unheimlich viel Anlass zu Kneks. Ich sehe dann vor mir eine Art Mont Klamott, so wie in Lichtenberg, mit nichts als Kneks, großem und kleinem, und obenauf sitzt der Kneksgott und zerkaut zwischen seinen verdammt dreckigen Zähnen lauter schwarze Pillendreher.
4
Der Tod von Oma Hela war also der erste Kneks für mich. Sechs Wochen später gab es den nächsten Kneks, aber der hing mit dem ersten zusammen und war verglichen damit bloß eine Art Mini-Kneks.
Die Greise räumten die Wohnung. Unsere prima alte Wohnung mit Küche direkt überm Magistratsschirm war ihnen vermutlich nicht mehr fein genug. Ich will zugeben, dass sie, wo jetzt Oma Hela nicht mehr da war, auch zu groß war. Die neue Wohnung lag sechster Stock Moll-Straße, in einem von den neuen Klötzen mit den hellgelben Pinkelbudenkacheln. Der Umzug dauerte einen Tag. Weil ich Kneks hatte, war ich krank. In der neuen Wohnung waren lauter neue; Möbel. Ich rede nicht davon, dass Oma Helas prima altes Sofa mit den kaputten Sprungfedern nicht mit in die neue Wohnung kam. Ich hätte protestieren können, aber ich war krank. Ich hätte protestieren können, obwohl ich krank war, aber ich sah ein, dass Oma Helas Sofa aus Jarosław in die Küche an der Schönhauser gehörte und genau dorthin und also in der scheißneuen Wohnung an der Mollstraße nichts zu suchen hatte.
Der Umzug dauerte einen Tag, und das Einräumen dauerte drei Tage, und bis ich wieder okeh war, dauerte zirka sechs Tage. In dieser Zeit verkündete die Greisin, sie hätte sich ein Vierteljahr unbezahlten Urlaub genommen. Offenbar wollte sie mir den Übergang in ein Dasein ohne Oma Hela erleichtern. Von ihrem Standpunkt aus war das möglicherweise gut gemeint, aber wenn sie glaubte, sie könne mir Oma Hela ersetzen, so hatte sie sich grauenvoll geirrt.
Wir liefen ziemlich überflüssig in der neuen Wohnung umeinander herum. Die Greisin interessierte sich für alles, was ich tat. Oma Hela hatte das nie gemacht. Nach einer Weile fing die Greisin an gereizt zu werden. Sie schielte öfter am Tag nach ihren Tabellen, Rechenstäben und Schnellheftern. Zwischendurch brachte sie es fertig, dass sie dummes Zeug über Oma Hela von sich gab. Vielleicht war das ihre Methode, mir Oma Hela abzugewöhnen, aber sie hätte das lieber unterlassen sollen. Ich sagte ungefähr, ohne Oma. Hela wäre ich überhaupt kein Mensch, und das solle erst mal jemand nachmachen. Nach sechs Wochen brach die Greisin ihren unbezahlten Urlaub ab und war froh, dass sie wieder von Herzen Kältetechnik machen durfte. Ich hatte nachmittags meine Ruhe, und morgens ging ich zur Schule.
Solange Oma Hela lebte, hatte ich eher Horror vor Schule und riss Schule einfach bloß ab. Meine Zensuren waren Durchschnitt. Es muss einer schon ein absolutes Rindvieh sein, wenn die Pauker sich aufraffen, dass sie Zensuren geben, die schlechter sind als Durchschnitt, und so viel kann ich behaupten, trotz Horror, dass Gittie Marczinkowski zu keiner Zeit ein Rindvieh war.
Das alles wurde explosionsartig anders, als wir sechsten Stock Mollstraße wohnten. Die Greise waren unterwegs. Ich riss vormittags Schule ab. Ich ging heim. Auf dem Küchenbord in der neuen Küche stand irgendwelcher Fraß, den mir die Greisin gekocht hatte. Ich brauchte ihn bloß warm zu machen. Kartoffelbrei oder Spaghetti. Ich machte Kartoffelbrei und Spaghetti warm und schlang sie runter. Ich brauchte keine Angst zu haben, dass sie nicht drin blieben. Ich war kuriert durch Oma Helas Bigos. Oma Hela war tot. Ich wohnte in der Mollstraße. Ich ging zum Fenster. Unten waren Autos und waren laut und stanken. Es waren vermutlich die gleichen Autos wie in der Schönhauser, aber ich war nicht mehr in der Schönhauser.
Ich hätte vielleicht lesen können. Die Greise haben ein Bücherregal. Die meisten Bücher waren Schwarten, wie sie die Greise brauchten. Pflanzenkunde und Kältetechnik. Daneben höchstens noch Schwarten, die sie irgendwann als Prämien gekriegt hatten, mit eingeklebten Urkunden. Also jedenfalls, mit Lesen war nichts.
Ich hätte Radio hören können, und tatsächlich habe ich Radio gehört. Ich habe in dieser Zeit erst mal Dixieland entdeckt, da man ja systematisch vorgehen muss. Also Cy Oliver und Papa Bue und Humphrey Littleton. Aber so was ist nachmittags nicht programmfüllend. Es ist überhaupt unglaublich, was nachmittags im Radio fällig ist, nämlich Dixieland zirka bloß fünfundvierzig Minuten maximal und die übrige Zeit Kinderfunk, Streichquartett und Blick in neue Bücher.
Das nächste Kino lag viel zu weit weg, außerdem stand ich damals überhaupt nicht auf Kino.
Ich habe also die Nachmittage für Schule gearbeitet und aus keinem anderen Grund, als um die Nachmittage totzuschlagen, sachlich. Das Ergebnis war, dass ich raketenartig aufstieg und nach sieben Monaten Spitze war.
Der Greis ist glatt aus dem Sessel gekippt, nachdem er mein nächstes Zeugnis beäugt hatte. Ich kriegte von ihm eine neue Armbanduhr von Glashütte, aber die war nach einem Dreivierteljahr im Eimer. Die Greisin sagte was, Oma Hela hätte mich eben in der Entwicklung behindert und sie, die Greisin, hätte das schon immer gewusst. Ich hätte jetzt kreischen können und sagen, dass sie keine Ahnung hätte von Oma Hela, auch nicht von mir, und ich hatte zusätzlich Lust, Schule für mich wieder als Horror zu erklären wie früher. Ich habe nicht gekreischt. Damals war ich vierzehn. Irgendwie hatte ich noch Respekt vor den Greisen. Der Horror wäre außerdem nur Krampf gewesen, und schließlich musste ich mit den Nachmittagen fertig werden.
5
Siebente Klasse lernte ich Rosi kennen. Rosi war ein fabelhafter Typ. Sie war ungeheuer knochig und kein bisschen hübsch. Sie hielt sich krumm. Sie trug eine Brille. Sie hatte dabei eine Art, mit Leuten umzugehen, dass diese Leute sofort in die Knie gingen und Rosi aus der Hand fraßen. Rosi hatte eine Stimme, als gurgle sie jeden Morgen mit Salzsäure und Ziegelsplitt, aber sie brauchte nur den Mund aufzumachen und mit dieser Stimme irgendwas zu sagen, und die Leute wurden weich.
Rosi war drei Klassen über mir, aber da ich bekanntlich zwei Jahre älter war als der Schnitt in meiner Klasse, kam ich Rosi bis auf ein Jahr näher. Rosi eröffnete in unserer Penne eine Art Ef-De-Jot-Kulturklub. Er war vollkommen anders als das, was solche Klubs sonst bieten, Laurentia-Singen und Laienspiel-Kiki und so. Rosi hatte einen Vater. Der Vater war Dispatcher beim volkseigenen Kraftverkehr in Lichtenberg. Von Rosis Vater kriegten wir einen abgewrackten Anderthalb-Tonnen-Lastwagen, der hinten offen war.
Der Lastwagen hätte eigentlich ausgeschlachtet werden müssen und anschließend als Schrott verkauft. Irgendwie brachte es Rosis Vater fertig, dass er den Lastwagen vorm Ausschlachten und Schrottverkaufen bewahrte. Er sorgte auch dafür, dass der Motor einigermaßen am Leben blieb. Vier, fünf Kilometer ließen sich völlig problemlos damit fahren.
Wir malten den Lastwagen erst mal von außen unheimlich bunt. Überwiegend orange und grün, in Streifen. Wir klebten eine Menge Plakate und Bilder darauf und überhaupt alles, was uns in die Hände fiel und für so was geeignet war. Wir brachten drei Wochen damit zu, den Wagen äußerlich herzurichten, und am Ende sah er vollkommen irre aus.
Es ging dann noch darum, für den Wagen, wenn wir ihn brauchten, einen Fahrer zu kriegen. Wir setzten uns in die Betriebskantine vom Kraftverkehr und redeten mit den Leuten. El-Ka-We-Fahrer sind ungeheure Typen. Sie riechen nach Dieselöl, Zigarettenrauch und trinken literweise Kaffee. Sie können umwerfende Geschichten erzählen, von Landstraßen, Anhaltern, Pannen, Pennern und von nächtlichen Fernfahrerkneipen. Wenn wir schließlich sagten, was wir von ihnen wollten, gähnten sie ganz träge hinter ihren vorgehaltenen Pranken und gaben uns zu verstehen, dass sie einen unregelmäßigen Dienst hätten und ihre Freizeit in jeder Sekunde brauchten. Wir schafften es trotzdem manchmal, dass wir einen von ihnen kriegten, und die übrige Zeit fuhr uns Rosis Vater.
Danach war es jedes Mal schon ein enormer Anblick, wenn wir mit dem irre bunten Anderthalb-Tonner von Lichtenberg Richtung Norden karrten. Ich glaube, unser Anblick war vollkommen lebensgefährlich. Wir stellten uns an alle möglichen Kreuzungen von Prenzlauer Berg. Wir standen oben auf dem Lastwagen in unseren blauen Klamotten und sangen und schrien bestimmte Sätze, die wir uns selber zurecht geknetet hatten. Über das, was gerade los war. Haiphong oder Leros oder Johannesburg. Wir sangen die alten Sachen von Ernst Busch und Guantanamera und We shall overcome. Wir hatten jede Menge Publikum. Die Leute hörten uns zu und klatschten oder ärgerten sich und schrien, sie wollten ihre Ruhe. Es war eine ungeheure Sache, was zu tun und zu merken, dass die Leute reagieren.