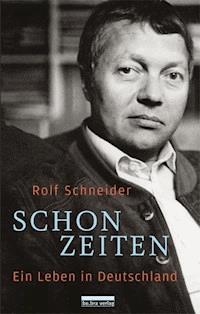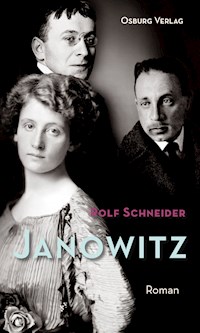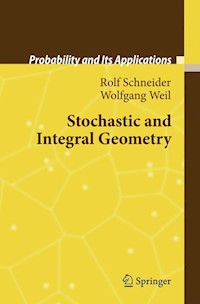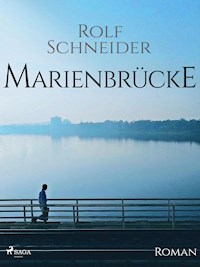
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser Roman ist ein leidenschaftliches Plädoyer gegen den Totalitarismus - in welcher Gestalt auch immer. Eine Kindheit in Nazi-Deutschland, eine Jugend in der jungen DDR, ein Leben zwischen Anpassung und Verrat. In seiner großen Erzählung über das Werden und Scheitern des Jacob Kersting gelingt Rolf Schneider ein Roman, in dem sich Glaube und Irrtum des 20. Jahrhunderts spiegeln. Im Februar 1988 reist der Ost-Berliner Kunsthistoriker Jacob Kersting für ein Forschungsprojekt nach Wien. Doch die Arbeit geht nur schleppend voran. Auch seine eigene Existenz erscheint Kersting zunehmend sinnlos. Seine Ehe ist am Ende. Der Staat, in dem er lebt, auch. Wie in einem Film ziehen Szenen seines Lebens an ihm vorbei: Erinnerungen an seinen Vater Robert, der als Anarchist in steten Konflikt mit den Herrschenden geriet. An seinen Freund Ytsche, dem es egal war, ob er beim Deutschen Jungvolk oder der FDJ dabei war. An die erste Begegnung mit seiner späteren Frau Sonja. Rolf Schneider ist ein besonderer Roman geglückt. In starken plastischen Bildern erzählt er vom Leben in zwei totalitären Systemen und verwebt Vergangenheit und Gegenwart zu einer großen Erzählung über das Scheitern, die Fehlbarkeit des Menschen und die Tröstungen des Kaffeehauses. AUTORENPORTRÄT Rolf Schneider, 1932 in Chemnitz geboren, studierte Germanistik, Anglistik und Romanistik in Halle-Wittenberg und ist seit 1958 freier Schriftsteller. Nach Protesten gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns wurden seine Publikationsmöglich-keiten stark eingeschränkt, 1979 folgte der Ausschluss aus dem DDR-Schriftstellerverband. Ro
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rolf Schneider
Marienbrücke
Roman
Saga
1
Am 1. Februar 1988, einem Montag, bestieg Jacob Kersting gegen 7 Uhr 30 im Fernbahnhof Berlin-Lichtenberg einen Zug, der den Namen Vindobona trug. Die Fahrt würde fast einen halben Tag dauern. Sie würde unterbrochen werden durch ausführliche Pass- und Zollkontrollen an zwei Grenzstationen.
Als Jacob Kersting auf dem Wiener Franz-Josefs-Bahnhof sein Zugabteil verließ, war es früher Abend. In den Straßen vor dem Bahnhof hing milchige Dämmerung, gesprenkelt von Lichtern. Ein älterer Mann, mit dem er während der Reise ins Gespräch gekommen war, Geschäftsreisender einer DDR-Exportbehörde, lud ihn ein zu einer gemeinsamen Taxifahrt, da beider Ziele in Wien sich nahe beieinander befanden. Kersting führte nur eine geringe Summe österreichischen Geldes mit sich und wusste nicht, wann er sie würde ergänzen können.
Österreich war sein erstes Reiseziel in einem Land außerhalb der deutschen Grenzen. Auf die erforderliche Genehmigung der DDR-Behörden hatte er lange warten müssen, erst zwei Tage vor Fahrtantritt war ihm das Ausreisevisum ausgehändigt worden. Er wusste, dass er damit ein Privileg wahrnahm, und wusste nicht, wie er es nutzen würde: Es gab verschiedene Möglichkeiten, die ihm gleichermaßen verlockend und riskant erschienen. Er verbot es sich, jetzt, an diesem Tag, ausführlich darüber nachzudenken.
Er war sechsundfünfzig Jahre alt. Er hatte sich in mehreren Publikationen zu Themen und Personen der jüngeren österreichischen Kunstgeschichte geäußert: Koloman Moser, Aktivitäten der Wiener Werkstätte. In Österreich war man deswegen auf ihn aufmerksam geworden. In Berlin, Hauptstadt der DDR, wurde er zu Empfängen und Abendessen des Wiener Botschafters geladen. Der war ein freundlicher weltläufiger Mensch, Kersting erzählte ihm von seinem Vorhaben, über den Architekten und Designer Josef Hoffmann zu arbeiten, worauf der Botschafter sagte, er wolle versuchen, daheim in Wien für Kersting etwas zu bewirken.
Einem Leipziger Verlagshaus war an einer möglichen Buchveröffentlichung gelegen. Vielleicht auch fand Kersting, wie schon zuvor, Interesse bei einem Münchener Kunstverleger. Die nun folgenden Verhandlungen, Briefwechsel und Telefonate mit den DDR-Behörden betreffend einen Arbeitsaufenthalt in Wien erstreckten sich über einen Zeitraum von vierzehn Wochen. Finanziert durch ein Stipendium des österreichischen Unterrichtsministeriums sollte Jacob Kersting Zugang erhalten zu Arbeitsresultaten und Hinterlassenschaften Josef Hoffmanns am Ort ihrer Entstehung.
Das Taxi hielt vor einem Gebäude, das einem riesigen Hotel ähnelte und ein Wohnheim für Studenten war. Im Inneren roch es nach abgestandenem Fett und saurem Wein. Der junge Mensch am Empfang wirkte verschlafen und trug ein auffälliges Furunkel am Hals. Er händigte Jacob Kersting einen Schlüssel aus. Kersting fuhr mit dem Aufzug bis zur vierten Etage und öffnete die Tür zu einer Wohnung, in der er vier Monate lang leben sollte. Sie bestand aus zwei dürftig möblierten Zimmern und einer winzigen Küche.
Als er am Morgen erwachte, hatte er unruhig geschlafen und behielt davon einen dumpfen Kopfschmerz. Er sah seine geöffnete Reisetasche, achtlos auf den Fußboden gestellt und mit heraushängenden Textilien: als hätte sie ihre Eingeweide verloren. Vor den Fenstern war das Gegurr von Tauben. Der Kopfschmerz wollte nicht nachlassen.
Er verließ das Studentenheim und ging die Straße hinab, die den Namen Pfeilgasse trug. Er ging vorüber an schmutziggelben Fassaden und einem Theater, das, wie die Aushänge mitteilten, englische Stücke in der Originalsprache aufführte. In der Hand den aufgeklappten Stadtplan, den er am Vorabend auf dem Franz-Josef-Bahnhof gekauft hatte, ging er bis zur Ringstraße und fühlte dabei eine sonderbare, wie fiebrige Erregung, Gemisch aus überschäumendem Glücksempfinden und diffuser Angst. An die Staketen eines Metallzaunes, hinter dem eine ausführliche Parkanlage begann, hatte ein Händler Zeitungen geheftet. Ihre Schlagzeilen handelten von dem österreichischen Bundespräsidenten Kurt Waldheim und von Jugendlichen in Ost-Berlin, verhaftet wegen ihrer Teilnahme an einer unerlaubten Demonstration. Kersting las es. Er spürte, wie das Gefühl fiebriger Erregung zerrann.
2
Das Palais Starhemberg, ein barocker Bau, befand sich am Minoritenplatz. Es beherbergte Amtsräume des österreichischen Bundesministeriums für Unterricht und Kunst. Jacob Kersting durfte den Eingang passieren, ohne auf eine kontrollierende Türwache zu treffen, das war eine für ihn ungewohnte Erfahrung. Dr. Alois Mühlbauer hatte sein Büro unter dem Dach. Der Raum zeigte abgeschrägte Mansardenwände. In zwei niedrigen, mit weinrotem Plüsch bezogenen Louis-Quatorze-Sesseln saßen Dr. Mühlbauer und Kersting einander gegenüber.
Dr. Mühlbauer hatte eine schräge Stirn und einen schwarzen Scheitel. Seine Schneidezähne standen auseinander. Wenn er die Lippen öffnete, erhielt sein Gesicht den Ausdruck von Lüsternheit. Aus einer Reklamepackung bot er Zigaretten an: Die Tabakindustrie, sagte er, sei in diesem Lande Staatsmonopol, die Bundesbediensteten würden deswegen degradiert zu kostenlosen Reklameträgern. Der Anteil der staatlichen Industrie in Österreich, sagte er, sei beim Vergleich mit anderen Staaten unverhältnismäßig hoch, Schlampereien der verstaatlichten Industrie hätten immer wieder zu förmlichen Regierungskrisen geführt, die jüngste, bei der Voest alpine, hätte Kersting bestimmt verfolgt. (Kersting hatte nicht.) Der Herr Bundeskanzler, sagte Dr. Mühlbauer, sei heimlich ein engagierter Anhänger der freien Wirtschaft, trotz seines sozialistischen Parteibuchs, leider müsse er Rücksicht nehmen auf die orthodoxe Basis in seiner Partei, die immer noch weitgehend im Austromarxismus verharre.
Bitte, er vertrete hier bloß seine private Meinung, sagte Dr. Mühlbauer und lächelte. Seine Sätze kamen flüssig. Sein Wiener Akzent war bloß schwach. Er wollte jetzt wissen, wie sich die DDR befinde. Er sagte Ostdeutschland. Er war nur einmal dort gewesen und da nur in Berlin, vor fast einem Vierteljahrhundert. Kersting begann mit einem ausweichenden Satz, um danach zu Einzelheiten zu gelangen, aber schon wieder redete Dr. Mühlbauer. Er schien an Ostdeutschland in Wahrheit nicht interessiert.
Er machte Kersting mit seiner Überzeugung bekannt, die Intellektuellen, er benutzte das slawische Wort Intelligenzija, seien die herrschende Klasse der Zukunft und die einzige gesellschaftliche Schicht mit realen Wachstumschancen. Das Aktiv-Kapital Geist mache noch Kleinstaaten wie selbstverständlich zu Weltmächten, Beispiel sei die gegenwärtige Republik Österreich, deren wesentliches Exportgut nicht Edelstahl heiße, sondern Kultur. Hier erfuhr Kersting, Wien weise eine autochthone geistige Entwicklung auf infolge der alles beherrschenden Einflüsse von Katholizismus und Barock. Spiel, sagte Dr. Mühlbauer, Verstellung und Charme. Die Welt als Theater. Das Leben als Mummenschanz und Improvisation. Bester Ausdruck dessen sei jene Liebenswürdigkeit, die weder Zuneigung noch sexuelle Akzeptanz bedeute, sondern die Veräußerlichung all dessen in die Unverbindlichkeit.
Ein wenig sprunghaft erfolgte Dr. Mühlbauers Gedankenführung. Kersting erfuhr, wie man unter der heutigen österreichischen Kleinstaatlichkeit offenbar leide, hinter der Zweiten Republik erhob sich in schattenhafter Monumentalität die einstige Doppelmonarchie, von deren Erbe man immer noch zehre. Dr. Mühlbauer entwarf einen Kulturkreis, dessen etwas undeutliche Grenzen sowohl Przemyśl wie Mailand wie Tetschen-Bodenbach umschlossen und dessen alles verbindende Gemeinsamkeit das Kaffeehaus war. Dr. Mühlbauer bot abwechselnd die Wendungen Mitteleuropa und josefinisch an, letzteres in Ableitung vom Sohn der Maria Theresia, dem Reformkaiser mit dem Toleranzpatent, und ein kaltes Entsetzen griff nach Kersting, als er erkennen musste, dass Dr. Mühlbauer meinte, Kersting sei nach Wien gekommen, um über den 1801 geborenen Sänger, Schauspieler und Komödiendichter Johann Nepomuk Nestroy zu forschen.
Hoffmann, sagte Kersting vorsichtig, in eine der raren Pausen von Dr. Mühlbauers Rede hinein, der österreichische Architekt und Formgestalter Josef Hoffmann. Er sagte das nicht korrigierend, schon gar nicht strafend, er wollte Dr. Mühlbauer nicht kränken. Dr. Mühlbauer blickte ihn an. Wieder lächelte er kurz und beinahe schmerzlich, als habe Kersting gewagt, ihm einen Irrtum zu unterstellen. Dr. Mühlbauer war gänzlich unbegabt, sich zu irren. Wie zum Beweise machte er sofort längere Ausführungen über österreichische Kultur in der Ersten Republik, die, lange vernachlässigt, nun endlich ins Blickfeld geraten sei, spätestens seit der von Hans Hollein besorgten Ausstellung anlässlich der Wiener Festwochen von 1985, Traum und Wirklichkeit, die Kersting bestimmt gesehen hätte, aber Kersting hatte nicht.
Dr. Mühlbauer, sah Kersting, war ein geübter und kenntnisreicher Plauderer, bevorzugt über Gegenstände der österreichischen Kulturgeschichte. Eben deswegen saß er als Beamter hier, im österreichischen Bundesministerium für Unterricht, und vertrat die Sache nach außen. Dr. Mühlbauer versicherte, dass er Rat und Hilfe für Kersting habe, wann immer Kersting dessen bedurfte. Er stellte Kersting einen gemeinsamen Besuch im nahe gelegenen Café Landtmann an der Ringstraße in Aussicht, zu dem es, wie Kersting vermutete, niemals kommen würde.
Kersting verabschiedete sich. Der Name Waldheim war nicht gefallen. Die Aktionen der DDR gegen jugendliche Demonstranten blieben unerwähnt. Die Modalitäten des Empfangs der vom Ministerium für Unterricht und Kunst ausgesetzten monatlichen Geldzahlungen an Kersting hatte Dr. Mühlbauer wie nebenher dargetan, mit zwei Sätzen.
3
In einer Telefonzelle am Schottentor durchblätterte Kersting das olivgrün eingebundene Fernsprechbuch der Stadt Wien. Er warf eine Schillingmünze ein und wählte einen Anschluss. Eine weibliche Stimme mit schrill sächsischem Akzent teilte mit, man sei die Botschaft der Deutschen Demokratischen Republik. Kersting sagte, er wolle seine Anwesenheit in Wien vermelden. Moment, sagte die Stimme. Die Leitung war für Sekunden unterbrochen. Dann meldet sich die Stimme zurück, wollte den Namen, die Dauer des Aufenthaltes und die Wiener Adresse erfahren. Streng fragte sie: Dienstlich oder privat? Kersting musste durchatmen, ehe er antwortete. Für ein paar Augenblicke fühlte er sich auf deprimierende Weise daheim.
Er stand auf der Marienbrücke über dem Donaukanal. Seine Kopfschmerzen waren vergangen. Er lehnte an einem Geländer, neben einer Statue der Madonna, die das Kind im Arm trug und umgeben war von metallenen Rosen. Eine Inschrift besagte, die Gottesmutter wolle sich herbeilassen, die Sünden zu vernichten. Was hieß für einen wie ihn Sünde? Ein amtmodisches Wort. Es gab Schuld, Versäumnis, Fehler, Vergehen, Verrat, das alles ließ sich ebenso als Sünde begreifen und ließ sich, als Sünde, abbitten und abbüßen, also verlieren. Katholizismus war eine gnädige Sache. Kersting war kein Katholik, er war kein Christ, er war es nie gewesen.
Tief unten floss in einem breiten Bett graues Wasser. Ein Platz für Selbstmörder, dachte Kersting, man hatte die Wahl, sich in den Donauarm zu stürzen oder auf die steinerne Uferbefestigung, um dort zu zerschellen. Ein Dampfschiff lag vor Anker unmittelbar neben der Brücke. Der Zugang war mit einem Baldachin versehen. Der Dampfer trug den Namen Johann Strauß, auf ihm erhob sich in Überlebensgröße eine aus Bronze gefertigte Plastik des berühmten Komponisten, Bogen in der Rechten und Geige am Kinn. Möwen hockten auf den Wellen. Auf dem anderen Ufer stand ein Geschäftshaus und zeigte an einer seiner Mauern mit digitalen Riesenzeichen die Uhrzeit. Kersting spie hinab in den Fluss, ehe er ging.
4
Das Bild der einander jagenden Strommasten hatten für Kersting, als er Kind war, zu den Vergnügungen des Eisenbahnfahrens gehört, aber mehr noch als dieser Anblick hatte ihn stets das Bild der zuckenden Pupillen beeindruckt, von jenen Fahrgästen, die dem Schauspiel der einander jagenden Strommasten zusahen.
Hinterher waren für ihn die Bilder und Eindrücke von Bahnfahrten aus diesen frühen Jahren ineinandergeflossen. Er erinnerte sich an das stundenlange Sitzen auf Bänken aus gelb lackierten Hölzern, die durch silbrige Schrauben zusammengehalten wurden. An der Unterkante des Türfensters hing ein breites hellgraues Gurtband herunter fast bis zum Abteilboden. Ein emailliertes Schild warnte in mehreren Sprachen davor, sich hinauszulehnen.
Bei ihrem Umzug nach Grotenweddingen war er schon acht. Vorher hatte er mit seinem Vater in Gera, Dresden, Lübeck und Chemnitz gewohnt. Er bewahrte von diesen Städten bloß Erinnerungen an Chemnitz, außer ein paar Bildern, die in das westliche Mecklenburg nahe der Ostsee passen müssten.
Die Straße dort war breit. Im Sommer wirbelte trockener Lehm auf. Die Fronten gehörten zu einstöckigen Backsteinhäusern mit fetten Dächern aus Reet oder Ziegeln, mit grünlackierten Fensterhölzern, mit gelb und rosa blühenden Dahlien neben der Haustür. Im Innern hing die Stubendecke niedrig, und auf den Gegenständen klebte fortwährend Feuchtigkeit, weil die Luft satt war von Nässe. Er meinte, die Häuser müssten vielleicht in einem am Rand von Lübeck gelegenen Arme-Leute-Dorf gestanden haben, wo die Landwirtschaft längst aufgelassen worden war, in den Häusern wohnten jetzt Arbeiter vom Trave-Hafen und aus den Fabriken für Nahrungsmittel und Metallteile.
In Chemnitz hatten sie die Erdgeschosswohnung eines vierstöckigen Mietshauses bezogen. Das Nachbargebäude beherbergte einen kleinen Lebensmittelladen, wo zu dem Zeitpunkt kurz nach ihrem Einzug die Butter, oder jedenfalls die sogenannte gute Butter, nicht mehr in beliebiger Menge eingekauft werden durfte. Die Begründung war im Radio zu hören, vielleicht wurde sie auch auf Plakaten und in der Zeitung gedruckt, aber er selbst konnte damals noch nicht lesen. Kanonen statt Butter. Der Geschäftsinhaber, Herr Goerner, war ein klein gewachsener Mensch, der ständig während seiner Arbeit einen gestärkten weißen Baumwollkittel trug, im Rücken mit einem schmalen Stoffriegel an zwei Knöpfen.
In der Tschechei waren die dort lebenden Deutschen zu Deutschland gekommen, mitsamt dem Gebiet, das sie bewohnten und das Sudetenland hieß. Dafür bringe man doch mal gern ein Opfer, sagte Herr Goerner. Die Butter entnahm er einem auf dem Fußboden seines Ladens stehenden Eichenfass, mit der Hilfe eines hölzernen Spachtels, den er hernach auf einem Blatt Pergamentpapiers abstrich. Genaue Mengen ergaben sich entsprechend der Anzeige auf Herrn Goerners Lebensmittelwaage. Sie wurden außerdem als Zahlen in ein Notizheft eingetragen. Bevor er zu schreiben anfing, benetzte Herr Goerner die Spitze seines Kopierstiftes mit der Zunge. Wenn ein Kunde sein Geschäft betrat oder es wieder verließ, grüßte Herr Goerner deutlich mit Heilhitler.
Die Lebensmittelwaage hatte auf ihrer der Kundschaft zugewandten Seite eine Aufschrift. Wenn Sie zufrieden sind, sagen Sie es anderen, wenn Sie es nicht sind, sagen Sie es mir.
Der Junge konnte diese Aufschrift erstmals buchstabieren, nachdem er zehn Monate lang die unterste Klasse der Volksschule in der Andréstraße besucht hatte. Danach grübelte er mühselig, wie jemand mit einer Lebensmittelwaage unzufrieden sein könnte, und wie es anstellen, dass ein aus Metall und Farben bestehender Gegenstand gesprochene Mitteilungen der Unzufriedenheit vernahm.
Zu diesem Zeitpunkt musste er immer noch, wenn er früh nachmittags zu Herrn Goerner ging, seinen Einkaufswunsch auf einem Zettel vorweisen, den sein Vater beschriftet hatte und in den außerdem die für den Einkauf benötigten Geldmünzen eingewickelt wurden. Herr Goerner wirkte auf ihn jetzt geschrumpft. Das mochte vielleicht bloß dadurch bedingt sein, dass der Junge seinerseits gewachsen war. Herr Goerner notierte auf dem Zettel die Einkaufssumme und subtrahierte von dem mitgebrachten Betrag. Das Wechselgeld wickelte er seinerseits in den Zettel. Herrn Goerners Laden führte auch Obst, Gemüse und Wurst. Backwaren führte Herrn Goerners Laden nicht. Am Ende der Straße befand sich der Schmidt-Bäcker, der außer Brot und Semmeln noch Kuchen anbot. Für ein Fünfpfennigstück ließen sich, in Tüten abgefüllt, die fortgeschnittenen Ränder von Blechkuchenstücken erwerben, Kuchenrindeln.
Es war schön, erinnerte sich der Junge, an der Kante des Gehsteigs zu sitzen und die süßen Streifen zu kauen. Überhaupt war die Straße, die nach einer Schlacht aus dem deutschfranzösischen Krieg von 1870 hieß, in seinen Augen manchmal so etwas wie ein schmutziges Idyll. Das passierte zum Beispiel an Nachmittagen im Frühsommer. Die Sonne stand schräg über den Schornsteinfirsten der Brauerei. Sie schüttete hellbraunes Licht auf den Basalt. Unter der Treppe, die zu Herrn Goerners Laden führte, wurden von Kindern Murmeln geschoben. Ein Glasbucker besaß den Wert von drei oder fünf Tonkugeln, je nach Art seiner Zeichnung. Der Boden hinter den Zementstufen von Herrn Goerners Laden hatte eine leichte Schräge zur Hauswand hin. Mit dem Sand, der sich aus dem morosen Rauputz herauskratzen ließ, wurde die Fläche geebnet, anschließend wurden Vertiefungen geformt. Auf den Gehwegplatten waren die Felder für Himmel und Hölle aufgemalt, mit weißer Schulkreide, die Mädchen sprangen darin, beidbeinig, einbeinig, je nach der Regel und hinter einem Bündel ineinandergehängter Sicherheitsnadeln her, das sie immer wieder aufhoben, um es sofort in ein anderes Feld zu werfen.
Die Sonne nahm Platz genau zwischen den Schornsteinen. Etwas Rauch stieg hoch. Er machte das Licht unruhig. Frauen in blumigen Kittelschürzen traten auf oder größere Jungen, mit Glaskrügen in der Hand. In geöffneten Fenstern zur Straße hin zeigten andere Frauen ihre Köpfe und hatten die nackten Unterarme auf ein Kissen oder eine wollene Häkeldecke gestemmt. Die Frauen und älteren Jungen kehrten zurück vom Keglerheim. Die Krüge waren angefüllt mit gelbem Bier, das eine Schaumhaube hatte und kalten sauren Geruch. In den Radios hinter den offenen Fenstern sang die chilenische Nachtigall Rosita Serrano, mit harten Konsonanten, Roter Mohn, warum welkst du denn schon. Sein Vater ging die Straße hinunter. Die Frauen in den Fenstern sahen zu ihm hin, und wie der Junge glaubte, taten sie es voll Bewunderung. Der Junge hatte seine Kuchenrindeln gegessen. Er zerknüllte das leere Papier, warf es in den Rinnstein und stand auf.
Auch Kuchenrindeln konnten schon bald höchstens ausnahmsweise gekauft werden, als nämlich Backwaren bloß gegen Lebensmittelkarten abgegeben wurden und Kuchenrindeln zu den wenigen weiterhin markenfreien Waren gehörten. Herr Goerner wurde eingezogen. Zu seinem Abschied zeigte er sich noch einmal stolz, ein kleiner Mensch mit blankem Schädel und großem hässlichem dunkelbraunem Muttermal hinter dem rechten Ohr, angetan mit einer Panzergrenadier-Uniform. In seinem Laden wurden allmählich die Waren weniger. Der Betrieb musste jetzt von Frau Goerner geführt werden, die es auch schon vorher gegeben hatte, aber bloß manchmal und wenn besonders viel Kundschaft gewesen war. Frau Goerner, im Wuchs größer als ihr Mann, hatte unförmig dicke Fußknöchel, die bandagiert wurden, und knickte beim Gehen in der Hüfte deutlich ein.
Der Junge besuchte jetzt in der André-Schule die Klasse 2 b. Jeder Schüler musste ein Kriegstagebuch führen. Dazu war erforderlich, dass ein großformatiges Schulheft Seite für Seite mit den Abbildungen vom Kriegsgeschehen sowie mit handschriftlichen Vermerken der Ereignisse an den Fronten angefüllt würde. Die Abbildungen waren mit der Schere aus Zeitschriften oder Tageblättern herauszutrennen, Berliner Illustrirte Zeitung, Chemnitzer Neueste Nachrichten. Die Kriegstagebücher wurden von Klassenlehrer Klostermann in unregelmäßigen Abständen eingesammelt und zensiert.
An der Litfaßsäule beim Eingang der Andréstraße hingen Plakate mit der Zeichnung eines deutschen Soldaten, der vor einem Eisenbahnzug stand. Der Soldat lachte und wirkte heldisch. Der Zug war klein, wie nebensächlich, und die in grobe Fraktur gebrachte Aufschrift hieß Räder müssen rollen für den Sieg. Manchmal wurden zur Probe die Sirenen für den Fliegeralarm eingeschaltet.
Lehrer Klostermann trug schütteres rotblondes Haar, hatte ein ausgehungertes Gesicht, mit Sommersprossen, und artikulierte seine Sprechlaute weit hinten in der Gurgel. Er hasste es, wenn Schüler mitten in der Unterrichtsstunde sich meldeten, bloß um austreten zu dürfen. Er hielt dies für disziplinlos, unmännlich, er zog auch Vergleiche mit den Entbehrungen unserer tapferen deutschen Frontsoldaten, und um seinen Forderungen auf unbedingten Gehorsam sinnlichen Ausdruck zu verleihen, bewahrte er im Wandschrank des Klassenzimmers eine kleine Sammlung von Rohrstöcken, die er gelegentlich hervorholte, einen nach dem anderen, um sie vor den Augen der Klasse auf ihren Zustand zu überprüfen. Er befühlte sie, hob sie dann hoch und ließ sie durch die Luft fauchen.
Manche der Stöcke waren an den Spitzen ausgefranst. Andere zeigten sich noch völlig intakt. Ihre Farben waren blasses Gelb, bei vereinzelt apfelsinenfarbener Tönung. Schläge mit einem ausgefransten Stock galten als vergleichsweise wenig schmerzhaft. Einem der Prügel war eine kurze hellblaue Metallkuppe übergestülpt, deren Berührung besondere Pein verhieß. Lehrer Klostermann wies ihn stets zuletzt vor, mit dem Ausdruck triumphierenden Genusses im Gesicht. In der Klasse gab es zwei Sitzenbleiber, grobe Burschen, die übereinstimmend bekundeten, jeder Rohrstock breche sofort auseinander, ähnlich einem Strohhalm, wenn man ihn mehrfach mit der Innenseite einer aufgeschnittenen Zwiebel bestreiche. Sie lieferten für ihre Behauptung keinen tätigen Beweis. Sie redeten das vielleicht bloß so, um im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu sein. Jacob fühlte eine heimliche Bewunderung für ihr aufsässiges Benehmen.
Er teilte zugleich jenen Abscheu, der die lärmend von Lehrer Klostermann eingenommene Haltung gegen die beiden war und der seinen Ausdruck fand im häufigen Abstrafen mit einem der Rohrstöcke. Der Geschlagene schrie jedes Mal übertrieben laut. Hinterher, in den Pausen, rühmte er sich seiner Verstellungskunst. Es sei alles, sagte er, bloß eine List gewesen, die zu erleidende Tortur zu verkürzen. Manche aus der Klasse hielten das für feig.
Ganz bestimmt empfand so Dietzel-Wolfgang. Er war der kleinste Junge aus der Klasse. Er trug sein hellblondes Haar kurz geschoren, dass überall auf seinem Schädel rosige Haut sichtbar war. Mit schwärmerischer Inbrunst verehrte er die militärischen Leistungen deutscher U-Bootfahrer aus zwei Weltkriegen, worüber er Beschreibungen gleich in mehreren Büchern besaß. Die waren eingebunden in marineblaues Leinen, mit silbernen Buchstaben auf dem Deckel, und sie waren angefüllt auch mit Fotos in Schwarz und Weiß. Immer wieder zog Dietzel-Wolfgang eines der Bücher aus seinem Schulranzen, um es aufzuschlagen und anderen zu zeigen und stolz zu sein.
Einmal, mitten im Unterricht, trat Dietzel-Wolfgang plötzlich aus der Bank heraus und ging sonderbar steifen Schritts zum Katheder. Er redete leise mit Lehrer Klostermann. Dann verließ er das Zimmer. Es brauchte, um den Inhalt seiner Worte zu vermuten, kein Rätselraten, da er bei seinem Gang eine dünne Urinspur hinter sich ließ. Als er vor dem Katheder stand, rann es ihm hörbar aus dem linken Hosenbein, eine kleine Strecke den blanken Unterschenkel mit dem weißen Wollsöckchen herab, von der Mitte der Wade an direkt und schräg bis auf das Linoleum, wo es als eine dunkle Lache stand. Lehrer Klostermann war zufrieden. Jemand hatte sich so vollkommen unter sein Verbot geduckt, bis erkennbar der menschliche Organismus versagte und sich entlud. Vielleicht war Dietzel-Wolfgang sogar beschämt, da die Prügelstrafe, mit der er gewiss gerechnet hatte, nicht verabfolgt worden war.
5
Das Bankgebäude befand sich eingangs der Herrengasse. Nicht weit davon, auf dem Kohlmarkt, gab es das Geschäft des Hofkonditors Demel, in dessen Schaufenster Ronald Reagan und Michail Gorbatschow als beinahe lebensgroße Zuckerpuppen posierten und dessen Inhaber, wusste Kersting aus einer Zeitung, die er sich gekauft hatte, in Ostasien flüchtig war.
Er stand am Michaelerplatz, gegenüber jenem Hause, das 1909, als es Adolf Loos umzubauen begann, der Firma Goldman und Salatsch gehörte. Die Säulen mit ihren grauen Marmorverkleidungen existierten noch. Die oberen Stockwerke hatten ihren glatten weißen Verputz. Die Fenster ohne alle Umrahmung hatte der Kaiser Franz Josef augenbrauenlos genannt, eine hübsche Metapher, doch Franz Josef hatte sie als vernichtenden Tadel gemeint. Die Empörung, die damals ganz Wien erfasst hatte wegen des Loos-Entwurfs und die zu einer Unterbrechung des Baugeschehens im Jahre 1910 führen würde, war inzwischen unbegreiflich geworden. Die Tragödie des Adolf Loos bestand unter anderem darin, dass er sich ausdrücklich als Traditionalist begriff und den Wienern damals als im höchsten Maße modern und umstürzlerisch erschien. Er entwarf mehr, als er baute. Noch seine Entwürfe blieben häufig bloß Sprache, statt wenigstens Bauskizze oder Modell zu sein. Verständlich die ohnmächtige Feindschaft dieses Mannes zu dem beängstigend produktiven Josef Hoffmann, den Loos verächtlich überquellend nannte.
Kersting war gekommen, ein Ausländerkonto zu eröffnen, damit ihm die dafür zuständige österreichische Behörde sein Arbeitsstipendium überweisen konnte. Er stand in der Schalterhalle. Er sagte sein Anliegen. Er musste seinen Reisepass vorweisen. Die Frau hinter dem Schalter durchblätterte die hellblauen Seiten, als sehe sie so was zum ersten Mal. Vielleicht sah sie es zum ersten Mal. Ihr Gesicht zeigte den Ausdruck beflissener Feindseligkeit. Sie bat Kersting um etwas Geduld. Sie ging davon, in Händen Kerstings Reisepass mit dem Abbild des DDR-Staatswappens auf dem Deckel. Kersting hatte Gelegenheit, die anderen Kunden und das übrige Personal zu betrachten.
Die in der langen Schalterhalle aufgestellten Computer-Monitore wuschen, so schien es, mit ihren Strahlungen aus den Angestellten alle Natürlichkeit fort. Die junge Beamtin, die schräg gegenüber von Kersting stand, hatte die Aura einer Untoten. Sämtliche Unterhaltungen erfolgten halblaut. Niemand, der nicht gemeint war, konnte von dem Mitgeteilten etwas verstehen. Die geraunten Laute standen für Konten, Beträge, Anlagen, Zinsen, Kredite, und alle verhielten sich, als sei dies etwas Obszönes.
Die Gesichter der Kunden waren den Mündern der Bankangestellten gierig lauschend zugeneigt. Eine Welle der Lüsternheit lief über ihre Mienen wie ein Lichtstrahl. Kersting stand neben einer mageren alten Dame. Ihr Hals war schlaff. Ihre Hände waren knotig und zeigten Altersflecken. Den Kupon, gegen den an der Kasse die gewünschte Auszahlung erfolgen sollte, erfasste sie, als handle es sich um ein zuckendes Tier oder ein männliches Genital. Der Wiener Seelenarzt Sigmund Freud, erinnerte sich Kersting, hatte das Geld dem Exkrement zugeordnet. Das Tabu ergab sich aus einem die Lust bloß mühsam zurückhaltenden Schamgefühl. Das Wiener Verhalten zum Geld war eine ins Unaufhörliche ausgedehnte anale Phase. Kersting wurde Zeuge eines analen Kapitalismus.
Die Beamtin, die Kersting bediente, kehrte zurück. Sie händigte Kersting eine Kunststoffkarte aus, dazu ein Bündel Scheckvordrucke in einer Kunststofftasche, alles in leuchtendem Gelb. Kersting setzte auf einen Vordruck seine Unterschrift. Der Gesichtsausdruck der Beamtin zeigte jetzt nur mehr Beflissenheit. Kersting war zum Teilhaber des analen Kapitalismus geworden.
6
Seine ersten Berührungen mit der Bildkunst verdankte er seinem Vater. Robert wollte, dass sein Sohn Jacob ihn immer bloß mit dem Vornamen anredete. Die Wörter Vater oder Papa, ihn betreffend, hasste er.
Robert war 1889 geboren, wie Adolf Hitler, und stammte aus dem gleichen Leipziger Proletarierviertel, in dem Walter Ulbricht groß geworden war. Roberts Vater war ein Mann mit rundem Gesicht und einer groben Nase gewesen: So blickte er von zwei bräunlichen Fotografien in Postkartengröße, in einem Album, das bei Robert im Bücherregal stand. Jacob blätterte manchmal darin. Die Bilder rochen stockfleckig. Robert und Roberts Vater, wusste der Junge, waren einander ähnlich gewesen in den Ausmaßen ihrer Hartnäckigkeit. Als Robert sich weigerte, in die väterliche Zigarrenmacherwerkstatt einzutreten, wurde er nach einer langen lautstarken Auseinandersetzung mit Worten, auch mit wiederholten Faustschlägen auf die Tischplatte, aus dem Haus getrieben.
Robert trat eine Lehre an in Leipzig-Stötteritz, bei einem 1873 gegründeten Unternehmen, das Textilmaschinen produzierte. Er lebte drei Jahre lang in einem Männerheim. Dann erhielt er seinen Gesellenbrief und ging sofort nach Süddeutschland, später nach Italien. Sechzehn Monate blieb er in der Toskana, Pistoia, wo er sich der anarchistischen Alianza della Rivoluzione Sociale von Errico Malatesta anschloss. Die Werkstätten und Fabriken, in denen er arbeitete, achteten ihn seiner Geschicklichkeit wegen. Als er nach Deutschland heimkehrte, weil er von Bremerhaven aus sich nach New York einschiffen wollte, begann der Erste Weltkrieg.
Statt auf dem norwegischen Dampfer Sör-Töndelag fand er sich wieder auf dem Mannschaftsdeck eines Schulschiffs der kaiserlichen deutschen Kriegsmarine, mit dem Heimathafen Kiel. Anschließend tat er als Obermatrose Dienst auf einem im Mittelmeer dümpelnden Schlachtschiff, das die Häfen des türkischen Verbündeten beschützen musste. Bei einer Schießerei mit britischen Kanonenbooten lief dieser Kreuzer, mit Namen Breslau, türkisch Midilli, auf eine Mine, dass er auseinanderbrach, Heck und Steven schräg in die Höhe gestellt. Die Besatzung sprang schreiend ins Wasser. Schwamm, wo des Schwimmens fähig, über eine Stunde, zwei englische Kriegsschiffe fischten die Überlebenden dann auf, unter ihnen Robert.
Reichliche zwei Jahre verbrachte er als Kriegsgefangener auf einer Festung der zu England gehörigen Mittelmeerinsel Malta. Damals begann er zu zeichnen, aus Langeweile, seine Hände zeigten sich auch darin geschickt. Im Frühjahr 1919 wurde er erst in einem Frachtschiff nach Apulien, danach, in einem mehrtägigen Güterbahntransport von Süden nach Norden, durch die gesamte italienische Halbinsel gefahren. In Wilhelmshaven das Feuer unter den Kesseln fortzureißen und die rote Fahne zu hissen, kam er zu spät, obwohl er das Bedürfnis dazu jedenfalls besessen hätte. Als er von Fürth, wo er vorübergehend in Arbeit stand, nach Leipzig fahren wollte, gelangte er bloß bis ins Vogtland. Der Zug wurde angehalten auf freier Strecke. Im Schotter des Bahndammes standen mehrere düstere Männer, Gewehr in der Hand und Signalbinde am rechten Arm. Einer schwenkte eine rote Fahne. Die Menschen sollten ihre Sache in die eigenen Hände nehmen, frei werden von jeglichem Zwang, voran dem ökonomischen, und eine Ordnung errichten, die das Ende war von aller bekannten Ordnung. Das klang sehr nach kollektivem Anarchismus. Augenblicklich beschloss Robert, sich den Männern anzuschließen und sich unter das Kommando ihres Anführers zu stellen, der Max Hoelz hieß.
Robert erlebte ihn als einen Menschen mit der unwiderstehlichen Anziehungskraft des edlen Räubers, wie schon der erfundene Karl Moor und der historische Schinderhannes einer gewesen waren. Einige Zeit behauptete sich ihr Aufstand. Dann befand sich die Reichswehr des sozialdemokratischen Ministers Noske gegen sie auf dem Vormarsch, Max Hoelz löste seine Armee auf und floh mit einigen seiner Freunde, darunter Robert, über die deutsch-tschechische Grenze.
Sie übernachteten in Heuschobern, wateten durch überschwemmte Wiesen und hatten ständig die böhmische Polizei hinter sich. Hoelz wurde aus einem Eisenbahnzug heraus verhaftet, in Marienbad. Robert gelangte bis Prag, wo er einem Mann, der offenbar unter materieller Not litt, auf einem Bahnhofsperron statt der angebotenen silbernen Taschenuhr dessen Identitätspapier und Namen abkaufte. Damit würde er die nächsten Jahre leben. Manchmal fertigte er auf Märkten Zeichnungen, Kohle auf bräunlichem Papier, die Abbilder von dafür zahlenden Passanten.
Als das Deutsche Reich eine politische Amnestie erließ, kehrte er zu seinem Geburtsnamen zurück. Bald darauf wurde er aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen, wegen seiner anarchistischen Neigungen. Er wechselte die Arbeitsplätze quer durch Deutschland, ein begabter Techniker und gefürchteter Querkopf, der mit seinem rednerischen Enthusiasmus gesamte Fabrikbelegschaften auf seine Seite und in die Rebellion treiben konnte. Seine Abende verbrachte er mit Fernstudien in seinem technischen Fach, außerdem vor Leinwänden, eine Weile lebte er in Dresden, wo er eine Art Abendschule für begabte Dilettanten besuchte, sie hieß Anderer Weg.
Robert, erinnerte sich Jacob, trug das Haar immer zurückgekämmt. Robert hielt sich sehr aufrecht. Er hatte kräftige Schultern. Mit den Jahren ging ihm der Ruf eines technologischen Wundermannes voraus und war dann noch erheblicher als die demagogische Begabung, die, wer kannte sich schon aus in linken Bewegungen, meist für kommunistisch gehalten wurde. Robert leistete dem Vorschub, indem er nochmals seinen Versuch mit der KPD machte, anderthalb Jahre lang, aber wieder Schwierigkeiten mit dem Parteigehorsam bekam und wieder ausgeschlossen wurde.
Eine Bindung seines Lebens war die mit Jacobs Mutter gewesen. Er hatte sie mitgenommen an insgesamt vier Orte zwischen Niedersachsen und Schlesien. Eine schmale Person, sah Jacob auf den vorhandenen Fotografien, mit Seitenscheitel und mit kurzgeschnittenem schwarzem Haar. Sie war bei der Geburt des Jungen gestorben.
Robert wurde für Jacob mehr, als Väter für andere Kinder waren. Das Kommen und Gehen von Frauenspersonen in ihren Wohnungen war dem Jungen vertraut. Er rief sie, wie Robert, bei ihren Vornamen. In der Chemnitzer Zeit gab es zuletzt Gerda, die gerne Seidenblusen zu gestreiften Männerhosen trug und sehr mager war, eine Schauspielerin ohne Engagement, beschäftigt als Directrice in einem Zwischenmeisterbetrieb für Damenmoden. Sie lachte gern. Ihr Lachen schlug immer um in einen Anfall von Raucherhusten.
Da er sich seiner Unentbehrlichkeit in der beruflichen Arbeit sicher war, weigerte sich Robert, zu den entsprechenden Anlässen eine Hakenkreuzfahne vors Fenster zu setzen. Bei dem darauf erfolgenden Besuch des NS-Blockwarts sagte er, dass er seine Fahne nicht finden könne, auf eine mehr oder minder es nicht ankomme, angesichts des eindrucksvoll auf der Straße sichtbaren Fahnenwalds, die Beflaggung tauge deswegen eher zum Ausweis für die Gesinnungstreue, das wolle man aber auch so sagen, es müssten nicht vaterländische Gründe vorgeschützt und statt dessen eine gesetzliche Verordnung erlassen werden. Der Obmann hörte das an. Er wusste eine passende Antwort nicht. Robert blieb bei seiner Weigerung. Der NS-Blockwart unternahm keinen weiteren Besuch in der Sache.
Die dunkle Verachtung, die Robert seiner Existenz wegen auf sich zog, ließ seinen Sohn Jacob nicht aus. Der sehnte sich insgeheim, ein gewöhnliches Leben zu haben wie andere Jungen. Manchmal wurde er eingeladen, zu einer Geburtstagsfeier, dort gab es Mütter und Großmütter, auch Geschwister. Bei ihm daheim gab es immer bloß Gerda, die nach verbranntem Tabak roch und mit heiserer Stimme redete.
Nicht einmal Gerda gab es dann mehr. Sie wurde verehrt von einem Fliegerleutnant, der häufig mit einem Strauß Rosen vor der Tür von Roberts Wohnung wartete. Schließlich ging Gerda fort, um ihren Luftwaffenoffizier zu heiraten. Nicht lange danach zog Robert mit Jacob aus Chemnitz fort.
7
Kersting erwarb eine Benutzerkarte für die Österreichische Nationalbibliothek. Sie wurde ihm ausgestellt ohne viel Aufhebens. Die kleine braune Pappkarte würde ihm Eintritt in den Lesesaal und die Lektüre dort erhältlicher Bücher sowie die Herstellung von Fotokopien ermöglichen.
Zuvor würde er seinen Mantel in einem Schrank verschließen. Der Lesesaal war in der Ausdehnung groß, in der Stimmung feierlich und etwas verschlafen. Er roch nach trockenem Staub und vergilbten Folianten. Kersting liebte die Lesesäle in alten Bibliotheken.
Wenn er das Gebäude verließ und auf die Freitreppe trat, sah er direkt über sich den Balkon, auf dem 1938 Adolf Hitler gestanden hatte, um zu den Wienern zu reden. Statt wie jetzt mit wartenden Fahrzeugen war der riesige Platz damals angefüllt gewesen mit Zehntausenden von Menschen, die genaue Anzahl hatte niemand je ermitteln wollen. Die beiden pompösen Heroendenkmäler in der Platzmitte stellten den Prinzen Eugen dar und den Erzherzog Carl, Sieger gegen Napoleon in der Schlacht bei Aspern. Die Reiterstandbilder waren Arbeiten eines geisteskranken Bildhauers namens Anton Dominik Fernkorn, der zur Zeit ihrer Fertigstellung schon im Irrenhaus saß. Zuletzt wurde erforderlich, dass man ihn für einige Stunden am Tag in seine Werkstätten entließ. Fernkorns Atelier hatte später der Maler Hans Makart übernommen, dessen riesige Historien- und Festbilder das ästhetische Entsetzen von Leuten wie Josef Hoffmann und Adolf Loos waren.
Kersting ging weiter durch die Alte Hofburg. In den Höfen roch es nach süßlichem Pferdeurin, Folge der hier unentwegt paradierenden Fiaker. Kersting wusste, über eine der dämmerigen Stiegen war Mary Vetsera zu ihrem Geliebten Rudolf geschlichen, das gierige Nymphchen zu dem todessüchtigen Erben eines morbiden Riesenreichs. In der kleinen fensterlosen Trafik standen beieinander zwei Kutscher. Sie hatten ihre Bowler ins rote Genick geschoben. Sie hielten Henkelgläser mit Silvaner in den Händen. Aber’s hat ja so kommen müssen, Wein gaberts ja noch gnua, sagte der eine. Das Gelächter des anderen klang wie eine Entleerung. Die lächelnde Trafikantin schnitt Faschiertes in Scheiben, die sie, eine nach der anderen, auf eine Waage legte. Kersting probierte die Vorstellung, er würde ständig in Wien leben.
Die Gluckgasse lag in der Inneren Stadt. In der Nähe befand sich der Neue Markt mit der Kapuzinerkirche und der Kapuzinergruft, wo die Gebeine der Habsburger beigesetzt waren in steinernen oder erzenen Sarkophagen. Wo die Besucher, in täglichen Strömen eingelassen, teilhaben konnten an der Wiener Neigung zu schauriger Erhabenheit und pompösem Sterben.
Die einfachen Wiener Gaststätten machten ihre täglichen Angebote bekannt durch Holztafeln mit Kreideaufschriften, hingestellt neben die Eingänge. Das Beißl an der Gluckgasse befand sich im Souterrain. Man musste von der Straße her Stufen hinabgehen, um einzutreten. Die Speisekarte versprach eine fette bäuerliche Küche, die träge, widerstandslos, auch bösartig machte. Jetz sauf i mi ein, sagte an Kerstings Nebentisch ein dicker Mensch, als die Serviererin ein mit Veltliner gefülltes Viertelliterglas vor ihn hinstellte. Er trug einen grauen Vollbart über einem geöffneten Hemdkragen. Er war vielleicht ein Künstler und benahm sich gemäß den Vorstellungen, die in Wien von Künstlern existierten.
An Kerstings Tisch saß eine junge Frau. Sie stocherte in ihren gerösteten Nierndln. Unvermittelt ließ sie Kersting wissen, dass sie das Kesseltreiben gegen den österreichischen Bundespräsidenten unerträglich finde. Was immer der Waldheim getan habe, es sei jedenfalls unmöglich, dass ein ordentliches Staatsoberhaupt auf den Druck der Straße hin oder wegen Einflussnahme aus dem Ausland sich sein Amt aberkennen lassen müsse. Weil, da würde bloß die Selbstachtung von einem Staat angegriffen und natürlich von dessen Bevölkerung. Bei anderen Ländern gebe es das auch nicht, bitte, des könnens nur mit uns machen. Nein, erwiderte höflich Kersting und nannte den Fall des früheren US-amerikanischen Präsidenten Nixon. Die junge Frau wiegte zweiflerisch ihren Kopf. Sie hatte davon vielleicht gehört, aber sie erinnerte sich nicht mehr genau. Übergangslos bestellte sie sich einen ungespritzten Wein. Woher Kersting kam? Berlin. Na Servas. Die junge Frau war in Berlin gewesen. Sehr sonderbare Stadt und von wegen Berliner Luft. Die Kellnerin räumte hastig das Geschirr fortgegangener Touristen beiseite. Wieder ohne Übergang: Politik sei eine dreckige Sache, und wer sich damit einlasse, wolle sowieso bloß seinen persönlichen Vorteil. Kersting wusste keine Entgegnung, die Frau wollte auch keine hören. Sie verlangte nach ihrer Rechnung. Als sie aufgestanden war, sah Kersting, dass sie mit dem linken Bein lahmte.
In dem Studentenhotel begegnet ihm, als er den Lift verließ, auf dem Korridor ein junger Mensch, der in der rechten Hand einen kleinen gläsernen Kaffeekrug hielt und in der linken einen Teller mit gebutterten Weißbrotscheiben. Unter dem rechten Arm trug er eine Tageszeitung, blaue Balken im schwarzweißen Schriftbild, Kersting las die Wörter Bundespräsident Waldheim wird nicht. Der junge Mann war bleich und offenbar übernächtigt. Das Haar hing ihm schwarzsträhnig in die Stirn. Er trug eine Brille mit starken Gläsern. Er fiel Kersting auf wegen seiner etwas ungelenken Bewegungen.
8
In das Weichbild von Grotenweddingen ragten von Ferne sichtbar drei Berge. Aus einem von ihnen wuchs eine pompöse Schlossanlage. Die Obstbaumblüte geschah hier zwei Wochen später als beispielsweise in Chemnitz, und der andere Unterschied zu der Stadt, aus der Jacob und Robert kamen, waren die Dächer, die in Chemnitz aus Schiefer bestanden und hier aus rot gebrannten Ziegeln. Die darunter befindlichen Häusermauern waren in Grotenweddingen Fachwerk, manche mit Klinkern zwischen dunkelbraunen Stielen, manche mit weiß oder lindgrün gekalktem Lehm. Gebäude aus Klinkern standen zum Beispiel am Marktplatz oder in der Breiten Straße und hatten geschnitzte Balkenköpfe, deren Muster eine farbige Halbrosette war.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!