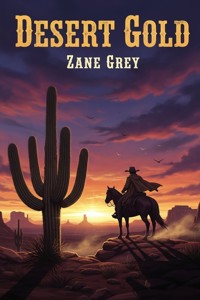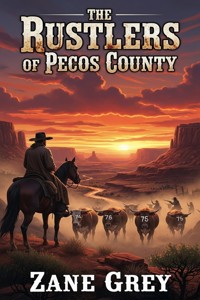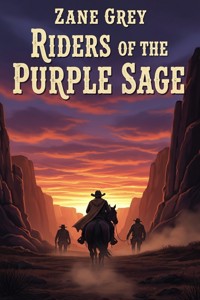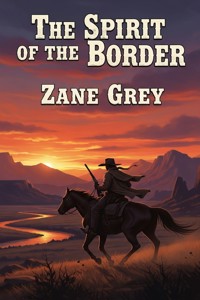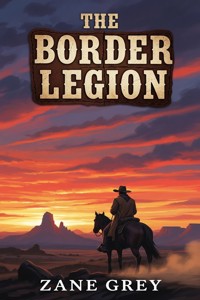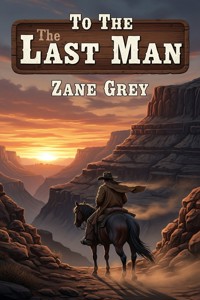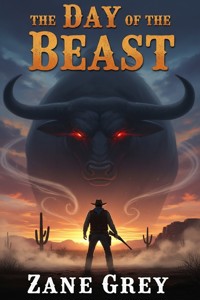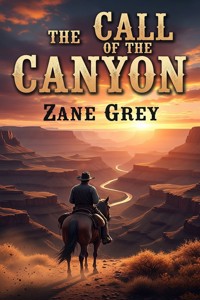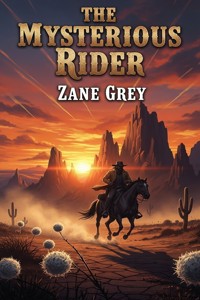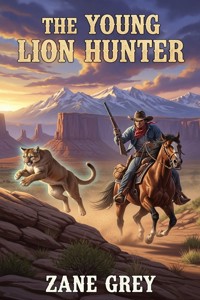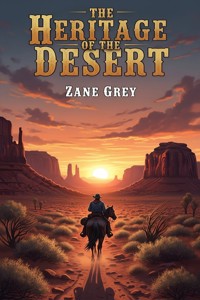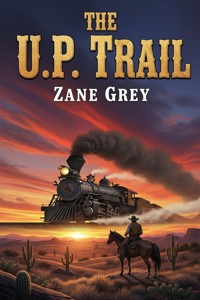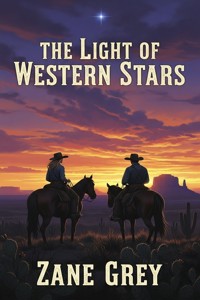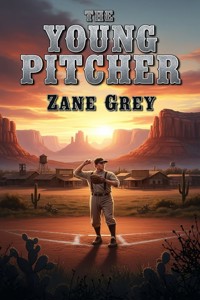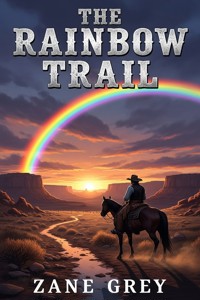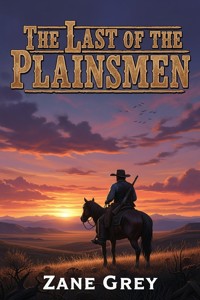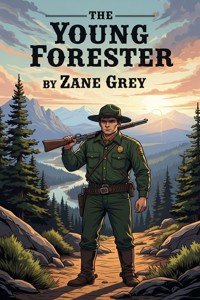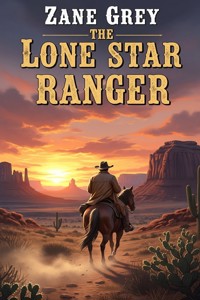0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"Die Reiter der purpurnen Salbei" ist einer der bekanntesten Wildwestromane von Zane Grey, dem berühmtesten Autor von Western. Der Roman erzählt die Geschichte von den drei Hauptfiguren Bern Venters, Jane Withersteen und Jim Lassiter, die in der Stadt Cottonwoods, Utah, auf unterschiedliche Weise mit der Verfolgung durch die örtliche Mormonengemeinschaft unter der Führung von Bischof Dyer und Elder Tull zu kämpfen haben. Zane Grey (1872-1939) war ein amerikanischer Schriftsteller, der vor allem durch seine Wildwestromane bekannt wurde. Die Romane zeigen Greys Liebe für die Landschaften und die Menschen des Westens, sie bieten oft eine romantische Liebesgeschichte und sind bei weitem nicht so aktionsbetont wie moderne Westernromane. Grey präsentierte den Städtern des amerikanischen Ostens den Westen und seine Ehr- und Moralbegriffe oft als positives Gegenbild . Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Die Reiter der purpurnen Salbei
Inhaltsverzeichnis
KAPITEL I. LASSITER
Das scharfe Klirren der eisenbeschlagenen Hufe verstummte, und gelbe Staubwolken zogen von den Baumwollbäumen über die Salweide hinaus.
Jane Withersteen blickte mit verträumten und besorgten Augen den weiten purpurnen Hang hinunter. Ein Reiter hatte sie soeben verlassen, und es war seine Botschaft, die sie nachdenklich und fast traurig stimmte, in Erwartung der Kirchenmänner, die ihr das Recht, sich mit einem Heiden anzufreunden, übel nehmen und angreifen würden.
Sie fragte sich, ob die Unruhen und Streitigkeiten, die in letzter Zeit in das kleine Dorf Cottonwoods gekommen waren, auch sie betreffen würden. Und dann seufzte sie und erinnerte sich daran, dass ihr Vater diese entlegenste Grenzsiedlung im Süden Utahs gegründet und ihr hinterlassen hatte. Ihr gehörten das gesamte Gelände und viele der Hütten. Das Withersteinhaus gehörte ihr, und die große Ranch mit ihren Tausenden von Rindern und den schnellsten Pferden der Salbei. Ihr gehörte die Bernsteinquelle, das Wasser, das dem Dorf Grün und Schönheit verlieh und das Leben in dieser wilden, purpurnen Hochlandwüste ermöglichte. Was auch immer mit Cottonwoods geschah, sie konnte sich dem nicht entziehen.
Das Jahr 1871 markierte einen Wandel, der sich im Leben der friedliebenden Mormonen an der Grenze allmählich vollzog. Glaze-Stone Bridge-Sterling, die Dörfer im Norden, hatten sich gegen das Eindringen nichtmormonischer Siedler und die Überfälle von Viehdieben erhoben. Es gab Widerstand gegen die einen und Kämpfe gegen die anderen. Und nun war Cottonwoods aufgewacht und hatte sich aufgerappelt und war hart geworden.
Jane betete, dass die Ruhe und Süße ihres Lebens nicht dauerhaft gestört werden würde. Sie wollte so viel mehr für ihr Volk tun, als sie es bisher getan hatte. Sie wünschte sich, dass die schläfrigen, ruhigen Pastorentage immer andauern würden. Ärger zwischen den Mormonen und den anderen Menschen, die nicht Mormonen sind, in der Gemeinde würde sie unglücklich machen. Sie war eine gebürtige Mormonin und eine Freundin der armen und unglücklichen Nichtmormonen. Sie wünschte sich nur noch, weiterhin Gutes zu tun und glücklich zu sein. Und sie dachte daran, was diese große Ranch für sie bedeutete. Sie liebte alles - den Pappelhain, das alte Steinhaus, das bernsteinfarbene Wasser, die Herden zotteliger, staubiger Pferde und Mustangs, die schlanken, reinrassigen Rennpferde, die grasenden Rinderherden und die mageren, sonnengebräunten Reiter der Salbei.
Während sie dort wartete, vergaß sie die Aussicht auf eine unvorhergesehene Veränderung. Das Wiehern eines trägen Esels durchbrach die nachmittägliche Stille, und es erinnerte sie an den schläfrigen Hof, die offenen Ställe und die grünen Luzernefelder. Ihre klare Sicht verstärkte den violetten Salbeihang, der sich vor ihr ausbreitete. Niedrige, prärieähnliche Böden fielen nach Westen hin ab. Dunkle, einsame Zedern, die nur vereinzelt zu sehen waren, stachen auffällig hervor, und in weiter Entfernung lagen Ruinen roter Felsen. Weiter oben am Hang erhob sich eine zerbrochene Mauer, ein riesiges Monument, das sich dunkelviolett abzeichnete und seinen einsamen, mystischen Weg zog, eine schwankende Linie, die im Norden verblasste. Hier, im Westen, war das Licht, die Farbe und die Schönheit. Nach Norden hin fiel der Hang zu einer düsteren Schluchtenlinie ab, aus der sich ein Aufschwung der Erde erhob, der nicht gebirgig war, sondern ein riesiger Haufen purpurner Hochebenen mit gerippten und fächerförmigen Wänden, burggekrönten Klippen und grauen Steilhängen. Über all das krochen die länger werdenden, abnehmenden Nachmittagsschatten.
Das schnelle Schlagen von Hufen rief Jane Withersteen auf den Plan. Eine Gruppe von Reitern galoppierte die Gasse hinauf, stieg ab und warf ihre Zügel ab. Sie waren sieben an der Zahl, und Tull, der Anführer, ein großer, dunkler Mann, war ein Ältester von Janes Kirche.
"Habt ihr meine Nachricht erhalten?", fragte er knapp.
"Ja", antwortete Jane.
"Ich habe diesem Reiter Venters eine halbe Stunde Zeit gegeben, um ins Dorf zu kommen. Er ist nicht gekommen."
"Er weiß nichts davon", sagte Jane. "Ich habe es ihm nicht gesagt. Ich habe hier auf dich gewartet."
"Wo ist Venters?"
"Ich habe ihn im Hof gelassen."
"Hier, Jerry", rief Tull und wandte sich an seine Männer, "nehmt die Bande und holt Venters hierher, wenn ihr ihn fesseln müsst."
Die staubgestiefelten und langspornigen Reiter preschten geräuschvoll in das Gehölz und verschwanden im Schatten.
"Elder Tull, was soll das heißen?", fragte Jane. "Wenn Ihr Venters verhaften müsst, könntet Ihr die Höflichkeit haben, zu warten, bis er mein Haus verlassen hat. Und wenn Sie ihn verhaften, würde das die Sache nur noch schlimmer machen. Es ist absurd, Venters zu beschuldigen, in die Schießerei im Dorf letzte Nacht verwickelt zu sein. Er war damals mit mir unterwegs. Außerdem hat er mir seine Waffen überlassen. Sie benutzen das nur als Vorwand. Was haben Sie mit Venters vor?"
"Das werde ich Ihnen gleich sagen", antwortete Tull. "Aber sagen Sie mir erst, warum Sie diesen wertlosen Reiter verteidigen?"
"Wertlos!", rief Jane entrüstet aus. "Er ist nichts dergleichen. Er war der beste Reiter, den ich je hatte. Es gibt keinen Grund, warum ich mich nicht für ihn einsetzen sollte, und jeden Grund, warum ich es tun sollte. Es ist keine kleine Schande für mich, Elder Tull, dass er durch meine Freundschaft die Feindschaft meines Volkes geweckt hat und ein Ausgestoßener geworden ist. Außerdem schulde ich ihm ewige Dankbarkeit dafür, dass er das Leben der kleinen Fay gerettet hat."
"Ich habe von deiner Liebe zu Fay Larkin gehört und davon, dass du sie adoptieren willst. Aber-Jane Withersteen, das Kind ist eine Nicht-Mormonin!"
"Ja. Aber, Elder, ich liebe die Mormonenkinder nicht weniger, weil ich ein nicht-mormonisches Kind liebe. Ich werde Fay adoptieren, wenn ihre Mutter sie mir schenken will."
"Ich bin nicht so sehr dagegen. Sie können dem Kind die mormonische Lehre vermitteln", sagte Tull. "Aber ich habe es satt, diesen Venters um dich herumhängen zu sehen. Ich werde dem ein Ende setzen. Sie haben so viel Liebe auf diese Bettler von Heiden zu verschwenden, dass ich mir vorstellen kann, dass Sie Venters lieben könnten."
Tull sprach mit der Arroganz eines Mormonen, dessen Macht nicht gebrochen werden konnte, und mit der Leidenschaft eines Mannes, in dem die Eifersucht ein verzehrendes Feuer entfacht hatte.
"Vielleicht liebe ich ihn wirklich", sagte Jane. Sie spürte, wie ihr Herz vor Angst und Wut schlug. "Daran habe ich nie gedacht. Armer Kerl! Er braucht sicher jemanden, der ihn liebt."
"Das wird ein schlimmer Tag für Venters, wenn Sie das nicht leugnen", erwiderte Tull grimmig.
Tulls Männer tauchten unter den Pappeln auf und führten einen jungen Mann auf die Gasse hinaus. Seine zerlumpten Kleider waren die eines Ausgestoßenen. Aber er stand groß und aufrecht, die breiten Schultern zurückgeworfen, die Muskeln seiner gefesselten Arme kräuselten sich, und in seinem Blick, den er auf Tull richtete, lag eine blaue Flamme des Trotzes.
Zum ersten Mal spürte Jane Withersteen Venters' wahren Geist. Sie fragte sich, ob sie diesen prächtigen Jungen lieben würde. Dann kühlte sich ihre Erregung ab und sie wurde sich der ernüchternden Tatsache bewusst, was auf dem Spiel stand.
"Venters, wirst du Cottonwoods sofort und für immer verlassen?", fragte Tull angespannt.
"Warum?", erwiderte der Reiter.
"Weil ich es befehle."
Venters lachte kühl und verächtlich.
Der Rote sprang auf Tulls dunkle Wangen.
"Wenn du nicht gehst, bedeutet das deinen Ruin", sagte er scharf.
"Ruin!", rief Venters leidenschaftlich. "Habt ihr mich nicht schon ruiniert? Was nennst du Ruin? Vor einem Jahr war ich noch ein Reiter. Ich hatte eigene Pferde und eigenes Vieh. Ich hatte einen guten Namen in Cottonwoods. Und jetzt hetzt ihr eure Männer auf mich, wenn ich ins Dorf komme, um diese Frau zu sehen. Ihr hetzt mich. Ihr verfolgt mich, als wäre ich ein Viehdieb. Ich habe nichts mehr zu verlieren - außer meinem Leben."
"Wirst du Utah verlassen?"
"Oh! Ich weiß", fuhr Venters spöttisch fort, "der Gedanke, dass die schöne Jane Withersteen einem armen Heiden freundlich gesinnt ist, macht dich krank. Du willst sie ganz für dich allein. Du bist ein verdammter Mormone. Du hast Verwendung für sie - und für das Withersteinhaus und Amber Spring und siebentausend Stück Vieh!"
Tulls harter Kiefer wölbte sich, und tobendes Blut schnürte die Adern seines Halses ein.
"Noch einmal. Wirst du gehen?"
"NEIN!"
"Dann werde ich dich auspeitschen lassen", erwiderte Tull barsch. "Ich werde dich im Salbei aussetzen. Und wenn du jemals zurückkommst, wird es dir noch schlechter gehen."
Venters' aufgeregtes Gesicht wurde kalt, und die bronzene Farbe veränderte sich.
Jane trat impulsiv einen Schritt vor. "Oh! Elder Tull!", rief sie. "Das werden Sie nicht tun!"
Tull hob ihr einen zitternden Finger entgegen.
"Das reicht von dir. Versteh doch, du darfst diesen Jungen nicht zu einer Freundschaft anhalten, die deinen Bischof beleidigt. Jane Withersteen, dein Vater hat dir Reichtum und Macht hinterlassen. Das hat dir den Kopf verdreht. Sie haben noch nicht begriffen, welchen Platz die mormonischen Frauen einnehmen. Wir haben mit Ihnen geredet, mit Ihnen ausgehalten. Wir haben geduldig gewartet. Wir haben dir deine Affäre erlaubt, was mehr ist, als ich je einer mormonischen Frau zugestanden habe. Aber du bist nicht zur Vernunft gekommen. Ein für allemal: Du kannst keine Freundschaft mehr mit Venters schließen. Er wird ausgepeitscht und muss Utah verlassen!"
"Oh! Peitscht ihn nicht aus! Das wäre heimtückisch!", flehte Jane mit der langsamen Gewissheit ihres schwindenden Mutes.
Tull stumpfte ihren Geist immer ab, und ihr wurde bewusst, dass sie eine Kühnheit vorgetäuscht hatte, die sie nicht besaß. Er tauchte jetzt in anderer Gestalt auf, nicht als eifersüchtiger Freier, sondern als Verkörperung des geheimnisvollen Despotismus, den sie von Kindheit an kannte - die Macht ihres Glaubens.
"Venters, willst du hier deine Prügel einstecken oder lieber in den Salbei gehen?", fragte Tull. Er lächelte ein furchterregendes Lächeln, das mehr als unmenschlich war, und doch schien es aus seiner dunklen Unnahbarkeit einen Schimmer von Rechtschaffenheit zu verbreiten.
"Ich werde es hier nehmen - wenn es sein muss", sagte Venters. "Aber bei Gott, Tull, du solltest mich lieber gleich umbringen. Das wäre eine teure Peitsche für dich und deine betenden Mormonen. Ihr macht mich noch zu einem Lassiter!"
Das seltsame Leuchten, das strenge Licht, das von Tulls Gesicht ausstrahlte, hätte eine heilige Freude über die geistige Vorstellung von erhabener Pflicht sein können. Aber da war noch etwas anderes in ihm, kaum verborgen, etwas Persönliches und Unheimliches, eine Tiefe seiner selbst, ein verschlingender Abgrund. So fanatisch und unerbittlich seine religiöse Stimmung war, so unbarmherzig würde sein körperlicher Hass sein.
"Ältester, ich bereue meine Worte", zögerte Jane. Die Religion in ihr, die lange Gewohnheit des Gehorsams, der Demut, aber auch die Qualen der Angst, sprachen aus ihrer Stimme. "Verschont den Jungen!", flüsterte sie.
"Du kannst ihn jetzt nicht retten", antwortete Tull schroff.
Ihr Kopf beugte sich vor dem Unvermeidlichen. Sie begriff die Wahrheit, als sich plötzlich eine sanfte Kraft in ihrer Brust zusammenzog und verhärtete. Wie eine Stahlstange versteifte sie alles, was in ihr weich und schwach gewesen war. Sie spürte, wie etwas Neues und Unverständliches in ihr geboren wurde. Noch einmal suchte ihr angestrengter Blick die Salbeipfade. Jane Withersteen liebte diese wilde, violette Wildnis. In Zeiten des Kummers war sie ihre Stärke gewesen, im Glück war ihre Schönheit ihre ständige Freude. In ihrer Not ertappte sie sich dabei, wie sie murmelte: "Woher kommt meine Hilfe!" Es war ein Gebet, als ob aus jenen einsamen purpurnen Weiten und roten Wänden und blauen Klüften ein furchtloser Mann hervorkäme, der weder an ein Glaubensbekenntnis noch an einen Wahn gebunden war und der eine schützende Hand über die Gesichter ihres rücksichtslosen Volkes halten würde.
Die unruhigen Bewegungen von Tulls Männern verstummten plötzlich. Dann folgte ein leises Flüstern, ein Rascheln, ein scharfer Ausruf.
"Seht!", sagte einer und deutete nach Westen.
"Ein Reiter!"
Jane Withersteen drehte sich um und sah einen Reiter, dessen Silhouette sich gegen den westlichen Himmel abzeichnete und der aus der Salweide ritt. Er war im goldenen Schein der Sonne von links herabgeritten und war bis kurz vor dem Ziel unbeobachtet geblieben. Eine Antwort auf ihr Gebet!
"Kennst du ihn? Kennt ihn irgendjemand?", fragte Tull hastig.
Seine Männer schauten und schauten, und einer nach dem anderen schüttelte den Kopf.
"Er ist von weit her gekommen", sagte einer.
"Das ist ein schöner Gaul", sagte ein anderer.
"Ein seltsamer Reiter."
"Er trägt schwarzes Leder", fügte ein vierter hinzu.
Mit einer Handbewegung, die zum Schweigen aufforderte, trat Tull so vor, dass er Venters verdeckte.
Der Reiter zügelte sein Pferd und schien mit einer geschmeidigen Vorwärtsbewegung in einem langen Schritt den Boden zu erreichen. Es war eine eigenartige Bewegung, weil sie so schnell war und weil der Reiter dabei nicht im Geringsten von der Front zu der Gruppe vor ihm abwich.
"Seht!", flüsterte heiser einer von Tulls Begleitern. "Er hat zwei schwarze Gewehre bei sich - tief unten - sie sind schwer zu sehen"
"Ein Revolvermann!", flüsterte ein anderer. "Leute, seid vorsichtig, wenn ihr eure Hände bewegt."
Die langsame Annäherung des Fremden hätte eine gemächliche Gangart sein können oder die verkrampften, kurzen Schritte eines Reiters, der es nicht gewohnt war, zu gehen; doch ebenso gut hätte es das vorsichtige Voranschreiten eines Mannes sein können, der kein Risiko einging.
"Hallo, Fremder!", rief Tull. In dieser Begrüßung lag kein Willkommen, nur eine schroffe Neugierde.
Der Reiter antwortete mit einem knappen Nicken. Die breite Krempe eines schwarzen Sombreros warf einen dunklen Schatten auf sein Gesicht. Einen Moment lang betrachtete er Tull und seine Kameraden genau, dann hielt er in seinem langsamen Schritt inne und schien sich zu entspannen.
"Guten Abend, Ma'am", sagte er zu Jane und nahm seinen Sombrero mit malerischer Anmut ab.
Als Jane ihn begrüßte, blickte sie in ein Gesicht, dem sie instinktiv vertraute und das ihre Aufmerksamkeit fesselte. Es hatte alle Merkmale des Fernreiters - die Magerkeit, den roten Sonnenbrand und die Unveränderlichkeit, die von Jahren der Stille und Einsamkeit herrührte. Aber es waren nicht diese Merkmale, die sie in ihren Bann zogen, sondern die Intensität seines Blicks, eine angestrengte Müdigkeit, eine durchdringende Wehmut des scharfen, grauen Blicks, als ob der Mann ewig nach dem suchte, was er nie fand. Janes feines weibliches Gespür spürte selbst in diesem kurzen Augenblick eine Traurigkeit, einen Hunger, ein Geheimnis.
"Jane Withersteen, Ma'am?", erkundigte er sich.
"Ja", antwortete sie.
"Das Wasser hier gehört Ihnen?"
"Ja."
"Darf ich mein Pferd tränken?"
"Gewiss. Dort ist der Trog."
"Aber vielleicht, wenn Sie wüssten, wer ich bin..." Er zögerte, den Blick auf die zuhörenden Männer gerichtet. "Vielleicht würdet ihr mir nicht erlauben, ihn zu tränken - obwohl ich nichts für mich verlange."
"Fremder, es spielt keine Rolle, wer du bist. Tränke dein Pferd. Und wenn du durstig und hungrig bist, komm in mein Haus."
"Danke, Ma'am. Ich kann es nicht für mich annehmen, aber für mein müdes Pferd..."
Das Getrampel der Hufe unterbrach den Reiter. Weitere unruhige Bewegungen von Tulls Männern lösten den kleinen Kreis auf und brachten den Gefangenen Venters zum Vorschein.
"Vielleicht habe ich etwas behindert - für ein paar Augenblicke vielleicht?", erkundigte sich der Reiter.
"Ja", antwortete Jane Withersteen mit einem Pochen in der Stimme.
Sie spürte die Anziehungskraft seiner Augen, und dann sah sie, wie er den gefesselten Venters, die Männer, die ihn festhielten, und ihren Anführer ansah.
"In diesem Land sind alle Viehdiebe, Diebe, Halsabschneider, Revolverhelden und alle anderen Taugenichtse zufällig Nichtmormonen. Ma'am, zu welcher Klasse der Taugenichtsen gehört dieser junge Mann?"
"Er gehört zu keiner von ihnen. Er ist ein ehrlicher Junge."
"Sie wissen das, Ma'am?"
"Ja, ja."
"Was hat er dann getan, dass er so gefesselt wurde?"
Seine klare und deutliche Frage, die sowohl an Tull als auch an Jane Withersteen gerichtet war, brachte die Unruhe zum Schweigen und sorgte für einen Moment der Stille.
"Frag ihn", antwortete Jane mit hoch erhobener Stimme.
Der Reiter entfernte sich von ihr, mit demselben langsamen, gemessenen Schritt, mit dem er sich ihr genähert hatte, und die Tatsache, dass er sie ganz zur Seite schob und ihn nicht näher an Tull und seine Männer heranbrachte, hatte eine durchdringende Bedeutung.
"Junger Mann, sprechen Sie", sagte er zu Venters.
"Hier, Fremder, das geht dich nichts an", begann Tull. "Versuche nicht, dich einzumischen. Du wurdest gebeten, zu trinken und zu essen. Das ist mehr, als du in jedem anderen Dorf an der Grenze zu Utah bekommen hättest. Tränke dein Pferd und mach dich auf den Weg."
"Ruhig, ruhig - ich mische mich noch nicht ein", antwortete der Reiter. Der Ton seiner Stimme hatte sich verändert. Ein anderer Mann hatte gesprochen. War er bei der Ansprache an Jane noch mild und sanft gewesen, so war er jetzt, bei seiner ersten Rede an Tull, trocken, kühl und bissig. "Ich bin gerade über ein seltsames Geschäft gestolpert. Sieben Mormonen, alle mit Gewehren bewaffnet, und ein Heide, der mit einem Seil gefesselt ist, und eine Frau, die auf seine Ehrlichkeit schwört! Seltsam, nicht wahr?"
"Seltsam oder nicht, das geht dich nichts an", erwiderte Tull.
"Wo ich aufgewachsen bin, galt das Wort einer Frau als Gesetz. Da bin ich noch nicht ganz rausgewachsen."
Tull schwankte zwischen Erstaunen und Wut.
"Meddler, wir haben hier ein ganz anderes Gesetz als die Launen der Frauen - das mormonische Gesetz! Pass auf, dass du es nicht übertrittst."
"Zum Teufel mit eurem mormonischen Gesetz!"
Die absichtliche Rede markierte einen weiteren Wechsel des Reiters, diesmal von freundlichem Interesse zu einer erwachenden Bedrohung. Sie bewirkte eine Verwandlung bei Tull und seinen Begleitern. Der Anführer keuchte und taumelte zurück angesichts der blasphemischen Beleidigung einer Institution, die ihm heilig war. Jerry, der die Pferde hielt, ließ das Zaumzeug fallen und erstarrte auf der Stelle. Die anderen Männer standen wie Pfosten, mit starren Armen und warteten.
"Sprich jetzt, junger Mann. Was hast du getan, dass du auf diese Weise gefesselt wurdest?"
"Das ist eine verdammte Unverschämtheit!", platzte Venters heraus. "Ich habe nichts Unrechtes getan. Ich habe diesen Mormonenältesten beleidigt, weil ich mit dieser Frau befreundet bin."
"Ma'am, ist es wahr, was er sagt?", fragte der Reiter Jane, aber seine zitternden, aufmerksamen Augen wichen nicht von dem kleinen Knäuel stiller Männer.
"Wahr? Ja, es stimmt", antwortete sie.
"Nun, junger Mann, mir scheint, einer solchen Frau ein Freund zu sein, wäre etwas, dem du nicht helfen willst und nicht helfen kannst.... Was wird man mit dir dafür machen?"
"Sie wollen mich auspeitschen. Du weißt, was das bedeutet - in Utah!"
"Ich denke schon", antwortete der Reiter langsam.
Der graue Blick der Mormonen, das unruhige Scharren der Pferde, Jane, die ihre aufsteigende Erregung nicht unterdrücken konnte, und Venters, der bleich und regungslos dastand, verstärkten die Spannung des Augenblicks. Tull brach den Bann mit einem Lachen, einem Lachen ohne Heiterkeit, einem Lachen, das nur ein Laut war, der Angst verriet.
"Kommt, Männer!", rief er.
Jane Withersteen wandte sich wieder an den Reiter.
"Fremder, kannst du nichts tun, um Venters zu retten?"
"Ma'am, Sie bitten mich, ihn zu retten - vor Ihren eigenen Leuten?"
"Bitten? Ich flehe dich an!"
"Aber Sie ahnen ja nicht, wen Sie da bitten."
"Oh, Herr, ich flehe Sie an - retten Sie ihn!"
"Das sind Mormonen, und ich..."
"Um jeden Preis - rettet ihn. Denn ich - Ich habe ihn gern!"
Tull knurrte "Du liebeskranker Narr! Verrate deine Geheimnisse. Es wird einen Weg geben, dich zu lehren, was du nie gelernt hast.... Kommt, Männer, raus hier!"
"Mormon, der junge Mann bleibt", sagte der Reiter.
Wie ein Schuss ließ seine Stimme Tull innehalten.
"Was!"
"Wer soll ihn festhalten? Er ist mein Gefangener!", rief Tull hitzig. "Fremder, ich sage dir noch einmal - misch dich hier nicht ein. Du hast dich schon genug eingemischt. Geh jetzt, oder..."
"Hör zu!... Er bleibt."
Absolute Gewissheit, über jeden Schatten eines Zweifels erhob sich die tiefe Stimme des Reiters.
"Wer bist du? Wir sind hier sieben."
Der Reiter ließ seinen Sombrero fallen und machte eine rasche Bewegung, die insofern eigenartig war, als sie ihn etwas geduckt zurückließ, die Arme angewinkelt und steif, die großen schwarzen Gewehrscheiden nach vorne geschwungen.
"LASSITER!"
Es war Venters' verwunderter, aufregender Schrei, der die verhängnisvolle Verbindung zwischen der eigenartigen Position des Reiters und dem gefürchteten Namen herstellte.
Tull streckte eine tastende Hand aus. Das Leben in seinen Augen verdunkelte sich zu der Düsternis, mit der Männer in seiner Angst das Nahen des Todes sahen. Doch der Tod schwebte zwar über ihm, stieg aber nicht herab, denn der Reiter wartete auf die zuckenden Finger, auf das Abwärtsblitzen der Hand, das nicht kam. Tull nahm sich zusammen und ging zu den Pferden, begleitet von seinen blassen Kameraden.
KAPITEL II. COTTONWOODS
Venters schien zu tief bewegt, um die Dankbarkeit, die sein Gesicht ausdrückte, in Worte zu fassen. Und Jane wandte sich dem Retter zu und ergriff seine Hände. Ihr Lächeln und ihre Tränen schienen ihn zu betäuben. Als bald so etwas wie Ruhe einkehrte, ging sie zu Lassiters müdem Pferd.
"Ich werde es selbst tränken", sagte sie und führte das Pferd zu einer Tränke unter einem großen alten Schwarzpappel Baum. Mit flinken Fingern löste sie das Zaumzeug und nahm das Gebiss ab. Das Pferd schnaubte und legte den Kopf schief. Der Trog war aus massivem Stein, ausgehöhlt, moosbewachsen und grün und feucht und kühl, und das klare braune Wasser, das ihn speiste, spritzte und plätscherte aus einem Holzrohr.
"Hat er dich heute weit gebracht?"
"Ja, Ma'am, über sechzig Meilen, vielleicht siebzig."
"Ein langer Ritt - ein Ritt, der - ach, er ist blind!"
"Ja, Ma'am", antwortete Lassiter.
"Was hat ihn blind gemacht?"
"Einige Männer haben ihn einmal gefesselt und ihm dann ein weißes Eisen an die Augen gehalten."
"Oh! Männer? Du meinst Teufel.... Waren das eure Feinde - Mormonen?"
"Ja, Ma'am."
"Um sich an einem Pferd zu rächen! Lassiter, die Männer meines Glaubens sind unnatürlich grausam. Zu meinem ewigen Leidwesen gebe ich es zu. Sie wurden getrieben, gehasst, gegeißelt, bis ihre Herzen verhärtet waren. Aber wir Frauen hoffen und beten für die Zeit, in der unsere Männer sich erweichen lassen werden."
"Ich bitte um Verzeihung, Ma'am - diese Zeit wird nie kommen."
"Oh, doch!... Lassiter, glaubst du dass die Frauen der Mormonen böse sind? War deine Hand auch gegen sie gerichtet?"
"Nein. Ich glaube, die Mormonenfrauen sind die besten und edelsten, die langmütigsten und die blindesten, unglücklichsten Frauen auf Erden."
"Ah!" Sie warf ihm einen ernsten, nachdenklichen Blick zu. "Dann wirst du mit mir das Brot brechen?"
Lassiter hatte keine Antwort parat und verlagerte unruhig sein Gewicht von einem Bein auf das andere und drehte seinen Sombrero in den Händen hin und her. "Ma'am", begann er, "ich nehme an, Ihre Herzensgüte lässt Sie über manche Dinge hinwegsehen. Vielleicht bin ich hier in der Gegend nicht sehr bekannt, aber im Norden gibt es Mormonen, die bei dem Gedanken, dass ich mit Ihnen am Tisch sitze, unruhig in ihren Gräbern ruhen würden."
"Das kann man wohl sagen. Aber - willst du es trotzdem tun?", fragte sie.
"Vielleicht haben Sie einen Bruder oder einen Verwandten, der vorbeikommen und beleidigt sein könnte, und ich würde nicht wollen..."
"Ich habe keinen einzigen Verwandten in Utah, von dem ich weiß. Es gibt niemanden, der das Recht hat, mein Handeln in Frage zu stellen." Sie wandte sich lächelnd an Venters. "Du wirst reinkommen, Bern, und Lassiter wird auch reinkommen. Wir werden essen und fröhlich sein, solange wir können."
"Ich frage mich nur, ob Tull und seine Männer unten im Dorf einen Sturm entfachen werden", sagte Lassiter in seiner letzten schwächelnden Haltung.
"Ja, er wird den Sturm aufziehen - nachdem er gebetet hat", antwortete Jane. "Komm."
Sie ging voran und hatte das Zaumzeug von Lassiters Pferd auf dem Arm. Sie betraten ein Wäldchen und gingen einen breiten Weg entlang, der von großen, niedrig verzweigten Schwarzpappeln beschattet wurde. Die letzten Strahlen der untergehenden Sonne warfen goldene Streifen durch die Blätter. Das Gras war tief und satt, ein willkommener Kontrast zu den salbeimüden Augen. Zwitschernde Wachteln hüpften über den Weg, und irgendwo in einer Baumkrone sang ein Rotkehlchen sein Abendlied, und in der stillen Luft schwebte die Frische und das Murmeln von fließendem Wasser.
Das Haus von Jane Withersteen stand in einem Kreis von Schwarzpappeln und war ein flaches, langgestrecktes Gebäude aus rotem Stein mit einem überdachten Hof in der Mitte, durch den ein lebhafter Strom bernsteinfarbenen Wassers floss. In den massiven Steinblöcken, dem schweren Gebälk und den soliden Türen und Fensterläden zeigte sich die Hand eines Mannes, der gegen Plünderung und Zeit gebaut hatte; und in den Blumen und Moosen, die den steingebetteten Bach säumten, in den leuchtenden Farben der Teppiche und Decken auf dem Hofboden und der gemütlichen Ecke mit Hängematte und Büchern und dem sauber gedeckten Tisch zeigte sich die Anmut einer Tochter, die für das Glück und den bevorstehenden Tag lebte.
Jane ließ Lassiters Pferd auf das dichte Gras los. "Du wirst wollen, dass er in deiner Nähe ist", sagte sie, "sonst würde ich ihn zu den Luzernenfeldern bringen lassen." Auf ihren Ruf hin erschienen die Frauen und begannen sofort, eilig hin und her zu laufen und den Tisch zu decken. Dann entschuldigte sich Jane und ging ins Haus.
Sie ging durch eine große Kammer mit niedrigen Decken, die wie das Innere einer Festung aussah, in eine kleinere, in der ein helles Holzfeuer in einem alten offenen Kamin loderte, und von dort in ihr eigenes Zimmer. Es hatte die gleiche Gemütlichkeit wie der heimelige Vorhof; außerdem war es warm und reich an sanften Farbtönen.
Selten betrat Jane Withersteen ihr Zimmer, ohne in ihren Spiegel zu schauen. Sie wusste, dass sie das Spiegelbild jener Schönheit liebte, die sie seit ihrer frühen Kindheit nie hatte vergessen dürfen. Ihre Verwandten und Freunde und später eine Schar mormonischer und nichtmormonischer Verehrer hatten die Flamme der natürlichen Eitelkeit in ihr entfacht. So dachte sie mit achtundzwanzig Jahren kaum noch an ihren wunderbaren Einfluss auf die kleine Gemeinde, die ihr Vater ihr praktisch als wohltätigen Grundherrn hinterlassen hatte, sondern kümmerte sich vor allem um den Traum, die Sicherheit und die Verlockung ihrer Schönheit. Diesmal jedoch blickte sie mit mehr als dem üblichen glücklichen Motiv in ihr Glas, ohne das übliche leichte bewusste Lächeln. Denn sie dachte an mehr als an den Wunsch, in ihren eigenen Augen, in denen ihres Freundes, schön zu sein; sie fragte sich, ob sie in den Augen dieses Lassiter, dieses Mannes, dessen Name die langen, wilden Bremsen aus Stein und die Ebenen der Weisen überquert hatte, dieses sanftmütigen, traurigen Mannes, der ein Hasser und Mörder der Mormonen war, schön erscheinen würde. Es war nicht mehr ihre übliche halbbewusste eitle Besessenheit, die sie antrieb, als sie eilig ihr Reitkleid gegen ein weißes tauschte und dann lange auf die stattliche Gestalt mit ihren anmutigen Konturen, auf das schöne Gesicht mit dem starken Kinn und den vollen, festen Lippen, auf die dunkelblauen, stolzen und leidenschaftlichen Augen blickte.
"Wenn ich ihn nur ein paar Tage, eine Woche, hier behalten kann, wird er nie wieder einen Mormonen töten", sinnierte sie. "Lassiter!... Ich erschaudere, wenn ich an diesen Namen denke, an ihn. Aber wenn ich den Mann ansehe, vergesse ich, wer er ist - ich mag ihn fast. Ich erinnere mich nur daran, dass er Bern gerettet hat. Er hat gelitten. Ich frage mich, was es war - hat er einmal eine Mormonin geliebt? Wie prächtig er sich für uns arme, unverstandene Seelen eingesetzt hat! Irgendwie weiß er - viel."
Jane Withersteen gesellte sich zu ihren Gästen und bat sie, an ihre Tafel zu gehen. Sie entließ ihre Frau und bediente sie mit ihren eigenen Händen. Es war ein reichhaltiges Abendessen und eine seltsame Gesellschaft. Zu ihrer Rechten saß der zerlumpte und halbverhungerte Venters; und obwohl blinde Augen hätten sehen können, welchen Anteil er an der Summe ihres Glücks hatte, sah er doch wie der düstere Ausgestoßene aus, zu dem ihn seine Treue gemacht hatte, und um ihn herum war der Schatten des von Tull vorausgesagten Verderbens. Zu ihrer Linken saß Lassiter in seinem schwarzen Lederkleid und sah aus wie ein Mann in einem Traum. Er war weder hungrig, noch gefasst, noch sprach er, und als er sich in häufigen unruhigen Bewegungen drehte, schlugen die schweren Waffen, die er nicht abgenommen hatte, gegen die Tischbeine. Wäre es sonst möglich gewesen, die Anwesenheit Lassiters zu vergessen, so hätten diese kleinen Gläser es unwahrscheinlich gemacht. Und Jane Withersteen redete und lächelte und lachte mit dem ganzen schillernden Spiel von Lippen und Augen, das eine schöne, kühne Frau für ihren Zweck aufbringen konnte.
Als das Essen beendet war und die Männer ihre Stühle zurückstellten, beugte sie sich näher zu Lassiter und sah ihm direkt in die Augen.
"Warum sind Sie nach Cottonwoods gekommen?"
Ihre Frage schien einen Bann zu brechen. Der Reiter erhob sich, als hätte er sich gerade an sich selbst erinnert und länger verweilt, als er es gewohnt war.
"Ma'am, ich habe in ganz Süd-Utah und Nevada nach etwas gejagt. Und durch Ihren Namen habe ich erfahren, wo ich es finde - hier in Cottonwoods (Schwarzpappel)."
"Mein Name! Oh, ich erinnere mich. Du kanntest meinen Namen, als du zuerst gesprochen hast. Sag mir, wo du ihn gehört hast und von wem?"
"In dem kleinen Dorf Glaze, glaube ich, das etwa fünfzig Meilen oder mehr westlich von hier liegt. Und ich habe es von einem Nichtmormonen gehört, einem Reiter, der sagte, Sie wüssten, wo ich zu finden sei..."
"Was?", fragte sie gebieterisch, als Lassiter abbrach.
"Das Grab von Milly Erne", antwortete er leise, und die Worte kamen mit einem Ruck.
Venters drehte sich in seinem Stuhl um und sah Lassiter erstaunt an, und Jane erhob sich langsam in weißem, stillem Erstaunen.
"Milly Erne's Grab?", echote sie im Flüsterton. "Was weißt du von Milly Erne, meiner besten Freundin, die in meinen Armen starb? Was warst du für sie?"
"Habe ich behauptet, irgendetwas zu sein?", erkundigte er sich. "Ich kenne Leute - Verwandte -, die schon lange wissen wollen, wo sie begraben ist, das ist alles."
"Verwandte? Sie hat nie von Verwandten gesprochen, nur von einem Bruder, der in Texas erschossen wurde. Lassiter, das Grab von Milly Erne befindet sich auf einem geheimen Friedhof auf meinem Grundstück."
"Bringst du mich hin?... Du würdest die Mormonen mehr beleidigen, als wenn du mit mir das Brot brichst."
"In der Tat, ja, aber ich werde es tun. Nur müssen wir ungesehen gehen. Vielleicht morgen."
"Danke, Jane Withersteen", antwortete der Reiter, verbeugte sich vor ihr und trat rückwärts aus dem Hof.
"Willst du nicht unter meinem Dach übernachten?", fragte sie.
"Nein, Ma'am, und nochmals danke. Ich schlafe nie in einem Haus. Und selbst wenn ich es täte, wäre da der aufkommende Sturm im Dorf unten. Nein, nein. Ich werde zum Weisen gehen. Ich hoffe, du wirst nicht für deine Freundlichkeit büßen müssen."
"Lassiter", sagte Venters mit einem halb verbitterten Lachen, "mein Bett ist auch das der Weisen. Vielleicht treffen wir uns dort."
"Mag sein. Aber der Salbei ist weit und ich werde nicht in der Nähe sein. Gute Nacht."
Auf Lassiters leisen Pfiff hin wieherte der Rappe und bahnte sich vorsichtig seinen blinden Weg aus dem Hain. Der Reiter zügelte es nicht, sondern ging neben ihm her, führte es an der Hand, und gemeinsam gingen sie langsam in den Schatten der Pappeln.
"Jane, ich muss bald los", sagte Venters. "Gib mir meine Gewehre. Wenn ich meine Waffen gehabt hätte..."
"Entweder mein Freund oder der Älteste meiner Kirche würde tot sein", warf sie ein.
"Tull wäre es mit Sicherheit."
"Oh, du wildblütige, wilde Jugend! Kann ich dich nicht Nachsicht und Barmherzigkeit lehren? Bern, es ist göttlich, seinen Feinden zu verzeihen. 'Lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen.'"
"Schweig! Sprich mit mir nicht mehr über Barmherzigkeit oder Religion - nach dem heutigen Tag. Heute hat mich diese seltsame Ankunft von Lassiter noch als Mann zurückgelassen, und jetzt werde ich als Mann sterben! ... Gebt mir meine Waffen."
Schweigend ging sie ins Haus und kam mit einem schweren Patronengürtel, einer mit Pistolen gefüllten Scheide und einem langen Gewehr zurück; diese reichte sie ihm, und als er den Gürtel anlegte, stand sie in stummer Beredsamkeit vor ihm.
"Jane", sagte er mit sanfterer Stimme, "schau nicht so. Ich gehe nicht hinaus, um deinen Kirchenmann zu ermorden. Ich werde versuchen, ihm und all seinen Männern aus dem Weg zu gehen. Aber siehst du nicht, dass ich mit meinen Kräften am Ende bin? Jane, du bist eine wunderbare Frau. Nie gab es eine so selbstlose und gute Frau. Nur in einem Punkt bist du blind: .... Hör zu!"
Von hinter dem Wäldchen ertönte das Klicken von Pferden im schnellen Trab.
"Ein paar von deinen Reitern", fuhr er fort. "Es wird Zeit für die Nachtschicht. Lasst uns auf die Bank im Hain gehen und dort reden."
Auf dem freien Feld war es noch hell, aber unter den sich ausbreitenden Pappeln verdunkelten die Schatten die Wege. Venters lenkte Jane von einem dieser Wege auf einen von Büschen gesäumten Pfad, der gerade breit genug war, dass die beiden nebeneinander gehen konnten, und führte sie auf einem Umweg weit weg vom Haus zu einer Anhöhe am Rande des Hains. Hier stand in einer abgelegenen Ecke eine Bank, von der aus man durch eine Öffnung in den Baumkronen den Salbeihang, die Felswand und die schemenhaften Linien der Schluchten sehen konnte. Jane hatte nicht mehr gesprochen, seit Venters sie mit seiner ersten harschen Ansprache schockiert hatte; aber den ganzen Weg über hatte sie sich an seinen Arm geklammert, und auch jetzt, als er anhielt und sein Gewehr auf die Bank legte, klammerte sie sich noch an ihn.
"Jane, ich fürchte, ich muss dich verlassen."
"Bern!", rief sie.
"Ja, es sieht so aus. Ich bin in keiner glücklichen Lage - ich fühle mich nicht wohl - ich habe alles verloren."
"Ich werde dir alles geben, was du..."
"Hör zu, bitte. Wenn ich von Verlust spreche, dann meine ich nicht das, was du denkst. Ich meine den Verlust des guten Willens, des guten Namens - all das, was es mir ermöglicht hätte, in diesem Dorf ohne Bitterkeit zu bestehen. Nun, es ist zu spät.... Nun, was die Zukunft angeht, denke ich, dass es das Beste wäre, wenn Sie mich aufgeben. Tull ist unerbittlich. Du solltest an seinen Absichten von heute erkennen, dass... Aber du kannst es nicht sehen. Deine Blindheit, deine verdammte Religion... Jane, verzeih mir, ich bin innerlich aufgewühlt und etwas tut mir weh. Nun, ich fürchte, die unsichtbare Hand wird ihr verborgenes Werk zu deinem Verderben tun."
"Unsichtbare Hand? Bern!"
"Ich meine deinen Bischof." Venters sagte es absichtlich und ließ sie nicht los, als sie zurückwich. "Er ist das Gesetz. Das Edikt ist ergangen, um mich zu ruinieren. Nun, sieh mich an! Es wird jetzt dazu dienen, dich dem Willen der Kirche zu unterwerfen."
"Ihr tut Bischof Dyer unrecht. Tull ist hart, ich weiß. Aber er ist schon seit Jahren in mich verliebt."
"Oh, dein Glaube und deine Ausreden! Du kannst nicht sehen, was ich weiß - und wenn du es sehen würdest, würdest du es nicht zugeben, um dein Leben zu retten. Das ist der Mormone in dir. Diese Ältesten und Bischöfe sind zu jeder Tat bereit, um die Macht und den Reichtum ihrer Kirche, ihres Reiches, weiter auszubauen. Denken Sie daran, was sie den Heiden hier angetan haben, was sie mir angetan haben - denken Sie an das Schicksal von Milly Erne!"
"Was weißt du über ihre Geschichte?"
"Ich weiß genug - vielleicht alles, außer dem Namen des Mormonen, der sie hierher gebracht hat. Aber ich muss mit dieser Art von Gerede aufhören."
Sie drückte seine Hand als Antwort. Er half ihr, sich neben ihn auf die Bank zu setzen. Und er respektierte ein Schweigen, von dem er ahnte, dass es von einer tiefen Emotion der Frau erfüllt war, die er nicht verstehen konnte.
Es war der Augenblick, in dem die letzten rötlichen Strahlen des Sonnenuntergangs kurz aufleuchteten, bevor sie der Dämmerung wichen. Und für Venters war der Ausblick, der sich ihm bot, in gewisser Weise wie ein Gefühl für seine Zukunft, und mit forschenden Augen studierte er die schöne purpurne, karge Einöde des Salbeis. Hier war das Unbekannte und das Gefährliche. Die ganze Szene beeindruckte Venters als eine wilde, strenge und mächtige Manifestation der Natur. Und so wie sie ihn irgendwie an seine Lebensperspektive erinnerte, so ähnelte sie plötzlich der Frau in seiner Nähe, nur dass in ihr eine größere Schönheit und Gefahr, ein noch unlösbareres Geheimnis und etwas Namenloses steckte, das sein Herz betäubte und sein Auge trübte.
"Seht! Ein Reiter!", rief Jane und durchbrach die Stille. "Kann das Lassiter sein?"
Venters ließ seinen Blick noch einmal nach Westen schweifen. Ein Reiter tauchte dunkel am Himmel auf und verschmolz dann mit der Farbe des Salbeis.
"Das könnte sein. Aber ich glaube nicht - der Kerl kam gerade herein. Wahrscheinlich einer eurer Reiter. Ja, ich sehe ihn jetzt deutlich. Und da ist noch einer."
"Ich sehe sie auch."
"Jane, deine Reiter scheinen so zahlreich zu sein wie die Salbeisträuße. Ich bin gestern in der Nähe des Weges zum Deception Pass auf fünf gestoßen. Sie waren bei der weißen Herde."
"Gehst du immer noch in diesen Canyon? Bern, ich wünschte, du würdest es nicht tun. Oldring und seine Viehdiebe leben irgendwo da unten."
"Und was ist damit?"
"Tull hat schon angedeutet, dass du oft am Deception Pass bist."
"Ich weiß." Venters stieß ein kurzes Lachen aus. "Als nächstes macht er einen Viehdieb aus mir. Aber, Jane, es gibt im Umkreis von fünfzig Meilen kein Wasser mehr, und das nächste ist im Canyon. Ich muss trinken und mein Pferd tränken. Da! Ich sehe noch mehr Reiter. Sie sind auf dem Weg."
"Die rote Herde ist am Hang, Richtung Pass."
Die Dämmerung brach schnell herein. Eine Gruppe von Reitern überquerte die dunkle Linie des niedrigen Bodens und wurde deutlicher, als sie den Hang hinaufstieg. Die Stille wurde durch den klaren Ruf eines ankommenden Reiters durchbrochen, und fast wie das Läuten eines Jagdhorns tönte die Antwort zurück. Die abgehenden Reiter bewegten sich schnell, kamen scharf in Sicht, als sie einen Kamm erklommen, um wild und schwarz über dem Horizont aufzutauchen, und zogen dann hinunter, um im Purpur des Salbeis zu verschwinden.
"Ich hoffe, sie treffen nicht auf Lassiter", sagte Jane.
"Das hoffe ich auch", antwortete Venters. "Inzwischen wissen die Reiter der Nachtschicht, was heute passiert ist. Aber Lassiter wird ihnen wahrscheinlich aus dem Weg gehen."
"Bern, wer ist Lassiter? Er ist nur ein Name für mich - ein schrecklicher Name."
"Wer ist er? Ich weiß es nicht, Jane. Niemand, den ich je getroffen habe, kennt ihn. Er spricht ein wenig wie ein Texaner, wie Milly Erne. Hast du das bemerkt?"
"Ja. Wie seltsam, dass er sie kennt! Und sie lebte zehn Jahre hier und ist seit zwei Jahren tot. Bern, was weißt du über Lassiter? Sag mir, was er getan hat - warum du Tull von ihm erzählt hast - und warum du gedroht hast, selbst ein weiterer Lassiter zu werden?"
"Jane, ich habe nur Dinge gehört, Gerüchte, Geschichten, von denen ich die meisten nicht geglaubt habe. In Glaze war sein Name bekannt, aber keiner der Reiter oder Rancher, die ich dort kannte, ist ihm je begegnet. In Stone Bridge hörte ich nie, dass er erwähnt wurde. Aber in Sterling und in den Dörfern nördlich von dort wurde oft von ihm gesprochen. Ich war noch nie in einem Dorf, von dem bekannt war, dass er es besucht hatte. Es gab viele widersprüchliche Geschichten über ihn und seine Taten. Einige sagten, er habe dieses und jenes Mormonendorf in die Luft gejagt, andere leugneten dies. Ich bin geneigt zu glauben, dass er es getan hat, und Sie wissen ja, wie die Mormonen die Wahrheit verbergen. Aber in einem Punkt waren sich alle einig: Lassiter war das, was die Reiter in diesem Land einen Revolverhelden nennen. Er ist ein Mann mit einer wunderbaren Schnelligkeit und Genauigkeit im Umgang mit einem Colt. Und jetzt, wo ich ihn gesehen habe, weiß ich noch mehr. Lassiter wurde ohne Furcht geboren. Ich beobachtete ihn mit Augen, die in ihm meinen Freund sahen. Ich werde nie den Moment vergessen, in dem ich ihn aufgrund dessen, was man mir über seine Hocke vor dem Ziehen erzählt hatte, erkannte. In diesem Moment rief ich seinen Namen. Ich glaube, dass dieser Schrei Tulls Leben gerettet hat. Jedenfalls weiß ich, dass zwischen Tull und dem Tod damals nicht die Breite des kleinsten Haares lag. Wenn er oder einer seiner Männer auch nur einen Finger nach unten bewegt hätte..."
Venters ließ unausgesprochen, was er meinte, aber Jane erschauderte bei dieser Andeutung.
Das fahle Nachleuchten im Westen verdunkelte sich, als die Dämmerung in die Nacht überging. Der Salbei breitete sich nun schwarz und düster aus. Ein schwacher Stern schimmerte am südwestlichen Himmel. Das Geräusch trabender Pferde war verstummt, und es herrschte eine Stille, die nur durch das schwache, trockene Prasseln von Pappelblättern im sanften Nachtwind unterbrochen wurde.
In diesen Frieden und diese Stille brach plötzlich das laute Jaulen eines Kojoten ein, und von weit her aus der Dunkelheit kam der schwache Antwortton eines hinterherziehenden Gefährten.
"Hallo! Die Hunde des Salbeis bellen", sagte Venters.
"Ich mag sie nicht hören", antwortete Jane. "Manchmal, wenn ich nachts wach liege und dem langen Klagelaut, dem zerbrechenden Bellen oder dem wilden Heulen zuhöre, denke ich an dich, der du irgendwo im Salbei schläfst, und mein Herz schmerzt."
"Jane, du könntest keine schönere Musik hören, und ich könnte kein besseres Bett haben."
"Denk nur! Männer wie Lassiter und du haben kein Zuhause, keinen Komfort, keine Ruhe, keinen Ort, wo ihr euer müdes Haupt hinlegen könnt. Nun! ... Lasst uns geduldig sein. Tulls Zorn wird sich abkühlen, und die Zeit wird uns helfen. Ihr könntet dem Dorf einen Dienst erweisen - wer weiß das schon? Wie wäre es, wenn Ihr das lange unbekannte Versteck von Oldring und seiner Bande entdeckt und es meinen Reitern erzählt? Das würde Tulls hässliche Andeutungen entkräften und Euch in Gunst bringen. Seit Jahren sind meine Reiter den Spuren des gestohlenen Viehs auf der Spur. Ihr wisst so gut wie ich, wie teuer wir für unsere Gebiete in diesem wilden Land bezahlt haben. Oldring treibt unser Vieh hinunter in das Netz der trügerischen Canyons, und irgendwo weit im Norden oder Osten treibt er es hinauf und hinaus zu den Märkten in Utah. Wenn du dich am Deception Pass aufhältst, versuche, die Pfade zu finden."
"Jane, daran habe ich auch schon gedacht. Ich werde es versuchen."
"Ich muss jetzt gehen. Und es tut weh, denn jetzt kann ich nicht mehr sicher sein, dass ich dich wiedersehe. Aber morgen, Bern?"
"Morgen sicher. Ich halte nach Lassiter Ausschau und reite mit ihm hinein."
"Gute Nacht."
Dann verließ sie ihn und entfernte sich, eine weiße, gleitende Gestalt, die bald in den Schatten verschwand.
Venters wartete, bis das leise Zuschlagen einer Tür ihm die Gewissheit gab, dass sie das Haus erreicht hatte, dann nahm er sein Gewehr und schlich geräuschlos durch die Büsche, die Anhöhe hinunter und unter den dunklen Bäumen hindurch zum Rand des Hains. Der Himmel färbte sich jetzt von grau zu blau; die Sterne hatten begonnen, die frühere Schwärze zu erhellen, und von der weiten flachen Fläche vor ihm wehte ein kühler Wind, der nach Salbei duftete. Er hielt sich dicht am Rande der Pappeln und ging schnell und lautlos nach Westen. Der Hain war lang, und er hatte noch nicht das Ende erreicht, als er etwas hörte, das ihn zum Stehenbleiben veranlasste. Leise dumpfe Geräusche verrieten ihm, dass Pferde in seine Richtung kamen. Er ließ sich in der Dunkelheit nieder, wartete und lauschte. Viel früher als er erwartet hatte, nach dem Geräusch zu urteilen, entdeckte er zu seinem Erstaunen Reiter in unmittelbarer Nähe. Sie ritten am Rande des Weidelandes entlang, und er wusste sofort, dass die Hufe der Pferde gedämpft waren. Das fahle Sternenlicht ließ ihn die Reiter nur undeutlich erkennen. Aber seine Augen waren scharf und an die Dunkelheit gewöhnt, und wenn er genau hinsah, erkannte er die riesige Masse und das schwarzbärtige Gesicht von Oldring und die geschmeidige, geschmeidige Gestalt des Leutnants des Viehdiebs, eines maskierten Reiters. Sie zogen weiter; die Dunkelheit verschluckte sie. Dann, weiter draußen auf der Weide, zog eine dunkle, kompakte Gruppe von Reitern vorbei, fast lautlos, fast wie Gespenster, und auch sie verschwanden in der Nacht.
KAPITEL III. AMBER QUELLE
Es war nicht ungewöhnlich, dass Oldring und einige seiner Männer Cottonwoods am hellen Tag besuchten, aber dass er im Dunkeln mit gedämpften Pferdehufen umherschlich, bedeutete, dass sich Unheil anbahnte. Außerdem erschien Venters die Anwesenheit des maskierten Reiters bei Oldring besonders bedrohlich. Denn dieser Mann war geheimnisvoll, er ritt selten durch das Dorf, und wenn er es tat, dann schnell; Reiter trafen sich selten bei Tag auf der Salbei, aber wo immer er ritt, folgten Taten, die so dunkel und geheimnisvoll waren wie die Maske, die er trug. Oldrings Bande beschränkte sich nicht auf das Rascheln von Vieh.
Venters lag im Schatten der Pappeln und dachte über diese zufällige Begegnung nach, und viele Augenblicke lang hielt er es nicht für sicher, weiterzugehen. Dann wandte er sich aus einem plötzlichen Impuls heraus in die andere Richtung und ging den Hain entlang zurück. Als er den Weg erreichte, der zu Janes Haus führte, beschloss er, hinunter ins Dorf zu gehen. So eilte er mit schnellen, weichen Schritten weiter. Als er den Hain hinter sich gelassen hatte, betrat er die einzige Straße, die es gab. Sie war breit und von hohen Pappeln gesäumt, und unter jeder Baumreihe befanden sich innerhalb des Fußweges Gräben, in denen das Wasser aus Jane Withersteens Quelle floss.
Zwischen den Bäumen funkelten die Lichter der Kerzen in den Häusern, und weit unten leuchteten die hellen Fenster der Dorfläden. Als Venters sich ihnen näherte, sah er eine Gruppe von Männern, die sich ernsthaft unterhielten. Das übliche Herumlungern an den Ecken, auf den Bänken und Stufen war nicht zu sehen. Venters blieb im Schatten und ging näher und näher, bis er Stimmen hören konnte. Aber er konnte nicht erkennen, was gesprochen wurde. Er erkannte viele Mormonen und suchte angestrengt nach Tull und seinen Männern, aber vergeblich. Venters schloss daraus, dass die Viehdiebe nicht die Dorfstraße entlang gekommen waren. Zweifellos besprachen diese ernsten Männer Lassiters Ankunft. Aber Venters war sich sicher, dass Tulls Absichten an diesem Tag nicht verraten worden waren und auch nicht verraten werden würden.
Da Venters sah, dass es für ihn wenig zu erfahren gab, begann er seine Schritte zurückzuverfolgen. Die Kirche war dunkel, das Haus von Bischof Dyer daneben war ebenfalls dunkel, ebenso wie Tulls Häuschen. In fast jeder Nacht um diese Zeit würde hier Licht brennen, und Venters bemerkte das ungewöhnliche Fehlen.
Als er gerade die Straße verlassen wollte, um den Hain zu umrunden, schlich er sich beim Geräusch trabender Pferde wieder zurück. Plötzlich entdeckte er zwei berittene Männer, die auf ihn zuritten. Er drückte sich in den Schatten eines Baumes. Wieder half ihm das jetzt hellere Sternenlicht, und er erkannte die kräftige Gestalt von Tull und neben ihm die kurze, froschartige Gestalt des Reiters Jerry. Sie schwiegen, und sie ritten weiter, um zu verschwinden.
Venters ging seinen Weg mit geschäftigen, düsteren Gedanken, ließ die Ereignisse des Tages Revue passieren und versuchte, die zu erraten, die in der Nacht brüteten. Seine Gedanken überwältigten ihn. Oben in diesem dunklen Hain wohnte eine Frau, die seine Freundin gewesen war. Und er schlich um ihr Haus herum, ein Gewehr in der Hand, verstohlen wie ein Indianer, ein Mann ohne Ort, ohne Volk, ohne Ziel. Über ihr schwebte der Schatten einer düsteren, verborgenen, geheimen Macht. Keine Königin hätte aus einem üppigen Vorrat königlicher geben können, als Jane Withersteen ihrem Volk gab, und ebenso jenen Unglücklichen, die ihr Volk hasste. Sie verlangte nur das göttliche Recht aller Frauen - Freiheit; zu lieben und zu leben, wie es ihr Herz wollte. Und doch waren ihre Gebete und ihre Hoffnung vergeblich.
"Seit Jahren sehe ich, wie sich ein Sturm über ihr und dem Dorf Cottonwoods zusammenbraut", murmelte Venters, während er weiterging. "Bald wird er platzen. Mir gefallen die Aussichten nicht." In dieser Nacht flüsterten die Dorfbewohner auf der Straße - und die nächtlichen Viehdiebe muffelten ihre Pferde - und Tull war im Verborgenen am Werk - und dort draußen in der Salbei versteckte sich ein Mann, der etwas Schreckliches bedeutete - Lassiter!
Venters ging an den schwarzen Pappeln vorbei und kletterte in die Salbei den allmählichen Abhang hinauf. Er orientierte sich an einem westlichen Stern. Von Zeit zu Zeit blieb er stehen, um zu lauschen, und hörte nur das vertraute Bellen des Kojoten, das Rauschen des Windes und das Rascheln des Salbeis. Bald tauchte zu seiner Rechten eine niedrige Felsengruppe auf, und als er sich in diese Richtung drehte, pfiff er leise. Aus den Felsen glitt ein Hund, der um ihn herum sprang und winselte. Er kletterte über grobes, zerbrochenes Gestein, wobei er sich vorsichtig einen Weg suchte, und stieg dann ab. Hier war es dunkler und vor dem Wind geschützt. Ein weißer Gegenstand wies ihm den Weg. Es war ein weiterer Hund, und dieser schlief, zusammengerollt zwischen einem Sattel und einem Rucksack. Das Tier wachte auf und klopfte zur Begrüßung mit dem Schwanz. Venters nahm den Sattel als Kopfkissen und rollte sich in seine Decken ein, das Gesicht zu den Sternen gerichtet. Der weiße Hund kuschelte sich dicht an ihn. Der andere winselte und trottete ein paar Meter weiter zu einer Bodenerhebung und kauerte dort auf der Lauer. Und in diesem wilden Versteck schloss Venters unter den großen weißen Sternen und dem intensiven, gewölbten Blau die Augen, verglich ihre Einsamkeit bitter mit seiner eigenen und schlief ein.
Als er erwachte, war der Tag angebrochen, und alles um ihn herum war hell stahlgrau. Die Luft hatte einen kalten Beigeschmack. Er stand auf, grüßte die Hunde und streckte seinen verkrampften Körper, dann sammelte er ein Bündel toter Salbeistöcke und entzündete ein Feuer. Getrocknete Rindfleischstreifen, die er für einen Moment in die Glut hielt, dienten ihm und den Hunden. Er trank aus einer Feldflasche. Es gab nichts anderes in seiner Ausrüstung; er hatte sich an ein spärliches Feuer gewöhnt. Dann setzte er sich mit ausgebreiteten Handflächen über das Feuer und wartete. Das Warten war monatelang seine Hauptbeschäftigung gewesen, und er wusste kaum, worauf er wartete, es sei denn auf das Verstreichen der Stunden. Aber jetzt spürte er, dass es in der unmittelbaren Gegenwart etwas zu tun gab; der Tag versprach ein weiteres Treffen mit Lassiter und Jane, vielleicht Neuigkeiten über die Viehdiebe; am morgigen Tag wollte er den Weg zum Deception Pass nehmen.
Und während er wartete, sprach er mit seinen Hunden. Er nannte sie Ring und Whitie; es waren Schäferhunde, halb Collie, halb Hirschhund, prächtig gebaut und perfekt ausgebildet. Es schien, als ob diese Hunde in seiner misslichen Lage die Art ihres Wertes für ihn verstanden und ihre Zuneigung und Treue danach ausrichteten. Whitie beobachtete ihn mit düsteren, liebevollen Augen, und Ring, der auf der kleinen Anhöhe über ihm kauerte, hielt unermüdlich Wache. Als die Sonne aufging, nahm der weiße Hund den Platz des anderen ein, und Ring legte sich zu den Füßen seines Herrn schlafen.
Nach und nach rollte Venters seine Decken zusammen und schnürte sie und seinen mageren Rucksack zusammen, dann kletterte er hinaus, um nach seinem Pferd zu suchen. Bald sah er es in einiger Entfernung in der Salweide und ging hin, um es zu holen. In diesem Land, in dem sich jeder Reiter eines guten Reittieres rühmte und auf ein Rennen erpicht war, in dem Vollblüter die herrlichen Weideflächen säumten, ritt Venters ein Pferd, das ein trauriger Beweis für sein Unglück war.
Dann lehnte Venters mit dem Rücken an einem Stein und wandte sich nach Osten, während er mit dem Stock in der Hand und der leeren Klinge wartete. Das prächtige Sonnenlicht erfüllte das Tal mit purpurnem Feuer. Vor ihm, links, rechts, wogend, rollend, sinkend, steigend, wie niedrige Wogen eines purpurnen Meeres, erstreckte sich der Salbei. Aus dem Wäldchen mit den Pappeln, einem grünen Fleck auf dem Purpur, schimmerte das matte Rot von Jane Withersteens altem Steinhaus. Von dort aus erstreckte sich das weite Grün der Gärten und Obstplantagen des Dorfes, die von den anmutigen Pappeln begrenzt wurden, und weiter unten leuchtete der tiefe, dunkle Reichtum der Luzernefelder. Unzählige rote, schwarze und weiße Flecken sprenkelten den Salbei, und das waren Rinder und Pferde.
Venters beobachtete und wartete und ließ die Zeit verstreichen. Schließlich sah er ein Pferd über einen Kamm steigen, und er wusste, dass es Lassiters Schwarzer war. Er kletterte auf den höchsten Felsen, so dass er sich von der Himmelslinie abhob, stellte sich hin und schwenkte seinen Hut. Das fast sofortige Wenden von Lassiters Pferd zeugte von der Schnelligkeit dieses Reiters. Dann stieg Venters ab, sattelte sein Pferd, schnallte seinen Rucksack um und wollte mit einem Wort an seine Hunde ausreiten, um Lassiter entgegenzureiten, als er beschloss, auf höherem Boden auf ihn zu warten, wo die Aussicht am schönsten war.
Es war lange her, dass Venters eine freundliche Begrüßung durch einen Menschen erlebt hatte. Lassiters Gruß erwärmte etwas in ihm, das durch Vernachlässigung kalt geworden war. Und als er ihn erwiderte, die eiserne Hand, die seine hielt, fest umklammerte und den grauen Augen begegnete, wusste er, dass Lassiter und er Freunde sein würden.
"Venters, lasst uns ein wenig reden, bevor wir hinuntergehen", sagte Lassiter und nahm sein Zaumzeug ab. "Ich bin nicht in Eile. Sie haben wirklich gute Hunde." Mit dem Blick eines Reiters nahm er die Spitzen von Venters Pferd in Augenschein, sagte aber nicht, was er dachte. "Nun, ist irgendetwas passiert, nachdem ich euch gestern Abend verlassen habe?"
Venters erzählte ihm von den Viehdieben.
"Ich habe mich im Salbei versteckt", antwortete Lassiter, "und habe niemanden gesehen oder gehört. Oldrin hat hier wohl gute Karten, denke ich. In Utah ist es nichts Neues, dass er sich in Canyons versteckt und keine Spuren hinterlässt." Lassiter schwieg einen Moment. "Ich und Oldrin' waren keine Fremden, als er vor ein paar Jahren sein Vieh in Bostil's Ford, am oberen Ende des Rio Virgin, trieb. Aber dort wurde er schikaniert und jetzt treibt er woanders."
"Lassiter, du kanntest ihn? Ist er Mormone oder Nichtmormone?"
"Kann ich nicht sagen. Ich habe Mormonen gekannt, die sich als Heiden ausgegeben haben."
"Kein Mormone hat das je behauptet, es sei denn, er war ein Viehdieb", erklärte Venters.
"Mag sein."
"Es ist ein hartes Land für jeden, aber am härtesten für Nichtmormonen. Haben Sie jemals von einem Nichtmormonen gehört, der es in einer Mormonengemeinde zu etwas gebracht hat?"
"Nein, noch nie."
"Nun, ich möchte aus Utah weg. Ich habe eine Mutter, die in Illinois lebt. Ich möchte nach Hause gehen. Das ist jetzt acht Jahre her."
Das Mitgefühl des älteren Mannes bewegte Venters dazu, seine Geschichte zu erzählen. Er hatte Quincy verlassen, war losgelaufen, um sein Glück in den Goldfeldern zu suchen, war aber nie weiter als bis Salt Lake City gekommen, wanderte hier und da als Gehilfe, Fuhrmann, Hirte und trieb dann südwärts über die Wasserscheide und über das Brachland und die zerklüftete Hochebene hinauf durch die Pässe zu den letzten Grenzsiedlungen. Hier wurde er zum Reiter der Weisen, besaß eigenes Vieh und kam eine Zeitlang zu Wohlstand, bis der Zufall ihn in die Dienste von Jane Withersteen stellte.
"Lassiter, den Rest brauche ich dir nicht zu erzählen."
"Nun, für mich wäre es nichts Neues. Ich kenne die Mormonen. Ich habe die seltsame Liebe, die Geduld, die Aufopferung, das Schweigen und das, was ich Wahnsinn nenne, ihrer Gottesvorstellung gesehen. Und darüber hinaus habe ich die Tricks der Männer gesehen. Sie arbeiten Hand in Hand, alle zusammen, und in der Dunkelheit. Keiner kann sich gegen sie wehren, es sei denn, er packt Waffen ein. Denn Mormonen töten nur langsam. Das ist das einzig Gute, das ich an ihrer Religion je gesehen habe. Venters, glauben Sie mir, diese Mormonen sind nicht ganz richtig im Kopf. Wie könnte ein Mormone sonst eine Frau heiraten, wenn er bereits eine Frau hat, und es dann Pflicht nennen?"
"Lassiter, du denkst, was ich denke", erwiderte Venters.
"Wie kommt es dann, dass du nie eine Waffe auf Tull oder einige von ihnen geworfen hast?", erkundigte sich der Reiter neugierig.
"Jane flehte mich an, ich solle geduldig sein und übersehen. Sie hat mir sogar meine Waffen abgenommen. Ehe ich mich versah, hatte ich alles verloren", antwortete Venters mit roter Farbe im Gesicht. "Aber, Lassiter, hör zu. Aus dem Wrack habe ich eine Winchester, zwei Colts und eine Menge Patronen gerettet. Die habe ich zum Deception Pass hinuntergeschafft. Dort habe ich sechs Monate lang fast jeden Tag mit meinem Gewehr geübt, bis mir der Lauf die Hände verbrannt hat. Ich habe das Ziehen geübt - das Abfeuern eines Colts, Stunde um Stunde!"
"Das finde ich interessant", sagte Lassiter, hob kurz den Kopf und richtete seinen grauen Blick auf Venters. "Könntest du eine Waffe werfen, bevor du mit dem Training anfängst?"
"Ja. Und jetzt ..." Venters machte eine blitzschnelle Bewegung.
Lassiter lächelte, und dann verengten sich seine bronzenen Augenlider, bis seine Augen nur noch graue Schlitze waren. "Du wirst Tull töten!" Er stellte keine Frage, sondern bekräftigte.
"Ich habe Jane Withersteen versprochen, dass ich Tull aus dem Weg gehen werde. Ich werde mein Wort halten. Aber früher oder später werden Tull und ich uns begegnen. So wie ich mich jetzt fühle, werde ich ziehen, wenn er mich auch nur ansieht!"
"Das denke ich auch. Da unten wird bald die Hölle los sein." Er hielt einen Moment inne und schnippte mit seinem Quirt einen Salbeibesen. "Venters, da du so aufgeregt bist, erzähl mir doch die Geschichte von Milly Erne."
Venters' Aufregung beruhigte sich, als er die Spur von unterdrücktem Eifer in Lassiters Frage wahrnahm.
"Die Geschichte von Milly Erne? Nun, Lassiter, ich werde dir sagen, was ich weiß. Milly Erne war schon seit Jahren in Cottonwoods, als ich dort ankam, und das meiste von dem, was ich Ihnen erzähle, geschah vor meiner Ankunft. Ich lernte sie ziemlich gut kennen. Sie war eine unscheinbare Frau, und sie war verrückt nach Religion. Ich hatte eine Idee, die ich nie erwähnt habe - ich dachte, dass sie im Herzen mehr Nichtmormonin als Mormonin war. Aber sie gab sich als Mormonin aus, und sie hatte die verschlossenen Lippen einer Mormonin. Weißt du in jedem Mormonendorf gibt es Frauen, die uns rätselhaft erscheinen, aber bei Milly gab es mehr als nur ein gewöhnliches Geheimnis. Als sie nach Cottonwoods kam, hatte sie ein wunderschönes kleines Mädchen, das sie leidenschaftlich liebte. Milly war in Cottonwoods nicht offen als Mormonenfrau bekannt. Dass sie wirklich eine Mormonenfrau war, daran habe ich keinen Zweifel. Vielleicht wollten die anderen Frauen der Mormonen Milly nicht anerkennen. So etwas kommt in diesen Dörfern vor. Mormonenfrauen tragen ein Joch, aber sie werden eifersüchtig. Nun, was auch immer Milly in dieses Land gebracht hatte - Liebe oder religiöser Wahnsinn -, sie bereute es. Sie gab das Unterrichten in der Dorfschule auf. Sie trat aus der Kirche aus. Und sie begann, für die mormonische Erziehung ihres kleinen Mädchens zu kämpfen. Dann zogen die Mormonen die Schrauben an - langsam, wie es ihre Art ist. Schließlich verschwand das Kind. "Verloren" lautete die Meldung. Das Kind wurde gestohlen, das weiß ich. Du weißt es auch. Das hat Milly Erne ruiniert. Aber sie lebte in der Hoffnung weiter. Sie wurde eine Sklavin. Sie arbeitete mit Leib und Seele, um ihr Kind zurückzubekommen. Sie hörte nie wieder davon. Dann sank sie.... Ich sehe sie noch vor mir, ein zerbrechliches Ding, so durchsichtig, dass man fast durch sie hindurchsehen könnte - weiß wie Asche - und ihre Augen!... Ihre Augen haben mich immer heimgesucht. Sie hatte eine echte Freundin - Jane Withersteen. Aber Jane konnte ein gebrochenes Herz nicht heilen, und Milly starb."
Lassiter sprach einen Moment lang nicht und wandte auch nicht den Kopf.
"Der Mann!", rief er schließlich mit heiserer Stimme aus.
"Ich habe nicht die geringste Ahnung, wer der Mormone war", antwortete Venters, "und auch kein Nichtmormone in Cottonwoods."
"Weiß es Jane Withersteen?"
"Ja. Aber ein glühend heißes Bügeleisen könnte ihr diesen Namen nicht aus dem Kopf brennen!"