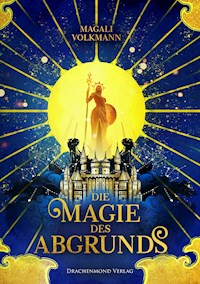8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eines Tages soll Riora über die Republik Anamoya regieren – zumindest, wenn es nach ihrem Onkel geht, der sie neben der Politik auch die geheime Kunst der Nekromantie lehrt. Doch als ihre Mutter ermordet wird, scheitert ihre Magie, und Rioras Welt bricht in sich zusammen. Warum musste ihre Mutter sterben? Welche Geheimnisse verbirgt die Republik, die von Intrigen und Korruption durchzogen ist? Riora schwört sich, den Schuldigen zu finden, wobei sie unerwartete Hilfe von dem Künstler Arias erhält. Obwohl sie sofort mit ihm aneinandergerät, muss sie ihm vertrauen. Denn ihre Familie ist nicht die einzige, die verbotene Magie beherrscht – und der Mörder hat weitaus mehr vor, als Blut in Anamoya zu vergießen … Die Erstausgabe erscheint als Softcover mit Farbschnitt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Die Republik der Knochen
Magali Volkmann
Copyright © 2023 by
Drachenmond Verlag GmbH
Auf der Weide 6
50354 Hürth
https://www.drachenmond.de
E-Mail: [email protected]
Lektorat: Stephan Bellem
Korrektorat: Sarah Nierwitzki
Layout Ebook: Stephan Bellem
Umschlagdesign: Alexander Kopainski
https://www.kopainski.com
Bildmaterial: Shutterstock
ISBN 978-3-95991-964-7
Alle Rechte vorbehalten
Inhalt
1. Riora
2. Arias
3. Riora
4. Arias
5. Riora
6. Arias
7. Riora
8. Arias
9. Riora
10. Arias
11. Riora
12. Arias
13. Riora
14. Arias
15. Riora
16. Arias
17. Riora
18. Arias
19. Riora
20. Arias
21. Riora
22. Arias
23. Riora
24. Arias
25. Riora
26. Arias
27. Riora
28. Arias
29. Riora
30. Arias
31. Riora
Glossar
Drachenpost
Kein Tod ohne Leben
Keine Asche ohne Sünde
Kein Land für Nekrobotaniker
Eingemeißelt über den Toren des Elfenbeinpalastes von Anamoya
Riora
Farben und Knochen
Ich war zehn Jahre alt, als ich zum ersten Mal einen Menschen sterben sah. Er lag unter einer Brüstung, die eben noch auf einem Balkon gestanden hatte, die Knochen zerschlagen, der Rücken gebrochen. Regen fiel auf meine Schultern und durchnässte meinen Umhang, während ich ihn betrachtete.
Ich zitterte. Natürlich zitterte ich.
Ich weinte leise.
Natürlich weinte ich.
»Hilf mir …«, flüsterte der Mann. »Ich kann nicht …«
Aber niemand kam. Nicht in dieser Nacht, nicht in den Albträumen, die mich noch Jahre später heimsuchten. Tränen liefen mir über die Wangen, ehe ich aufschluchzte und das Gesicht in den Händen vergrub.
»Es tut mir leid«, wisperte ich. »Ich weiß nicht, was ich tun soll.«
Ich konnte nicht sehen, ob er mich flehend anblickte. Aber in meinen Träumen tat er es. Lass es aufhören, betete ich stumm. Bitte, lass es aufhören, mach es wieder gut, mach alles wieder …
Es raschelte in der Finsternis.
Ich schrak auf. Als ich zwischen meinen Fingern hindurchspähte, sah ich, dass ein Mann neben dem Verletzten niederkniete und eine Hand auf seine Schulter legte.
»Können Sie mich hören?«
Er stöhnte leise.
»Gut.« Kurzes Schweigen. »Hören Sie mir jetzt genau zu. Vergessen Sie mein Gesicht. Vergessen Sie meine Nichte. Versprechen Sie mir, dass Sie niemals darüber reden werden, was in dieser Gasse geschehen ist.«
Der Mann hustete. Blut sickerte aus seinem Mundwinkel, dick und schleimig.
»Ich …«
»Versprechen Sie es.«
Ein kurzes Zögern.
Dann: »Ja. Bitte. Ich schwöre …«
»Gut«, unterbrach ihn mein Onkel. »Sieh genau hin, Riora.«
Ich spürte, wie mir einige letzte Tränen über die Wangen liefen, als ich folgsam den Kopf hob. Mein Onkel erwiderte meinen Blick schweigend, ehe er sich abwandte. Er war sehr groß und breitschultrig … seine Hand jedoch sanft, als er eine Efeuranke am zerstörten Balkongeländer berührte. Das linke Auge war von einer Klappe bedeckt. Das rechte blickte auf den verletzten Mann hinab, hart und dunkel.
Dann legte er zwei Finger an dessen Wunden.
Ich hielt den Atem an. Wie von selbst streckte sich sein Arm gerade aus, während das wunde Fleisch abschwoll, die eben noch zerfetzte Haut über seinen Muskeln zusammenwuchs. Der Efeu begann jedoch, zwischen den Fingern meines Onkels zu verdorren. Zuerst waren es nur einige Blätter. Danach kroch die Trockenheit an der Ranke hinauf, saugte alles Leben heraus, bis nur noch totes, spinnenbeinartiges Gestrüpp übrig war.
Der Mann stöhnte. Tränen rannen über seine Wangen und mein Herz schlug schnell vor Aufregung. Es wird besser, dachte ich. Esteria sei Dank, es wird besser.
Angespannt beobachtete ich, wie sein Körper bebte. Wie sein Fleisch zusammenwuchs, ehe es plötzlich erstarrte. Er stieß ein Keuchen aus, leise, gequält.
Dann regte er sich nicht mehr.
Stille trat ein. Regen prasselte auf meine Schultern. Ich blickte zu meinem Onkel hinüber, doch er stand wortlos auf.
»Ist er …«, flüsterte ich.
Sein Gesicht war hart wie Stein, als er mir den Kopf zudrehte.
»Riora«, sagte er, »wenn wir nach Hause kommen, schreibst du mir einen Aufsatz über die Todesursache dieses Mannes. Ich zeige dir, in welchen Büchern du das nachschlagen kannst. Es wird Zeit, dass du lernst, wie der menschliche Körper aufgebaut ist und welchen Einfluss wir auf ihn nehmen können.«
»Er ist wirklich tot?«, fragte ich leise.
Mein Onkel nickte.
Ich spürte, dass ich zu zittern begann, ehe ich unwillkürlich aufschluchzte. Ich konnte nichts dagegen tun, obwohl ich wusste, dass er böse sein würde … Weinte noch heftiger, als er streng auf mich herunterblickte.
»Hör auf damit«, mahnte er. »Du bist eine Nekrobotanikerin. Das Sterben hat keine Bedeutung für dich. Du solltest es nicht fürchten – es ist der Tod, der dich zu fürchten hat.«
»Aber … aber er ist …«
Sein Blick wurde etwas dunkler, etwas kühler. Ich wollte aufhören, zu weinen, doch ich hätte ebenso gut aufhören können, Arme oder Beine zu besitzen. Krampfhaft würgte ich meine Schluchzer herunter, dadurch wurde nur ein seltsames Glucksen daraus, das mir in der Magengrube wehtat.
»Riora«, sagte er mahnend.
Ich schniefte leise.
»Ja, Onkel«, flüsterte ich.
Er wirkte zufrieden. Zumindest war da ein Zucken in seinem Mundwinkel, das im rechten Licht beinahe wie Zufriedenheit aussah. Er legte mir seine Hand auf die Schulter, doch tröstend war diese Berührung nicht. Im Gegenteil. Noch nie hatte ich mich so verloren gefühlt wie in dieser Gasse.
»Gehen wir«, sagte mein Onkel. »Ich möchte deinen Aufsatz morgen früh auf dem Schreibtisch haben. Dein Platz für heute Abend ist in der Bibliothek, ja?«
Ich senkte den Kopf. Mein Magen verkrampfte sich, während stumme Tränen über meine Wangen rollten. Wenn ich bloß gerade am anderen Ende der Welt gewesen wäre. Irgendwo, wo die Sonne schien und niemand jemals sterben musste.
»Ja, Onkel«, wiederholte ich flüsternd.
* * *
Stumm saß ich da, über meine Bücher gebeugt, und rieb mir die Stirn.
Dunkelheit lag über der Stadt. Neben mir flackerte eine Öllampe, die einzige Lichtquelle in der Bibliothek. Inzwischen war dieser Tag elf Jahre her, doch ich dachte manchmal daran, wenn ich arbeitete. Aufsätze über Nekrobotanik. Studien über Knochen und Pflanzen. Stunden tief in den Eingeweiden der Stadt, wo mein Onkel Leichen für mich geöffnet und mir die Geheimnisse gezeigt hatte, die sich unter ihrer Haut verbargen.
Blut und Tränen in dieser Nacht.
Eine ferne Erinnerung, die mich nur noch selten weckte.
Ich seufzte leise. Nicht weit von mir ging ein Skelett durch die Bibliothek, ohne Notiz von mir zu nehmen, und staubte die Regale ab. Die gelben Knochen waren von Ranken umsponnen, die Augenhöhlen mit Blüten gefüllt. Gelegentlich fielen trockene Blätter zu Boden. Das Konstrukt bemerkte es nicht.
Nekrobotanik heilte die Lebenden und weckte die Toten. Alles, was man brauchte, war eine Pflanze. Das nekrobotanische Zauberwerk sog ihr Leben aus und bewegte das Skelett, bis sie verdorrte – wenn man viel Erfahrung hatte wie mein Onkel, konnte man ihm sogar einfache Befehle erteilen.
Der Knochendiener kam in meine Richtung, beugte sich über mich hinweg und fing an, die Bücher über meinem Kopf abzustauben. Staub rieselte auf mein Gesicht. Ich musste niesen.
»Nein, nicht hier«, sagte ich zu ihm. »Du kannst hier saubermachen, wenn ich nicht da bin.«
Er trottete in eine andere Richtung davon. Eine Weile sah ich dem Knochendiener zu, ohne an etwas Bestimmtes zu denken, bis ich Schritte hinter mir hörte. Sofort richtete ich mich auf. Es gab nicht viele Leute, die hier herumliefen, und keiner von ihnen hätte mich gern beim Träumen erwischt.
»… eigentlich müsste sie hier irgendwo sein.«
Eine dunkle, tiefe Stimme. Der Knochendiener zog träge weiter, unbeeindruckt von den Geräuschen in der Bibliothek.
»Natürlich ist sie das«, sagte eine Frau. »Riora wird sich zwischen ihren Büchern verkrochen haben, wie immer.«
Ich löschte das Licht meiner Öllampe. Wenig später traten Gestalten ins Mondlicht, eine groß und dunkel, die zweite deutlich zarter. Mein Onkel war ein Berg von einem Mann, wie es auch mein Vater gewesen war, mit schwarzem Haar und einem groben, dichten Bart. Vor Jahren hatte er das linke Auge verloren und trug deswegen eine Klappe über der leeren Höhle, eine Mahnung an jeden, der sich zu leichtfertig mit unserer Kunst beschäftigte. Nekrobotanik war gefährlich. Wenn man nicht wusste, was man tat, konnte man Körperteile verlieren oder sogar daran sterben.
Hinter ihm ging meine Mutter, in Seide gekleidet, das goldene Haar hochgesteckt. Zart und elegant war sie, sprach meistens leise, außer wenn ein Diener ihr Missfallen erregte. Ich konnte ihr Parfüm bis in meine Leseecke riechen. Wahrscheinlich kamen die meisten Schiffe, die Düfte transportierten, nur ihretwegen nach Anamoya.
»Lass das Mädchen in Ruhe, Savina«, sagte mein Onkel. »Soll sie ihren Verstand ruhig mit Büchern füttern. Es gibt zu wenige Leute in dieser Stadt, die überhaupt welchen besitzen.«
Meine Mutter schnaubte. »Du forderst zu viel von ihr, Kyrian. Sie ist noch so jung.«
»Sie ist neunzehn. Es wird Zeit, dass sie mehr über unsere Künste lernt – und darüber, wo ihr Platz in dieser Stadt ist. Wir sind nicht irgendeine Familie. Ganz Anamoya blickt zu uns auf.«
»Sie wird dir niemals Schande machen«, sagte meine Mutter. »Riora ist ein gutes Mädchen, das weißt du doch. Du darfst sie nicht mit deinen Erwartungen erdrücken.«
Mein Onkel gab sich nicht die Blöße, darauf zu antworten. Ich konnte sehen, wie düster sein Gesichtsausdruck war, als er wenig später den Kopf in meine Richtung drehte. Ich machte mir nicht die Mühe, mich zu verstecken, weil es sowieso nichts geholfen hätte. Kyrian Anamoias entging niemals etwas.
»Riora«, sagte mein Onkel. »Du solltest nicht im Dunkeln lesen. Du wirst dir die Augen verderben.«
»Dafür wird mein Verstand davon satt«, konterte ich.
Er schmunzelte darüber, während meine Mutter zu uns aufschloss.
»Ich habe dich den ganzen Tag gesucht«, erklärte sie mir. »Ich hätte wissen müssen, dass du dich wieder hier versteckst, Riora. Du hast nichts außer deinen Büchern im Kopf! Es wäre gesünder, ein wenig unter die Leute zu gehen.«
»Das Studium von Leben und Tod ist eine ernste Angelegenheit, Mutter«, dozierte ich. »Menschen vergehen. Die Geheimnisse des Sterbens und dem, was danach kommt, nicht.«
»Bald wirst du vergehen, wenn du immer nur hier drinnen sitzt«, schimpfte sie, aber mein Onkel lachte darüber.
»Für heute hast du die Toten ausnahmsweise einmal genug studiert«, sagte er scherzhaft. »Ich bin nur hier, weil ich dir etwas erzählen wollte, bevor du zu Bett gehst.«
»Ach wirklich?«
»Dein Tonfall«, mahnte er, schien jedoch nicht böse zu sein. »Ich habe seit einer Weile darüber nachgedacht, unsere Kunstsammlung zu erweitern. Dein Vater hat sie sehr gern gehabt. Er würde sich freuen, wenn etwas Neues dazukäme, denke ich. Morgen wird ein Künstler zu uns kommen, um Gemälde der Familie anzufertigen. Natürlich habe ich ihn auch gebeten, dich zu porträtieren.«
Ich spürte, wie sich ein jähes Lächeln auf meinem Gesicht ausbreitete.
»Ein Künstler?«, wiederholte ich. »Das ist ja wunderbar!«
Mein Onkel lächelte. »Ich wusste, dass dich das freuen würde.«
»Und wie«, stimmte ich zu. Als mein Vater noch gelebt hatte, hatte er mir so manches Kunstwerk gezeigt, geschaffen von den größten Malern und Bildhauern Anamoyas. Die Statue des Aschekaisers, die am goldenen Markt im Herzen der Stadt stand, die prächtigen Fresken, die unsere Göttin Esteria und ihre stolzen Krieger zeigten. Ich dachte häufig daran zurück. Ich besaß nicht viele Erinnerungen an die Zeit mit meinem Vater, weil ich noch ein Kind gewesen war, als er gestorben war.
»Wer wird zu uns kommen?«, fragte ich. »Dovati? Oder Piraino?«
»Salvati«, sagte meine Mutter.
Mir fiel fast die Kinnlade herunter.
»Der Salvati?«, wiederholte ich aufgeregt. »Er ist eine Legende! Er hat die Decke der großen Esteriakirche gestaltet.«
»Ja, und das war wirklich teuer«, sagte mein Onkel mit einem leisen Hüsteln. »Aber für die Gemälde war es kein Problem, ihn zu bekommen. Ich … habe meine Differenzen mit ihm, doch er scheint in finanziellen Schwierigkeiten zu sein. Er hat den Auftrag erstaunlich schnell angenommen.«
»Nicht nur in finanziellen, wenn ich ihn mir so ansehe«, sagte meine Mutter angewidert. »Dieser Mann hat ein wirklich abscheuliches Benehmen. Kyrian, du hättest Piraino mit dieser Aufgabe betreuen sollen.«
»Piraino malt wie ein dreibeiniger Hund«, konterte mein Onkel. »Hast du sein Bildnis der Göttin gesehen? Sie hat an einer Hand sechs Finger.«
»Du weißt genau, was ich meine.«
»Savina!«
Ich hörte ihnen kaum zu. Salvati, dachte ich. Er war ein Gott der Malerei, jemand, dessen Bilder eher wie lebendige Wesen wirkten als Konstrukte aus Ölfarbe und Leinwand. Seine Werke hingen in unzähligen wichtigen Gebäuden in Anamoya und wurden für absurde Preise an Interessenten verkauft. Noch in hundert Jahren würde man über seine Arbeiten sprechen. Darin waren sich alle einig.
Und er würde ein Porträt von mir anfertigen.
Ein aufgeregtes Kribbeln erfasste mich. Wie es wohl sein würde, ein Gemälde von mir anzusehen – noch dazu eines von einem der größten Künstler, der je gelebt hatte?
»Das ist unglaublich«, flüsterte ich.
Mein Onkel nickte.
»Salvati wird morgen zu uns kommen, um mit seiner Arbeit zu beginnen«, erklärte er. »Lass dich nicht von ihm einschüchtern, ja? Er ist etwas speziell.«
»Speziell?«, fragte ich. »Was meinst du damit?«
Mein Onkel schüttelte den Kopf. Ich runzelte die Stirn, hakte jedoch nicht weiter nach; dafür war ich viel zu aufgeregt. Arias Salvati, einer der größten Maler unserer Zeit, würde ein Bild von mir erschaffen.
Was er wohl für ein Mensch war?
Arias
Ein schöner Abend an der Lagune
Sonnenlicht stach mir ins Gesicht.
Obwohl ich die Augen geschlossen hielt, war es so hell um mich herum, dass es wehtat. Ohne zu überlegen, beschirmte ich sie mit dem Unterarm, doch mein Schädel hämmerte, als wäre er unter die Hufe eines Pferdes geraten. Ich stöhnte leise, drehte mich auf die Seite. Als ich meine Hand in den Untergrund krallte, rieselte Sand zwischen meinen Fingern hindurch.
Verdammt. Was war letzte Nacht passiert?
Ich wusste es nicht. Ich hatte auch keine Lust, es herauszufinden. Am besten vergrub ich mich im Sand, bis der Schmerzanfall vorüberging. Aber im gleichen Augenblick, als mir dieser fabelhafte Gedanke kam, schob sich ein Schatten vor die Sonne.
Ich blinzelte. Ein verschwommener Fleck zeichnete sich vor mir ab, den ich mit einiger Mühe als lebendige Person identifizierte.
»Oh. Du bist endlich wach, was? Du hast versucht, die Grenze nach Melenya zu kreuzen, und bist in einen Hinterhalt gelaufen.«
Ich kniff die Augen zusammen. »Was für ein Hinterhalt?«
»Es war fürchterlich«, verkündete der Mann; er klang nahezu penetrant gut gelaunt. »Zwanzig schwer bewaffnete Schläger. Ekelhafte Kerle mit gemeinen Klingen in den Fäusten. Du kannst froh sein, dass ich da war, um sie alle abzuwehren.«
»Oh, Esterias Atem …«
Ein jäher Schmerz schoss durch meine Schläfen. Mein Magen drehte sich ruckartig um, doch irgendwie schaffte ich es, meinen Mageninhalt bei mir zu behalten.
»Tyban?«, krächzte ich. »Bist du das?«
»So stark und schön, wie die Göttin mich geschaffen hat, Arias.« Er lachte, ehe er mir etwas in die Hand drückte. »Du hast das hier übrigens verloren.«
Ich betastete den Gegenstand, bevor ich begriff. Es war meine Brille. Wortlos setzte ich sie auf, fixierte Tyban samt schadenfrohem Grinsen deutlich schärfer als zuvor. Die meisten Anamoyaner hatten dunkles Haar, eine schlanke Gestalt und olivfarbene Haut, die nur selten in der heißen Sonne verbrannte. Tyban besaß nichts davon. Er war bestenfalls mittelgroß, aber muskulös, hatte einen wilden roten Haarschopf, der stets etwas abstand, so oft er ihn auch nach hinten strich.
Ich setzte mich langsam auf. Das grelle Licht schmerzte in meinen Augen, dennoch erkannte ich, dass ich an einem Strand lag, wie es viele rund um Anamoya gab. Ein Stück entfernt ragten Hütten auf, die aussahen, als wären sie aus Treibholz errichtet worden. Wäscheleinen waren zwischen ihnen gespannt, und die Kleider darauf bewegten sich im salzig schmeckenden Wind.
Anamoya selbst, die Perle des Westens, zeichnete sich in der Ferne ab. Bereits von hier konnte ich die goldenen Türme der Esteriakirchen sehen, die türkisfarbene Lagune voller Schiffe. Wo die Gebäude endeten, ragten Klippen auf, über und über mit Dschungel bewachsen. Vögel flogen aus den Baumkronen, während ich hinsah. Sie fanden hier reichlich Nahrung.
Ich rieb mir die Schläfen.
»Es gab gar keinen Hinterhalt, oder?«
»Quatsch. Ich wollte dich nur ärgern.« Tyban richtete sich auf. Er trug einen dünnen weißen Umhang mit Kapuze, wohl damit er sich nicht verbrannte. »Du warst sturzbetrunken, Arias.«
Oh, dachte ich. Das erklärte einiges.
»Ich hatte doch nur ein oder zwei Bier«, murmelte ich.
»Redest du von Gläsern oder Fässern?«
»Fick dich, Tyban.«
Zur Antwort stieß Tyban mit der Fußspitze in den Sand. Ein Schauer aus Sandkörnern verteilte sich über meinen Beinen. Ich ignorierte das, so gut ich konnte, versuchte, meine Gedanken zu ordnen.
»Was machen wir überhaupt hier?«
»Du hast mit diesem Hafenarbeiter gewettet, dass du nicht länger als eine Stunde für den Weg in die Vororte und zurück brauchst. Da warst du schon ziemlich betrunken.« Tyban schien, zu überlegen. »Ich schätze, du hast außerdem zwanzig Dukaten an den Kerl verloren.«
Ich schloss kurz die Augen. Großartig. Da war ich also offenbar an Geld gekommen, was selten genug geschah, und verschwendete es an solchen Blödsinn.
»Und du? Was machst du hier?«
Tyban rieb sich demonstrativ das Kinn, als würde er darüber nachdenken. Er hatte einen kurzen Bart, der sich an der Kante seines Gesichtes entlangzog und etwas rötlicher als sein Kopfhaar war.
»Ich habe überprüft, ob du die Wette einhältst und nicht einfach irgendwo in der Stadt verschwindest. Das war natürlich Ehrensache.«
»Großartig …«
Ich versuchte, aufzustehen, doch die bloße Bewegung löste ein grässliches Rumoren in mir aus. Meine ganze Welt kippte. Tyban trat elegant zur Seite, während ich mich vorbeugte und geräuschvoll in den Sand übergab. Als ich damit fertig war, kroch ich zittrig zum Meer hinüber, um mir den Mund auszuspülen. Das Wasser war widerlich salzig. Allerdings besser als der Geschmack von Galle in der Kehle.
Eine Weile verharrte ich, wo ich war. Dann, ganz langsam, kam ich auf die Beine. Es fühlte sich wie das Schwierigste an, was ich je getan hatte, und Tyban schien das auch so zu sehen, denn er ergriff ohne ein Wort meinen Arm und führte mich zu einer Straße.
Ich kniff die Augen zusammen, während Tyban dem nächstbesten Passanten auf einem großen Karren zuwinkte.
»Wir bräuchten einen netten Mann, der bereit wäre, uns nach Anamoya mitzunehmen!«, rief er. »Na, wie wäre es?«
»Was ist denn für mich drin?«, rief der Fahrer zurück.
Tyban griff in seine Tasche und zog zwei goldene Dukaten heraus. Einen Herzschlag lang arbeitete es auf dem Gesicht des Mannes, ehe er seinen Karren abrupt anhielt.
»Reiche Freunde wie euch nehme ich doch immer mit.«
»Guter Mann«, lobte Tyban und stieg auf die Ladefläche, auf der mehrere prall gefüllte Säcke lagen. Ich ließ mich auf einem davon nieder, schloss die Augen, während der Karren weiterfuhr.
»Danke für deine Hilfe, Tyban.«
»Oh, keine Ursache. Du hast mich dafür bezahlt.«
Ich runzelte die Stirn. »Ach, habe ich das?«
»Ja, natürlich. Du wolltest, dass ich dich rechtzeitig wecke, falls du nicht von allein wach wirst. Du hast gesagt, dass du heute zur Familie Anamoias willst.«
Ich riss die Augen auf.
Der Auftrag. Gestern erst war Kyrian Anamoias damit auf mich zugekommen, hatte mir eine unverschämte Menge Dukaten dafür versprochen, seine Familie zu porträtieren. Es war meine erste größere Arbeit seit einer Weile. Deswegen hatte ich auch beschlossen, das Ganze mit einer guten Flasche Wein zu feiern. Oder fünf, so wie sich mein Schädel anfühlte.
Das Problem daran war, dass ich im Stadtpalast der Familie hätte sein sollen, um mit den Gemälden zu beginnen.
Und zwar jetzt.
»O nein«, flüsterte ich.
* * *
Verschwitzt und zerzaust hastete ich dem Stadtpalast der Familie Anamoias entgegen. Mein Kopf pulsierte mit jedem Schritt, als würde er gleich zerbersten. In den Armen trug ich so viele Zeichenmaterialien wie möglich; den Rest schleppte mir Tyban hinterher. Er sagte, dass er mich nicht allein lassen würde, bis ich nicht an meiner Staffelei stand. Schwer zu sagen, ob ich ihm dankbar sein oder ihn später dafür häuten sollte.
Vielleicht beides.
Der Stadtpalast der Familie Anamoias war ein sandfarbener Klotz, umgeben von Kanälen, wie sie sich durch die ganze Stadt zogen. Drei Stockwerke ragten über mir auf, durchzogen von Fenstern, gekrönt von einem flachen Dach. Es war nicht weit von denen der umliegenden Häuser entfernt. Anamoya war voller enger Gassen, in die kaum Sonnenlicht hinabdrang.
Ich versteifte mich, als ich ins Gebäude trat. Auf dem Innenhof war es etwas kälter, denn er wurde von einem großen, alten Baum beschattet. Sofort eilte ein Bediensteter in Cremeweiß auf uns zu. Bei meinem Anblick presste er die Lippen aufeinander, als hätte er plötzlich üble Magenschmerzen.
»Arias Salvati?«
»Ja, das bin ich«, sagte ich matt.
»Sie sind zu spät«, sagte er mahnend. »Kyrian Anamoias erwartet Sie seit über einer Stunde.«
»Tut mir leid. Ich bin auf dem Weg hierher in einen Hinterhalt geraten.«
Tyban kicherte. »Geh nur«, sagte er, »ich bringe deine Ausrüstung weg. Ha! Ein Hinterhalt …«
Ich drückte Tyban meine Tasche in die Hand, während der Bedienstete auf eine Tür zeigte. Er machte immer noch ein Gesicht, als fürchtete er, sich eine heimtückische Krankheit neben mir einzufangen.
»Dort entlang, den Gang hinunter und die letzte Tür zur Linken«, sagte er.
»Ich werde versuchen, mir das zu merken«, erwiderte Tyban zwinkernd und ging. Ich sah zu, wie er verschwand, strich dabei mein Haar nach hinten. Nicht dass das irgendetwas half. Es war von Natur aus widerspenstig.
»Gehen wir«, sagte ich zu dem Bediensteten. »Wir wollen Anamoias nicht noch länger warten lassen, oder?«
Er nickte, ehe er mich eine Treppe hinaufführte. Ich blickte mich schweigend um. Offenbar war jemand in diesem Haus ein Kunstsammler, denn an den Wänden hingen einige Gemälde, die ich als Arbeiten meiner Kollegen erkannte. Doch wer immer hier Bilder sammelte, er beschränkte sich nicht auf die anamoyanische Malerei. Viele Werke stammten aus den freien Städten an der Küste, andere aus der Piratenrepublik Nandes, aus Melenya oder Balys mit seinen wilden Dschungeln, sogar aus den fernen Ländern jenseits der Meerenge.
Das Arbeitszimmer von Kyrian Anamoias ließ mir keinen Zweifel daran, wer diese Kunstwerke eingekauft hatte. Auch hier hingen einige Gemälde zwischen den Bücherschränken, während der Regent selbst am Schreibtisch saß und arbeitete. Als er mich kommen hörte, sah er auf. Sein Gesicht verhärtete sich.
Das ging ja schon gut los.
Einige Herzschläge lang fixierten wir einander. Mein Blick fing sich an seiner dunklen Augenklappe. Niemand sprach Anamoias jemals darauf an, aber es hieß, dass er das Auge in der Rebellion der Wellen verloren hatte. Das war vor fünfzehn Jahren gewesen, als Piraten die Küste von Anamoya überfallen hatten und wir alle gerade so mit unserem Leben davongekommen waren.
»Salvati«, sagte Kyrian Anamoias. »Ich habe Sie früher erwartet.«
»Ich war unterwegs«, erklärte ich. »Es, ähm, gab Probleme bei der Rückreise.«
Er musterte mich mit Schärfe, als wüsste er genau, dass ich ihm gerade eine saftige Halbwahrheit unterbreitet hatte. Ich erwiderte seinen Blick, ohne zu blinzeln. Leute wie er waren gefährlicher als Klapperschlangen. Besser, mir keine Blöße vor ihm zu geben.
»Hübsche Kunstsammlung, die Sie hier haben«, sagte ich. »Muss ein Vermögen gekostet haben.«
»Das hat sie, ja.« Er legte den Kopf zur Seite. »Es ist eine große Ehre, bald einige Ihrer Bilder aufnehmen zu können. Ich habe das Deckenfresko in der Esteriakirche gesehen, das Sie gestaltet haben. Das Werk eines Meisters, wirklich.«
»Danke«, sagte ich. »War auch eine Menge Arbeit.«
Sein Gesicht verhärtete sich kaum merklich. Ich tat, als hätte ich das nicht bemerkt. Reiche Anamoyaner legten viel Wert auf Etikette, aber ich brachte es nur selten über mich, ihren steifen Regeln zu folgen.
»Ich muss gestehen, dass ich mich immer gefragt habe, warum Sie Künstler geworden sind«, sagte er. »Ich habe Ihren Großvater gekannt. Sie sind bei ihm aufgewachsen, nachdem Ihre Eltern starben, nicht wahr?«
Ich nickte knapp.
»Erinnern Sie sich an ihn?«
»Lebhaft«, sagte ich steif. »Aber wie wäre es, wenn wir mehr über das Geschäft reden und weniger über meine Familie?«
Anamoias legte die Fingerkuppen aneinander. Ich erwiderte seinen Blick, ohne mich zu regen. Diesen Schmerz würde ich nicht mit ihm teilen. Nein. Eigentlich mit niemandem auf der Welt.
»Wie Sie wünschen«, sagte er kühl. »Also. Ich stelle Ihnen Räumlichkeiten hier in meinem Stadtpalast zur Verfügung, in denen Sie arbeiten können, bis der Auftrag beendet ist. Sie werden mit einem Porträt meiner Nichte beginnen. Riora ist eine intelligente junge Dame und eine Liebhaberin der anamoyanischen Kunst. Eines Tages wird sie meine Nachfolge antreten. Bestimmt werden Sie sich blendend mit ihr verstehen.«
In seinen Worten schwang eine leise Warnung mit. Ich verkniff mir meine Antwort. Die Position des Regenten war eigentlich nicht erblich; er wurde vom Großen Rat gewählt, der aus den zwanzig mächtigsten Familien Anamoyas bestand. Vermutlich würde Anamoias also an einigen Fäden ziehen, damit sie in der Familie blieb, wenn er eines Tages abdanken musste.
»Meine Nichte erwartet Sie bereits«, sagte Kyrian Anamoias. »Oh, und … falls Sie sich erfrischen möchten, neben dem Atelier befindet sich ein Badezimmer.«
»Was, sehe ich so schlimm aus?«, rutschte es mir heraus.
Sein Auge verengte sich. »Seien Sie vorsichtig, Salvati«, sagte er schlicht. »Hier gelten andere Regeln als im Rest der Stadt. Wenn Sie Ihre freche Art nicht in den Griff bekommen, werde ich Sie so schnell vor die Tür setzen, wie ich Sie in dieses Haus eingeladen habe.«
Ich biss die Zähne zusammen. Ich hätte diesen Auftrag gar nicht angenommen, hätte ich das Geld nicht gebraucht. Anamoias war jedoch bereit, mehrere tausend Dukaten für die Gemälde zu zahlen. Ein absurd hoher Preis. Aber auch einer, von dem ich gut würde leben können.
So ein Angebot konnte ich nicht einfach ausschlagen.
»Dann werde ich mich an die Arbeit machen«, sagte ich.
»Viel Erfolg«, sagte Anamoias trocken.
Ich gab mir nicht die Blöße, darauf zu antworten. Schweigend stand ich auf und verließ den Raum, wobei ich erfolglos versuchte, das grässliche Pulsieren hinter meinen Schläfen zu ignorieren. Einen Augenblick lang erwog ich, zu beten, dass seine Familie netter sein würde als er. Doch vermutlich würde sich die Göttin Esteria genauso taub stellen wie sonst auch.
Großartig, dachte ich.
Das würden ein paar lange Wochen werden.
Riora
Das Chaos in Person
Sonnenlicht flimmerte durch das Geäst, während ich mich in meinem Buch vergrub.
Es war heiß auf den Straßen von Anamoya. Obwohl ich im Schatten mehrerer großer Bäume saß, klebte der Schweiß an meiner Haut. Sommer in der Stadt waren so warm, dass jeder Gedanke erlahmte, bevor man ihn wirklich gedacht hatte. Schwierig, in dieser Hitze zu arbeiten. Doch ich hatte tagsüber nur wenig Zeit für mich und wollte sie so gut wie möglich nutzen.
Also vertiefte ich mich in meine Lektüre. Es war ein Buch über Medizin, das einst meinem Vater gehört hatte. Er war früh gestorben – allerdings nicht an Nekrobotanik, sondern weil er betrunken in einen Kanal gefallen war. Mein Onkel schüttelte den Kopf, wenn er darüber sprach. Viele Dinge waren ein Zeichen von Schwäche für ihn, doch Trunkenheit ganz besonders.
»Er war ein närrischer Herumtreiber, dein Vater«, erklärte er mir dann. »Ich habe ihn gern gehabt, aber er war von Natur aus chaotisch. Nichts konnte ihn jemals aufhalten, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, und mit seinen Eskapaden hat er große Schande über die Familie gebracht. Du solltest danach streben, anders als er zu werden, Riora.«
»Ich werde mein Bestes tun«, hatte ich versprochen.
»Sehr gut«, meinte er. »Und nun sag mir die Grundregeln der Nekrobotanik auf, damit ich weiß, dass du etwas gelernt hast.«
Ich blickte auf mein Buch hinab. Mein Vater hatte sie an den Rand der Seite geschrieben, die ich gerade betrachtete.
1.Nekrobotanik ist die Kunst, Knochen und Pflanzen zu verbinden. So geschaffene Mechanismen gehorchen einfachen Befehlen. Die Lebenskraft der Pflanze zehrt sich dabei auf – verdorrt sie, endet auch der Zauber.
2.Nekrobotanik kann verwendet werden, um Verletzungen zu heilen, wenn man die Pflanze mit einem Patienten verbindet. Sie greift dabei den Körper des Botanikers an.
Mögliche Konsequenzen: Unfruchtbarkeit, Verlust von Körperteilen, Tod.
Mit einem Seufzen klappte ich das Buch zu.
Um mich herum lärmte die Stadt, der nahe gelegene Dschungel. Schweißperlen rollten meinen Nacken hinab, doch ich blieb noch eine Weile unter den Bäumen sitzen, ehe ich mich auf den Heimweg machte. Pflanzen wuchsen überall in Anamoya, vor allem auf den unzähligen kleinen Inseln, die sich im Brackwasser des Deravani gebildet hatten. Der Fluss brachte viel fruchtbaren Schlamm aus den Dschungeln mit, in dem sich alle möglichen Kreaturen ansiedelten.
Doch das Wasser war seicht genug, um hindurchzuwaten; durchzogen von Blättern, zwischen denen kleine Fische lebten. Als ich die Straße erreichte, begegneten mir Frauen, an deren Fingern metallene Krallen schimmerten. Männer, die Absätze an den Stiefeln und Klingen am Gürtel trugen, die jeden herausforderten, der sie auch nur schief ansah.
Einigen von ihnen folgten Skelette durch die Gassen. Manche waren dick angezogen, andere nur in Seide gehüllt, sodass man ihre Knochen deutlich unter den farbigen Schleiern sah. Die Leute schmückten ihre Diener gern, um ihren Wohlstand zur Schau zu stellen. Einmal begegnete mir sogar eine Frau mit einem Skelett, dem ein Wust an Blumen aus dem geöffneten Schädel spross. Die Ranken fielen in einer wilden Mähne am Rücken hinunter, kringelten sich an den Spitzen zu trockenem Gespinst.
Ich hatte natürlich keinen Knochendiener bei mir, doch ich erreichte den Stadtpalast meiner Familie ohne Störungen. Rasch brachte ich mein Buch weg, ehe ich die Bediensteten anwies, mir ein Bad einzulassen. Als ich sauber war, zog ich mich sorgfältig an. Eine cremefarbene Bluse mit langen Ärmeln, darüber eine schwarze Weste und eine passende Hose.
Mein Herz klopfte vor Aufregung. So würde ich verewigt werden.
Wie seltsam. Wie wunderbar.
Einige Augenblicke lang betrachtete ich mich, strich lose Fäden von meinen Ärmeln, um so ordentlich wie möglich auszusehen. Wenig später hörte ich Schritte. Meine Mutter trat ein, in ein dünnes grünes Kleid gehüllt, das ihr sehr gut stand. Auch sie trug goldene Krallen an den Fingern. Viele hochrangige Frauen zeigten auf diese Art, dass sie es nicht nötig hatten, sich ihren Lebensunterhalt mit Arbeit zu verdienen.
»Möchtest du Salvati so entgegentreten?«
Ich betrachtete mich im Spiegel, verspürte plötzlich Zweifel. »Warum, stimmt etwas nicht?«
»Es ist in Ordnung, Riora, aber es fehlt noch ein wenig Schmuck. Er wird dich für die Ewigkeit malen. Da ist das angemessen, denkst du nicht?«
Statt auf meine Antwort zu warten, zog sie etwas aus ihrer Tasche. Metall blitzte. Wenig später legte sie mir eine Silberkette um den Hals, ein Stein in der Mitte, dessen Blau ungefähr dem Blauton meiner Augen entsprach.
»Was hältst du davon?«
Ich berührte die Kette vorsichtig. »Sie ist wunderschön«, sagte ich.
Sie lächelte darüber, ordnete einige meiner verirrten Haarsträhnen. Ich war zwar nicht immer einer Meinung mit meiner Mutter – wer war das schon? –, aber in diesem Augenblick durchströmte mich Wärme.
»Riora?«
»Hm?«
Meine Mutter schwieg kurz. Das irritierte mich, weil es ihr eigentlich nicht ähnlich sah. »Denkst du manchmal, dass dein Onkel dir zu viel aufbürdet?«
»Was? Wieso sollte ich … Es ist alles in Ordnung, wirklich.«
Einige Herzschläge lang blickten wir gemeinsam in den Spiegel. Mir fiel auf, wie ähnlich wir einander sahen, obwohl ich das dunkle Haar meines Vaters geerbt hatte. Schmale Gesichter. Blaue Augen. In zwanzig Jahren würde ich bestimmt aussehen wie sie jetzt.
Dann nickte meine Mutter mir zu.
»Das ist gut, aber wir müssen bald darüber sprechen. Er setzt dich so stark unter Druck.« Sie schüttelte den Kopf. »Lass dich nicht von Salvati ärgern, ja?«
»Nekrobotanische Theorien, die ich nicht verstehe, ärgern mich«, erklärte ich. »Da muss er schon früh aufstehen, um anstrengender zu sein als das.«
Sie seufzte. »Du bist manchmal genau wie dein Onkel.«
Ich setzte ein schelmisches Lächeln auf. Sie lächelte ebenfalls, wandte sich um und verließ das Zimmer. Einige Herzschläge lang blieb ich vor dem Spiegel stehen, ehe ich mit klopfendem Herzen nach unten ging. Für den Auftrag hatte mein Onkel einen Raum herrichten lassen, der Salvati als Atelier dienen sollte. Bestimmt wollte er hin und wieder nachsehen, was der Künstler trieb. Einen Blick darauf erhaschen, wie die Meisterwerke entstanden, die er zu erschaffen pflegte.
Vorsichtig trat ich nach drinnen, zuckte zusammen, als ich einen rothaarigen Mann entdeckte. Er war von schlanker Gestalt, die Arme jedoch so kräftig wie die eines Hafenarbeiters und von feinen Narben gezeichnet. Summend breitete er Zeichenutensilien auf einem Tisch aus, hielt gelegentlich inne, um das eine oder andere neugierig zu mustern. Der Tür hatte er den Rücken zugedreht. Das war gar nicht so ungefährlich in einer Stadt wie Anamoya.
»Entschuldigen Sie«, platzte ich heraus. »Sind Sie Arias Salvati?«
Der Mann wandte sich um. Sein Haar hatte er mit einem bunten Tuch gebändigt, das er etwas unordentlich um seine Stirn gewickelt hatte, verschiedene Perlen und Federn zwischen die Strähnen gewoben. Es ließ ihn beinahe wie einen verirrten Piraten aussehen.
»Was? Oh. O nein.« Er zwinkerte mir zu. »Arias wünschte, dass er mehr wie ich wäre.«
Ich hob eine Braue. Er lachte.
»Ich heiße Tyban«, sagte er. »Ich helfe Arias heute bei seiner Arbeit. Ich bin ein Freund von ihm.«
»Wirklich?«, fragte ich verwundert. »Hat er keine Schüler?«
»Er hatte einmal einen«, erwiderte Tyban leichthin, »aber das ging ungefähr drei Monate lang gut, bis sie sich so heftig gestritten haben, dass man sie noch in Nandes hören konnte.«
Mir wurde flau im Magen. »Er … er wird mich doch nicht anschreien, oder?«
»Ich glaube nicht«, sagte Tyban, »aber er hat heute einen schlechten Tag. Ich würde Ihnen raten, so wenig wie möglich mit ihm zu sprechen, er kann gerade wahrscheinlich sowieso keine gehaltvolle Konversation führen.«
»Oh«, sagte ich schwach. Irgendwie hatte ich mir das Ganze anders vorgestellt. Viel freundlicher und magischer, wie ein Ereignis, an das ich noch lange glücklich zurückdenken würde. »Wie kommt das?«
»Er hat üble Kopfschmerzen«, gestand Tyban.
»Das tut mir leid«, sagte ich. »Heute ist es sehr heiß. Da bekomme ich auch manchmal so ein Pochen im Kopf.«
Tyban lachte. »Ha! Ja, natürlich. Die Hitze …«
Ich wollte ihn fragen, was er damit meinte, aber im gleichen Augenblick flog die Tür zum Atelier auf.
Ich zuckte zusammen. Ein Mann trat ein, der etwas älter sein mochte als ich, die Wangen von Bartstoppeln bedeckt, das schmutzig-blonde Haar unordentlich zusammengebunden. Obwohl er eine Brille trug, hatte ich noch nie jemanden gesehen, der so wenig wie ein gebildeter Mensch wirkte. Seine Haut war gerötet, als hätte er kürzlich zu viel Zeit in der Sonne verbracht, seine Kleidung zerknittert und aus irgendeinem Grund voller Sandkörner.
Ich verzog unwillkürlich das Gesicht.
»Arias!«, sagte Tyban so freudig überrascht, als sähen sie einander zum ersten Mal. »Du lebst ja noch. Wie schön. Ich dachte schon, dass du in diesem riesigen Haus verloren gegangen wärst.«
Das ist Arias Salvati?
Ein vages Entsetzen durchfuhr mich. Meine Mutter hatte mir einmal von einem seiner Auftritte auf einem Maskenball berichtet, wie sie fast jede Woche von den Reichen ausgerichtet wurden. Ein Ehrengast, überall bewundert, so wortgewandt wie elegant im Tanz. Gekleidet in feinste Stoffe, das Haar zurückgekämmt, die Maske vergoldet. Ein Mensch, den alle Frauen um sich wollten – und einige Männer vermutlich auch.
Du meine Güte. Was war bloß mit ihm passiert?
Salvati sah mich schief an. Seine Augen waren blutunterlaufen.
»Sie sind die Nichte von Anamoias?«
»Ich heiße Riora«, sagte ich höflich. »Es freut mich, Sie kennenzulernen.«
Ich hielt ihm eine Hand entgegen, doch er fixierte mich misstrauisch, ohne sie zu ergreifen. Rasch ließ ich sie wieder fallen. Röte stieg mir in die Wangen, aber bevor einer von uns etwas sagen konnte, räusperte sich Tyban.
»Es war schön, Ihre Bekanntschaft zu machen, Riora«, sagte er zu mir. »Leider muss ich jetzt gehen. Lassen Sie sich nicht von Arias ärgern, ja?«
Salvati schnaubte leise. Ich ignorierte ihn.
»Bleiben Sie gar nicht hier, Tyban?«
Tyban grinste. »Ach was, er ruiniert sein Leben schon von allein.«
»Was soll das heißen?«, fragte ich entgeistert.
Aber Tyban lachte, wandte sich ab und ging. Ich lauschte auf seine verhallenden Schritte, während sich Stille im Raum ausbreitete. Beinahe wäre ich ihm nachgelaufen, um ihn zu bitten, im Atelier zu bleiben. Nur um nicht allein mit diesem schauerlichen Mann sein.
Bloß nicht!
Ich hob den Kopf, begegnete Salvatis düsterem Blick und schluckte.
»Äh …«
»Setzen Sie sich einfach hin.« Er wandte sich ab, um die Materialien zu begutachten, die Tyban für ihn ausgelegt hatte. »Sie müssen nichts tun – außer still dazusitzen. Das sollten Sie schaffen.«
Er sah mich nicht einmal an, während er das sagte. Beschäftigte sich stumm mit seinen Werkzeugen, ehe er eine Leinwand auf eine Staffelei stellte. Sein Gesicht war eigenartig hart. Eigenartig angespannt.
War das nur, weil er sich nicht gut fühlte?
Ich wagte es nicht, ihn zu fragen. Stattdessen lauschte ich darauf, wie er zu arbeiten anfing, leise in sich hineinfluchte und mich offenbar so wenig wie möglich zu beachten versuchte. Ich schüttelte mich innerlich. Hoffentlich sind diese Wochen schnell um, dachte ich.
Ewig würde ich diesen Mann bestimmt nicht ertragen.
Arias
Die Wunder der Nekrobotanik
Die Arbeit im Stadtpalast fiel mir noch schwerer, als ich befürchtet hatte. Hinter meinen Schläfen hämmerte es so stark, dass meine Augen tränten, während bei den einfachsten Reizen Übelkeit in mir aufstieg. Helles Licht zum Beispiel, der Geruch der Farben, sogar zu schnelle Bewegungen. Am liebsten hätte ich mich irgendwo zusammengerollt und abgewartet, bis dieses Elend vorüber war.
Verdammt, warum hatte ich mich auch betrinken müssen?
Zumindest schien Riora Anamoias nichts davon mitzubekommen. Ich fasste sie ins Auge, während ich zeichnete, studierte sie so genau wie möglich. Die Natur hatte es gut mit ihr gemeint, denn bis auf das schwarze Haar hatte sie nichts mit ihrem Onkel gemeinsam. Stattdessen war sie von zarter Statur, hatte ein weiches Gesicht mit nur feinen Kanten. Ich sah ihr deutlich an, dass sie kaum nach draußen kam. Ihre Haut war so blass, dass teilweise die Adern hindurchschimmerten, ihr Blick fest auf ihre Füße gerichtet.
Doch vielleicht trügte der Schein.
Der Name Anamoias war kein gewöhnlicher Familienname. Er bedeutete so viel wie über Anamoya herrschend und wurde dem Regenten samt seinen Angehörigen verliehen, wenn er die Macht ergriff. Einige von ihnen hatten gut und weise regiert. Sie waren von der Republik geliebt und beweint worden, als ihre Zeit in dieser Welt zu Ende gegangen war.
Kyrian Anamoias würde nicht dazugehören.
Er war in erster Linie für seine Härte bekannt, dieser Mensch. Für seine Kompromisslosigkeit selbst im Angesicht größter Gefahr. Vor Jahren hatte er die Piraten, die Anamoya hatten plündern wollen, bis auf den letzten Mann gejagt. Manche Leute hielten ihn für gefährlich kompetent. Andere für vollkommen verrückt.
Niemand hätte es je gewagt, ihm das eine wie das andere ins Gesicht zu sagen.
Ich blickte auf. Riora Anamoias sah immer noch konzentriert auf ihre Füße, als wären sie die interessantesten Objekte, die sie je gesehen hatte. Sie war offensichtlich nicht aus dem gleichen Holz geschnitzt wie er, doch ihre Verwandtschaft genügte mir, um auf der Hut zu sein.
In den zwanzig Familien von Anamoya trug jeder eine Maske.
Da konnte man nicht vorsichtig genug sein.
* * *
Wie so oft, wenn ich mich schlecht fühlte, verging der Tag unendlich langsam. Gegen Abend verabschiedete ich mich von Riora Anamoias und verließ den Stadtpalast, ohne mich weiter umzusehen. Der Kopfschmerz hatte sich inzwischen auf ein erträgliches Maß eingependelt. Ich verschwand in einer Seitenstraße, froh, etwas frische Luft schnappen zu können …
… nur um beinahe in Tyban hineinzulaufen.
Ich zuckte zusammen, doch Tyban trat mir elegant aus dem Weg. Seine bernsteinfarbenen Augen funkelten. Er sah immer aus, als amüsierte er sich heimlich über einen Witz, den nur er verstand.
»Da bist du ja wieder«, begrüßte er mich. »Und, wie war es?«
»So schön, als hätte mir jemand einen faulen Zahn gezogen«, sagte ich mürrisch. »Hast du den ganzen Tag hier gewartet?«
»Sehe ich aus, als hätte ich so viel Zeit?«, erwiderte Tyban belustigt. »Ich bin erst vor einer Stunde zurückgekommen. Du hast schlecht ausgesehen. Da dachte ich mir, dass ich besser nachsehen sollte, wie es dir geht.«
Ich musste lächeln. »Danke.«
»Keine Ursache. Also, wie fühlst du dich?«
»Gut«, log ich.
Er hob stumm eine Braue.
»Schön«, sagte ich seufzend. »Mein Kopf fühlt sich an, als würde er gleich explodieren, und die Arbeit hat es nicht besser gemacht. Ich arbeite ungern für diese Familie.«
»Warum das denn?«, fragte Tyban stirnrunzelnd.
Ich bedeutete ihm stumm, mir zu folgen. Gemeinsam entfernten wir uns vom Stadtpalast, gingen an einem der unzähligen Kanäle entlang, die sich durch Anamoya zogen. Mücken schwirrten über dem Wasser. Ich bemerkte, dass sich eine davon auf meinem Arm niederlassen wollte, und verscheuchte sie mit einer Handbewegung.
»Was ich dir jetzt erzähle, weißt du aber nicht von mir, ja?«
Tyban hob mit ironischer Geste seine Hand. »Ich schwöre es bei all dem Sand, den du heute Abend noch aus deinen Schuhen kippen musst.«
Ich verdrehte die Augen. Er lachte.
»Also«, sagte ich. »Die Familie Anamoias besteht aus Nekrobotanikern. Man kann diesen Leuten nicht trauen, in Ordnung? Sie sind verlogen bis ins Mark.«
Tyban blieb stehen. »Woher willst du das wissen?«
»Weiß ich eben«, sagte ich ausweichend. »Viele Mitglieder der zwanzig Familien sind Nekrobotaniker. Was glaubst du, wie sie sonst an die Macht gekommen sind?«
Tyban runzelte die Stirn, als dächte er ernsthaft darüber nach, ehe er zu grinsen anfing. »Ich wusste gar nicht, dass du an Verschwörungen glaubst.«
»Ich wusste gar nicht, dass du ein Schwachkopf bist«, sagte ich gereizt.
Tyban feixte, ging jedoch nicht darauf ein. »Deine Theorie hat aber einen Fehler, Arias. Warum sollten so mächtige Leute verbergen, was sie sind?«
»Das machen alle reichen Familien mit diesem Talent«, erklärte ich. »Sie holen sich sogar Knochendiener von nekrobotanischen Handwerkern, statt ihre eigenen zu erschaffen. Das hat zwei Gründe. Der erste ist, dass Nekrobotaniker nicht besonders fruchtbar sind – es schädigt ihre Körper, Energie von Lebendem zu stehlen und sie in Totes zu zwingen. Das steht im Weg, wenn man sein Kind vorteilhaft verheiraten will.«
»Aha«, sagte Tyban. »Und der zweite?«
»Es gibt einen Unterschied zwischen den Handwerkern und den zwanzig Familien«, sagte ich. »Erstere besitzen ein Talent, das sie zu Geld machen, weil sie sonst verhungern. Sie nehmen dafür in Kauf, in Bedrängnis zu geraten, wenn es irgendwo einen Zwischenfall mit ihren Konstrukten gibt. Aber die zwanzig Familien haben das nicht nötig. Für sie ist Nekrobotanik ein Werkzeug, um mehr Macht zu erlangen.«
Tyban legte den Kopf zur Seite. »Ach ja? Wie funktioniert das?«
»Sagen wir, dass ich ein Nekrobotaniker bin, der jemanden in dieser Stadt wirklich nicht leiden kann«, erklärte ich. »Ich könnte ein Messer aus Knochen schleifen, eine Pflanze darum wickeln und es losschicken, damit es einer Person meiner Wahl die Kehle durchschneidet. Das Grünzeug vertrocknet, nachdem es ausgezehrt ist, das Knochenmesser ist so eingestellt, dass es ohne die Energiequelle zerspringt. Da hast du es. Nur noch Staub und Wurzeln – keine Möglichkeit, herauszufinden, wer es war.«
»Das ist aber spezifisch, Arias. Geht es dir gut?«
»Das ist die Geschichte vom Untergang der Familie Veranza, du Trottel«, sagte ich. »Bis heute weiß man nicht, wer das Attentat verübt hat – weil niemand, der in Anamoya etwas zu sagen hat, sich als Nekrobotaniker offenbart.«
Tyban schien darüber nachzudenken, ehe er mit den Schultern zuckte.
»Ich verstehe«, sagte er. »Aber was kümmert es dich? Anamoya ist bis unter die Dächer mit Dieben und Assassinen vollgestopft. Nekrobotaniker sind im Vergleich dazu harmlos. Sie haben schon seit Ewigkeiten nichts Schlimmes mehr getan.«
»Jedenfalls nichts, was man ihnen beweisen kann.«
Tyban verdrehte die Augen. »Wir sind heute aber paranoid.«
Ich schnaubte leise. Nur wenige Menschen wussten, wozu Nekrobotaniker imstande waren, denn diese Leute hüteten ihre Geheimnisse eifersüchtig. Besser, nichts mehr dazu zu sagen. Tyban würde mich womöglich nur fragen, woher ich das alles wusste, und manche Dinge erzählte man nicht einmal seinem moralisch flexiblen besten Freund.
Tyban verschränkte die Hände hinter dem Kopf.
»Wie auch immer«, sagte er. »Schaffst du es, nach Hause zu finden, ohne in einen Kanal zu fallen? Ich muss zur Arbeit.«
»Was soll das denn für eine Arbeit sein?«, erkundigte ich mich skeptisch.
»Unten im Hafenbezirk gibt es eine hübsche Villa«, erzählte Tyban, »deren Eigentümer eine Reise nach Aspara unternommen haben. Bestimmt fühlen sich ihre Schätze sehr einsam. Jemand sollte nach dem Rechten sehen.«
Ich musste lachen. »Du bist eine Stütze unserer Gesellschaft, Tyban.«
»Weiß ich doch, Arias. Weiß ich doch.« Er zwinkerte mir zu. »Brauchst du morgen eigentlich wieder einen Assistenten? Heute hatte ich eine Menge Spaß.«
»Wenn du magst. Niemand legt meine Pinsel so ordentlich hin wie du.«
»Das war die Antwort, auf die ich gehofft habe«, sagte er, deutete eine ironische Verneigung an und eilte davon, bevor ich ihm die Ohren dafür langziehen konnte. Ich schüttelte grinsend den Kopf. Dieser Trottel!
Ich rieb mir die Schläfen, hinter denen noch ein vager Restschmerz nachhallte, und ging zum nächstbesten Kanal hinunter. Dort lagen mehrere geschmückte Barken, deren Besitzer den ganzen Tag lang nichts anderes taten, als zwischen den Bezirken von Anamoya hin und her zu fahren. Ich drückte einem von ihnen etwas Geld in die Hand, nannte ihm mein Ziel und schloss kurz die Augen, als wir uns in Bewegung setzten.
Der Fährmann nahm eine lange Stange hervor und begann, zu staken. Einige Augenblicke glitten wir durch warmes Halbdunkel. Die Häuser standen hier so nah beieinander, dass ich beide Arme hätte ausstrecken können, um ihre Wände zu berühren. Die Fensterläden waren verschlossen, die Mauern fleckig, wo sich der Putz abgelöst hatte. Anamoya konnte schmutzig sein. Anamoya konnte widerlich sein. Anamoya stank nach Brackwasser, war von Mücken verseucht, besaß keine einzige sichere Straße ins Hinterland.
Dann verließen wir den Kanal.
Und die Stadt begann, zu strahlen.
Sonnenlicht brach sich auf dem Wasser. Hier erstreckte es sich so weit in alle Richtungen, dass es fast aussah, als befänden wir uns in einer von Gebäuden umgebenen Bucht. An einem Ende entdeckte ich eine Esteriakirche mit kuppelförmigem Dach, das in der Sonne glänzte, während sich an der anderen Wohnhäuser mit schmalen Balkonen entlangzogen.
Das alles war von Pflanzen überwachsen. Sie ringelten sich an den Häusern hinab, bildeten üppige Körbe aus Blüten, die selbst auf größere Distanz süßen Duft verströmten. Auch an den Straßen wuchsen Büsche, die sich manchmal bis auf unbenutzte Barken ausgebreitet hatten. Während wir fuhren, passierten uns sogar mehrere Boote, die eher aussahen wie schwimmende Gärten als wie menschengemachte Konstrukte. Lichter baumelten an den Zweigen hinab, flackerten kaum eine Handbreit über dem Wasser.
Dann tauchten wir wieder zwischen den Häusern ein. Die Sonne versteckte sich hinter den Dächern. Hier im Halbdunkel roch es nicht besser als in den dunklen Gassen, die es in so großer Masse in Anamoya gab. Es sah beinahe ebenso trostlos aus.
Dunkelwasser.
Eine Weile fuhren wir fast lautlos durch die Kanäle, bis das Boot an einem maroden Holzsteg zum Stehen kam. Ich stieg aus und ging ein Stück, bis ich die Tür eines schäbigen Hauses erreichte. Das unterste Geschoss war unbewohnt, die Fenster vernagelt. Feuchtigkeit, die tief ins Mauerwerk einzog, war ein ernstes Problem in Anamoya.
Auf der mittleren Etage lebte eine Familie mit gefühlt einem Dutzend kreischender Kinder, doch ganz oben gab es niemanden außer mir. Ich öffnete die Tür, trat in eine unangenehme Mischung aus Wärme und Modergeruch und ging sofort zum Fenster hinüber, um es zu öffnen.
Die flachen Gebäude von Anamoya, nur durch Kanäle voneinander getrennt, reichten bis zum Horizont. Auf der Landseite endeten sie an dichtem grünem Dschungel; zum Ozean hin erstreckte sich die berühmte Lagune von Anamoya mit ihrem türkisfarbenen Wasser. Dort, etwas abseits vom Rest der Stadt, erspähte ich eine Insel. Sie war nur durch eine schmale Brücke mit dem Festland verbunden. Während ich hinschaute, zogen mehrere Männer einen Karren darüber hinweg, der mit weißen Seidentüchern geschmückt war.
Weiß war die Farbe des Todes.
Sie brachten jemanden nach Vetalia, auf die Friedhofsinsel.
Ich schloss kurz die Augen. Nach dem Tod konnte man seine Knochen an Nekrobotaniker übergeben lassen, um der verbleibenden Familie zu etwas Geld zu verhelfen, doch viele Anamoyaner ließen sich lieber dort bestatten. Ich war zum letzten Mal vor mehr als fünfzehn Jahren dort gewesen. Als ich …
Bilder stiegen vor meinem inneren Auge auf. Ein gurgelnder Schrei. Ein regungsloser Körper, über dem Bett gefesselt, in dem er sonst geschlafen hatte; leise und vergessen ausblutend.
Auf dem Boden ein Hauch von Pulver. Gelblich, beinahe weiß.
Trockenes Wurzelwerk, ausgezehrt.
Ich kniff die Augen zusammen, bis die Bilder verschwanden. So oft hatte ich sie vor mir gesehen. Sie gezeichnet, in der Hoffnung, sie endlich aus dem Kopf zu bekommen.
Aber nichts half.
Und nichts würde die Erinnerungen jemals wirklich begraben können.
* * *
Am nächsten Morgen waren meine Kopfschmerzen zum Glück fast vollkommen verschwunden. Während ich frühstückte, verflüchtigten sie sich gänzlich, und als ich mich zum Stadtpalast der Familie Anamoias aufmachte, empfand ich beinahe so etwas wie Tatendrang. Die Aussicht, an einem Bild zu arbeiten, beruhigte mich immer.
Ganz egal, wie unerträglich die Welt war.
Wenig später erreichte ich das Gebäude. Tyban war nirgends zu sehen, was mich keineswegs wunderte; er versäumte manchmal Verabredungen, weil er sich von irgendetwas hatte ablenken lassen. Als ich jedoch ins Atelier trat, fand ich nicht etwa einen leeren Raum vor. Stattdessen schritt eine Frau dort umher, die ich nicht kannte und die bis auf ihr helles Haar einige Ähnlichkeiten mit Riora Anamoias aufwies.
Einen Augenblick lang beobachtete ich sie schweigend. Sie kontrollierte jeden Pinsel mit spitzen Fingern, sah sich genau an, was ich bereits gezeichnet hatte. Nicht dass es viel zu sehen gegeben hätte. Ich hatte zwar erste Skizzen angefertigt, bezweifelte jedoch, gestern irgendetwas Gehaltvolles produziert zu haben.
Ich trat hinter die Frau. Sie wirbelte sofort zu mir herum, als hätte ich sie bei etwas Verbotenem ertappt, die Augen zu Schlitzen verengt.
»Esterias Atem! Warum schleichen Sie sich so an?«
Ich ging gar nicht erst darauf ein. »Wieso laufen Sie denn wie ein verwirrtes Huhn durch das Atelier?«
Ihre Nasenflügel blähten sich, als sie scharf einatmete. »Ich kontrolliere Ihre bisherige Arbeit, Salvati. Wir zahlen immerhin viel Geld für Ihre Bilder.«
»Und? Sind Sie zufrieden?«
»Ich hätte gedacht, dass Sie schon mehr geschafft haben.« Sie bedachte mich mit einem langen, düsteren Blick. »Sie sind genauso frech, wie die Leute sagen. Ich weiß nicht, warum Kyrian Sie damit beauftragt hat. Es ist den Ärger nicht wert.«
Ich weiß nicht, warum Ihr Mann Sie geheiratet hat, dachte ich. Wahrscheinlich hat man ihm das Gleiche gesagt. Ich entschied mich jedoch, diesen Kommentar für mich zu behalten, denn bei meinem Glück brachte mich die irre reiche Frau noch für meine scharfe Zunge um.
»Wo ist Anamoias überhaupt?«
»Er ist mit wichtigen Geschäften beschäftigt«, erklärte sie mir so hochnäsig, als hätte sie jedes davon persönlich für ihn abgeschlossen. »Vermutlich kommt er erst heute Abend wieder.«
»Fein«, sagte ich, »jeder Augenblick ohne ihn ist einer, in dem ich in Ruhe arbeiten kann. Apropos. Ich muss weitermachen.«
Sie betrachtete mich mit einem Ausdruck tiefster Abscheu. Ich nahm an, dass sie das absichtlich tat, um mich zu ärgern. Doch ich empfand lediglich eine Mischung aus Resignation und grimmiger Befriedigung.
»Gut«, zischte sie. »Aber ich behalte Sie im Auge. Ich kenne Ihren Ruf, Salvati. Den kennen wir alle.«
Damit stolzierte sie davon, wobei ihre Schritte klar und laut über den Marmorboden hallten. Ich beobachtete, wie sie sich entfernte, hoffentlich bis ans andere Ende der Welt. So eine dumme Ziege!
Die Ankunft von Riora Anamoias hielt mich jedoch von weiteren Gedanken zu ihrer unsäglichen Mutter ab. Sie grüßte mich mit einem knappen Nicken, ehe sie sich setzte, offenbar bestrebt, nicht mehr als absolut notwendig mit mir zu sprechen. Ich fasste sie ins Auge. Das schwarze Haar hatte sie peinlich genau hochgesteckt, sodass man Gesicht und Hals besser sehen konnte, doch ihr Blick wanderte unruhig umher.
»Meine Mutter kam mir gerade entgegen«, sagte sie.
»Ah«, sagte ich. »Ja. Reizende Person.«
Sie runzelte die Stirn. Offenbar konnte sie nichts mit dieser Antwort anfangen.
»Sie wollte bestimmt nur nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Es tut mir leid, wenn sie Ihre Arbeit durcheinandergebracht hat. Sie kann manchmal etwas herrisch sein, aber eigentlich ist sie ein guter Mensch.«
Riora Anamoias hatte eine seltsam unsichere Art zu sprechen. Als würde sie fürchten, für jedes falsche Wort einen Schlag in den Nacken von mir zu bekommen. Unschön, dachte ich. Aber nicht unverständlich. Wahrscheinlich wäre ich genauso vorsichtig, wenn ich mit Kyrian Anamoias und diesem Drachen von einer Mutter zusammenleben müsste.
»Dafür können Sie doch nichts«, sagte ich, ohne darüber nachzudenken. »Nekrobotaniker sind eben so.«
Eine steile Falte bildete sich auf Rioras Stirn. »Was?«
Verdammt.
»Nichts«, sagte ich eilig. »Ich habe nur laut nachgedacht.«
Riora räusperte sich. »Sie ist keine … also, so etwas sollten Sie niemandem vorwerfen. Wir sind keine Nekrobotaniker. Wir waren auch nie welche.«
Ich schnaubte. Die zwanzig Familien waren von Grund auf verlogen, aber offenbar hatte dieses Talent Riora Anamoias übersprungen.
»Natürlich nicht«, sagte ich. »Und ich regiere das Kaiserreich von Melenya von meiner hübschen kleinen Wohnung in Dunkelwasser aus.«
Für einen Herzschlag sah ich einen Anflug von Schrecken in ihrem Blick. Für einen Herzschlag. Dann jedoch richtete sie sich auf, wobei sie offenbar versuchte, so eindrucksvoll wie möglich auszusehen.
Das misslang ihr schrecklich.
»Selbst wenn wir welche wären«, sagte sie nervös, »was wir nicht sind …«
Ich verkniff mir ein Schnauben. Riora schien das nicht zu bemerken.
»… kümmert sich mein Onkel darum, dass es allen Anamoyanern gut geht. Wenn Sie diese Lügen herumerzählen sollten, wird er sich auch um Sie kümmern.«
»Ich bitte Sie. Wir wissen beide, dass ich nicht lüge.«
»Das habe ich ernst gemeint«, beharrte sie.
Ich sah sie schief an. Inzwischen war ihr die Röte in die Wangen gestiegen, aber es war schwer zu sagen, ob das vor Wut passiert war oder aus Scham. Sollte Kyrian Anamoias doch kommen, wenn er wollte. Dann würden wir sehen, wer sich hier um wen kümmerte.
»Was macht er denn, wenn ich es herumerzähle?«, fragte ich. »Mich in einen Kerker stecken? Damit wüssten die Leute, dass ich recht habe.«
»Ja, zum Beispiel«, empörte sie sich. »Mein Onkel hat recht. Sie haben wirklich keine Manieren.«
»Das ist auch das Einzige, womit er je recht hatte«, sagte ich säuerlich. »Fein. Ich sage niemandem, dass Sie aus einer Dynastie verlogener Knochenklapperer kommen, in Ordnung? Tun Sie mir jetzt einen Gefallen, setzen Sie sich auf den Stuhl und lassen Sie mich meine Arbeit machen.«
»Sie sind so ein arroganter Mistkerl!«, fuhr sie mich an.
»Nur für Nekrobotaniker«, gab ich zurück.
»Oh, Sie elender …«
Aber bevor sie ihren Satz beenden konnte, unterbrach uns ein Schrei.
Ich zuckte zusammen. Riora zuckte zusammen. Einen Augenblick lang starrten wir einander halb erschrocken und halb ungläubig an, ehe ich den Kopf in die Richtung drehte, aus der das Geräusch gekommen war.
»Was war das?«
Riora antwortete nicht, sondern verließ das Atelier. Ich folgte ihr hinaus – durch einen mir bisher unbekannten Gang des Gebäudes, eine Treppe hinauf, die in die mittlere Etage führte. Ein Schaudern kroch zwischen meinen Schulterblättern hinab. Irgendetwas stimmte nicht.
»Mutter?«, rief Riora. »Ist alles in Ordnung?«
Niemand antwortete.
Riora begann, zu laufen. Ich beeilte mich, Schritt mit ihr zu halten, als sie eine Tür aufstieß und in den Raum dahinter eilte. Ein unangenehm kaltes, aufreibendes Gefühl erfasste mich.
Ein zweiter Schrei. Dann ein dritter, der nicht zu den anderen beiden passte.
Ich hastete in den Raum. Begriff erst, dass Riora geschrien hatte, als sie erschrocken die Hände auf ihren Mund presste – als sie in das Zimmer starrte, das sich als ein verschwenderisch eingerichtetes Schlafgemach entpuppte. Die Wäsche war von der Matratze des Doppelbettes geworfen worden, die Laken abgezogen. Jemand hatte sie zu mehreren Seilen gedreht und an der Decke des Zimmers aufgehängt.
Dort oben hing Savina Anamoias, die Hände über ihrem Kopf gefesselt, die Kehle von einer Seite zur anderen durchgeschnitten. Ein roter Fleck hatte sich auf ihrer Bluse ausgebreitet, wo ihr das Blut über die Brust gelaufen war. Darauf war ein gefalteter Brief festgesteckt. Eine weiße Blüte, unbefleckt, die absurd aus all dem Rot hervorstach.
Einen Augenblick lang starrte ich dieses grässliche Bild ungläubig an. Mein Herzschlag schien sich immer weiter zu verlangsamen, während sich ein dumpfes Summen in meinem Kopf ausbreitete. Rasch senkte ich den Blick. Auf dem Boden lagen trockene Wurzeln, bestäubt von weißlichem Pulver. Da erst spürte ich, wie sich ein namenloser, eisiger Schrecken in meinen Gliedmaßen festsetzte.
Nein. Nein.
Das konnte nicht sein. Das war unmöglich.
Der Brief fiel von der Brust der Toten, drehte sich im Flug wie ein sterbender Schmetterling. Einem Impuls folgend hob ich ihn auf und steckte ihn in meine Tasche, aber meine Finger fühlten sich kalt und taub an. Ruhig, sagte ich mir, obwohl alles in mir erzitterte. Bleib ruhig, Arias … bleib ruhig …
Ich blickte zu Riora hinüber. Sie schien meine Aufregung nicht einmal bemerkt zu haben. Mit weit aufgerissenen Augen fixierte sie die fürchterliche Szene, während ein Windstoß durch ihre Kleidung fuhr.
»Nein«, flüsterte sie. Ihre Stimme brach. »Nein, bitte.«
Sie begann, zu weinen. Ich starrte auf ihr hochgestecktes Haar, das sich in der Brise aus seinem Knoten löste. Moment. Warum war es hier so windig? Warum …
Ein jäher Schrecken durchfuhr mich.
Das Fenster. Wer hatte es geöffnet?
Ich blickte auf und sah eine dunkle Gestalt an der gegenüberliegenden Wand des Hauses hängen.
Einen Augenblick lang vergaß ich Riora Anamoias. Ich vergaß sogar, dass das hier nicht mein Stadtpalast war, nicht meine Angelegenheit, dass mir jeder unbedachte Schritt nur Scherereien einbringen würde. Ohne ein weiteres Wort wirbelte ich herum und begann, zu laufen. Hastete nach unten, stürmte durch die nächstbeste Tür auf den Innenhof des Gebäudes hinaus.