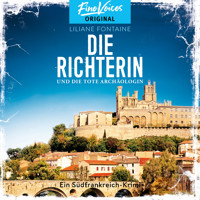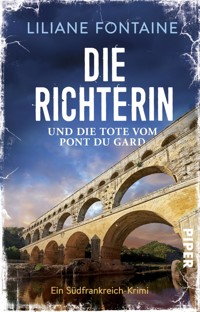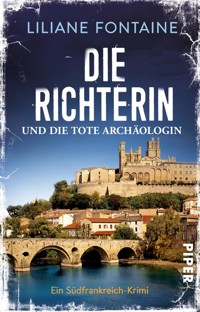6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Untersuchungsrichterin Mathilde de Boncourt ermittelt
In der Nähe von Nîmes verunglückt die Schülerin eines Eliteinternats bei einem scheinbar tragischen Reitunfall tödlich. Doch bei der Obduktion wird klar: Es war kein Unfall, sondern Mord. Mathilde de Boncourt und ihr Team beginnen ihre Ermittlungen, stoßen bei Schülern wie Lehrern jedoch auf eine Mauer des Schweigens. Bald stellt sich heraus, dass es einen Zusammenhang zu dem rätselhaften Tod eines Schülers ein Jahr zuvor geben könnte. Als auf dem Gelände kurz darauf die Leiche des Sportlehrers aufgefunden wird, muss Mathilde sich fragen, ob womöglich weitere Leben in Gefahr sind …
Mathilde de Boncourt ermittelt:
Band 1: Die Richterin und die Tote vom Pont du Gard
Band 2: Die Richterin und die tote Archäologin
Band 3: Die Richterin und der Kreis der Toten
Band 4: Die Richterin und das Ritual des Todes
Band 5: Die Richterin und der Tanz des Todes
Band 6: Die Richterin und das Erbe der Toten
Band 7: Die Richterin und der Todesbote
Alle Bände sind in sich abgeschlossene Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels » Die Richterin und das Ritual des Todes« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2021
Redaktion: Sandra Lode
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: Danita Delimont/Getty Images
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht und dafür keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Cover & Impressum
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Prolog
Sssss. Eine Stechmücke umschwirrte seinen Kopf, bereit, es sich auf einem Stückchen Haut bequem zu machen, zuzustechen und sich eine Mahlzeit zu gönnen. Mit einem Wedeln seiner linken Hand verscheuchte er den winzigen Blutsauger. Sollte der sich sein Opfer doch auf der anderen Seite suchen. Phil würde noch nicht mal was davon bemerken.
Sie teilten sich das Zimmer. Philiberts Reich nahm die rechte Hälfte ein, seines die linke. Die rechte Seite sah immer aus, als hätte eben eine Bombe eingeschlagen. Drohte eine Zimmerkontrolle, verschwanden Klamotten, Bücher, Schuhe und Dreckwäsche im Schrank, der sich dann nur noch mühsam schließen ließ. In die Schränke schaute niemand.
Philibert drehte sich im Bett auf den Bauch, das Schnarchen ebbte für ein paar Sekunden ab. Dann ein tiefer Seufzer. Der Junge nahm wieder seine Rückenschläferposition ein, und das Schnarchkonzert begann mit voller Lautstärke von vorne. Unter normalen Umständen wäre Michel jetzt aufgestanden, hätte Philibert einen ordentlichen Klaps auf den Brustkorb gegeben, ihm zur Not eine Sekunde lang die Nase zugehalten, in der Hoffnung, sein Freund würde endlich eine Stellung finden, in der weniger Bäume ihr Leben lassen mussten.
Doch diese Nacht war keine Nacht wie jede andere. Zum gefühlt hundertsten Mal schaute Michel auf sein Handy. Noch eine halbe Stunde. Und in spätestens zwei Stunden … Er hatte kein Auge zugetan. Aufregung, Vorfreude, aber auch Beklemmung bei der bangen Frage, was nun wirklich auf ihn zukommen würde. Es ging nicht immer zimperlich zu, so viel war ihm klar. Dieses bedrückende Gefühl beherrschte nicht nur seinen Kopf, er spürte es auch körperlich, als ob man ihn ganz eng in etwas eingewickelt hätte. So musste sich ein Insekt fühlen, wenn die Spinne es mit ihren klebrigen Fäden einspann. Ob er unter einer Art Klaustrophobie litt?
Er strampelte die Bettdecke komplett weg. Doch die Befreiungsaktion nutzte nichts. Für einen Moment glaubte Michel, keine Luft mehr zu bekommen. Ein schweres, unsichtbares Gewicht legte sich auf seine Brust, hinderte ihn am Atmen. Der Junge spürte, wie seine Poren winzige Schweißtröpfchen freigaben, die sich wie ein Film auf Gesicht und Nacken legten. Seine blonden, kurz geschnittenen Locken klebten ihm am Kopf. Er setzte sich auf und drehte den Oberkörper in Richtung Klimagerät, das auch in der Nacht brummte und das Zimmer auf angenehme zweiundzwanzig Grad herunterkühlte. Der Spuk verschwand so schnell, wie er gekommen war. Die Haut fühlte sich wieder trocken an, die Beklemmung ließ nach, das Herzrasen ebbte ab. Nur noch ein leichtes Klopfen in seinem Hals blieb davon übrig. Die Vorfreude hatte die Furcht besiegt.
Als die Tür zu seinem Zimmer geöffnet wurde, war Michel mit einem Satz auf den Beinen. Während Philibert den Schlaf der Gerechten schlief, war er bereits in seine blauen Shorts und das weiße Poloshirt geschlüpft, die Sommeruniform der Jungs.
»Chut, kein Licht.«
Michel wurde links und rechts an den Armen gefasst und in Richtung Zimmertür gedreht. Er gab keinen Laut von sich. Das hatte man ihm bereits eingetrichtert – nur nicht auffallen, keinen Lärm machen, nicht kichern. Das Letzte, was man jetzt gebrauchen konnte, war ein Philibert, der aus seinem Tiefschlaf erwachte und sich an die Fersen seines Freundes und Zimmergenossen Michel heftete. Doch um dieses Problem erst gar nicht zu provozieren, hatte man vorgesorgt.
»Hat er das Zeug getrunken?« Weniger als ein Flüstern.
Michel wisperte zurück. »Jeden einzelnen Schluck.«
Philiberts Lieblingsgetränk war an jedem Abend, den der liebe Gott erschuf, ein Becher Kakao, den er geräuschvoll mit einem Strohhalm schlürfte, bevor er in seinen noch geräuschvolleren Schlaf versank. Und es durfte nur Trinkschokolade von Valrhona sein. Nur hatte der dunkle Kakao heute Abend nicht ganz so wie sonst geschmeckt. Eine leichte Bitternote, die Philibert mit einem Achselzucken und der Einschätzung, man solle sich die Zähne nicht vor diesem Genuss putzen, abgetan hatte.
»Heh, muss das sein?«
»Ja, muss sein. Stell dich nicht so an. Wir machen sie später wieder ab.«
Die Augenbinde, die Michel die Sicht nahm, wurde an seinem Hinterkopf verknotet. Das Gewebe fühlt sich angenehm kühl und leicht an, war jedoch so fein und eng gewebt, dass er überhaupt nichts mehr sah. Erneut stellte sich dieses Gefühl von Furcht ein, und sein Herz klopfte bis zum Hals.
»Ich mag das nicht, so blind durch die Gegend zu latschen. Was, wenn ich nun irgendwo drüberstolpere? Dann scheppert’s, oder ich leg mich auf die Fresse.«
»Blödsinn, wir führen dich und passen schon auf, dass unserem chouchou nichts passiert. Alors, es geht los.«
Wieder packten Hände Michel an den Armen. Er hatte keine Ahnung, wie viele ihn begleiteten. Wahrscheinlich waren es in seinem Zimmer eben zwei gewesen. Und die anderen warteten draußen. Beim Passieren der Tür zum Flur wurde es schon eng, drei Personen passten nicht gleichzeitig durch. Michels rechter Arm wurde freigegeben, dafür drückte ihn nun jemand von hinten vorwärts.
Er konzentrierte sich aufs Riechen, wenn er schon nichts sehen konnte. Seine Nase würde ihm ganz sicher verraten, wohin sie ihn brachten. Er hatte sowieso schon einen Verdacht. Hinter dem Château lagen die Sportanlagen des Internats, daran schloss sich ein weitläufiger Park mit einer Reihe von Gebäuden an, die die ehemaligen Schlossbesitzer im Verlauf der letzten beiden Jahrhunderte zu ihrem Vergnügen oder aus rein praktischen Gründen dort hatten errichten lassen. Ein runder Tempel mit acht Säulen auf einer kleinen Anhöhe, eine Grotte, in der schon lange kein Wasser mehr über den künstlich angelegten Felsvorsprung sprudelte, ein chinesisches Teehaus, das immer abgeschlossen war, um die wertvollen Kacheln an den Wänden zu schützen, ein Swimmingpool aus den Zwanzigerjahren, der mit einer festen Plane abgedeckt war, damit niemand hineinfiel, und der Eiskeller, der noch im Zweiten Weltkrieg zum Lagern von Eis, empfindlichen Lebensmitteln und, wie man sich erzählte, zum Kühlen Hunderter Flaschen Champagner genutzt worden war. Auf diesen Kühlkeller, der halb unterirdisch angelegt und dessen Eingang von grob behauenen Steinen eingefasst war, tippte Michel. Auch dieser Keller war normalerweise abgeschlossen. Doch es gab kein Problem, das seine Freunde nicht lösen konnten. Und bald wäre er Teil dieser verschworenen Gemeinschaft. Erneut klopfte sein Herz bis zum Hals, diesmal vor überschäumender Freude.
Kies knirschte unter seinen Füßen. Die außergewöhnliche Hitze des Spätfrühlingstages war jetzt einer angenehmen Kühle gewichen. Zu den beiden, die ihn aus dem Zimmer geleitet hatten, gesellten sich noch vier oder fünf weitere Personen, schätzte Michel. Einer ging wohl voraus, der Rest marschierte hinter ihm her. Seine beiden Begleiter hielten ihn sicher an den Ellbogen, geleiteten ihn nun an den Tennisplätzen vorbei. Michel roch den roten Sand, der noch die Sonnenwärme des Tages gespeichert hatte. Ganz anders der Geruch des Rasens auf dem Rugbyfeld, der täglich gehegt und gepflegt wurde.
Jetzt mussten sie wohl bald ihre Handys mit der Taschenlampenfunktion anmachen. Bis zum Rugbyfeld waren die Wege auch in der Nacht beleuchtet. Zwar nur schwach, aber immerhin so, dass niemand über etwas auf dem Boden Liegendes stolpern und sich dabei verletzen konnte. Die Sicherheit der ihnen Anvertrauten war, neben der Lehre und dem Vorbereiten auf das Leben, die höchste Priorität der Internatsleitung.
Jemand schlug Michel spielerisch mit einem Ast zwischen die Schulterblätter – Patricia. Mit einem leisen Kichern verschwand sie wieder. Ihren Duft hätte er aus Hunderten von Düften herausgerochen. Allerdings würde wahrscheinlich niemand außer ihm ihren Geruch als Duft beschreiben, doch für ihn war es der Duft der Düfte schlechthin. Eine Mischung aus Heu, Stroh und Pferd – Patricia war eine begeisterte Reiterin –, der immer an ihr haftete, und dazu dieses unverwechselbare Bouquet ihres Parfums. Irgendetwas mit Pink von Cacharel. Er hatte den Flakon auf ihrem Nachttisch gesehen.
Michels Nase enthüllte ihm den weiteren Weg. Die mit Rosen angelegten Rabatten nach barockem Vorbild, die Kräuterbeete, in denen die jüngeren Schüler fleißig herumgärtnerten, der Mischwald mit seiner harzigen und erdigen Note. Tief sog er das Aroma des Waldes in sich hinein, fühlte sich ganz eins mit der ihn umgebenden Natur. Plötzlich stutzte er, hielt an, brachte seine Begleiter fast zum Stolpern. Ein süßlich-fauliger Geruch war in seine empfindliche Nase gestiegen.
»Hier liegt was Totes.« Seine Worte unterbrachen die Stille.
»Was? Wo? Ich seh nix.« Die kleine Karawane blieb stehen. Wahrscheinlich wurde die Umgebung jetzt mit den Lampen abgescannt. Ein Rascheln verriet Michel, dass sich jemand in Richtung Unterholz bewegte.
»Tatsächlich. Da liegt ein Hase. Ich glaub, er ist noch nicht lange tot. Sieht eigentlich noch ganz lebendig aus.«
Ein kurzer Pieks mit dem Ast in seinen Rücken, und Michel trottete weiter. Keiner wunderte sich groß darüber, dass er den Tierkadaver gerochen hatte. Schon immer hatte er über diesen außergewöhnlichen Geruchssinn verfügt. Allerdings hatte es außer ihm selbst nie jemanden wirklich interessiert. Vielleicht seinen großen Bruder, eigentlich Halbbruder, den sein Vater mit in die Ehe gebracht hatte. Der zog ihn immer damit auf, er würde eines Tages als Parfumeur enden und den ganzen Tag seinen Riechkolben in einen Glaskolben stecken. Sein Bruder ärgerte ihn gerne und häufig, und doch verband die beiden eine tiefe Zuneigung. Michel nahm die Sottisen des Älteren gelassen. Und nicht nur das, er liebte die kleinen Wortscharmützel mit ihm. Im Moment blieb ihm zu Hause allerdings nur sein Hund Bleu als Kumpel, denn seit drei Jahren studierte sein Bruder in Toulouse und kehrte nur noch sporadisch ins Elternhaus zurück. Bald würde er seinen Abschluss in der Tasche haben, und dann ab nach Neuseeland, um sich dort ein halbes Jahr von den Strapazen des Studiums zu erholen.
Tatsächlich hatte Michel insgeheim schon mit einer Ausbildung zum compositeur de parfum geliebäugelt. Die phänomenale Fähigkeit seiner Nase war, so glaubte er, kaum schlechter als die seines Hundes. Er roch Bleu, den Epagneul bleu de Picardie der Familie, schon von Weitem, wenn der Spaniel mit der grau melierten Decke mit nassem Fell von einem Spaziergang zurückkehrte, und der Geruch nach kaum angebranntem Fleisch in der Pfanne stieg ihm schon in die Nase, wenn alle anderen noch keine Ahnung von der sich anbahnenden kulinarischen Katastrophe hatten.
Ein sanfter Druck an den Armen, und der kleine Tross hielt an. Seine Ahnung hatte Michel nicht getrogen. Erde, Steine, auch sie verströmten ihr eigenes Aroma. Sie waren am Eiskeller angelangt, aus dem ihm, obwohl er mit einer schweren Eisentür verschlossen war, ein modriger Geruch entgegenschlug. Ja, das war unverkennbar der alte Vorratskeller, der in die Erde gegraben worden war. Ein Schlüssel drehte sich quietschend im Schloss.
»Könnt ihr das Ding jetzt abmachen? Ich will sehen, wo ich bin.« Michel wollte ihnen den Spaß nicht verderben. Sie hatten sich Mühe gegeben, damit er nicht herausfand, wo sie ihn hinbrachten. Und er tat ihnen den Gefallen. »Hallo, hört mich jemand? Wo sind wir? Hopp, lasst mich endlich teilhaben an dem, was eure Augen sehen, hochwohlgeborene Gefährten.«
Das Kichern von Patricia war zu vernehmen.
»Gleich«, brummte eine Stimme. Benjamin?
Michel wurde in den halb unterirdischen Steinbau gezogen und geschoben. Fast wäre er über eine Unebenheit im Boden gestolpert. Geschickt hielten ihn kräftige Arme an seiner Seite vom Sturz ab.
»Noch ein paar Schritte, dann sind wir da.«
Ein angenehmer Duft nach feuchtem Stroh und Pilzen drang jetzt in Michels Nase. Bis vor zwei Jahren waren im Keller Champignons gezüchtet worden. Allerdings hatte sich jetzt schlagartig das Klima verändert. Die plötzliche Kälte ließ den Jungen zittern. Oder war es die Aufregung über das, was nun folgen sollte? Endlich würde er ein Teil der Gruppe werden. Nicht nur ein stiller Beobachter, Bewunderer, sondern er würde einen festen Platz in ihrer Mitte einnehmen. Nur noch das Ritual. Ein kleiner Schritt, und er, der Auserwählte, wäre einer von ihnen.
Eine Unruhe, deren Ursprung nicht in der frostigen Temperatur lag, nahm von Michel Besitz. Es war ganz sicher stockdunkel im Eiskeller. Wenn nur nicht immer noch diese blöde Binde wäre. Gut, sobald sie endlich entfernt wäre, würden sich seine Augen daran gewöhnen. Von den anderen war kein einziger Mucks zu hören. Als würden alle den Atem anhalten. Er wurde ein Stück weitergeschoben, vor seinem Gesicht breitete sich verstärkt feuchte Kühle aus. Er stand vor einer Wand, wurde dann umgedreht und mit dem Rücken an die buckligen, grob behauenen Steine gepresst. Michel konzentrierte sich. Gleich musste doch irgendetwas passieren! Da, es war so weit, ein Geräusch. Plopp. Kling, Metall auf Glas. Ein Gefäß, eine Flasche mit Bügelverschluss war geöffnet worden. Michel hielt den Atem an. Er krümmte sich, als würde man ihm körperliche Schmerzen zufügen, als dieser fürchterliche, widerwärtige, alles was es an ekelhaftem Gestank gab übertreffende Geruch in seine Nase stieg.
Das konnten sie doch nicht machen! So gemein, so hinterhältig konnten sie doch nicht sein. Oder? Michel konnte sich genau erinnern, wann er es ihnen erzählt hatte. Es hatte boudin zum Mittagessen gegeben. Blutwurst, gekocht aus Blut und Gewürzen. Sonst nichts. Widerlich, ungenießbar. Die Farbe, die Konsistenz. Er hatte sich fast in seinen Teller übergeben. Man hatte ihn nicht gezwungen weiterzuessen, aber seine Freunde hatten die Lippen zusammengekniffen und sich wissend zugenickt. Damals musste die Idee geboren worden sein, welchem Ritual sie ihn unterziehen würden. Alles, nur das nicht! Schon spürte er, wie sein Magen rebellierte.
»Nein, bitte nicht. Ich mach alles, aber zwingt mich nicht, das zu trinken, zwingt mich nicht, Blut zu trinken.«
Verblüffung lag in einer Mädchenstimme. Patricia. »Woher weißt du das? Die Flasche ist noch mindestens vier Meter von dir entfernt.«
»Ich rieche es eben. Wenn ihr nicht wollt, dass ich euch gleich auf die Füße kotze, macht die Flasche zu, und lasst es gut sein. Überlegt euch was anderes. Ihr könnt mich in Scheiße stecken, ich lauf geteert und gefedert durch Nîmes. Aber das nicht.«
Eine dumpfe Stimme – jemand hielt sich offenbar ein Tuch oder einen Schal vor den Mund – wies ihn zurecht.
»Stell dich nicht so an, Memme. Ein paar Schlucke genügen. Dir muss doch wohl klar sein, dass jeder von uns bis an seine Grenzen gehen musste. Und so wie es aussieht, ist das deine. Da musst du drüber, dich überwinden. Mit dem Blut des Stiers wird dessen Kraft sich in dir entfalten. Du wirst selbst so stark werden wie er, und nichts und niemand wird dir jemals wieder etwas anhaben können.«
Die letzten Worte drangen wie eine Beschwörung an Michels Ohren. Was, wenn er es nicht tat, nicht das Blut, diese klebrige widerliche rote Flüssigkeit zu sich nahm? Dann wäre er raus. Die nächsten zwölf Monate würden zum reinsten Spießrutenlaufen werden. Die Mädchen würden ihn verachten, die Jungs mit Spott und Häme überziehen. Er nickte.
»Her damit.« Er versuchte, seiner Stimme einen festen, forschen Klang zu geben. Doch dabei hatte er das Gefühl, sein Magen würde sich nach außen stülpen und sein Unterkiefer hätte gerade einen gewaltigen Schlag abbekommen. Er fuhr sich mit der Hand übers Kinn. Nicht nur das Kinn, sein ganzes Gesicht war trotz der Eiseskälte schweißnass. Ihm war kotzübel. Der Geruch kam immer näher. Einen Moment stellte sich Michel vor, wie eins der Mädchen mit der Flasche, dem heiligen Gral gleich, auf ihn zuschritt. Schon spürte er die Flasche an seinen Lippen. Er musste doch nur einen Schluck nehmen, und ein zweiter wäre wahrscheinlich schon gar nicht mehr so eklig. Nur ein einziger Schluck, vielleicht würde der ihnen sogar genügen. Die klebrige Feuchtigkeit drang in seinen Mund. Er wand sich wie ein Wurm, um der Flasche auszuweichen. Die Steine bohrten sich schmerzhaft in seinen Rücken, es tat so weh, er bekam kaum noch Luft. Als ob eiserne Finger seinen Körper abtasteten, wanderte der Schmerz nach vorne, breitete sich in seinem Brustkorb aus, drückte das letzte bisschen Luft aus seinen Lungen. Todesangst schnürte ihm die Kehle zu. Sein Herz raste, es zuckte, es pumpte. Er stieß einen keuchenden Schrei aus, versuchte, die drängende Hand mit der Flasche wegzuschlagen. Er schrie immer lauter. Oder waren es die Schreie der anderen? In seinem Kopf raste und dröhnte es. Seine Beine gaben nach. Er spürte, wie er an der rauen Steinwand hinunterrutschte. Arme versuchten, ihn zu stützen, aufzuheben. Dann nichts mehr.
Als der Handywecker brummte, wusste er im ersten Moment nicht, wo er war. Obwohl das Klimagerät das Zimmer angenehm kühlte, klebte seine Schlafanzughose feucht an seinem Körper. Er setzte sich auf. So einen beschissenen Albtraum hatte er noch nie gehabt. Er bekam die wirre Geschichte nicht mehr zusammen. Allerdings hatte er immer noch diesen widerlichen, ekelerregenden Geschmack im Mund. Sein Schädel brummte, als hätte er die halbe Nacht durchgesoffen. Draußen war es hell, die Sonne versprach einen heißen Tag. Er rappelte sich auf, stieg aus dem Bett. Heute wäre er der Erste unter der Dusche.
»Heh, Mann, aufstehen.« Nichts rührte sich. Normalerweise war der Kerl doch um diese Zeit meist schon im Bad und blockierte ewig das Klo. Wegen seiner empfindlichen Nase. Er ging zum Bett und schlug die Decke zurück, in die sein Freund bis zum Hals eingewickelt war.
»Komm schon, verarsch mich nicht. Zeit zum Aufstehen. Du kannst auch zuerst ins Bad.« Sein Freund lag reglos im Bett. Kein unwilliges Kopfschütteln, kein verräterisches Zucken der Mundwinkel.
»Merde, hör auf mit dem Blödsinn! Das vertrag ich nicht auf nüchternen Magen.«
Er beugte sich hinunter, lupfte ein Augenlid an. Erschrocken fuhr er zurück. Dann überwand er sich, ergriff die Hand des Liegenden und suchte den Puls. Nichts. Seine Augen wanderten über den Körper des Freundes, der in kurzer Schlafhose und mit nacktem Oberkörper dalag. Ganz ruhig, als schliefe er. Philibert hatte noch nie einen Toten gesehen. Doch dass Michel nicht mehr unter den Lebenden weilte, wurde ihm jetzt schlagartig bewusst. Mit schriller Stimme um Hilfe schreiend, rannte er aus dem Zimmer, als wäre der Leibhaftige hinter ihm her.
Kapitel 1
Ein halbes Jahr später. Dezember
Er war auf der Flucht.
Auf der Flucht vor den Festtagen, vor seinem Vater, den er nur noch in tiefes Schweigen gehüllt antraf, vor seiner Stiefmutter, deren Schluchzen die Räume erfüllte, und vor Marie und Marie, den beiden grand-mères, deren Fassungslosigkeit und Hilflosigkeit man mit Händen greifen konnte. Ihre Fragen nach dem »Wie konnte das passieren? Hätte man es denn verhindern können?« waren voller Verzweiflung. Doch nie ein Satz des Vorwurfes, ein »Warum habt ihr nicht besser auf ihn aufgepasst?«. Keine Vorwürfe gegenüber den Eltern, gegenüber ihm. Lediglich ein geseufztes »Junge, du bist … du warst doch sein großer Bruder. Ihr habt euch doch so nahegestanden.«
Was hätte er darauf antworten sollen? Bei dieser Bemerkung schloss Marie mémé ihre runzeligen Hände zu Fäusten und presste sie eng aneinander. Marie mamie war die Mutter seines Vaters, Marie mémé die seiner Stiefmutter. Michel hatte die familiär-liebevollen Ausdrücke mémé und mamie zur Unterscheidung seiner beiden grand-mères einfach an ihre Vornamen angehängt, damit jede wusste, wer denn nun gemeint war. Und so rief sie seit vierzehn Jahren die ganze Familie.
Als er gerade das Haus mit Bleu verlassen wollte, hielt mamie ihn zurück.
»Warum war Michel überhaupt in diesem Internat, wo niemand auf ihn aufgepasst hat?«
Er zuckte mit den Schultern. Weil Michel darauf bestanden hatte, sein BAC an dieser Schule zu machen? Niemand hatte ihn gedrängt, auf ein Internat zu gehen, in dem er auch noch die meisten Wochenenden verbrachte.
Das Verhältnis zu den Eltern war entspannt und liebevoll. Und doch hatte Michel es vorgezogen, mit seinen Freunden, die, mit Ausnahme der Ferien, immer im Internat lebten, dort abzuhängen. Vielleicht hatte sein Bruder sich einsam gefühlt, als er zum Studium nach Toulouse gegangen war. Michel war eben kein Einzelgänger, er war ein Herdentier. Vielleicht war es das Leben in einer Gemeinschaft, das Sicheinfügen in eine Gruppe wie in eine Familie, was das Internat so interessant für ihn gemacht hatte. Die Eltern hatten Michels Wunsch schnell nachgegeben. Der Junge war ein Sturkopf, ein tête de mule. Die Schule hatte einen hervorragenden Ruf, das Schulgeld war kein Thema und das Schlossinternat nicht auf einem anderen Kontinent. Stolz hatte Michel an seinem ersten Tag für ein Foto in seiner neuen Schuluniform posiert. Ein Jahr später war er tot.
Noch einmal zuckte er hilflos mit den Schultern. Er nahm seine Großmutter kurz in den Arm. »Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, mamie.«
Dann trat er, wie seit vielen Tagen, seine morgendliche Flucht an. Bleu trabte eng neben seinem Herrchen her, als spüre er, dass der seinen ganz besonderen Trost brauchte. Nur wenn eine Krähe krächzend aus dem winterhellen, frisch eingesäten Feld aufflog, hob er wie fragend den Kopf, um dann hinter dem schwarzen Rabenvogel herzujagen. Dann kehrte er schwanzwedelnd zurück, schaute mit seinen freundlichen, traurigen Spanielaugen, als ob er sagen wolle: Ich vermisse Michel auch so sehr. Michel hatte den Hund zu seinem zehnten Geburtstag bekommen, ein graues Fellknäuel, das alle Herzen im Sturm erobert hatte.
Es begann wieder zu schneien. Schon das zweite Mal seit Anfang Dezember. Marie mémé, die aus den Vogesen stammte, kannte das: Schnee im Winter, Schnee an Weihnachten. Er hatte die weiße Pracht, wie seine Großmutter die Flöckchen, die kaum einen Tag liegen blieben, nannte, vielleicht drei, vier Mal in seinem Leben hier in Südfrankreich erlebt. Er blieb stehen und schaute in den Himmel. Zu der Krähe hatten sich vier weitere gesellt. Vielleicht lag ein toter Hase im Feld, den sie sich schmecken lassen würden. Wie hatte seine Großmutter jüngst gesagt? »Eine Krähe macht keinen Winter«. Eine Redensart. Es waren aber fünf. Sie machten einen Winter. Die winzigen Eiskristalle setzten sich auf sein Gesicht, schmolzen. Er fuhr sich mit der Zunge über die Lippen, und ein lauter Schrei brach aus ihm hervor. Erschrocken fing der kleine Spaniel zu heulen an.
»Ist schon gut, mein Junge. Das heißt, nichts ist gut. Wollen wir umkehren? Maman wartet bestimmt schon mit dem Essen.«
Noch vier Tage bis Weihnachten. Die Woche vor Heiligabend hatte seit Jahren ihre festen Rituale. Eine Woche vor dem 24. Dezember reisten die Großmütter an. Dann wurde zusammen eingekauft, gekocht, geschlemmt, getrunken, gefeiert, sich beschenkt und vor dem Kamin gelacht, gealbert, erzählt. Doch in diesem Jahr war alles anders. Das Haus war ein Ort der Trauer geworden, auch wenn die beiden Maries mit bunten Geschenken im Gepäck angekommen waren.
»Nur eine Kleinigkeit für jeden. Was würde Michel denken, ein Weihnachten ohne Geschenke. Er wäre ganz traurig.« Die beiden alten Damen hatten ihre Zimmer bezogen, nach alter Familientradition war man dann zu einem ersten Glas Champagner vor dem Kamin zusammengetroffen. Und dann … ja, dann hatten sich alle weinend in den Armen gelegen.
Marie mémé hatte nach dem Abendessen als Erste den Mut gefunden. Die Großmütter wussten natürlich, dass Michels Herz plötzlich zu schlagen aufgehört hatte. Aber warum? Um diese Frage zu beantworten, hatte sein Körper aufgeschnitten, obduziert werden müssen. Obduktion, Leichenschau. Als wäre sein kleiner Bruder Opfer eines Verbrechens geworden. Doch der Tod eines so jungen Mannes gab Rätsel auf, musste untersucht werden. Michel war an einem Herzinfarkt gestorben. Mit gerade mal siebzehn Jahren.
Mémé hatte einen Schluck eau de vie genommen, sich geräuspert und gefragt: »Was hat denn dieser Mediziner nun genau gesagt? Das ist doch nicht normal. Ein gesunder Junge bekommt doch nicht einfach wie ein steinalter Mann einen Herzinfarkt. Wir beide, Marie und ich, wissen, dass ihr uns alte Frauen schonen wollt. Aber wir sind seine Großmütter, wir haben ihn geliebt. Wir würden uns wünschen, die Wahrheit von euch zu erfahren. Nicht wahr, Marie?«
Mamie nickte bekräftigend.
Nein, es war in der Tat gar nichts normal. Er kannte den Obduktionsbericht auswendig.
Nach einem Moment des Zögerns war sein Vater aufgestanden, mit schweren Schritten in sein Arbeitszimmer gegangen und mit einem dunkelblauen Umschlag zurückgekommen. Mit unbeweglicher Miene las er vor, Michels Mutter flüsterte jedes Wort mit. Auch sie kannte den Text bis hin zum unaussprechlichsten medizinischen Fachbegriff auswendig. Als er geendet hatte, schauten sich die beiden Großmütter stumm und mit Tränen in den Augen an.
»Das heißt, er könnte also noch leben, wenn diese Krankheit rechtzeitig erkannt worden wäre?« Marie mamies Stimme war nur noch ein Flüstern. »Warum habt ihr es uns nicht gleich gesagt? Vielleicht nicht am Tag von Michels Beerdigung. Aber ein paar Tage, ein paar Wochen später.« Es war kein Vorwurf in ihrer Stimme, nur ein trauriges Unverständnis.
»Weil wir an dieser Tatsache zu zerbrechen drohten. Weil es für uns so fassungslos, so irreal war … ist. Wir haben ein Kind, das täglich am Abgrund geht, und wir wissen es nicht einmal. Wir fühlen uns schuldig, immer noch schuldig, und wir werden diese Schuld für immer tragen.« Die letzten Worte hatte sein Vater gebrüllt, die Papiere auf den Tisch geworfen und war aus dem Zimmer gestürzt.
Schweigen am Tisch.
»Ich schau nach Papa.« Seine Stiefmutter stand auf, legte ihm kurz die Hand auf die Schulter und verließ den Raum. Bleu hatte sich auf seine Decke auf dem Sofa verzogen. Gemeinsam räumten er und die beiden Maries den Tisch ab, verstauten die Essensreste im Kühlschrank, das Geschirr in der Spülmaschine. Dann zogen sie sich wieder ins Wohn-Esszimmer zurück. Marie mémé füllte drei Gläser mit ihrem Elsässer Mirabellenschnaps und setzte sich neben Bleu aufs Sofa. Der Hund hob den Kopf, leckte über ihre Hand und rollte sich wieder auf seiner Decke zusammen. Sie zeigte auf den Obduktionsbericht.
»Mein Junge, sei so gut, und erklär es uns noch einmal.«
Er trank sein Glas auf einen Zug leer und fasste dann das zusammen, was der Mediziner entdeckt hatte. Er schloss die Augen. Wie andere ein Gedicht aufsagen konnten, war er in der Lage, die Worte des Arztes wiederzugeben.
»Michel litt an einer Aortenisthmusstenose. Ein Herzfehler, den er schon vor seiner Geburt hatte. Es ist der am häufigsten übersehene Herzfehler.«
Schweigend lauschten die beiden Frauen den Worten ihres Enkels, die einem medizinischen Lehrbuch entsprungen zu sein schienen, erfuhren, dass in den ersten drei Lebensmonaten eines Kindes bei lediglich fünfzig Prozent der Betroffenen diese Fehlbildung der Aorta, die unterhalb der Kopf- und Armarterien verengt ist, überhaupt diagnostiziert wird, bei einigen dann in ihrer Jugend, bei vielen erst im Erwachsenenalter.
Er fuhr fort: »Das führt dazu, dass der Blutdruck in der oberen Körperhälfte zu hoch ist und die untere schlechter durchblutet wird. Aber wer fühlt schon dauernd den Puls oder misst den Blutdruck? Daher wird der Mist meist so spät erkannt, nämlich erst dann, wenn es mal zu einer Messung des Blutdrucks kommt. Keine Ahnung, vielleicht bei einer Sportuntersuchung, vor einer kleinen OP oder was weiß ich. Und dann kann man handeln. Der Fehler wird operiert, oder ein Stent wird gesetzt. Fertig. Was Michel hatte, nennt man die adulte Form, weil sie eben erst bei einem jungen Erwachsenen entdeckt wird. In seiner oberen Körperhälfte herrschte ein erhöhter Blutdruck, aber der überlastet das linke Herz zunächst nicht. Diese Form der Erkrankung besteht oft jahrelang ohne irgendwelche Symptome. Die kommen erst, wie ich schon sagte, im Jugend- oder frühen Erwachsenenalter. Und dann wird es lebensgefährlich. Aufgrund der Engstelle der Aorta haben sich bei Michel vor allem die Blutgefäße im Bereich der Rippen, im Schulterbereich und die Brustwandarterien enorm vergrößert. Hätte man sein Herzleiden frühzeitig erkannt, hätte man ihn sogar noch vor der Geburt behandeln können oder direkt nach der Geburt operieren, alles wäre möglich gewesen. Bis auf ein paar kleine Einschränkungen hätte er ein normales Leben führen können. Doch niemand hat von seiner Krankheit gewusst. Ein paar Tage vor seinem Tod hat er sich wohl nicht so ganz fit gefühlt, haben seine Freunde berichtet. Zwei Tage vor seinem Tod war es ziemlich heiß gewesen, und der Sportkurs hat einen Ausdauerlauf gemacht. Ein Infekt, körperliche Überanstrengung, und sein Herz hat einfach aufgehört zu schlagen.«
Bei den letzten Worten versagte seine Stimme. Seine Großmütter hatten ihn schweigend in die Arme genommen. Die beiden Maries waren zwei starke Frauen. Es war gut, dass sie jetzt für ihn und die Eltern da waren.
Er wurde aus seinen Gedanken gerissen. Hupend holperte das gelbe Postauto mit dem stilisierten blauen Vogel an ihm vorbei zum Haus der Russos.
»Ich kann die Post mitnehmen«, schrie er noch hinterher, doch da war der Wagen schon hinter der Kurve verschwunden. Wahrscheinlich hatte er mehr als einen Brief für die Familie zu transportieren. Oder der Fahrer erhoffte sich eine kleine Aufmerksamkeit zu Weihnachten in Form eines Geldscheins in einem Briefumschlag. Die Umschläge lagen immer schon geraume Zeit vor den Feiertagen in der Diele bereit und wurden nach und nach an die Postboten, Müllwerker, den Gärtner, die Zugehfrau, eben an alle, die der Familie einen Dienst erwiesen, verteilt.
Er war noch ein paar Hundert Meter von der hohen Mauer entfernt, die das Villenanwesen vor neugierigen Blicken schützte, als der Wagen hupend und mit einem freundlich winkenden Fahrer wieder an ihm vorbeifuhr. »Joyeux Noël«, schallte es heraus. Fröhliche Weihnachten. Die Familie Russo war weit entfernt davon.
Der Spaniel sah fragend zu ihm hoch. Nach Hause?, bedeutete sein Blick. »Wir laufen noch ein paar Meter, mein kleiner Bleu, ich brauch noch ein bisschen Zeit.«
In der folgenden halben Stunde wurde der Himmel immer dunkler. Bleischwer hingen graue Wolken am Himmel, das leichte Geriesel der Flocken verwandelte sich in immer stärker werdenden Schneefall, und als Herr und Hund wieder vor dem Haus standen, war die Temperatur ein gutes Stück unter den Gefrierpunkt gefallen. Riesige Schneeflocken fielen jetzt dicht wie ein Vorhang auf den Boden, wo sie liegen blieben.
In der Diele rieb er dem Hund mit einem Handtuch aus der Gästetoilette das Fell trocken und rubbelte sich anschließend durch die Haare. Umgekehrt wäre es sinnvoller gewesen, schoss es ihm durch den Kopf.
»Junge, bist du endlich zurück. Komm bitte ins Arbeitszimmer.«
Die Stimme seines Vaters klang unnatürlich hoch, fast kippte sie. Ein Schluchzen drang aus dem Büro. Seine Stiefmutter? Eine der beiden Maries? Als er die Tür öffnete, saß sein Vater kreidebleich am Schreibtisch, seine Stiefmutter stand mit geröteten Augen und geschwollenen Lidern neben ihm, eine Hand auf seiner Schulter. Von den beiden Großmüttern war nichts zu sehen. Die zitternde rechte Hand seines Vaters hielt ein Blatt Papier. Einen Brief? Ein Umschlag dazu lag auf der Schreibtischplatte. Jetzt klang die Stimme seines Vaters tonlos.
»Komm her und lies das.«
Mit unsicheren Schritten näherte er sich dem Schreibtisch. Was erwartete ihn? Ein Anhörungsbogen wegen zu schnellen Fahrens? Er konnte sich an eine solche Situation nicht erinnern. Und nachdem die gilets jaunes landesweit fast alle Radarfallen zerstört hatten, waren viele von ihnen immer noch nicht wieder hergerichtet oder ausgetauscht worden. Und außerdem war das keine Sache, über die man sich im Hause Russo im Moment aufregte.
Mit einem mulmigen Gefühl griff er nach dem Blatt, das sein Vater ihm schweigend hinhielt. Es war eine einzige Zeile. Keine Anrede, kein Briefkopf, keine Unterschrift. Die Handschrift fein und gleichmäßig, fast wie gedruckt, die Worte geschrieben auf unauffälligem weißem Papier. Ohne groß darüber nachzudenken, griff er mit spitzen Fingern das Blatt an der oberen Ecke. Er überflog den kurzen Text. Dann reichte er ihn wortlos zurück, nahm genauso vorsichtig den Umschlag. Kein Absender, die Adresse säuberlich geschrieben. Familie Russo, kein Vorname, Straße, Ort. Eine Briefmarke in der oberen rechten Ecke, der Poststempel verwischt bis auf die gerade noch leserlichen Anfangsbuchstaben Nî für Nîmes.
»Was hat das zu bedeuten?« Er ließ sich schwer in den alten Lederfauteuil fallen, der seinem Vater als Besuchersessel diente.
»Was das zu bedeuten hat? Dein Bruder hat einen Herzinfarkt erlitten, ist aber beileibe nicht eines natürlichen Todes gestorben. Das hat es zu bedeuten.«
Die Faust seines Vaters landete donnernd auf der Schreibtischplatte, seiner Stiefmutter liefen die Tränen jetzt in Strömen übers Gesicht. Sie trat vor den Sessel, kniete sich hin und umfasste die Hände ihres Stiefsohnes.
»Michel ist an seiner Herzerkrankung gestorben. Aber irgendjemand hat seinen Tod provoziert. Vielleicht noch nicht mal ahnend, was er anrichtete. Aber eine Person, oder mehrere, tragen die Verantwortung für seinen Tod. Das hat dieses Schreiben zu bedeuten.«
Er lehnte sich im Sessel zurück und schloss die Augen. Mehr zu sich selbst murmelte er die wenigen Worte vor sich hin.
Michel hätte nicht sterben müssen. Bitte verzeihen Sie.
Kapitel 2
Ein halbes Jahr später. Juni
Mathilde de Boncourt genoss den Sonntagmorgen. In der Nacht hatte es auf siebzehn Grad abgekühlt, und jetzt, um neun Uhr, war die Luft noch voller Frische. In zwei Stunden würden die Temperaturen schon auf über achtundzwanzig Grad geklettert sein. Dann konnte das Konzert der Zikaden beginnen. Schönwetterwölkchen zogen in gemächlichem Tempo über den noch blassblauen Himmel.
Mathilde schob sich das letzte Stück brioche in den Mund, Hefeteigbrötchen, von Odile mit Liebe und einer ordentlichen Portion geschmolzener Butter gebacken, von Mathilde mit einem Esslöffel Feigenkonfitüre bestrichen und genussvoll verzehrt. Bis auf das zwitschernde Flöten eines Vogels, der im dichten Blätterlaub des alten Maulbeerbaums sein Nest gebaut hatte, war nichts zu hören. Die Küken der Mönchsgrasmücke waren schon geschlüpft, und Mathilde beobachtete, wie das Weibchen mit dem rotbraun gefiederten Köpfchen soeben das Nest verließ, um für die Kleinen ein schmackhaftes Insekt zu erjagen. Kein menschliches Wesen war zu sehen oder zu hören. Ihr Großvater war bereits seit Stunden auf den Beinen und saß mit Philippe im Arbeitszimmer über irgendwelchen Abrechnungen. Grand-père Rémy war die graue Eminenz des Weingutes Château de Boncourt, während Philippe Maréchal, Mathildes Onkel, seit ein paar Jahren offiziell die Geschäfte führte.
Mathilde packte ihre bol mit dem langsam verblassenden Aufdruck der Helden ihrer Kindheit, Tintin und Milou, aus der sie den Milchkaffee geschlürft hatte, Teller, Butter und den Marmeladentopf auf ein Tablett und brachte es in die Küche, in der ebenfalls ungewohnte Ruhe herrschte. Nur die beiden Hunde lagen auf den bunt gemusterten ausgetretenen Fliesen und klopften mit ihren Schwänzen auf den Boden, ein dumpfes, rhythmisches Geräusch. Sie hatten schon vor einer Stunde einen ausgiebigen Spaziergang mit Rémy unternommen und hielten nun ihre Vormittagssiesta. Odile war nach Saint-Gilles gefahren, ihr war heute, am heiligen Sonntag, nach einem Kirchgang zumute gewesen. Eine Nachbarin hatte sie abgeholt, und die beiden Damen würden sich im Anschluss an das Hochamt noch eine Tasse Kaffee im Les Magnolias gönnen.
Mit der Sonntagsausgabe des Midi Libre kehrte Mathilde auf die Terrasse zurück, auf der ein alter schmiedeeiserner Tisch und ein paar Stühle standen, von denen keiner mehr so recht zum anderen passen wollte. War einer der altmodischen Stühle mit seinem Binsengeflecht kaputt, brachte Odile die Sitzfläche zu Étienne, einem Mann von weit über siebzig Jahren, der sich noch auf das Flechten von Binse, Weide und Rohr verstand. Vivienne, Mathildes Tante, hatte vor zwei Jahren noch zusätzlich auf antik getrimmte Metallstühle gekauft, die allerdings so unbequem waren, dass Rémy sich weigerte, sie überhaupt zu benutzen. Bei dem Wort »vintage«, mit dem Vivienne die beiden Stühle charakterisierte, hatte er lediglich missmutig durch die Nase geschnaubt.
»Vor ein paar Jahren hat man alten Krempel weggeworfen, und heute ist alles vintage. Was für ein Blödsinn«, war sein Kommentar gewesen.
Mathilde machte es sich in einem Korbstuhl bequem, der eigentlich in den Pavillon gehörte, der das Ende des parkähnlichen Gartens markierte. Dahinter schlossen sich ein kleiner See und ein schattiges Wäldchen mit Maulbeerbäumen und Steineichen an. Die Weinfelder, die daran angrenzten und sich links und rechts der langen Auffahrt zum Château de Boncourt, so weit das Auge reichte, erstreckten, zeigten ein üppiges hellgrünes Blätterkleid, das die zartgelben Blütenstände, aus denen sich die Trauben entwickeln würden, wie ein schützender Mantel umgab. Vor jeder zweiten Reihe mit Weinstöcken blühte ein Rosenstrauch von schimmerndem Rosé bis zu samtigem Rot. Ein Fest für Augen und Nase.
Mathilde legte die Zeitung ungelesen auf den Tisch und schloss für einen Moment die Augen. Sie seufzte tief und zufrieden, verspürte, wie so oft, eine große Dankbarkeit dafür, ein solch privilegiertes Leben führen zu dürfen. Sie hatte diese große wunderbare Familie, ihre Arbeit, die sie erfüllte, und die Möglichkeit des Rückzugs in ihr geliebtes Zuhause, vor allem dann, wenn sie als Untersuchungsrichterin, als juge d’instruction im Palais de Justice von Nîmes in einem besonders nervenaufreibenden Fall ermittelte.
Sie verbannte die Gedanken an ihre Arbeit und zündete sich eine Zigarette an. Ihr großes Laster. Die Schachtel mit den Gauloises blondes, denen sie seit Jahren die Treue hielt, steckte neuerdings in einer passenden farbenfrohen Metallbox, die die schnöde Pappverpackung kaschierte. Die bunten Punkte darauf sollten wohl suggerieren, dass es sich bei dem Inhalt um harmlose Drops handelte, so die Meinung von Odile. Sie hatte nur mit dem Kopf geschüttelt.
»Albernes Zeug. Mit den bunten Punkten auf dem Etui werden die Dinger auch nicht gesünder.«
»Aber es sieht hübscher aus, und sie gehen mir auch nicht kaputt, wenn ich sie mal in die Hosentasche stecke«, hatte Mathilde hoheitsvoll geantwortet.
Odile hatte Mathilde großgezogen, und noch immer hatte Mathildes Wohlergehen für den guten Geist des Hauses oberste Priorität, was nicht selten in einer ordentlichen Auseinandersetzung enden konnte, die allerdings nie von langer Dauer war. Dabei drehte es sich immer um dieselben Streitpunkte. Was war gesund für Mathilde? Auf keinen Fall Zigaretten! Wie hatte sie sich zu benehmen? Nicht aus der bol schlürfen! War sie angemessen gekleidet? Mit der Hose voller Hundesabber kannst du dich nicht blicken lassen! Und in den letzten Monaten immer häufiger: Warum gehst du nicht mal aus? Was ist mit Martin? Wann kommt der Commandant denn wieder zu Besuch?
Ja, Mathilde und die Männer, es war ein Dauerthema für Odile. Da war einerseits Martin Endress, der Reiseschriftsteller aus Deutschland und enger Freund Mathildes. Und natürlich Commandant Rachid Bouraada, Polizist der Police Judiciaire in Nîmes, Mathildes engster Mitarbeiter, Vertrauter und Fels in der Brandung.
Sie seufzte und blies den Rauch durch die Nase. Die kleinen Wölkchen kringelten sich nach oben, verloren sich. Mathildes Blick ging zum Pavillon. Die Sonne hatte mittlerweile eine solch wärmende Kraft, dass die Feuchtigkeit, die sich eben noch in Form winziger Perlen an die langen Grashalme geklammert hatte, nun wie ein feines Dunstgespinst nach oben stieg. Ihr Blick glitt zum Teich. Obwohl im Mai ausgiebiger Regen gefallen war, hatte dieser nicht ausgereicht, den kleinen See wieder einigermaßen zu füllen. Und das wenige war mittlerweile fast verdunstet. Dort hatte Sébastien, Mathildes Cousin, früher den Eingang zur Hölle vermutet, wenn durch die allmählich einsetzende Hitze der Sonne gepaart mit der morgendlichen Kühle die Verdunstung des Wassers im Teich sichtbar wurde. Kaum stiegen die feinen Nebelschwaden auf, war er hingerannt und hatte erwartet, dass sich jeden Moment die Erde öffnete und den Weg zum Höllenschlund freigab. Doch die Hölle, das wusste Mathilde, hatte viele Zugänge, viele Gesichter.
»Mathilde? Hast du ein paar Minuten Zeit für mich?«
Sie fuhr, aus ihren Gedanken gerissen, zusammen. Vor ihr stand Lucette, Philippes Frau. Lucette betrieb mit großer Freude und enormem Tatendrang den Hofladen, in dem sie im Frühjahr vor allem grünen Spargel und weiße dicke Zwiebeln verkaufte und den sie während des ganzen Jahres mit außergewöhnlichen Köstlichkeiten bestückte, die sie zusammen mit Odile erfand und in Gläser und Tüten füllte. Raffinierte Konfitüren, Brotaufstriche aus Oliven und Tomaten, Kastanienpüree, Kräutermischungen aus Bohnenkraut, Rosmarin und Zitronenthymian, einfach alles, was das Land in so reichhaltiger Fülle bescherte, wurde geerntet und zu Gaumenfreuden verarbeitet. Es war auch vor etlichen Jahren Lucettes Idee gewesen, die Rosensträucher vor die Reihen der Weinreben zu pflanzen. Ehemals dienten die Rosen dazu, vor Krankheiten wie dem Mehltau zu warnen, da dieser zunächst die Rosen und erst dann die kostbaren Weinstöcke befiel.
»Natürlich. Setz dich doch.«
»Ich hab Odile frische Erbsen vorbeigebracht. Der Lammeintopf bekommt damit den letzten Pfiff.«
Odile hatte schon am Vortag einen navarin d’agneau mit Frühlingsgemüsen vorbereitet, eine Köstlichkeit, bei der allein schon der Gedanke daran Mathilde ein nagendes Hungergefühl bereitete. Der Duft des Lammschmortopfes erfüllte immer noch die Küche. Mit einem ordentlichen Glas Weißwein, Kartoffeln, Karotten, kleinen weißen Rüben, den navets, den frischen Erbsen und grünem Spargel war Odiles navarin eine kulinarische Offenbarung.
»Ich hab dir was mitgebracht.«
Lucette stellte Mathilde eine kleine Schale mit einem großen Klecks einer verführerisch duftenden Mousse hin. »Koste mal. Ich muss nur noch mit Odile beraten, wie wir sie unseren Kunden anbieten können. Ich glaube, es wird zu aufwendig sein, sie täglich immer wieder frisch zuzubereiten. Wir müssten die Mousse in Gläser mit Schraubdeckel füllen.«
Lucette hatte auch einen Löffel mitgebracht und hielt ihn Mathilde hin. Sie unterzog die Mousse einer Augenkontrolle, dann roch sie daran.
»Ziegenkäse, Kräuter und …«, sie schnüffelte erneut, »… hmm, zitronig, hauchzitronig.« Mathilde nahm einen Löffel der cremigen Masse und schob ihn in den Mund. Ihr Gesicht verzog sich verzückt.
»Wie köstlich ist das denn?« Ein zweiter Löffel folgte, und die kleine Schale war in Sekundenschnelle geleert.
Lucette strahlte übers ganze Gesicht.
»Du hast einen guten Geruchssinn. Brousse de chèvre, Petersilie, Thymian, wie sagtest du, hauchzitronig, das gefällt mir. Dazu ein winziger Klecks Honig und dann der Clou, ein wenig confierte Zitrone. Pfeffer, Salz, eine Prise Piment d’Espelette. Ich habe es mit Gelatineblättern versucht, und siehe da, die Mousse hält sich wunderbar in Form.«
Mathilde fuhr mit dem Zeigefinger durch die Schale und schleckte ihn ab.
»Davon darf kein Krümelchen verloren gehen. Aber du bist doch sicher nicht nur wegen der Erbsen und der Mousse gekommen?«
Mathilde kannte Lucette. Kulinarisches besprach sie ausschließlich mit Odile. Und bis ein Produkt nicht so weit ausgereift war, dass es auch tatsächlich in den Hofladen wanderte, blieb das große Küchengeheimnis eben ein Geheimnis.
»Nein, du hast recht. Es geht um die Zwillinge. Philippe und ich wissen uns im Moment keinen Rat.«
Aha, die Zwillinge. Mathilde hatte vermutet, die elterlichen Sorgen würden einem der beiden älteren Brüder der Rasselbande gelten. Zurzeit war besonders Alexandre ungenießbar. Didier, der älteste der Maréchal-Brüder, hatte sein Studium an der École nationale supérieure des sciences agronomiques in Bordeaux aufgenommen. Er würde irgendwann als Winzer in die Fußstapfen Rémys und Philippes treten. Alexandre, der Zweitälteste, wusste im Moment dagegen überhaupt nichts mit sich anzufangen. Sein Versuch, sich einen Hipsterbart wachsen zu lassen, scheiterte an seinem nicht wirklich üppig sprießenden Kinnbarthaar. Dazu machten ihm Pickel zu schaffen, von denen sein Bruder verschont geblieben war. Und vor vier Wochen war ihm seine Freundin Chrissy abhandengekommen. Sie hatte sich für einen echten Bartträger entschieden. Seither knatterte der junge Mann nach Schulschluss mit seinem Mofa durch die Gegend, zog ein Gesicht wie zehn Tage Regenwetter und verkrümelte sich, sobald sein Vater nach einer helfenden Hand Ausschau hielt.
Mathilde hielt sich geflissentlich aus allem raus, es reichte, wenn Odile ab und zu dem jungen Mann den Kopf wusch. Von derartigen pubertären Plagen waren die Zwillinge noch weit entfernt. Noah und Arthur waren mittlerweile zehn Jahre alt und Zwillinge, wie sie im Buche standen. Kaum auseinanderzuhalten, fußballverrückt und immer für einen Streich zu haben. Liebevoll les cocos, die Früchtchen, von Mathilde genannt. Und seitdem Sébastien ein kleines Elektroauto sein Eigen nannte, mit dem er auf dem weitläufigen Besitz der Familie herumfuhr, waren sie noch anhänglicher als sonst. Sébastien, der mit dem Downsyndrom zur Welt gekommen war, und die Zwillinge waren trotz des Altersunterschiedes von fast zehn Jahren ein gutes Gespann. Doch wer wusste, wie lange das noch anhielt. Sébastien wurde immer selbstständiger, verbrachte mittlerweile viel Zeit in einer Wohngruppe für Behinderte, und die Zwillinge würden nach den Sommerferien von der École primaire zum Collège wechseln.
»Noah und Arthur, oder nur eins der beiden Früchtchen?«, fragte Mathilde schmunzelnd.
Lucette seufzte tief. »Man sollte nicht meinen, dass die zwei eineiige Zwillinge sind. Sie sind seit einiger Zeit in ihrem Wesen so unterschiedlich. Sagt der eine hüh, sagt der andere hott. Will der eine Fisch, schreit der andere nach Fleisch. Sucht sich der eine einen Western raus, möchte der andere einen Trickfilm sehen. Ich weiß überhaupt nicht, wann das angefangen hat. Vielleicht kümmere ich mich zu wenig um sie. Alexandre muss ich seit Wochen im Auge behalten, da bleibt mir für seine kleinen Brüder kaum Zeit. Und dann noch der Hofladen. Irgendwie hab ich gar nicht mitgekriegt, dass da was im Busch ist«, fügte Lucette mit leiser Stimme hinzu.
»Ach was, du bist doch immer für deine Jungs da. Kaum hat sich einer das Knie aufgeschlagen, rennst du schon mit Jod herbei, kein Geburtstag, zu dem du die zwei nicht karrst, kein Elternabend, an dem du nicht anwesend bist. Also bitte, du bist die beste Mutter, die man sich vorstellen kann.«
»Danke, das ist lieb von dir.« Lucette lächelte. »Tja, die Schule. Damit hast du gerade einen wunden Punkt angesprochen. Noah ist voll und ganz damit zufrieden, nach den Ferien zum Collège in Saint-Gilles zu wechseln. Doch unser Arthur, du glaubst es nicht, hat sich in den Kopf gesetzt, ein Internat besuchen zu wollen. Er lässt sich einfach nicht von dem Gedanken abbringen. Stell dir vor, er behauptet, er brauche Abstand zu seinem Bruder, zu Noah, zu seinem Zwilling. Und zu uns. Der Knirps ist gerade mal zehn Jahre alt. Das ist doch nicht zu fassen.« Sie schüttelte den Kopf.
»Und wie kommt er gerade auf ein Internat?«
Mathilde dämmerte, was Lucette ihr gleich erzählen würde. Wann hatte sie mit Arthur über die Schule gesprochen? Das war irgendwann in den Osterferien der Kinder gewesen.
Lucette stemmte die Arme in die Hüften und schnaufte. »Daran ist dieses Buch schuld. L’Internat de l’Ile aux Cigales. Er hat es verschlungen. Es geht da um eine Schule, das Internat auf der Zikadeninsel, in dem Schüler mit besonderen Fähigkeiten aufgenommen werden. Sie erleben irgendwelche Abenteuer, und das Internat birgt ein Geheimnis. Arthur ist hin und weg. ›Maman, das ist ein Zeichen. Die Zikaden. Das musst du doch einsehen. Zikadeninsel, Zikadenschloss.‹ Du hättest ihn mal hören sollen, er ist total aus dem Häuschen. Er sagte, du hättest ihm von diesem Internat Château des Cigales erzählt.«
Mathilde nickte. Auch sie hatte eine Phase gehabt, eine sehr kurze Phase, während der sie es in der Familie nicht mehr ausgehalten hatte. Grand-père Rémy, der permanent über sie wachte, Odile, die ihr, so kam es ihr vor, unaufhörlich Vorhaltungen machte, eine unglückliche Liebe, das Erwachsenwerden und das Begreifen, dass ihre Eltern nie mehr wiederkommen würden. Ja, sicher, Maman und Papa waren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, als sie drei Jahre alt gewesen war. Sie war zu klein gewesen, um sie wirklich zu vermissen. Doch mit vierzehn, fünfzehn war ihr der Verlust schlagartig bewusst geworden. Wie eine Faust in die Magengrube hatte sie diese Erkenntnis getroffen. Mathilde wollte nur noch weg. Und ihr Großvater hatte nachgegeben. Sie hatte für ein halbes Jahr das Internat Château des Cigales, das Zikadenschloss, besucht. Und war reuevoll wieder zurückgekehrt.
»Ja, das Internat Château des Cigales. Es ist ja gar nicht so weit weg, von Nîmes keine zwanzig Minuten entfernt. Ich war ein halbes Jahr dort. Und ich hab es Arthur gegenüber erwähnt.«
»Und warum nur so kurz?«
»Es lag nicht an der Schule. Sie genießt, glaube ich, immer noch einen sehr guten Ruf. Aber ich hab mich einfach nicht wohlgefühlt. Das war nicht meine Welt. Ich hab keinen Anschluss an die anderen gefunden. Es lag wohl daran, dass ich sehr mit mir selbst beschäftigt war in dieser Zeit.«
»Also gab es keinen besonderen Grund?«
Mathilde dachte nach. »Nein, mir fällt keiner ein. Ich war einfach unglücklich dort. Ich weiß heute nicht mehr, was ich eigentlich erwartet hatte. Ein halbes Jahr nach meinem ›Ausbruch‹ bin ich wieder reuevoll in den Schoß der Familie zurückgekehrt.« Sie lächelte und dachte daran, wie ihr Großvater sie brummend in die Arme geschlossen hatte und nie ein Wort über das Schulgeld verlor, das er für ein ganzes Jahr bezahlt hatte. »Was habt ihr nun vor, wegen Arthur?«
Lucette traten jetzt Tränen in die Augen. »Philippe meint, wenn er unbedingt möchte, dann schicken wir ihn eben aufs Internat. Du kennst doch den kleinen Sturkopf. Er wird im Collège in Saint-Gilles keinen Finger krumm machen. Da helfen auch keine Drohungen. Arthur wird sich ganz einfach verweigern. Philippe meinte, wir schauen uns die Schule zusammen an, reden mit dem Direktor. Das Schulgeld ist für die Kinder, die am Wochenende nach Hause fahren, erschwinglich. Und darauf würden wir natürlich bestehen. Es kommt überhaupt nicht infrage, dass er Samstag und Sonntag auch noch dort verbringt. Ach, unser kleiner Arthur. Er hat sogar schon eine Fähigkeit an sich entdeckt, die er dort weiterentwickeln möchte. Wie in diesem Buch. In der Geschichte wollen die Kinder eine Rockband gründen, glaube ich. Und Arthur fühlt sich neuerdings zum Maler berufen.«
Mathilde konnte nicht mehr an sich halten. Sie brach in lautes Gelächter aus. »Seit wann denn das?«
Nun musste auch Lucette lachen. Sie wischte sich mit dem Handrücken die Tränen aus den Augen.
»Er hat diesen Malwettbewerb in der Schule gewonnen. Arthur hat eine Sonnenblume von van Gogh nachgemalt. Und das gar nicht mal so schlecht. Und der Preis war dieses Jugendbuch über das Internat auf der Zikadeninsel. Nun, und das Internat, das er sich rausgesucht hat, bietet einen ganz besonderen Unterricht an. Allerdings nur für die Klassen vor dem BAC. Das ist unserem Arthur allerdings egal. Für ihn ist ausschlaggebend, dass Madame Mugler in diesem Jahr an der Schule als externe Lehrkraft unterrichtet.«
»Sandrine Mugler, die Malerin und Bildhauerin?«
»Genau die. Vor ein paar Wochen ist ein Bild von ihr in Paris bei Artcurial für 350 000 Euro versteigert worden. Und rate mal, was sie gemalt hat. Eine Sonnenblume. Das Bild heißt Une fleur pour Vincent. Noch ein Zeichen, meinte Arthur.«
Lucette rollte mit den Augen, und Mathilde schmunzelte. »Alors, ihr habt euch also schon entschieden, Arthur einstweilen ziehen zu lassen?«
»Philippe schon, ich bring es noch nicht übers Herz. Deswegen wollte ich ja auch mit dir sprechen. Du kennst die Schule. Wenn du dort schlechte Erfahrungen gemacht hättest, würde ich sofort mein Veto einlegen.«
»Nein, schlechte Erfahrungen habe ich nicht gemacht. Aber es ist mehr als zwanzig Jahre her, und ich war gerade mal ein paar Monate dort. Seitdem hat sich sicher viel geändert. Wie überall, natürlich auch an den Schulen. Zum Positiven, aber auch zum Negativen.«
Kapitel 3
Sonntag
»Das muss doch jetzt nicht noch auf den letzten Drücker sein. In ein paar Wochen hat jeder von uns sein BAC in der Tasche, und dann, adios compañeros, wir werden in alle Winde zerstreut sein.«
Theatralisch hob Tatiana ihre Arme, breitete sie aus und tänzelte mit Flatterbewegungen wie ein riesiger Vogel durch das Zimmer. Ihr russischer Akzent hatte in den zwei Jahren, in denen sie das Internat Château des Cigales besuchte, nichts von seiner Fremdartigkeit verloren. Im Gegenteil. Tatiana wusste, dass die Jungs darauf standen, und sie kultivierte den für die anderen exotischen Klang. Das junge Mädchen war extrem schlank, ihr rabenschwarzes Haar kurz geschnitten, à la Garçonne, wie sie mit einem genüsslich gerollten »R« betonte. Ihre Augen waren von einem irritierenden irisierenden Graugrün. Wenn sie nicht gerade ihre Schuluniform tragen musste, bevorzugte sie enge, dreiviertellange Hosen und einen geringelten dünnen Baumwollpullover, wie sie es auf einem Foto ihres großen Vorbildes, der Schauspielerin Jean Seberg, gesehen hatte. Es gab kaum einen männlichen Schüler jenseits der dreizehn Jahre, der nicht ein Auge auf sie geworfen hätte. Doch Tatiana Sorokina sparte sich auf. Sparte sich auf für einen, der im Moment unerreichbar für sie war. Denn er war mit Ophélie zusammen. Dies allein wäre für die selbstbewusste Tochter eines millionenschweren russischen Bauunternehmers kein Hindernis gewesen. Ohne mit der Wimper zu zucken, hätte sie Paul Ophélie ausgespannt. Doch Paul Grandmontagne, der attraktivste Mann, den sie je in ihrem siebzehnjährigen Leben gesehen hatte, war leider offenbar treu wie Gold. Also ließ sie jeden Versuch, ihn sich zu angeln, bleiben. Die anderen aus der Gruppe hätten es ihr wahrscheinlich auch übel genommen und sie Knall auf Fall abserviert, ausgestoßen, sie zu einem Paria gemacht. Doch irgendwann würde ihr Tag kommen.
Tatiana hatte drei Ziele im Leben – aufs Titelblatt der Vogue kommen, als Hauptdarstellerin in einem Film Jean Seberg verkörpern und mit Paul Grandmontagne den Rest ihres Lebens verbringen. Die Zeit arbeitete für sie. Schon jetzt hatte Ophélie eindeutig den Ansatz zu Orangenhaut an den Oberschenkeln. Und wenn sie ihre Haare nicht regelmäßig färbte, waren sie von einem undefinierbaren Straßenköterbraun.
Paul befreite sich aus Ophélies Armen. Beide lagen auf Pauls Bett, am Fußende hockten Thierry und Benjamin und warteten ab, was der Chef mitzuteilen hatte. Patricia stand stumm mit dem Rücken zu ihren Freunden am Fenster und schaute auf die gläserne Orangerie. Hier würden in ein paar Wochen die Zeugnisse verteilt werden, Häppchen und Champagner serviert, und dann würden sie – wie hatte Tatiana gesagt – in alle Winde zerstreut werden.
Im Gegensatz zu Ophélie war das Blond von Patricias Haaren reinste Natur. Goldblond und lockig. Ihr rundliches Gesicht war nicht wirklich schön, die Nase ein wenig zu groß, der Mund ein wenig zu breit. Doch ihre klaren, haselnussbraunen Augen ließen die kleinen Schönheitsfehler vergessen. Patricia war ein Mädchen, mit dem man Pferde stehlen konnte. Und diesem Tier gehörte ihre ganze Liebe. Jede freie Minute verbrachte sie auf dem Pferderücken und gehörte, dank ihres Talents, mittlerweile zu den besten jungen Reitern ihres Jahrgangs in Südfrankreich. Die restliche freie Zeit innerhalb der Internatsmauern verbrachte sie mit ihrer Clique, auch wenn es ihr immer schwerer fiel, sich Pauls Führungsstil und seinen absurden Ideen unterzuordnen. Wenn sie es sich genau überlegte, hatte sie eigentlich sogar die Nase gestrichen voll von ihm. Aber es waren ja nur noch wenige Wochen bis zu den Ferien.
Paul setzte sich auf und gab Ophélie einen Klaps auf den Hintern, den sie mit Schmollmund und Luftkuss kommentierte.
»Wir haben einen Pakt geschlossen. Jeder, der sich uns anschließen will, soll seine Chance haben. Es sei denn, er oder sie kommt aus irgendwelchen Gründen überhaupt nicht infrage. Ein gewisser Opportunismus ist uns ja schließlich nicht fremd.« Er grinste Beifall heischend in die Runde, und die anderen nickten zustimmend. »Samir und Florence sind seit Januar dabei. Abgesehen von ihren Kotzereien – ich finde, Florence hat auch reichlich übertrieben –, haben sie alles gut überstanden. Bei Samir dachte ich zuerst, er rennt zu Barrois, aber ich hab ihm klargemacht, dass ihm das nicht gut bekommen wird. Und er hat sich ja dann auch wieder eingekriegt. Wo stecken die beiden überhaupt? Wir haben doch halb fünf verabredet. Oder täusche ich mich?«
Er schaute auf seine Uhr, eine Chopard Imperiale. Nicht die teuerste Uhr der Welt, die er da zu Weihnachten bekommen hatte, aber chic und funktionell. Er wollte es ja auch nicht übertreiben.
Patricia drehte sich um und quetschte sich zwischen die beiden Freunde ans Fußende.
»Du stinkst schon wieder nach Pferd.« Benjamin rümpfte die Nase und ließ sich auf den Boden gleiten.
Patricia zuckte nur mit den Schultern. »Mir doch egal. Ich riech nix. Samir und Florence müssen der Mugler helfen, im Kunstraum für die ersten beiden Stunden morgen die Staffeleien aufzustellen. Ich hab gehört, Aktzeichnen ist angesagt. Nur weiß noch keiner, wen wir zeichnen werden. Wir dürfen also gespannt sein. Ist schon ein Knaller, dass uns eine der angesagtesten Malerinnen Frankreichs unterrichtet. Sie wird mit Marie Laurencin verglichen und …«
Weiter kam sie nicht. Paul übernahm wieder das Kommando. Er schnalzte anerkennend mit der Zunge, was ihm einen bösen Blick von Ophélie einbrachte.
»Das gefällt mir, Aktmalerei. Solange es nicht diese fette Qualle Corinne ist, die sich auf einem Sofa vor uns rekelt. Aber jetzt mal im Ernst. Auch wenn wir in ein paar Wochen getrennte Wege gehen«, Ophélie stieß ein quiekendes Geräusch aus, und Paul klopfte ihr in einer, wie er glaubte, beruhigenden Geste aufs Hinterteil, »so wollen wir uns doch nicht aus den Augen verlieren. Das ist doch klar. Wer weiß, auf welche Weise wir uns zukünftig gegenseitig nützlich sein können. Und Castor kann uns sehr nützlich sein. Sein Vater ist immerhin bei Orange ein hohes Tier. Also, wer von euch ist dafür?«
Alle hoben die Hand. Kurz hatte Patricia gezögert. Pauls Proben wurden immer brutaler. Sie musste später mit Ophélie und Tatiana reden. Vielleicht hatten ja drei Frauen Einfluss auf den Freund. So etwas wie im letzten Jahr durfte einfach nicht wieder passieren. Pauls herrische Stimme riss sie aus ihren Gedanken.
»Wenn Samir und Florence dagegen gewesen wären, hätten wir sie klar überstimmt. Ich schlage Samstagnacht vor. Erhebt jemand Einspruch?«
Allgemeines Kopfschütteln.
»Was hast du dir für Castor überlegt?« Benjamin Bonnaire hatte eine Stimme wie ein Reibeisen.
Paul setzte eine geheimnisvolle Miene auf. »Lasst euch überraschen. Ihm wird Hören und Sehen vergehen. Im wahrsten Sinn des Wortes.«
Kapitel 4
Montag
Das Gespräch mit Lucette ging Mathilde nicht aus dem Kopf. Sie saß an ihrem Schreibtisch im Palais de Justice in Nîmes. Christine, ihre Sekretärin, hatte eben eine Akte abgeholt, um sie dem Staatsanwalt zu übergeben. Raub mit Todesfolge, der Ladenbesitzer war niedergeschlagen und tödlich verletzt worden. Die Sache war nach den Ermittlungen nun reif für die Gerichtsverhandlung. Mathildes Job war erledigt.
Wie kam ein Zehnjähriger nur auf die Idee, Abstand von seiner Familie zu brauchen? Dieses Jugendbuch konnte doch nicht der alleinige Auslöser für seinen Wunsch sein. Sie war immerhin fünfzehn Jahre alt gewesen, war dabei, erwachsen zu werden, setzte sich mit der Tragödie in der Familie auseinander. Gut, die Zeiten änderten sich. Vielleicht war Arthur mit seinen zehn Jahren schon erwachsener, als alle glaubten.
Mathilde hatte noch am selben Abend aus einem Pappkarton, der auf dem obersten Regalbrett ihres Wandschranks im Schlafzimmer stand, ein paar Fotos aus der Internatszeit herausgekramt. Viele waren es nicht. Das Château des Cigales war ein stattliches Gebäude aus dem späten 18. Jahrhundert. Es stand inmitten eines riesigen Parks. Mathilde konnte sich noch an das alte Schwimmbad erinnern, in das die Katze des Hausmeisters gefallen war. Das Tier war Gott sei Dank unverletzt geblieben, aber eine massive Abdeckung schützte seitdem Mensch und Tier vor weiteren Unfällen. Auch ein Foto der aus Glas und Eisen konstruierten Orangerie war dabei. Ein wunderschöner filigraner Bau, in dem Konzerte und Theateraufführungen der Schüler stattfanden.
Sie betrachtete nachdenklich das einzige Klassenfoto, das sie von ihrem damaligen Jahrgang hatte. Kaum ein Gesicht kam ihr noch bekannt vor. Irgendwie hatte sie dieses halbe Jahr komplett aus ihrem Gedächtnis verbannt. Und genau betrachtet, war sie eigentlich nie wirklich in der Schule und in der Schülergemeinschaft angekommen. Schnell hatten sich in ihrer Klasse Gruppen gebildet. Die, die sich aufspielten und glaubten, etwas zu sagen zu haben, die, die kuschten, andere wiederum blieben Einzelgänger, so wie Mathilde. Nach kurzer Zeit schon war klar gewesen, dass die Zepterschwinger unter sich bleiben wollten. Wenn man sich ihnen näherte, senkten sie die Stimme oder schwiegen, taten jedoch immer irgendwie geheimnisvoll. Mathilde war es egal gewesen.
Sie hatte sich dann doch nach einiger Zeit mit einem Mädchen angefreundet, das anfangs genauso verloren gewirkt hatte wie sie. Ihr Vater war Ire, ein Diplomat. Daran konnte sich Mathilde noch erinnern. Sie hatten sich versprochen, einander zu schreiben, aber daraus war nie etwas geworden. Erin, so hieß das Mädchen.
Ende der Leseprobe