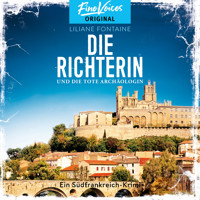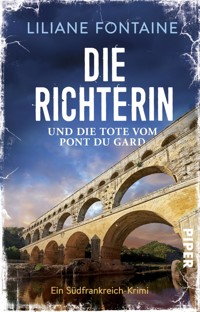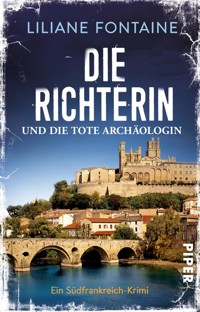
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Languedoc, Südfrankeich: ein ominöser Mord an einer Archäologin, ein toter Kapitän, ein geheimnisvolles antikes Artefakt – der zweite außergewöhnliche Fall für Untersuchungsrichterin Mathilde de Boncourt mit jeder Menge südfranzösischem Flair!
Auf dem Gelände einer archäologischen Grabung wird die Leiche der Archäologin Flavia Leone entdeckt. Die Frau ist erstickt worden, und auf ihrem Gesicht liegt die Nachbildung einer antiken Totenmaske. Einige Tage später wird im nicht weit entfernten Sète Flavias Mann tot aufgefunden, der Kapitän auf einem Cargoschiff war. Bei den gerichtsmedizinischen Untersuchungen stellt sich heraus, dass das Paar auf die gleiche Art und am selben Tag den Tod gefunden hat. Madame le Juge Mathilde de Boncourt, Commandant Rachid Bouraada und Lieutenant Felix Tourrain von der Police Judiciaire in Nîmes nehmen die Ermittlungen auf und stoßen auf jede Menge Ungereimtheiten ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
© 2019 Piper Verlag GmbH, München Redaktion: Sandra LodeCovergestaltung: FAVORITBUERO, MünchenCovermotiv: GettyImages/Murat Taner
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Prolog
»Wenn der Himmel sich spaltet, und wenn die Sterne zerstreut sind, und wenn die Meere über die Ufer treten, und wenn die Gräber aufgewühlt werden; dann wird jede Seele wissen, was sie getan und was sie unterlassen hat.«
Koran 82:1–5
Ssssssssst. Der kalte Stahl durschnitt die trockene, heiße Luft.
Nein, er würde nicht um Gnade bitten oder betteln, und winseln schon gar nicht. Er wusste, was ihn erwartete. Gnade – für diese Menschen ein Fremdwort. Das hatten sie in der Vergangenheit schon tausende Male unter Beweis gestellt.
Wie viele Jahre machte er jetzt seinen Job? Weit über das übliche Pensionsalter hinaus. Er hatte die Siebzig bereits vor vielen Sommern überschritten. Niemand machte ihm etwas vor, niemand hatte ihm in all den Jahrzehnten des Schaffens seine Position streitig gemacht. Niemand reichte an seinen Wissensschatz heran, den er für immer in seinem Kopf bewahren würde. Zumindest solange der noch auf seinen Schultern saß. Das feine Lächeln, das bei diesem Gedanken seine trockenen, aufgerissenen Lippen umspielte, irritierte die Männer.
Sein internationales Renommee war außerordentlich. Noch vor wenigen Jahren hatte er vor der Fachwelt gesprochen, seine Entdeckungen und Erkenntnisse veröffentlicht, sich mit Kollegen aus aller Welt ausgetauscht. Diese Zeit war schon lange vorbei. Wann hatte ihn zuletzt eine gebannt lauschende Zuhörerschaft auf der Reise durch seine faszinierende Welt begleitet? Vor sieben, acht Jahren? Oder war es länger her? Es kam ihm wie eine Ewigkeit vor.
Ein Dröhnen unterbrach seine Gedanken. Die Erde bebte erneut. Er schloss die Augen. Sein Schmerz war grenzenlos, und er litt wie noch nie in seinem Leben, spürte den Staub auf dem Gesicht, schmeckte ihn im Mund, wusste ihn in seinen Ohren.
Nicht noch mehr! Reichte es ihnen immer noch nicht?
Sekunden der Stille, gefolgt vom Brummen der Motoren.
Seine Knie schmerzten, seine Handgelenke waren taub. Ein letzter Versuch, um vielleicht doch noch zu retten, was unrettbar verloren war. Seine Stimme war nur noch ein Flüstern.
Sssssssst. Kälte – Wärme – dann nichts mehr.
Wissen, Tradition, Ehrfurcht, Träume. Alles für immer unter dem Sand begraben.
Kapitel 1
Der Albtraum nahm immer wieder eine neue Gestalt an. Doch der damit verbundene Schrecken milderte sich langsam ab. In dieser Nacht war sie lediglich auf den Stufen zum Palais de Justice zusammengesackt. Ohne Schmerzen, ohne das Gefühl, dem Tod nahe zu sein. Eher wie ein kurzer Schwächeanfall bei brütender Hitze, der einem die Sinne raubte. Dann plötzlich empfand sie eine unendliche Leichtigkeit, etwas oder jemand zog sie auf die Beine. Sie fühlte den Boden unter den nackten Füßen. Und dann schwebte sie nach oben, Zentimeter für Zentimeter, von einer unsichtbaren Kraft begleitet. Sie spürte einen leichten Druck, eine Hand, die ihre Hand erfasst hatte, sie geleitete. Zu dieser Hand gesellte sich eine schemenhafte Gestalt, der sie jedoch kein bekanntes Gesicht zuordnen konnte. Immer weiter hob sie vom Boden ab, bis in Höhe der Justitia, der Göttin, die inmitten des Dreiecksgiebels thronte und für Gerechtigkeit sorgte. Unsicher schaute sie sich um, erwartete, dass Justitia das Wort an sie richtete. Doch die Lippen der Göttin blieben versiegelt. Nach einem Augenblick des Verweilens in der Höhe glitt sie langsam zurück auf den Boden. Die Hand löste sich aus ihrer, die schemenhafte Gestalt verschmolz mit dem Nichts. Sie hockte auf den kalten Steinstufen, und Tränen strömten über ihr Gesicht. Sanft wurden sie von einem warmen, wenngleich rauen Gefühl weggewischt.
Untersuchungsrichterin Mathilde de Boncourt erwachte aus ihrem Traum, als eine lange Hundezunge ihr liebevoll über die Wangen schlabberte. Sie schlug die Augen auf und schaute ins Gesicht von Henri, dem schwarzen Labrador, der sie hingebungsvoll mit seinen bernsteinfarbenen Augen anblickte, sozusagen Auge in Auge, denn er lag kaum zehn Zentimeter von ihrem Kopf entfernt, seinen schweren Schädel ebenfalls auf das Kissen gebettet. Mathilde fuhr dem jungen Hund über das glatte Fell. »Ein bisou für mich schon am frühen Morgen. Das nenn ich Treue. Sonst küsst mich ja keiner um diese Uhrzeit.«
Sie rekelte sich, und der Hund sprang vom Bett. Er hatte seine Pflicht erfüllt. Mathilde war geweckt, und er würde in der Küche nachschauen, ob dort etwas für ihn zu holen war. Babou, sein älterer Hundekumpel, war mit dem Herrchen unterwegs. Sie hatten ihn nicht mitgenommen. Aber das störte Henri wenig, dann blieb mehr für ihn übrig. Er drückte mit dem Kopf die Schlafzimmertür auf und trollte sich. Mathilde schob die Bettdecke von sich. Die große Fenstertür war in der Nacht offen geblieben, eine erfrischende Brise hatte die Schwüle des Tages vertrieben.
An den Wochenenden ließ Mathilde es gemütlich angehen. Während der Woche blieb sie in Nîmes, wo sie ein kleines Appartement bewohnte, von dem aus sie nur wenige Gehminuten bis zu ihrem Arbeitsplatz im Palais de Justice hatte. Gestern hatte sie die Akte der Toten vom Pont du Gard geschlossen. Vorläufig. Der Fall, im Grunde waren es mehrere Fälle, hatte sie, Commandant Rachid Bouraada und Lieutenant Felix Tourrain, die beide der Police Judiciaire angehörten, monatelang beschäftigt. In der Szene war Ruhe eingekehrt. Keine Anzeigen, keine toten Mädchen. Als hätte dieser Zirkel wohlsituierter Bürger, der sich junge Mädchen wie Sklaven hielt, sie ausbeutete und missbrauchte, nie existiert.
Eigentlich hatte Mathilde sich geschworen und auch hoch und heilig versprochen, keine Zigarette mehr vor dem Frühstück zu rauchen, schon gar nicht in ihren eigenen vier Wänden, die sie im Château de Boncourt bewohnte. Odile wurde jedes Mal fuchsteufelswild, wenn sie den Geruch dieser »stinkenden Glimmstängel«, wie sie sie nannte, in der kleinen Wohnung, der Wäsche oder den Gardinen bemerkte.
Doch wenn sie einen Schritt auf den Balkon machen würde, wäre sie ja nicht mehr drin in ihrem Zimmer. Barfuß schlurfte Mathilde in ihrem Nachtgewand – bunt gemusterte Schlafshorts mit passendem Shirt – auf den schmalen Balkon, der nicht tiefer als einen halben Meter war. Ein kunstvoll geschmiedetes Geländer bewahrte seine Besucher vor dem Absturz. Sie zündete sich eine ihrer geliebten Gauloises blondes an. Herrlich, dieser erste Zug am frühen Morgen. Und an der frischen Luft schmeckte ihre Zigarette noch mal so gut. Und war wahrscheinlich bei Weitem nicht so schädlich.
Es war ein herrlicher Morgen. Wie ein ebenmäßiger grüner Teppich lagen die Weinfelder vor ihr, noch hingen die Trauben klein und unscheinbar an den Weinstöcken. Doch dies würde sich bald ändern. In jedem Jahr gab es diesen einen Tag, an dem die Natur regelrecht zu explodieren schien. Dann wurden die Trauben prall und saftig, ihre Farben verwandelten sich in Rubinrot und Smaragdgrün.
Das Weingut und das Schloss waren seit Jahrhunderten im Besitz der Familie de Boncourt. Mathildes Großvater Rémy war die graue Eminenz, der Patron im Hintergrund, sein Neffe Philippe leitete nun offiziell die Geschicke des Weinbaubetriebs.
»Mathilde, was bekommen wir von dir, wenn wir Odile nicht verraten, dass du auf dem Balkon rauchst?«
Vor dem Balkon hatten sich Noah und Arthur aufgebaut. Die achtjährigen Zwillinge von Philippe und seiner Frau Lucette trugen Trikots der französischen Nationalmannschaft Les Bleus und kurze Hosen. Noah hatte einen Fußball unter den Arm geklemmt.
Mathilde lachte und drückte ihre Zigarette am Geländer aus. »Ihr Lümmel. Wisst ihr, was auf Erpressung steht? Na, was habt ihr denn vor? Trainiert ihr für die nächste WM?«
Noah rollte mit den Augen und schubste seinen Bruder an. Mitleidig schauten die beiden nach oben. Dass Erwachsene immer so ein dummes Zeug reden mussten.
»Du hast echt keine Ahnung, Mathilde. Bei der nächsten WM sind wir gerade mal etwas älter als zehn. Wir sind hinten auf der Wiese und kicken ein bisschen. Wenn du Sébastien siehst, sag ihm, er kann gern mitspielen.«
Kopfschüttelnd drehten sie sich um und marschierten davon, nicht ohne sich dabei abwechselnd in die Seiten zu rempeln. Mathilde grinste. Die beiden waren echt kleine Früchtchen. Die beiden älteren Brüder der Zwillinge waren in diesem Alter genauso gewesen. Heute waren sie Teenager und große Früchtchen, die mit ihren Mopeds durch die Gegend knatterten und sofort unsichtbar wurden, wenn Philippe oder Lucette etwas für sie zu tun hatten.
Wie immer wedelte Mathilde den Geruch, den ihre Zigarette verbreitete, mit den Händen in die Landschaft. Und wie immer schoss es ihr durch den Kopf, dass dies gar nichts nutzte, dass Odile mit ihrer Nase, die dem Riechorgan eines Hundes Konkurrenz machen konnte, genau erschnuppern würde, wo sie geraucht hatte. Sie marschierte ins Bad und zog den mit dunkelgrünen Drachen bestickten Kimono über, der ihrer verstorbenen Mutter gehört hatte. Mathildes Eltern waren vor mehr als dreißig Jahren bei einem Flugzeugabsturz über dem südchinesischen Meer ums Leben gekommen. Die Maschine und ihre Insassen waren nie gefunden worden. Mathilde war dann, nachdem auch ihre Grand-mère Sophie gestorben war, von Grand-père Rémy großgezogen worden.
Vor der altmodischen Badewanne, die auf mächtigen Löwentatzen ruhte, lag einer ihrer Pantoffeln. Sie schlüpfte hinein und schaute sich suchend um. Wahrscheinlich hatte der Hund den zweiten ins Schlafzimmer geschleppt. Und da lag er, auf dem Boden am Fußende ihres Bettes. Auf einem Bein stehend, angelte sie mit dem anderen Fuß nach dem zierlichen Pantoffel. Die bequemen weichen Schuhe mit dem lilafarbenen Leopardenmuster und dem kleinen vergoldeten Absatz hätte man als extravagant bezeichnen können, wenn nicht die puscheligen Leopardenöhrchen und der kurze Schwanz sie in ein paar witzige Hausschuhe verwandelt hätten.
»Ah, zut alors! Wenn ich dich erwische, du frecher Kerl.«
Mathilde beugte sich zu dem Pantoffel hinunter, in den sie eben hineingeglitten war. Eines der Leopardenohren fehlte. Gestern Abend waren es noch zwei gewesen. Ganz sicher war es von Henri nicht nur abgebissen, sondern auch noch verschluckt worden. Morgen würde sich das Ohr dann farblich von einem Hundehaufen absetzen. Unverdaut, aber nicht mehr brauchbar. Ihr Magen grummelte. Zeit fürs Frühstück.
In der riesigen Küche war Odile dabei, die Erdbeeren, die Lucette vorbeigebracht hatte, zu Marmelade zu verarbeiten. Es roch nach frischem Kaffee, und ein Duft, den Mathilde über alles liebte, zog in ihre Nase. »Brioche, himmlisch, sind sie schon fertig?«
Ohne sich umzudrehen, zeigte die Haushälterin auf den langen Refektoriumstisch. Unter einem karierten Handtuch wölbte sich das buttrige Hefegebäck.
»Odile, rühr schneller, die Erdbeermarmelade passt genau in mein Frühstückshungergefühl. Du kannst mir gleich einen Klecks auf den Teller geben.«
»Guten Morgen, meine liebe Odile. Danke, dass du schon Kaffee für mich gekocht hast, danke für die Brioche und noch mal danke für die Erdbeermarmelade, die du so leidenschaftlich rührst, dass dir das Handgelenk schmerzt«, brummte Odile vor sich hin.
»Das hab ich genau gehört. Obwohl mir ein Ohr abhandengekommen ist. Eigentlich bin ich schwer verletzt.«
»Was ist das denn für ein Unsinn, Mathilde? Was für ein Ohr?« Odile dreht sich nun doch kurz um, musterte Mathilde, die dabei war, sich von dem Hefekuchen eine dicke Scheibe abzuschneiden.
»Da, Henri hat heute Morgen fette Beute gemacht. Das linke Leopardenohr wandert wahrscheinlich gerade durch seinen Magen. Hoffentlich bekommt es ihm.«
Mathilde wackelte mit dem Fuß, der in dem angeknabberten Pantoffel steckte. Odile betrachtete ihn amüsiert, während Mathilde sich in eine Schale Kaffee eingoss, einen Schwung Milch dazu kippte und sich eine ordentliche Portion Butter auf ihre Brioche strich.
»Also eben kam er fröhlich in die Küche, hat seinen Napf leergeputzt und auch noch ein Stück trockenes Baguette abgestaubt. Apropos Magen. Übertreibst du es nicht ein wenig? So viel Butter? Da ist ja schon jede Menge Fett in der Brioche.« Odile hatte sich wieder dem großen Kupferkessel zugewandt, in dem der süße Aufstrich vor sich hin brodelte.
»Die Marmelade braucht ein Bett.«
»Sie ist noch nicht fertig und viel zu heiß. Im Kühlschrank ist Aprikosenkonfitüre. Von Lucette. Mit Schuss.«
Das ließ sich Mathilde nicht zweimal sagen, und auf dem Butterbett landete ein großer Löffel der gold-orangen Konfitüre, die mit Wodka und grünem Pfeffer verfeinert worden war. »Sag mal, wo stecken denn alle? Es ist so ruhig.«
»Dein Großvater ist mit Babou unterwegs, und Sébastien ist mit seiner Mutter nach Uzès auf den Markt. Seitdem er dort Martin kennengelernt hat, hofft er jeden Samstag, ihn an derselben Stelle wiederzutreffen. Ihm ist klar, dass Martin in Deutschland lebt, aber er meint, man könne ja nie wissen, vielleicht wäre er ja heute da. Tsss. Und du kennst ihn ja. Wenn Sébastien sich etwas in den Kopf gesetzt hat …«
Sébastien, Mathildes Cousin, war mit dem Downsyndrom auf die Welt gekommen. Die Ehe von Vivienne, seiner Mutter, war daran zerbrochen. Und für Vivienne war ihr Sohn seitdem ihr gesamter Lebensinhalt geworden.
»Die Hauptsache ist doch, er kommt unter Leute. Vivienne klammert viel zu sehr. Sébastien ist erwachsen, sie sollte ihn endlich etwas mehr loslassen. Aber wenn man mit ihr redet, ist es, als würdest du gegen eine Wand rennen. Noch gibt sie keinen Millimeter nach. Na ja. Irgendwann wird sie einsehen müssen, dass er nicht mehr an ihrem Rockzipfel hängen kann.«
Sehnsüchtig schielte Mathilde nach der Brioche, die noch übrig geblieben war. Aber zwei dicke Scheiben waren genug. »War das köstlich. Ich könnte jeden Morgen davon essen. Keiner macht sie besser als du, Odile. Sie sind einfach …«, Mathilde schnalzte mit der Zunge, »… unübertrefflich. Odile, du bist die Beste.«
»Schau einer an, Mademoiselle hat ja doch Manieren. Und was hast du heute so vor? Du hast dir doch hoffentlich keine Arbeit mitgebracht? Du solltest dich an den Wochenenden wirklich ausruhen.«
»Nur eine ganz kleine winzige Akte. Ansonsten ist Faulenzen angesagt. Wo ist denn die Zeitung?«
Normalerweise lag der Midi Libre auf dem Tisch, zerlesen und zerknittert, wenn ihr Großvater und Odile mit ihm fertig waren.
»Winzige Akte?« Odile machte ein skeptisches Gesicht. »Als ob du dich mit Winzigkeiten abgeben würdest. Aber du bist alt genug, um zu wissen, wie du deine Wochenenden gestaltest. Und die Zeitung liegt noch unberührt da hinten«, sie nickte in Richtung Tellerschrank, »sie kam heute später, und dein Großvater hat noch nicht reingeschaut. Steht doch eh immer dasselbe drin. Wenn ich auf den Seiten mit den politischen Nachrichten aus aller Welt diesen Affen schon sehe. Diese kleinen Augen, Haare wie ein Wollschwein, und so was ist Präsident der USA. Unglaublich.« Odile hatte sich in Rage geredet, während sie gleichzeitig damit begonnen hatte, die nun fertige Erdbeermarmelade in Gläser zu füllen.
»Kann ich dir helfen?«
»Nein, lieber nicht. Du verbrennst dir noch die Finger.«
Odile stellte Glas für Glas, jedes mit einem Schraubdeckel verschlossen, kopfüber auf ein Handtuch. Mathilde hatte sich inzwischen die Zeitung geholt und blätterte summend eine Seite nach der anderen durch.
»Du hast recht, Odile, da ist er schon wieder. Hat irgendwas in die Welt getwittert. Und er sieht tatsächlich ein bisschen wie ein Wollschwein aus. Wobei ich glaube, wir tun den Tierchen Unrecht. Die sind wenigstens zu was Nutze. Kannst du dich erinnern? Der alte Nicolas hatte so ein Schwein, das war zur Trüffelsuche abgerichtet. Ich hatte als Kind wirklich Angst vor ihr. Es war eine riesige Sau, und Nicolas hatte immer ein paar Maiskolben dabei. Wenn das Schwein was gefunden hatte, steckte er ihm schnell den Mais zwischen die Zähne, damit sie sich nicht über die Trüffeln hermachen konnte. Meine Güte, leben die beiden noch?«
»Nein, Gott hab sie selig. Nicolas ist bestimmt schon sieben, acht Jahre tot. Und das Schwein noch viel länger. Mir läuft jetzt noch das Wasser im Mund zusammen, wenn ich an den Geruch denke, den die Trüffeln verströmen. Wenn Nicolas welche gebracht hat, es kam ja nicht so oft vor, hatte er sie in einem großen Taschentuch und breitete das hier auf dem Tisch aus. Und am Abend gab es ein Festmahl. Ja, so war das früher. Ich überlege die ganze Zeit, wie das schlaue Schweinchen hieß.«
Odile runzelte die Stirn und dachte nach. Auch Mathilde kramte in ihrem Gedächtnis. Dann riefen beide Frauen gleichzeitig »Donna, es hieß Donna« und brachen in lautes Gelächter aus.
Nur ganz allmählich beruhigten sie sich, immer wieder wurden sie von neuen Lachsalven geschüttelt. Dann wischte sich Odile mit einem Küchentuch die Tränen vom Gesicht und meinte trocken: »Aber eins muss man dem Trüffelschwein lassen. Sie war wenigstens sympathisch, allem Fremden gegenüber sehr aufgeschlossen und posaunte nicht gleich jeden Mist, den sie hinterlassen hatte, hinaus in die Welt.«
Kapitel 2
Aus dem angekündigten Gewitter war nichts geworden, Montpellier blieb verschont. Die schwarzen Wolkenungetüme, die sich über dem Meer aufgetürmt hatten, waren, ohne einen Tropfen zu verlieren, in Richtung Hinterland gezogen, und würden sich über den Cevennen abregnen. Und wenn ein Gewitter sich in diesem Massiv einmal festgesetzt hatte, war es nicht so schnell dazu zu bewegen, die Berge wieder zu verlassen. Blitze zuckten über Anduze, dem Tor zu den Cevennen, Donner grollte, der Himmel öffnete seine Schleusen. Doch dann hatte der auf das Land herabprasselnde Regen ein unerwartetes Einsehen, wurde immer kümmerlicher und versiegte nach einer halben Stunde schließlich ganz.
Als sie den Anruf auf ihrem Handy erhielt, war es halb zehn und schon wieder hell in ihrem Büro. Sie knipste die Schreibtischlampe aus und stellte sich ans offene Fenster. Noch war die Luft nicht ganz so drückend. Doch das würde sich bald ändern. Spätestens in einer Stunde würde das Quecksilber die Fünfundzwanzig-Grad-Marke in Montpellier übersteigen und das Land mit frühsommerlicher Hitze verwöhnen.
Sie hatte das Stockwerk, in dem das Institut der Archéologie classique et méditerranéenne der Universität Paul Valéry untergebracht war, heute ganz für sich. Es war Sonntag, und kein Kollege hatte sich hierher verirrt, geschweige denn einer ihrer Studenten. Das Semester war seit drei Wochen zu Ende, und dann mieden die Studenten die Uni wie der Teufel das Weihwasser. Die Archäologin Flavia Leone, Professorin für Klassische und Mediterrane Archäologie in Montpellier, verzichtete freiwillig auf ihren Urlaub. Die Zeit drängte, die Funde, die die Grabung erbracht hatte, mussten gesichert und katalogisiert werden. Schon jetzt hatte das Musée d’Ambrussum seine Ansprüche auf das, was die Ausgräber entdeckt hatten, angemeldet. Die Reste der ehemaligen römischen Villa lagen keine zwei Kilometer von Ambrussum entfernt, einer galloromanischen Grabungsstätte mit einem gallischen Oppidum aus dem 4. Jahrhundert vor Christus sowie einer Festungsmauer und römerzeitlichen Gebäuden, die eine Station für Reisende an der Via Domitia markierten.
Flavia legte ihre Lesebrille auf dem Fensterbrett ab und nahm den Anruf entgegen. Das Gespräch dauerte eine Minute. Dann drückte sie auf den kleinen roten Hörer. Was noch zu sagen war, würden sie in einer Stunde von Angesicht zu Angesicht besprechen. Darauf hatte Flavia bestanden. Es klingelte erneut. Was war denn jetzt schon wieder? Genervt hielt sie den Hörer ans Ohr, das sofort der unsäglichen Stimme von Persephone ausgesetzt war.
»Was willst du denn noch?«, fragte Flavia schroffer als beabsichtigt. Doch nach der Anrede »Flavia«, die in einer Tonlage hervorgebracht wurde, bei der jeder Hund sofort den Schwanz eingezogen hätte, war nichts mehr zu hören. »Hallo, Persephone, hörst du mich?« Keine Reaktion. Typisch. Na dann eben nicht.
Flavia ordnete die letzten Keramikscherben in die flachen, an Setzkästen erinnernden Holzkisten ein. Ordnung musste sein. Zufrieden schob sie die letzte Kiste auf das Wandregal, klebte einen Aufkleber, auf den sie handschriftlich Nr. 37 geschrieben hatte, auf die schmale Holzleiste. Dann griff sie nach ihrem Schlüsselbund mit dem türkis schillernden Skarabäus am Schlüsselring, der in einer Terrakottaschale lag, und überprüfte, ob die Schubladen ihres Schreibtischs verschlossen waren. Ihre leichte Jacke ließ sie über der Lehne des Schreibtischstuhls hängen. Die würde sie heute ganz sicher nicht mehr benötigen.
Flavia verließ ihr Büro, das sie ebenfalls sorgfältig absperrte. Vorsichtshalber rüttelte sie noch mal an der Türklinke. Nicht auszudenken, wenn eines der kostbaren archäologischen Artefakte gestohlen werden würde.
Flavias Wagen war das einzige Fahrzeug, das auf dem Parkplatz unterhalb des Gebäudes des Archäologischen Instituts stand. Feiner gelber Sand lag wie ein Film auf dem Auto. Ein Gruß aus der Sahara, wie er mindestens einmal im Monat herüberzog. Ein Hitzeschwall kam ihr entgegen, als sie die Fahrertür öffnete. Im Wageninneren roch es unangenehm. Flavia schnupperte und entdeckte, was den üblen Geruch verursacht haben musste. Unter dem Beifahrersitz lag ein Stück Baguette, das mit dem Rest einer Sardine und je einer Scheibe hart gekochtem Ei und einer roten Zwiebel belegt war. Angewidert griff sie mit spitzen Fingern danach. Das hatte diese fette Wachtel gestern Abend doch mit Absicht unter den Sitz gelegt. Nur hatte Flavia es da noch nicht gerochen. Erst jetzt, wo die Hitze den Zersetzungsprozess der Lebensmittel in Gang gesetzt hatte, stank das Zeug bis zum Himmel. Sie beförderte das angebissene Baguette in einen Mülleimer auf dem Parkplatz. Persephone konnte was erleben. Dieses Miststück.
Persephone Titeux gehörte mit Maxime Berchwyler zu ihren engsten Assistenten. Allerdings war die Rolle der Assistentin nicht ganz das, was sich Persephone für ihre Zukunft vorgestellt hatte. Sie hatte sich Hoffnungen darauf gemacht, den vakanten Stuhl von Professeur Schmidt zu besetzen, nachdem dieser in den Ruhestand verabschiedet worden war. Persephone entstammte einer wahren Archäologendynastie. Wenn man sie so hörte, hatten ihre Vorfahren bereits direkt im Anschluss an die Römerzeit in Südfrankreich mit den ersten Grabungen begonnen. Tatsächlich war einer ihrer Ahnen an Napoleons Seite in Ägypten gewesen und hatte dort die Grablege eines Priesters entdeckt. Persephones Vater war Professor für Archäologie in Nantes. Für ihn war es klar, dass sein einziges Kind, seine begnadete Tochter, in Montpellier zur ungekrönten Königin der Grabungsszene gekürt werden würde. Doch Flavia Leone hatte ihm und ihr einen Strich durch diese Rechnung gemacht. Sie war auf den vakanten Stuhl gehoben worden, sie hatte nun die Leitung inne und das Sagen. Seitdem hatte sich Persephone Titeux schon mehrfach an anderen Universitäten beworben, doch ohne Erfolg.
Sie und Flavia kamen mehr schlecht als recht miteinander aus. Und genau die Grabung bei Ambrussum hatte das Fass für Persephone zum Überlaufen gebracht. Sie hatte mit den ersten Sondierungsmaßnahmen begonnen, und Flavia hatte ihr das Heft aus der Hand genommen, als sich die große Bedeutung der Funde herauskristallisierte. Dann begannen die Racheakte. Scherben wurden umsortiert, Notizen verschwanden, ein Kratzer an Flavias Wagen, eine geöffnete Flasche Nagellack, deren Inhalt Flavias Handtasche ruinierte. Und jetzt das Baguette mit seinem unappetitlichen Belag. Ja, es war wirklich Zeit für eine Aussprache mit Persephone.
Persephone – Göttin der Unterwelt, dem antiken Mythos entsprungen. Mit ihrer Figur würde sie das Tor zur Unterwelt wahrscheinlich sprengen. Gute einen Meter fünfundachtzig Körpergröße, mindesten neunzig Kilo schwer und Hände, die wie ein Schraubstock alles zerquetschen konnten. Flavia musste laut lachen, als sie sich Persephone in einem antiken Gewand vorstellte. Mindestens drei Tücher, groß wie Bettlaken würden bei der Gewandung vonnöten sein.
Flavia stieg in ihren Kombi und fuhr los. Beide Seitenfenster ließ sie offen, damit der Durchzug den schlechten Geruch endlich aus dem Wageninneren beförderte. Nach weniger als einer Stunde war sie am Grabungsgelände angekommen. Sie stellte ihren Wagen auf dem provisorisch angelegten, staubigen Parkplatz ab. Das Brummen der Fahrzeuge, die die nahe gelegene Route nationale befuhren, war als gleichmäßiges, leises Geräusch zu hören. Direkt am Parkplatz hatte man ein Schild angebracht, das darauf hinwies, dass das Betreten des Grabungsareals strengstens untersagt war.
Wie und ob man überhaupt die römische Villa, oder das, was noch von ihr übrig war, zukünftig der Öffentlichkeit zugänglich machen wollte, war noch nicht entschieden. Die Reste des ehemals sicherlich prächtigen Wohnhauses eines reichen Römers waren bei Arbeiten an einer Kanalisation entdeckt worden und hatten natürlich das Interesse der archäologischen Welt geweckt. Als man dann noch auf die Überreste eines Mosaikfußbodens gestoßen war, hatte sich Flavia Leone persönlich um die Grabung gekümmert und sich so den Zorn der Kollegin zugezogen. Die Reste des Mosaiks – es waren lediglich knapp sieben Quadratmeter – waren mittlerweile abgetragen worden. Sie würden, frisch zusammengefügt, wahrscheinlich das Museum von Ambrussum bereichern.
Das Grabungsterrain war von einem Bauzaun eingefasst, den man, wenn man es darauf anlegte, sicherlich überwinden konnte. Doch es gab nichts mehr zu holen, die Grabungen waren mehr oder weniger beendet, der größte Teil der Funde lag sicher verwahrt in Montpellier.
Zwei Zaunelemente waren durch ein großes Sicherheitsschloss miteinander verbunden. Flavia sperrte es auf und schlüpfte zwischen den Metallmatten hindurch. Auf der anderen Seite herrschte eine Stille, als sei sie in eine andere, jenseitige Welt gelangt. Sogar die Zikaden, die in den hohen schlanken Zypressen außerhalb des Terrains ihr Konzertspektakel zum Besten gaben, waren nur gedämpft zu hören. Flavia liebte diese Augenblicke, wenn sie sich ganz alleine in dieser anderen Welt aufhielt. Vor ihren Augen wuchsen die Fundamente der Villa zu stattlichen Mauern empor, ein rotes Ziegeldach erhob sich über dem prächtigen Gebäude, der Brunnen im Peristyl plätscherte, dienstbare Geister reichten dem Hausherrn Trauben und Feigen in einer großen Tonschüssel.
Ein Geräusch ließ sie herumfahren. Ein gezielter Tritt in die Magengrube, und Flavia Leone ging in die Knie. Der Schmerz raubte ihr die Luft zum Atmen. Fassungslos versuchte sie, ihrem Erstaunen mit Worten Ausdruck zu verleihen. Doch ihre Stimme versagte. Das Erstaunen steigerte sich zu blankem Entsetzen, als ihre Schultern niedergedrückt wurden. Kein Schrei vermochte ihrer Kehle zu entweichen, als ein unglaublicher Druck auf ihre Brust und ihren Bauch ausgeübt wurde. Gleichzeitig hinderten kräftige Hände sie daran, durch Mund und Nase zu atmen. Flavia versuchte sich aufzubäumen, die Arme zu heben, um den Körper, der sich ihrer bemächtigt hatte, abzuschütteln. Doch ihre Schultern waren wie mit dem Boden verwachsen. Die Archäologin hatte keine Chance. Ihr Thorax wurde mit einer ungeheuren Kraft zusammengedrückt, die Sauerstoffzufuhr, die Luft zum Atmen, die Luft zum Überleben unterbunden. Flavia Leone erstickte qualvoll.
Kapitel 3
»Günther, lass das doch! Du kannst doch nicht einfach da rein. Vielleicht ist ja jemand drin. Der Kombi, der da steht, muss ja irgendwem gehören.« Anette Sievers hätte es besser wissen müssen. Je inständiger sie auf ihren Mann einredete, desto bockiger wurde er.
»Ich kann kein Französisch, also kann ich auch nicht verstehen, was auf dem Schild steht. Und wenn jemand auftaucht, lass ich es eben bleiben«, gab er zur Antwort und ruckelte weiter am Bauzaun. Nichts zu machen. Alle Teile fest zusammengefügt. Er inspizierte die nächste Nahtstelle, und sein Blick fiel auf ein massives Vorhängeschloss. Vielleicht war der Bügel ja nicht richtig eingeklinkt. Schade, das Schloss war zu. Günther Sievers wanderte weiter am Zaun entlang. Da! Hier konnte er womöglich durchschlüpfen. Er rüttelte vehement an den beiden Teilen, dann hatte er es geschafft, hatte zwei Metallelemente so gegeneinander verschoben, dass er sich durch den schmalen Spalt hindurchquetschen konnte.
Seine Frau war unterdessen nähergekommen. Ein Blick nach links, ein Blick nach rechts. Niemand war in der Nähe. Gott sei Dank. »Tsss, du kannst kein Französisch. Wem willst du das denn weismachen? Und, was siehst du?«
Anette Sievers war jetzt doch ein wenig neugierig geworden. »Lohnt es sich? Jetzt sag schon, was siehst du?«
»Noch nix. Löcher in der Erde, Erdhaufen. Fundamente. Komm rein und guck selbst. Ahh, interessant. Da hinten scheint mir das Peristyl gewesen zu sein. Da sind tatsächlich noch Säulenreste zu erkennen. Muss ich mir mal genauer anschauen.«
Anette blickte sich noch einmal um. Keiner zu sehen. Sie seufzte und quetschte sich ebenfalls durch die Lücke im Bauzaun.
Anette und Günther Sievers verbrachten ihren dritten Urlaub in Folge in dem kleinen schilfgedeckten Steinhaus am Rande der Camargue. Seit Günther pensioniert war, nutzten sie den kompletten Juni für ihren Jahresurlaub. Es war schon sommerlich warm, aber die Gegend war bei Weitem noch nicht so von Touristen überlaufen wie im Juli und August. Günther Sievers war Lehrer für Latein und Physik am Staatlichen Gymnasium in Offenbach gewesen. Doch seine große Leidenschaft hatte schon immer der Archäologie gehört. Als erster Vorsitzender des Kelten- und Römer-Vereins Bürgel war es ihm eine heilige Pflicht, den Spuren der Römer zu folgen, wo immer er sich gerade aufhielt. Und dies war im Moment das Languedoc, genauer gesagt eine Grabungsstätte nur knapp zwei Kilometer entfernt vom Oppidum von Ambrussum bei Villetelle. Bei Kanalarbeiten waren die Arbeiter auf die Reste einer herrschaftlichen Villa gestoßen, und bevor es mit dem Straßenbau weitergehen konnte, hatte die Inrap in Zusammenarbeit mit dem Archäologischen Institut der Universität Paul Valéry in Montpellier die Initiative zur Sicherung der historisch wertvollen Reste ergriffen. Das Institut national de recherches archéologiques préventives – das Französische Institut für archäologische Präventivgrabungen – widmete sich der Aufgabe, archäologisch wertvolle Funde zu retten, und Günther Sievers widmete sich seiner Passion, solche Grabungen persönlich in Augenschein zu nehmen. Als er auf der Internetseite des Inrap gelesen hatte, dass man bei den Bauarbeiten wahrscheinlich auf die Reste einer römischen Villa suburbana gestoßen war, war er nicht mehr zu halten gewesen. Allerdings war der Öffentlichkeit der Zutritt verboten. Als Günther am Donnerstag versucht hatte, sich einen Überblick über den Fortgang der Grabungen zu verschaffen, hatten ihm die Archäologen freundlich, aber bestimmt mitgeteilt, leider dürfe kein fachfremdes Publikum auf das Gelände. Fachfremdes Publikum! Frechheit! Da waren sie bei Günther Sievers aber an den Richtigen, das heißt an den Falschen, geraten. Empört war er in seinen Wagen gestiegen, ließ sich auch von Anette nicht mehr beruhigen. Als er dann am Sonntag sein Grabungsset, wie er es nannte, ins Auto legte und den staubigen Fahrweg in Richtung römische Villa einschlug, schwante Anette nichts Gutes.
Das Grabungsbesteck schleppte Günther bei jedem Spaziergang und auf allen Wanderungen mit. Man konnte ja nie wissen. Ordentlich war es in einem dunkelroten Leder-Rolletui verpackt. Spatel und Kellen in sechsundzwanzig und acht Millimetern, Fein-, Flach-, Löffel-, Haken- und Spitzspatel, Bürsten und Pinselset warteten auf ihren Einsatz.
Anette beschirmte ihre Augen mit der Hand und schaute ihrem Mann kopfschüttelnd nach. Beige Bermudahose, kakifarbenes Hemd, die Füße steckten in Wollsocken und derben Schuhen. Ein Feldskorpion, der durchaus hier angetroffen und dessen Stich sehr unangenehm werden konnte, hatte keine Chance, bis zu Günthers Haut vorzudringen. Hätte er nicht sein Strohhütchen auf dem schütteren Haar getragen, man hätte ihn für einen alten Pfadfinder halten können.
Anette seufzte, als sie sah, wie er sein Rolletui auspackte, es auf einem Säulenstumpf ablegte und eine kleine Kelle entnahm.
»Und, was sagt der Fachmann?«
Günther hatte mit einem Blick die gesamte Anlage analysiert. »Würde sagen, prachtvolle Suburbana. Bestimmt ein Offizier in Rente, der sich das Ding geleistet hat. Hochrangiger Offizier, mindestens Primus Pilus.«
Anette rollte mit den Augen.
»Da, schau her. Hier das Peristyl, dort das große Atrium, hier drum herum die Schlafräume, es folgt logischerweise«, er zeigte mit der kleinen Kelle hinter sich, »das Speisezimmer. Hier zwischen Atrium und Peristyl das Tablinum, also der Empfangsraum des Hausherrn. Und was dürfen wir hinter dem Peristyl erwarten? Hm, Anettchen, was wohl?«
Er konnte es einfach nicht lassen, diese oberlehrerhafte Art ertrug sie nun schon seit vierzig Jahren. »Die Exedra, Herr Lehrer.«
»Du brauchst gar nicht so schnippisch zu tun, Anette. Ja, es ist die Exedra. Noch an den wenigen Resten der Fundamente können wir ablesen, dass es sich um eine Villa wie aus dem Bilderbuch gehandelt haben muss. Was wohl schon an Kleinfunden zutage befördert wurde? Mal schauen, ob mir auch ein wenig Finderglück beschert ist.«
Günther bückte sich und fing an, vorsichtig ein wenig Erde wegzukratzen. Anette wusste, es hatte keinen Zweck, ihn darauf hinzuweisen, dass solche Raubzüge auch hier in Frankreich verboten waren.
»Ich schau mich mal ein bisschen um.«
Sie erwartete keine Antwort. Selbstvergessen wühlte ihr Gatte im Dreck. Das Areal mochte vielleicht knapp dreitausend Quadratmeter groß sein. Hinter der Stelle, wo Günther die Exedra vermutete, war wohl etwas Besonderes entdeckt worden, das man mit einer großen dunkelgrünen Plane abgedeckt hatte. Anette schlenderte durch das Peristyl und scheuchte dabei eine Eidechse auf, die sich auf einem großen Stein sonnte, der sich bei näherer Betrachtung als Rest eines schlichten Kapitells entpuppte. Was die Archäologen wohl unter der Plane geschützt gelagert hatten? Die Plane war mit Steinen auf dem Rand beschwert worden, damit kein plötzlicher starker Windstoß sie anhob oder gar davontrug. Anette bückte sich, schob zwei Steine zur Seite und spähte vorsichtig unter die Plane.
Der Schrei gellte in Günthers Ohren. Er ließ den Pinsel fallen, mit dem er soeben eine, wie er hoffte, antike Münze vom Staub der Geschichte befreien wollte. Er kannte seine Anette. Wenn er am Arbeiten war, musste schon ein triftiger Grund vorliegen, ihn mit einem solchen Schrei zu unterbrechen. Mit wenigen Schritten war er an ihrer Seite.
Anette kniete im Sand und zeigte mit zitternder Hand auf die Plane. Und was Günther darunter erspähte, ließ ihm – trotz strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen – das Blut in den Adern gefrieren.
Kapitel 4
»Sébastien, hör auf zu quengeln. Wenn ich fertig bin, spielen wir eine Partie.«
Mathilde de Boncourt hatte sich die Akte Benoît Lambert – sie war nicht ganz so winzig, wie sie Odile hatte glauben lassen – mit nach Hause genommen. Die Untersuchungsrichterin hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, fernab der Hektik, die tagtäglich in und um ihr Büro im Palais de Justice in Nîmes herrschte, die Akten ein letztes Mal zu studieren, auf etwaige Rechtschreibfehler oder, was erheblich dramatischer war, auf Formfehler zu überprüfen und die Worte der Klageschrift noch einmal auf sich wirken zu lassen.
Der Fall ging ihr unter die Haut. Es war dem Autohändler und Werkstattbesitzer Lambert lange Zeit nicht nachzuweisen gewesen, dass er den Tod seiner Frau billigend in Kauf genommen oder ihn sogar geplant hatte. Yvonne Lambert hatte die Scheidung eingereicht, drei Tage vor dem Scheidungstermin war das gemeinsame Einfamilienhaus in Flammen aufgegangen. Yvonne Lambert war qualvoll erstickt. Sie war im Badezimmer gewesen, das abgeschlossen war. Das Feuer war im Keller ausgebrochen. Jemand hatte mit Waschbenzin getränkte Lappen in Brand gesteckt und so ein nicht mehr aufzuhaltendes Inferno entfacht. Lambert war hoch verschuldet. Investitionen zur Modernisierung seines Autohauses hatten ihn hohe Kredite aufnehmen lassen. Er wollte die Versicherungssumme für das Haus und die Lebensversicherung für seine tote Ehefrau kassieren. So die Vermutung von Mathilde und Commandant Rachid Bouraada. Rund drei Millionen Euro.
Auf den Verdacht, er könnte das Feuer gelegt haben, war man schnell gekommen. Ein Verkäufer eines Baumarktes hatte ihn auf einem Foto im Midi Libre wiedererkannt. Er war der Mann gewesen, der in Unmengen Waschbenzin gekauft hatte. Lambert hatte ausgesagt, das Waschbenzin für die Autowerkstatt besorgt zu haben, wo es in großen Mengen benötigt würde. Mit tränenerstickter Stimme hatte er immer und immer wieder beteuert, mit dem Brand und dem Tod seiner Frau nichts zu tun zu haben. Er hatte ehrlich erschüttert gewirkt, dass seine Frau auf so furchtbare Weise das Zeitliche gesegnet hatte. Aber weder Bouraada noch Mathilde hatten ihm die Trauer abgenommen, seine Tränen waren ihnen falsch und die Miene des untröstlichen Ehemanns aufgesetzt vorgekommen. Nur, sie hatten nichts gegen ihn in der Hand gehabt. Doch dann war seine Tierliebe Lambert zum Verhängnis geworden.
Mathilde schüttelte den Kopf, als sie noch einmal las, über welch simple Geschichte er letztendlich gestolpert war.
Klack, klack, klack. Die Kugeln aus Eisen prallten aufeinander. Sébastien gab keine Ruhe. Mathilde hatte ihm versprochen, mit ihm eine Rund Pétanque zu spielen. Er war ein Meister darin, sich der kleinen Zielkugel – dem cochonette, dem Schweinchen – nicht einfach nur zu nähern, sondern es im Kies, auf dem sie spielten, geradezu zu versenken.
»Sébastien, bitte. In ein paar Minuten geht’s los. Hör so lange mit der Klackerei auf, das macht mich nervös.«
Stille. Nur das Zirpen einer Zikade drang aus der Schirmpinie, unter der Mathilde saß. Doch sie nahm das Tierchen gar nicht wahr. Zu allgegenwärtig war der Gesang der Zikaden, als dass sie noch darauf achtete.
»Wann kommt Martin wieder? Ich habe gestern in Uzès nach ihm geschaut, aber er war nicht da. Martin würde sofort mit mir spielen. Mathilde, wann kommt Martin?«
Mathilde wusste, es hatte keinen Zweck, so zu tun, als hätte sie seine Frage nicht gehört. Sébastien war eben anders als andere junge Männer in seinem Alter. Ein freundlicher, quirliger Junge, aber manchmal so bockig wie ein Eselchen. Und er hatte es nicht leicht, denn seit den schrecklichen Geschehnissen im letzten Sommer hütete Vivienne ihren Sohn wie ihren Augapfel. Im Moment allerdings hatte sie sich ein wenig aufs Ohr gelegt. Eine leichte Migräne. Sie hatte Sébastien bei Mathilde im Park gelassen.
»Ich weiß es nicht. Er schreibt an einem neuen Buch, und wenn er damit fertig ist, wird er kommen. Aber das kann noch ein paar Wochen dauern.«
»Wie viel Wochen. Mehr als zwei? Oder hundert. Oder tausend?«
Mathilde seufzte. »Keine zwei, keine hundert. Sei so lieb und spiel ein wenig mit den Hunden.«
»Babou und Henri sind auch nicht da. Die sind mit Onkel Rémy unterwegs. Henri ist nicht nett gewesen. Er sollte bei mir bleiben, ist dann aber hinter Babou hergerannt. Und dann waren alle weg. Wo wohnt Martin?«
»In Deutschland. In Bonn. Das ist dort eine Stadt. So wie Sète oder Nîmes. Aber du hast doch schon Ansichtskarten von Martin bekommen. Mit Fotos drauf.«
»Du hast doch gesagt, wie Sète. Aber da waren keine Schiffe auf dem Bild und kein Meer.«
»Sébastien. Jetzt lass mich noch fünf Minuten in Ruhe. Bring mir mal bitte eine Flasche Wasser. Und wenn du wiederkommst, bin ich fertig, dann spielen wir.«
Mathilde wandte sich wieder ihren Unterlagen zu. Sie hörte, wie Sébastien missmutig die Kugeln auf den Boden knallte. Dann trottete er mit gesenktem Kopf davon.
Er hatte an Martin einen wahren Narren gefressen. Die Wege von Mathilde de Boncourt und dem deutschen Reiseschriftsteller hatten sich im letzten Jahr in Uzès zufällig gekreuzt, und eine tiefe Freundschaft hatte sich zwischen den beiden entwickelt. Martin hatte sich vorgenommen, Mitte September oder Anfang Oktober wieder nach Südfrankreich zu reisen, um hier die letzten warmen Sonnenstrahlen zu genießen, wenn es in Deutschland vielleicht schon ungemütlich und herbstlich wäre. Und Mathilde freute sich schon auf den Freund aus Deutschland.
Ja, mit seiner Tierliebe hatten sie Benoît Lambert an den Haken bekommen. Er besaß eine Sphinx-Katze, eine Rasse, bei der das Fell kaum mehr als ein dünner Flaum den Körper bedeckte. Und dieses Tier durfte, da es auf Sonnenstrahlen mit Sonnenbrand reagierte, das Haus grundsätzlich nicht verlassen. Am Tag des Brandes jedoch war Lambert zufällig von einem Nachbarn dabei beobachtet worden, wie er die Katze in einer Transportbox aus dem Haus getragen hatte. Der Nachbar hatte diesem Umstand jedoch keine Bedeutung beigemessen. Erst vor drei Wochen, als er eine Reportage im Fernsehen über diese außergewöhnliche Katzenart gesehen hatte, war es ihm klar geworden: Lambert musste einen besonderen Grund gehabt haben, seine wertvolle Katze außer Haus zu bringen. Und damit hatten sie ihn. Er leugnete zwar weiter standhaft, beteuerte, nie den Tod seiner Frau gewollt zu haben, aber Mathilde war sich sicher, die Staatsanwaltschaft würde mit ihrer Klageschrift den Prozess gegen Lambert eröffnen. Sie schlug die Akte zu und rieb sich die Augen.
Typisch Sébastien. Jetzt war er schon seit fast zehn Minuten verschwunden. Eben konnte es ihm nicht schnell genug gehen, und nun trödelte er im Haus herum, um eine Flasche Wasser zu organisieren. Ihr war es egal, sie musste bei dieser Affenhitze kein Pétanque spielen.
Mathilde stand auf und schaute Richtung Château. Kein Sébastien in Sicht. Nun, sie würde sich ein wenig ausstrecken und im Liegestuhl auf ihn warten. Sie zerrte das segeltuchbespannte Holzgestell in den Schatten und legte sich hin. Keine zwei Minuten später war sie eingeschlafen.
*
Mathilde schreckte hoch. Im ersten Augenblick wusste sie überhaupt nicht, wo sie war. Ihr Rücken schmerzte. Mühsam richtete sie sich in ihrem Liegestuhl auf. Sie musste eingenickt sein. Sébastien hatte ihr die Flasche Wasser gebracht und diese neben ihre Akten auf den schmiedeeisernen Tisch gestellt. Mathilde schaute auf ihre Armbanduhr. Sie hatte fast eine Dreiviertelstunde geschlafen. Die Pétanque-Kugeln waren, ebenso wie Sébastien, verschwunden.
Was hatte sie eben nur geweckt? Mathilde sah sich suchend um. Da lag ihr Handy auf der Akte zum Fall Benoît Lambert. Es war der Klingelton gewesen, der sie aus dem Schlaf gerissen hatte. Ein paar Töne der Marseillaise, Töne, die nicht zu überhören waren, schräg, wie auf dem Kamm geblasen. Sie stemmte sich aus der Liege. Ihr linkes Bein schmerzte. Ein Überbleibsel der schweren Verletzung, die sie von dem Attentat auf sie vor dem Palais de Justice in Nîmes davongetragen hatte.
Ein verpasster Anruf. Bouraada. Mathilde drückte auf den Knopf zum Rückruf, und Sekunden später hörte sie Commandant Rachid Bouraadas weiche Stimme durchs Telefon.
»Rachid, was liegt an? Falls Sie wegen der Sache Lambert anrufen, da brauchen wir uns, glaube ich, keine Gedanken zu machen. Die ist in trockenen Tüchern.«
»Nein, da mach ich mir keine Sorgen. Lambert wird festgenagelt und wandert in den Bau. Ich weiß, es ist Sonntagnachmittag, aber wir haben hier was, das sollten Sie sich anschauen, Mathilde. Felix habe ich schon beigeordert. Ich bin bereits mit den Leuten von der Spurensicherung vor Ort. Die werden ganz schön was zu tun bekommen. Ahh, da kommt Docteur Regis. Hat heute wohl Dienst, der Alte …«
»Rachid, jetzt machen Sie’s doch nicht so spannend. Was ist passiert, wo ist es passiert?«
»Sie haben vielleicht schon von diesem spektakulären archäologischen Fund in der Nähe von Villetelle gehört, diese römische Villa, die man ausgegraben hat. Dort haben wir eine Leiche, nicht weniger spektakulär, die Sie ganz sicher interessieren wird. Fahren Sie in Richtung Ambrussum. Nach der ersten Hinweistafel in Gallargues fahren Sie rechts in den Chemin du Bascourt, dann sind Sie schon da. Und ziehen Sie bequeme Schuhe an, das Gelände ist sehr uneben, ich meine, wegen Ihres Beins.«
Bouraada machte eine kleine Pause. »Oder hätte ich das jetzt nicht sagen sollen?«
Mathilde lachte laut. »Nein Rachid, alles in Ordnung. Sie dürfen mir fast alles sagen. Ich werde meine Wanderschuhe anziehen und mich wenn nötig an Ihren Arm klammern. In vierzig Minuten bin ich da. Bis gleich.«
Nachdenklich blickte sie auf ihr Handy. Was hatte der Commandant damit gemeint, eine Leiche, die sie ganz sicher interessieren würde?
Kapitel 5
Mathilde brauchte etwas mehr als eine halbe Stunde vom Château de Boncourt bis zum Schauplatz des Verbrechens. Drei Polizeifahrzeuge standen vor einem hohen Bauzaun, daneben zwei Wagen der Identificationcriminelle – der Kriminaltechnik – und ein Kombi. Der uralte, ehemals weiße Peugeot gehörte Docteur Alain Regis, dem médecin légiste. Bärbeißig und meist kurz angebunden, konnte Mathilde sich für die Untersuchungen vor Ort und in der Gerichtsmedizin kaum einen kompetenteren Arzt wünschen. Ein dunkelroter Ford Escort stand etwas abseits. Mathilde fiel sofort das deutsche Kennzeichen auf, das mit OF begann. Was für eine Stadt sich hinter den beiden Buchstaben verbarg, wusste sie jedoch nicht.
Sie trug noch die Shorts und die ärmellose Bluse, die sie im Garten angehabt hatte. Ihre Füße steckten ohne Socken in derben Wanderschuhen, wie sie es versprochen hatte. Ihre rotblonde Mähne hatte sie zu einem Pferdeschwanz gebunden, der hinten aus einer grünen Baseballkappe baumelte. Zwei junge Polizisten standen am offiziellen Zugang zur Grabungsstätte. Sie salutierten und ließen Mathilde passieren.
Die Untersuchungsrichterin verharrte einen Moment und ließ die ganze Szenerie auf sich wirken. Vor ihr lag das Grabungsareal. In der hinteren rechten Ecke stand eine Art Blockhütte. Überall lagen Steine herum, die Mathilde für archäologische Funde hielt. Manche waren eindeutig als Teil einer Säule zu erkennen, andere Steine, die ebenfalls nummeriert waren, sahen für sie aus wie schlichte Felsbrocken. Zwischen den Fundamenten der Villa und dem Holzhaus wuselten weiß gekleidete Kriminaltechniker und Polizisten in Uniform herum. Commandant Bouraada stand mit Regis vor einer dunkelgrünen Plane, um die weiträumig gelbes Plastikband mit der Aufschrift gendarmerie nationale – zone inderdite gespannt war. Lieutenant Felix Tourrain hockte vor einem älteren Ehepaar, das im Schatten auf mehreren übereinandergestapelten Brettern saß, und redete, wie es Mathilde schien, beruhigend auf die beiden ein.
Bouraada entdeckte Mathilde, hob die Hand und winkte. Im Geviert zwischen den Bauplanen, die vor die Zaunelemente gespannt waren, staute sich die nachmittägliche Hitze. Die Stimmen der Polizisten drangen dumpf an Mathildes Ohren. In der brütenden Sommerhitze hier zu arbeiten, war für die Archäologen sicherlich kein Zuckerschlecken.
»Bonjour Docteur, bonjour Rachid. Da liegt man gemütlich in seinem Liegestuhl und genießt den freien Tag, und dann präsentieren Sie mir, statt einer schönen Schokoladentarte zum Nachmittagskaffee, eine Leiche«, begrüßte Mathilde den Polizisten und den Arzt.
»Bonjour, Mathilde. Es tut mir leid, aber wir wissen, dass Sie den Fall persönlich übernehmen wollen. Regis hat mich informiert, nachdem er das Opfer in Augenschein genommen hatte.«
Kurz blieb der Blick des Commandant an der hellen Narbe auf Mathildes linkem Oberschenkel hängen. Alles war gut verheilt, doch die Narbe würde bleiben. Seine Miene war undurchdringlich. Mehr noch. Mathilde spürte, dass ihn etwas bedrückte, etwas, das er am Telefon nicht hatte preisgeben wollen. Der Mediziner hatte sich ein paar Meter von ihnen entfernt, nachdem er Mathilde mit einem knappen Kopfnicken begrüßt hatte. Typisch Regis. Er murmelte die Eindrücke, die er bei der ersten Begutachtung der Leiche gewonnen hatte, in sein Diktiergerät.
»Sie machen mich neugierig, Rachid. Geben Sie mir einen kurzen Überblick, bevor ich mir unseren Toten – oder ist es eine Frau? – zu Gemüte führe.«
»Die beiden Herrschaften da hinten bei Felix«, der Commandant zeigte auf die älteren Leute im Schatten, »haben die Leiche entdeckt. Sie haben den Schreck ihres Lebens bekommen. Verschaffen sich unberechtigt Zutritt zum Grabungsgelände und entdecken eine Tote. Ja, es ist eine Frau. Und die Tote ist für Sie keine Unbekannte, Mathilde.«
Mathilde hob fragend die Augenbrauen.
»Es ist, so wie es aussieht, Flavia Leone.«
»Flavia. Ach, du großer Gott,« entfuhr es Mathilde. »Und was heißt, ›so wie es aussieht‹?«
Die Archäologin Flavia Leone war eine Schulfreundin von Mathilde gewesen. Ihr Vater, ein italienischer Diplomat, hatte eine Französin geheiratet, und Flavia war ihr einziges Kind. Auf der weiterführenden Schule hatte sie bis zum Abschluss mit Mathilde die Schulbank gedrückt. Dann verloren sich die beiden Mädchen aus den Augen, Flavia verschwand nach dem Bac geradezu von der Bildfläche. Als Mathilde längere Zeit nichts von ihr gehört hatte, fragte sie bei der Familie nach, wo ihre Freundin sei. Die Auskunft war knapp. Flavia sei für ein Jahr ins Ausland gegangen. Mehr war man nicht bereit, ihr zu erzählen. Dann hörte Mathilde über Freunde wieder von Flavia, sie studiere Archäologie in Padua und Paris. Mathilde hatte mit dem Jurastudium in Montpellier begonnen. Sie dachte zwar ab und zu noch an die Schulfreundin, doch hatte sie nicht versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen.
Zufällig hatten sich die beiden Frauen vor ein paar Monaten in Nîmes getroffen, als Mathilde mit Bouraada und Regis bei einem Glas Weißwein in einem Bistrot vor der Arena saß. Sie hatten sich versprochen, einander zu treffen, doch dazu war es nicht gekommen. Und heute lag Flavia tot unter einer grünen Plastikplane in der Hitze eines Junisonntags.
»Das werden Sie gleich selbst sehen. Docteur Leone trug ihren Ausweis im Portemonnaie, der in der hinteren Hosentasche steckte.«
Mathilde wartete keine weitere Erklärung ab und strebte in Richtung Plane. Regis stand bereits wieder davor und hob das grüne Plastik an, sodass die Untersuchungsrichterin einen Blick darauf werfen konnte, was sich darunter verbarg. Sie zog tief die Luft ein, stieß sie wieder aus und wandte sich ab. »Ich verstehe.«
Unter der Plane lag ausgestreckt auf dem Rücken eine weibliche Person. Ihre braunen Beine steckten in Shorts, die Füße in hellbraunen Mokassins. Den Oberkörper verhüllte eine elegante cremefarbene Seidenbluse. Die Arme lagen gekreuzt über der Brust. Flavia war nicht gekleidet, als wäre sie auf dem Gelände zur Arbeit erschienen.
Doch an der Stelle, wo ihr Gesicht war, war nichts. Das heißt, es war nicht nichts, es war nur etwas, das man dort nicht erwartet hätte. Auf dem Gesicht lag eine Maske. Aus welchem Material sie war, konnte Mathilde nicht erkennen. Sie sah, soweit sie es beurteilen konnte, irgendwie antik, aber nicht wirklich alt aus.
»Meine Güte, was ist das denn? Das sieht ja aus wie eine Totenmaske, aber warum liegt sie auf ihrem Gesicht?«
Docteur Regis bückte sich zu der Leiche hinunter, schob seinen Kugelschreiber vorsichtig unter die Maske und hob sie an. Mathilde entfuhr ein Schrei. Flavias einst so schönes Gesicht war aufgedunsen, die Augen blutrot.
»Mathilde, kommen Sie hier weg. Kein schöner Anblick.«
Rachid Bouraada führte Mathilde, die sich nicht dagegen sträubte, von der Leiche Flavia Leones weg. Nach einer Minute hatte sie zu ihrer alten Professionalität zurückgefunden.
»Legen wir los, Rachid. Die zwei da hinten haben also die Leiche entdeckt. Fangen wir an, unsere Fragen zu stellen.«
In diesem Moment erklang die Marseillaise. Mathilde warf einen Blick auf das Display und drückte den Anruf weg. Nur wenige Sekunden später ertönte die Melodie erneut. Sie zuckte entschuldigend mit den Achseln und entfernte sich ein paar Schritte.
Ende der Leseprobe