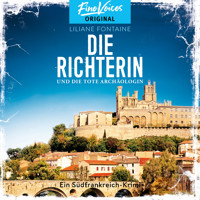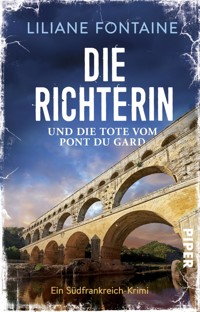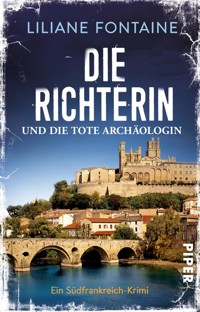9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Nîmes im Frühling und ein packender Mordfall Es ist Frühling in Nîmes, und im Musée de la Romanité wird die Ausstellung »Welt der Kelten« vorbereitet. Als dort eine wertvolle Grabbeigabe aus einer Vitrine gestohlen wird, stirbt ein Wachmann bei der Verfolgung des Eindringlings. Mathilde de Boncourt und ihr Team übernehmen den Fall, doch schon kurze Zeit später tauchen weitere Leichen auf! Erst scheinen die Morde nichts mit dem Raub zu tun zu haben, doch tatsächlich sind sie Teil eines keltischen Rituals. Eines tödlichen Rituals, in dessen Zentrum sich die Richterin plötzlich selbst wiederfindet. Mathilde de Boncourt ermittelt: Band 1: Die Richterin und die Tote vom Pont du Gard Band 2: Die Richterin und die tote Archäologin Band 3: Die Richterin und der Kreis der Toten Band 4: Die Richterin und das Ritual des Todes Band 5: Die Richterin und der Tanz des Todes Band 6: Die Richterin und das Erbe der Toten Band 7: Die Richterin und der Todesbote Alle Bände sind in sich abgeschlossene Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Südfrankreich-Krimi gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Die Richterin und der Todesbote« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Redaktion: Sandra Lode
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Prolog
Kapitel 1
Einige Tage zuvor
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Epilog
Zwei Wochen später
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Prolog
Sie erwachte durch einen eigenartigen Geruch, der in ihre Nase drang. Nicht unangenehm, aber fremd. Wie lange hatte sie geschlafen? Sie hob den Kopf, um nach der Uhr zu greifen, die immer auf ihrem Nachttisch lag. Doch ihre Hand tastete vergeblich. Vergeblich nach der Uhr, vergeblich nach überhaupt irgendetwas. Sie fiel einfach ins Leere. Die Hand wanderte zurück, glitt suchend neben den Körper.
Was war das? Dort, wo das Bettlaken sein sollte, fühlten ihre Finger etwas Pelziges. Ein Fell? In diesem Moment wurde ihr bewusst: Etwas stimmte ganz und gar nicht. Sie war nicht in ihrer Wohnung, nicht in ihrem Schlafzimmer, geschweige denn in ihrem Bett. Mühsam versuchte sie, ihre Gedanken zu ordnen. Woran konnte sie sich erinnern?
Sie sah sich vor dem Museum stehen. Wollte sie hinein? War sie eben herausgekommen? Es spielte keine Rolle. Und danach? Keine Erinnerung. Hatte sie einen Unfall gehabt? Eine Welle der Erleichterung durchströmte sie. Ein Unfall! So musste es gewesen sein. Nichts Dramatisches, sonst wäre sie jetzt nicht bei Bewusstsein. Und jetzt lag sie geborgen und sicher in einem Krankenhaus. Daher auch der Geruch. Doch was hatte ein Fell in einem Krankenhausbett zu suchen? Sie war zu müde, um die Frage weiterzuverfolgen.
Mach die Augen auf, befahl sie sich. Warum war sie nicht schon vorher auf diese Idee gekommen? In ihrem Kopf ging es drunter und drüber. Reiß dich zusammen! Öffne die Augen. Schau dich um. Such die Klingel, um eine Schwester oder einen Arzt zu rufen. Sie werden dich aufklären. Darüber, was passiert ist, in welchem Zustand du dich befindest.
Zumindest lebte sie. Ganz kurz schoss ihr der Gedanke durch den Kopf, sie könne träumen und sei im Traum aus dem Traum erwacht. Aber nein, nie hatte sie in einem solchen Zustand etwas gerochen. Sie musste also wach sein. Mühsam versuchte sie, ihre Augen zu öffnen.
Ihre Lider waren schwer. Warum war es ihr nicht möglich, sie auch nur einen Millimeter zu bewegen? In einem ersten Anflug von Sorge, sie hätte vielleicht doch schwere Verletzungen erlitten, glitten ihre Finger über ihr Gesicht, wanderten zu den Augen, ertasteten etwas Glattes, Kühles, griffen zu, hielten es reflexartig fest. Endlich konnte sie die Lider öffnen. Sie blinzelte ein paarmal, drehte den Kopf langsam hin und her. Mehr war nicht möglich, denn schon diese leichte Bewegung ließ sie aufstöhnen. Der Schmerz unter der Schädeldecke breitete sich aus, explodierte. Sie schloss die Augen, vor denen punktförmige Blitze zuckten.
Ob sie von einem Auto angefahren worden war? Lag sie mit übelsten Kopfverletzungen da? Doch müsste sie dann nicht so etwas wie einen Verband, Bandagen spüren? Noch immer umklammerten ihre Finger irgendetwas. Sie ballte die Hände zu Fäusten, stemmte sie auf das Bett und versuchte, sich langsam aufzurichten. Sie erwartete, dass ihr Körper Schmerzsignale aussendete. Doch nichts geschah.
Aus halb geöffneten Lidern fiel ihr Blick auf eine Wand, verweilte darauf. Die Erkenntnis, dass sie auf eine grobe Mauer, nein, es war eher eine buckelige Felsenwand, starrte, ließ sie schlucken. Das flackernde Licht von zwei Fackeln in Wandhaltern, die schräg an der Wand befestigt waren, erhellte ein wenig die direkte Umgebung. Fassungslos erkannte sie, dass sie mitnichten in einem Krankenhaus lag. Oder war sie doch in einem Albtraum gefangen, aus dem sie nicht mehr herausfand?
Kneifen, man kneift sich doch, wenn man glaubt zu träumen. Mechanisch öffnete sie eine Faust. Das, was sie festgehalten hatte, landete auf dem Boden, der, so hörte es sich an, aus Holz war. Dann die andere Faust. Sie betrachtete, was in der schweißnassen Hand verborgen war. Der Gegenstand war rund und glatt, es war eine Münze. Auf ihren Augen hatten Münzen gelegen. Sie wusste, was dies zu bedeuten hatte. Münzen waren der Lohn für den Fährmann, der seinen Gast ins Reich der Toten brachte. Langsam löste sich ihre geistige Erstarrung, der Schmerz, der ihren Schädel malträtierte, ließ ganz allmählich nach.
Ruhig, ganz ruhig. Alles auf Anfang. Sie saß auf einem schmalen Bett. Hatte zwei Münzen auf den geschlossenen Augen gehabt. Eine lag jetzt auf dem Boden, die andere ließ sie auf das Bett fallen. Erneut glitten ihre Hände über das Fell. An einer Felswand brannten zwei Fackeln, illuminierten schwach die Wand. Der Rest des Raumes, des Verlieses – dieses Wort kam ihr spontan in den Sinn – blieb nahezu im Dunkeln. Angestrengt versuchte sie, etwas zu erkennen, doch alles blieb diffus.
Sie schob die Beine aus dem Bett, stellte die Füße auf, erhob sich, schwankte leicht, blieb dann einigermaßen stabil stehen. Sie begann, sich von Kopf bis Fuß abzutasten. Zuerst der Kopf, in der Hoffnung, doch auf einen Verband zu stoßen, auf Mullbinden, irgendetwas, das ihr bestätigte, vielleicht doch in einem Krankenhaus gelandet zu sein. Unsinn. Ihre Haare waren zu einem Zopf geflochten, der seitlich über dem rechten Schlüsselbein lag. Das war nicht ihre gewohnte Frisur. Weiter über das Gesicht, den Hals. Halt, was war das? Erstaunlicherweise hatte sie es bis jetzt nicht gespürt, das, was nun leicht auf ihren Nacken drückte. Sie tastete danach, ein Ring, der locker um ihren Hals lag. Eine Erinnerung kehrte zurück. Weiter. Ihre Arme waren nackt. Ihr Körper bis zu den Waden von einem weich fallenden Gewand verhüllt und um den Bauch gegürtet. Die Füße steckten in leichten Lederschuhen. Nie hatte sie jemals solche Kleidung getragen. Der Nebel in ihrem Kopf wurde lichter, ihre Gedanken ordneten sich. Entschlossen ging sie auf die Fackeln zu, zog eine aus ihrer Halterung und erkundete den Felsenraum.
Das Bettgestell war aus Metall, die Beine endeten in Tierpfoten mit Krallen. Darauf ausgebreitet das Fell. An einer Wand eine Art Anrichte. Sie sah ein schlankes Gefäß aus einem hellen Material, verschlossen mit einem Stöpsel, den sie herauszog. Ein schwerer, aber nicht unangenehmer Duft entströmte. Parfum. Jedoch nicht der Geruch, der sie geweckt hatte. Das mussten die Fackeln gewesen sein, denn schon mischte sich der Duft aus dem Flacon mit dem leicht ranzigen Geruch des brennenden Talgs.
Neben dem Parfumfläschchen entdeckte sie ein Holzkästchen. Sie öffnete es. Perlen lagen darin und ein kleiner Spiegel. Ihr Blick fiel auf zwei Becher und eine hohe Kanne mit gebogenem Hals. Sie war leer. Eine Erinnerung sagte ihr, dass es sich um eine Weinkanne handelte. Neben dieser lagen zwei Trinkhörner mit goldfarbenen Beschlägen. Ihr Blick wanderte weiter. Ein Kamm aus Bein. Frauen benutzen Kämme.
Sie drehte sich um. Die den Fackeln gegenüberliegende Wand dominierte ein vierrädriger Wagen. Die Räder waren aus Holz, die Deichsel ragte in den Raum. Auf dem Gefährt stapelten sich Teller aus Metall, daneben stand ein großer Kessel, den ein umlaufendes Relief zierte. Sitzende Männer und eine Schlange waren dargestellt. Die Wand hinter dem Wagen war mit groben Brettern vertäfelt. Sie kniff die Augen zusammen, hielt die Fackel ein Stück höher. Es schien, als wären über den Brettern Klappen mit Metallringen angebracht, hinter denen sich etwas verbergen könnte. Die Klappen maßen geschätzt dreißig mal dreißig Zentimeter, es waren fünf an der Zahl.
Sie trat näher, hob eine nach oben an. Ein Schrei entfuhr ihr, und sie ließ sie wieder fallen. Mit zitternder Hand öffnete sie die nächste. Der Anblick war nicht mehr so erschreckend wie beim ersten Mal, trotzdem atmete sie zur Beruhigung tief ein und aus. Auch aus diesem Hohlraum starrte sie ein menschlicher Schädel aus riesigen Augenhöhlen an. Schweiß lief ihr über den Rücken, als sie nach und nach jedes der kleinen Verstecke inspizierte. Fünf Klappen, fünf Hohlräume, aber nur vier menschliche Schädel.
Langsam wich sie zurück, ließ sich auf das Bett sinken. Sie befand sich weder in einem Krankenhaus noch in einem Verlies, sie war in einer Totengruft aufgewacht. Sie hob die Fackel, beleuchtete erneut im Sitzen die Wände. Es musste doch eine Möglichkeit zur Flucht geben. Ob sie sie vorhin einfach nicht registriert hatte? Doch, da war sie. Eine schwere Holztür mit einem Ring in der Mitte, ein Schlüsselloch, aber keine Klinke. Sie sprang auf, zog und rüttelte, doch die Tür gab keinen Millimeter nach. Sie war gefangen, gefangen in einem Grab, einer Gruft.
Es zischte. Talg tropfte von der Fackel auf den Boden. Sie erlosch. Und bald würde auch die zweite Lichtquelle verglimmen. Noch konnte sie ihre Umgebung peu à peu erkunden. Sie stutzte. Merkwürdig, das war ihr bisher nicht aufgefallen. Unterhalb der mittleren Klappe umgab eine Rahmung aus Holz drei der Bretter. Sie maß in der Breite keinen Meter, ebenso in der Höhe. Auf allen vieren bewegte sie sich darauf zu. Doch es gab nirgendwo eine Möglichkeit, die Verschalung zu öffnen. Sie krallte ihre Finger zwischen zwei Bohlen, die Nägel brachen ab. Keine Chance.
Sie kroch zurück zum Bett, zog sich hoch und setzte sich. Erneut versuchte sie, ihre Erinnerungen zu ordnen. Sie hatte den Anruf erhalten, als sie gerade in das Museum hineingehen wollte. Und jetzt war sie hier, umgeben von antiken Grabbeigaben, fand keinen Ausgang, keinen Ausweg. Wartete. Wartete worauf? Wogegen sie sich bis jetzt erfolgreich gewehrt hatte, ergriff langsam Besitz von ihr. Es war die pure Angst, aus diesem Grab nicht mehr lebend herauszukommen.
Kapitel 1
Einige Tage zuvor
»Ruhe bitte, lasst mich einen Toast aussprechen.« Rémy de Boncourt, graue Eminenz im Hintergrund des Weinguts Château de Boncourt, erhob sich.
Mathilde beobachtete fasziniert jede seiner Bewegungen. Ihr grand-père war fast neunzig, aber immer noch eine stattliche Erscheinung. Aufrecht stand er da, kein Zittern in der Stimme, die dunklen Augen aufmerksam auf die Schar seiner Familie gerichtet, die sich um den großen Tisch im Esszimmer versammelt hatte. Hier wurde nur getafelt, wenn es etwas Besonderes zu feiern gab: Geburtstage, Weihnachten, das Osterfest. Oder wie heute das Gründungsjubiläum des Weinguts, das Rémys Großvater Fernand de Boncourt mit der Pflanzung der ersten Reben zu verdanken war.
Mathilde saß zu seiner Linken, rechts Rémys Neffe Philippe, der mittlerweile die Geschäfte des Guts leitete, jedoch nicht ohne regelmäßig den Rat des Patrons, seines Onkels, einzuholen. An Mathildes Seite hatte Rémy Commandant Rachid Bouraada platziert, den Lebensgefährten seiner Enkelin, während sich neben Philippe seine Frau Lucette und ihre vier Söhne reihten.
Erneut musste Rémy um Aufmerksamkeit bitten, weil die beiden Jüngsten seines Neffen, die Zwillinge Arthur und Noah, miteinander tuschelten und kicherten, denn heute durften sie zum ersten Mal einen Schluck Champagner als Aperitif trinken.
»Ruhe jetzt«, flüsterte Lucette und gab Arthur einen leichten Klaps auf den Hinterkopf.
»Aua, das hat wehgetan«, empörte sich der Junge laut, was ihm einen tadelnden Blick von seiner Tante Vivienne einbrachte, die ihm mit ihrem Sohn Sébastien gegenübersaß. Sébastien zog eine Grimasse, worauf Noah in schallendes Gelächter ausbrach.
»Sébastien, das gilt auch für dich. Hör mit den Faxen auf«, schalt Vivienne ihren Sohn. Sébastien, der mit dem Downsyndrom zur Welt gekommen war, legte den rechten Zeigefinger vor seinen Mund. Chut. Der junge Mann, der ewig von seiner Mutter in Watte gepackt worden war, hatte mittlerweile dank Mathilde und Martin, einem engen Freund der Familie, ein stattliches Selbstbewusstsein entwickelt. Wenn er nicht im Château wohnte, lebte er in einer betreuten Wohngruppe in Nîmes. Die Zwillinge, die eben schon wieder mit ihren Faxen anfangen wollten, verzogen schuldbewusst das Gesicht und gaben endlich Ruhe.
Um Rémys Aufforderung, ihn jetzt endlich reden zu lassen, zu unterstützen, klopfte Odile mit einer Gabel an ihr Glas. Und auf Odile, Haushälterin und guter Geist der Familie, hörte endlich die ganze Gesellschaft. Mathilde lächelte sie dankbar an. Für sie war Odile die Mutter, die sie nie gehabt hatte, nachdem ihre Eltern vor mehr als fünfunddreißig Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen waren.
Jetzt richteten sich alle Blicke aufmerksam auf Rémy, der in seiner kleinen Rede an die zurückliegenden Jahre und Monate erinnerte, die so manchem Landwirt und Weinproduzenten tiefe Sorgenfalten in die Stirn getrieben hatten.
Der letzte Frühling war zunächst mit milden Temperaturen ins Languedoc gezogen, die Weinreben öffneten die ersten Knospen, zartes Grün ließ sich blicken. Der Rebschnitt war beendet, und die Reben waren gebunden, um den Trieben genügend Halt zu geben. Dann hatte eine kalte Nacht die Winzer in helle Aufregung versetzt, das Thermometer war gefallen, und es war zu befürchten gewesen, der einsetzende Frost könne die jungen Knospen und Blättchen erfrieren lassen. Doch das Wetter hatte ein Einsehen gehabt und das Quecksilber seinen Abwärtstrend bei kühlen, aber nicht frostigen sechs Grad gestoppt.
Ein ungewöhnlich heißer Sommer hatte den Winzern erneut Sorge bereitet. Das Wasser drohte knapp zu werden. Doch war auch der Sommer ohne größere Schäden für die Weinreben ins Land gezogen und hatte mit seinen strahlend warmen Sonnentagen letztendlich für die Ernte erstklassiger Trauben gesorgt.
Nun war der Frühling dabei, sich erneut über den Winter zu erheben. Noch waren die Nächte kühl, während so manche Tage bereits eine Ahnung des Sommers boten. An diesem festlichen Abend war sogar dichter Nebel aufgezogen, Grund genug, im Esszimmer den Kamin anzuzünden, der wohlige Wärme in das große Zimmer abgab, dessen holzgetäfelte Wände mit Landschaftsgemälden und Portraits geschmückt waren. Direkt hinter Rémy hing das Bildnis seines Ahns Fernand de Boncourt, der mit einem verschmitzten Lächeln wohlwollend auf seine Nachkommen herabblickte.
Rémy erhob sein Glas, in dem goldener Champagner funkelte, der passende Begleiter zu Odiles Vorspeise, einer Gänseleber im Briocheteig. Nie und nimmer hätte die Familie auf Gänseleber als Entrée zu einem Festessen verzichtet, auch wenn diese aus Gründen des Tierschutzes, vor allem außerhalb Frankreichs, nicht unbedingt nur Freunde hatte. Sébastien, der als Kind eine Gans namens Rigoletto sein Eigen nannte, hatte immerhin durchgesetzt, dass sich Odile nach einer Gans umsah, die vor ihrer Schlachtung nicht so leiden musste. Bei einem Biogänsezüchter in den Cevennen war sie fündig geworden. Zwar war die Leber kleiner als gewohnt, aber im Briocheteig fiel dies nicht auf, und ihr Geschmack war vorzüglich. Die ganze Familie war zufrieden mit dieser Lösung, und nun lag die Vorspeise auf den edlen Porzellantellern mit dem Rosenmuster, von denen angeblich schon Napoleon Bonaparte gespeist hatte, als er eine Nacht auf Château de Boncourt verbracht haben sollte. Genaueres wusste niemand.
»Liebe Odile, mein erster Dank gebührt dir. Nicht nur wegen des Essens.« Rémy zwinkerte Odile zu, deren Gesicht tatsächlich eine zarte Röte überzog. »Ohne dich wäre diese Familie nicht die, die sie ist. Du verwöhnst uns, du hältst alles in Gang, und wenn du mal etwas zu tadeln hast, dann hat es auch Hand und Fuß. Sogar die Hunde haben das erkannt, nicht wahr, ihr zwei?«
Henri und sein alter Hundefreund Babou lagen vor dem Kamin und hoben, als sie angesprochen wurden, die Köpfe und klopften mit dem Schwanz auf den Parkettboden.
»Und heute hast du dich selbst übertroffen, meine liebe Odile.« Rémy zeigte auf den Tisch. »Es wird uns, wie immer, ein Fest sein. Schon die Vorspeise lässt mir das Wasser im Mund zusammenlaufen, und der Duft, der meine Nase aus der Küche erreicht hat, verspricht etwas ganz Großartiges. Es riecht nach deiner berühmten Lammkeule, von der ich weiß, wie schnell du mit diesem Gericht das Herz von Rachid im Sturm erobert hast.« Er nickte dem Commandant lächelnd zu.
»Mein nächster Dank gilt dir, mein lieber Philippe. Ohne dich wären unsere Weine nicht das, was sie heute sind. Vor Jahren hast du mich mit großer Beharrlichkeit davon überzeugt, dass wir uns endlich zum Roséwein bekennen sollten. Und der Erfolg gibt dir recht.«
Schon räusperte sich Philippe, winkte bescheiden ab, doch Rémy ließ ihn nicht zu Wort kommen. »Nein, mein Lieber, keine Widerrede. Allerdings glaube ich, Lucette hatte dabei ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. Ohne ihren geliebten Pinot Noir Rosé wäre sie wahrscheinlich wieder nach Lothringen abgereist.«
Philippes Frau nickte bestätigend und hauchte ihrem Mann ein Küsschen zu. Die Stimmung war beschwingt, fröhlich, und Mathilde sah mit Freuden, wie sehr ihr Großvater es genoss, seine große Familie um sich zu haben, und wie bedingungslos er Rachid angenommen hatte.
Zuletzt wandte sich Rémy seiner Enkelin zu.
»Mathilde, als du damals mit dem Studium der Rechtswissenschaften begonnen hast, habe ich einen winzigen Stich verspürt. Nicht, dass du keine Winzerin werden wolltest, sondern es war die Angst, dich eventuell durch eine vielversprechende Karriere an Paris zu verlieren. Aber du bist hiergeblieben, ein größeres Geschenk hättest du mir nicht machen können. Und nun genug der Rede, sie ist länger geworden als geplant. Bon appétit.«
Mathilde war gerührt. »Grand-père. Was sollte ich bitte in Paris? Wo wir hier auf dem schönsten Fleckchen der Erde leben dürfen. Das hat sogar Martin erkannt, nicht wahr, mon chèr Martin? Stoßen wir auf uns und unser wunderbares Zuhause an.«
Sie hob ihr Glas und prostete Martin Endress zu, der neben Sébastien saß. Der Reiseschriftsteller aus Bonn hatte sich nicht weit vom Schloss in dem kleinen Dorf Saint-Fons niedergelassen, war mit Mélisande, einer hiesigen Tierärztin, liiert und bei den Festen der Familie nicht mehr wegzudenken.
»Und ich hab Martin entdeckt. Als ich mit Mathilde auf dem Markt war. In Uzès. Weißt du noch? Und dann hab ich dich in Bonn besucht. Das war ein Abenteuer. Und jetzt bist du hier, und ich hab es nicht mehr weit, wenn ich dich sehen will.« Sébastien strahlte übers ganze Gesicht und boxte Martin freundschaftlich auf den Arm.
Diese Begegnung vor ein paar Jahren, als der Deutsche nach Südfrankreich gereist war, um etwas über das Schicksal seiner jüdischen Großmutter herauszufinden, war der Beginn der Freundschaft zwischen Mathilde und Martin gewesen.
Kurz nach Mitternacht war das Festmahl beendet. Lucette reichte als Digestif einen Mirabellenschnaps, den sie aus ihrer alten Heimat mitgebracht hatte. Als Sébastien sein Glas zum zweiten Mal füllen wollte, griff seine Mutter ein.
»Das eine Glas genügt, chéri. Du hast schon ordentlich dem Wein zugesprochen. Und du weißt, wie dich sonst Albträume quälen werden.«
Der junge Mann schob gehorsam sein Schnapsglas von sich. »Dann aber noch einen winzigen Schluck Rotwein, d’accord?«
Vivienne nickte, und Martin goss seinem Freund ein wenig Rotwein nach, den Sébastien genüsslich trank.
»Ob die Kelten hier auf unserem Land auch schon Wein angebaut haben? Was meinst du, tonton Rémy?«, fragte er dann über den Tisch hinweg.
»Wie kommst du denn darauf, mein Junge?«
Sébastien überlegte einen Moment. »Ich war mit meinen Leuten aus der Wohngruppe im Museum. Wo die ganzen Römersachen und so ausgestellt sind. Bald kommt eine Keltenausstellung rein, die schauen wir uns an. Und der Mann, der sie aufbaut, hat uns gesagt, die Kelten hätten schon Wein getrunken. Ich hab ja geglaubt, die hätten eher Bier getrunken.«
»Nein, die trinken nur Zaubertrank«, krähte Noah dazwischen.
»Zaubertrank auch, aber nur, wenn sie kämpfen müssen«, erwiderte Sébastien mit einem halb mitleidigen Blick auf seinen Cousin. »Du hast eben nicht viel Ahnung. Aber Bier haben sie auch getrunken, hat der Mann gesagt. Aber eben auch Wein. Und der muss doch irgendwo angebaut worden sein, oder? Vielleicht hier, direkt bei uns. Martin, du weißt doch so was.«
Martin lächelte. »Ich kann mir das schon vorstellen, also, dass sie Wein getrunken haben. Warte, ich schau mal in mein schlaues Smartphone.« Er zog sein Telefon aus der Jackentasche und drückte ein paar Tasten. Alle warteten gespannt auf das Ergebnis seiner Recherche.
»Hier, ein Artikel in einer deutschen Zeitschrift. Da steht, die Kelten pflegten einen mediterranen Lebensstil. Das Weintrinken haben sie von den Griechen übernommen und Trinkgefäße aus Griechenland benutzt. Allerdings haben sie aus den Schalen auch ihr Bier geschlürft.« Er grinste.
»Und woher weiß man das?«, fragte Noah.
»Die Forscher haben bei Grabungen in keltischen Siedlungen Keramikgefäße entdeckt, die aus Griechenland importiert worden sind. Und die haben sie auf Nahrungsrückstände hin untersucht. Das waren Funde, wartet kurz, ah aus einer Siedlung am Mont Lassois im Burgund. Man konnte genau feststellen, wer was getrunken hat. Das ist ja interessant. Die Soldaten haben wahrscheinlich Hirsebier getrunken, etwas höher gestellte Bewohner, zum Beispiel die Handwerker, tranken Gerstenbier und die ganz reichen Leute Wein. Und sie kochten sogar damit. Vielleicht sogar etwas in der Art wie deine köstliche Lammkeule heute Abend, Odile.«
»Also eine Art agneau bourguignonne.« Odile lächelte verschmitzt.
»Nein, erstaunlich. Tatsächlich gab es im Burgund offenbar damals keinen Weinanbau. Hier steht, die Weine wurden aus Griechenland, Italien und Südfrankreich importiert. Und die Trinkgefäße wurden auch in Gräbern gefunden. Damit hätten wir Sébastiens Frage fast beantwortet. Wer weiß, vielleicht ist tatsächlich auf euren Feldern bereits Wein angebaut worden. Wann soll diese Ausstellung denn sein, Sébastien? Sie würde mich brennend interessieren.«
»In einer Woche. Sie sind jetzt am Auspacken und Vorbereiten. Dann gehe ich mit dir wieder rein. Zuerst mit meinen Freunden und dann mit dir, einverstanden?«
»Wir wollen da auch hin«, krähten die Zwillinge.
Plötzlich stand Rémy auf. »Wartet mal, ich hab da was.«
Alle sahen sich fragend an, als der alte Mann das Esszimmer verließ. Zwei Minuten später kehrte er mit einer alten Zigarrenschachtel zurück, die er neben seinem Glas abstellte.
»Was ist da drin?« Neugierig sprangen Noah und Arthur auf und starrten auf die Schachtel.
»Gleich, seid mal nicht so ungeduldig«, brummte Rémy und klappte langsam den Deckel auf. Er griff hinein und hob etwas, das in weiches Papier gewickelt war, heraus. Bedächtig schälte er das geheimnisvolle Teil aus seiner Umhüllung, während alle die Hälse reckten.
»Das hier hat einer unserer Erntehelfer vor Jahren im Boden gefunden. Östlich des ersten Feldes vor der Allee. Gott sei Dank ein gutes Stück von unseren Weinreben entfernt. Er hat es mir gebracht, und eigentlich wollte ich es immer mal jemandem, der Ahnung von solchen Sachen hat, zeigen. Aber dann war das Museum zeitweilig, als der Neubau entstand, geschlossen, und es ist mir total aus dem Kopf gekommen.« Vorsichtig legte er das Teil auf seiner Stoffserviette ab.
»Das ist ja kaputt«, ließ sich Noah enttäuscht vernehmen. »Und so was hebst du auf?«
»Egal, das ist Teil eines Schatzes, der bei uns gefunden worden ist. Leute, wir finden noch mehr«, jubelte Arthur.
Jetzt waren alle Augen auf den Gegenstand gerichtet. Mathilde zog die Serviette vorsichtig zu sich heran.
»Das sieht aus wie ein antikes Stück«, konstatierte sie mit einer gewissen Ehrfurcht in der Stimme. »Martin, das könnte doch ein Teil einer solchen Trinkschale sein, von der du gesprochen hast.«
Martin hatte sich bereits erhoben und begutachtete den Fund. »Stimmt, hier, ein Henkel. Die Schale, der Fachbegriff ist Kylix, ist in der Hälfte zerbrochen. Und da erkennt man Spuren der Bemalung. Viel ist es ja nicht mehr. Mit ein bisschen Fantasie würde ich den Umriss eines Kopfes erkennen, das könnte ein Bart gewesen sein. Aber sicher bin ich mir da nicht. Wer weiß, vielleicht ist es der Rest eines Satyrs. Das, was ihn eindeutig identifizieren könnte, fehlt leider.«
»Was wäre das denn?«, fragte Arthur wissbegierig.
Jetzt ging das Fundstück reihum. Philippe hielt sich die halbe Schale probeweise an den Mund. »Da entfaltet sich das Aroma aber gewaltig drin«, schmunzelte er und gab sie an seine Frau weiter.
»Nun, ein Satyr besitzt im Oberkörper eine menschliche Gestalt, unten sieht er aus wie eine Ziege«, beantwortete Martin Arthurs Frage.
»Ach, und so was gab es?«
»Mensch, Arthur, das ist eine Sagengestalt«, belehrte Noah seinen Bruder.
»Und hat man noch mehr bei diesem Feld gefunden?«, fragte Rachid interessiert.
Rémy schüttelte den Kopf. »Nein, das war alles. Nachdem der Mann das Teil gefunden hatte, hielten die anderen natürlich die Augen auf. Aber mehr war nicht zu entdecken. Wie es wohl dahin gekommen ist?«
»Vielleicht gab es auf eurem Terrain eine keltische Ansiedlung«, schlug Martin vor. »Sie wurde aufgegeben, alles ist zerstört und vergangen. Nur das allein ist übrig geblieben.«
Alle schwiegen, und wie es schien, machte sich jeder seine eigenen Gedanken darüber, was sich auf dem Grund und Boden der de Boncourts wohl vor Jahrhunderten abgespielt haben mochte.
»Dann waren es aber reiche Kelten«, folgerte Sébastien und beendete als Erster das Schweigen. »Du hast doch gesagt, sie haben das Geschirr importiert. Das konnten bestimmt nur die mit viel Geld. Oder ein reicher Kelte hat bei uns in den Weinfeldern vor vielen Jahren ein Picknick gemacht und die Schale dabeigehabt. Dann ist sie ihm hingefallen, ist kaputtgegangen, und er hat seinen Müll einfach liegen lassen. Geht eigentlich gar nicht.«
»Da hast du allerdings recht, mein Junge.« Liebevoll strich Vivienne ihrem Sohn über die Haare.
»Maman, lass das, ich bin doch kein kleines Kind mehr.« Sébastien legte den Kopf schief.
Mittlerweile war die Schale bei Odile angekommen. Sie drehte sie um. »Nicht spülmaschinenfest«, stellte sie lachend fest und fuhr sachte mit dem Finger über den Henkel. »Wirst du den Fund nun melden, Rémy?«
»Muss ich ja wohl«, brummte er. »Ich hoffe nur, es kommt keiner auf die Idee, unser Land zu einer archäologischen Ausgrabungsstätte zu machen.«
»Du könntest die Schale Sabine zeigen. Felix’ Freundin restauriert doch solche Artefakte«, schlug Rachid vor.
Rémys Miene blieb skeptisch. »Ihr habt recht, ich muss diesen Fund endlich öffentlich machen. Aber wie gesagt, ich möchte nicht, dass unsere Felder plattgemacht werden.«
»Vielleicht ist es gar kein altes Stück, sondern eine Fälschung. Dann wird auch niemand die Reben anrühren«, meinte Mathilde. »Das Geschäft mit nachgemachten Antiken boomt.«
Doch ihr Großvater winkte ab. »Jetzt mal ernsthaft, Mathilde. Wie sollte denn eine halbe Fälschung in unsere Erde gelangen? Aber das ist eine gute Idee, Rachid. Ich vertraue euch das Ding an, ihr gebt es an Lieutenant Tourrain weiter. Dann sehen wir, was passiert.«
Er wickelte das gute Stück wieder ein, verstaute es in der Schachtel, und damit war das Thema bei Tisch erledigt.
Kapitel 2
Vincent Castello rieb sich über die Augen. Jetzt ein starker Kaffee, das wäre nicht übel. Er sah auf seine Uhr. Noch eine Stunde bis zum Schichtwechsel. Francis Leclerc würde ihn ablösen. Der Junge war erst seit kurzer Zeit dabei. Wie er selbst gehörte Francis zu Sécurité et plus, der Firma, die das passende Konzept für die Sicherheit des Museums erarbeitet hatte, es pflegte, die Mitarbeiter ausbildete und stellte, die sich um den Schutz der wertvollen Exponate kümmerten.
Er selbst war nach seiner Pensionierung vom Polizeidienst von Sécurité et plus angeheuert worden. Viele seiner Kollegen verdienten sich nach dem offiziellen Staatsdienst etwas dazu, denn meist reichte das Geld hinten und vorne nicht. Das Haus war noch nicht abbezahlt, die Kinder vielleicht im Studium, eine teure Scheidung musste finanziell bewältigt werden. Die einen verdingten sich als Türsteher, die anderen als Wachpersonal auf Firmengeländen. Oder, wie er, in einer Einrichtung, sei es ein Kaufhaus oder eben ein Museum.
Ihm gefiel die Arbeit, und er machte sie nicht des Geldes wegen. Das hieß, ein wenig mehr in der Kasse war nicht schlecht. Vielleicht für ein Wohnmobil, mit dem er die archäologischen Stätten in Frankreich oder weiter bereisen würde? Außerdem war ihm zu Hause schlicht und ergreifend die Decke auf den Kopf gefallen. Hier war es in der Nacht ruhig, er saß vor seinen Bildschirmen, schaute nach, ob alles in Ordnung war, ging seine Runden und blieb dabei gerne vor dem einen oder anderen Exponat stehen, um es zu bewundern, nachzulesen, aus welcher Zeit es stammte, und sich so seine Gedanken über die Vergangenheit zu machen.
Castellos Frau war Krankenschwester und bevorzugte ebenfalls die Nachtschichten. Die wurden besser bezahlt. Bald würde auch sie das Rentenalter erreicht haben. Dann hatten sie noch genug Zeit, in der Nacht zu Bett zu gehen. Sein Dienst begann um einundzwanzig Uhr, endete um vier. Um halb fünf lag er in der Falle, schlief bis um zehn und hatte dann eigentlich den ganzen Tag vor sich.
Er gähnte herzhaft, ließ seinen Blick über die Monitore schweifen. Alles absolut ruhig. Castello stand auf, streckte sich und machte sich auf den Weg zu den einzelnen Abteilungen. Hier waren die Relikte der Kelten, die vor ewigen Zeiten in der Gegend ansässig gewesen waren, dort die Ausstellung zu den Römern, denen Nîmes viel zu verdanken hatte, und zuletzt der Blick auf das Mittelalter, eine Zeit, die Castello allerdings nicht sonderlich interessierte.
Spannend fand er zurzeit vor allem den Aufbau der neuen Ausstellung. Als er mit seiner Arbeit im Museum begonnen hatte, war im Untergeschoss gerade die zu den Etruskern zu sehen. Er hatte den Namen dieses Volkes zwar schon mal gehört, hatte allerdings keine Vorstellung, wo und wann sie gelebt oder wie sie ihre Leute beerdigt hatten. Staunend war er durch das Souterrain gewandert, hatte alles in sich aufgesogen, was es zu diesem Volk zu sehen und sagen gab. Und jetzt folgten ihnen, bereit, dem interessierten Publikum präsentiert zu werden, die Kelten. Die Gallier, wie man sie in Frankreich nannte, das Volk, das vor den Römern hier gelebt hatte, mit ihnen verschmolzen war und über das man nach und nach durch archäologische Grabungen und Funde immer mehr erfuhr.
Als die Kisten mit den Exponaten von überallher eingetroffen waren, hatte er eine Sonderschicht eingelegt, um das Abladen und Öffnen der schweren Holzkisten mit zu überwachen. Jedes einzelne Teil war herausgehoben worden, wurde mit Listen und dem Katalog verglichen, in den all das Eingang gefunden hatte, was man aus der Schweiz, Deutschland, Österreich oder dem restlichen Frankreich erwartete. Mit gebührendem Abstand hatte er beobachtet, wie man vorsichtig die Artefakte nachmaß und begutachtete. Mittlerweile war ein Teil bereits hinter Glas gewandert, damit man die wunderbaren Schätze in wenigen Tagen bestaunen konnte.
Vincent Castello hatte sich einen der Ausstellungskataloge erbeten, in dem alles Wissenswerte über das Volk der Kelten nachzulesen war, wann und wo sie ihren Ursprung hatten und wo sie hingezogen waren. Die wichtigsten Exponate waren abgebildet. Castellos Lieblingsstück war die Skulptur eines Vogels – er selbst war ein eifriger Vogelbeobachter –, der im keltischen Oppidum von Roquepertuse gefunden worden war und jetzt seine Heimat im Musée d’Archéologie Méditerranéenne in Marseille hatte.
Vor sich hin summend begann der Wachmann seine Runde. Los ging es ganz oben im Mezzanin, in dem Fresken und Mosaikböden aus der Römerzeit präsentiert wurden. Castello genoss die Stille, nur sein eigenes Summen klang in seinen Ohren. Weiter ging es in Ebene eins. Die dort ausgestellten Münzen interessierten ihn nicht sonderlich. Man konnte sie zwar durch ein Vergrößerungsglas betrachten, aber viel war nun wirklich nicht darauf zu sehen.
Auch jede Menge Grabsteine waren hier ausgestellt, und es wurde umfassend über die in der Römer- und frühen Christenzeit damals üblichen Bestattungsriten informiert. Ein Grabstein für ein Ehepaar, dessen Gesichter ihn, aus dem Stein herausgehauen, ruhig anschauten, hatte es Castello besonders angetan. So etwas würde er sich für sich und Alicia wünschen. Die Leute würden über den Friedhof schlendern und garantiert stehen bleiben. Sie würden sich fragen, wer wohl hier bestattet sein könnte, und kämen zu dem Schluss, es müsse sich ganz sicher um eine wichtige Familie aus Nîmes handeln. Castello schmunzelte bei diesem Gedanken und wanderte weiter.
Plötzlich hielt er inne. Was war das für ein Geräusch? Wo kam es her? Aus dem Erdgeschoss? Er sah auf seine Uhr. Seine Ablösung war noch nie vor der Zeit im Museum eingetroffen. Eigentlich war Francis ein ausgemachter Faulpelz, so schien es ihm. Er lauschte angestrengt. Nichts. Wahrscheinlich hatten seine Sinne ihm einen Streich gespielt. Es herrschte absolute Stille.
Castello umrundete die große Neptunstatue, die vor Jahren bei Grabungen in Nîmes entdeckt worden war. Der Gott des Meeres, der Gott des Wassers. Ein Bein fehlte ihm, aber dafür hatte er ja seinen Dreizack als Stütze, so sah es jedenfalls Castello. Er nickte der bärtigen Gottheit zu und verharrte auf seiner Runde beim Pentheus-Mosaik, das während Bauarbeiten für eine Tiefgarage in der Avenue Jean-Jaurès zutage getreten war. Als Polizist war er froh, nie in einen solchen Fall wie den des Pentheus verwickelt gewesen zu sein, hatte doch die Mänade Agave, seine Mutter, ihn eigenhändig getötet. Die griechische Mythologie besaß Unmengen solcher Geschichten. Nichtsdestotrotz konnte Castello einer solchen Arbeit nur höchsten Respekt zollen. Auf mehr als fünfunddreißig Quadratmetern hatte der Künstler Tausende von bunten Steinchen zusammengefügt und dieses herrliche Kunstwerk geschaffen.
Er wandte sich dem Bereich mit den Fundstücken der vorrömischen Epoche zu, der Zeit, als die Kelten die Region besiedelt hatten. Die Vitrinen waren leer, kleine Tafeln wiesen darauf hin, dass die Exponate im Untergeschoss in der Sonderausstellung zu finden waren. Castello warf einen Blick in das sogenannte Haus des Gailhan, ließ den Strahl seiner Taschenlampe über den Boden und die Wände gleiten. So etwa hatten die Gallier gewohnt. Es war mehr eine Hütte als ein Haus und sehr bescheiden. Um wie viel prächtiger mussten die Anführer der verschiedenen keltischen Stämme gelebt haben, wenn man sich die Funde betrachtete, die die Besucher bald anlocken würden, ging es dem Wachmann durch den Kopf. Feinste Goldschmiedearbeiten in Form von Ringen, Anhängern oder Armbändern, edle Trinkgefäße, die von weit hergekommen waren, oder prächtige Waffen zeugten davon.
Die Mittelalterabteilung war, wie immer, schnell erledigt. Castello stieg die Stufen hinunter ins Souterrain, wo er sich ein wenig mehr Zeit nehmen würde, schließlich befand sich hier bereits einiges davon, was ihn besonders interessierte. Er betrat den ersten Raum, sein Blick blieb an der Schautafel hängen, die darstellte, welche Wanderungen die Kelten durch einen großen Teil Europas geführt hatten. Daneben zeigten Schwarz-Weiß-Fotografien diverse Ausgrabungsstätten, Oppida, Siedlungen vergleichbar einer Stadt, von der nichts mehr übrig war bis auf den Hügel, auf dem die Gebäude aus Holz errichtet worden waren.
Ebenfalls als Hügel erkennbar, aber natürlich kleiner, die Grabstätten, in denen, wie Castello mittlerweile wusste, ganz besondere Schätze entdeckt worden waren. Diese hatten zum Teil als Kopien den Weg nach Nîmes gefunden, was Castello wunderte. Warum nicht die Originale, hatte er gefragt. Die Besucher würden den Unterschied nicht erkennen, hatte ihm die Kuratorin erklärt, sogar Fachleute würden das nachgefertigte Stück kaum davon unterscheiden können. Grund sei, dass so manches Exponat besonders empfindlich und kostbar war, daher könne man es nicht auf die Reise nach Südfrankreich schicken.
Castellos Blick wanderte zu einem Goldreif. Er war in einer speziell gesicherten Vitrine ausgestellt. Der Torques, wie diese Schmuckstücke hießen, stammte aus einem Grab in einem Ort namens Reinheim in Deutschland, direkt an der Grenze zu Frankreich. Eine keltische Fürstin war dort beigesetzt worden, und wie eine Nachbildung des Inneren des Grabes auf einem Foto zeigte, war jenes prachtvoll ausgestattet gewesen. Der Fürstin hatte es an nichts fehlen sollen. Der Goldring war allerdings wie die ausgestellte Röhrenkanne, die zu einem Trinkgeschirr gehörte, eine Kopie. Gefertigt war die Kanne aus Bronzeblech, der Henkel und der verzierte Deckel waren gegossen. Doch auch als Kopie war sie ein wunderschönes Stück, das von der Kunstfertigkeit der Kelten zeugte.
Irgendwie war Castello die Form einer solchen Kanne bekannt vorgekommen. Und er hatte Madame Jacquemot, die Direktorin des Museums, danach gefragt. Die Kanne erinnere ihn an eines der etruskischen Exponate in der letzten Sonderausstellung. Madame Jacquemot hatte voller Hochachtung genickt. »Monsieur Castello, wenn die Studenten der Archäologie so ein gutes Auge hätten wie Sie, wäre ich höchst zufrieden. In der Tat imitiert das keltische Stück ein etruskisches Vorbild.« Und Castello hatte sich gefragt, ob er nicht ins Auge fassen sollte, als Senior ein Studium der Archäologie zu beginnen.
Er ging um die Vitrine herum, betrachtete fasziniert die feine Arbeit. Am oberen Griffansatz war eine bärtige Maske ausgeformt, darunter ein Widderkopf und wiederum darunter eine Satyrmaske über einem spiralartig verzierten Blatt. Die Darstellung solcher Köpfe, so hatte es ihm die Direktorin erklärt, war ein wichtiges Motiv für die Kelten. Sie hatte es Schädelkult genannt, da für die Kelten der Kopf als Sitz des Lebens von ganz besonderer Bedeutung war. Den Griff des Kannendeckels fand Castello eher niedlich, ein Pferdchen mit einem menschlichen Gesicht, die Ohren groß und aufrecht.
Ein großer Teil der Leihgaben stammte, wie der Vogel, aus Marseille. Das Bildnis aus Stein eines Druiden hatte es Castello ebenfalls angetan. Der Druide, ein hoher Priester der Kelten, trug eine Blattkrone auf dem Kopf. Diese Blätter stellten angeblich Misteln dar, eine besonders heilige Pflanze.
Der Blick des Wachmanns wanderte nach links. Castello schluckte schwer und fuhr sich unwillkürlich mit seiner Rechten an den Hals. Halluzinierte er? Vor zwei Stunden war das Exponat doch noch in der Vitrine mit der Leihgabe aus einem anderen Fürstengrab gewesen. Ein Goldring aus Hochdorf in Deutschland. Nicht glatt, sondern elegant in sich gewunden. Ein außergewöhnlicher Torques. Und ein Original. Pures Gold. Hoch versichert und unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen angeliefert. Und in einer Art kleinem Hochsicherheitstrakt aus Panzerglas untergebracht. Vor zwei Stunden hatte er ihn auf seinem Monitor herangezoomt. Er war nicht mehr da! Nur die Hinweistafel, die an der Wand anzubringen war, lag dort.
Schweiß brach Castello aus allen Poren. Der Halsring war geraubt worden, das Geräusch von vorhin war keine Einbildung gewesen. Jemand hatte es geschafft, sämtliche Sicherheitsvorkehrungen zu überwinden, in das Untergeschoss zu gelangen, die Vitrine zu öffnen und den Torques zu entwenden.
Castello bekam weiche Knie, er musste sich an die Wand lehnen. In seinem langen Leben als Polizist war er zu so manchem Einbruch gerufen worden, hatte so manchen Dieb überführt. Auch Räuber, die in Juwelierläden eingedrungen waren, dreist die Glaskästen mit ihrem kostbaren Inhalt ausgeräumt und nicht selten die Inhaber oder Kunden mit Waffen bedroht hatten, ihnen wertvollen Schmuck und Uhren auszuhändigen. Aber das hier, das war einzigartig.
Castello atmete tief ein und aus. Ruhe bewahren. Vielleicht war der Dieb noch im Haus. Wann hatte er das Geräusch gehört? Vor zehn Minuten, fünfzehn? Oder hatte der Dieb den Halsring erst aus der Vitrine genommen, als er auf seinem Routinegang sich dem Souterrain näherte? Wie lange war er jetzt hier im Untergeschoss? Endlich wich die Lähmung, die sich seiner Glieder und seines Gehirns bemächtigt hatte. Er musste Alarm schlagen und dem Einbrecher hinterherjagen. So viele Wege, aus dem Museum zu kommen, gab es nicht.
Castello rannte los, die Treppe hinauf. Er nahm ein Scharren wahr, ein Kratzen irgendwo im Erdgeschoss, wo sich der Kassenraum, die Garderoben und Toiletten sowie der kleine Buchladen befanden. Wie war das nur möglich gewesen? Während seiner Dienstzeit? Hatte sich der Dieb vielleicht in der Toilette eingesperrt? War von dort aus zu seinem Beutezug aufgebrochen? Castellos Schritt wurde immer schneller, er rannte, er keuchte. Ein schmerzhaftes Stechen erfüllte seine Brust, er bekam kaum noch Luft. Der Schmerz breitete sich aus, zog in die Arme, in den Nacken, presste alle Luft aus seinen Lungen, seinem Körper heraus. Er stolperte, stürzte mit den Knien auf den obersten Treppenabsatz. Ein neuer Schmerz durchfuhr ihn. Doch er war nicht vergleichbar mit dem, der in seinem Oberkörper tobte.
Vincent Castello bemühte sich, sich aufzurappeln, stemmte sich mit den Händen auf den Boden, kroch auf allen vieren in den Bereich, in dem die Schleusen waren, die den Besuchern erlaubten, diese heiligen Hallen zu betreten oder zu verlassen. Schweiß tropfte auf den Boden, mischte sich mit dem Speichel, der ihm aus dem Mund lief, als er versuchte, endlich wieder tief ein- und auszuatmen. Vergeblich, der Atem stockte ihm im wahrsten Sinne des Wortes.
Nicht aufgeben, nicht aufgeben, schnapp ihn dir, Castello, alter Junge. Und mit dem Gedanken, kläglich versagt zu haben, brach Vincent Castello endgültig auf dem kühlen Boden zusammen.
Kapitel 3
Mathilde hatte Rachid um kurz vor acht am Hôtel de Police in der Avenue Pierre Gamel abgesetzt und war zum Palais de Justice weitergefahren. Rachid musste zu einem Meeting nach Lyon und würde erst am nächsten Tag wieder in Nîmes sein. Sie parkte in der Tiefgarage gegenüber dem altehrwürdigen ehemaligen Zugang zum Justizgebäude. Ihr Weg führte nicht direkt zum Haupteingang, sondern sie nahm sich die Zeit, bei der Bronzestatue des Matadors El Nimeño vorbeizuschlendern, ihm mit einem kurzen Gruß zuzunicken, denn mit dieser kleinen imaginären Begegnung begann grundsätzlich ein guter Tag für sie.
Die Restaurierungsarbeiten an der antiken Arena waren weiter vorangeschritten. Stück für Stück erstrahlten die mächtigen Steine nach ihrer Sandstrahlreinigung hell und sauber. Dabei fragte sich Mathilde, wie oft wohl der Stein eine solche Prozedur ertragen konnte, bis er vollends weggestrahlt worden war. Ihr jedenfalls gefiel die Arena besser mit der Patina des Alters.
Bruno, der Wachmann, der um diese Zeit im Gerichtsgebäude Dienst hatte, fragte Mathilde nach dem werten Befinden, und Mathilde ihrerseits erkundigte sich nach Brunos Frau, die vor ein paar Wochen ihr fünftes Kind geboren hatte. Die Richterin sang vor sich hin, als sie die Treppe ins erste Obergeschoss nahm, wo sich ihr Büro befand. Christine saß im Vorzimmer und ordnete Akten, die sie gleich Mathilde aushändigen würde.
»Bonjour, irgendwelche Neuigkeiten, Christine?«, fragte Mathilde gut gelaunt.
Christine schüttelte den Kopf. »Das Übliche. Seit dem Drama im Sommer hatten wir nichts wirklich Spektakuläres mehr. Allerdings können Sie wahrscheinlich gerne auf Mord und Totschlag verzichten. In den blauen Mappen liegen zwei Fälle, die Sie vielleicht interessieren werden. Lebrun und Hugo. Beide sind wieder auf freiem Fuß gewesen und erneut straffällig geworden. Man könnte meinen, die Leute lernen nichts dazu. Und das hier können Sie gleich mitnehmen. Es ist wohl eilig. Juge Demongeot bittet Sie, noch einmal drüberzuschauen. Nächste Woche soll der Prozess eröffnet werden. Es ist diese Erpressergeschichte aus Alès.«
Sie hielt Mathilde einen dünnen gelben Ordner hin, den diese ergriff.
»Ich sehe es mir gleich an, danke Christine. Würden Sie mir bitte eine Tasse Ihres unvergleichlichen Kaffees vorbeibringen?«
Mathilde verschwand in ihrem Arbeitszimmer und öffnete das Fenster. Als sie am Morgen Château de Boncourt verlassen hatten, war bereits ein leichter Wind aufgekommen und hatte sich an die Arbeit gemacht, die Wolken, die sich in der Nacht über die Sterne gelegt hatten, zu vertreiben. Der Himmel verhieß nun einen strahlenden Tag. Der Sommer, der la Canicule, als die Temperaturen bis zu zweiundvierzig Grad erreicht hatten, war lange Vergangenheit und bald wieder Zukunft. Schon jetzt befürchtete man eine Wasserknappheit nie gekannten Ausmaßes, und die ersten Regulierungen zum Wassersparen wurden angemeldet bis hin zum Verbot neuer Swimmingpools. Die Touristen, die bald die ersten warmen Frühlingstage im Süden verbringen würden, waren zurzeit noch spärlich gesät, und die Stadt gehörte weitgehend den Einheimischen.
Mathilde schnappte sich eine Gauloise Blonde aus ihrem Zigarettenetui mit den bunten Punkten und zündete sie an. Ein tiefer Zug, das Gesicht der Sonne entgegengestreckt, in wenigen Minuten ein erster Schluck Bürokaffee, und der Arbeitstag konnte beginnen. Ihr Blick fiel auf den gläsernen Reklamekasten an der Ecke der Rue de l’Aspic, in dem ein großes Plakat Werbung für die neue Ausstellung im Musée de la Romanité, dem Antikenmuseum, machte.
Les Gaulois – notre héritage, nos ancêtres. Die Gallier – unser Erbe, unsere Ahnen. Die Gallier, das keltische Volk, das das heutige Frankreich besiedelt hatte. Insofern waren alle Gallier Kelten, aber nicht alle Kelten Gallier. Mathilde musste schmunzeln. Dann war es wohl erblich bedingt, dass sie, seitdem sie rauchte, keiner anderen Zigarette als der Gauloise, der Gallierin, etwas abgewinnen konnte.
Sie kniff die Augen zusammen und studierte das Plakat. Es zeigte ein Ausstellungsstück, das Mathilde schon vor ein paar Jahren beeindruckt hatte. Kurz nach der Eröffnung des Museums hatte die Belegschaft des Palais de Justice ihren Betriebsausflug eben dorthin unternommen, zumal im dazugehörigen Restaurant ein Sternekoch seine Küche eröffnet hatte, dessen Kreationen man nach dem Museumsbesuch hatte testen wollen.
Damals war der antike Fund erstmals gezeigt worden. Es war die Büste eines keltischen Kriegers, geschaffen im siebten bis sechsten Jahrhundert vor Christus. Mathilde konnte sich auch deswegen so gut daran erinnern, da die Mutter von Christine in Sainte-Anastasie lebte, wo man den Krieger mit dem markanten Gesicht und dem imposanten Kopfschmuck entdeckt hatte.
Noch bevor die junge Frau, die die Gruppe durch das Museum führte, etwas dazu erklären konnte, hatte Christine schüchtern die Hand gehoben und erzählt, wie ihre Mutter beeindruckt aus dem Badezimmerfenster im Obergeschoss ihres Hauses die Ausgrabung stundenlang verfolgt hatte, war der Krieger doch direkt hinter ihrem Haus bei Kanalarbeiten aus der Erde geborgen worden.
Mathilde nahm einen tiefen Zug, und ihre Gedanken wanderten zurück ins Museum. Erstaunt hatte die Museumsmitarbeiterin Christines Worten gelauscht. Ihre Mutter hatte sich dann ein paar Tage später an die Gruppe der Archäologen herangewagt und nachgefragt, was man denn dort nun gefunden hätte. Bereitwillig hatte sie Auskunft erhalten, und ihr wurde sogar ein Foto auf einer Digitalkamera präsentiert, das das gute Stück bis ins Detail zeigte.
Was wie ein riesiges Kopftuch auf dem Haupt des Kriegers aussah, war ein Helm, jedoch nicht aus Bronze oder Eisen, sondern vielmehr aus mit Wolle gepolstertem Leder. Daran waren, so die Vermutung der Archäologen, dekorativ Hörner angebracht, die vielleicht sogar aus Gold oder Silber gefertigt gewesen waren. Ähnliche Büsten waren im Mittelmeerraum entdeckt worden, die alle, zusätzlich zum Helm, einen auffälligen Brustschild mit Schulterträgern besaßen. Dieser war beim Krieger in Nîmes mit Pferdemotiven dekoriert. Wahrscheinlich handelte es sich bei solchen Bildnissen um reale Personen aristokratischer Herkunft, die als Helden oder Ahnen verehrt worden waren und somit einen außergewöhnlichen Platz in der Gesellschaft eingenommen hatten.
Alle hatten gespannt Christines Worten gelauscht und nach ihrem kleinen Fachvortrag applaudiert.
Mathilde kehrte in die Gegenwart zurück. Apropos Christine. Wo blieb sie denn mit dem Kaffee? Mathilde rauchte ihre Zigarette zu Ende, entsorgte den Stummel im Abfallkorb, schloss das Fenster und wandte sich der Akte des Kollegen Demongeot zu. In diesem Augenblick öffnete sich die Tür. Christine betrat das Büro, doch der erhoffte Kaffeeduft blieb aus.
»Mathilde, es ist etwas passiert. Sie erinnern sich doch sicher an Vincent Castello? Ein Cousin meiner Mutter.«
»An Ihre Mutter habe ich eben gedacht. Und natürlich, Brigadier Castello. Und er ist mit Ihnen verwandt? Ist er nicht mittlerweile in Pension? Mon Dieu, Christine, Sie sind ja leichenblass. Setzen Sie sich. Was ist denn geschehen?«
Christine ließ sich schwer auf den Stuhl gegenüber von Mathildes Schreibtisch fallen. Tränen schossen ihr in die Augen, und Mathilde reichte ihr ein Papiertaschentuch aus ihrer Schreibtischschublade, das Christine dankend annahm.
»Vincent war schon seit drei Jahren in Pension. Irgendwann ist ihm zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen, und er wollte etwas dazuverdienen. Wenn Alicia, seine Frau, in Rente geht, wollten sie reisen. Sie haben auf ein Wohnmobil gespart. Er hat einen Job bei Sécurité et plus angenommen, und die haben ihn im Musée de la Romanité eingesetzt. Es hat ihm unheimlich viel Spaß gemacht. Er war ganz beseelt von der antiken Geschichte seiner Heimatstadt.« Mit jedem Satz hatte Christine schneller gesprochen. Jetzt sank sie in sich zusammen, schniefte und schnäuzte sich.
Natürlich hatte Mathilde registriert, dass ihre Sekretärin von Castello in der Vergangenheit gesprochen hatte. Er war also offenbar verstorben. Schlimm, aber warum ging es Christine nur so an die Nieren? Castello war ein Cousin ihrer Mutter, demnach kein ganz enger Verwandter. Da musste mehr dahinterstecken. Sie schwieg und wartete ab, bis Christine sich wieder gefasst hatte.
»Es muss heute in der späten Nacht passiert sein. Als seine Ablösung kam, war Vincent tot. Er lag im Foyer des Museums, hinter den Schleusen zu den Ausstellungsräumen. Er hatte einen Herzinfarkt.« Erneut schluchzte Christine, und ein zweites Taschentuch wanderte über den Schreibtisch.
Mathilde ahnte, dass die Geschichte damit nicht zu Ende war. Ein Herzinfarkt bei einem Mann im Alter von Vincent war allerdings nichts Ungewöhnliches.
»Das tut mir unendlich leid, Christine«, sagte sie mitfühlend.
»Das war noch nicht alles.« Christine holte tief Luft. »Wie es aussieht, war er hinter jemandem her. Einem Dieb, genauer gesagt. Ein wertvolles Exponat ist aus einer Vitrine verschwunden. Ein goldener Halsring, der aus einem deutschen Museum für die Ausstellung zur Verfügung gestellt worden ist. Wahrscheinlich hat ihn das alles immens aufgeregt, sein Herz blieb einfach stehen. Vielleicht hatte er ja eine Herzschwäche, von der er gar nichts geahnt hat.«
Mathilde nickte. »Das kommt vor. Aber woher wissen Sie das alles schon? Es ist eben mal …«, sie schaute auf ihre Armbanduhr, »… Viertel vor neun.«