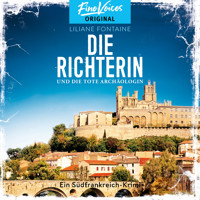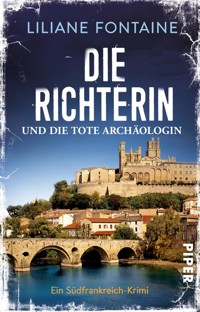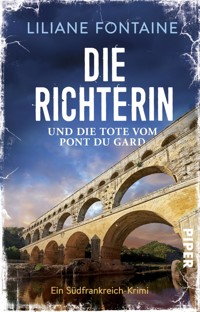
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Spannender Frankreich-Krimi mit viel Liebe zu Land, Kultur und Leuten: Start der Krimireihe um die Untersuchungsrichterin Mathilde de Boncourt
Für Fans von »Madame le Commissaire« und Kommissar Dupin: leichte Urlaubslektüre mit packendem Kriminalfall
Mathilde de Boncourt überlebt nur knapp einen Anschlag. Wem ist die Untersuchungsrichterin zu gefährlich geworden? Vom großväterlichen Weingut im Languedoc ermittelt sie gegen einen mächtigen Pädophilenring. Gemeinsam mit Rachid Bouraada von der Police Judiciaire versucht sie, den Tätern auf die Schliche zu kommen. Doch dann kreuzt ihr Weg den des attraktiven Reiseschriftstellers Martin Endress und sie muss feststellen, dass ihre eigene Familie Geheimnisse hat.
Krimiautorin Liliane Fontaine hat in »Die Richterin und die Tote vom Pont du Gard« mit Mathilde de Boncourt eine starke Untersuchungsrichterin erschaffen, die wie die Autorin selbst die Region um Avignon kennt und liebt. Der Roman Noir verwebt verschiedene Handlungsstränge zu einem unterhaltsamen Frankreich-Krimi.
Urlaubsflair und Spannung vereint
Trotz schwerer Themen wie Kindesmisshandlung und dem Zweiten Weltkrieg verliert der Roman von Liliane Fontaine niemals seine Leichtigkeit. Die detaillierte, anschauliche Sprache, die liebenswerten Charaktere und die immer durchscheinende Liebe zu Südfrankreich machen diesen Krimi zur perfekten Urlaubslektüre und zu einer Neuerscheinung von 2020, die Fans von Kriminalromanen nicht verpassen dürfen.
Liebe zu Südfrankreich spürbar
Autorin Liliane Fontaine liebt Frankreich vermutlich so sehr wie ihre Hauptfigur Mathilde de Boncourt. Landschaft, Menschen und Kultur beschreibt sie so eindrücklich und begeistert, dass der Leser den nächsten Besuch kaum erwarten kann. Die deutsche Kunsthistorikerin mit französischen Wurzeln weiß, wovon sie spricht, wenn sie in den mittlerweilen 5 Bänden der Reihe den Leser nebenbei mit geschichtlichen Informationen versorgt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
© 2018 Piper Verlag GmbH, München Redaktion: Sandra LodeCovergestaltung: Favoritbüro, MünchenCovermotiv: GettyImages/Paul Williams – Funkystock
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Prolog – Pont du Gard – Sommer
Nîmes – Frühling – Palais de Justice
Les Milles, Aix-en-Provence – Herbst 1941
Nîmes – Polyclinique du Grand Sud – Frühling
Les Milles, Aix-en-Provence – Herbst 1941
Nîmes, Polyclinique du Grand Sud – Frühling
Bonn – Südfrankreich – Sommer
Château de Boncourt – Sommer
Nîmes – Ein Apartment – Frühsommer
Bonn – Südfrankreich – Sommer
Saint-Gilles – Sommer
Perlen des Midi – Sommer
Saint-Gilles – Eine erste Spur – Sommer
Château de Boncourt – Sommer
Hôtel de police – Sommer
Remoulins – Spätsommer, ein Jahr zuvor
Château de Boncourt – Sommer
Arles – Begegnung – Sommer
Anduze – Villa Viroulet – Sommer
Maguelone – Ehemalige Abtei – Sommer
Uzès – Sommer
Château de Boncourt – Sommer
Saint-Gilles – Sommer
Sommières – Sommer
Château de Boncourt – Sommer
Château de Boncourt – Sommer
Saint-Gilles – Restaurant Les Magnolias – Sommer
Saint-Gilles – Villa Les Trois Figues – Vier Tage zuvor
Hôtel de police – Sommer
Ribaute-les-Tavernes – Sommer
Château de Boncourt – Sommer
Saint-Laurent-d’Aigouze – Sommer
Nîmes – Sommer
Arles – Sommer
Saint-Gilles – Traffic Bar – Sommer
Le Vigan – Sommer
Saint-Gilles – Sommer
Saint-Gilles – Sommer
Remoulins – Sommer
Saint-Gilles – Auberge La Pause du Pèlerin – Sommer
Saint-Gilles – Gendarmerie Nationale – Sommer
Saint-Gilles – Auberge La Pause du Pèlerin – Sommer
Château de Boncourt – Sommer
Aigues-Mortes – Büro von Leon Daudet – Sommer
Remoulins – Sommer
Château de Boncourt – Sommer
Château de Boncourt – Sommer
Hôtel de police – Sommer
Les Milles – Sommer
Château de Boncourt – Sommer
Epilog – Saint-Laurent-d’Aigouze – Cimetière Communal – Sommer
Prolog – Pont du Gard – Sommer
»Papa, schau, ein Engel. Er möchte fliegen. Papa, kann ein Engel auch ohne Flügel fliegen?«
Die Hitze dämpfte alle Geräusche. Der Aufschrei, der sich in den Kehlen fassungsloser Touristen geformt hatte, blieb dumpf, wie durch einen riesigen Wattebausch ausgestoßen.
Das kleine Mädchen hatte seine Hand aus der des Vaters gelöst und zeigte auf eine weiße Gestalt zwischen den oberen Arkadenbögen des Pont du Gard. Dort, wo niemand sein sollte, sein durfte. Da oben drohte Lebensgefahr.
Im Moment des kollektiven Aufschreis fiel die weiße Gestalt. Der Engel ohne Flügel war sofort tot.
Bei der Zeugenbefragung würde der Vater aussagen, er habe zunächst nichts bemerkt. Erst als Emily, seine Tochter, nach oben gezeigt habe, sei ihm die weiße Gestalt aufgefallen. Und da wäre es schon zu spät gewesen. Da habe er nur noch dieses flatternde Hemd vor Augen gehabt. Wie ein weißes Tuch an einer Wäscheleine habe es sich im Wind aufgebauscht.
Er habe immer gedacht, ein menschlicher Körper würde sich im Fall aus dieser Höhe drehen. Aber nein, die Gestalt habe irgendwie quer in der Luft gelegen, fast so, als wolle sie fliegen. Er habe seine Kleine daher auch in dem Glauben gelassen, ein Engel würde herabfliegen.
»Papa, kann ein Engel auch ohne Flügel fliegen?«, habe sie gefragt. Die Kleine habe ja sehr viel Fantasie.
»Papa, ob der Teufel den Engel heruntergeschubst hat?«
Ja, eine Menge Fantasie habe seine Tochter, würde der Vater nicht ohne einen gewissen Stolz den Polizisten berichten.
Nîmes – Frühling – Palais de Justice
Die Untersuchungsrichterin Mathilde de Boncourt verließ unmittelbar nach dem Urteilsspruch den Cour d’assises. Es war exakt 16.53 Uhr. Sie schlüpfte seitlich durch den Nebeneingang des Gerichtssaals über den Korridor hinaus aus dem alten Trakt des Palais de Justice in den neuen Flügel am Boulevard des Arènes. Sollte die wartende Pressemeute sich auf andere stürzen.
Die Urteilsverkündung hatte schon im Gerichtssaal auf der Seite der Verteidigung einigen Tumult ausgelöst. Die Presse hatte, sehr zur Verärgerung der berichterstattenden Zunft, vor dem Saal warten müssen. Immer wieder hatte man ungeduldiges Scharren und Gemurmel vor der Tür gehört, immer wieder mussten Gerichtsdiener die wartenden Reporter auffordern, Ruhe zu geben. Doch kaum war die große Saaltür geöffnet worden, waren die Pressevertreter nicht mehr aufzuhalten, drängten die Gerichtsdiener zur Seite, rempelten sich gegenseitig aus dem Weg und hielten Mikrofone und Kameras hoch. Jeder wollte als Erster einen der heiß begehrten Kommentare erhalten, egal ob von der Anklage oder aus dem Munde der Verteidigung. Handys wurden in Sekundenschnelle aus den Taschen gezogen, wieder eingeschaltet. Und so verbreitete sich die Nachricht von der Verurteilung blitzschnell im ganzen Land.
Mathilde de Boncourt war zufrieden. Der honorable Docteur Bernard Jalabert verschwand für viereinhalb Jahre hinter Gittern, seine ebenso ehrenwerte Gattin wurde wegen Beihilfe immerhin für achtzehn Monate aus dem Verkehr gezogen. Damit lag der Urteilsspruch nur geringfügig unter dem von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafmaß von fünf Jahren. Vor einer Woche hätte Mathilde keinen Sou darauf verwettet, dass die beiden überhaupt verurteilt werden würden. Selbstsicher und blasiert saßen sie da, lächelten höhnisch bei jedem Wort, das von der Anklagebank kam. Sie waren sich sicher gewesen, diesen Prozess unbeschadet zu überstehen. Doch dann hatte sich das Blatt gewendet. Die drei Verteidiger des Arztes und seiner Gemahlin hatten noch kurz vor Beginn des letzten Prozesstages versucht, eine Verurteilung auf Bewährung zu erreichen. Doch der Staatsanwalt, Maître Lalande, hatte sich auf einen solchen Kuhhandel nicht mehr eingelassen. Nun, da die Beweislage so erdrückend geworden war, als das Opfer endlich bereit war, sein Schweigen zu brechen, wollte er, sehr zur Genugtuung Mathilde de Boncourts, diesen Mann und seine Gehilfin hinter Gittern sehen.
Aminata war dreizehn Jahre alt gewesen, als das Ehepaar Jalabert das Mädchen aus Mauretanien als Haussklavin »auserkoren« hatte. Dank ihrer mutigen Aussage und der Schilderungen ihres mehr als fünfjährigen Martyriums hatten die Geschworenen ihr Urteil einstimmig gefällt, und der Vorsitzende Richter, Juge Demongeot, hatte nicht eine Sekunde mit der Verurteilung und dem Verkünden des Strafmaßes gezögert.
Mathilde hatte vor mehr als einem Jahr begonnen, gegen die Jalaberts zu ermitteln. Aufmerksame Nachbarn, die neu in das noble Viertel gezogen waren, hatten als Erste den Verdacht ausgesprochen, dass im Hause Jalabert etwas nicht mit rechten Dingen zuging. Die exklusive Wohnung der beiden war observiert worden, und als man das Mädchen außer Haus schaffen wollte, hatte die Police Judiciaire unter der Leitung von Commandant Rachid Bouraada zugegriffen.
Bis zum Prozess war es noch ein weiter Weg gewesen, beharrlich hatte die junge Frau geschwiegen, aus Angst vor einem Racheakt der Jalaberts. Erst als man ihr zugesichert hatte, dass die beiden nach ihrer Aussage hinter Gittern verschwinden würden, hatte Aminata den Mut gefunden, gegen ihre Peiniger auszusagen. Für Mathilde de Boncourt war dieser Prozess nur die Spitze des Eisbergs. Sie war sich sicher, dass hier ein gut organisiertes Netzwerk sein Unwesen trieb, diskret und verschwiegen. Und wenn der wohlhabende Arzt tatsächlich nur ein kleineres Rädchen in diesem Getriebe war … Mathilde konnte sich ausmalen, was auf sie und ihre Kollegen von der Polizei noch an Ermittlungen zukommen würde. Doch vorerst war zwei von ihnen das Handwerk gelegt worden.
Mathilde raffte mit der linken Hand ihre schwarze Robe und ertastete gleichzeitig mit der rechten das noch prall gefüllte Päckchen Zigaretten in der Innentasche ihres Richtergewandes. Vom Konsum der mindestens zwanzig Zigaretten pro Tag war sie heute Nachmittag noch weit entfernt. Sie lechzte geradezu nach einer Zigarette, spürte schon den Geschmack im Mund, sehnte den Moment herbei, wo sich ihre Lungen mit dem köstlich-schädlichen Rauch füllten. Ja, Mathilde bekannte sich zu ihrem Laster, sie genoss jeden Zug, auch wenn ihr der Aufdruck auf der roten Verpackung verkündete, dass dieses Vergnügen tödlich enden konnte. Das Risiko nahm sie gerne in Kauf. Sie lebte mit der Gefahr, eine Tatsache, die letztendlich auch ihr Beruf mit sich brachte. Was sollten da ein paar Zigaretten bewirken? Lächerlich. Allerdings war das Rauchen im gesamten Palais de Justice verboten, und so eilte Mathilde dem Ausgang des Gebäudes am Boulevard des Arènes entgegen. Diesen kurzen Augenblick des Triumphes wollte sie alleine und mit der wohlverdienten Zigarette genießen. Erst dann würde sie sich, wenn es sich ergab, den Fragen der Presse und den Anfeindungen der Familie Jalabert stellen.
In seinem Glaskäfig saß der diensthabende Wachmann Bruno Gracia, der streng auf jeden ein Auge hatte, der das Palais de Justice betreten oder verlassen wollte. Fragend schaute er zu Mathilde hinüber, wollte wissen, wie der Prozess ausgegangen war.
»Zeigen Sie es diesen Schweinen, Madame le Juge«, hatte er Mathilde am Morgen zugerufen, als sie im eleganten grauen Kostüm das Gebäude betreten hatte.
Mathilde reckte Zeige- und Mittelfinger zum Victory-Zeichen und grinste. »Wir haben es geschafft, Bruno, der gute Doktor und seine Angetraute schmoren erst mal ein paar Jahre hinter Gittern. Und das Schmerzensgeld kann sich sehen lassen. Juge Demongeot hat die beiden bluten lassen. Fast eine Million Euro, nicht schlecht, was? Zweihunderttausend Euro für jedes Jahr der Peinigung. Von mir aus hätte es noch höher ausfallen können, ich hätte das Pack am liebsten am Bettelstab gesehen, aber, mein lieber Bruno, ich will nicht klagen, Nein, ich will ganz und gar nicht klagen.«
Bruno nickte zufrieden. Er hatte gewusst, dass Mathilde als Siegerin aus diesem Prozess hervorgehen würde. Insgeheim war er ein wenig verliebt in sie. Elisa, seine Frau mit spanischen Wurzeln, die ihm fünf Kinder geschenkt hatte, liebte er aus tiefstem Herzen, aber die Untersuchungsrichterin, ja, zu der konnte man aufschauen – im wahrsten Sinne des Wortes. In ihrer Robe wirkte sie noch größer, und mit ihren knapp hundertachtzig Zentimetern überragte sie Bruno fast um Haupteslänge. Im Vorbeieilen griff sich Mathilde an den Kopf, löste den Knoten, zu dem sie ihr Haar geschlungen hatte, und schüttelte ihre rotblonde Mähne. Dazu diese wachen, grünen Augen – ja für Bruno war Mathilde de Boncourt die Verkörperung der Göttin der Gerechtigkeit, die Mensch gewordene Justitia.
Es war kurz nach siebzehn Uhr, als die Untersuchungsrichterin das Gebäude verließ. Sie blieb am oberen Treppenabsatz stehen und atmete tief die frische Luft ein. Die Anspannung des Tages fiel von ihr ab, ihr Job war, zumindest für heute, erledigt. Es war ein düsterer Nachmittag, dieser Nachmittag im März. Leichter Nieselregen hüllte seit den frühen Morgenstunden die Stadt in unwirtliches Grau. In ein paar Wochen ist Ostern, ging es Mathilde durch den Kopf. Ab dann gäbe es für den Strom der Reisenden kein Halten mehr. Jetzt waren nur wenige Touristen in der Stadt unterwegs. Mathilde konnte auf Anhieb Einheimische von Auswärtigen unterscheiden, zumal wenn sie hier an dieser Stelle stand, denn sie blickte vom Palais de Justice direkt auf die berühmte Arena von Nîmes. Und hier liefen Tag für Tag zwei Gruppen von Menschen an ihr vorbei: die Touristen, die ihre Hälse reckten, um das mächtige Bauwerk genau betrachten zu können, und die Einheimischen, die meist achtlos vorbeischlenderten, die Arena kaum noch eines Blickes würdigten. Und wenn sie irgendwohin schauten, dann auf den Boden, um nicht in einen Hundehaufen zu treten.
Das riesige Oval des einstigen römischen Amphitheaters übte auf Mathilde immer wieder eine große Faszination aus. Vierundzwanzigtausend Menschen hatten darin Platz gefunden. Und hinter diesen mächtigen zweigeschossigen Mauern mit ihren imposanten Rundbögen hatte eine ganz eigene Art der Gerichtsbarkeit stattgefunden. Zum Tode Verurteilte wurden wilden Tieren ausgeliefert, die sie zerrissen, wurden gegen Gladiatoren in den Kampf geschickt, die selbst oft dem Tode geweiht waren. Mathilde seufzte. Sie liebte die Historie, die so grausig und doch so spannend war, bewunderte die Arena, gleichermaßen angefüllt von blutiger Geschichte und doch so wunderschön.
Noch heute wurde ihr Boden regelmäßig mit Blut getränkt, dem der Kampfstiere, die während der Feria im September ihr Leben lassen mussten. Auch wenn sie diese Art von blutigem Stierkampf nicht mochte, so konnte Mathilde den Stolz, den seine Anhänger für die Matadore empfanden, nachvollziehen. Sie bevorzugte die courses camarguaises, die sie, wenn es ihre Zeit erlaubte, besuchte. Mit lauten Rufen feuerte sie dann die in Weiß gekleideten Stierkämpfer an, die als raseteurs und cocardiers ihren Mut und ihre Geschicklichkeit beweisen mussten, wenn sie den Stieren die zwischen die Hörner gespannten Kokarden entrissen. Doch hier überlebte der Stier die Auseinandersetzung. Irgendwann landete er dann zwar trotzdem im Kochtopf, aber er hatte zumindest in der Arena eine Chance gehabt.
Allerdings pflegte Mathilde zu einem Matador eine besondere Beziehung. Auf dem Weg von ihrer Wohnung in der Rue Dorée zum Palais de Justice hielt sie regelmäßig bei El Nimeño inne, dem französischen »Matador de toros«, der seinem Leben im November 1991 mit nur siebenunddreißig Jahren ein Ende gesetzt hatte. Der in Deutschland geborene Christian Montcouquiol – so sein bürgerlicher Name – war nach Nîmes, Heimatstadt seiner Mutter, zurückgekehrt und hatte seinen Siegeszug als gefeierter Matador angetreten. Nach seinem Tod hatte die Stadt ihrem großen Sohn eine überlebensgroße Bronzefigur gewidmet, die – wo auch sonst – vor der Arena aufgestellt worden war, in der er seine großen Triumphe gefeiert hatte.
Es war Mathilde zu einer lieben Gewohnheit geworden, ein kurzes imaginäres Zwiegespräch mit dem Stierkämpfer zu halten – für sie der Auftakt zu einem hoffentlich erfolgreichen und glücklichen Tag. Sie war ein kleines Mädchen gewesen, als sie El Nimeño kennengelernt hatte. Mit ihrem Großvater hatte sie den manadier Guillaume Rossignol besucht. Ein junger Matador war auf dem Hof gewesen, wollte sich von der Qualität der Kampfstiere, die Rossignol züchtete, überzeugen. Als Mathilde El Nimeño gefragt hatte, ob er niemals Angst vor den mächtigen Tieren verspüre, die ihn doch töten könnten, hatte er gelacht, den Kopf geschüttelt und ihr geantwortet: »Il faut toujours aller jusqu’au bout de sa passion.« Sie hatte zuerst nicht verstanden, was er damit meinte. El Nimeño hatte ihre Hand genommen, und ihr erklärt, man müsse immer bis zum Ende seiner Leidenschaft gehen, das heißt, man müsse seine Leidenschaft auch leben, bis in die letzte Konsequenz. Der Stierkampf sei sein Leben, seine Passion, und für diese Passion wäre er auch bereit, ohne Angst zu sterben. Als der Matador einige Jahre später nach einer schweren Verletzung, die ihm ein Stier in der Arena zugefügt hatte, nicht mehr in der Lage gewesen war zu kämpfen, hatte er sich das Leben genommen.
Mathilde war tief beeindruckt von diesem Mann gewesen und hatte die Worte des Stierkämpfers als Grundsatz ihrer eigenen Lebenseinstellung auserkoren. Was sie anpackte, verfolgte sie mit Leidenschaft und Hartnäckigkeit, für ihre Überzeugung würde sie bis zum Ende kämpfen.
Doch heute musste sie ihre Zwiesprache mit El Nimeño auf den Nachhauseweg verschieben. Mathilde war am Morgen die Zeit davongelaufen, als sie die passende Garderobe herausgesucht hatte. Es hätte zwar keine Rolle gespielt, was sie anzog, da ihre Richterrobe alles kaschierte, doch sie war in der Kleiderfrage bei Gericht äußerst penibel. Nichts konnte sie mehr aufregen, als wenn sie unter dem Gewand eines Kollegen eine zerschlissene Jeans entdeckte oder die Falten der weißen, breiten Krawatte nicht exakt nebeneinander lagen.
Der Nieselregen wurde mittlerweile von einem starken Wind begleitet, der durch den Boulevard des Arènes strich. Mathilde griff in die Innentasche ihrer Robe und zog ihre Gauloises blondes und ein Feuerzeug hervor. Vor ein paar Monaten hatte sie noch überlegt, ihrer Lieblingszigarette untreu zu werden, als bekannt geworden war, dass man die Produktion von Nantes ins Ausland verlegen wolle. Aber keine andere Zigarette konnte mit der Blonden mithalten. Mathilde steckte sich die Zigarette zwischen die Lippen und entfachte ihr Feuerzeug. Ein Windstoß ließ die Flamme sofort wieder ersterben. Sie setzte erneut an, und wieder war die Flamme nach kurzem Aufflackern erloschen. Sie versuchte, das Feuerzeug mit der Hand abzuschirmen, doch die Windböen, die jetzt noch vehementer durch die Straße fegten, ließen ihr keine Chance. Mathilde wandte sich seitlich ab, versuchte, mit ihrem Körper das aufzüngelnde Flämmchen zu schützen. Nur dieser spontanen Drehung hatte die Untersuchungsrichterin ihr Leben zu verdanken.
Sie hatte das Motorrad, das sich von rechts mit rasender Geschwindigkeit näherte, nicht bemerkt. Der erste Schuss fiel um 17.06 Uhr, riss Mathilde von den Beinen, die Kugel hatte ihre Schulter durchschlagen. Den Bruchteil einer Sekunde später zerfetzte eine zweite Kugel ihre Oberschenkelarterie. Eine dritte Kugel schlug hinter ihr in den linken Pfeiler des Eingangs zum Palais de Justice ein, sie hatte Mathildes Schädeldecke nur um Millimeter verfehlt.
Vom Verlassen des Gebäudes bis zum ersten Schuss waren nach Aussage von Bruno Gracia nicht mehr als drei Minuten vergangen. Vom Zusammenbrechen auf den Stufen des Gebäudes bis zum Eintreffen der Rettungskräfte vergingen dank der schnellen Reaktion des Wachmanns keine sechs Minuten. Und seiner Geistesgegenwart verdankte Mathilde ihr Leben. Als die Rettungskräfte eintrafen, kniete Bruno neben ihr und hatte seine Finger so um ihren Schenkel gepresst, dass die Blutung zwar nicht gestoppt, aber vermindert worden war. Bevor sie das Bewusstsein verlor, galt ihr letzter Gedanke El Nimeño, dem sie heute nicht von ihrem Triumph erzählen konnte.
Les Milles, Aix-en-Provence – Herbst 1941
Lange hatte Dr. Alfons Reuter gehofft, man habe sie einfach vergessen. Sie waren jetzt bereits seit drei Monaten im Lager. In den letzten Wochen vor ihrem Abtransport hatte er jede Nacht und jeden Tag damit gerechnet, dass sie vor der Tür stehen würden mit dem Befehl in der Hand, ihn und seine Familie abzuschieben. Er hatte von dem Internierungslager bei Aix-en-Provence gehört, in das man unliebsame Personen brachte, um sie dann nach Deutschland abzutransportieren. Und was unter einer unliebsamen Person zu verstehen war, hatte auch er nun begreifen müssen.
Mehr als sieben Jahre hatte er als Mediziner und Professor für Anatomie an der Medizinischen Fakultät der Universität Montpellier einen untadeligen Ruf genossen. Er hatte sich ein neues Zuhause geschaffen, als er 1935 von Heidelberg nach Frankreich gekommen war, um hier einen vakanten Lehrstuhl einzunehmen. Dr. Reuter war der jüngste der Professoren gewesen, hatte sich bereits in Heidelberg als Spezialist für Wirbelverletzungen einen Namen gemacht. Seine Familie hatte ihn mit gemischten Gefühlen in das unbekannte Frankreich ziehen lassen. Er hatte seine Entscheidung nie bereut, war schnell heimisch geworden und hatte einen engen freundschaftlichen Kontakt zu seinen einheimischen Kollegen. Der großgewachsene, schlaksige Deutsche überzeugte durch sein Können und nicht zuletzt dadurch, dass er nach nur wenigen Monaten die französische Sprache fast perfekt beherrschte.
Nachdem er drei Jahre ein eher unspektakuläres Liebesleben geführt hatte, wurde ihm ein besonderes Glück zuteil. Er lernte seine Frau kennen, Sarah, eine französische Jüdin, deren Vater als Direktor der Opéra National de Montpellier höchstes Ansehen genoss. Im offenen Haus seiner Schwiegereltern gingen Wissenschaftler, Intellektuelle und Künstler ein und aus. Ein Kollege hatte ihn zu einem Literaturabend in die Villa von Benjamin Leopold mitgenommen, und er war mit offenen Armen empfangen worden. An diesem Abend brillierte Lion Feuchtwanger mit Auszügen aus »Die Geschwister Oppermann«, dem Roman, den er in seinem Exil in Sanary-sur-Mer verfasst hatte. Die nachfolgende Diskussion der Gäste um Feuchtwangers »Blindheit« gegenüber Russland interessierte Alfons schon nicht mehr. Er hatte nur Augen für Sarah. Die älteste Tochter Benjamins und Kunststudentin hatte sich rührend um ihn gekümmert, ihn mit den anderen Gästen bekannt gemacht. In die zierliche Person mit dem dunklen Haar, das sie zu einem Chignon geschlungen hatte, und den großen, fast schwarzen Augen, verliebte er sich auf den ersten Blick unsterblich. Sie hatte ein rotes Kleid mit weißen Punkten getragen, und der Ohr- und Halsschmuck aus Korallen hob sich von ihrer gebräunten Haut warm ab.
Noch im selben Jahr heirateten Alfons Reuter und Sarah Leopold kurz vor Weihnachten. Seine Familie in Deutschland litt darunter, nicht dabei sein zu können. Sein Vater war schwer erkrankt, und die politischen Verhältnisse hielten sie davon ab, eine Reise nach Frankreich zu wagen. Auf Befehl Hitlers waren deutsche Soldaten in Österreich einmarschiert, und in der Nacht vom 9. auf den 10. November waren in ganz Deutschland jüdische Geschäfte und Synagogen in Schutt und Asche gelegt worden. Seine Mutter schrieb ihm, der Vater verzweifle geradezu an dieser Welt. Einer seiner Kollegen am Gymnasium, Wilhelm Abrahams, sei von hinten mit einem Stein fast totgeschlagen worden, Wilhelm, der niemandem auch nur irgendwann etwas zuleide getan hatte.
Auch im Hause Leopold wurden die politischen Ereignisse zum Hauptdiskussionspunkt eines jeden Abends. An einem dieser Abende verbreitete es sich wie ein Lauffeuer: Deutschland hatte Polen angegriffen. Bald wurden die ersten unliebsamen Ausländer aufgefordert, Frankreich zu verlassen. Alfons Reuter steckte in der tiefsten Krise seines Lebens. Er bangte um seine Familie in Deutschland, von der er nach Kriegsbeginn nichts mehr gehört hatte. Nur durch die Ehe mit einer Französin war es ihm überhaupt noch möglich, weiterhin im Land zu bleiben, und allein dem immer noch großen Einfluss seines Schwiegervaters war es zu verdanken, dass er seiner Arbeit an der Universität weiter nachgehen konnte.
Der Tag, an dem ihm Sarah mitteilte, sie sei schwanger, war der einzige, der in ihm das gleiche wilde Glücksgefühl entfachte, wie er es an jenem Tag verspürt hatte, als sie seinen Heiratsantrag angenommen hatte. Am 1. Juni 1940 erblickte Anne Reuter das Licht der Welt, nur drei Wochen vor der Kapitulation Frankreichs. Vier Wochen später gelang es Benjamin Leopold, seiner Frau und Sarahs Schwester im letzten Augenblick, offiziell das Land zu verlassen und in die USA zu reisen. Alfons Reuter und Sarah blieben mit ihrer vier Wochen alten Tochter zurück.
Seinen Lehrauftrag hatte Alfons aufgeben müssen, und er verließ kaum noch die Wohnung. Nur ein enger Freund war ihnen geblieben, Docteur Philippe Sagard, bei dem sie einmal in der Woche zu Abend aßen. Wie überall waren der Krieg und die politischen Verhältnisse das allumfassende Thema. Nach der Kapitulation gehörte Südfrankreich zwar zur unbesetzten Zone, doch was nun folgte, erfüllte viele Franzosen mit großer Wut. Bereits kurz nach der Gründung des »État Français« im Juli 1940 wurden viele jüdische Franzosen ihrer Ämter enthoben, verloren ihre Arbeit. Keinen Tag zu früh hatte Benjamin Leopold mit seiner Familie das Land verlassen. Sagard warnte seinen Freund Reuter, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis auch sie in das Internierungslager Les Milles abgeschoben werden würden, von dort sei der Weg nach Deutschland nicht mehr weit. Man munkle, dass die Deutschen die Juden in den Osten verschleppen würden, und sie würden nicht mehr zurückkehren.
Als Sarah zum Stillen mit Anne das Esszimmer verlassen hatte, vertraute Sagard Reuter an, er habe gehört, dass man die Juden zu Tausenden töte, Reuter müsse sich etwas einfallen lassen. Les Milles sei im Moment voll von Ausländern, hauptsächlich Deutsche. Einigen sei bereits die Flucht gelungen. Man solle es kaum für möglich halten, zurzeit wären sogar Leute wie der Künstler Max Ernst inhaftiert. Und ob er von der Geschichte von Lion Feuchtwanger gehört habe. Der sei aus einem anderen Lager bei Nîmes in Frauenkleidern geflohen, angeblich hätte die amerikanische Botschaft in Marseille ihm dabei geholfen. Es sei einfach unglaublich, was sich im Moment im Land abspiele.
In derselben Nacht hatten Alfons und Sarah beschlossen, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um mit Hilfe von Benjamin Leopold Frankreich verlassen zu können. Doch es war bereits zu spät. Am Nachmittag des nächsten Tages hielt ein Fahrzeug vor der Wohnung, und zwei Männer in schwarzer Uniform forderten Reuter höflich, aber bestimmt auf, das Wichtigste zu packen, man würde ihn und seine Familie nach Les Milles bringen, von wo es in absehbarer Zeit nach Deutschland gehen würde. Reuter hatte nur hoffen können, dass Sagard seinen Schwiegervater über die nun lebensbedrohliche Lage informieren würde.
Die Tage im Lager vergingen mit einer Eintönigkeit, die bald – es war vollkommen absurd – eine Normalität suggerierte, für die man fast schon eine Art Dankbarkeit empfand. Es gab genügend zu essen und zu trinken, man ließ die Insassen in Ruhe. Das Lager, das in einer alten Ziegelei untergebracht war, schien allerdings mit jedem Tag voller zu werden, und die hygienischen Verhältnisse wurden immer katastrophaler. Wie Reuter mittlerweile erfahren hatte, waren bereits direkt nach Kriegsbeginn Anfang September 1939 die ersten Häftlinge, deutsche und österreichische, aber auch osteuropäische Juden und Intellektuelle, die vor Hitler oder Stalin geflüchtet waren und in Frankreich jetzt als »feindliche Ausländer« galten, nach Les Milles gebracht worden. Reuter wurde jedes Mal von einer Angst, die ihm fast das Herz zerriss, überwältigt, wenn er nur daran dachte, wie viele Menschen er schon hat ankommen sehen, die mittlerweile wieder verschwunden waren. Die Worte seines Freundes Sagard kamen ihm in den Sinn. Er behielt seine Ängste für sich, wollte Sarah nicht damit belasten. Sie kümmerte sich hingebungsvoll um Anne, und wenn die Kleine schlief, dann verschwand sie, um sich an der Arbeit an dem großen Wandbild zu beteiligen. Keiner wusste so recht, wer es begonnen hatte, aber zahlreiche Künstler, die in Les Milles auf ihre Abschiebung warteten, hatten sich schon an der malerischen Gestaltung der Wand beteiligt.
Wie Alfons Reuter später erfahren sollte, fuhren von Les Milles fünf Züge mit zweitausend Juden über das Sammellager Drancy bei Paris nach Auschwitz in den sicheren Tod.
Nîmes – Polyclinique du Grand Sud – Frühling
Mathilde de Boncourt stand vor der alten Hauptfassade des Palais de Justice. Von der Esplanade Charles-de-Gaulle hatte man einen guten Blick auf die prächtige Fassade, die der Architekt Gaston Bourdon in Anlehnung an die Front des antiken römischen Tempels in der Innenstadt von Nîmes, dem Maison Carrée, 1836–46 erbaut hatte. Majestätisch erhob sich der mächtige Eingangsbereich, zu dem eine Freitreppe führte. Sechs kannelierte korinthische Säulen trugen den Dreiecksgiebel, dazwischen im Architrav die Inschrift »Palais de Justice«. Links anschließend der historische Trakt des »Tribunaux«, rechts der »Cour d’apell«.
Mathildes Blick blieb an dem großen Giebelfeld hängen. In der Mitte thronte Justitia, ihr linker Arm wies zu einer Schar Menschen, ihre rechte Hand reckte hoch erhoben ein Schwert. Daneben standen und kauerten ebenfalls Menschen, nackte und bekleidete, die ihren Urteilsspruch erwarteten. Mathilde fröstelte plötzlich, obwohl die Sonne mit ihrer ganzen Kraft von einem Himmel schien, dessen Blau je weiter das Auge schaute, in ein intensives Violett überging. Sie blickte an sich herab und stellte entsetzt fest, dass sie vollkommen nackt war. In dem Moment, als sie mit den Händen ihre Blöße bedecken wollte, erhob sich Justitia, breitete Schwingen aus, von denen Mathilde gar nicht gewusst hatte, dass sie überhaupt existierten, und stürzte sich mit einem ohrenbetäubenden Kreischen und erhobenem Schwert auf Mathilde. Mathilde stieß einen Schrei aus. Justitia war neben ihr gelandet. Nun aber klang ihre Stimme, es war nur noch ein Flüstern, beruhigend, vertrauenerweckend.
»Sie ist wieder bei uns.«
Was sollte das heißen, natürlich war sie da, wo sollte sie gewesen sein?
»Mathilde, Mathilde, hören Sie mich?« Nur ein Wispern. Aber ja, verdammt, sie hörte doch.
»Mathilde, Madame de Boncourt, Sie haben sehr lange geschlafen. Wir sind froh, Sie wieder bei uns zu haben.«
Was hieß hier geschlafen, wo war sie, wer sprach zu ihr? Mühsam versuchte Mathilde, ihre Augen zu öffnen. Es gelang ihr nicht, es fühlte sich an, als wären die Augenlider zusammengeklebt.
»Befeuchten Sie das Papiertüchlein, tupfen Sie ihr sanft über die Augen, dann fällt es ihr leichter.«
Wohltuende Kühle, erfrischender Balsam strich über ihre Augen. Nun konnte sie blinzeln, langsam die Augen einen Spalt öffnen. Ihr Blick fiel auf eine rein weiße Fläche, sonst war da nichts. Vielleicht war sie blind, konnte nichts mehr sehen, nur noch weißes Nichts, vielleicht hatte Justitia sie mit dem Schwert geblendet. Sie schloss die Augen wieder. Da, erneut dieses Wispern.
»Mathilde, Sie hören uns. Sie verstehen uns. Versuchen Sie noch einmal, langsam Ihre Augen zu öffnen.«
Sie folgte der Stimme, gab sich alle Mühe, befahl ihren Augen, sich zu öffnen, doch ihre Lider waren bleischwer. Wieder brachte ein sanftes Tupfen ihren Augen Entspannung, und wieder gelang ihr danach ein schwaches Blinzeln. Nichts hatte sich verändert, immer noch sah sie nur diese weiße große Fläche. Eine Wand? Langsam bewegte sie den Kopf nach links, ihr Nacken war verspannt vom langen Liegen. Die Stimmen wisperten aufmunternd. Ihre Augen tasteten sich von der weißen Wand zu etwas, was sich bewegte, wie durch einen Windstoß sich aufbauschte, wehte wie ein Banner. Aber es war keine Fahne, es war ebenfalls weiß. Ein Vorhang? Der Blick glitt weiter, mühsam, blieb an einem großen Fenster hängen, endete an einem weiteren Vorhang. Gut, sie war in einem Zimmer mit weißer Wand und weißen Vorhängen. An was erinnerte sie das nur? Unendlich langsam drehte sie den Kopf wieder in seine Ausgangsposition, dann nach rechts, weg von der Wand. Wieder etwas Weißes, ein Schrank, dann eine Tür, eine andere weiße Wand.
Jemand hatte ihre Hand ergriffen, streichelte sie behutsam, knetete dann ihre Finger. Unwillig wollte sie ihre Hand entziehen, doch der Griff blieb fest, dann entspannten sich ihre Finger, das Kneten tat doch gut. Nun glitten ihre Augen, leichter als eben noch, weiter, blieben an einem Gesicht, nein, zwei Gesichtern hängen. Eines davon kam ihr vage bekannt vor, das andere war fremd. Sie wollte etwas sagen, doch kein Ton kam aus ihrem Mund. Eine plötzliche Erinnerung durchzuckte ihr Gehirn. Sie sah sich erschossen auf den Stufen des Palais de Justice liegen. War sie tot? Aber wurden einer Toten erfrischende Tücher aufs Gesicht gelegt, massierte man ihre Finger? Wohl kaum. Noch einmal versuchte Mathilde zu sprechen, die erste, nahe liegende Frage zu stellen.
»Wo bin ich?«, krächzte sie. In ihren Ohren hallten diese drei Worte wie unartikulierte Laute eines Tieres. Doch die beiden Gesichter hatten sie offensichtlich verstanden.
»Sie sind im Krankenhaus, in der Polyclinique du Grand Sud. Mein Name ist Docteur Michel Villeneuf. Ich werde Ihnen ganz kurz erklären, was geschehen ist. Bitte sprechen Sie nicht, das alles hat Zeit. Neben mir sitzt Commandant Rachid Bouraada. Er wird mit Ihnen reden, aber erst, wenn Sie dazu in der Lage sind. Mathilde, Sie sind nach dem Prozess gegen Bernard Jalabert angeschossen und schwer verletzt worden. Sie lagen fast fünf Wochen im künstlichen Koma, das heißt, wir haben Sie operiert und gleichzeitig in eine Art Dauernarkose versetzt. Nun sind Sie über den Berg. Wir haben Sie langsam wieder aufwachen lassen, aber Sie werden gleich wieder tief und fest schlafen. Mathilde, wir sind froh, dass Sie es geschafft haben.«
Fest schlafen. So viel hatte Mathilde de Boncourt noch gehört, dann verlangten Körper und Geist wieder nach ausgiebigem und heilendem Schlaf.
Les Milles, Aix-en-Provence – Herbst 1941
Es war ein sommerlich heißer Oktobertag, als Alfons Reuter aus seinen Gedanken gerissen wurde. Die Luft war wie Blei, schwer drückte sie auf das alte Ziegeleigebäude. Er lag mit Anne im Arm auf seiner Pritsche. Die Kleine fieberte bereits seit einigen Tagen. Mit Wadenwickeln hatten sie versucht, das Fieber zu senken, doch heute glühte das Kind mit der Sonne um die Wette. Vor ihm stand einer der wachhabenden Soldaten, er war plötzlich, wie aus dem Nichts, aufgetaucht. Er legte einen Zeigefinger an seine Lippen und bedeutete Alfons zu schweigen.
»Hören Sie genau zu, Reuter. Heute Nacht, Punkt ein Uhr, gehen Sie mit Ihrer Frau und dem Kind zum westlichen Tor. Draußen wartet ein Wagen auf Sie. Der Schlüssel steckt. Im Handschuhfach liegen Papiere, die Sie und Ihre Frau als Paul und Suzanne Petit ausweisen. Das Kind ist ebenfalls eingetragen. Eine Passage von Sète nach Tanger liegt ebenfalls dabei, für Sie drei. Sie werden im Hafen von Tanger erwartet und in Sicherheit gebracht. Bei der ersten sich bietenden Möglichkeit werden Sie mit einem Frachtschiff in die USA reisen können. Viel Glück.«
Der Mann verschwand im Schatten, noch ehe Reuter begreifen konnte, was hier geschehen war. Als Sarah eine halbe Stunde später von ihrer Arbeit an dem Wandbild zurückkehrte, war er immer noch fassungslos, konnte nur mit stammelnden Worten seiner Frau von den Anweisungen zur geplanten Flucht berichten.
»Dein Vater hat es geschafft, Sarah, er hat immer noch seine Kontakte. Vielleicht auch über die amerikanische Botschaft, wie bei Feuchtwanger.« Er umarmte seine Frau und drückte sie heftig an sich. Sarah schob ihn ein Stück von sich weg.
»Und du glaubst nicht, dass das eine Falle sein könnte? Kaum haben wir uns mit der Kleinen davongeschlichen, erschießen sie uns, vielleicht um ein Exempel zu statuieren. Sie zeigen, wie es einem ergeht, wenn man zu flüchten versucht. Alfons, ich habe Angst.«
»Sarah, dazu waren die Angaben zu konkret.«
»Natürlich waren sie konkret, es muss alles Hand und Fuß haben, sonst würden wir uns doch nicht darauf einlassen.«
»Vielleicht hast du ja recht«, gab Alfons Reuter nach, »aber es ist unsere einzige Chance. Wenn wir bleiben, werden wir abtransportiert, vielleicht voneinander getrennt, vielleicht ist es unser sicherer Tod. Aber wenn uns wirklich eine Fluchtmöglichkeit geboten wird, die dein Vater organisiert hat, haben wir wenigstens eine Chance zu überleben. Wir müssen es wagen. Ich weiß, du ängstigst dich auch wegen Anne, wegen ihres Fiebers. Sarah, ich bitte dich, wir müssen es versuchen, und wir werden es schaffen.«
Es war totenstill in dieser Nacht. Die meisten Lagerinsassen schliefen einen tiefen Schlaf, ermattet von der ungewöhnlichen Hitze des Tages oder gefangen in der Ohnmacht, dem Schicksal auf diese unerbittliche Weise ausgeliefert zu sein. Auch Sarah war eingeschlafen, nur Anne wimmerte ab und zu leise vor sich hin. Alfons Reuter weckte seine Frau, und ohne aufgehalten zu werden, schlichen sie zum angegebenen Tor. Für Alfons stand fest, dass dies nur möglich war, weil nicht nur dieser eine Wachmann bestochen worden war. Das Tor stand einen Spalt offen, eben breit genug, dass Reuter mit dem Kind auf dem Arm und Sarah mit einem kleinen Koffer aus Hartpappe, der das Notwendigste enthielt, hindurchschlüpfen konnten. Kaum waren sie hindurch, schloss sich das Tor leise hinter ihnen. Ein Automobil stand in zweihundert Meter Entfernung, ein Renault Vivaquatre, ein bequemer Reisewagen. Es war Reuter unerklärlich, dass niemand auf den Wagen aufmerksam geworden war. Wahrscheinlich war er erst vor Kurzem hier abgestellt worden, denn ein solches Auto wäre ansonsten im Handumdrehen konfisziert worden. Er legte das Kind auf den Rücksitz, es schlief nun tief und fest, doch der kleine Körper glühte. Im Handschuhfach lagen die Papiere. Die Passfotos zeigten tatsächlich ihre Gesichter. Reuter hatte keine Zeit, sich darüber zu wundern. Sie mussten los.
Holpernd setzte sich der Wagen auf der unbefestigten Straße in Bewegung. Die Stille war geradezu gespenstisch. Niemand verlor ein Wort. Konzentriert lenkte Reuter das Auto bis zur Landstraße. Für die Strecke vom Lager über Arles, Aigues-Mortes bis Sète würden sie mindestens fünf Stunden brauchen. Die Nacht war verhangen, es grenzte an ein Wunder, dass niemand ihren Weg kreuzte. Die Menschen waren froh, wenn sie sicher in ihren Häusern saßen.
Nach drei Stunden hatten sie die Höhe von Arles erreicht. Anne war mittlerweile aufgewacht, und ihr anfängliches Wimmern hatte sich zu einem Gebrüll gesteigert, das den ganzen Wagen ausfüllte. Sarah saß nun hinten bei ihrer Tochter und versuchte, sie zu beruhigen.
»Alfons, sie glüht, das Fieber muss sehr hoch sein. Wir müssen etwas unternehmen. Ihre Händchen sind schon ganz vertrocknet. Sie braucht eine Medizin, Alfons, bitte, lass dir etwas einfallen.«
Reuter hielt an. Die feuchten Lappen, die Sarah eingepackt hatte, waren nicht mehr zu gebrauchen. Das kleine Gesichtchen war krebsrot, und tatsächlich sah die Haut aus wie die eines runzeligen Apfels. Alfons Reuter fasste einen Entschluss.
»Sarah, du erinnerst dich an Docteur Barbier in Saint-Gilles? Ich habe zwar schon lange keinen Kontakt mehr zu Claude gehabt, aber er wird uns helfen.«
»Mir ist alles recht. Lange hält Anne das nicht mehr durch.« Mit Tränen in den Augen drückte sie das kleine Bündel an sich.
Reuter fuhr in Richtung Norden. Von Arles waren es vielleicht zwanzig Kilometer bis nach Saint-Gilles. Er fand das Haus des Landarztes auf Anhieb. Das eiserne Gartentor quietschte in den Angeln. Erschrocken blickte Reuter auf die Nachbarhäuser, aber alles blieb dunkel. Mit dem Türklopfer in Form einer kleinen Hand pochte er an die Haustür. Claude Barbier hatte entweder einen leichten Schlaf, oder er hatte wach gelegen, denn schon nach einer Minute öffnete er. Er war es gewohnt, in der Nacht an ein Krankenbett gerufen zu werden. Als er Alfons Reuter erkannte, schien er nicht im Mindesten überrascht.
»Herein mit euch. Ich habe schon von Sagard gehört, was passiert ist. Keine Angst, ich stelle keine Fragen. Nur die, wie ich euch helfen kann?«
Sarah hielt dem Arzt das Kind entgegen, das erneut in einen tiefen, unruhigen Schlaf gefallen war. Barbier fackelte nicht lange. Er weckte seine Haushälterin und seinen jungen Gast, dem er auftrug, Eis aus dem Eiskeller zu holen und Handtücher nass zu machen. Er hatte den Jungen vorübergehend in seinem Haus aufgenommen, da dessen Mutter, eine Patientin Barbiers, in ein paar Tagen ihr drittes Kind bekommen würde, und der Junge, ein Wildfang wie er im Buche stand, seinen Eltern gehörig auf die Nerven ging. Barbier, der ein großes Herz besaß, hatte sich bereit erklärt, den Bengel für ein paar Tage bei sich aufzunehmen, bis das Kind da wäre und sich die Situation im Hause der Eltern wieder normalisiert hatte.
Rose bat er, ein stärkendes Mahl zuzubereiten, das sie später wohl alle gut gebrauchen könnten. Der Junge verschwand, und Rose machte sich umgehend in der Küche zu schaffen.
Bald waren die Beinchen des Kindes in nasse Tücher gehüllt. Barbier hörte es ab, klopfte auf den schmächtigen Rücken. Dann nahm er ein kleines flaches Hölzchen und öffnete ihm den Mund. Er lachte aufatmend. »Ich kann euch beruhigen. Es ist zwar außergewöhnlich, aber sie bekommt bereits ihren ersten Zahn. Ich werde ihr ein wenig Aspirinpulver verabreichen, um das Fieber zu senken, es wird auch die Schmerzen lindern. In ein, zwei Tagen hat sie es überstanden. Eine echte kleine Französin, hat es eilig mit den Zähnchen. Wusstet ihr, dass Napoleon mit einem Zahn und Louis XIV. sogar mit zwei auf die Welt gekommen ist?«
»Claude, dass ich das nicht selbst bemerkt habe. Mein Gott, wer rechnet denn damit.« Alfons Reuter wusste nicht, ob er lachen oder weinen sollte.
Sarah hingegen schluchzte hemmungslos. Die ganze Anspannung fiel von ihr ab, und sie zitterte nun am ganzen Körper. Claude legte Alfons seine Tochter in den Arm. Er führte Sarah zu einem Sessel und drückte sie sanft hinein. Aus einem cremefarbenen Medizinschrank holte er ein Fläschchen, ließ ein paar Tropfen auf einen Löffel fallen und schob in ihr einfach in den Mund.
»Das wird dir guttun, du brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen. Mit der Kleinen kommt alles wieder in Ordnung«, brummte er beruhigend.
»Ich habe uns den Eintopf von heute Mittag heiß gemacht. Wenn es nicht reicht, Brot und Käse sind auch noch da.« Rose war aus der Küche aufgetaucht, hinter ihr stand der Junge, der die kleine Gesellschaft misstrauisch beäugte.
Die Haushälterin hatte im Esszimmer gedeckt, und trotz des Drangs weiterzukommen, das Ziel in Sète zu erreichen, ließen sich Alfons und Sarah dankbar nieder, um die kräftige Gemüsesuppe zu löffeln. Auf Wein verzichteten sie, Claude dagegen langte kräftig zu. Der Junge hatte sich ebenfalls zu ihnen an den Tisch gesetzt, aber noch keinen Bissen angerührt. Unverhohlen starrte er Alfons feindselig an.
»Junge, was ist mit dir, du bist unhöflich. Wenn du keinen Hunger hast, dann ab ins Bett mit dir, es ist spät.« Roses strenge Stimme ließ keinen Widerspruch zu.
Der Junge zerkrümelte unentschlossen ein Stück Weißbrot, stand dann auf und nickte, immer noch ohne ein Wort zu sagen, den am Tisch Sitzenden zu. Statt in sein Zimmer zu gehen, trollte er sich in die Küche. Irgendetwas stimmte mit diesen Leuten doch nicht. Als Rose hereinkam, um die Teller in die Steinspüle zu stellen, fragte er neugierig: »Sag mal Rose, was ist mit den Leuten los? Und der Mann, er hat einen merkwürdigen Akzent. Ist er etwa Deutscher?«
Rose setzte eine geheimnisvolle Miene auf. »Psst, das geht dich alles nichts an. Es sind Freunde des Doktors, und mehr brauchst du nicht zu wissen.«
»Aber der Mann ist Deutscher, ich bin mir sicher. Was hat ein ›Boche‹ in seinem Haus, an seinem Tisch zu suchen?«
»Jetzt reicht’s aber. Auch wenn er Deutscher ist, er ist der Freund des Doktors und braucht Hilfe. Basta. Und jetzt ab mit dir, bevor Docteur Barbier solche Sprüche noch zu Ohren kommen. Ein ›Boche‹, ich fasse es nicht. Alfons ist ein guter Mann. Tss, tss, ein ›Boche‹ …«
Sie verließ die Küche mit einer luftgetrockneten Salami und einem halben Laib Brot, beides in ein Geschirrtuch gewickelt. Für Alfons und Sarah kam die Zeit, sich zu verabschieden. Das Baby schlief nun fest und ruhig. Alfons standen die Tränen in den Augen. Er umarmte Rose.
»Soll ich euch nicht noch etwas Veilchenwurzel aus dem Garten holen. Die Wurzeln lindern die Schmerzen beim Zahnen, lasst Anne einfach ein wenig darauf herumbeißen.«
»Rose, hab Dank, aber wir müssen los. Wir haben das Pulver von Claude, es wird genügen.«
Sarah hielt bereits Anne auf dem Arm. Auch ihr liefen die Tränen übers Gesicht.
»Wir sind euch so dankbar. Wir versuchen, uns zu melden, sobald wir angekommen sind. Wir wissen nicht, wann dies sein wird oder ob wir überhaupt unser Ziel erreichen. Aber die Gewissheit, so treue Freunde zu haben, wird uns Kraft geben.«
Alfons legte das schlafende Baby auf den Rücksitz, dann stiegen er und Sarah in den Wagen, winkten noch einmal kurz und fuhren los. Langsam verloren sich die beiden Gestalten, die zurückgeblieben waren, in der schwindenden Nacht. Gegen acht Uhr würde die Sonne aufgehen, doch dann hätten sie den Hafen von Sète erreicht. Kaum fünf Minuten später war auch Sarah eingeschlafen. Alfons schüttelte die auch ihn überfallende Müdigkeit ab, durch das Seitenfenster, das er ein Stück heruntergelassen hatte, drang erfrischende kühle Luft ins Wageninnere. An dieser Stelle musste er achtgeben. Die Strecke war hier leicht abschüssig, sehr kurvig und eng. Er bremste ab, doch das Auto verlangsamte nicht, im Gegenteil, es wurde immer schneller. Alfons trat wieder auf die Bremse.
Um Gottes Willen, was ist das?
Die Bremsen versagten erneut. Schon geriet der Wagen ins Schlingern, driftete auf die Gegenfahrbahn. Alfons konnte nur mühsam gegenlenken. Sollte das das Ende ihrer Flucht in die Freiheit sein, sollten an dieser Biegung mit den Platanen am Wegesrand ihre Träume enden? Noch einmal trat er vehement auf die Bremse. Jetzt brach der Wagen komplett aus, raste auf einen Baum zu. Alfons riss das Lenkrad herum, das Auto grub sich mit den Vorderreifen in einen Graben, der die Straße von einem Feld trennte, und kam zum Stehen. Anne war vom Rücksitz gefallen und brüllte aus Leibeskräften. Die Beifahrertür war aufgesprungen und Sarah mit voller Wucht aus dem Innenraum katapultiert worden. Alfons lag benommen mit dem Oberkörper über dem Lenkrad.
Oh Gott, das Baby, Sarah.
Alfons kroch aus dem Auto, beugte sich in den Fond des Wagens. Anne war so fest in dicke Decken gehüllt gewesen, dass sie offensichtlich nicht zu Schaden gekommen war. Wie ein Kokon lag sie hinter dem Fahrersitz. Alfons hob sie auf, sie atmete ruhig und tief, hatte nur geschrien, weil sie so erschrocken war. Er war unsäglich erleichtert. Er legte das Kind zurück, eilte zur Beifahrertür. Sarah lag zusammengekrümmt drei Meter entfernt, sie bewegte sich nicht, stieß leise wimmernde Laute aus.
»Sarah, Liebling, bleib ruhig liegen, ich bin bei dir.«
Alfons beugte sich über seine Frau. Ihr Gesicht war leichenblass, sie blutete aus einer Kopfwunde.
»Alfons, was ist mit Anne. Ich wollte zu ihr, aber ich spüre meine Beine nicht, sie sind nicht mehr da«, wisperte sie.
»Sarah, Anne geht es gut. Sie schläft, hörst du, unserem Baby geht es gut. Hab keine Angst, deine Füße sind noch da. Das ist nur der Schock.«
Doch Sarah hörte ihn nicht mehr, sie war bewusstlos geworden. In diesem Moment näherte sich ein Automobil aus der Richtung, aus der sie gekommen waren. Hoffentlich fährt der Wagen vorbei, betete Alfons. Doch das Auto hielt direkt an der Straße auf ihrer Höhe.
»Alfons, Sarah? Ich bin’s, Claude. Um Gottes willen, was ist passiert? Wartet, ich komme.« Im Licht des Schweinwerfers näherte sich Claude Barbier.
»Claude, was machst du hier? Wir hatten einen Unfall. Plötzlich haben die Bremsen versagt. Ich weiß nicht, was mit Sarah ist. Dem Kind und mir geht es gut, aber Sarah, sie hat kein Gefühl in den Füßen. Sie ist bewusstlos.« Alfons’ Stimme versagte.
»Rose hat mir keine Ruhe gelassen, ich wollte euch für Anne von der Veilchenwurzel bringen. Sie hat sie extra ausgegraben. Ich bin hinter euch her gerast, so schnell ich konnte. Aber, oh Gott, wer konnte denn so etwas ahnen. Wer rechnet denn damit, dass so etwas Schreckliches passiert.« Er schluchzte auf. Dann riss er sich zusammen. »Ihr müsst hier weg, so schnell wie möglich. Euer Wagen ist nicht mehr fahrtüchtig. Nehmt meinen.«
»Sarah muss in ein Krankenhaus, Claude, sie muss untersucht werden.«
»Weißt du, was dann passiert? Wenn jemand herausfindet, wer sie ist, dass sie eine Jüdin ist, verheiratet mit einem Deutschen. Und das werden sie, egal welches Krankenhaus du aufsuchst, irgendjemand wird dich erkennen. Wenn ihr abgeschoben werdet, ist das euer sicherer Tod. Ihr habt nur diese eine Chance. Nehmt meinen Wagen, ich bitte dich. Versucht, bis nach Sète durchzukommen. Wenn ihr in Tanger seid, seid ihr in Sicherheit, die Spanier schieben euch nicht ab. Bitte!«
Nach einem kurzen Moment des Zögerns, willigte Alfons ein. Dasselbe hatte er vor Stunden zu Sarah gesagt, es war ihre einzige Chance. Mithilfe von Claude legte er Sarah, die immer noch nicht zu sich gekommen war, auf den Rücksitz von Claudes Wagen, fixierte sie mit Riemen, die im Kofferraum lagen. Anne packte er in den Fußraum vor dem Beifahrersitz, gut gepolstert mit weiteren Decken. Ein letztes Mal umarmte er seinen Freund.
»Claude, ich wüsste nicht, was wir ohne dich getan hätten.«
Dann stieg Alfons Reuter ein und fuhr in den anbrechenden Morgen einem ungewissen Schicksal entgegen. Mit hängenden Schultern stand Claude Barbier am Straßenrand und blickte ihnen nach. Er hatte das Gefühl, als müsse ihm jeden Moment das Herz zerspringen.
Nîmes, Polyclinique du Grand Sud – Frühling
In den Tagen, nachdem man sie aus der Dunkelheit des künstlichen Komas befreit hatte, wachte Mathilde de Boncourt für immer länger werdende Phasen auf, ermuntert durch flüsternde Stimmen, die ihr zuraunten, alles werde gut, man sei glücklich, dass sie es geschafft habe. Sie konnte die Stimme ihres Großvaters Rémy erkennen, dessen beruhigender Bass sie schon als Kind in den Schlaf gewiegt hatte. Dann die klare und angenehme Stimme des Arztes und den kehligen Ton, der so charakteristisch für die Stimme Bouraadas war.
Nach einer Woche fühlte sich Mathilde so weit wiederhergestellt, dass sie darum bat, das Kopfteil ihres Bettes höher zu stellen. Auch ihr Appetit war zurückgekehrt. Nach den Tagen mit leichten Brühen, verlangte es sie nach festen Mahlzeiten, und das Hühnerfrikassee, das man ihr brachte, verschlang sie so gierig, dass ihr übel wurde. Noch behinderte ein weicher Schulterverband ihre Bewegungsfreiheit, aber endlich konnte sie sich genauer umschauen. Die Wände waren immer noch weiß, ein Fernseher auf einem Gestell, das an der Decke befestigt ist, war komplett zur Seite geschoben. Vor dem Fenster stand nun jedoch ein kleiner Tisch, auf dem mehrere Vasen mit Blumensträußen verteilt waren. Wie ihr die Krankenschwester erzählte, waren Dutzende von Blumengebinden geliefert worden, aber erst gestern hatte Docteur Villeneuf erlaubt, die schönsten und frischesten in ihr Zimmer zu bringen. In den Gärten und den Parks sei alles in voller Blüte, und diese Sträuße würden ihr den Frühling ins Zimmer bringen.
Bis jetzt hatte Mathilde noch nicht erfahren, was sich auf den Stufen zum Palais de Justice tatsächlich abgespielt hatte. Und immer, wenn sie ihre Erinnerung daran abrufen wollte, war es, als würde ein Vorhang fallen und ihrem Gedächtnis den Zugang zum Geschehenen verwehren. Wenigstens würde sie heute Nachmittag von Docteur Villeneuf etwas über die Art und Schwere ihrer Verletzungen und über ihren aktuellen Zustand erfahren.
Es klopfte, und Mathilde ertappte sich dabei, dass sie sich zum ersten Mal, seit sie hier bewusst in diesem Krankenhausbett lag, Gedanken um ihr Aussehen machte. Mit ausgebreiteten Armen und schräg geneigtem Kopf, als würde er sie gleich in die Arme schließen wollen, steuerte der Arzt auf sie zu.
»Ahh, meine Liebe. Es ist schön, Sie so wohlauf zu sehen. Wie Sie bemerkt haben, haben wir Ihre Schulter immer noch in Watte gepackt.« Er grinste. »Das war, Gott sei Dank, ein glatter Durchschuss, und fast alles ist wieder verheilt. Schlimmer war die Kugel, die Ihre Arteria femoralis durchschlagen hat, ihre Oberschenkelarterie«, ergänzte er, als er Mathildes fragenden Blick sah. Sie hatte den Begriff schon öfter gehört, konnte aber heute nichts damit anfangen. Hoffentlich hatte ihr Gedächtnis keinen Schaden genommen.
»Sie haben unglaubliches Glück gehabt, dass der Wachmann wusste, wie man das Bein abdrückt, um die Blutung zu mindern. Sonst wären Sie an Ort und Stelle innerhalb weniger Minuten verblutet. Hätte der Schütze Sie am Kopf getroffen, Sie wären wahrscheinlich sofort tot gewesen. Dieser dritte Schuss ging meines Wissens in einen der Pfeiler am Eingang des Gebäudes. Aber darüber wird Sie Commandant Bouraada aufklären. Haben Sie Fragen?«
Mathilde hatte tausend Fragen. »Wie lange muss ich noch im Krankenhaus bleiben?«
»Ich habe mir schon gedacht, dass das Ihre erste Frage sein wird. In zwei Tagen werden wir die Schiene, die Ihren Oberschenkel stabilisiert, entfernen, dann werden Sie bei uns mit Rehamaßnahmen beginnen. Wenn Sie so weit sind, dass Ihre Muskulatur wieder einigermaßen einsatzbereit ist, werden Sie entlassen, natürlich nur unter der Bedingung, dass Sie in den nächsten Wochen und Monaten Ihr Bein weiterhin trainieren, sich ansonsten aber schonen. Sie können sich dafür in ein Rehabilitationszentrum begeben, Sie können aber auch eine Praxis für Krankengymnastik aufsuchen, oder noch besser, jemand würde dafür zu Ihnen nach Haus kommen. Das Haus Ihres Großvaters bietet ja genügend Platz, Sie könnten für diese Zeit sogar eine feste private Kraft einstellen, die bei Ihnen wohnt und Ihnen so jederzeit zur Verfügung steht.«
»Das heißt, ich bin für diese Zeit krankgeschrieben, kann nicht zum Dienst?« Mathilde bemerkte, wie ungehalten ihre Stimme klang. Es tat ihr leid.
»Commandant Bouraada hat mich schon vor Ihnen gewarnt. Er wusste, dass dies Ihre zweite Frage sein wird. Nein, und ich sage nochmals Nein, Sie können nicht zum Dienst. Sie müssen auch mental zuerst einen gewissen Abstand gewinnen. Und bis Ihr Bein wieder richtig belastbar sein wird, da werden schon noch etliche Wochen ins Land gehen. Genießen Sie doch einfach diese unfreiwilligen Ferien, die Sie bei Ihrem Großvater verbringen können. Lesen Sie, schlafen Sie viel, entspannen Sie sich mit Musik, machen Sie bald kleine Spaziergänge, um Ihre Muskeln zu trainieren, und lassen Sie sich einfach verwöhnen.«
Mathilde de Boncourt war kein Mensch, der lange mit seinem Schicksal haderte. Sie musste das Beste aus der Situation machen. Und es gab Schlimmeres, als ein paar Wochen auf dem Weingut zu verbringen. Odile, die Haushälterin ihres Großvaters, würde sie mit Freuden verwöhnen, und wenn ihr doch der Sinn nach Arbeiten stand, nun, sie wusste schon, wie sie an ihre Akten kommen würde. Doch das brauchte sie dem guten Doktor nicht auf die Nase zu binden.
»So weit alles klar? Dann wären wir uns ja einig. Wir werden hier die Reha langsam angehen lassen. Am Anfang werden Sie noch starke Schmerzen empfinden, scheuen Sie sich nicht, um weitere Schmerzmittel zu bitten. Sie werden auch mit Kreislaufproblemen zu kämpfen haben. Aber auch dafür sind wir gerüstet, meine Liebe. Und je fleißiger Sie trainieren, desto eher werden Sie auch die ersten Erfolge verspüren. So, das war’s für heute. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, draußen sitzt Commandant Bouraada. Er möchte Sie besuchen. Übrigens, er saß fast täglich an Ihrem Bett. Ein treuer Mitarbeiter, den Sie da haben. Und keine beruflichen Gespräche mit ihm! Haben Sie mich verstanden. Keine Aufregung, die tut Ihnen nicht gut.«
Docteur Villeneuf tätschelte Mathilde die Hand, dann verabschiedete er sich. Kaum war der Arzt aus der Tür, als sich die schlanke Gestalt Rachid Bouraadas verlegen dem Bett näherte.
Ende der Leseprobe